Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Symbolverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Praktische Relevanz und Problemstellung
1.2 Zielsetzung der Arbeit
2 Definitorische Grundlagen
2.1 Gesundheit
2.1.1 Definition
2.1.2 Arbeitsfähigkeit - Gesundheit als Faktor der Gesunderhaltung
2.2 Betriebliches Gesundheitsmanagement und Betriebliche Gesundheitsförderung
2.3 Arbeits - und Gesundheitsschutz
3 Betriebliche Gesundheitsförderung im Krankenhaus
3.1 Instrumente der betrieblichen Gesundheitsförderung
3.1.1 Einführung von Gesundheitszirkeln
3.1.2 Mitarbeiterbefragung
3.1.3 Betrieblicher Gesundheitsbericht
3.1.4 Arbeitsunfähigkeitsanalyse
3.2 Das Krankenhaus als Arbeitsplatz
3.2.1 Arbeitsbedingungen und - belastungen der Pflegekräfte
3.2.2 Arbeiten im Nacht- und Schichtdienst
3.2.3 Berufskrankheiten und krankheitsbedingte Fehlzeiten
3.3 Darstellung der betrieblichen Gesundheitsförderung im deutschen Krankenhauswesen
3.3.1 Akteure der betrieblichen Gesundheitsförderung im Krankenhaus
3.3.2 Deutsches Netz Gesundheitsfördernder Krankenhäuser (DNGfK)
3.3.3 Die Krankenkassen
3.3.4 Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst - und Wohlfahrtspflege (BGW)
3.3.5 Initiative für neue Qualität der Arbeit (INQA)
3.3.6 Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA)
3.4 Darstellung der betrieblichen Gesundheitsförderung im österreichischen Krankenhauswesen
3.4.1 Akteure der betrieblichen Gesundheitsförderung im Krankenhaus
3.4.2 Österreichisches Netzwerk Gesundheitsfördernder Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen (ONGKG)
3.4.3 Fonds Gesundes Österreich (FGÖ)
3.4.4 Wiener Allianz für Gesundheitsförderung
4 Praxisprojekte zur Gesundheitsförderung im Krankenhaus
4.1 Projekt ‚Gemeinsam Gesünder‘ im Krankenhaus Barmherzige Brüder Eisenstadt
4.2 Projekt ‚Fit und Vital - unser Spital‘ im Bezirkskrankenhaus Schwaz
4.3 Das Gesundheitsprogramm Carus Vital des Universitätsklinikums Dresden
4.4 Projekt ‚Gezieltes Rückentraining für Mitarbeiter‘ im Städtischen Klinikum Solingen
5 Vergleichende Analyse und kritische Beurteilung
6 Fazit
Anhangsverzeichnis
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Zielsetzung der Arbeit
Abbildung 2: Einordnung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements
Abbildung 3: AU - Daten der DAK Gesundheit 2014
Abbildung 4: Gesundheitsförderungsmaßnahmen von Krankenhäusern in %
Abbildung 5: Zuwachs an Mitgliedern im ONGKG 1998 - 2007
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser eseprobe nicht enthalten
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1:Instrumente der betrieblichen Gesundheitsförderung
Tabelle 2: 18 Kernstrategien
Tabelle 3:Geförderte Projekte des FGÖ
Symbolverzeichnis
Abbildung in dieser eseprobe nicht enthalten
1 Einleitung
1.1 Praktische Relevanz und Problemstellung
Das Setting Krankenhaus und das dort tätige Pflegepersonal ist heutzutage verschiedenen Herausforderungen ausgesetzt.1 Diese sind auf unterschiedliche Einflussfaktoren zurückzuführen, wie etwa auf die Folgen des demographischen Wandels, auf den Fachkräftemangel im Bereich der Pflege oder steigenden Kostendruck. So steht der demographische Wandel für einen deutlichen Anstieg des Altersdurchschnitts in der Bevölkerung.2 Diese Altersverteilung führt zu einem steigenden Bedarf an pflegerischer Versorgung, woraus Folgen für die Arbeitswelt resultieren.3
In Gesundheitseinrichtungen wie dem Krankenhaus ist Gesundheit Gegenstand der Arbeit.4 Dementsprechend setzt sich der größte Anteil von Mitarbeitern aus der Gruppe der Gesundheits- und Krankenpfleger zusammen, welche die Versorgung hilfsbedürftiger und kranker Patienten zur Aufgabe hat. Der Beruf der Pflegekraft ist durch hohe Anforderungen in physischer, psychischer und sozialer Hinsicht geprägt.5 Ein hohes Verantwortungsgefühl, körperliche Ausdauer und Geschicklichkeit sind heutzutage unabdingbar um den Beruf adäquat ausüben zu können. Der Umgang mit Ausnahmesituationen, bedingt durch den direkten Kontakt zu sterbenden und schwerstkranken Patienten muss zusätzlich bewältigt werden.6 Psychische Belastungen ergeben sich zudem aus Personalmangel, welcher durch Einsparungen des Krankenhauses entsteht, aus einer hohen Fluktuation in der Pflege sowie Schicht- und Nachtdiensten.7 Hinzu kommen körperliche Belastungen, wie das täglich schwere Heben, Tragen und Umlagern von Patienten.8 Hierbei sind vor allem die arbeitsbedingten Muskel - Skelett - Erkrankungen hervorzuheben, welche die Gruppe mit den häufigsten Krankheitsarten und mit den meisten Arbeitsunfähigkeitstagen im Bereich der Pflege darstellen.9 Erkrankungen, welche durch Belastungen des Muskel - Skelett - Systems verursacht werden, führen häufig zu Fehlzeiten und belasten das restliche Team durch Mehrarbeit.10 Das Risiko eines frühzeitigen Berufssaustiegs aufgrund von Berufskrankheiten ist hoch und im Pflegeberuf weit verbreitet.11 Neben den Folgen des demographischen Wandels stellen eine Steigerung chronischer Erkrankungen wie beispielsweise Herz - Kreislauf - Erkrankungen, Krebserkrankungen oder Diabetes mellitus, die Zunahme von Multimorbidität und andauernde Pflegebedürftigkeit weitere Herausforderungen für das Berufsbild der Pflege dar.12 Es wird somit deutlich, dass die Pflege von kranken und alten Menschen im Krankenhausbereich einen wachsenden Bereich ausmacht.13 Aus genannten Gründen werden Gesundheitsleistungen heute und besonders in naher Zukunft stark nachgefragt sein. Die psychische und physische Gesundheit von Pflegekräften gilt als eine wichtige Ressource von Krankenhäusern.14 Denn die Pflegekräfte sind ein wesentlicher Faktor dafür, die Wettbewerbsfähigkeit und die Existenzsicherung des Krankenhauses zu gewährleisten.15
Infolgedessen sind entsprechende Maßnahmen und Konzepte notwendig, um die Gesundheit der Pflegekräfte zu fördern und somit den Erhalt der Arbeitsfähigkeit von Pflegekräften sicherzustellen. Dabei geht es vor allem darum die Leistungsfähigkeit in psychischer sowie physischer Hinsicht dauerhaft zu erhalten, diese zu unterstützen und gegebenenfalls wiederherzustellen.16 Die Implementierung Betrieblicher Gesundheitsförderung und der Einsatz gezielter Maßnahmen zur Förderung und Erhaltung der Gesundheit können der genannten Problematik entgegenwirken.17 Hierfür wird zunächst eine Analyse zur Erfassung des IST-Zustandes im Betrieb benötigt. Anschließend können Interventionen geplant und durchgeführt werden.18 Für die Etablierung Betrieblicher Gesundheitsförderung sind finanzielle, personelle und organisatorische Ressourcen notwendig. Im besten Fall geschieht diese Verankerung mit Unterstützung von Akteuren. Die Maßnahmen setzen dort an, wo Schwierigkeiten bestehen und führen eine Lösung bzw. Verbesserung der Lage herbei.19
Anhand einer Studie des Deutschen Krankenhausinstituts aus dem Jahr 2013 wird allerdings deutlich, dass Erfolge, Nachhaltigkeit und Wirksamkeit von BGM - Maßnahmen im deutschen Krankenhauswesen nicht flächendeckend realisiert werden.20 Daran lässt sich die Frage anschließen, ob es sich hier um ein rein deutsches Problem handelt und wie Betriebliche Gesundheitsförderungsmaßnahmen in anderen Ländern betrieben und dort etabliert werden. Es empfiehlt sich also ein Vergleich. Aufgrund des zu beachtenden Umfangs der vorliegenden Arbeit ist jedoch der Vergleich auf ein weiteres Land zu beschränken. Hierfür bietet sich als direktes Nachbarland Österreich an. Bei dem Vergleich der beiden Länder stellt sich die Frage, inwiefern Unterschiede in der Umsetzung der Betrieblichen Gesundheitsförderung von Krankenhäusern in den beiden Länder bestehen?
1.2 Zielsetzung der Arbeit
Die genannte Fragestellung soll letztlich anhand der Darstellung der verschiedenen Akteure und Maßnahmen in beiden Ländern sowie dem Vergleich zweier BGF-Projekte pro Land beantwortet werden. Dabei soll im Rahmen der Arbeit die These geprüft werden, dass Gesundheitsförderungsprojekte in Österreich nachhaltiger, wirksamer und innerhalb einer besseren organisatorischen Struktur durchgeführt werden und verankert sind als im deutschen Krankenhauswesen. Zu diesem Zweck wird folgendermaßen vorgegangen:
Die Arbeit konzentriert sich auf die Akteure im Bereich der Betrieblichen Gesundheitsförderung sowie auf die bestehenden Aktivitäten im Krankenhauswesen (Unterziel). Die Analyse ausgewählter Gesundheitsförderungsprojekte pro Land soll dabei einen Einblick in die Vorgehensweise des österreichischen und deutschen Krankenhauswesens geben. Dabei konzentrieren sich die ausgewählten Projekte aus beiden Ländern auf die eigenen Mitarbeiter. Primär wenden sie sich hier an die Berufsgruppe des Pflegepersonals, welche speziellen Arbeitsbedingungen und - belastungen ausgesetzt ist. Dementsprechend sollen deren Arbeitsbedingungen und - belastungen im Krankenhauswesen aufgezeigt werden (Unterziel). Zum Abschluss erfolgt in einem Fazit ein Überblick über die wesentlichen Erkenntnisse.
Abbildung in dieser eseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Zielsetzung der Arbeit (Quelle: eigene Darstellung)
2 Definitorische Grundlagen
2.1 Gesundheit
2.1.1 Definition
Der Begriff Gesundheit ist sehr komplex und besitzt eine Vielzahl von Definitionen und wissenschaftlichen Theorien.21 Prinzipiell kann man davon sprechen, dass die Feststellung von Gesundheit oder Krankheit immer stark von der subjektiven Wahrnehmung beeinflusst wird.22 In der Bevölkerung wird Gesundheit oftmals lediglich mit dem Ausfall von körperlicher Gesundheit verbunden.23 Die Auffassung Gesundheit als Abwesenheit von Krankheit zu betrachten, konnte jedoch in den letzten Jahren durch Entwicklung und Forschung im Gesundheitswesen erweitert werden24. Eine der bekanntesten Definitionen des Begriffes ‚Gesundheit‘ findet sich in der Beschreibung der WHO wieder. Bereits 1948 definierte die Organisation den Begriff Äals ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen“25. Demnach wird Gesundheit als eine lebenslange und permanent herzustellende Ausgeglichenheit und nicht als ein einmal erreichter, widerstandsfähiger Zustand dargestellt.26 Diese Definition dient heutzutage als Grundlage von Gesundheitsprogrammen und hat in den Wissenschaften des Gesundheitswesens für vielerlei Anregung gesorgt.27
Durch die WHO wurde 1986 auch die erste internationale Konferenz zur Gesundheitsförderung abgehalten, bei welcher Grundsätze und Ziele zur Förderung der Gesundheit verabschiedet wurden. Die ‚Ottawa Charta‘ wurde vor allem als Antwort auf eine neue Sichtweise von Gesundheit in der Welt gesehen. Laut WHO ist Gesundheit als ein Teil des täglichen Lebens zu verstehen, weniger als ein Lebensziel. Es geht im Kern darum das Wohlbefinden eines Menschen auf allen Ebenen zu erreichen, indem die eigenen Bedürfnisse befriedigt und Träume verwirklicht sowie die umgebende Außenwelt verändert werden sollte.28 Die Voraussetzungen für Gesundheit werden unter anderem als Bestandteil der Ottawa Charta beschrieben: ÄGrundlegende Bedingungen und konstituierende Momente von Gesundheit sind Frieden, angemessene Wohnbedingungen, Bildung, Ernährung, Einkommen, ein stabiles Öko-System, eine sorgfältige Verwendung vorhandener Naturressourcen, soziale Gerechtigkeit und Chancengleichheit. Jede Voraussetzung des Gesundheitszustandes ist zwangsläufig fest an diese Grundvoraussetzungen gebunden.“29
In der Ottawa-Charta wird weiter aufgeführt, dass Faktoren politischer, sozialer, ökonomischer und kultureller Herkunft die Gesundheit aufrechterhalten aber auch schädigen können. So heißt es auch, dass der Gesundheitszustand für die persönliche und soziale Entwicklung eine ausschlaggebende Bedingung darstellt und entscheidend für die eigene Lebensqualität ist.30 Eine weitere Definition von Gesundheit ergibt sich aus der Beschreibung von Badura und Hehlmann. Hier wird Gesundheit gleichzeitig als Grundlage und als Resultat der Wechselwirkung zwischen Personen, Verhalten und der Außenwelt bezeichnet: ÄGesundheit ist eine Fähigkeit zur Problemlösung und Gefühlsregulierung, durch die ein positives seelisches und körperliches Befinden insbesondere ein positives Selbstwertgefühl - und ein unterstützendes Netzwerk sozialer Beziehungen erhalten oder wieder hergestellt wird.“31
Im Rahmen dieser Beschreibung geht es darum vorhandene Potentiale in der betroffenen Person, in ihrem Verhalten und in ihrer Außenwelt zu verstehen und zugänglich zu machen. Die Erhaltung der Gesundheit und Vermeidung von Krankheit kann nach Ansicht von Badura und Hehlmann nur durch eine Stabilisierung der eigenen Ressourcen realisiert werden. Diese genannte Auffassung beschreibt Gesundheit als eine Kompetenz zur Bewältigung des Lebens. Ein ähnliches Verständnis für den Begriff ‚Gesundheit‘ entwickelte 1979 der Professor für Soziologie Anton Antonovsky.32 Antonovsky konzentrierte sich auf den sogenannten salutogenetischen Ansatz mit der Fragestellung, was den Menschen gesund hält. Antonovsky beschäftigte sich in diesem Zusammenhang mit der Gesundheitsstärkung - mit den Bedingungen, die zur Gesunderhaltung beitragen.33 Das Salutogenese-Modell nach Antonovsky hat das Ziel Potentiale und Ressourcen sowie Lebensbedingungen herauszustellen, welche die Chance steigern, gesund zu bleiben und die Gesundheit zu stärken. Das salutogenetische Verständnis versteht Gesundheit als einen lebenslangen Prozess der Begegnung zwischen Faktoren, die Gesundheit fördern, anderseits aber auch gefährden. Zu den Faktoren der Widerstandskraft zählen sozioemotionale Bedingungen wie Selbstsicherheit, Halt im Familien - und Freundeskreis, ein gutes Klima im Betrieb, aber auch geistige Fähigkeiten wie Veränderung - und Wachstumsfähigkeit.34
Nach Antonovsky bewegt sich der Mensch im Laufe eines Lebens zwischen den Polen Gesundheit und Krankheit und wählt dabei eine der beiden Richtungen35. Entscheidend für den Weg, den der Einzelne einschlägt, ist das so genannte ‘Kohärenzgefühl‘. Dieses setzt sich aus drei Aspekten zusammen:36
- Gefühl der Verstehbarkeit: Die Strukturen im Leben verstehen Gefühl der Sinnhaftigkeit: Den Sinn im Leben sehen
- Gefühl der Handhabbarkeit: Aufgaben lassen sich aus eigener Kraft meistern37
Das Kohärenzgefühl gibt die Fähigkeit eines Menschen an, mit inneren und äußeren Reizen, welche durch Stress verursacht werden, zurechtzukommen.38
2.1.2 Arbeitsfähigkeit - Gesundheit als Faktor der Gesunderhaltung
Gesundheit ist als ein Entwicklungsprozess zu betrachten, der verschiedenen Voraussetzungen unterliegt. Eigenverantwortlichkeit und die Entfaltung der eigenen Persönlichkeit sind hierbei gleichermaßen von Bedeutung wie Beeinträchtigungen durch die Arbeit oder durch das private Leben.39 In der heutigen Zeit der Globalisierung nimmt diese großen Einfluss auf die Arbeitsbedingungen und Rahmenbedingungen eines jeden Beschäftigten. Innovationen und allgemeine Veränderungen in der Arbeitswelt sorgen für einen Wandel, der sich in der Arbeitswelt deutlich bemerkbar macht. Diese Veränderungen nehmen Einfluss auf Arbeitsprozesse und - vorgänge sowie auf die Arbeitsorganisation. Vor diesem Hintergrund ist die eigene Arbeitsfähigkeit und deren Aufrechterhaltung ein wertvolles Gut und stellt einen kostbaren Erfolgsfaktor für das Unternehmen dar. Das Resultat einer gesundheitlich guten Verfassung sichert den Einsatz und stärkt die Leistungsfähigkeit im Unternehmen. Zudem wird die Resistenz gegen Stress gestärkt sowie eine Verbundenheit mit dem Unternehmen aufgebaut. Fehlzeiten können gemindert werden und somit auch finanzielle Einbußen.40 Die Arbeitsfähigkeit oder auch Arbeitsbewältigungsfähigkeit genannt, stellt ein wichtiges Potential eines jeden Beschäftigen dar. Diese setzt sich aus zwei Bestandteilen zusammen.
Das erste Segment sind die individuellen Ressourcen wie die sozialen, geistigen und physischen Anlagen eines Menschen. Das zweite Segment wird durch die Anforderungen und Bedingungen der Arbeitsstelle bestimmt.41
2.2 Betriebliches Gesundheitsmanagement und Betriebliche Gesundheitsförderung
Die Begriffe Betriebliches Gesundheitsmanagement und Betriebliche Gesundheitsförderung werden oftmals synonym verwandt.42 Aber dennoch ist es notwendig für jeden Begriff eine eigene Definition anzuwenden, da Betriebliche Gesundheitsförderung lediglich einen Bestandteil des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) darstellt. Unter dem Begriff ‚Betriebliches Gesundheitsmanagement‘ werden verschiedene Maßnahmen zur Förderung und zum Erhalt der Gesundheit von Angestellten verstanden. BGM hat die Vorbeugung von Krankheiten, die Stärkung von Gesundheitspotentialen und eine Verbesserung der Mitarbeiterzufriedenheit als Ziel. Sie ist auf gesunde sowie auf chronisch kranke Beschäftige ausgerichtet.43 Nach Wegner wird BGM folgendermaßen definiert:
ÄBetriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) ist die systematische und zielorientierte Steuerung aller Unternehmensprozesse, mit dem Ziel, Gesundheit, Leistung und Erfolg für das Unternehmen und alle seine Beschäftigten zu erhalten und zu fördern.“44
Die Beweggründe zur Etablierung eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements sind vielfältig. Ausgangspunkt ist beispielsweise eine hohe Rate an Fällen von Berufskrankheiten oder die Entstehung von Kosten arbeitsbedingter Erkrankungen und Unfälle.45 Heutzutage wird BGM in sehr unterschiedlichen Kontexten verwendet und unter verschiedenen Vorstellungen der jeweiligen Dienstleister umgesetzt. Ein Großteil der Dienstleister des Gesundheitswesens bietet Maßnahmen und Projekte unter der Begrifflichkeit des Betrieblichen Gesundheitsmanagements an, jedoch sind diese nicht immer mit einer fundierten Grundlage ausgestattet, sei es wissenschaftlich, finanziell oder personell.46
Laut des Bundesministeriums für Gesundheit fällt die ‚Betriebliche Gesundheitsförderung‘ als ein zentraler Bestandteil unter den Begriff des ‚Betrieblichen Gesundheitsmanagements‘. Weitere Bereiche wie der Arbeits - und Gesundheitsschutz, das Betriebliche Eingliederungsmanagement, die Betriebliche Suchtprävention sowie das Beratungs - und Unterstützungssystem umfassen das BGM (Abbildung 2).47
Abbildung in dieser eseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: Einordnung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements Quelle: In Anlehnung an Wienemann, E. (2012), S. 176)
Vor der Einführung eines BGM ist die Betrachtung des eigenen Betriebs in seiner Gesamtheit notwendig.48 BGM knüpft auf verschiedenen Ebenen - genauer Handlungsfelder - wie beispielweise der Unternehmenskultur, der Führung des Unternehmens oder dem Betriebsklima an. BGM sieht die Arbeitsorganisation, den Arbeitsplatz, die Arbeitsumgebung sowie die Arbeitsmittel und - stoffe als zentrale Handlungsfelder, die es zu gestalten gilt. Aber auch die Handlungskompetenz, der Gesundheitszustand, das Gesundheitsverhalten sind weitere Bereiche an welchen BGM ansetzt.49
Die Einführung eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements verfolgt eine Vielzahl von Zielen. Das oberste Ziel des BGM ist grundsätzlich ein gesundes Unternehmen zu schaffen, welches sich durch eine gesunde Arbeitsweise und gesunde Mitarbeiter kennzeichnet.50 Bei der Umsetzung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements ist dabei eine Unterscheidung zwischen operativen und strategischen Zielen von Bedeutung. Unter strategischen Zielen werden langfristige Ziele wie die Intensivierung von Mitarbeiterorientierung verstanden. Die operativen Ziele hingegen schließen kurzfristige Vorhaben und Ereignisse mit ein, wie beispielsweise die Abwicklung einzelner Prozesse im Rahmen von Projekten.51 Aufbauend auf diesen Zielen lassen sich nach Münch et al. vier weitere Teilziele fassen.52 Das erste Teilziel ist der Aufbau und die langfristige Festigung des Managementsystems. Voraussetzungen für eine dauerhafte Verankerung im Betrieb sind strukturelle und planerische Bedingungen, die Abwicklung von Kernprozessen wie Maßnahmenplanung, Intervention, Diagnose und die Etablierung der verschiedenen Strukturen und Abläufe in die Routine des Betriebes.53 Letztlich erfolgt die Bewertung bzw. Beurteilung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements. Eine entscheidende Rolle für die erfolgreiche Umsetzung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements ist das Engagement Veränderungen im Unternehmen herbeizuführen und deren Bereitschaft der Führungsebene. Nur durch eine Unterstützung finanzieller, zeitlicher und personeller Ressourcen sowie der Einbindung verbindlicher Rahmenregelungen kann BGM produktiv umgesetzt werden. Ein weiteres Ziel ist die Stärkung und Förderung des persönlichen Sozial - und Humankapitals. Das Humankapital wird als Oberbegriff von Wissen, der Berufserfahrung und der Kompetenz von Mitarbeitern verstanden. Das Vorhandensein von Sozialkapital lässt sich als Ressource beschreiben, die mit einem langfristigen Gebilde von Beziehungen einhergeht.54 Durch die Stärkung der genannten Komponenten wird die Bewältigung von Stresssituationen und anderen Belastungsfaktoren unterstützt und ist somit entscheidend für eine psychische Gesundheit und Wohlbefinden. Eine mitarbeiterorientierte Führung sowie eine gesundheitsfördernde Arbeitsgestaltung können so zur Stärkung von Sozialkapital beitragen.55 Weiteres Ziel des BGM ist die Steigerung von Produktivität, Qualität und Wirtschaftlichkeit im Betrieb. Die Einführung von BGM wird ebenso den finanziellen Interessen gerecht. Die Reduzierung von Fehlzeiten und die Erhöhung der Leistungsfähigkeit von Mitarbeitern können langfristig zur Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit und Existenzsicherung des Betriebes führen.56 Die Verbesserung von Gesundheit und Wohlbefinden der Mitarbeiter ist das vierte und wichtigste Teilziel von BGM.57 In Anbetracht des demographischen Wandels kommt diesem Ziel ein hoher Stellenwert zu. Das Vorliegen von physischem und seelischem Wohlbefinden beeinflusst die Fähigkeit und Bereitschaft Leistung im Betrieb zu erbringen. Im Vordergrund steht das Bestreben die Gesundheit der Mitarbeiter zu erhalten. Dieses Ziel bildet ein Interesse beider Seiten - die der Mitarbeiter, aber auch die der Unternehmen, um dauerhaft auf dem Markt bestehen zu bleiben.58 Bezogen auf das letzte genannte und vordergründige Ziel des BGM zeigt sich eine eindeutige ‚win - win - Situation‘, da beide Interessen angemessen beachtet werden.59
Im Weiteren wird der Begriff der ‚Betrieblichen Gesundheitsförderung‘ als ein Bestandteil des Betrieblichen Gesundheitsmanagements näher erläutert. Wie im ersten Kapitel bereits beschrieben, wurde der Begriff sowie die Grundsätze und Ziele der Gesundheitsförderung 1986 auf der internationalen Konferenz ‚Ottawa - Charta‘ der WHO formuliert. Dort lautet die Definition von Gesundheitsförderung:60
ÄGesundheitsförderung zielt auf einen Prozess, allen Menschen ein höheres Maß an Selbstbestimmung über ihre Gesundheit zu ermöglichen und sie damit zur Stärkung ihrer Gesundheit zu befähigen. Um ein umfassendes, seelisches und soziales Wohlbefinden zu erlangen, ist es notwendig, dass sowohl einzelne als auch Gruppen ihre Bedürfnisse befriedigen, ihre Wünsche und Hoffnungen wahrzunehmen und verwirklichen sowie ihre Umwelt meistern bzw. verändern können. In diesem Sinne ist die Gesundheit als ein wesentlicher Bestandteil des alltäglichen Lebens zu verstehen und nicht als vorrangiges Lebensziel. Gesundheit steht für ein positives Konzept, das in gleicher Weise die Bedeutung sozialer und individueller Ressourcen für die Gesundheit betont wie die körperlichen Fähigkeiten. Die Verantwortung für die Gesundheitsförderung liegt deshalb nicht nur bei dem Gesundheitssektor sondern bei allen Politikbereichen und zielt über die Entwicklung gesünderer Lebensweisen hinaus auf die Förderung von umfassendem Wohlbefinden hin.“61
Demnach sieht die WHO ‚Gesundheitsförderung‘ als ein Konzept zur Stärkung und Festigung der Gesundheitsressourcen- und potenziale des Menschen. Gesellschaftliche Organisationen sollen dazu bewegt werden, gesundheitsfördernde Arbeits - und Lebensbedingungen zu entwickeln und auszuführen. Gesundheitsförderung setzt als komplexer Ansatz auf Mitarbeiterebene und Unternehmensebene an und zielt auf die jeweilige Erweiterung der Gesundheitskompetenzen.62 Maßnahmen der Gesundheitsförderung beziehen sich in diesem Zusammenhang zum einen auf die eigenen vorhandenen Ressourcen wie der Kompetenz mit Schwierigkeiten und Belastungen im täglichen Leben fertigzuwerden. Zum anderen beziehen sich die Maßnahmen auf Ressourcen, die von außen Einfluss nehmen wie die Arbeitsgestaltung, Führung der Mitarbeiter und Organisationsentwicklung.63 Demzufolge gibt es ein großes Feld von gesundheitsfördernden Maßnahmen, die auf eine Umgestaltung von Arbeitsbedingungen, organisatorischen Bedingungen sowie Verhaltensmöglichkeiten von Mitarbeitern abgestimmt sind.64 Nach Nieder und Michalk lassen sich verschiedene Maßnahmen in die Bereiche Verhaltensprävention und Verhältnisprävention einteilen.65 Die Verhaltensprävention zielt auf Gewohnheiten, Einstellungen und Handlungsweisen ab. Maßnahmen für diesen Bereich setzen am Gesundheitsverhalten, wie beispielsweise Bewegungstraining, Rückenschule, Suchtberatung oder Ernährungsberatung, an. Dagegen bezieht sich die Verhältnisprävention auf die Beseitigung negativer Einflüsse auf die Gesundheit ab. Sie fokussiert sich auf die Umwelt und bildet beispielsweise Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitssituation.66
Die Betriebliche Gesundheitsförderung umfasst eine Reihe verschiedener Instrumente um eine Datenerhebung zur Analyse des IST - Zustandes im Betrieb vorzunehmen.67 Nur durch eine Analyse können Hinweise auf Arbeitsabläufe, welche gesundheitlich beeinträchtigend oder sogar gesundheitsgefährdend sind, gefunden werden.68 Der IST - Zustand wird somit idealerweise vor Planung der Maßnahmen erhoben um herauszufinden, welche Maßnahmen bislang im Betrieb durchgeführt wurden und was zukünftig erreicht werden sollte. Anschließend können entsprechende Maßnahmen zur Gesundheitsförderung im Betrieb eingeleitet werden. Betriebliche Gesundheitsförderung orientiert sich an der Methode des Projektmanagements.69 Während der Abwicklung eines Projekts werden verschiedene Instrumente eingesetzt. Als typische Mittel zur Analyse des IST-Zustandes werden beispielsweise Befragungen von Mitarbeitern, Krankenstandauswertungen oder Gesundheitszirkel durchgeführt.70 Eine Beschreibung von Instrumenten zur Erlangung einer IST-Situation im Unternehmen werden in Kapitel 3.1 erläutert.
Der Einsatz des BGM versucht die Anforderungen und Beanspruchungen am Arbeitsplatz der Mitarbeiter und ihrer Umwelt zu betrachten und dort anzusetzen. Durch die Steuerung und Einbettung betrieblicher Prozesse versteht sich BGM als eine Führungsaufgabe, die eine Einbeziehung der Mitarbeiter erfordert.71 Besonders die Kultur und das Leitbild des Betriebes sollten bei der Einführung betriebsinterner Prozesse und Strukturen des BGM berücksichtigt werden. Die Durchführung und die tatsächliche Entfaltung eines BGM hängen im Einzelfall von verschiedenen Faktoren wie der Anzahl der Beschäftigten, der wirtschaftlichen Situation oder der Unternehmenskultur ab und entscheiden somit über das Ausmaß.72
2.3 Arbeits- und Gesundheitsschutz
Die rechtliche Grundlage des Arbeitsschutzes in Organisationen stellt das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) vom 21. August 1996 dar.73 Die EG-Rahmenrichtlinie ‚Arbeitsschutz‘ von 1989 bildet dabei das Fundament des deutschen Arbeitsschutzgesetzes. Die EG-Rahmenrichtlinie dient dazu, den Gesundheitsschutz und die Sicherheit von Angestellten durch geeignete Maßnahmen des Arbeitsschutzes zu fördern und zu sichern.74 Jeder Arbeitgeber ist für eine Einbindung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes in die betrieblichen Abläufe verantwortlich.75 Bei der Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes haben Unternehmen acht allgemeine Grundsätze durchzusetzen (siehe § 4 ArbSchG):
Nach § 4 ArbSchG Abs. 1 sollte es oberste Norm sein, dass die Arbeit keine Gefährdung für die psychische oder physische Gesundheit der Beschäftigten darstellt.
Darüber hinaus gilt es Gesundheitsgefahren an ihrem Ursprung zu bekämpfen (siehe § 4 ArbSchG Abs. 2). Die Maßnahmen im Arbeitsbereich sollten die Bereiche Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene berücksichtigen (siehe § 4, Nr. 3, ArbSchG). Bezüglich der Planung von Maßnahmen sollte zudem darauf geachtet werden, dass der Zustand von Technik, Arbeitsorganisation, Arbeitsbedingungen, sozialen Bindungen und Einfluss der Außenwelt in Bezug auf die Arbeitsstelle sachgerecht miteingebunden wird (siehe § 4, Nr. 4, ArbSchG). Allgemein vorgegebene Schutzmaßnahmen sind individuell übergeordnet. Zusätzlich ist es notwendig, dass der Arbeitgeber spezielle Gefahren identifiziert, die für besonders schutzbedürftige Beschäftigtengruppen existieren (siehe § 4, Nr. 6, ArbSchG). Aus diesem Grund ist es notwendig, den Beschäftigten präzise Anweisungen zu geben wie in bestimmten Situationen zu verfahren ist (siehe § 4, Nr. 7, ArbSchG). Darüber hinaus ist es vonnöten, dass die Arbeitsanweisungen und Regelungen des Arbeitsgebers allgemein geschlechtsneutral formuliert sind. Eine geschlechtsspezifische Unterscheidung, ob mittelbar oder unmittelbar, ist nur zulässig, wenn dies aus biologischen Gründen erforderlich ist (siehe § 4, Nr.8, ArbSchG).
Der zentrale Gedanke des Gesetzes ist es, Unternehmen gegenüber den Bereichen Sicherheit und Gesundheit ihrer Beschäftigten sensibel zu machen und Verantwortung zu verlagern.76 Die Grundpflichten des Arbeitgebers bestehen darin, Maßnahmen des Arbeitsschutzes für seine Mitarbeiter zu treffen, welche Einfluss auf Sicherheit und Gesundheit nehmen. Diese Maßnahmen gilt es auf Wirksamkeit zu überprüfen und ggf. abzuändern (siehe § 3, Abs. 1, ArbSchG). Zudem hat der Arbeitgeber dafür Sorge zu tragen, von den Mitarbeitern benötigte Mittel zu diesem Zweck zur Verfügung zu stellen und sich um eine geeignete Struktur zu sorgen. Der Arbeitgeber hat die Aufgabe, dass entsprechende Maßnahmen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes in die Strukturen der Führung sowie in die täglichen Abläufe eingebunden werden (siehe § 3, Abs. 2, Nr. 1, Nr. 2, ArbSchG). Gleichzeitig ist das Unternehmen für die entstandenen finanziellen Aufwendungen verantwortlich (siehe § 3, Abs. 3, ArbSchG).
Die Verantwortung der eigenen Mitarbeiter hinsichtlich des Arbeits- und Gesundheitsschutzes obliegt jedem Arbeitgeber.77 Nach dem Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) ist der Arbeitgeber verpflichtet Betriebsärzte, Fachkräfte für Arbeitssicherheit oder Sicherheitsingenieure für die Ermittlung und Beurteilung von Gefährdungen und möglichen Ursachen einzubestellen (siehe § 1, ASiG). Die Aufgabe dieser Fachkräfte liegt in der Unterstützung der Unfallverhütung und der Umsetzung entsprechender Maßnahmen. Dabei stellt die Gefährdungsanalyse und -beurteilung einen zentralen Bestandteil im betrieblichen Arbeitsschutz dar.78 Sie dient dazu systematische und umfangreiche Untersuchungen in einem bestimmten Arbeitsbereich durchzuführen um vorhandene Gefährdungen hervorzuheben. Die Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen sollte regelmäßig stattfinden und ein Baustein des Arbeitsschutzes sein. Durch diese Anwendungen lassen sich Gefährdungen vermeiden. Störungen in den Abläufen, finanzielle Verluste und unfallbedingte Ausfälle können zudem vermieden werden. Weitere positive Effekte sind die Qualitätssicherung und die Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Das Resultat einer Gefährdungsbeurteilung können die Entwicklung von Mitarbeitermotivation und eine Steigerung der Leistungsbereitschaft sein.79 Mitarbeiter sind eine wertvolle Ressource eines jeden Arbeitgebers. Somit sollte es im Interesse eines jeden Arbeitgebers sein, Gefährdungspotentiale im Unternehmen zu identifizieren und entsprechende Schutzmaßnahmen zu treffen.80
3 Betriebliche Gesundheitsförderung im Krankenhaus
3.1 Instrumente der betrieblichen Gesundheitsförderung
3.1.1 Einführung von Gesundheitszirkeln
Wie bereits im Kapitel 2.2 erwähnt, finden in der Betrieblichen Gesundheitsförderung verschiedene Instrumente Anwendung um Informationen über Arbeitsbedingungen, Krankenstände und Arbeitsbelastungen herauszufinden, diese zu analysieren und entsprechende Interventionen einzuleiten.81 Die verschiedenen Instrumente lassen sich entsprechend in verschiedene Phasen gliedern. Diese werden als‘ Konstituierungs- und Zielfindungsphase‘, ,Planung und Analyse‘, ‚Durchführung von Interventionen‘ und ‚Auswertung und Evaluation‘ bezeichnet (Tabelle 1).82 Wie in der aufgeführten Tabelle ersichtlich finden pro Phase in der Praxis verschiedene Instrumente Anwendung.
Abbildung in dieser eseprobe nicht enthalten
Tabelle 1:Instrumente der betrieblichen Gesundheitsförderung (Quelle: Pitteroff, K. (2008), S. 26)
Im Folgenden werden vier Instrumente beschrieben, welche sich in der betrieblichen Gesundheitsförderung gut etabliert und bewährt haben.83 Diese Instrumente nennen sich Gesundheitszirkel, Mitarbeiterbefragung, betrieblicher Gesundheitsbericht und Krankenstandsanalyse.84 Das Instrument ‚Gesundheitszirkel‘ wird zur Ermittlung von Risiken am Arbeitsplatz sowie zur Entwicklung von Lösungsvorschlägen herangezogen.85 Gesundheitszirkel nehmen einen angesehenen Platz im betrieblichen Gesundheitsmanagement ein und haben in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen.86 Die Funktion von Gesundheitszirkeln besteht darin, die Arbeitssituation der Beschäftigten unter gesundheitsfördernden Aspekten zu durchleuchten und gesundheitsbelastende Verhaltens- oder Arbeitsweisen zu erkennen.87 Die Erarbeitung und Entwicklung von Lösungsvorschlägen zur Förderung und Verbesserung gesundheitsfördernder Arbeitsbedingungen und dem Gesundheitsbewusstsein ist dabei das Ziel. Zusätzlich sollen die Selbstkompetenz sowie das Pflichtbewusstsein der Angestellten zur Herstellung und Umsetzung der eigenen Gesundheits- und Arbeitssituation gestärkt werden.88 Im Zentrum der Zirkelarbeit steht der Erfahrungsschatz der Mitarbeiter über tägliche Arbeitsbedingungen- und belastungen sowie die Auswirkungen auf die psychische und physische Gesundheit.89 Der Gesundheitszirkel besteht demnach aus maximal sechs bis acht freiwilligen Mitarbeitern eines bestimmten Arbeitsbereichs. Gesundheitszirkel werden immer unter der Leitung eines Moderators durchgeführt. Dies geschieht während der Arbeitszeit und sollte in regelmäßigen Abständen stattfinden. Bei der Erstellung eines Zirkels gilt es darauf zu achten, Mitarbeiter aus der gleichen Hierarchieebene ohne die Einbindung eines Vorgesetzten, zu wählen. Dies nicht zu beachten, kann dazu führen, dass die Beschäftigen bevormundet oder beeinflusst werden, sodass kreative Vorschläge oder auch Kritik nicht geäußert werden.90
Um Gesundheitszirkel erfolgreich zu führen, müssen einige betriebliche Voraussetzungen erfüllt sein. Eine der Rahmenbedingungen ist das Einverständnis des Vorgesetzten und des Betriebsrates zur Gründung eines Zirkels. Liegt deren Einwilligung vor, so steigen die Chancen, dass Veränderungen im Unternehmen getätigt werden.91 Zudem sind die Sorgfältigkeit, mit der die Arbeitsbedingungen analysiert werden und die Wirksamkeit der ausgearbeiteten Vorschläge entscheidende Voraussetzungen für einen Erfolg. Um das Vertrauen der Mitarbeiter zu stärken, sollten möglichst viele Lösungsvorschläge im Unternehmen umgesetzt werden. Hierbei sollte es sich vor allem auch um schwer durchführbare Vorschläge handeln. Indem die Unternehmensleitung diesbezüglich Maßnahmen einleitet, manifestiert sich darin glaubhaft deren Bereitschaft tatsächliche Veränderungen in der Betrieblichen Gesundheitsförderung durchzuführen. Dadurch erhöht sich die Glaubwürdigkeit gegenüber der Mitarbeiter und das Vertrauen der Belegschaft in Veränderungsprozessen.92 Die Arbeit im Gesundheitszirkel bestätigt das Resultat jahrelanger betrieblicher Erfahrung. Durch die Arbeit im Team - wie dem Gesundheitszirkel - entstehen schnell kreative Ansätze für Ideen und Lösungen zur Behebung von Problematiken im Berufsalltag.93
3.1.2 Mitarbeiterbefragung
Mitarbeiterbefragungen dienen als weiteres Instrument der betrieblichen Gesundheitsförderung.94 Diese werden als Analyse - Instrument eingesetzt und haben zweierlei Hintergründe. Zum einen werden diese angewandt um Themen wie Gesundheit und Wohlbefinden am Arbeitsplatz anzusprechen, auf Gesundheitsrisiken aufmerksam zu machen sowie auf bekannte Problemstellen hinzuweisen. Zudem tragen Mitarbeiterbefragungen dazu bei, Informationen über Einstellungen, Erfahrungen und Bedürfnisse der Mitarbeiter zu gewinnen. Die durch Mitarbeiterbefragungen gewonnenen Informationen stellen eine bedeutende Quelle zur Verbesserung von Arbeitsprozessen dar und können somit dazu beitragen das Wohlbefinden der Mitarbeiter im Unternehmen zu steigern.95 Für die Planung einer Mitarbeiterbefragung ist eine sorgfältige Vorbereitung erforderlich. Entscheidend ist hier, dass die Entscheidungsträger eine genaue Vorstellung der Ziele und Absichten haben. Deshalb sollte im Vorfeld geklärt sein, ob Maßnahmen und Veränderungen prinzipiell umgesetzt werden können. Dies ist deshalb von Bedeutung, da Mitarbeiterbefragungen die Erwartungen der Mitarbeiter steigern. Denn die Annahme und Hoffnung dieser wird bestärkt, dass mithilfe gewonnener Informationen entsprechende Veränderungen durchgeführt werden könnten.96
Um bei Mitarbeiterbefragungen authentische Ergebnisse zu erhalten, muss das Unternehmen bereit sein, sich auf Kritik einzulassen. Durch die praktische Umsetzung der Ergebnisse und die daraus resultierenden Erfolgen erfährt die Gesundheitsförderungsgruppe Unterstützung durch die Mitarbeiter.97
Mitarbeiterbefragungen können in schriftlicher oder mündlicher Form abgewickelt werden und werden anonym durchgeführt.98 Bei Befragungen in Form von Interviews spielt der Interviewer eine bedeutende Rolle. Dieser sollte eine vertrauenserweckende und offene Ausstrahlung besitzen um umfangreiche Auskünfte der Befragten zu erlangen.99
3.1.3 Betrieblicher Gesundheitsbericht
Ein weiteres hilfreiches Instrument der betrieblichen Gesundheitsförderung ist der ,Betriebliche Gesundheitsbericht‘. Dieser lässt sich als eine Art Geschäftsbericht bezeichnen, welcher Aufschluss über gesundheitsbezogene Daten der Mitarbeiter gibt.100 Der betriebliche Gesundheitsbericht stellt einen zentralen Teil des betrieblichen Gesundheitsmanagements dar und enthält Ergebnisse von Mitarbeiterbefragungen und Problemlösungsvorschlägen. Er kann genauso Arbeitsunfähigkeitsdaten der Krankenversicherungen oder betriebliche Informationen wie Dokumentationen über Frühverrentungen enthalten. Die Aufgabe des Gesundheitsberichts besteht darin, Informationen darüber zu liefern, in welchen Berufsgruppen oder Arbeitsbereichen gesundheitliche Probleme und Beeinträchtigungen bestehen. Er hat die weitere Aufgabe eine Transparenz über die durchgeführten oder in Planung stehenden BGM - Maßnahmen zu schaffen. Gleichzeitig soll dieser ein Bewusstsein für die Bedeutsamkeit des betrieblichen Gesundheitsmanagements im Betrieb schaffen.101
Offenkundig werden die betrieblichen Gesundheitsziele in den Gesundheitsberichten nicht immer klar und deutlich verfasst. Maßnahmen, welche sich zukünftig als schwer umsetzbar zeigen, werden im Gesundheitsbericht nicht formuliert, um Unzufriedenheit der Mitarbeiter sowie Missverständnisse zu vermeiden.102
3.1.4 Arbeitsunfähigkeitsanalyse
Die Arbeitsunfähigkeitsanalyse lässt sich als eine Fehlzeitenanalyse auf der Basis von Arbeitsunfähigkeitsdaten bezeichnen. Sie stellt ein Standardinstrument zum Erfassen von arbeitsbedingten gesundheitlichen Risiken dar.103 Die Arbeitsunfähigkeitsanalyse kann auf Anfrage des Betriebes vonseiten der Krankenkasse erstellt werden. Die Auswertung erfolgt nach Häufigkeiten sowie der Verteilung der von den Mitgliedern gemeldeten Krankheitsfälle aus dem Unternehmen. Dazu werden die Aspekte Krankheitsdauer und - diagnose der erkrankten Mitarbeiter zur Auswertung der Analyse verwertet. Zur eindeutigen Auffassung der Arbeitsunfähigkeitsdaten müssen zudem Daten aus Mitarbeiterbefragungen und Berufsgenossenschaften über aktuelle Zahlen von Berufsunfällen und Gefährdungsbeurteilungen zugezogen werden. Zur Darstellung eines Vergleichs können Daten aus der gleichen Branche und eine Analyse über den Durchschnitt aller Mitglieder der jeweiligen Krankenkasse eingesetzt werden.104 Dabei als interessant stellen sich die betriebsinternen Vergleiche der verschiedenen Abteilungen dar, welche Auffälligkeiten hervorheben können. Der Datenschutz sorgt in diesem Rahmen dafür, dass einzelne Mitarbeiter geschützt werden. Dank der Erfassung dieser genannten Daten können Maßnahmen im Unternehmen entwickelt werden um die Gesundheit der Mitarbeiter zu schützen und zu fördern.105
3.2 Das Krankenhaus als Arbeitsplatz
3.2.1 Arbeitsbedingungen und -belastungen der Pflegekräfte
Krankenhäuser stellen einen unverzichtbaren Bestandteil des heutigen Gesundheitswesens dar.106 Die Gründe für stationäre Behandlungen, welche im Krankenhaus durchgeführt werden, liegen in der Schwere und Art der zu behandelnden Erkrankung. Auch die Anwendung von besonderen modernen Diagnostikverfahren oder die Betreuung durch fachlich geschultes Personal erfordern einen stationären Aufenthalt im Krankenhaus.107 Laut § 107 SGB V sind Krankenhäuser demnach Einrichtungen, die sich der Krankenhausbehandlung oder Geburtshilfe widmen und unter ständiger ärztlicher Leitung und pflegerischem Personal stehen. Sie verfügen über therapeutische und diagnostische Behandlungsoptionen und ihr Ziel ist, das Heilen und Erkennen von Krankheiten sowie die Linderung von Krankheitsbeschwerden (siehe § 107 Abs. 1, SGB V). Unabhängig von der Art der Erkrankung beansprucht jede stationäre Behandlung eine Betreuung und Pflege, welche rund um die Uhr geleistet werden muss.108 Die Arbeit am Menschen lässt sich demnach als eine Dienstleistungsarbeit bezeichnen. Zur Erklärung des Begriffs ‚Dienstleistung‘ zählen verschiedene Ansätze, jedoch liegt keine allgemein anerkannte Definition vor.109 Der Arbeitskreis ‚Produktivität von Dienstleistungsarbeit‘ definiert den Begriff folgendermaßen:110
ÄDer Begriff der Dienstleistungsarbeit wird definiert als die Summe der geordneten Tätigkeiten eines Anbieters in einem auf Wertzuwachs ausgerichteten Prozess. Dienstleistungsarbeit wird eingesetzt als Mittel zur Erreichung der Ziele eines Abnehmers. Dieser ist selbst aktiv in den Erstellungsprozess einbezogen. Dienstleistungsarbeit des Anbieters ist damit effektive Arbeit für heteronome (fremdbestimmte, fremden Einflüssen unterliegende) Zwecke unter Einbeziehung heteronomer Mittel.“111
Die genannte Definition beschreibt eine allgemeine Dienstleistung, welche im produkt - sowie personenbezogenen Bereich Anwendung findet. Die Charakteristik einer Dienstleistung beschreibt sich als eine Leistung, die nur abstrakt und immateriell erbracht werden kann. Der Fokus der Dienstleistungsarbeit liegt dabei auf der Kommunikation und Kooperation zwischen Anbieter und Abnehmer. Ein Merkmal davon ist, dass der Einfluss von externen Faktoren nur unterschiedlich auf die Dienstleistung wirken kann, anders als bei der Produktivität von Produkten.112 Als Dienstleistungsarbeit zählen Leistungen, welche personenbezogen, konsumbezogen oder produktionsbezogen erbracht werden. Infolgedessen ist die personenbezogene Dienstleistung, welche beispielsweise in der Pflege Anwendung findet, durch die Leistung der Pflegekräfte am Patienten und im Allgemeinen durch den Umgang am Patienten charakterisiert. Im Mittelpunkt steht hier die soziale Interaktion zwischen dem Kunden bzw. Patient und dem Dienstleister.113 Zur personenbezogenen Dienstleistungsarbeit im Krankenhaus zählen Leistungen die zur pflegerischen Versorgung und Betreuung von kranken und alten Patienten, oder auch hilfsbedürftigen jungen Patienten, welche nicht in der Lage sind, sich selbst zu versorgen, erbracht werden. Die Dienstleistungsarbeit stellt hohe Anforderungen. Diese sind eine ausgeprägte Arbeitssorgfalt, ein hohes Verantwortungsgefühl gegenüber den Patienten und ein Geschick für organisatorische und planerische Tätigkeiten.114 Infolgedessen bringt die Dienstleistungsarbeit im Pflegeberuf enorme Risiken für die psychische und physische Gesundheit mit sich.115 Durch die rasche Modernisierung, den demographischen Wandel und den Anspruch des Krankenhauses wettbewerbsfähig zu sein, nehmen Aspekte wie Leistungsfähigkeit und Leistungsbereitschaft bei Dienstleistungen bedeutend zu. Krankenhäuser sind durch gesundheitspolitische Strukturen gezwungen wirtschaftlicher und effektiver zu arbeiten.116 Die damalige Einführung der Fallpauschalen, auch DRGs genannt, führte zu einer Intensivierung dieser Problematik. Folgen daraus sind die Verkürzung der Liegezeiten und ein Anstieg der Fallzahlen, was auf eine höhere Belastung des Personals hinausläuft. Zudem führt die stetige Zunahme einer alternden und damit auch einer deutlich zunehmend kränkeren Bevölkerung zu einer verstärkten Nachfrage von pflegerischen Leistungen.117 Auch das Krankheitsspektrum wird sich durch die zunehmende Vergreisung der Gesellschaft zukünftig verändern. Selbiges trifft auf die Ansprüche der Patienten mit unterschiedlichen Krankheitsbildern zu, die den Wettbewerb der Krankenhäuser wahrnehmen.118
Wie bereits erwähnt, sind die Pflegerinnen und Pfleger großen psychischen und physischen Belastungen ausgesetzt. Ein weiterer Grund, der psychisch belastet, ist der Stellenabbau im Bereich des Pflegepersonals.119 Das Deutsche Institut für angewandte Pflegeforschung e.V. gibt bei einer bundesweiten Befragung von Pflegekräften zur Situation der Pflege und Patientenversorgung im Krankenhaus, dem sogenannten ‚Pflege-Thermometer‘, aus dem Jahr 2009, an, dass in den Jahren 1996 bis 2008 insgesamt 50.000 Vollkraftstellen in der Krankenhauspflege abgebaut wurden. Dies macht einen Abbau von 14,2 % aus und betrifft jede siebte Stelle.120 Hinzuzufügen ist, dass der Fachkräftemangel im Bereich der Pflege ein weiteres Problemfeld darstellt. Deutsche Krankenhäuser weisen im Jahr 2014 eine relativ hohe Vakanzzeit hinsichtlich der Stellenbesetzung im Vergleich zum allgemeinen Durchschnitt der Berufe in Deutschland auf. Hier gibt die Studie zur bundesweiten Befragung von leitenden Pflegekräften des Deutschen Instituts für angewandte Pflegeforschung e.V. aus dem Jahre 2014 eine durchschnittliche Vakanzzeit von 117 Tagen an. Dies sind 40 Tage mehr als in anderen Berufsfeldern.121 Hinsichtlich des Personalmangels liegt die Problematik zum einen in einem strukturellen Mangel, aber auch in einem realen Mangel an Personal. Dies lässt den Beruf der Krankenpflege weniger attraktiv erscheinen. Es zeigt sich zusätzlich, dass der demographische Wandel in zweifacher Hinsicht ein Problem im Bereich der Pflege darstellt bzw. darstellen wird. Der Anteil der pflegebedürftigen Patienten erhöht sich zunehmend und das Personal, welches die Pflegeleistungen erbringt, wird immer älter und wird in seiner Leistungsfähigkeit dadurch zusätzlich gefordert.122
3.2.2 Arbeiten im Nacht- und Schichtdienst
Der Beruf der Krankenpflege ist verschiedensten Belastungen ausgesetzt.123 Einen wichtigen Aspekt des Berufs stellen die Arbeitszeiten im Krankenhaus dar. Diese sind von Schicht-, Wochenend- und Nachtdiensten sowie zahlreichen Überstunden geprägt, um die Sicherung der medizinischen Versorgung im Krankenhausbereich zu gewährleisten.124
In der Krankenhauspflege finden in der Regel zwei Schichtsysteme Anwendung. Der Tagdienst setzt sich aus einem Zweischichtsystem mit einer Kombination von Wochenendarbeiten zusammen. Die zweite Komponente bildet der Nachtdienst. Sogenannte Nachtschwestern- und pfleger arbeiten ausschließlich in diesem Schichtdienst. Die Belastung durch die Nachtdienste kann sich in einer Störung des körpereigenen Rhythmus zeigen. Für die Arbeit in diesem Dienst ist somit eine Anpassung des gesamten Lebensrhythmus vonnöten. Dies gestaltet sich in der Umsetzung überwiegend schwierig, da das soziale Leben maßgeblich von Kindern, Familie im Allgemeinen, und Freunden beeinflusst und geprägt wird. Die Folge daraus ist, dass der Körper einem permanenten Wechsel durch die Anpassung der Körperfunktionen an die jeweilige Tages - oder Nachtzeit unterworfen ist.125 Nervosität, Abgeschlagenheit und Stimmungsschwankungen gelten als Symptome, welche sich im Zusammenhang mit einem Schlafdefizit zeigen. Dies wird durch den veränderten Wach - und Arbeitsrhythmus hervorgerufen.126 Eine weitere Problematik zeigt sich in der Unterbesetzung der Nachtdienste. Denn eine knappe Besetzung von Pflegepersonal kann zur Gefährdung der eigenen Sicherheit führen.127 So berichtete etwa das Deutsche Ärzteblatt in dem Artikel ‚Pflege: Nachtdienst in Krankenhäusern zum Teil deutlich unterbesetzt‘ im Jahr 2015 von einer stichprobenartigen Untersuchung der Nachtdienste in 237 Krankenhäusern durch die Gewerkschaft Verdi. Hierbei zeigte sich, dass 1.147 von insgesamt 2.056 durch Verdi besuchte Stationen mit lediglich einer Pflegekraft besetzt waren. Die Anzahl der Patienten pro Station lag dabei durchschnittlich bei 25. Diese Verhältnisse weisen auf eine schlechte personelle Besetzung der Pflegekräfte hin. Die Folgen, die sich daraus ergeben, zeigen sich häufig in einer Überforderung des Personals sowie gesundheitlicher psychischer und physischer Beeinträchtigung und darüber hinaus auch in einer unzureichenden Versorgung der Patienten.128
3.2.3 Berufskrankheiten und krankheitsbedingte Fehlzeiten
Urlaubstage sowie die Freistellung für Fort - und Weiterbildung zählen zu den allgemeinen Fehlzeiten im Beruf. Die Gründe für krankheitsbedingte Fehlzeiten ergeben sich aus den jeweiligen Anforderungen im Beruf.129 Im Pflegebereich zählen dazu Fehlzeiten, welche überwiegend durch Muskel - Skelett - Erkrankungen und psychischen Belastungen bedingt sind.130
Nach dem aktuellsten Gesundheitsreport der DAK-Gesundheit aus dem Jahr 2015 liegt das Gesundheitswesen neben dem Wirtschaftszweig ‚Verkehr, Lagerei und Kurierdienste‘ mit einem Krankenstandwert von 4,5 Prozent an der Spitze und somit auch über dem Durchschnitt im Vergleich zu anderen Branchen. Dabei liegen - wie bereits erwähnt - Erkrankungen des Muskel - Skelett - Systems und psychische Erkrankungen an der Spitze der häufigsten Krankheitsarten in Bezug auf Arbeitsunfähigkeitstage (siehe Abbildung 3).131
Abbildung in dieser eseprobe nicht enthalten
Abbildung 3: AU - Daten der DAK Gesundheit 2014 (Quelle: DAK Gesundheit (2015), S. 17)
Erkrankungen des Muskel - Skelett - Systems entstehen bei der pflegerischen Tätigkeit im Umgang mit Patienten durch häufiges Tragen und Heben der Patienten, der Arbeit im Stehen und ungünstigen Körperhaltungen wie etwa Rumpfbeugungen.132 Diese genannten Merkmale der Arbeit führen zu Kreuz - oder Rückenschmerzen und körperlicher Erschöpfung. Auf Dauer können jahrelanges Heben und Tragen schwerer Lasten sowie extreme Rumpfbeugehaltungen zu bandscheibenbedingten Erkrankungen der Lenden - oder Halswirbelsäule führen. Berufsbedingte Wirbelsäulenverschleißerkrankungen und bandscheibenbedingte Erkrankungen sind typische berufsspezifische Erkrankungen im Bereich der Pflege und führen wie bereits im Gesundheitsreport der DAK-Gesundheit genannt als einer der häufigsten Ursachen zur Arbeitsunfähigkeit.133 Im schlimmsten Fall droht die dauerhafte Arbeitsunfähigkeit - das frühzeitige Ausscheiden aus dem Berufsleben.134 Um diese Folgen von Rückenschmerzen oder das Entstehen von Erkrankungen des Muskel - Skelett - Systems zu vermeiden, sind eine rückengerechte Arbeitsweise und ein körperliches Training in Form von Rückenschule erforderlich. Auch das Nutzen von Hilfsmitteln zum Erhalt der Gesundheit von Pflegepersonal stellt eine große Hilfe und Erleichterung im Umgang mit pflege - und hilfsbedürftigen Patienten dar. Diese Hilfsmittel, wie etwa Bettzügel oder Haltegürtel, sind oft defekt, nicht verfügbar, es fehlt die Zeit deren Anwendung oder die Handhabung ist nicht bekannt.135 Neben körperlichen Erkrankungen droht auch eine psychische Überbelastung bei Pflegekräften. Diese kann beispielsweise durch Stress, hohes Arbeitsaufkommen, eine Verrichtung der Arbeit unter ständigem Zeitdruck, häufige Unterbrechungen der Arbeit oder bedingt durch neue Aufgaben oder unzureichende Kommunikation im Team entstehen.136 Psychische Belastungen und Burnout sind häufig die Folgen jahrelanger Überbeanspruchungen in der Pflegetätigkeit.137 Bei der psychiatrischen Diagnose ‚Burnout‘ handelt es sich um einen lang anhaltenden Zustand der psychischen und physischen Ermüdung. Burnout geht mit verschiedenen Symptomen einher wie depressiven Verstimmungen, Antriebslosigkeit und permanenter Müdigkeit.138 Folgende Bedingungen können zur regelrechten Erschöpfung und somit zu Burnout führen:
- Überlastung mit Arbeit
- Mangel an Kontrolle
- Mangel an Lob und Anerkennung
- Ungerechtigkeit und das Fehlen von Kollegialität
- Fehlender Zusammenhalt im Team
- Widersprüchliche Grundsätze und Wertvorstellungen.139
Von Burnout abzugrenzen ist Stress. Er kann in gewisser Weise die Vorstufe zu Burnout darstellen. Stress gehört somit zum Bereich der psychischen Erkrankungen und zählt laut DAK- Gesundheitsreport zu den häufigsten Krankheitsursachen.140 Stress kann zur Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit führen und nicht selten zum berufsbedingten Ausfall. Dauerhaft kann Stress verschiedene Erkrankungen wie beispielsweise einen Herzinfarkt auslösen.141 Für das Gegenteil von Stress und Überforderung im Beruf, hat sich eine neue Bezeichnung entwickelt, genannt ‚Boreout‘. Dieses Krankheitsbild führt zu einer Unzufriedenheit bedingt durch Unterforderung und Langeweile im Berufsalltag und ist selten im Pflegeberuf verbreitet.142
Wie das Kapitel zeigt, führen viele berufsspezifische Gründe auf den hohen Krankenstand in der Pflege hin. Obwohl sich das Setting Krankenhaus auf die Versorgung von Kranken und somit auf die Wiederherstellung von Gesundheit konzentriert, ist das Gesundheitsrisiko für Pflegekräfte hoch und der Aufgabenbereich trägt eine hohe Verantwortung mit sich.143
3.3 Darstellung der betrieblichen Gesundheitsförderung im deutschen Krankenhauswesen
3.3.1 Akteure der betrieblichen Gesundheitsförderung im Krankenhaus
Die Zahl der Krankenhäuser nimmt einen großen Teil der Gesundheitsversorgung in Deutschland ein. Die deutsche Krankenhaus Gesellschaft gibt laut Krankenhausstatistik aus dem Jahre 2014 eine Gesamtanzahl von 1.980 Krankenhäusern mit einer Patientenfallzahl von insgesamt 19.148.626 an.144 Dabei liegt der Anteil der dort beschäftigten Pflegekräfte bei 318.749. Ersichtlich aus der genannten Statistik ist, dass die Patientenanzahl gegenüber dem Jahre 2013 um 1,9 % gestiegen ist und die Verweildauer der stationären Behandlung um -1,3 % gesunken ist. Dies weist auf eine erhöhte Arbeitsdichte in den Krankenhäusern hin.145
Die Betriebliche Gesundheitsförderung in Deutschland nahm ihren Ausgangspunkt in der Ottawa - Charta der WHO aus dem Jahre 1986.146 Dadurch, dass die WHO in dieser Charta erstmalig den Begriff ‚Gesundheitsförderung‘ näher fasste und die Notwendigkeit für solche eine Förderung unterstrich, bildeten sich in der Folge Bewegungen, die es sich zum Ziel machten, Gesundheitsförderung in Krankenhäusern fest zu etablieren. Die Ottawa-Charta war also die Grundlage dieser Reformbestrebungen - auch in Deutschland. Eine der fünf Strategien der Ottawa-Charta ist die ‚Neuorientierung der Gesundheitsdienste‘.147 Diese Reorientierung sollte sich in einem Wandel der Krankenhausorganisation und vor allem in einer Fokussierung auf die Bedürfnisse von Patienten und Angestellten manifestieren. Die Aufgaben des Krankenhauses sollten somit erweitert werden. Die Erklärung liegt darin, dass die Erkrankungen von Patienten weiterhin geheilt und behandelt werden müssen und gleichzeitig deren Gesundheit gefördert werden sollte. Das Prinzip der WHO appelliert daran, die Gesundheit der Patienten, des Krankenhauses als Organisation, seiner Mitarbeiter und der Kommune bzw. Gemeinde zu fördern. Diese Gruppen sollen dazu befähigt werden, ihr eigenes Interesse gesund zu bleiben, vertreten und die Verantwortung für ihre eigene Gesundheit übernehmen zu können. Im Zuge dieser beschriebenen fünften Strategie entstanden im Jahre 1993 verschiedene Pilotprojekte, welche durch die WHO gefördert wurden.148
Das folgende Kapitel stellt die Akteure in Krankenhäusern in Deutschland dar, welche die betriebliche Gesundheitsförderung unterstützen und fördern. Einzelne Projekte und Maßnahmen werden kurz erläutert um darzustellen in welchem Umfang die Gesundheit und Förderung von Mitarbeitern, primär die Berufsgruppe der Pflegekräfte, in Klinken betrieben wird.
3.3.2 Deutsches Netz Gesundheitsfördernder Krankenhäuser (DNGfK)
Aufgrund des von der WHO initiierten Reformprozesses kam es in Deutschland zur Gründung des Deutschen Netzes gesundheitsfördernder Krankenhäuser (DNGfK). 1993 startete hier eins der oben angesprochenen WHO - Pilotprojekte unter dem Titel ‚Gesundheitsförderndes Krankenhaus‘. Daraufhin folgte 1993 - 1997 das Europäische Pilotkrankenhausprojekt ‚Health Promoting Hospitals‘. Insgesamt 20 Krankenhäuser aus elf europäischen Ländern wirkten an diesem Projekt mit, fünf davon stammten aus Deutschland.149 Dies war zugleich der Start für das Internationale Netzwerk Gesundheitsfördernder Krankenhäuser. Dieses besteht heute bzw. nach dem neuestem Stand (Februar 2015) aus ca. 900 Mitgliedseinrichtungen. Diese erstrecken sich über 40 nationale und regionale Netzwerke auf allen Kontinenten.150 Ziel des Europäischen Pilotkrankenhausprojektes war es, Erfolgsmodelle auszubauen um Transfer und Erkennbarkeit dieser Modelle für das Netzwerk gesundheitsfördernder Krankenhäuser zu sichern.151 Das Projekt ermöglichte den Austausch unter Krankenhäusern und stellte gleichzeitig eine gute Basis für andere Krankenhäuser dar. Krankenhäuser, welche an diesem Projekt teilnahmen sorgten für Aufmerksamkeit und weckten das Interesse anderer Einrichtungen. Infolgedessen kam es zur Entwicklung von regionalen sowie nationalen Netzwerken.152 Durch den Erfahrungsaustausch von Mitgliedern konnten seitdem wissenswerte Informationen gesammelt werden und Ziele können zukünftig gemeinsam verwirklicht werden.153 Laut Website des Deutschen Netzes Gesundheitsfördernder Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen existieren deutschlandweit 70 Einrichtungen, dazu zählen Krankenhäuser und Rehabilitationseinrichtungen.154 Die Website bietet zudem einen Einblick über die Regelmäßigkeit der nationalen Konferenzen, welche ab dem Jahr 2006 jährlich stattgefunden haben. Für die Jahre 2013 und 2014 existieren keine Einträge. Die nationale Konferenz aus dem Jahr 2015 musste wegen zu geringer Teilnehmerzahl abgesagt werden.155 Unter Leitung und mit Unterstützung des DNGfK sind einige Projekte zustande gekommen. Die Homepage des DNGfK stellt fünf Publikationen zur Verfügung, welche Einblicke in Projekte und Leitfäden gewähren sollen. Die erste Publikation gibt Ausschluss über die im Jahr 2006 entstandenen Projekte unter dem Motto ‚Gesundheit braucht Bewegung‘.156 Unter dem Aufruf, Ideen für die Umsetzung von Bewegung und körperlicher Aktivität im Krankenhaus zu sammeln, sind insgesamt 60 Projekte eingereicht worden.157 Neun Umsetzungsbeispiele davon wurden in Zusammenarbeit mit der Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA) und der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) in einer Broschüre im Jahre 2008 veröffentlicht.158
In Bezug auf den aktuellen Stand von Gesundheitsförderungsmaßnahmen, welche im Rahmen von Betrieblicher Gesundheitsförderung in Krankenhäusern betrieben werden, hat das Deutsche Krankenhausinstitut eine Studie entworfen (Abbildung 4). An dieser Erhebung haben 309 Krankenhäuser teilgenommen.159
Abbildung in dieser eseprobe nicht enthalten
Abbildung 4: Gesundheitsförderungsmaßnahmen von Krankenhäusern in % (Quelle: Löffert, S., Golisch, A. (2013), S. 77)
Anhand der Abbildung ist ersichtlich, dass 41 % der deutschen Krankenhäuser Gesundheitsförderung umsetzen, 9,3 % den Handlungsbedarf erkennen, jedoch keine Maßnahmen in Bewegung setzen und 12,5 % keine Umsetzung treffen.160 Anhand dieser Studie geht zudem hervor, dass die befragten Krankenhäuser zwar den Handlungsbedarf von BGM erkennen, jedoch keine messbaren Zielvorstellungen festgelegt oder Evaluationen von Maßnahmen durchgeführt haben.161
In Weiteren wird abschließend auf die Grundsatzdokumente eingegangen, welche zur Orientierung und als Prinzipien zur Darstellung eines gesundheitsfördernden Krankenhauses dienen.162 Diese Grundsatzdokumente konnten 1997 in Wien durch das Engagement von Arbeitsgemeinschaften im Rahmen der 5. Internationalen Konferenz Gesundheitsfördernder Krankenhäuser erarbeitet werden. Die Grundprinzipien setzen sich aus fünf grundlegenden Standards und 18 Kernstrategien zusammen. Diese nennen sich internationale HPH- Qualitätsinstrumente.163 Die Grundprinzipien richten sich dabei an verschiedene Zielgruppen. Diese setzen sich aus Patienten, deren Angehörige und den Beschäftigten des Krankenhauses zusammen.164 Diese Instrumente dienen den Mitgliedern dazu, Gesundheitsförderung in der jeweiligen Einrichtung umzusetzen und diese ins Qualitätsmanagement einzubeziehen. Die 18 Kernstrategien bilden wie bereits erwähnt die Grundlage für die Bereiche Patienten, Mitarbeiter und Bevölkerung. Sechs Strategien davon geben diesen jeweils die Ziele der Gesundheitsförderung vor (Tabelle 2).165
Abbildung in dieser eseprobe nicht enthalten
Tabelle 2: 18 Kernstrategien
(Quelle: Österreichische Netzwerk Gesundheitsfördernder Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen (2008), S. 10)
Weitere fünf Standards und ein Selbstbewertungsinstrument gehören zu den Grundprinzipien der Gesundheitsförderung in Krankenhäusern.166 Das Selbstbewertungsinstrument wird in diesem Zusammenhang benötigt um die Standards in das Qualitätsmanagement von Krankenhäusern einzubinden. Somit besteht für jede Einrichtung die Möglichkeit anhand spezifischer Fragestellungen eine Gesamteinschätzung vorzunehmen.167 Die Standards passen sich an den Patientenpfad an, wobei damit der gesamte Aufenthalt des Patienten gemeint ist. Die fünf Standards nehmen in diesem Rahmen Bezug auf Management -Grundsätze, Patienteneinschätzung, Patienteninformation - und intervention, Förderung eines gesunden Arbeitsplatzes, Kontinuität und Kooperation.168
3.3.3 Die Krankenkassen
Weitere Interventionen wurden im Krankenhaus durch die Unterstützung von Krankenkassen durchgeführt. Der BKK-Berufsverband sowie die AOK sind hier vorwiegend beteiligt, da diese vereinzelte Gesundheitsförderungsprojekte in Krankenhäusern begleiten.169 Hier sind zwei Beispiele auf der Homepage des Bundesministeriums für Gesundheit zu finden.
[...]
1 Vgl. Rieder, K., Heyden, M. A. (2015), S. 9.
2 Vgl. Rimbach, A. (2013), S. 1; Rieder, K., Heyden, M. A. (2015), S. 9; Initiative Neue Qualität der der Arbeit (2010), S. 5.
3 Vgl. Höppner, H. (2004), S. 21; Initiative Neue Qualität der Arbeit (2010),S. 5.
4 Vgl. Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (2008), S. 3.
5 Vgl. Spiker, I., Schopf, A. (2007), S. 14.
6 Vgl. Höppner, H. (2004), S. 9; Spiker, I., Schopf, A. (2007), S. 14.
7 Vgl. Höppner, H. (2004), S. 9 ff. ; Löffert, S., Golisch, A. (2013), S. 5; Pröll, U., Streich, W. (1984), S. 1; Schrappe, M. (2005), S. 113 f.
8 Vgl. Spiker, I., Schopf, A. (2007), S. 15.
9 Vgl. Initiative Neue Qualität der Arbeit (2010), S. 5.
10 Vgl. Pfaff, H. et al. (2005), S. 84.
11 Vgl. Höppner, H. (2004), S. 9; Friedrich, D. et al. (2007), S. 7.
12 Vgl. Neue Initiative Qualität der Arbeit (2010), S. 5.
13 Vgl. Höppner, H. (2004), S. 21.
14 Vgl. Höppner, H. (2004), S. 47.
15 Vgl. Pfaff, H. et al (2005), S. 84; Rimbach, A. (2013), S. 1.
16 Vgl. Rimbach, A. (2013), S.1.
17 Vgl. Friedrich, D. et al. (2007), S. 7; Rimbach, A. (2013), S. 1.
18 Vgl. Münch, E., Walter, U., Badura, B. (2004), S. 22 f.
19 Vgl. Friedrich, D. et al. (2007), S. 7.
20 Vgl. Löffert. S., Golisch, A. (2013), S. 100; Eikamp, J. (2013), S. 11 , Müller, B. (2010), S. 125 ff.
21 Vgl. Hackmann, M. (2005), S. 17.
22 Vgl. Spicker, I., Schopf, A. (2007), S. 23.
23 Vgl. Badura, B., Hehlmann, T. (2003), S. 13; Bienert, M. L., Razavi, B. (2007), S. 58 f.
24 Vgl. Leu, R. E., Doppmann, R., Keller, T., Deutschmann, R. (1986), S. 158.
25 WHO (2014), S. 1.
26 Vgl. Zähringer, M. (2016), S. 3.
27 Vgl. Spiker, I., Schopf, A. (2007), S. 23; Hackmann, M. (2005), S. 17.
28 Vgl. WHO (1986), S. 1 ff.;
29 WHO (1986), S. 1 f.
30 Vgl. Badura, B., Hehlmann, T. (2003), S. 13; WHO (1986), o.S.; Spiker, I., Schopf, A. (2007), S. 23.
31 Badura, B., Hehlmann, T. (2010), S. 32.
32 Vgl. Hackmann, M. (2005), S. 20.
33 Vgl. Höppner, H. (2004), S.35 f.; Decker, F., Decker, A. (2015), S. 50 ff.
34 Vgl. Decker, F., Decker, A. (2015), S. 50 ff.; Spiker, A. , Schopf, A. (2007), S. 25 f.
35 Vgl. Bienert, M. L., Razavi, B. (2007), S. 59; Ulich, E., Wülser, M. (2004), S. 39 ff.
36 Vgl. Badura, B., Walter, U., Hehlmann, T. (2010), S. 45.
37 Vgl. Antonovsky, A. (1997), S. 22 ff.
38 Vgl. Badura, B., Walter, U., Hehlmann, T. (2010), S. 45.
39 Vgl. Westermeyer, G, Stein, B. A. (2006), S. 107; Rimbach, A. (2013), S. 17.
40 Vgl. Dzudzek, J. (2010), S. 27; Rimbach, A. (2013), S. 17.
41 Vgl. Rimbach, A. (2013), S. 17 f.
42 Vgl. Rimbach, A. (2013), S. 27.
43 Vgl. Eikamp, J. (2013), S. 3; Stachel, K. (2013), S. 190.
44 Wegner, B. (2008), S. 6.
45 Vgl. Unfallkasse Baden -Württemberg (2016), o. S.; Wegner, B. (2009), S. 3.
46 Vgl. Rimbach, A. (2013), S. 27.
47 Vgl. Decker, F., Decker, A. (2015), S. 150.
48 Vgl. Wegner, B. (2009), S. 3 ; Borchardt, G. (2004), S. 24 f.
49 Vgl. Wegner, B. (2009), S. 3 f..; Borchardt, G. (2004), S. 24 f.
50 Vgl. Rudow, B. (2004), S. 24.
51 Vgl. Rimbach, A. (2013), S. 29; Rudow, B. (2004), S. 24.
52 Vgl. Münch, E., Walter, U., Badura, B. (2004), S. 188; Rimbach, A. (2013), S. 29.
53 Vgl. Dzudzek, J. (2010), S. 46 f.; Münch, E., Walter, U., Badura, B. (2004), S. 188; Spiker, I., Schopf, A. (2007), S. 37.
54 Vgl. Pfaff, H. et al. (2005), S. 84.
55 Vgl. Münch, E., Walter, U., Badura, B. (2004), S. 188 f.; Dzudzek, J. (2010), S. 46 f.
56 Vgl. Singer, S., Neumann, A. (2010), S. 51.
57 Vgl. Münch, E., Walter, U., Badura, B. (2004), S. 188 f.; Dzudzek, J. (2010), S. 46 ff.
58 Vgl. Singer, S. Neumann, A. (2010), S. 52 ff.
59 Vgl. Meggeneder, O. (2000), S. 45.
60 Vgl. Badura, B., Walter, U., Hehlmann, T. (2010), S. 35; Spiker, I., Schopf, A. (2007), S. 32.
61 WHO (1986), S. 1.
62 Vgl. Borchardt, G. (2004), S. 24; Rimbach, A. (2013), S. 55.
63 Vgl. Rosenbrock, R. , Michel, C. (2007), S. 27 f.; Rimbach, A. (2013), S. 55; Spiker, I,. Schopf, A. (2007), S. 36.
64 Vgl. Borkel, A., Rimbach, A., Wolters, J. (2011), S. 5; Rimbach, A. (2013), S. 56.
65 Vgl. Nieder, P., Michalk, S. (2007), S. 46; Rimbach, A. (2013), S. 56.
66 Vgl. Eikamp, J. (2013), S. 5; Nieder, P., Michalk, S. (2007), S. 46.
67 Vgl. Meggeneder, O. (2000), S. 46.
68 Vgl. Meggeneder, O. (2000), S. 47.
69 Vgl. Meggeneder, O. (2000), S. 46.
70 Vgl. Dietscher, C., Nowak, P., Pelikan, J. M. (2000), S.46 f.; Rudow, B. (2014), S. 35.
71 Vgl. Rimbach, A. (2013), S. 28 f.; Rudow, B. (2004), S. 11.
72 Vgl. Rimbach, A. (2013), S. 28 f.; Rudow, B. (2004), S. 11.
73 Vgl. Rudow (2004), S. 90 f.; Rimbach, A. (2013), S. 46.
74 Vgl. Rudow (2004), S. 90 f.; Rimbach, A. (2013), S. 46.
75 Vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2007), o. S.; Rudow, B. (2014), S. 38.
76 Vgl. Gutmann, J., Kollig, M. (2005), S. 43.
77 Vgl. Rudow, B. (2014), S. 41.
78 Vgl. Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (2016), o. S.; Rudow, B. (2014), S. 41.
79 Vgl. Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege, o. S.; Rimbach, A. (2013), S.49; Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2007), o. S.
80 Vgl. Gutmann, J., Kollig, M. (2005), S. 44; Rudow, B. (2014), S. 38.
81 Vgl. Gerstner, A., Schambortski, H., Wilhelm, M. (2008), S.185.
82 Vgl. Pitteroff, K. (2008), S. 26.
83 Vgl. Gerstner, A., Schambortski, H., Wilhelm, M. (2008), S. 199 ff.
84 Vgl. Pitteroff, K. (2008), S. 26.
85 Vgl. Gerstner, A., Schambortski, H., Wilhelm, M. (2008), S. 185.
86 Vgl. Sochert, R. (2000), S. 47; Vogt, U. (2010), S. 247.
87 Vgl. Meggeneder, O. (2000), S. 50
88 Vgl. Meggeneder, O. (2000), S. 50; Slesina, W. (2000), S. 53; Decker, F., Decker, A. (2015), S. 177.
89 Vgl. Slesina, W. (1996), S. 50.
90 Vgl. Decker, F., Decker, A. (2015), S. , Meggenender, O. (2000), S. 50 f.
91 Vgl. Meggeneder, O. (2000), S. 51; Vogt, U. (2010), S. 248.
92 Vgl. Laireiter, A.-R., Meister, M. (2002), S. 352 f.; Vogt- Akpetou, U. (1999), S. 161
93 Vgl. Meggeneder, O. (2000), S. 51
94 Vgl. Pitteroff, K. (2008), S. 26 f.
95 Vgl. Gerstner, A., Schambortski, H., Wilhelm, M. (2008), S. 201; Wallner, A. (2001), S. 29; Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (1996), S. 80 f.
96 Vgl. Rixgens, P (2010), S. 207.
97 Vgl. Wallner, A. (2001), S. 29. Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (1996), S. 80 f.
98 Vgl. Gerstner, A., Schambortski, H., Wilhelm, M. (2008), S. 202 f.
99 Vgl. Wallner, A. (2001), S. 29. Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (1996), S. 80 f.
100 Vgl. Meggeneder, O. (2000), S. 49.
101 Vgl. Slesina, W. (1996), S. 47 f.; Hesse, G. (2010), S. 265.
102 Vgl. Meggeneder, O. (2000), S. 49.
103 Vgl. Bödeker, W. (2010), S. 239.
104 Vgl. Gerstner, A., Schambortski, H., Wilhelm, M. (2008), S.186.
105 Vgl. Techniker Krankenkasse (2016), o. S.; Gerstner, A., Schambortski, H., Wilhelm, M. (2008), S. 186.
106 Vgl. Gerstner, A., Schambortski, H., Wilhelm, M. (2008), S. 186.
107 Vgl. Gerstner, A., Schambortski, H., Wilhelm, M. (2008), S. 186.
108 Vgl. Pröll, U., Streich, W. (1984), S. 1.
109 Vgl. Koch, V. (2010), S. 4.
110 Vgl. Arbeitskreis ‚Produktivität von DL-Arbeit‘ (2012), S. 1.
111 Arbeitskreis ‚Produktivität von Dienstleistungsarbeit‘ (2012), S. 1.
112 Vgl. Arbeitskreis ‚Produktivität von Dienstleistungsarbeit‘ (2012), S. 1.
113 Vgl. Robert Bosch Stiftung (2001), S. 149; Koch, V. (2010), S. 12 f.
114 Vgl. Landau, K. (1991), S. 1; Höppner, H. (2004), S. 68;
115 Grundböck, A., Nowak, P., Pelikan, J. M. (1997), S. 20.
116 Vgl. Münch, W., Walter, U., Badura, B. (2004), S. 9.
117 Vgl. Höppner, H. (2004), S. 28 f.
118 Vgl. Weinmann, J. (2005), S. 1.
119 Vgl. Spiker, I., Schopf. A. (2007), S. 15 f.
120 Vgl. Deutsches Institut für angewandte Pflegeforschung e.V. (2010), S. 5; Buchberger, B. et al. (2011), S. 19.
121 Vgl. Deutsches Institut für angewandte Pflegeforschung e.V. (2014), S. 18.
122 Vgl. Hasselhorn, H. M. , Müller, B. H. (2005), S. 23.; Glaser, J., Höge. T. (2005), S. 52.
123 Vgl. Spiker, I., Schopf, A. (2007), S. 14 ff.; Schmidt, C. (2013), S. 208 ff.
124 Vgl. Pröll, U., Streich, W. (1984), S. 1; Höppner, H. (2004), S. 31; Schrappe, M. (2005), S. 113 f.
125 Vgl. Sczesny, C. (2007), S. 13 ff.
126 Vgl. Sczesny, C. (2007), S. 13 ff.
127 Vgl. Ärztezeitung (2015), o. S.
128 Vgl. Deutsches Ärzteblatt (2015), o.S.; Verdi (2015), o .S.
129 Vgl. AOK (2015), o..S; Werner, S. (2014), o. S.
130 Vgl. Bundesanstalt für Arbeitsmedizin (1996), S. 86.
131 Vgl. DAK Gesundheit (2015), S. 17 ff.
132 Vgl. Schmidt, K.- H., Neubach, B. (2004), S. 268.
133 Vgl. DAK Gesundheit (2015), S. 17 ff.
134 Vgl. Brandenburg, S. (1994), S. 1; DAK Gesundheit (2015), S. 17 ff.
135 Vgl. Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (2012), S. 4 ff.; Kuhn, S. (1994), S. 60.
136 Vgl. Dieckmann, S. et. al. (2014), S. 11.
137 Vgl. Büssing, A., Perrar, K. M. (1991), S 42 f.
138 Vgl. Dohm, S., Gerstner, A., Schambortski, H., Wilhelm, M. (2008), S. 92.
139 Vgl. Kaluza, G. (2004), S. 25 ff.
140 Vgl. Straßmann, B. (2014), o. S.
141 Vgl. Bischkopf, J, Sonntag, A. (2006), S. 158.
142 Vgl. Welk, I. (2015), S. 103; Quernheim, G. (2010), S. 14.
143 Vgl. Grundböck, A., Nowak, P., Pelikan, J. M. (1997), S. 20.
144 Vgl. Deutsche Krankenhausgesellschaft (2015), S. 1.
145 Vgl. Deutsche Krankenhausgesellschaft (2015), S. 1.; Statistisches Bundesamt (2015), S. 8.
146 Vgl. WHO (1986), S. 1.
147 Vgl. WHO (1986), S. 1; Pelikan, J. M. (1997), S. 31.
148 Vgl. Pelikan, J. M., Nowak, P. (1998), S. 31 f.; Eikamp, J. (2013), S. 10.
149 Vgl. Deutsches Netz Gesundheitsfördernder Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen (2016), o. S.
150 Vgl. Österreichisches Netzwerk Gesundheitsfördernder Krankenhäuser und Gesundheits- einrichtungen (2016), o. S.
151 Vgl. Nowak, P, Lobnig, H., Pelikan, J. M., Karjic, K. (1997), S. 100.
152 Vgl. Garcia- Barbero, M. (1997), S. 14.
153 Vgl. Deutsches Netz Gesundheitsfördernder Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen (2016), o. S.
154 Vgl. Deutsches Netz Gesundheitsfördernder Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen (2016), o. S.
155 Vgl. Deutsches Netz Gesundheitsfördernder Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen (2016), o. S.
156 Vgl. Deutsches Netz Gesundheitsfördernder Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen (2016), o. S.
157 Vgl. Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (2008), S. 3.
158 Vgl. Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (2008), S. 3.
159 Vgl. Löffert, S., Golisch, A. (2013):, S. 76 f.
160 Vgl. Löffert, S., Golisch, A. (2013), S. 76 f.
161 Vgl. Löffert, S., Golisch, A. (2013), S. 100.
162 Vgl. Deutsches Netz Gesundheitsfördernder Krankenhäuser (2010), S.1.
163 Vgl. Dietscher, C., Krajic, K, Pelikan, J. M. (2008), S. 41.
164 Vgl. Deutsches Netz Gesundheitsfördernder Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen (2016). o. S.; Deutsches Netz Gesundheitsfördernder Krankenhäuser (2010), S. 1; Österreichisches Netzwerk Gesundheitsfördernder Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen (2008), S. 10.
165 Vgl. Österreichisches Netzwerk Gesundheitsfördernder Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen (2008), S. 10; Reiter, P. (2011), S. 15.
166 Vgl. Groene, O. (2006), S. 21; Dietscher, C., Krajic, K., Pelikan, J. M. (2008), S. 41.
167 Vgl. Dietscher, C., Krajic, K., Pelikan, J. M. (2008), S. 41.
168 Vgl. Groene, O. (2006), S. 21; Dietscher, C., Krajic, K., Pelikan, J. M. (2008), S. 41.
169 Vgl. Müller, B. (2009), S. 14.
- Arbeit zitieren
- Marina Rüttger (Autor:in), 2016, Betriebliche Gesundheitsförderung im Krankenhaus, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/351033
Kostenlos Autor werden








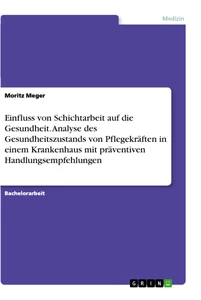











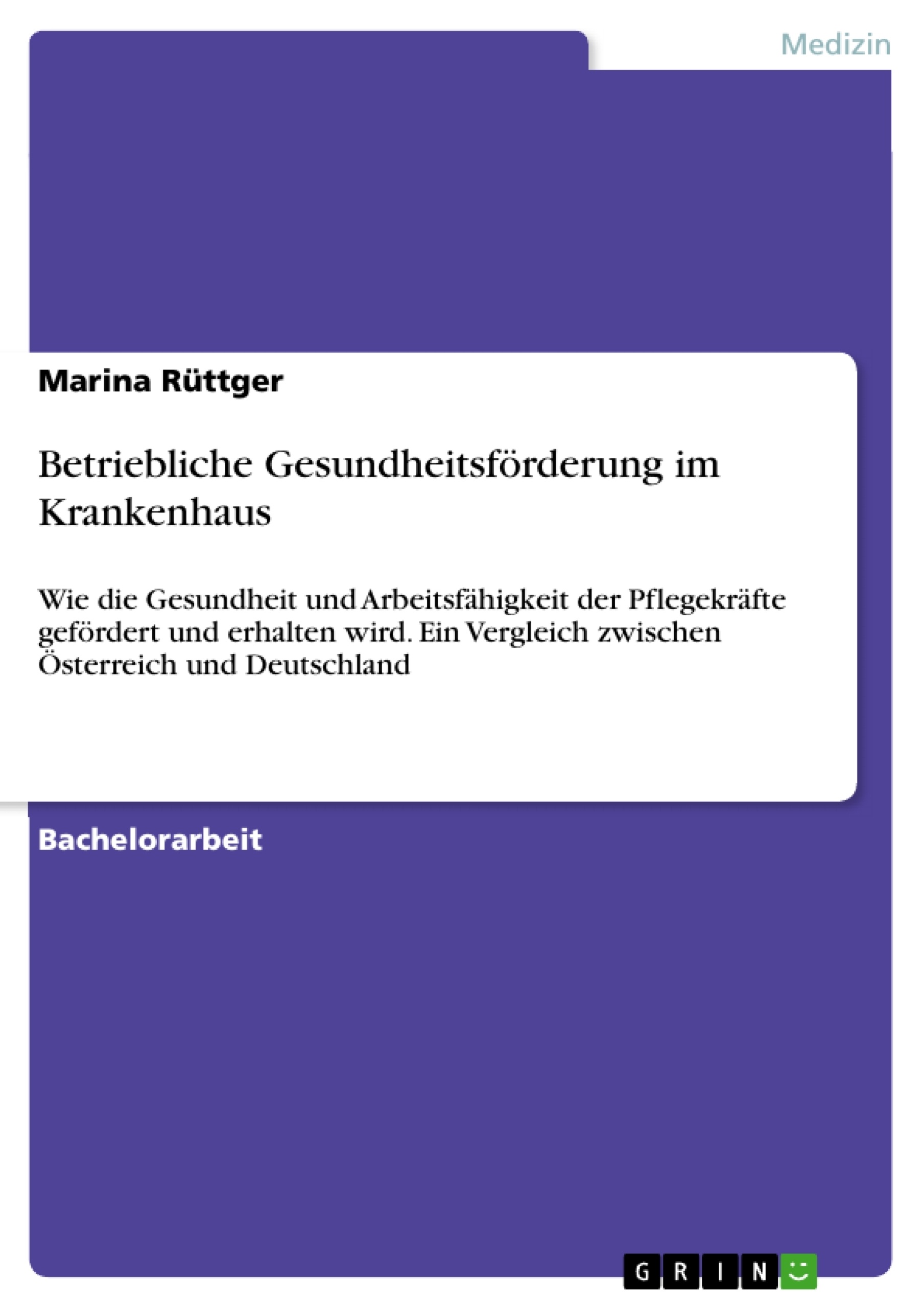

Kommentare