Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
3. Rassismus
3.1 Determinationen von Rassismus
3.2 Rassismus-Theorien
3.2.1 Formen und Ebenen des Rassismus
3.2.1.1 Rassismus und Sprache
3.2.1.2 Sekundärer Rassismus
3.3 Ausländer- und Fremdenfeindlichkeit
3.4 Ursachen von Rassismus
3.5 Strategien gegen Rassismus
3.6 Rassismussensible Perspektive
4. Die Kinder- und Jugendhilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
4.1 Der rechtliche Rahmen
4.1.1 Das Kinder- und Jugendhilfegesetz
4.1.2 Die UN-Kinderrechtskonvention
4.1.3 Das Ausländerrecht
4.2 Die Inobhutnahme als Beginn in der Jugendhilfe
4.2.1 Das Clearingverfahren
4.2.1.1 Die Altersfeststellung
4.2.2 Die Vormundschaft
4.3 Die Heimerziehung im Rahmen der Hilfen zur Erziehung
4.3.1 Monoethnische und Multiethnische Gruppen
4.3.2 Integrierte Gruppenformen
4.4 Sonstige Unterbringungsformen
4.4.1 Asylbewerberaufnahmeeinrichtungen und Wohncontainer
4.5 Hilfen fürjunge Volljährige
4.6 Interkulturelle Kompetenz
4.7 Der Begriff der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlings
5. Schlussbetrachtung und Anregungen
Literaturverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1. Einleitung
Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (im Folgenden: umF) repräsentieren eine vulnerable Gruppe, die in den vergangenen Monaten durch vielfältige Ereignisse auch in den Medien ein großes Aufsehen erhalten hat. Dies bezieht sich zum Beispiel auf die Gefahren des Fluchtweges - insbesondere auf den Mittelmeerweg, bei dem Berichte über ertrunkene Kinder als eine Alltäglichkeit erscheinen. Auch, dass diese nach der überlebten Flucht wenig ausgearbeitete Zugänge zu einem angemessenen Asylverfahren erhalten und nach Ankunft in Deutschland teilweise kläglichen Lebensbedingungen in den von einer guten Infrastruktur abgeschotteten Asylbewerberaufnahmeeinrichtungen ausgesetzt sind, scheint in der Gesellschaft eine bekannte Thematik zu sein. Das Mitgefühl für die besondere Lebenssituation derer steht dabei stets in Konfrontation mit der gesellschaftlichen Unsicherheit und Unruhe, die durch die steigende Anzahl und Relevanz der Flüchtlinge produziert wird. Dies äußert sich häufig in rassistischen Übergriffen, Ausgrenzung, sowie negativer Etikettierung.
Jedoch bleibt dabei die gesetzlich verankerte Kinder- und Jugendhilfe als grundlegende Institution, die sich um die existenzielle Versorgung der umF kümmert, in der Gesellschaft meist unthematisiert. Die Formen der Hilfe und Unterstützung sind insgesamt wenig bekannt. Da die Kinder- und Jugendhilfe ein Feld der Sozialen Arbeit darstellt, das in der Gesellschaft mit Hilfe und Fürsorge in Verbindung gebracht wird, scheint auch das Hinterfragen auf Ablehnung oder gar Rassismus innerhalb dieser in Bezug zu umF nicht als notwendig. Denn auch gerade bezüglich Rassismus ist in Deutschland eine Tabuisierung des Begriffes herauszustellen, was in enger Verbindung zum Nationalsozialismus während des zweiten Weltkriegs gedeutet werden muss. Demnach ist die Forschung zu Rassismus in Deutschland in Bezug auf umF wenig weit ausgeprägt, sodass zumeist ein Fokus auf die Fluchterfahrungen und das Leben im Herkunftsland gelegt wird (vgl. Har- gasser 2014, 123f.). Doch trotz der Umgehung und Abwendung der Thematik um Rassismus ist es nicht zu verleugnen, dass dieser in der deutschen Gesellschaft vorzufinden ist.
Demnach ist es das zentrale Anliegen dieser Arbeit, einerseits die Kinder- und Jugendhilfe im Umgang mit umF in Bezug auf das Aufgabenfeld zu erforschen und andererseits dieses im Hinblick auf Rassismus zu analysieren. Dabei soll herausgefunden werden, ob die Kinder- und Jugendhilfe als Feld der Sozialen Arbeit rassistische Elemente beherbergt und welche Anregungen zum Entgegnen dieser Elemente an die Kinder- und Jugendhilfe gegeben werden können.
Dabei wird es als wichtig erachtet, im Kapitel Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge zuvor einen Einblick auf die aktuelle Situation und das Leben dieser zu geben. Dies erfolgt aus statistischer, rechtlicher und psychosozialer Perspektive und soll weiterhin auch eine Einführung in die Thematik von Flucht generell geben.
Nachfolgend soll das Kapitel Rassismus eine theoretische Grundlage bieten, um bei der späteren Anwendung auf die Praxis ein Verständnis dessen zu haben. Dabei sollen vorerst die Determinationen von Rassismus erläutert werden, welche sich auf die Merkmale, die zum Anlass für Rassismus genommen werden, beziehen. Des Weiteren werden verschiedene Theorien über Rassismus herangezogen, um das breite Spektrum dessen zu verdeutlichen. Nachdem auch eine Abgrenzung zu anderen Begriffen, sowie die Ursachen und Strategien gegen Rassismus dargestellt wurden, wird anhand dieser theoretischen Fundierung eine »rassismussensible Perspektive« entwickelt, mit derer ein Handlungsplan zum Erforschen von Rassismus innerhalb der Praxis der Kinder- und Jugendhilfe erarbeitet wird.
Die Anwendung dessen geschieht dann im Kapitel Die Kinder- und Jugendhilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und soll demnach den erarbeiteten Handlungsplan der »rassismussensiblen Perspektive« auf verschiedene Arbeitsfelder der Kinder- und Jugendhilfe im Umgang mit umF, sowie rechtlichen Bedingungen und weiteren Bezüge einbeziehen. Dabei soll weiterhin auch auf die Situation in Aachen und Nordrhein-Westfalen generell eingegangen werden, um praktische Beispiele darzustellen.
Die Ergebnisse dessen werden schließlich im Kapitel Schlussbetrachtung und Anregungen zusammengefasst, sodass ein Überblick über das Vorkommen von Rassismus innerhalb der Kinder- und Jugendhilfe im Umgang mit umF erhalten werden kann und an diesen Ergebnissen orientiert, Anregungen an das Arbeitsfeld in Bezug auf dem Entgegnen von Rassismus gegeben werden können.
2. Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (im Folgenden: BAMF) fasst generell umF als Personen unter 18 Jahren zusammen, „die ohne Begleitung eines für sie verantwortlichen Erwachsenen in einen Mitgliedsstaat der EU einreisen. Hierzu gehören auch Minderjährige, die nach der Einreise ohne Begleitung zurückgelassen werden“ (BAMF 2012, 27). Dabei wird im Verständnis von umF die Einreise durch eine Flucht bedingt. Diese stellt eine Form der Zwangsmigration dar, bei der es sich um eine nicht freiwillige und ungeplante Entscheidung handelt, das Heimatland zu verlassen. Demnach wird eine Flucht durch äußere Umstände erzwungen (vgl. Hargasser 2014, 18). Die Gründe dafür sind neben Krieg zum Beispiel „Vertreibung, Verfolgung, Missbrauch als Kindersoldat, Arbeitszwang aber auch die Hoffnung auf ein besseres Leben oder die Suche nach Bildungsmöglichkeiten“ (Espenhorst/Berthold 2010, 291). Im Gegensatz dazu ist die freiwillige Migration dadurch gekennzeichnet, dass die Auswanderung aus persönlichen Gründen erfolgt und demnach im Herkunftsland auch keine Gründe existieren, die eine zwanghafte Ausreise bedingen würden (vgl. Zimmermann 2012, 20).
Der mit der Flucht verbundene Begriff des „Flüchtlings“ ist in zwei Weisen zu verstehen. Einerseits im juristischen Sinne zur Beschreibung von Personen, die ein Asylverfahren bereits zum Status eines anerkannten Flüchtlings nach § 16 GG durchlaufen haben. Andererseits auch als Personen, die diesen rechtlichen Status oder einen anderen legalen Aufenthaltsstatus in Deutschland erst anstreben (vgl. Deutscher Caritasverband e.V. 2015). Dabei werden in diesem Kontext beide Weisen mit einbezogen. Zudem hat der Ausdruck „Flüchtling“ in Deutschland in den vergangen Jahrzehnten eine „eher negative Konnotation erhalten. Den so Kategorisierten wird zusammen mit unbegleiteten Minderjährigen häufig Asylmissbrauch unterstellt“ (Hargasser 2014, 53).
Die Anzahl der Flüchtlinge weltweit ist derzeit stetig steigend. Ende des Jahres 2013 waren zum ersten Mal nach dem zweiten Weltkrieg über 50 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht (51,2 Mio.), von denen 50 Prozent Kinder ausmachten (vgl. UNO-Flüchtlingshilfe 2013). Doch auch speziell in Deutschland ist dieser Anstieg deutlich zu bemerken, was die Entwicklungen der Asylzahlen von 2015 des BAMF belegen.
Denn
„Im Berichtsmonat März wurden 28.681 Erstanträge beim Bundesamt verzeichnet. Gegenüber dem Vormonat (Februar: 22.775 Personen) ist die Zahl der Erstanträge um 25,9 % gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahr (März 2014: 9.839 Personen) ist eine Steigerung des Monatswertes um 191,5 % zu verzeichnen“ (BAMF 2015, 5)
Dabei waren im Bereich von Januar bis März 2015 Kosovo mit 21.105 Erstanträgen, Syrien mit 14.711 Erstanträgen und Albanien mit 6.311 Erstanträgen, die am stärksten vertretenen Herkunftsländer der asylbeantragenden Flüchtlinge (vgl. ebd., 5). Die Asylpolitik in Europa ist durch diesen Anstieg auf Reformen angewiesen. Denn die Folgen von Flucht sind ein humanitäres Problem, welches sowohl die Politik, als auch Ökonomie, Medizin und Soziale Arbeit aktivieren sollte, unterstützende und helfende Maßnahmen zu ergreifen. Dabei sind diese derzeit aber stets nur mangelhaft ausgeprägt (vgl. Lutz 2012, 37f.). Zudem lässt sich feststellen, dass vor allem die Grenzen zu Europa immer weiter ausgebaut werden. Demnach schaffen es vergleichsweise immer weniger Flüchtlinge, den Weg nach Europa über die vielfältigen Hürden zu überwinden. Dabei erhält die 2004 gegründete EU Agentur FRONTEX eine Bedeutung, da sie zur Abwehr von Flüchtlingen an den Außengrenzen der EU dient und als Ziel die Minderung der illegalen Einwanderung besitzt (vgl. Löhlein 2010, 30ff.).
Auch die freudige Ankunft in Deutschland darüber, eine bessere Zukunft zu erhalten, wird schnell mit der Erkenntnis getrübt, dass die Aufnahmegesellschaft eher weniger einladend agiert, so dass viele vielfältige Barrieren vorerst bekämpft werden müssen, was ein verstärktes Gefühl von Fremdheit hervorrufen kann. In Deutschland kann beispielsweise festgestellt werden, dass die Mehrheit der Flüchtlinge, die Asyl suchen, einen unsicheren Aufenthaltsstatus in Form einer Duldung oder Aufenthaltsgestattung erhalten, mit dem einschränkende Maßnahmen einhergehen, die gerade bei umF Hilflosigkeit und Zukunftsängste auslösen und zusätzliche traumatisierende Faktoren darstellen (vgl. Hargasser 2014, 113ff.). Auch Flüchtlinge, die noch im Asylverfahren sind oder bereits abgelehnt wurden, unterliegen bedeutsamen rechtlichen und sozialen Einschränkungen, die zur Abschreckung dienen sollen (vgl. Wirtgen u.a. 2010, 110). Gerade auf umF bezogen lässt sich feststellen, dass insgesamt in den Jahren 2011 und 2012 nur 16 umF in Deutschland den vollen Flüchtlingsstatus nach § 16 GG erhielten und im Jahr 2011 sogar von einer Ablehnung der Asylanträge von umF mit ca. 54% und 2012 ca. 51,4 % auszugehen ist (vgl. ebd., 43). Jedoch ist die Datenlage speziell für umF in Deutschland wenig zufriedenstellend, da das Ausländerzentralregister (AZR) zwar Informationen über das Alter derer erhält, jedoch nicht über familiäre Verbindungen. Demnach kann keine genaue Aussage darüber getroffen werden, wie viele umF genau in Deutschland leben (vgl. DCV 2014, 19).
Zudem wird in den Mitgliedsländern der EU mit umF sehr unterschiedlich umgegangen. Selbst in Deutschland ist dies der Fall, da einige Bundesländer und Kommunen eine hohe Sensibilität für die Lebenslage dieser hegen - andere diese jedoch in kaum einer Weise umsetzen (vgl. ebd., 8). Zwar erhalten umF mit dem Aufenthalt in Deutschland besondere Unterstützung durch die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe im Rahmen des SGB VIII uneingeschränkt bis zum 18. Lebensjahr - wohingegen erwachsenen Flüchtlingen Leistungen des Asylbewerberleistungsgesetz gewährt werden - jedoch gewährleisten diese nicht den vollen Schutz der umF (vgl. Schwarz/Tamm 2010, 38). Denn trotz der sozialen Unterstützungsinstitution der Kinder- und Jugendhilfe kann festgestellt werden, dass das Leben der umF in Deutschland von „Armut, mangelhafter Gesundheitsversorgung, erzwungener Untätigkeit, Schutzlosigkeit, Verlust von Handlungsspielräumen und gesellschaftlicher Ausgrenzung geprägt ist“ (Hargasser 2014, 124). Zudem müssen sie Verfahren durchlaufen, in denen ihre Aussagen nicht geglaubt und respektiert werden und sie sich dabei außerdem entwürdigenden Untersuchungen unterwerfen müssen (vgl. Kauffmann 2010, 48). Diese Verhältnisse haben ein besonders hohes Ausmaß auf umF, da sie in einer Lebensphase sind, in der die Persönlichkeitsentwicklung noch nicht abgeschlossen ist und sie sich biologisch und psychisch noch weiterentwickeln müssen (vgl. Hargasser 2014, 9).
Die mangelnde Datenlage bezüglich umF wirkt sich auch darauf aus, dass nicht erfasst ist, wie viele umF momentan Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe erhalten, welche Institutionen mit welchen Konzepten im Umgang mit umF arbeiten und welche Erfahrungen diesbezüglich bereits gemacht wurden. Denn auch durch die heterogenen Herkunftsländer scheint eine Standardisierung der Umgangsweisen kaum möglich (vgl. Brinks u.a. 2014, 301). Damit verbunden ist auch, dass es kaum Erkenntnisse darüber gibt, welche Handlungsmöglichkeiten die Soziale Arbeit innerhalb der Jugendhilfe zu umF überhaupt hat und welche als sinnvoll erscheinen (vgl. Stauf 2012, 64).
Doch nicht nur innerhalb der Kinder- und Jugendhilfe zu umF sind Studien und Daten mangelhaft. Auch in Bezug zu Rassismus gibt es kaum Anhaltspunkte zu umF, obwohl diese in Deutschland in erster Linie als Fremde betrachtet werden und demnach eine besonders vulnerable Gruppe für Rassismus darstellen. Trotzdem ist auffallend, dass dieser in Studien kaum erwähnt wird, obwohl er gerade für umF in Bezug auf aufenthaltsrechtliche Bestimmungen einen hohen Einfluss auf das psychosoziale Leben derer, sowie auch auf Zugänge zur Gesellschaft hat. Demnach sind auch Institutionen und ihre Mitarbeiterinnen in Rassismusbezügen kaum untersucht (vgl. Hargasser 2014, 116). Zudem wird im Zusammenhang mit umF immer wieder auf eine geforderte Integration angesprochen. Dabei setzt diese bereits eine integrationsfreundliche Gesellschaft und Gesetze voraus, in denen kein Rassismus vorherrscht. Demnach kann Integration auch nur dann ohne Diskriminierung funktionieren, wenn Integration nicht einseitig als Anpassung der umF an eine vermeintliche deutsche „Leitkultur“ geschieht (vgl. Kauffmann 2010, 40).
Bereits diese Sachverhalte lassen vermuten, dass der Stand von umF in Deutschland und auch in der Kinder- und Jugendhilfe niedrig und von Benachteiligungen geprägt ist. Demnach soll das Zusammenspiel dessen mit Rassismus untersucht werden. Umjedoch eine genauere Vorstellung von Rassismus erhalten zu können, wird dieser nachfolgend theoretisch fundiert.
3. Rassismus
Durch das thematisierte vorherrschende Abwenden und Verschweigen von Rassismus in der Gesellschaft und dem erläuterten benachteiligten Stand von umF in Deutschland, wird es als wichtig erachtet, vorerst überhaupt zu erläutern, was Rassismus ist und somit in verschiedenen Zusammenhängen zu beleuchten. Dabei werden Rassismus-Theorien dargestellt und auf verschiedenen Ebenen und in diversen Formen erklärt. Zudem wird auf die Ursachen von und Strategien gegen Rassismus eingegangen, sodass aus diesen theoretischen Fundierungen anschließend die für die weiteren Ausführungen relevante »rassismussensible Perspektive« herausgearbeitet werden kann.
3.1 Die Determinationen von Rassismus
Da es über Rassismus viele verschiedene Theorien gibt, ist es für die Definition dessen vorerst bedeutsam herauszustellen, welche Merkmale es gibt, die zu einer bewerteten Unterscheidung von Menschen und somit zu Rassismus veranlassen. Dabei gibt es verschiedene Ansätze, die diese Merkmale eng oder weit fassen.
Eng gefasst würde sich Rassismus nur auf bewertete Unterschiede zwischen Rassen beziehen, wobei diese erste Determination bereits im Begriff des Rassismus selbst liegt. Dabei haben die Wurzeln des Wortes Rasse ihren Ursprung im späten Mittelalter, obwohl der Begriff des Rassismus erst im 20. Jahrhundert auftauchte (vgl. Zerger 1997, 13). Der Rasse-Begriff ist bereits mit verschiedenen Theorien und Verständnissen verbunden. Miles (2000, 17ff.) zeigt diesen in drei verschiedenen Zusammenhängen auf. Einerseits den Rasse-Begriff in der Biologie (v.a. in der Genforschung) und in den Sozialwissenschaften. Andererseits in der Umgangssprache als Schlüsselelement des Alltagsverstandes. Im biologischen Zusammenhang werden Menschen bzw. Gruppen in Rassen aufgrund phänotypischer und physiologischer Merkmale unterschieden. Dies kann sich auf die Haut- und Haarfarbe, Lippengröße oder der Form und Größe von Nase, Schädel etc. beziehen. Die Sozialwissenschaften gehen dabei - wie auch Miles - davon aus, dass es sich um eine soziale Konstruktion der Wirklichkeit bei der Definition von Gruppen aufgrund phänotypischer und physiologischer Merkmale als Rassen handelt und demnach diese sozial imaginierte Konstruktionen und keine biologischen Realitäten darstellen (vgl. ebd., 17ff.). Dem fugt Mecheril (2004, 188) hinzu, dass dieser Konstruktionsvorgang in Abhängigkeit der Interessen der Politik und Administration steht. Der Zusammenhang zur von Miles angebrachten Sprache wird nachfolgend (vgl. 3.2.1.1) noch erläutert.
Die biologische Determination der Rasse ist heute etliche Male widerlegt. Für den Rassen-Theoretiker Hall (2000, 7) gibt es beispielsweise keine wissenschaftlich belegte hierarchische Unterteilung der Menschheit in biologisch unterscheidbare Rassen, was für ihn jedoch nicht bedeutet, dass es keine phänotypischen Unterschiede zwischen Menschen gibt.
Die UNESCO versuchte im Jahr 1949 beispielsweise unter dem Einfluss der nationalsozialistischen Rasse-Politik, die biologische Determination durch den Vorschlag, den Rasse-Begriff mit dem Begriff der „ethnischen Gruppen“ zu ersetzen, ganz abzuschaffen. Damit sollte ein soziologisches bzw. kulturelles Konzept zur Begegnung der unbestreitbaren Vielfalt von Menschen entstehen (vgl. Palm 2010, 354). Miles (2000, 18f.) hingegen bezieht sich noch auf die biologische Determination, stützt sichjedoch darauf, dass die durch phänotypischen Merkmale unterschiedenen Menschen weitere kulturelle Merkmale besitzen, sodass Rasse eine Determination durch biologische und kulturelle Charakteristika erhält.
Demnach wird deutlich, dass auch Kultur und Ethnie als Determinationen möglich sind, die ein weiter gefasstes Verständnis von Rassismus mit einschließen.
Bei der Determination der Rasse auf kulturelle Merkmale werden nicht biologische, sondern auch kulturelle Unterschiede in Form von „Mentalität, Denk- oder Handlungsweisen, die mit der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Kultur als feststehend und unveränderbar imaginiert werden“ (Hornscheidt/Nduka-Agwu 2010, 13) unterstellt. Dabei wird meist von einem kritisch zu betrachtenden statischen Kulturbegriff ausgegangen. Denn da Kultur festlegt, was dazu gehört oder eben nicht, werden dynamische, differenzierte Wandlungsprozesse kaum berücksichtigt. Daraus kann die Vorstellung entstehen, dass es Kulturen gebe, die nicht zusammenpassen und sich in einer Gesellschaft nicht gemeinsam etablieren könnten. Dabei werden dann kulturelle Symbole zu Symbolen des Nicht-Dazugehörens gedeutet (vgl. Arndt 2012, 28f). Dieser statische Kulturbegriff beschreibt Kultur demnach in sich geschlossen und wird als unveränderlich betrachtet. Lévi-Strauss gehtjedoch davon aus, dass die Vielfalt von Kulturen „viel größer und reicher als alles, was zu kennen uns je vergönnt sein wird“ (1972, 12) ist und demnach Kultur kein statischer, sondern ein dynamischer Begriff ist. Er streitet zwar durch die geographischen Entfernungen und bedeutenden Eigenarten des Umfelds nicht ab, dass Menschen unterschiedliche Kulturen hervorgebracht haben, jedoch würde dies nur dann ganz zutreffen, wenn sich jede Kultur isoliert voneinander entwickelt hätte. Seiner Ansicht nach darf die Verschiedenheit der Kulturen nicht gespaltet betrachtet werden, da diese auch in Beziehung zueinander stehen (vgl. ebd., 15). Trotzdem greifen die Rassismus-Theorien auf einen statischen Kulturbegriff zurück, um Begründungszusammenhänge für Handlungen zwischen verschiedenen Gruppen leichter erklären zu können (vgl. Eppenstein/Kiesel 2008, 70). Diese Erweiterung des Rasse-Begriffs auf kulturelle Merkmale fasst Balibar (2000, 110) unter dem Begriff des »Neo-Rassismus« oder »Rassismus ohne Rassen« zusammen. Demnach wird an die Stelle der Rasse in Bezug auf die Biologie, das Konzept der Kultur gestellt.
Darauf nimmt auch Terkessidis, der in die selbe Richtung wie Miles argumentiert, Bezug. Dass die Unterschiede nicht mehr am Menschen, sondern an kulturellen Umgangsformen festgemacht werden, bedeutet für ihn nämlich „keineswegs das Verschwinden von biologischen Erklärungen. Entstehung, Abgrenzung und Überleben von Kulturen können durchaus biologisch“ (1998, 228) determiniert verstanden werden. Dem schließt sich auch Mecheril (2004, 192) an, da für ihn diese „alten“ biologischen und „neuen“ kulturellen Unterscheidungskriterien heute in Formen des Rassismus vermischt und parallel existieren.
Auch die Determination des Rassismus auf Ethnien bezieht sich auf ein statisches Verständnis. Dabei wird der Begriff „ethnisch“ im alltäglichen Sprachgebrauch oft mit „anders“ gleichgesetzt. Unterstellungen ethnischer Merkmale beruhen dabei immer auf einer Reduktion der Menschen, was sich auf das Herkunftsland, die Hautfarbe, Religion oder auch Kultur beziehen kann (vgl. Spindler 2006, 60). Da dies die Annahme mit einschließt, dass es „homogene Kulturräume mit einer einheitlichen (genetisch definierten) Abstammung, Geschichte, Religion und Sprache“ (Arndt 2012, 632) gebe, lässt dies wiederum keine dynamischen Übergänge zu, sondern stellt ein Instrument zur Erzeugung von statischer Differenz dar.
Bereits der deutsche Nationenbegriff beruht auf der Vorstellung einer ethnisch und kulturell homogenen Gesellschaft. Dabei wird diese deutsche Selbstzuschreibung durch die Anwesenheit von Ausländerinnen/Flüchtlingen in Frage gestellt (vgl. Winter 2004, 15). Die Thematisierung von Kultur wird zumeist auf die Herkunftkultur bezogen, „in denen „Die Deutschen“ oder „Die Ausländer“ bzw. einzelne national, religiös oder sprachliche identifizierbare Gruppen als „So-Seiende“ kulturell codiert und auf entsprechende Eigenschaften festgelegt werden“ (Eppen- stein/Kiesel 2008, 70). Daraus entstehen demnach natio-ethno-kulturelle Zugehörigkeiten, die auf nicht zu veränderbaren Merkmalen festgeschrieben werden, die Differenz betonen (vgl. ebd., 83). Denn anlehnend an Mecheril (2004, 22) wird bei der Vorstellung von Deutschen, Ausländerinnen oder auch Flüchtlingen meistens nicht nur abgegrenzt von Unterschieden der Kultur, Herkunft (Nation) oder Ethnizität gesprochen, sondern von einem Zusammenspiel derer.
Diese natio-ethno-kulturelle Determination verweist auf eine hierarchische Ordnung in Bezug auf die Zugehörigkeit, „die in privilegierte, als deutsch (oder die Staatsangehörigkeit des jeweiligen Landes) [...] geltende Zugehörige auf der einen Seite und in benachteiligte oder ausgegrenzte [...] nicht deutsch geltende“ (Melter 2012, 18)unterscheidet.
Noch weiter gefasst können auch die sexuelle Orientierung, sowie das Geschlecht, eine Behinderung oder das Alter als Grundlage für Rassismus betrachtet werden, was in diesem Kontext aber weniger berücksichtigt wird (vgl. Graupner 2012, 32).
Zusammenfassend kann sich Rassismus demnach auf die Abwertung einer Gruppe von Menschen herangezogen an vermeintlichen Unterschieden rassischer, kultureller, ethnischer oder natio-ethno-kultureller Zuschreibungen beziehen. Aus diesem Grund werden im weiteren Verlauf bei einer rassischen Unterscheidung auch die weiteren Determinationen mit einbezogen. Diese Determinationen fasst Zerger (1997, 28) als Nutzen für ein Klassifikationsschema zur Einteilung der Menschheit zusammen, um die Welt zu ordnen, berechenbar und beherrschbar zu machen.
3.2 Rassismus-Theorien
Die zuvor benannten Determinationen, in denen es um bewertete Differenzen im Wesentlichen geht, sind die Grundlagen für Rassismus. Da diese jedoch bereits mit verschiedenen Theorien behaftet sind, wird verständlich, dass auch die Definition des Rassismus aufgrund seiner Vielschichtigkeit schwierig ist. Dies liegt auch an der Tatsache, dass sich die Vorstellungen darüberje nach historischem Kontext ändern. Diese historische Festlegung des Rassismus bezieht auch Hall ein, der davon ausgeht, dass Rassismus
„historisch spezifisch ist, je nach der bestimmten Epoche, nach der bestimmten Kultur, nach der bestimmten Gesellschaftsform [...]. Wenn wir über konkrete gesellschaftliche Realität sprechen, sollten wir also nicht von Rassismus, sondern von Rassismen sprechen“ (2000, 11).
Für ihn hat der rassistische Diskurs eine eigentümliche Struktur, da er zwei binär entgegengesetzte Gruppen konstruiert. Die Gruppe, welche rassistisch ausgeschlossen wird, weist dann das Gegenteil der Tugenden auf, welche die Mehrheitsgesellschaft auszeichnet. Demnach geht er z.B. davon aus, dass wenn »Wir« rational und kultiviert sind, die »Ausgeschlossenen« irrational und primitiv sein müssten. Genau diese Spaltung in binäre Gegensätze ist für ihn das Entscheidende beim Rassismus, wobei eine konstruierte Differenz geschaffen wird (vgl. ebd., 14). Auch Mecheril bezieht diese konstruierte Differenz mit ein, da für ihn Rassismus eine Praxis ist, „die von einem symbolischen Schema der hierarchischen oppositionellen Unterscheidung [zwischen »Uns« und den »Anderen«] getragen wird und mit Mitteln verknüpft ist, diese Unterscheidungen praktisch wirksam werden zu lassen“ (2004, 187).
Nach Miles (2000, 24ff.) unterscheiden sich Rassismen durch die verschiedenen Gruppen als Objekte des Rassismus, den Differenzen zwischen diesen und den einer Gruppe zugeschriebenen Merkmalen. Dabei wird die Abwertung der »Anderen« immer durch die vermeintlichen Unterschiede (rassisch, ethnisch, kulturell oder natio-ethno-kulturell) legitimiert. Demzufolge tritt Rassismus bereits auch als weniger zusammenhängende konstruierte Sammlung von Stereotypen, Vorurteilen und Zuschreibungen auf.
Darüber hinaus sind die Ausschließungspraxen, welche in fast jeder RassismusTheorie aufgefasst werden, ein bedeutender Teil von Rassismus. Für Miles (2000, 23) bedeuten diese die Benachteiligung einer bestimmten Gruppe von Ressourcen und Dienstleistungen in einer Gesellschaft. Da diesen Ungleichheiten Prozesse zur Unterscheidung zwischen Menschen über ihren Wert und ihrer Berechtigung vorausgehen müssen - was eine Differenz impliziert - können demnach begrenzte Ressourcen als Ausgangspunkt für Rassismus betrachtet werden. Rassistische Ausschließungspraxen beziehen sich demnach nach Miles zusammenfassend auf vorsätzlich geschaffte Strukturen der Ungleichheit zwischen »Uns« und den »Anderen«. Dies konkretisiert Hall (2000, 14) weiterhin noch damit, dass diese Ausschließungspraxen nicht nur dazu dienen würden, bestimmten Gruppen Zugänge zu materiellen und kulturellen Ressourcen zu verhindern, sondern diese auch symbolisch aus der Gemeinschaft der Nation auszuschließen. Auch Osterkamp (2000, 60) bezieht sich auf Ausschließungspraxen in Bezug zu Rassismus, indem sie die Ausgrenzung bestimmter Gruppen nicht primär auf ihre Fremdartigkeit bezieht, sondern diese für sie dazu benutzt werden, um die eigenen Chancen an der Beteiligung zu sichern.
Mit den Ausschließungspraxen ist auch der Rassismus als Ideologie verbunden. Denn für Hall entstehen beispielsweise rassistische Ideologien „immer dann, wenn die Produktion von Bedeutungen mit Machtstrategien verknüpft sind und diese dazu dienen, bestimmte Gruppen vom Zugang zu kulturellen und symbolischen Ressourcen auszuschließen“ (2000, 7). Auch Zerger (1997, 169) definiert Rassismus als eine ideologische Erscheinung, die gesellschaftsstrukturell als eine Erscheinung von Ein- und Ausgrenzung auftritt und eine wichtige identitätsstiftende Funktion auf individueller und gesellschaftlicher Ebene einnimmt. Für ihn ist auch der Machtaspekt von großer Bedeutung, der bei den Ausschließungspraxen hinzugenommen werden muss. Demnach stellt Rassismus für ihn zusammenfassend
„nicht nur eine Legitimationsstrategie für eine bestimmte Form der Machtausübung in Strukturen sozialer Ungleichheit dar, sondern kann allgemeiner auf ideologische Formen angewendet werden, deren machtabhängige Wirksamkeit im konkreten Einzelfall untersucht werden muß“ (ebd., 83).
Für Miles (2000, 24) ist Rassismus als Ideologie durch folgenden Gehalt bestimmt: Einerseits, dass bestimmte biologische Merkmale eine Bedeutung erhalten, die dadurch zum Erkennungs-Merkmal verschiedener Gruppen werden, bei denen der Status und die Herkunft so als faktisch und nicht veränderbar dargestellt werden. Andererseits, dass die dargestellte Gruppe auch weitere bewertete biologische und kulturelle Merkmale beinhalten muss und demnach so dargestellt wird, als würde dies negative Folgen für andere nach sich ziehen.
Auch Efferding betrachtet den Rassismus als eine Ideologie, die dann wichtig wird, „wenn gesellschaftliche Probleme auftreten, für deren Lösung die Menschen auf derselben Ebene keine Lösung haben“ (2000, 43).
Dabei sind die zwei wichtigsten Ideologien, die mit dem Rassismus verknüpft sind, der Sexismus (Unterschiede des Geschlechts) und der Nationalismus (Unterschiede zwischen Nationalstaaten), da auch diese beiden auf Grundlage einer Bedeutungskonstitution entstehen und demnach als Argument für Ausschließungspraxen benutzt werden können (vgl. Miles 2000, 30).
Die Rassismusdefinition von Memmi gilt als die klassische und wird häufig als die Grundlegende eingestuft. Dabei versteht er Rassismus als die „verallgemeinerte und verabsolutierte Wertung tatsächlicher oder fiktiver Unterschiede zum Nutzen des Anklägers und zum Schaden seines Opfers, mit der seine Privilegien oder seine Aggressionen gerechtfertigt werden sollen“ (1992, 100). Demnach bezieht er noch eine andere Sichtweise mit ein, da Rassismus für ihn eine Form von Aggression darstellt und die Angst für ihn im Vordergrund steht, eigene Ressourcen zu verlieren, was zur Verteidigung von Vorteilen führt (vgl. ebd., 106).
3.2.1 Formen und Ebenen des Rassismus
Rassismus kann in verschiedenen Formen auf unterschiedlichen Ebenen auftreten. Einerseits in der Gesellschaft auf der institutionellen und strukturellen Ebene. Dabei beschreibt Osterkamp (1997, 95) institutionellen Rassismus damit, dass Handlungen und Denkmuster nicht nur eine Angelegenheit von einzelnen Haltungen von Individuen sind, sondern im Geflecht des ganzen gesellschaftlichen Zusammenlebens existieren, dass die Zugehörigen der eigenen Gruppe geplant und strukturiert gegenüber der Nicht-zugehörigen Gruppe bevorzugt.
Dies kann bereits auf die vorher dargestellten Ausschließungspraxen übertragen werden. Miles (2000, 27) konkretisiert institutionellen Rassismus damit, dass dieser vorherrscht, wenn durch einen rassistischen Diskurs Ausschließungspraxen entstanden sind, die diesen zwar voraussetzen, jedoch nicht mehr explizit mit diesem gerechtfertigt werden. Andererseits auch dann, wenn ein ausdrücklicher rassistischer Diskurs so modifiziert wurde, dass der offene rassistische Gehalt durch andere Worte eliminiert wurde, aber der eigentliche Sinn weiter transportiert wird. Bei beiden Formen wird der rassistische Diskurs nicht ausgesprochen, aber bleibt in den Ausschließungspraxen enthalten. Demnach bezieht sich institutioneller Rassismus nach Miles nur dann auf Ausschließungspraxen, wenn diese durch einen nun nicht mehr existierenden rassistischen Diskurs begründet oder angekurbelt wurden und daher diese Praxen institutionalisiert wurden.
Terkessidis (1998, 210ff.) nimmt zur Beschreibung des institutionellen Rassismus die Kultur hinzu, da dieser davon ausgeht, dass innerhalb einer Kultur die Einheit der Institutionen erklärt und legitimiert werden würden. Dabei dürfen die »Anderen« ihren Platz darin nicht finden. Denn zum Einen richtet Kultur allerorts informelle Grenzen zwischen »Uns« und den »Anderen« auf. Zum Anderen werden die »Anderen« Teil dieser Sinneswelt durch konstruierte Abweichung. Für ihn bezieht sich dies auf sogenannten Ausschluss durch Einbeziehung in die Gesellschaft, welchem die Aufrechterhaltung der Differenz zu Teil wird. Daher sind die vielen Orte, in denen Differenz hervorgebracht wird, nicht Ergebnis einer zentralen Instanz, sondern werden durch uneinheitliche institutionelle Ensembles, welche den Menschen verschiedenartige Handlungsalternativen verwehren, gebildet.
Für Mecheril (2004, 197f.) weist der Mechanismus des institutionellen Rassismus darauf hin, dass zwischen bestimmten Gruppen auf benachteiligender Art unterschieden wird, welche den Institutionen genügt und demnach diese nicht auf rassistische Denkmuster von einzelnen Individuen angewiesen sind. Denn die Institutionen wirken als ein Rahmen, in dem Rassismus ausgeübt werden kann und deren Strukturen rassistische Denkmuster in individuelles Tun leicht transformieren können.
Auf der strukturellen Ebene zeigt sich Rassismus gerade dann, wenn er unbewusst ist. Demnach empfinden durch Rassismus Privilegierte diesen oftmals als Normalität, da er unauffällig und angenommen ist (vgl. Hornscheidt/Nduka-Agwu 2010, 35). Dies betrifft beispielsweisejene Formen von Rassismus, „die die Betroffenen nicht direkt verbal oder körperlich, sondern aufgrund behördlicher Maßnahmen (Willkür, Vereitelungen von Rechten, Unterlassungen von Hilfeleistungen u.ä.m.) diskriminieren“ (Beckmann 1997, 214).
Außerdem kann Rassismus auf der Ebene der Individuen agieren. Individueller Rassismus kann auch als interaktiver Rassismus auf der Mikroebene betrachtet werden. Nach Zerger (1997, 88) steht dieser im gesellschaftlichen Kontext in enger Verbindung zum ideologischen Rassismus und dem makrostrukturellen Phänomen des institutionellem Rassismus. Er geht von individuellen Personen aus und zeigt sich durch rassistische Diskriminierungen in Bezug auf „Erniedrigungen, Verächtlichmachung, Bedrohung, Beleidigung und Beschimpfung wie sie alltäglich auf der Straße, im öffentlichen Personenverkehr, in der Schule, im Woh- numfeld [...] und in besonderer Weise das Lebensgefühl“ (Berger 2002, 41) von rassistisch Diskriminierten, beeinträchtigen. Durch den Bezug zum Alltäglichen wird der individuelle Rassismus oft auch als Synonym des Alltagsrassismus benutzt. Dieser bezeichnet die Gesamtheit von Vorurteilen, Stereotypen und negativen Denkmustern, sowie diskriminierende Handlungen gegen rassisch, ethnisch, kulturell oder natio-ethno-kulturell unterschiedenen Gruppen. Die Elemente des rassistischen Diskurs, welche auf der ideologischen Ebene produziert werden, treffen dabei mit den spezifischen Wahrnehmungen im Alltag einzelner Menschen zusammen (vgl. Zerger 1997, 88). Dabei besagt Leiprecht (2001, 2), dass der Begriff des Alltagsrassismus darauf aufmerksam macht, dass es auch alltägliche und einfache, aber mit weitreichenden Konsequenzen verbundene Konstruktionen von »Uns« und den »Anderen« gibt. Diese kennzeichnen die in der Mehrheitsgesellschaft alltäglichen Rassismen, welche „subtil, unauffällig, verdeckt und latent sein können“ (ebd.). Dabei handelt es sich nicht zwangsläufig um bewusst gewollte Prozesse, sondern vielfach auch um Handlungen innerhalb bestimmter Strukturen, die unbewusste rassistische Konsequenzen nach sich ziehen (vgl. ebd.).
3.2.1.1 Rassismus und Sprache
Bereits zu Anfang wurde unter Berücksichtigung von Miles (2000) auf die Sprache in Bezug zum Rasse-Begriff hingewiesen (vgl. 3.1). Den Zusammenhang dessen formulieren Horscheidt und Nduka-Agwu treffend, da in ihrer Definition »Rassen« nicht ohne rassistische Zuschreibungen und Konstruktionen existieren und diese demnach „eine v.a. über sprachliche und visuelle soziale Handlungen geschaffene und immer wieder re_Produzierte Form der bewerteten Klassifizierung von Personen“ (2010, 13) darstellen. Auch für Zerger (1997, 170) ist Sprache eine der wichtigsten Komponenten, um Rassismus zu reproduzieren. Dies bezieht sich nicht nur auf die medial vermittelte gesellschaftliche Kommunikation, sondern vor allem auch auf Alltagsgespräche.
Sprache lässt sich in verschiedenen Dimensionen ausdrücken. Sowohl als direktes Ansprechen eines Interaktionspartners oder beim Sprechen oder Schreiben über etwas, dass sich auf Personen oder Sachen beziehen kann und für sich selbst oder größere Gruppen gedacht ist. Auch wenn sich Kommunizierende nicht darüber bewusst sind, impliziertjede Sprachsituation ein Handeln, da somit immer eine Vorstellung über die Realität konstruiert wird. Nach Hornscheidt und Nduka-Agwu (2010, 29f.) reproduziert Sprache normalisiertes Wissen, was bedeutet, dass über das sprachlich erzeugte Wissen Identitäten aufgerufen, reproduziert und verändert werden. Demnach schaffen sprachliche Bezeichnungen durch ihre Konstruktionen Vorstellungen über Identitäten. Durch die dauernde Benutzung von bestimmten Bezeichnungen wird daher immer eine Auswahl, die von Stereotypen und Zuschreibungen, sowie machtvollen Bildern geprägt ist, getroffen. Demnach ist Sprache dazu fähig »Andere« rassistisch zu diskriminieren, indem sie die Angesprochenen sprachlich nicht so erstellt, wie „sie es sich wünschen bzw. sie sich durch die Wortwahl ignoriert, ausgeschlossen oder herausgehoben und negativ bewertet fühlen“ (ebd., 30). Um herauszufiltern, wann ein Sprachgebrauch rassistisch ist, müssen stets die Macht- und Sprechpositionen reflektiert werden. Dabei ist es weiterhin bedeutsam, die gesellschaftlichen Kontexte kritisch mit einzubeziehen (vgl. ebd., 34). Ein Beispiel zum Zusammenhang zwischen Rassismus und Sprache bezieht sich darauf, MigrantInnen als Ausländerinnen zu titulieren, da damit impliziert wird, dass diese nicht zugehörig, sondern ausgeschlossen sind (vgl. Winter 2004, 24).
Eine bedeutende Tatsache ist auch, dass Rassismus nicht erst dann auftritt, wenn er von den rassistisch Diskriminierten durch Sprache so bezeichnet wird. Denn Rassismus kann sich bereits in Form von Ignoranz in Bezug auf ein Nicht-Hinse- hen/-Hören, (Ver-)Schweigen und Verhehlen von Privilegierten äußern (vgl. Horn- scheidt/Nduka-Agwu 2010, 39).
3.2.1.2 Sekundärer Rassismus
Anschließend an den zuvor benannten Rassismus durch Ignoranz und Nichtbeach- ten kann der Begriff des sekundären Rassismus nach Melter (2007, 120) angebracht werden. Diesen definiert er als Verleugnen und Herabschwächen von Rassismus, was mit einer Verantwortungsdelegation an die rassistisch Diskriminierten verbunden ist. Nach Melter werden dabei keine offenen Abwertungen getätigt, jedoch ist für ihn die fehlende Verantwortungsübernahme für institutionellen, strukturellen und individuellen Rassismus, ein Anzeichen für sekundären Rassismus. Demnach wird die Bedeutsamkeit von Rassismuserfahrungen kaum beachtet, so- dass sich mit dem Thema nicht aktiv auseinandergesetzt wird. Somit tritt sekundärer Rassismus zusammenfassend dann auf, wenn Rassismus nicht thematisiert „in seiner Alltäglichkeit und institutionellen Verankerung nicht wahrgenommen, individualisiert, naturalisiert, pathologisiert oder als quasi unumgängliche Folge der allgemeinen wirtschaftlichen Rezession dargestellt“ (ebd.) wird.
Den sekundären Rassismus seitens PädagogInnen als Haltung beschreibt Melter unter mehreren Gesichtspunkten:
- „die Abwehrhaltung gegenüber der Möglichkeit, dass Formen von Alltagsrassismus aktuell im konkreten Lebensumfeld des Jugendlichen bedeutsam sein könnten bzw. bedeutsam sind;
- das Negieren, dass es sich bei bestimmten Ereignissen und Konstellationen, mit denen die Jugendlichen konfrontiert sind, um Rassismus gehandelt haben könnte;
- das Bestreiten der Notwendigkeit, mit den Jugendlichen über Rassismuserfahrungen und Zugehörigkeitsfragen zu kommunizieren;
- das Leugnen der eigenen professionellen Verantwortung, sich mit Formen des alltäglichen Rassismus auseinander zu setzen“ (ebd., 123).
3.3 Ausländer- und Fremdenfeindlichkeit
Betrachtet man den Rassismus in der heutigen deutschen Gesellschaft, ist auffallend, dass dieser wörtlich im Alltag kaum eingesetzt wird. Um rassistische Diskriminierungen zu thematisieren, wird meist von „Ausländerfeindlichkeit“ oder „Fremdenfeindlichkeit“ gesprochen. Diese unterscheiden sichjedoch zum Rassismus durch ihre verschiedenen Schwerpunkte. Ausländerfeindlichkeit lässt die Tatsache außer Betracht, dass auch Inländer Fremde darstellen können, was sich beispielsweise auf homosexuelle Menschen bezieht. Denn diese spielt lediglich auf die Ablehnung von Menschen ohne deutschen Pass an. Fremdenfeindlichkeit hingegen lässt sich als deskriptiven Begriff für von Einzelnen benutzte rassistische Denk- und Verhaltensweisen beschreiben, bei denen die analytische Dimension von strukturellem Rassismus nicht mit einbezogen wird (vgl. Winter 2004, 23f.). Demnach kommt bei der Fremdenfeindlichkeit auch die Thematisierung zwischen der machtvollen wichtigen Unterscheidung im Rassismus zwischen »Wir« und den »Anderen« nicht zum Tragen (vgl. Mecheril 2004, 185).
3.4 Ursachen von Rassismus
Bei der Erläuterung von Rassismus ist es wichtig darzustellen, warum dieser überhaupt existiert. Neben der übergeordneten Erklärung dessen in der Befürchtung vor „Enttraditionalisierung, soziale[r] Deklassierung, Orientierungslosigkeit und Werteverlust“ (Winter 2004, 21) gibt es weitere unterschiedliche Ansätze, die versuchen, die Ursachen von Rassismus zu analysieren. Verhaltenswissenschaftliche Ansätze, die sich im Schnittfeld von Biologie und Psychologie befinden, erklären Rassismus beispielsweise als natürliche/anthropologische Abwehrreaktion gegen das Fremde. Dabei wird davon ausgegangen, dass dies aufgrund der biologischen Ausstattung der Menschen geschieht (vgl. Mecheril 2004, 182).
Der psychoanalytische Ansatz hingegen bestimmt die Ursachen von Rassismus in der Angst vor der Vermischung mit den »Anderen«. Terkessidis (1998, 214ff.) geht beispielsweise davon aus, dass das »Wir« nur durch den Ausschluss der »Anderen« existiert. Die Angst wird durch die Bedrohung produziert, dass die Häufigkeit der »Anderen« zu sehr zunimmt und somit ein Chaos/Zivilisationsverlust auftreten könnte. Demnach erleben sich die Privilegierten durch die »Anderen« als eine Einheit, sodass die »Anderen« demzufolge zur Selbsterkenntnis des Eigenen nützlich sind. Dies hat nach Terkessidisjedoch zur Folge, dass die Anwesenheit der »Anderen« stets das Eigene gefährdet. Dem entgegnen »Wir« aber damit, dass immer dann, wenn Institutionen die »Anderen« durch Einbeziehung ausgeschlossen werden, auch die »Anderen« den Preis für die Angst der Privilegierten bezahlen müssen (vgl. ebd.).
Auch Hall (1994, 114) schließt sich diesem psychoanalytischen Ansatz an, indem er davon ausgeht, dass die Konstruktion der »Anderen« dazu da ist, die eigene Identität zu erstellen und demnach Identifikationen zu sichern. Weiterhin bezieht er noch den Kulturaspekt mit ein, da für ihn die Ursache des Rassismus auch in der Angst vor kultureller Verschmutzung liegt. Memmi fasst dies passend und verständlich darin zusammen, dass die Unversehrtheit der Einheit, welche als bedroht erscheint, gegen alles nicht Zugehörige und von außen Kommende verteidigt werden muss. Dabei zwingt diese Verteidigung jedoch eine Offensive (in Form von Rassismus), sowie umgekehrt. Wenn die eigene Gruppe selbst angreift, muss diese auch damit rechnen, Rückschläge zu verzeichnen. Dabei „nährt Angst die Angst und Aggression die Aggression. Wie man sieht, ist die Behauptung der Rasse ein Mittel zu dieser Behauptung des Ichs“ (1992, 100).
Des Weiteren können gruppenpsychologische Forschungen als Deutung der Ursache einbezogen werden, die davon ausgehen, dass sich Menschen verschiedenen Kategorien zuordnen bzw. zugeordnet werden und demnach Teilhabe in einer Gruppe erhalten. Dadurch beginnen diese, den Mitgliedern der eigenen Gruppe Vorteile zu verschaffen und die fremden Gruppen zu benachteiligen (vgl. Mecheril 2004, 183).
Zerger (1997, 169) nimmt bei den Ursachen und der (Re-)Produktion rassistischer Denkmuster auch den Ansatz des Sozialisationsprozesses hinzu. Dabei geht er davon aus, dass rassistische Denkmuster durch gesellschaftliche Diskurse vermittelt und im Alltag weiter reproduziert werden. Bezüglich der Sozialisationsfaktoren bezieht er diese nicht nur als Ergebnis kognitiver Prozesse mit ein, sondern sucht die Ursachen rassistischer Denkmuster auch in der Persönlichkeitsentwicklung.
3.5 Strategien gegen Rassismus
Da nun bereits auf das Phänomen von Rassismus eingegangen wurde, stellt sich die Frage, wie diesem entgegengegangen werden kann. Dabei wird sich auf den Antirassismus als Gegnerschaft zum Rassismus oft berufen, um Strategien gegen den Rassismus zu beschreiben. Die Ansätze dessen versuchen gegen die bewertenden Unterteilungen der Menschen und gegen die Vorstellung der biologisch existierenden Rassen vorzugehen. Dies stellen zum Beispiel Interventionen auf der strukturell-institutionellen Ebene des Rassismus dar, was sich auf Kämpfe gegen rassistische Bezeichnungen bezieht oder mit Interventionen gegen rassistische Übergriffe gewährleistet werden soll. Auch sind interkulturelle Trainings, welche Vorurteile und Informationen lokalisieren, Teil dessen (vgl. Kaldrack/Pech 2011, 229f.). Beruft man sich bei den Ursachen von Rassismus auf den Sozialisationsprozess, schlägt Ehmann (2002, 237f.) beratende Maßnahmen und politische Bildung vor, die das ganze soziale Umfeld mit einbeziehen und methodisch-didaktisch Interkulturelles Lernen, Toleranz- und Menschenrechtserziehung beinhalten. Mecheril weist bei antirassistischen Strategien auf konkretere Maßnahmen hin, die sich beispielsweise auf das Bewusstwerden und die Reflexion der eigenen Identität (anschließend an Hall (2000) (vgl. 3.4)), den
„Wechsel auf übergeordnete Gruppenkategorien (etwa: von »Wir Türken« und »Wir Deutschen« zu »Wir im Stadtviertel«), Aufklärung und Information [...] und schließlich auch Erziehungsformen, die sich als Erziehung nicht autoritätsgläubiger und nicht unterwürfiger Menschen verstehen“ (2004, 183), beziehen. Auch Zerger (1997, 7) schlägt bei antirassistischen Maßnahmen und Strategien erst eine Erklärung des Begriffs von Rassismus, sowie die Analyse von Ursachen vor und setzt diese den angreifenden Maßnahmen und Strategien voraus. AufRassismus als Ideologie bezogen, ist es nach Winter (2004, 8) bei antirassistischen Strategien eine Voraussetzung, an Diskursen anzugreifen und sich einzumischen. Dies bezieht er auch auf das Durchbrechen der in der Gesellschaft vorherrschenden ethnischen Schichtung und Segregation, was auch Miles (2000, 26) verfolgt, indem die Veränderung von gesellschaftlichen Verhältnissen für ihn wichtiger ist, als rassistisch Diskriminierende in ihrem »Unrecht« zu belehren.
[...]
- Arbeit zitieren
- Anonym, 2015, Die Kinder- und Jugendhilfe im Umgang mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen aus rassismussensibler Perspektive, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/344674
Kostenlos Autor werden

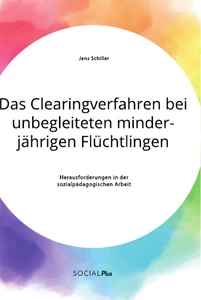

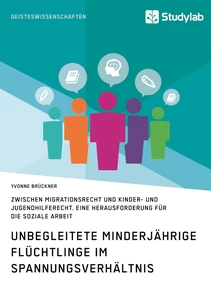







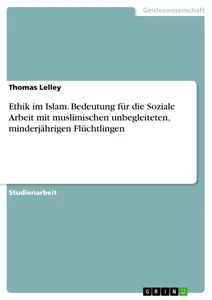









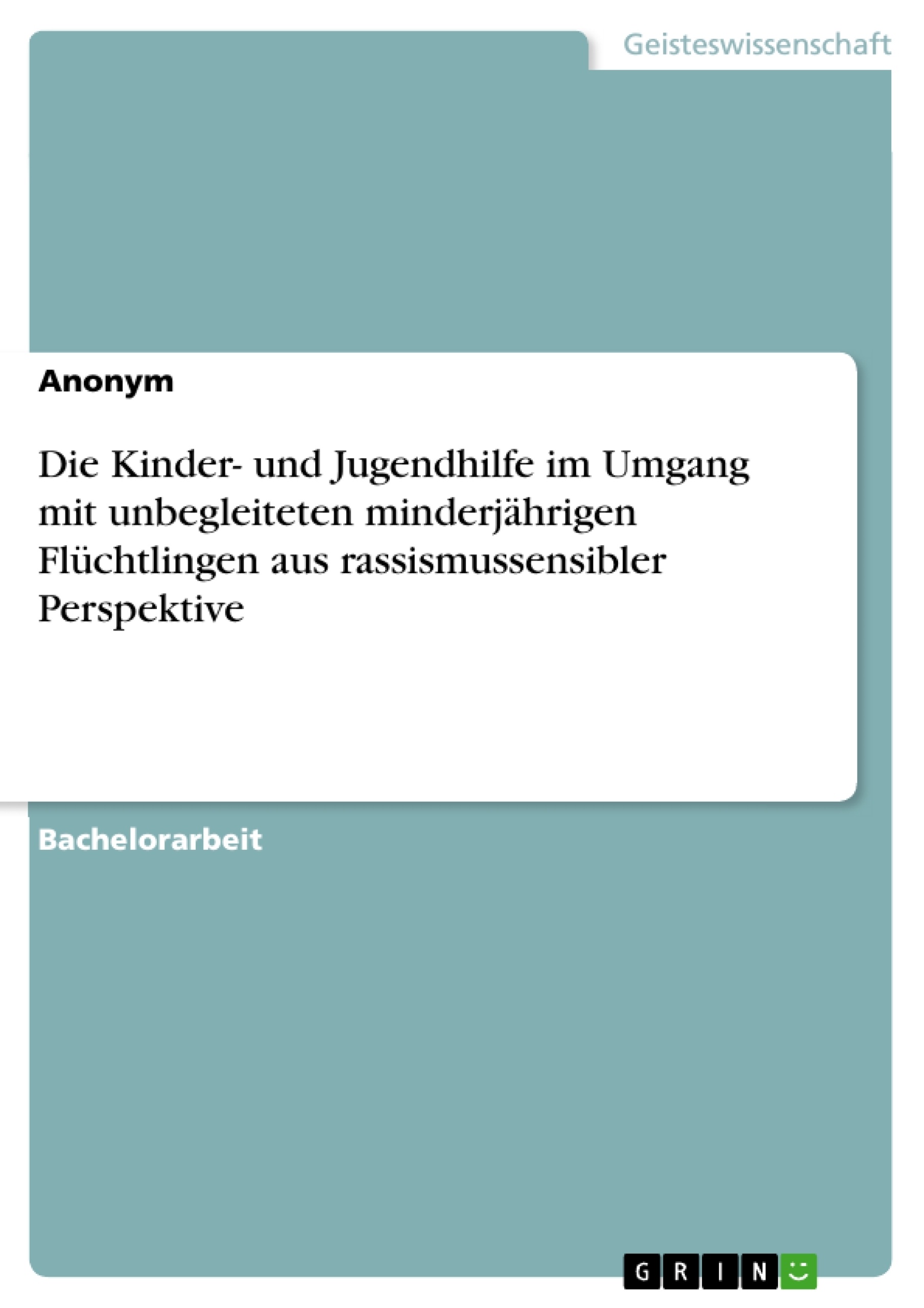

Kommentare