Extrait
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Basil Bernsteins Theorie schichtenspezifischen Sprachverhaltens
3. Bernstein und die Saphir-Whorf-Hypothese
4. Erste Phase der Theorie Bernsteins 1958-1962
4.1 Empirische Untersuchungen
4.2 Merkmale der sprachlichen Kodes
5. Bernsteins Erklärung der Sprachkodes aus der Sozialstruktur
5.1 Die Beziehung zwischen Kognition und sozialer Schicht
5.2 Offene und geschlossene Kommunikationssysteme
5.3 Status- und personen-orientierte Familien
5.4 Die Rolle der sozialen Kontrolle innerhalb der beiden Familientypen
6. Der Einfluss der Herkunftsfamilie auf den Schulerfolg der Kinder
7. Die kompensatorische Erziehung
8. Zusammenfassung
9. Literaturverzeichnis
1.Einleitung
Die Soziolinguistik ist eine relativ neue Wissenschaft, die sich erst nach dem 2. Weltkrieg entfaltete und ihren deutlichen Höhepunkt in den 60er bis Mitte der 70er Jahren erreichte. Begriffen als Teildisziplin der Linguistik, beschreibt die Soziolinguistik die sprachlichen Gegebenheiten, die auf Gesellschaftliches zurückzuführen sind.[1] Mit anderen Worten formuliert, untersucht die Soziolinguistik die Beziehungen zwischen der Sprache und der gesellschaftlichen Gruppenzugehörigkeit von Sprechern und Hörern,[2] d.h. die Sprache als soziales Phänomen.[3]
Die vorliegende Hausarbeit beschäftigt sich mit der Darstellung eines der Teilgebiete der Soziolinguistik, nämlich die Erforschung des schichtenspezifischen Sprachverhalten und die existierenden Kommunikationshemmungen zwischen den verschiedenen Schichten einer Gesellschaft. Das Problem des Zusammenhangs zwischen Sprache und sozialer Schicht wurde schon in Arbeiten aus den 19. Jahrhundert erkannt. So weist Peter Martin Roeder darauf hin, dass schon in den Arbeiten von Degerando 1847 bemerkt wurde, „dass die Kinder der Wohlhabenden mehr Worte und weniger Handlungen, die der Armen mehr Handlungen und weniger Worte verstünden“[4]. Wissenschaftlich hat man sich aber viel später auf diesem Gebiet bemüht. Insbesondere Mitte der 50er und Anfang der 60er Jahre des 20 Jahrhunderts begann das Interesse zu diesem Thema zu wachsen und erfuhr einen regelrechten Boom in den 70er Jahren. Die bildungspolitische Situation weltweit fand zu dieser Zeit ihren Ausdruck in Schlagwörtern wie ‚Mobilisierung der Bildungsreserven’, ‚Chancengleichheit’, ‚kompensatorische Erziehung’ und ähnlichen.[5] Sowohl in den U.S.A., als auch in England und wenig später auch in der Bundesrepublik erfolgten zahlreiche wissenschaftliche Bemühungen, die sich mit dem schichtenspezifischen Sprachverhalten umfangreich beschäftigten.
In der vorliegenden Hausarbeit werden die Arbeiten des britischen Bildungssoziologen Basil Bernstein vorgestellt. Dazu ist vorab anzumerken, dass Bernstein zwischen 1958 und 1972 etwa 30 Aufsätze verfasst hat, in denen er stets den Grundgedanken seiner Theorie definitorisch und konzeptuell modifiziert hat.[6] Somit wird hier keineswegs der Anspruch erhoben, die Konzeption von Bernstein komplex und vollständig zu erfassen. Dennoch soll versucht werden, die wesentlichsten Ergebnisse seiner empirischen Arbeiten und seiner Code-Theorie anzusprechen. Kapitel 2 soll dem allgemeinen Einstieg in den wichtigsten Hypothesen Bernsteins dienen. Im Kapitel 3 wird das Verhältnis von Bernstein zu der Relativitäts- oder „Sapir-Whorf-Hypothese“ referiert, um Bernstein sprachtheoretisch einordnen zu können. Im Kapitel 4 werden die empirischen Untersuchungen aus der ersten Phase (1958-1962) der theoretischen Bemühungen dargestellt. Gleichzeitig werden die beiden Sprachkodes in einen zusammenfassenden Überblick unter 4.2 erfasst. Kapitel 5 beschäftigt sich mit Bernsteins Erklärung der Sprachkodes aus der Sozialstruktur, während Kapitel 6 den Zusammenhang zwischen Herkunftsfamilie und Schulerfolg im Zusammenhang dieser Theorie erklärt.
2. Basil Bernsteins Theorie schichtenspezifischen Sprachverhaltens
Zwischen 1956 und 1972 entwickelte Basil Bernstein seine „Theorie der linguistischen Codes“, auch bekannt als „Defizit-Hypothese“ und löste unter Soziologen, Pädagogen, Psychologen und Linguisten eine umfangreiche Diskussion über das Verhältnis von Sprache und sozialer Schicht aus. Wesentlicher Grund für dieses Interesse bestand darin, dass während die frühren Arbeiten nahezu theorielose und deskriptive Ansätze darstellten, sich Basil Bernstein darum bemühte, eine integrative Theorie schichtenspezifischen Sprachverhaltens zu formulieren, die es gestattete, viele der empirischen Befunde in einen systematischen Bezugsrahmen zu setzen.[7]
Die grundlegende These Bernsteins besagte:
„Unterschicht und Mittelschicht gebrauchen sehr verschiedene Varianten der gleichen Kultursprache. Die Unterschiede haben ihre Ursache in schichtenspezifischen Sozialbeziehungen. Sie verfestigen sich auf der psychologischen Ebene des Individuums, grenzen dessen kognitive Möglichkeiten ab und stabilisieren so ihrerseits die zugrunde liegende Sozialstruktur“.[8]
Damit versuchte Bernstein frühere soziolinguistische und psycholinguistische Ansätze zu verbinden und somit die individualpsychologische Theorie durch eine Theorie des Spracherwerbs im sozialen Kontext aufzuheben.[9]
Um seine Grundannahme zu verdeutlichen versucht Bernstein die Existenz zweier sozioökonomischer Sprechweisen zu belegen. Er unterscheidet zwei dichotome Sprachvarianten: einen „elaborated code“ (elaborierter Kode) und einen „restricted code“ (restringierter Kode). Ursprünglich im Englischen als ‚Signalsystem’ oder ‚Chiffrierbuch’ verstanden,[10] definierte Bernstein die Kodes als Systeme des Sprechens und Prinzipien, die die sprachlichen Planungsfunktionen steuern.[11] Nach Bernstein stellen die beiden Kodes symbolische Transformationen der Sozialbeziehungen dar.[12] Beiden Kodes werden bestimmte Merkmalle zugeordnet. Der elaborierte Kode ist der leistungsfähigere und wird von der Mittelschicht gebraucht, während der restringierte weniger leistungsfähig ist und überwiegend von der Unterschicht gebraucht wird.[13]
Wie bereits in der Einleitung angesprochen, erfuhr die Theorie von Bernstein eine lange Entwicklung und basierte schließlich auf einer Reihe von Aufsätzen, in denen Bernstein unter den Druck kollegialer Kritik vielfach seine Konzepte zu revidieren und zu konkretisieren versuchte.[14]
Im Folgenden werden seine Untersuchungen grob in zwei Phasen aufgeteilt, um ein besseres Verständnis der Entwicklung seiner Arbeiten zu ermöglichen. Vorher aber wird noch kurz das Verhältnis von Bernstein zu der Relativitäts- oder „Sapir-Whorf-Hypothese“ kurz dargestellt, um Bernstein in einen sprachtheoretischen Rahmen einordnen zu können.
3. Bernstein und die Saphir-Worf-Hypothese
Die Sapir-Worf-Hyphothese wurde von den amerikanischen Linguisten Edward Sapir und seinem Schüler Benjamin Lee Whorf verfasst und besagt, dass Wahrnehmung und Denkprozesse eines Individuums durch dessen Muttersprache strukturiert und sogar gesteuert werden.[15] Diese Hypothese geht aus der Erforschung von Indianer- und Eskimosprachen hervor und begründet die Auffassung, dass die lebensraumbedingten Erfahrungen die Sprache einer Kultur prägen.[16]
Diesem linguistischen Relativitätsprinzip stimmt Bernstein zu, aber er geht gleichzeitig einen Schritt weiter, indem er die Unterschiede zwischen Nationalsprachen verschiedener Kulturkreise auch innerhalb einer Kultur und einer Sprache nachzuweisen versucht[17]. Bereits in seinem Aufsatz "Some Sociological Determinants of Perception. An Enquiry into Sub-cultural Differences" (1958) schreibt Bernstein: „die entscheidende Tatsache ist, dass es innerhalb jeder Gesellschaft bestimmte Bevölkerungsschichten gibt, welche die Sprache in all ihren Formen unterschiedlich gebrauchen“. Eine Gesellschaft ist demnach aus verschiedenen Systemen von schichtenspezifischen Sozialbeziehungen zusammengesetzt, die die verschiedenen linguistischen Sprechweisen hervorbringen und die Sprecher auf verschiedene Weise in ihrem Verhalten determinieren.[18]
[...]
[1] Vgl. Veith, Werner 2002, S.3
[2] Vgl. Gross, Harro 1998, S. 167
[3] Vgl. Maibauer, Jörg 2002, S. 3
[4] Vgl. Roeder, Peter M. 1965, S.14f
[5] Vgl. Ort, Michael 1976, S.5
[6] Vgl. Niepold, Wulf 1974, S.11
[7] Vgl. Ort, Michael 1976, S.22
[8] Zit. aus Niepold, Wulf 1974, S.9f
[9] Vgl. Niepold, Wulf 1974, S.10
[10] Vgl. Veith, Werner 2002, S.102
[11] Vgl. Neuland, Eva 1975, S.37
[12] Vgl. Oevermann, Ulrich 1972, S.76
[13] Vgl. Veith, Werner 2002, S.102
[14] Vgl. Ort, Michael 1976, S.29
[15] Vgl. Niepold, Wulf 1974, S.10
[16] Vgl. Veith, Werner 2002, S.111
[17] Vgl. Niepold, Wulf 1974, S.10f
[18] Vgl. Neuland, Eva 1975, S.77
- Citation du texte
- Snejana Iovtcheva (Auteur), 2004, Sozialbedingte Sprachbarrieren in der Schule. Die Theorie von Basil Bernstein, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/34461
Devenir un auteur


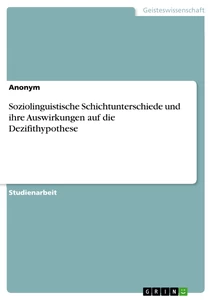

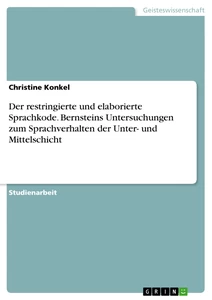
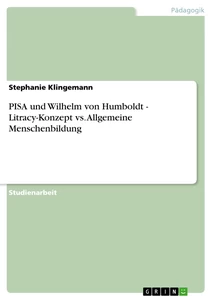
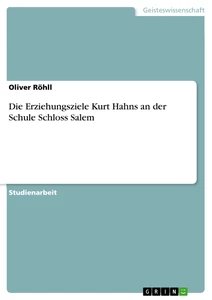
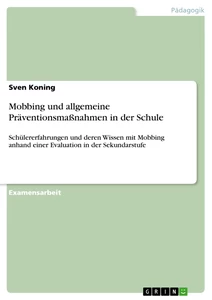

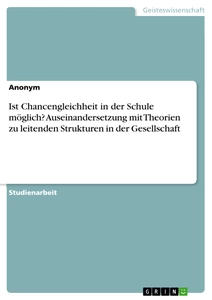
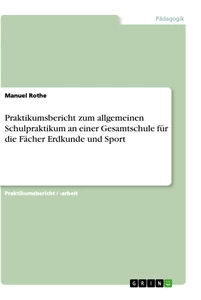
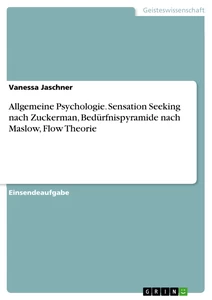
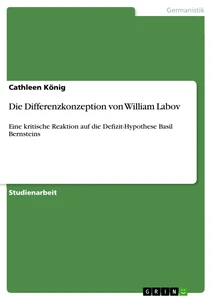
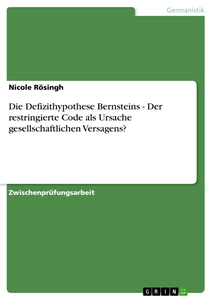





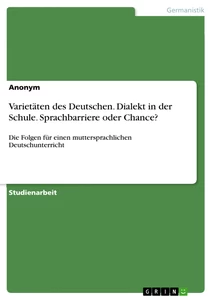
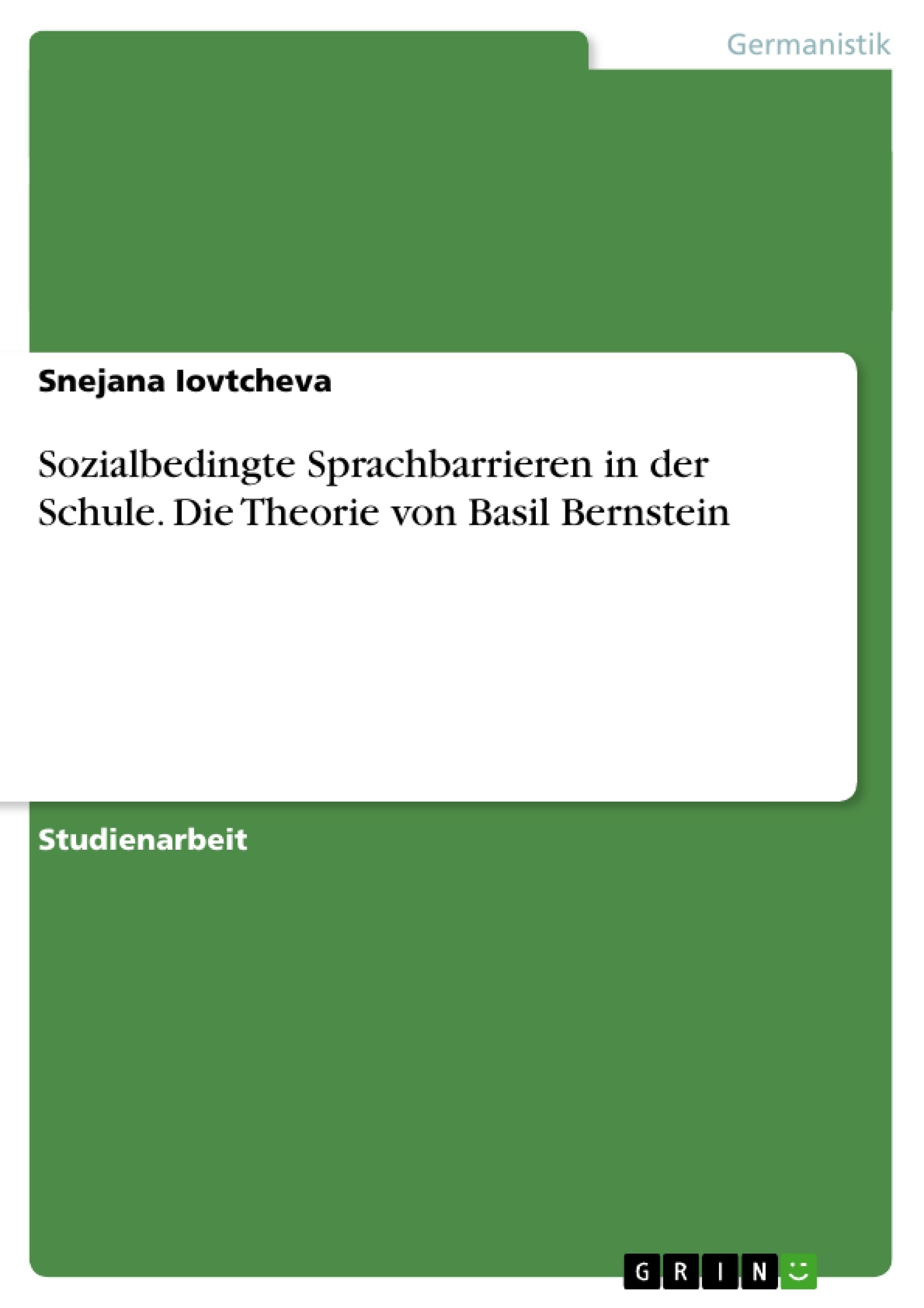

Commentaires