Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Problematisierung geschlechtsspezifischer Unterschiede im Schriftspracherwerb
3. Entwicklung der Lese- und Schreibfähigkeiten
3.0 Mündlichkeit und Schriftlichkeit
3.1 Entwicklung von Literacy in der Familie
3.1.1 Familiale Bedingungs- und Einflussfaktoren
3.1.2 Geschlechtsspezifische Unterschiede
3.1.3 Theoretische Erklärungsansätze der geschlechts- spezifischen Unterschiede
3.2 Entwicklung der Lese- und Schreibfähigkeiten in der Schule
3.2.1 Stufenmodelle des Schriftspracherwerbs als Rahmenmodelle
3.2.2 Entwicklung der basalen Lesefähigkeit
3.2.2.1 Logographisches Lesen
3.2.2.2 Alphabetisches Lesen
3.2.2.3 Orthographisches Lesen
3.2.2.4 Der Erwerb von „Sichtwörtern“ und Automatisierung beim Worterkennen
3.2.3 Textlesen/Lesekompetenz
3.2.4 Entwicklung der basalen Schreibfähigkeit
3.2.5 Entwicklung von Rechtschreibstrategien
3.2.6 Erwerb der Schreibkompetenz
3.2.7 Lese- und Schreib-Schwierigkeiten
3.2.8 Geschlechtspezifische Unterschiede im schulischen Schriftspracherwerb
3.3 Methoden des Lese- und Schreibunterrichts
3.3.1 Basale Leselehrverfahren
3.3.2 Basale Schreiblehrverfahren
3.3.3 Methoden des Textleseunterrichts
3.3.4 Methoden der Textproduktionsvermittlung
4. Praktisch-didaktische Konsequenzen für die Lese- und Schreibförderung im Unterricht
4.1 Motivation
4.2 Förderung des fachspezifischen Lernstrategiewissens
4.3 Umsetzungsmöglichkeiten eines geschlechter- differenzierenden Förderunterrichts
4.3.1 Leseförderung
4.3.2 Schreibförderung
4.4 Formen des Lesens
4.5 Notwendigkeit der Förderung des identifikatorischen Lesens fiktionaler Texte von Jungen
4.6 Zehn Rechte auf Lesen und Schreiben
5. Schluss
Literaturverzeichnis
1. Einleitung
Lesen und Schreiben stellen auf den verschiedenen Ebenen, sowohl beim Umgang mit der Schrift – dem Worterkennen bzw. dem Rechtschreiben – wie auf der Textebene, unterschiedliche Zugangsweisen im Gebrauch und in der Auseinandersetzung mit schriftlicher Kommunikation dar. Diese unterschiedlichen Zugangsweisen können sich ergänzen und gegenseitig beeinflussen, wobei sich der jeweilige Beitrag des Lesens bzw. Schreibens mit dem Entwicklungsstand des Lernenden verändert.
Auf die außerordentliche Wichtigkeit der Lese- und Schreibfähigkeit wird unter anderem in den Richtlinien und Lehrplänen für die Grundschule zur Erprobung in Nordrhein-Westfalen hingewiesen:
„Die schriftsprachlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten des Lesens und Schreibens bilden die Grundlage für jedes weitere Lernen in der Grundschule und darüber hinaus.“ (Ministerium 2003, S. 29)
Dass die Leistungen der Mädchen in diesen Fähigkeiten und Fertigkeiten denen der Jungen überlegen sind, ist nicht erst seit PISA und IGLU bekannt. Seit den 1990er Jahren ist – besonders in der Leseforschung – auf diesen Befund hingewiesen worden.
In der vorliegenden Arbeit werde ich mich mit dem geschlechtsspezifisch differenziellen Lese- und Schreibverhalten von Mädchen und Jungen auseinandersetzen und die sich daraus ergebenden Konsequenzen für die schulische Förderung herausarbeiten.
Um einen Überblick über die Unterschiede in den Lese- und Schreibfähigkeiten zwischen den Geschlechtern zu geben, werde ich zunächst kurz die Ergebnisse verschiedener empirischer Untersuchungen darstellen und der Frage nach dem Einfluss und der Interventionsnotwendigkeit der Schule nachgehen (vgl. 2).
Es muss bereits an dieser Stelle deutlich darauf hingewiesen werden, dass die Zugehörigkeit zu einer Geschlechtergruppe keine Auskunft über das Niveau der Lese- oder Schreibkompetenz geben kann. Wenn im Folgenden von den Interessen und Leistungen „der Jungen“ und „der Mädchen“ die Rede ist, beziehe ich mich auf Ergebnisse von Untersuchungen, die statistisch und
tendenziell stimmen, die aber nicht bedeuten, dass die Daten auf jeden Jungen und jedes Mädchen automatisch zuträfen. Ebenso wie Jungen sehr kompetente Leser und Schreiber sein können, finden sich unter den Mädchen besonders leistungsschwache.
Im dritten Teil wird die Entwicklung der schriftsprachlichen Fähigkeiten dargestellt werden. Hier ist zwischen der Entwicklung von „Literacy“ innerhalb der Familie (3.1) und dem schulischen Schriftspracherwerb zu unterscheiden (3.2).
Der familiale Einfluss auf den Erwerb der Lese- und Schreibfähigkeiten bei Kindern ist von besonderer Bedeutung und trägt primär zu den geschlechtsspezifischen Differenzen bei. Die Thematisierung der Ursachen der Unterschiede kann jedoch keinen Schwerpunkt dieser Arbeit bilden, da keine empirisch belegten Nachweise, sondern nur theoretische Erklärungsansätze (3.1.3) für die Differenzen in den schriftsprachlichen Leistungen von Jungen und Mädchen existieren.
An die Darstellung der schulischen Entwicklung des Lesens und Schreibens, sowohl im Hinblick auf den Anfangsunterricht als auch auf die Entfaltung der Fähigkeiten, wird sich eine Ausführung der geschlechtsspezifischen Unterschiede in der schulischen Entwicklung anschließen.
Im Weiteren werde ich verschiedene Unterrichtsmethoden zur Vermittlung der basalen und auch der textbezogenen Fähigkeiten vorstellen und auf der Basis der bis dahin herausgestellten Entwicklungsunterschiede hinsichtlich ihrer geschlechterdifferenzierenden Möglichkeiten prüfen. Auch die Zielsetzungen der ab diesem Jahr verbindlich zu erprobenden Lehrpläne und Richtlinien des Fachs Deutsch für die Grundschule werden bei der Methodenuntersuchung einbezogen, denn hier wird die Forderung nach geschlechterdifferenzierender Förderung – besonders im Hinblick auf die Lesefähigkeit – explizit als Aufgabe angeführt:
„Die Förderung der Lesekompetenz berücksichtigt die unterschiedlichen Neigungen und Interessen von Mädchen und Jungen.“ (Ebd., S. 39)
Die Lesekompetenz wird nicht nur in den Richtlinien, sondern auch in der PISA- und der IGLU-Studie als außerordentlich bedeutsam und in besonderem Maß von Geschlechterunterschieden betroffen hervorgehoben: Lesen gilt als „zentrale Kulturtechnik in unserer Gesellschaft“, da es notwendig ist, „schriftlich fixierte Inhalte sinnentnehmend“ verstehen zu können, „um sich zu orientieren, zu informieren und weiterzubilden“ (Bos et al. 2003, S. 266).
Insgesamt werde ich daher die Leseentwicklung von Jungen und Mädchen etwas stärker als die Schreibentwicklung berücksichtigen. Da das Lesen- und Schreibenlernen aber eng miteinander verknüpft sind und sich gegenseitig unterstützen, wird das schriftliche Sprachhandeln stets auch beachtet.
Im letzten Teil meiner Arbeit werde ich mich insbesondere mit den schulischen Möglichkeiten einer Leseförderung, die auf die individuell subjektiven Interessen und Fähigkeiten eingeht, beschäftigen, wobei auch didaktische Konsequenzen in Bezug auf die Schreibförderung thematisiert werden. Die Leseförderung ist nicht nur aufgrund der prominenten Bedeutung der Lesekompetenz zu betonen, sondern auch wegen ihres Einflusses auf die Schreibkompetenz von Jungen und Mädchen. Das Verständnis und die Vorstellungen von Texten und ihrer Intention erweitern sich mit zunehmender Leseerfahrung und Rezeptionsfähigkeit. Dies zieht auch eine Veränderung der Konzeption des eigenen Schreibens nach sich.
2. Problematisierung der geschlechtsspezifischen Unterschiede im Schriftspracherwerb
Empirische Befunde aus standardisierten internationalen Untersuchungen zum Lesen und Schreiben zeigen, dass Unterschiede in den Lese- und Schreibleistungen von Mädchen und Jungen existieren. Die meisten Ergebnisse lassen eine eindeutige Überlegenheit der Mädchen erkennen (vgl. z.B. Bos et al. 2004; Deutsches PISA-Konsortium 2001; Richter/Brügelmann 1994; May 1994). In schriftsprachunabhängigen Bereichen wie Intelligenz, Zahlbegriff und Mengenauffassung hingegen waren keine signifikanten Differenzen erkennbar, so dass ausgeschlossen werden kann, dass es sich um eine generelle Überlegenheit der Mädchen handelt (vgl. Richter/Brügelmann 1994, S. 10). Wenn keine kognitiven Leistungen außerhalb des Schriftspracherwerbs die Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen erklären können, müssen insbesondere Faktoren wie Lernmotivation und Arbeitsstil ins Blickfeld rücken.
Ich möchte im Folgenden eine Übersicht über die empirischen Befunde zu den Fragen geben, ob Jungen bereits mit schlechteren Voraussetzungen in die Schule kommen oder ob die Unterrichtspraxis erst Unterschiede produziert und in welchen Teilleistungen die Geschlechterunterschiede im Schriftspracherwerb liegen. Auf die Ursachen und Konsequenzen werde ich im Einzelnen in den folgenden Kapiteln eingehen.
Bereits zu Schulbeginn können häufiger Schulanfängerinnen als Schulanfänger komplexere schriftsprachliche Leistungen wie das Aufschreiben von Wörtern erbringen und auch in der Gruppe der Frühleser dominiert die Anzahl der Mädchen (vgl. Richter 1996, S. 98). Bemerkenswert ist allerdings, dass innerhalb der Gruppe der frühlesenden Kinder die Jungen in allen untersuchten Variablen – Anzahl der gelesenen Texte, Sinnverständnis, Lesegenauigkeit und besonders in der Lesegeschwindigkeit – bessere Leistungen als die Mädchen erbrachten. Der Grund für diese qualitativen Unterschiede könnte in der Lesemotivation liegen: Während mehr Mädchen als Jungen durch Nachahmung älterer Geschwister vor der Einschulung Lesen lernen, kommen Jungen häufig durch Eigeninitiative zum Lesen. Dieses interessengeleitete Lesenlernen könnte zu besseren Leseleistungen als das Imitationslernen führen (vgl. Neuhaus-Siemon 1994, S. 69).[1]
In anderen Vorläuferfertigkeiten für den Schriftspracherwerb unterscheiden sich die Geschlechter zu Schulbeginn jedoch nicht. Am Anfang der ersten Klasse scheinen die Jungen den Einstieg in den Schriftspracherwerb ebenso wie die Mädchen erfolgreich zu bewältigen. Was die Leseleistungen betrifft, zeigt sich spätestens aber am Ende der zweiten Klasse der Vorsprung der Mädchen. Wie sich auch durch PISA gezeigt hat, schaffen es die Jungen bis zum Ende der Sekundarstufe I nicht, den Rückstand aufzuholen. Im Gegenteil, während bei der internationalen Vergleichsstudie für die Grundschule IGLU 2001 die deutschen Jungen zwar signifikant aber in den Mittelwerten nicht gravierend hinter ihren Klassenkameradinnen zurücklagen (vgl. Bos et al. 2004, S. 71), ist der Unterschied zwischen den durch PISA getesteten 15-jährigen Schülerinnen und Schülern beträchtlich größer, hier entspricht der Leistungsvorsprung etwa einer halben Kompetenzstufe (vgl. Deutsches PISA-Konsortium 2001, S. 253).
Auch wenn deutsche Schüler und Schülerinnen der Grundschule besser als die der weiterführenden Schulen abgeschnitten haben, ist eine Verbesserung der Förderung und Qualifizierung im Bereich der vorschulischen und grundschulischen Bildung eine zentrale bildungspolitische Aufgabe. Die Institution Grundschule ist die einzige schulische Einrichtung in Deutschland, die unabhängig von vorhergehenden Leistungen und sozialer Herkunft die Förderung aller Schülerinnen und Schüler zur Aufgabe hat. Nicht befriedigend gelöste Probleme auf der Grundschulebene lassen sich in den weiterführenden Schulen nicht mehr kompensieren, sie spitzen sich vielmehr zu, wie durch die PISA-Ergebnisse gezeigt wurde (vgl. Bos et al. 2003, S. 299f.). Das von Jungen und Mädchen am Ende der vierten Klasse erreichte Leistungsniveau ist von zentraler Bedeutung für die weitere Schullaufbahn. Besonders Kinder, die schon in der Grundschule zur „Risikogruppe“ gezählt werden können, werden im weiteren Verlauf ihrer Schulzeit aller Wahrscheinlichkeit nach erhebliche Schwierigkeiten haben und auch am Ende der Sekundarstufe I zur unteren Leistungsgruppe gehören. Im Zusammenhang mit den Lese- und Schreibfähigkeiten betrifft dies Kinder mit Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten in besonderem Maße; bei Jungen werden diesen Schwierigkeiten weitaus häufiger diagnostiziert als bei Mädchen. Positiv hervorzuheben ist, dass im internationalen Vergleich zwischen den deutschen Mädchen und Jungen, die die Grundschule besuchen, das Ausmaß der Unterschiede in Bezug auf das Leseverständnis geringer ist als in den meisten anderen getesteten Ländern (vgl. ebd. S. 114).
Aber auch hier sind die Leistungen beim Lesen literarischer Texte bei den Mädchen signifikant höher; die Differenz beim Lesen von Informationstexten fällt dagegen recht gering zugunsten der Mädchen aus (vgl. ebd.).
Innerhalb der Leseleistungen unterscheiden sich die Geschlechter besonders in Bezug auf die Lesequantität und –intensität, Lesestoffe und Leseweisen, Lesefreude und Leseneigung erheblich (vgl. Eggert/Garbe ²2003). Mädchen lesen mehr und haben andere Lesepräferenzen als Jungen. Während sich männliche Leser eher für sachbezogene Informationen interessieren, bevorzugen Mädchen das identifikatorische Lesen fiktionaler Geschichten (vgl. Hurrelmann 1994, S. 25). Von besonderem Lektüreinteresse sind für Jungen außerdem die reinen Spannungsgenres und Comics (vgl. Bischof / Heidtmann 2002b, S. 27f.). Grundschüler rezipieren Comics insgesamt zeitaufwändiger als Bücher (vgl. ebd.).
Die Unterschiede beschränken sich jedoch nicht auf die Nutzung von Printmedien, sondern finden sich auch im Gebrauch anderer Medien (vgl. Vorderer / Klimmt 2002, S. 215). In der Nutzung des Fernsehers setzen sich die auch für das Lesen geltenden Unterschiede fort: Frauen und auch Mädchen bevorzugen Spiel- und Liebesfilme, Männer und Jungen interessieren sich mehr für actiongeladene Abenteuerfilme oder informierende Magazinsendungen. Die Unterhaltungsfunktion der Medien ist für beide Geschlechter bedeutsam; darüber hinaus scheint jedoch für das männliche Geschlecht die Information und für das weibliche die Möglichkeit zum sozial-emotionalen Miterleben eine bevorzugte Funktion zu sein.
Ein Vergleich der Rechtschreibleistungen von Grundschülern und Grundschülerinnen zeigt, dass auch in diesem Bereich die Mädchen ihre Altersgenossen während der ersten zwei Jahre überholen. Sigrun Richter hat mehrere Untersuchungen zu Geschlechterdifferenzen in der Rechtschreibleistung von Kindern zusammengestellt und überprüft, welchen Verlauf diese in der Schulzeit nehmen. Sie kam zu dem Ergebnis, dass alle Studien zwei Trends bestätigen:
1. Die Mädchen sind den Jungen von der zweiten bis zur neunten Klasse, welche die letzte untersuchte Klasse war, bezüglich ihrer Rechtschreibung signifikant überlegen.[2]
2. In fast allen Untersuchungen sind zu allen Messzeitpunkten die Mädchen in der oberen und die Jungen in der unteren Leistungsgruppe erheblich überrepräsentiert (vgl. Richter 1996, S. 108).
Die festgestellten Leistungsunterschiede beziehen sich auf alle untersuchten Teilaspekte der Rechtschreibung. Beim Schreiben freier Texte sind die Differenzen allerdings noch größer als beim Schreiben von Diktaten.
Die Untersuchung „Zu Rechtschreibwortschatz und Fehlerquoten in freien Texten von Viertklässlerinnen und Viertklässlern“ zeigt folgende Unterschiede: Mädchen schreiben durchschnittlich ca. 20 Prozent längere Texte als Jungen, machen dabei aber weniger Rechtschreibfehler. Die geringere Fehlerquote und der größere Textumfang stehen insofern in einem Zusammenhang, da die Mädchen dadurch einen größeren Übungseffekt erzielen. Ihr verwendeter Wortschatz ist um ungefähr 15 bis 20 Prozent umfangreicher, was auch - zumindest zum Teil - eine Folge der längeren Texte ist. Bei Artikeln, Konjunktionen und Partikeln ist allerdings der Wortschatz der Jungen breiter. Der verwendete Wortschatz von Mädchen und Jungen unterscheidet sich beträchtlich: insgesamt überlappt er sich zu weniger als zwei Dritteln, bei Inhaltswörtern sogar in weniger als der Hälfte (vgl. Prevot 1993).
In Bezug auf die freie Textproduktion im Anschluss an vorhergehende Leseaktivität konnte Bertschi-Kaufmann im Zuge eines Projektes zu den literalen Aktivitäten von Primarschulkindern konstante geschlechtsspezifische Unterschiede feststellen: Die Schreibaktivität innerhalb des offenen Rahmens eines Lesetagebuchs ist bei Mädchen grundsätzlich höher (vgl. Bertschi-Kaufmann 2000, S. 257). Auch die Bereitschaft Gelesenes oder Teile hiervon in eigenen narrativen Texten zu schildern und dabei detailliert vorzugehen ist bei Mädchen generell deutlich größer ausgeprägt. Jungen drücken sich weniger häufig erzählend aus und in den meisten Fällen auch weniger ausführlich (vgl. ebd.).
Jungen liegen zwar insgesamt und in den Extremgruppen hinter den Rechtschreibleistungen der Mädchen zurück, berücksichtigt man aber die Schreibleistung bei Wörtern, die aus ihrer Erfahrungswelt stammen, zeigt sich, dass sie diese Wörter häufiger als andere, in einzelnen Fällen sogar häufiger als die sonst überlegenen Mädchen richtig schreiben. Die Hypothese, dass subjektive geschlechterspezifische Bedeutung und Wort(recht)schreibung in einem Zusammenhang stehen, fanden May, Brügelmann und Richter in mehreren Untersuchungen bestätigt (May/Brügelmann/Richter 1993, May 1994). Dieser Einfluss subjektiver Bedeutsamkeit von Wörtern trifft auf beide Geschlechter zu. Im Vergleich geschlechtstypischer Wörter konstatiert May, dass Jungen besser Jungenwörter und Mädchen besser Mädchenwörter schreiben (May 1994, S. 112). IGLU bestätigte diese Ergebnisse insofern, dass hier die Jungen bei Wörtern aus dem technischen Umkreis (ölig, informieren, sinkt, drehen) und mit Bezug zu Abenteuern (Muskeln, Strapazen, spuken) nicht signifikant mehr Fehler machten als die Mädchen, aber auch nicht umgekehrt. Nur ein Wort wurde von den IGLU getesteten Schülern häufiger richtig als von den Schülerinnen geschrieben: ‚Benzintanks’ (vgl. Bos et al. 2003, S. 249).
Als Konsequenz dieser Beobachtung stellt Richter folgende Untersuchungshypothese auf:
Die insgesamt geringeren schriftsprachlichen Leistungen der Jungen sind auf eine insgesamt geringere Berücksichtigung jungenspezifischer Erfahrungen und Interessen im Schriftsprachunterricht zurückzuführen.
(Richter 1996, S. 241)
Diese These wird im letzten Teil der Arbeit aufgegriffen werden.
Ebenso wie Jungen für sie besonders bedeutsame Wörter wesentlich häufiger richtig schreiben, selbst wenn es sich um schwierige Wörter handelt, gilt auch für das Lesen, dass ein Zusammenhang zwischen Leistung und Interesse besteht. So fand Lehmann heraus, dass Jungen beim Lesen von Sach- und Gebrauchstexten spezielle Kompetenzen entwickeln.
Auch in diesem Zusammenhang wurde die Hypothese aufgeworfen, dass die Unterlegenheit der Jungen durch deren zu geringe Berücksichtigung im Deutschunterricht zustande komme.
Tatsächlich fand Lehmann bei der Analyse der IEA-Studie heraus, dass die Überlegenheit der Mädchen auf die Leseleistung bei narrativen Texten beschränkt sei, die den Großteil sowohl des Deutschunterrichtes als auch der Lesetests ausmachen. Auch IGLU belegte diese Ergebnisse: Die Jungen erzielten beim Lesen von Informationstexten bessere Ergebnisse als beim Lesen literarischer Texte (vgl. Bos et al. 2003, S. 114).
Insgesamt berichten die Studien durchgehend über Verschiebungen in den Mittelwerten, über deren Relevanz man eventuell hinwegschauen könnte. Diese Ergebnisse täuschen aber darüber hinweg, dass in der Gruppe der Leistungsschwachen besonders viele förderbedürftige Jungen sind. Betrachtet man die beiden unteren Kompetenzstufen der orthographischen Leistungen, die das untere Leistungsquartil umfassen, sind Jungen mit jeweils fast 60 Prozent überrepräsentiert. Im oberen Leistungsquartil hingegen befinden sich mit 61, 5 Prozent mehr Mädchen (vgl. Bos et al. 2003, S. 250). Die Differenzen sind im erweiterten orthographischen Bereich dabei größer als die im elementaren. Somit bestätigt auch IGLU, dass bei Mädchen eine zügigere Entwicklung der orthographischen Strategien zu beobachten ist (vgl. ebd.).
Auch die Lesefertigkeit der Jungen wurde in der IGLU-Studie nicht als besonders besorgniserregend schlechter als die der Mädchen eingestuft. Doch auch hier gilt es zu beachten, dass zum einen das Ziel einer langfristigen Lesemotivation über die Schule hinaus besonders bei männlichen Schülern verfehlt wird und zum anderen - zum Teil bedingt durch die geringere Motivation und den dadurch fehlenden Übungseffekt - deutlich mehr Jungen als Mädchen unter Leseschwierigkeiten leiden.
Besonders häufig in den unteren Leistungsgruppen finden sich Jungen aus Familien mit Migrationshintergrund. Sowohl PISA als auch IGLU haben gezeigt, dass die Probleme dieser Kinder hinsichtlich der Entwicklung der Lese- und Schreibfähigkeiten in Deutschland besonders ausgeprägt sind. Sie gehören durch verschieden Faktoren überdurchschnittlich häufig der potentiellen Risikogruppe schwacher und extrem schwacher Leser und Schreiber an. Als Risikofaktoren, die die Wahrscheinlichkeit der Zugehörigkeit zu dieser Gruppe erhöhen, erweisen sich niedrige Schicht, niedriges Bildungsniveau, Migrationshintergrund der Herkunftsfamilie und männliches Geschlecht. Die alarmierenden Ergebnisse deuten auf die dringende Notwendigkeit einer frühzeitigen Intervention – zum Beispiel durch sprachliche Frühförderung – in und vor der Grundschule hin.
Jungen und Mädchen werden nicht mit den gleichen Voraussetzungen in den Vorläuferfertigkeiten eingeschult. Schon vor Schulbeginn ist die Gefahr für Jungen zur Risikogruppe des Schriftspracherwerbs erheblich größer als das der Mädchen. Mannhaupt berichtet von einem Verhältnis von etwa 4:1 zu Ungunsten der Jungen (vgl. Mannhaupt 1994, S. 48). Die Jungen sind von Beginn des Schriftspracherwerbs benachteiligt. Die vorhandenen Unterschiede bei Schülern und Schülerinnen entstehen nicht erst in den ersten Schuljahren, sondern stellen eine Folge des Zusammenspiels von häufiger fehlenden Voraussetzungen und ungenügender Anpassung der Methodik des Anfangsunterrichts an die Schwierigkeiten dieser Kinder dar. Während des schulischen Schriftspracherwerbs stabilisieren sich die Unterschiede, so dass davon ausgegangen werden kann, dass der schulische Unterricht vorhandenen Unterschieden nicht entgegenwirkt. Damit verfehlt die Grundschule die in den Richtlinien festgelegte Aufgabe, dass „unterschiedliche Interessen, Sichtweisen und Lernwege von Mädchen und Jungen“ (Ministerium 2003, S. 14) Berücksichtigung finden. Inwieweit die familiale schriftsprachliche Sozialisation zur Verursachung der Differenzen beitragen und in welchem Maße die Schule speziell die benachteiligten Jungen fördern kann, wird in den folgenden Kapiteln thematisiert werden.
3. Entwicklung der Lese- und Schreibfähigkeiten
3.0 Mündlichkeit und Schriftlichkeit
Das schulische Erlernen des Lesens und Schreibens wird in der Regel als Schriftspracherwerb bezeichnet.
Der Begriff „Schriftspracherwerb“ lässt bereits auf die erheblichen Anforderungen im sprachlichen und kognitiven Bereich, die mit dem Erlernen des Lesens und Schreibens verbunden sind, schließen. Dabei hebt die Begrifflichkeit des „Erwerbs“ die Eigenständigkeit der Aneignung hervor. Ebenso wie das Kind im handelnden Austausch mit erwachsenen Anderen sprechen lernt, indem es Eigenregeln bezüglich der Semantik und des Aufbaus von Wörtern bildet, Gesetzmäßigkeiten und Beziehungen entdeckt, lernt es durch den Umgang mit Schrift auch deren Struktur kennen (vgl. Dehn et al. 1999).
Dass aber zwischen gesprochener und geschriebener Sprache fundamentale Unterschiede bestehen, hat Wygotski bereits Ende der 60er Jahre festgehalten (vgl. Wygotski 1969): Geschriebene Texte setzen eine gewisse Abstraktion vom Gesprächspartner und auch von der lautlichen Ebene der Sprache voraus. Die Nutzung von Schrift beim Lesen und Schreiben erfordert die bewusste Steuerung der Aufmerksamkeit auf den Text und damit ein Zurückziehen von der unmittelbaren Situation, in der der Schreiber oder Leser sich befindet. Schrift stellt also im Verhältnis zur Sprache nicht nur ein sekundäres System dar, als das es in der Sprachwissenschaft lange betrachtet wurde, sondern ist in den letzten Jahrzehnten als eigenständiges System in das Zentrum der Forschung gerückt. Die Beziehung von Sprache und Schrift oder von Mündlichkeit und Schriftlichkeit wurde in Deutschland besonders von Günther untersucht (vgl. Günther 1993):
Mündlichkeit und Schriftlichkeit unterscheiden sich nicht nur medial, phonisch auf der einen, graphisch auf der anderen Seite, sondern auch konzeptionell. Lesen bedeutet nicht, graphische Zeichen in mündliche Sprache zu dekodieren. Schrift ist - für den kompetenten Leser- ein eigenes Kommunikationssystem, welches eigener Rezeptionsbedingungen und Versprachlichungsstrategien bedarf. Koch und Österreicher zeigen einige Merkmale auf, die typischerweise eher der Mündlichkeit oder der Schriftlichkeit zugehörig sind: Während der mündlichen Sprache dialogische, spontane, situationsgebundene, private, etc. Kommunikationsbedingungen zugeordnet sind, stehen auf Seiten der Schrift Monologizität, Reflektiertheit, Situationsentbundenheit, Öffentlichkeit etc. In Bezug auf die Versprachlichungsstrategien führen Koch und Österreicher für die Mündlichkeit z.B. Prozesshaftigkeit und Vorläufigkeit an, außerdem zeichne die mündliche Rede u. a. geringere Kompaktheit, Komplexität, Elaboriertheit und Informationsdichte im Vergleich zur Schriftlichkeit aus (vgl. Koch/Österreicher bei Günther 1993, S. 88).
Diese prototypischen Strukturdifferenzen werden begrifflich als ‚konzeptionelle Mündlichkeit’ und ‚konzeptionelle Schriftlichkeit’ eingeordnet.
Die konzeptionelle Dimension von Mündlichkeit und Schriftlichkeit ist graduell, während der mediale Unterschied immer dichotom ist: Ein Text kann nur entweder phonisch oder graphisch sein. Ein medial schriftlich vorliegender Text kann aber einen hohen Grad konzeptueller Mündlichkeit aufweisen (z.B. eine SMS oder ein Tagebucheintrag), während ein medial mündlicher Text konzeptionell von schriftlicher Qualität sein kann (z.B. ein Vortrag oder eine Predigt).
Die Bedeutung, die die Unterscheidung zwischen konzeptioneller Mündlichkeit und konzeptioneller Schriftlichkeit für das Lesen- und Schreibenlernen hat, besteht darin, dass Kinder mit dem Erwerb der Schriftsprache nicht nur das Prinzip der Alphabetschrift begreifen lernen müssen, sondern dass sie auch eine neue Form der Sprache erwerben. Günther weist explizit auf die Unangemessenheit eines Lese- und Schreibunterrichts hin, der allein auf die Vermittlung eines anderen Kanals abstellt. Das würde, so Günther, voraussetzen, dass SchulanfängerInnen das gesamte nötige Vorwissen bereits mitbrächten und sie lediglich zu lernen hätten, die Buchstabenformen auf die ihnen schon zur Verfügung stehende Phonologie zu übertragen. Günther geht davon aus, dass sich das phonologische Bewusstsein von Sprache aber erst nach dem Verständnis elementarer Eigenschaften von Geschriebenem ausbildet, also eine Folge des Schriftspracherwerbs ist. Erst durch räumliche, nicht flüchtige, geschriebene Texte haben Kinder die Möglichkeit sich ein phonologisches System und dessen Struktur zu konstruieren. (vgl. Günther 1993, S. 91). Inwieweit es sich bei der Ausbildung des phonologischen Bewusstseins um eine Voraussetzung oder eine Folge des Erwerbs der Schriftsprache handelt, werde ich in 3.2.2.2 näher erläutern.
Erste Erfahrungen mit Schrift und Schriftlichkeit sammeln Kinder nicht erst im Anfangsunterricht der Grundschule; sie beginnen ihre Schullaufbahn vielmehr mit den unterschiedlichsten Vorkenntnissen, die sie bereits seit dem Kleinkindalter innerhalb der Familie gesammelt haben.
3.1. Entwicklung von Literacy in der Familie
Die Übersetzung des Wortes „Literacy“ in die deutsche Sprache ist problematisch, da kein einzelnes Wort die Bedeutung trifft. Zum Teil wird es in der Fachliteratur mit „Literalität“ übersetzt, wörtlich bedeutet es aber Lese- und Schreibkompetenz. Diese Übersetzung ist allerdings ergänzungsbedürftig, da der Begriff „Literacy“ mehr als die Grundfertigkeiten des Lesens und Schreibens beschreibt. Er umfasst Kompetenzen wie Textverständnis und Sinnverstehen, sprachliche Abstraktionsfähigkeit, Lesefreude, Vertrautheit mit Büchern, die Fähigkeit sich schriftlich auszudrücken, Vertrautheit mit Schriftlichkeit oder „literarischer“ Sprache, oder sogar Medienkompetenz.
Die Entwicklung von Literacy in der Familie umfasst einerseits den für die Entwicklung der Schreib- und Lesefähigkeiten wichtigen Bereich der ersten Erfahrungen mit den oben genannten Kompetenzen, die Familie hat andererseits besonders bezogen auf die Vermittlung von Freude am Bücherlesen, die Motivation zu regelmäßiger Buchlektüre und auch auf die Lesekarriere im weiteren Verlauf des Lebens der Kinder weitreichenden Einfluss. Mit diesem Einfluss der Familie auf die Kinder hat sich hauptsächlich die Lesesozialisationsforschung auseinander gesetzt. Die Lesesozialisation hat aber durch die Auseinandersetzung und das Vertrautwerden mit Schriftlichkeit auch entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung der Schreibfähigkeit.
Ich möchte im Folgenden erst einmal auf die Bedingungs- und Einflussfaktoren der familialen Lese- (und Schreib-)sozialisation eingehen um dann die geschlechtsspezifischen Unterschiede von Mädchen und Jungen zu erläutern. Anschließend werde ich einige theoretische Erklärungsansätze möglicher Ursachen geschlechtsspezifischer Unterschiede in der literarischen Entwicklung von Jungen und Mädchen thematisieren.
3.1.1 Familiale Bedingungs- und Einflussfaktoren
Die Entwicklung der Lese- und Schreibfähigkeiten von Kindern beginnt, wie erwähnt, nicht erst mit dem Erwerb der Schriftsprache in der Schule. Erste Erfahrungen mit Schriftlichkeit sammelt ein Kind, indem es in seiner sozialen Umgebung unterschiedlichsten Lesematerialien, literalen Praktiken und vor allem mündlichen Formen konzeptioneller Schriftlichkeit begegnet. Es sieht Erwachsene oder ältere Kinder beim Lesen der Zeitung, beim Schreiben von Notizzetteln, beim Kartenlesen und vielen anderen alltäglichen Handlungen, die das Kind die Bedeutung der Schriftkundigkeit erahnen lassen.
Genau genommen ist bereits der Spracherwerb eine Vorstufe der kindlichen Lesesozialisation, denn in dieser Zeit stellen Eltern bereits die Weichen für jede spätere Beziehung ihrer Kinder zu Sprache und Schrift. Unter günstigen Bedingungen wird das Sprechen lernende Kind motiviert, sich mit sprachlich-narrativen Phänomenen zu befassen und wird nach und nach mit Wortkenntnis, Grammatik, Satzbau sowie mit dem Wissen um die Symbol- und Kommunikationsfunktion von Sprache vertraut gemacht.
In der ersten, der prä- und paraliterarischen Phase der Lesesozialisation gibt es verschiedene kulturell etablierte Formen, die Kinder noch vor dem eigenen Lesen an den Umgang mit Schriftsprache heranführen. Eine semi-literarische Kommunikationsform, die bereits im frühesten Kindesalter praktiziert wird und als Brücke zwischen Schriftlichkeit und Mündlichkeit für die Kinder bezeichnet werden kann, ist das Vorlesen und die Anschlusskommunikationen über das Gelesene (vgl. Hurrelmann 2003a, S. 184). Durch die elaborierte Mündlichkeit, die das Vorlesen darstellt, wird die Schriftlichkeit vorbereitet. Wie groß die Bedeutung des (Vor-)Lesens für die sprachliche Entwicklung von Kindern ist, zeigten Bruner und Ninio bereits 1978 in ihren Untersuchungen zum frühen Spracherwerb (vgl. Bruner/Ninio 1978): In der Interaktion zwischen Mutter und Kind beim gemeinsamen Betrachten eines Bilderbuches lernt das Kind noch vor seinem dritten Lebensjahr elementare literarische Regeln wie den Symbolcharakter des im Buch Gezeigten. Es kann den „Übergang von der Behandlung der Welt als Inbegriff von ‚Objekten für Handlungen’ zu einer Sicht der Welt, in der es primär um ‚Objekte der Betrachtung’ geht“, vollziehen (Hurrelmann 1994, S. 20). Durch die Möglichkeit der andauernden Betrachtung des Bilderbuches und des kontinuierlichen sprachlichen Handlungszusammenhangs findet das Kind beim ‚Lesen’ von Büchern zu einer „kontemplativen Haltung, in der es sich selbst ein Stück weit von der Welt abzugrenzen und unterscheiden lernt“ (ebd.). Die Vorlesesituation hat aber nicht nur eine Schlüsselfunktion für die Sprachentwicklung, wie Bruner und Ninio entdeckten, sie stellt auch eine Schlüsselsituation für den Literaturerwerb und die Entwicklung der Schreibkompetenz dar.
In erster Linie lernt das Kind durch die vorlesende Person den Umgang mit situationsabstrakter und dekontextualisierter Sprache (vgl. Snow/Ninio 1986). Es hängt von der Kompetenz des erwachsenen Vorlesers ab, inwieweit sich eine Vermittlung zwischen den Anforderungen des Textes auf der einen Seite und den Fähigkeiten und dem Erfahrungshorizont des Kindes auf der anderen Seite einstellt. Eine von Nähe und Intimität geprägte Rezeptionssituation und eine „Atmosphäre der intellektuellen Partnerschaft zwischen Erwachsenen und Kindern“, konstatiert Hurrelmann, sei für das kompetente Vorlesen aber ebenso wichtig. Wird das Vorlesen als Pflichtübung absolviert oder beispielsweise als Mittel zur Ruhigstellung vor dem Einschlafen etc. funktionalisiert, wirkt es eher kontraproduktiv (vgl. Hurrelmann 1998, S. 137). Vorlesesituationen als pädagogisches Zwangsarrangement, wie sie in unteren sozialen Schichten häufig beobachtet werden, verstellen möglicherweise schon in einem sehr frühen Alter einen lustvollen Zugang zur Literatur. Durch Beobachtungen von Vorlesesituationen zwischen Eltern - insbesondere von Müttern, da diesen in der Vor- und Frühphase der literarischen Sozialisation in der Regel nach wie vor die Aufgabe der Einführung in die „Sphäre symbolischer Weltdarstellung“ (Hurrelmann 1999, S. 188) zufällt - und Kleinkindern zeigte sich, dass schon in dieser frühen Phase auffallende schichtspezifische Unterschiede zu beobachten sind (vgl. Wieler 1998). Vor allem in Familien der mittleren sozialen Schichten wird die gemeinsame Bilderbuch-Rezeption im Sinne einer idealen Sprachlernsituation an eine spezifisch musterhafte Ausprägung von Vorlesegesprächen gebunden. Mütter niedrigerer sozialer Schichten und geringeren Bildungsniveaus lassen die Interaktion mit ihren Kindern während des Vorlesens nicht in dem Maß zu wie Mütter mit höheren Schulabschlüssen. Fragen und Themenabweichungen werden in sehr viel geringerem Maße toleriert, obwohl besonders das aktive Mittun der Kinder die Leselernbereitschaft fördert (vgl. Scheerer-Neumann 2003, S. 513). Wie ein restringierter oder elaborierter Sprachcode innerhalb der Familie weitergegeben wird, so wird also auch ein restringierter oder elaborierter ‚Literaturcode’ auf die Kinder übertragen.
Andere prä- und paraliterarische Kommunikationsformen, die Kinder an Schriftlichkeit heranführen, sind das Bilderbuchlesen, Geschichten erzählen, Lieder singen, Wortspiele erfinden, Kinderreime und -gedichte lernen. Diese Übergangsformen sind medial mündlich, weisen aber verschiedene Grade konzeptioneller Schriftlichkeit auf. Aus den Erkenntnissen der idealtypischen Entwicklung von Literacy in der Familie lässt sich ableiten, dass dieser spielerische und mündlich dominierte Umgang mit Schriftsprache phonologische Bewusstheit und damit auch spätere Lese- und Schreibleistungen fördert (Dehn / Sjölin 1996, S. 1148). Besonders die Formen, die eine Aktivität von Seiten des Kindes voraussetzen, wie das Lernen von Reimen oder Wortspiele machen, eignen sich durch ihren spielerischen Charakter vornehmlich als Übergangshilfen in die Schriftsprache. Vielen Eltern, besonders den Vätern, sind diese Formen der Kommunikation allerdings gänzlich unbekannt, obwohl sie ein hohes sprachliches und literarisches Anregungspotenzial bieten (vgl. Becker/Elias et al. 2002, S. 194).
Nicht nur weil sie die frühesten Einflüsse auf die Kinder im Leseentwicklungsprozess hat, ist die Familie - nach übereinstimmender Forschermeinung - die wichtigste Instanz zur Vermittlung von Lese- und, durch ihre Hinführung zur Schriftlichkeit auch von Schreibkompetenz, sie hat durch die Möglichkeit der alltäglichen, diffusen und ungeplanten Einflussnahme auch die nachhaltigsten Einflüsse (vgl. Groeben/Hurrelmann 2002, S. 138). Die Prozesse der literarischen Sozialisation werden von der Familie nicht nur vor Schuleintritt geprägt, sondern auch während der schulischen Lese- und Schreiberziehung.
Die Kinder erfahren zunächst durch Beobachtung und Koorientierung, welchen Sinn und Wert das Lesen und auch das Schreiben in ihrer sozialen Umgebung hat. Hierbei spielt die Vorbildfunktion der Eltern eine wichtige Rolle. In einer Studie der Stiftung Lesen zum Leseverhalten in Deutschland zeigte sich, dass die Lesepraxis von Schülerinnen und Schülern sehr stark mit der elterlichen Lesepraxis zusammenhängt. Siebenundsiebzig Prozent der als „Vielleser“ klassifizierten Kinder haben Eltern, von denen mindestens einer regelmäßig liest (vgl. Stiftung Lesen 2001). Lesepraxis ist natürlich nicht mit Lesekompetenz gleichzusetzen, eine intensive Lesepraxis ist jedoch eine wichtige Voraussetzung für den Kompetenzerwerb. Die Lesesozialisationsstudie zum Leseklima in der Familie hat bezüglich der Vorbildfunktion der Eltern gezeigt, dass große geschlechtsspezifische Unterschiede hinsichtlich des Leseverhaltens der Eltern bestehen. Hierbei zeigt nur die Buchlektüre Auswirkungen auf das Leseverhalten der Kinder, das Zeitung- und Zeitschriftenlesen der Eltern hat keine Bedeutung (vgl. Hammer / Hurrelmann 1994, S. 7). Nicht nur dass die Frauen eine höhere Affinität zum Bücherlesen vorweisen, sie gehören auch seltener der Gruppe der extremen Wenigleser an[3]. Sie lesen insgesamt häufiger und auch länger als Väter. Grundlegende Geschlechterunterschiede der Eltern fallen ebenfalls bei den Leseerfahrungen auf: Für die Mütter ist das genießende Lesen und die ästhetisch-reflexive Rezeption ausschlaggebend, die Väter zielen in erster Linie auf die kognitiv-intellektuelle Form der Verarbeitung ab. Die Wichtigkeit der sozial-emotionalen Beteiligung für Frauen spiegelt sich auch in ihren Buchgattungsinteressen wider. Sie favorisieren „Frauenliteratur“ vor „Biographien“, außerdem „Bücher über Menschenkenntnis“ sowie „Kochbücher“ und „Bücher über Gesundheit“. Das Spektrum der für Mütter interessanten Gattungen, die sich größtenteils mit psycho-sozialen Inhalten auseinandersetzen, ist breiter als das der Männer, die sich hauptsächlich für sachorientierte Themen interessieren (vgl. Hurrelmann et al., ²1995). Dieses weiter gefächerte Spektrum der Leseinteressen der Mütter steht in einem deutlich positiven Zusammenhang mit der Lesefreude der Kinder.
Auch als Schreibvorbild tritt die Mutter häufiger in Erscheinung: z. B. durch Tagebucheintragungen, Briefe, Notizen im Haushalt etc.
Die Vorbildwirkung der Mutter, aber auch des Vaters in Bezug auf die Vermittlung der Wertschätzung des Schreibens spielt in der Familie eine große Rolle: Kinder, die Erwachsene nur bei pragmatischem Schriftgebrauch wie dem Ausfüllen von Formularen etc. sehen, werden eher eine Reduktion der Schrift auf ihren normativen Anspruch vornehmen und sich dem unter Umständen gerade widersetzen, bis sie eigene Erfahrungen mit dem kulturellen Umgang mit Schrift machen und diese als Anstoß zur Bewältigung bedrängender Wünsche kennen lernen (vgl. Dehn / Sjölin 1996, S. 1149).
Die dargestellten Differenzen im Lese- und Schreibverhalten der Eltern deuten bereits an, dass vor allem die Mutter als Lese- und Schreibvorbild hervorzuheben ist (vgl. Hurrelmann 2002, S. 193). Besonders entscheidend ist, dass die Buchlektüre der Mütter häufiger in das Familiengeschehen integriert ist als die Lesetätigkeit der Väter, die in den meisten Familien in größerer Distanz zur Familieninteraktion stattfindet. Dadurch haben die Väter nur am Rande Vorbildwirkung für die Kinder.
Die Mutter ist die zentrale Bezugsperson für die Lese- und auch Schreibentwicklung, solange die zentrale Erziehungs- und Betreuungsarbeit bei ihr liegt, so Hurrelmann (ebd.). In einer Befragung von 153 männlichen Bibliotheksnutzern im Alter zwischen sechs und achtzehn Jahren, von Mai bis Juli 2001, gaben die befragten lesenden Jungen allerdings an, dass nur etwa 70% ihrer Mütter und 50% ihrer Väter läsen (Heidtmann/Bischof 2002a, S. 260f.). Außerdem konnte im Zuge dieser Studie kein Unterschied zwischen dem Einfluss des Leseverhaltens der Mütter und dem der Väter festgestellt werden. Dass es sich allerdings positiv auf das Leseverhalten der Jungen auswirkt, wenn überhaupt eines der Elternteile regelmäßig liest, wurde auch hier bestätigt (ebd., S. 261f.). Inwieweit sich die Kölner Lesestudie und die von Bischof und Heidtmann beschriebene Untersuchung vergleichen lassen, ist fraglich, da es sich bei der Befragung von Heidtmann und Bischof um eine empirisch nicht repräsentative Querschnittsuntersuchung handelt. Außerdem sind bei der Kölner Untersuchung von Hurrelmann, Hammer und Nieß die Familien selbst eingebunden worden, während in der Erhebung von 2001 nur die Schüler zum Leseverhalten ihrer Eltern befragt wurden. Hinzu kommt, dass es sich in der Untersuchung von 2001 nur um die Gruppe lesender Jungen handelt, da die Daten in Bibliotheken erhoben wurden und so davon ausgegangen werden kann, dass Bibliotheksbenutzer nicht zur Gruppe der Wenigleser zählen. Außerdem wird die sozialisierende Funktion des Geschlechts der kindlichen Bezugsperson hier offenbar übersehen[4]. Diese Umfrage ist meines Erachtens dadurch nicht in der Lage die Ergebnisse von Hurrelmann zu widerlegen.
Das Lesevorbild der Eltern spielt zwar eine entscheidende Rolle in der Lesesozialisation, die Leseentwicklung der Kinder baut sich aber insgesamt vor allem über die sozialen Bezüge der Lesetätigkeit auf (vgl. Hurrelmann 1994, S. 7, 79; Bischof/Heidtmann 2002b, S. 31). Die soziale, selbstverständliche Einbindung der Buchlektüre in den Familienalltag, d. h. sowohl in interaktiver als auch kommunikativer Weise, ist bedeutsam. Kinder aus Familien, in denen gemeinsames Erleben von Lesesituationen, Gespräche über das Gelesene und gemeinschaftliche Besuche von Buchhandlungen und Bibliotheken stattfinden, lesen länger und häufiger und haben auch mehr Freude an der Buchlektüre. Lesen im familialen Kontext darf also nicht isoliert sein, sondern es sollte, wenn es eine stabile, intrinsische Lesemotivation zum Ziel haben soll, den Kindern möglich sein an den Leseerfahrungen der Eltern teilzunehmen.
Die diffuse, selbstverständliche Einbindung der Buchlektüre in den Alltag hat weitaus positivere Auswirkungen als eine bewusste Leseerziehung durch die Eltern. Vor allem wenn diese mit forcierter Leseförderung in erster Linie Leistungs- und Aufstiegsziele für die Kinder verbinden, die Kinder ihre Eltern aber als wenig vertraut mit Büchern wahrnehmen, können Ermahnungen zum Lesen demotivierende Wirkung zeigen (vgl. Hurrelmann 1994, S. 8). Kinder am Ende ihrer Grundschulzeit wollen in Bezug auf ihr Leseverhalten weder ermahnt noch kontrolliert werden. Das Lesen oder Nicht-Lesen dient für sie zum Teil als Beziehungsregulierung in Bezug auf die Eltern. Viele Eltern entsprechen zwar dem Anlehnungsbedürfnis und dem noch ausgeprägten Verlangen nach Nähe, das Kinder über ihr Lesen ausdrücken; ebenso wichtig ist aber die Akzeptanz, wenn über die Lektüre Distanz geschaffen werden soll, indem sich die Heranwachsenden im Lesen einen Bereich von Erfahrungen, Abenteuern und Träumen zu sichern versuchen, der nur ihnen selbst gehört.
Andere Bedingungsfaktoren, die prominenten Einfluss auf den Erwerb der Lesekompetenz und den Schriftlichkeitserwerb allgemein haben, sind der Sozialstatus und die Bildung der Eltern. Die Bildung der Eltern kann aber nicht schon selbst als Erklärung für die unterschiedliche Entwicklung der Kinder gelten, vielmehr sind die meisten Faktoren, über die sich Lesefreude und feste Lesegewohnheiten konkret vermitteln, mit Bildungsvoraussetzungen eng verknüpft. Die Schichtzugehörigkeit ist sogar ein wichtigerer Indikator für die Entwicklung der Lese- und auch Schreibfähigkeiten als das Alter. In den verschiedenen sozialen Schichten gibt es deutliche Überlappungen der Leistungsverteilung; der Zusammenhang zwischen Sozialschicht und Schriftlichkeitskompetenz kann somit als eng, aber nicht determinierend interpretiert werden (vgl. Bos et al. 2003, S. 282). Diese Schichtabhängigkeit wurde auch durch Untersuchungen zur Entwicklung von Sprachbewusstheit und Sprachanalyse, den kognitiven Aspekten des Schriftlichkeitserwerbs, gezeigt (vgl. Ferreiro / Teberosky 1982). Sie bezieht sich demnach nicht nur auf die Lese-, sondern ebenso auf die Schreibkompetenz.
Die Ausstattung einer Familie mit Büchern z.B. lässt deutlich ihren sozialen Status erkennen und wird als Indikator für die Bildungsnähe angesehen (vgl. Bos et al. 2003, S. 50). Während Familien niedrigerer Bildung und Schicht ihre Kinder häufiger mit elektronischen Medien wie eigenem Fernseher, Videorekorder, Computer oder Stereoanlage ausstatten, achten Eltern aus den oberen Schicht- und Bildungsniveaus auf eine „höhere Zugangsschwelle“ zur unkontrollierten Nutzung dieser Medien (vgl. Hurrelmann et al. ²1995, S. 35). Sie versuchen den Medienkonsum ihrer Kinder dadurch in Richtung Buch zu lenken. Kinder können heute zwar in verschiedenen Medienumwelten zu Lesern werden, die Einschränkung des Fernsehkonsums stellt aber eine wichtige Entwicklungsbedingung dar (vgl. ebd., S. 80). Mit den neuen Medien sind dem Buch zwar scharfe Konkurrenten gewachsen, eine simple Substitution findet aber nicht statt (vgl. Groeben 2002, S.11). Durch empirische Forschung wurde die Verdrängungsthese weitgehend falsifiziert, so Groeben. Vielmehr muss zwischen verschiedenen Mediennutzungsmustern unterschieden werden, in denen das Lesen eine mehr oder weniger konstitutive Rolle einnimmt. Es können also nicht nur in rein buchorientierten Elternhäusern Kinder zu Lesern heranwachsen, auch in Familien, in denen vielfältige Medienaktivitäten stattfinden, sind die Voraussetzungen für eine Entwicklung zum Leser gegeben. Werden audiovisuelle Medien nur zu Unterhaltungszwecken genutzt, verringert dies die Chancen einer erfolgreichen Lesesozialisation. Die selektive Nutzung elektronischer Medien in einer Familie und eine im Vordergrund stehende Nutzung von Printmedien bieten die günstigsten Bedingungen für eine Entfaltung der kindlichen Lesefähigkeit (vgl. Hurrelmann et al. ²1995, S. 6). Nach Schön ist es in der Regel allerdings so, dass von einem zu eng gefassten Lesebegriff ausgegangen wird, wenn von der Verdrängung des Lesens durch neuere Medien gesprochen wird. Gemeint ist unausgesprochen das literarische Lesen auf einem ästhetisch hohen Niveau und dieses hat historisch stets nur in einer kleinen Gruppe stattgefunden, so dass der Verlust dieser „Lesekultur“ in der breiten Schicht nicht beklagt werden könne (vgl. Schön 1999). Trotz dieser kritischen Stimmen (vgl. auch Bertschi-Kaufmann 2000, S. 25) scheint der Begriff der Lesekultur die insgesamt leseförderliche und –motivierende Haltung von Familien, Schulen und außerschulischen gesellschaftlichen Institutionen gut zu umschreiben. Mit Lesekultur ist keinesfalls nur die Beschäftigung mit Hochliteratur gemeint, hier stimme ich Bertschi-Kaufmann zu (vgl. ebd.), sondern eine von verschiedenen Seiten getragene Einstellung dem Lesen gegenüber, die sich in mannigfaltigen Anregungen und Unterstützungsmöglichkeiten äußert.
Es ist insgesamt aber nicht zu ignorieren, dass mit der Expansion des Fernsehangebots und der Ausweitung des Fernsehkonsums das elterliche Lesevorbild immer weniger geboten wird und dass Familien - hier ist Schön beizupflichten- besonders der unteren Sozial- und Bildungsschichten Kindern reichere Chancen bieten, Fernseh- statt Buchkonsumenten zu werden, da der Fernseher bei ihnen sehr viel selbstverständlicher als das Buch in den Alltag eingebunden wird.
Dass Lesen eine zentrale Kulturtechnik darstellt, die für die Teilhabe an einer schriftbasierten Kultur als unverzichtbare Voraussetzung gilt, ist in der Literatur häufig herausgestellt worden (vgl. z. B. Richter / Christmann 2002; Schreier/Rupp 2002; Hurrelmann 2003). Welche Rolle diese aber in unserer sich zur Informations- und Mediengesellschaft veränderten und noch verändernden Gesellschaft einnimmt, wird kontrovers diskutiert. Auf der einen Seite steht die Annahme, dass die Lesekompetenz gerade für den Umgang mit neueren Medien eine Basiskompetenz darstellt (vgl. z.B. Christmann / Groeben 1999; Hurrelmann 2003). Eine Begründung, die diese Auffassung der Bedeutung von Lesekompetenz unterstreicht, ist, dass Lesen die ergiebigste Quelle des Begriffslernens und die beste Übungsform für den Umgang mit elaborierter Sprache darstellt (vgl. Hurrelmann 1994, S. 20). Betrachtet man das Lesen als Informationsaufnahme und das Lesen als Unterhaltung getrennt voneinander, gilt es als gesichert, dass das Lesen den Aufbau einer Interessenstruktur fördert, die die Informationsaufnahme durch verschiedenste Medien unterstützt (vgl. Hurrelmann 2003, S. 4). Die Fähigkeit konzeptuelle Schriftlichkeit zu verstehen braucht ein Kind nicht nur, um mit medial schriftlichen Texten umgehen zu können, sondern auch um Informationstexte und argumentative Texte der audiovisuellen Medien begreifen zu können (vgl. Hurrelmann 1998, S. 130). Für das Verständnis und den Lerneffekt informativer Fernsehsendungen hat sich herausgestellt, dass regelmäßiges Lesen und die damit verbundene aktive und kognitiv anspruchsvolle Rezeptionsweise größere Bedeutung haben als sicherer routinierter Umgang mit dem Medium Fernseher. Habituelle Leser lernen dadurch, dass sie die bewussteren Rezipienten sind, nicht nur mehr aus Fernsehsendungen, sie sind auch die kritischeren Zuschauer, wodurch ihr Kompetenzvorsprung wiederum vergrößert wird (vgl. ebd.). Auch in Bezug auf Hyper(media)texte präsentiert sich Schrift in neuen ästhetischen Zusammenhängen. Die strukturelle Besonderheit von multimedialen Textversionen, in denen die Schrift. in Verbindung mit weiteren Zeichensystemen steht und in eine Hypertextstruktur eingebunden ist, besteht in einer gelockerten Kohärenz und einer der konzeptionellen Mündlichkeit nahen Ausdrucksweise (vgl. Bertschi-Kaufmann 2000, S 29)
Die Position, dass Lesekompetenz durch den Fernsehkonsum sukzessive immer bedeutungsloser werden wird und auch die Kindheit verdrängen wird, wie sie seit den 1980er Jahren z. B. von Postman vertreten wird (vgl. Postman 1984), ist m. E. durch die Untersuchungen und Ausführungen von Hurrelmann, Groeben etc. nicht haltbar.
Die Nutzung von Büchern ist also mit besonderen kognitiven Leistungen und sozialen Interaktionsprozessen verbunden, die den regelmäßigen Leser zu einem kompetenteren Nutzer anderer Medien werden lassen. Wenn aber eine weit entwickelte Lesefähigkeit die Basiskompetenz für die souveräne Nutzung des gesamten Medienangebots darstellt, bedeutet Leseabstinenz zugleich auch eine massive Erschwerung des Umgangs mit den elektronischen Medien.
Die Notwendigkeit und die Wichtigkeit von Lesekompetenz in Bezug auf die informatorische Funktion kann also auch im Zusammenhang mit dem Erwerb von Medienkompetenz nicht angezweifelt werden. Die Unterhaltungsfunktion des Lesens scheint dagegen eher durch andere, elektronische Medien wie Hörkassetten, Filme oder Computerspiele ersetzbar zu sein. Inwiefern sich geschlechtsspezifische Unterschiede in diesem Bereich auswirken und welche möglichen Ursachen in Frage kommen, wird weiter unten thematisiert.
Die kindliche Sozialisation in der Familie hat also entscheidenden Einfluss auf die Vorkenntnisse der Kinder hinsichtlich der bereits erfahrenen und verfügbaren konzeptionellen Schriftlichkeit. Von großer Bedeutung für die anfängliche Entwicklung der schriftlichen Sprachproduktion und für die kontinuierlichen Aspekte des Schreibenlernens sind zum einen der ungesteuerte Erwerbsprozess von Funktionen des Lesens und Schreibens in der Familie, zum anderen der ungesteuerte Erwerb von Textstrukturkenntnissen auch in Bezug auf monologische Texte durch das Hören von Geschichten, die die Bezugspersonen erzählen. Außerdem wirkt die Familie durch ihren Einfluss auf die mündliche Sprachkompetenz des Kindes auf dessen Entwicklung in der ersten Primarschulzeit ein. Die Einblicke in die Schrift, die viele Kinder bereits vor der Einschulung besitzen, können drei Kategorien zugeteilt werden (vgl. Scheerer-Neumann 2003, S. 514):
1. Schriftzeichen repräsentieren in irgendeiner Form gesprochene Sprache. Als Beispiel für die frühe Unterscheidung von Mündlichkeit und Schriftlichkeit kann das Verstellen der Stimme und die besondere Ausdrucksweise angeführt werden, die Kinder nutzen, wenn sie tun, als ob sie vorläsen. 2. Schrift hat eine kommunikative Funktion. Unter frühkindlichen Schreibungen von Kindern im Alter von erst vier oder fünf Jahren existiert ein beträchtlicher Anteil von „››Briefen‹‹, Hinweisschildern und Wunschzetteln und sogar Beschimpfungen“ (ebd.). 3. Außer diesen grundsätzlichen Erkenntnissen erlangen die Kinder sehr konkrete Vorkenntnisse. Hier sind Buchstabenkenntnisse und zum Teil sogar das ganzheitliche Lesen und Schreiben einzelner ausgesuchter Wörter anzuführen. Die Erkenntnisse der ersten beiden Kategorien gewinnen Kinder durch Anregungen in der Familie. Dieser Komplex von Anregungen und Unterstützungen, den die Familie schon im frühen Alter der Kinder leisten kann, unterscheidet sich nicht nur quantitativ, sondern in erster Linie qualitativ nach Schicht und Bildungsgrad. Die Qualität wird von der Passung an die Entwicklungsbedürfnisse der Kinder und der Anregung zu Anschlusskommunikationen bestimmt. Für Kinder aus bildungsferneren und damit auch buchferneren Familien bedeutet dies allerdings, dass sie mit sehr viel geringeren Einblicken in die Schriftlichkeit den Schulanfang meistern müssen. Kinder aus schriftfernen Elternhäusern haben im Anfangsunterricht des Lesens und Schreibens oft wesentliche Probleme überhaupt zu verstehen, was von ihnen verlangt wird.
Hurrelmann schließt daraus, dass die Probleme, die viele Kinder mit dem Lesenlernen und Schreibenlernen hätten, eher aus den Schwierigkeiten entstünden, die der Umgang mit der Schriftsprache bereitet, als aus den Schwierigkeiten, die mit dem Erwerb der ‚technischen’ Lesefähigkeit verbunden seien (Hurrelmann et al. ²1995, S.64).
3.1.2 Geschlechtsspezifische Unterschiede
Trotz vergleichbarer familialer Voraussetzungsgefüge lassen sich beträchtliche Unterschiede zwischen dem Leseverhalten der Mädchen und dem der Jungen ausmachen. Obwohl die Mädchen nachweislich keine intensivere familiale Förderung erfahren, entwickeln sie größere Lesefreude, lesen häufiger und auch länger als ihre Altersgenossen. Dementsprechend ist auch ihre Lesefertigkeit besser entwickelt. Sie können aber nicht nur besser lesen, sie nennen auch andere, weniger starke, Lesehemmungen als Jungen. Bei Jungen geht die Wahl zwischen anderen Freizeitbeschäftigungen und dem Lesen häufig zuungunsten des Lesens aus, was vielleicht auch dadurch zu begründen ist, dass das Lesen von Jungen wegen ihrer etwas schlechteren Lesefertigkeit als noch anstrengender empfunden wird. In Bezug auf das Schreibverhalten kann ähnliches konstatiert werden: Mädchen schreiben längere und anspruchsvollere Texte (vgl. Brügelmann 1994, S. 17), wodurch sich auch hier ein Übungseffekt einstellt. Ob die Schreibförderung in Bezug auf die Textproduktion auch geschlechtsegalitär verläuft, ist m. E. zweifelhaft: Mädchen werden durch Geschenke wie Tagebücher, Briefpapier, Poesiealben häufiger dazu angehalten, sich schriftlich auszudrücken.
In Bezug auf die Lektürevorlieben kann man in typisierender Zuspitzung sagen, dass Mädchen –wie ihre Mütter– stärker an Fiktionslektüre, literarischer Unterhaltung und Jungen ebenso wie ihre Väter stärker als Mädchen an Informations- und Sachlektüre, also einer Verbindung von Lesen mit pragmatischem Nutzen interessiert sind. Die Leseweisen, die diesen Vorlieben entsprechen, sind auf der einen Seite stärker emotional-identifikatorisch und auf der anderen Seite stärker kognitiv-intellektuell. Mädchen berichten wesentlich häufiger als Jungen, dass ein Buch sie schon einmal stark berührt hat (vgl. Runge 1997, S.32). Für sie ist die sozial-emotionale Dimension des Lesens wichtig, das genießende und reflexive Lesen nimmt für sie ebenso wie für ihre Mütter eine prominente Rolle ein (vgl. Hurrelmann et al. ²1995, S. 32). Mädchen sind in stärkerem Maße bereit, sich emotional zu beteiligen, sie gehen schneller affektive und reichere Beziehungen zu Büchern ein. Jungen hingegen halten mehr Distanz, sie betonen kognitive Modi der Rezeption stärker, haben dadurch weniger belohnende Leseerfahrung. Neuere Untersuchungen ergaben, dass Jungen sich neben dem Lesen aus informatorischen Gründen auf Comics und spannungs- und aktionsorientierte Genres beschränken (vgl. Bischof/ Heidtmann 2002b, S. 27ff.). Wenn Jungen literarische Fiktion lesen, fragen sie eher nach einer möglichen Rückführung auf die Realität, technische Analyse liegt ihnen näher als empathische Einfühlung (vgl. Barth 1997, S. 19f.). Die Intensität der Leseerfahrungen zeigt aber wiederum Auswirkungen auf die Lesefreude, Lesehäufigkeit und Lesedauer (vgl. ebd.). Lassen sich Kinder von Büchern intellektuell und sozial-emotional ansprechen, steigen ihre Gratifikationserwartungen, was sich in stabiler Lesemotivation niederschlägt. Die besseren Leseleistungen der Mädchen, die auch PISA und IGLU quittieren (vgl. Deutsches PISA-Konsortium 2001, S. 251ff.; Bos et al. 2004, S. 71), hängen scheinbar mit dieser höheren Lesemotivation und der daraus resultierenden umfangreicheren Lesepraxis zusammen. Töchter profitieren mehr als die Söhne von der Leseförderung innerhalb der Familie, die wie oben bereits erwähnt, die Institution mit der nachhaltigsten Wirkung auf die Gratifikationserwartungen der Kinder ist.
An dieser Stelle soll noch einmal betont werden, dass aus der Geschlechtszugehörigkeit nicht automatisch geschlossen werden kann, ob sich ein Kind viel oder wenig mit Texten auseinandersetzt. Ebenso wie es unter den Mädchen schlechte Leserinnen und Schreiberinnen gibt, finden sich auch Jungen in der Leistungsspitze des schriftsprachlichen Bereichs.
[...]
[1] Neuhaus-Siemon weist aber darauf hin, dass die Validität eines Teils der Daten hinsichtlich der Befragungen zum Nachahmungslernen der Mädchen eingeschränkt sei, da die Angaben der LehrerInnen über die Motive des frühen Lesenlernens nur auf die nachträgliche Einschätzung der Eltern und Kinder selbst gestützt seien.
[2] Einzige Ausnahme: ein nicht signifikantes Ergebnis in Klasse 5, was auf den „Deckeneffekt“ zurückzuführen ist, d. h. der verwendete Text war zu leicht, um im oberen Bereich noch differenzieren zu können (vgl. Richter 1996, S. 101).
[3] Nach eigenen Angaben finden sich unter den befragten Müttern insgesamt 2%, unter den befragten Vätern 7% Wenigleser, deren Lesedauer weniger als zehn Minuten täglich beträgt (Hurrelmann/Hammer/Nieß ²1995, S. 33).
[4] Vgl. 3.1.3 zur genaueren Erläuterung des Einflusses der geschlechtsspezifischen Sozialisation.
- Arbeit zitieren
- Anne Kathrin Göhmann (Autor:in), 2004, Die Entwicklung von Lese- und Schreibfähigkeiten bei Grundschulkindern - geschlechtsspezifische Unterschiede, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/34333
Kostenlos Autor werden




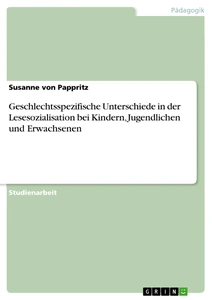

















Kommentare