Leseprobe
Inhalt
1. Einleitung
2. Schulische Berufsorientierung im historischen Kontext
2.1 Berufsorientierung in der Schule nach 1945
3. Die Hauptschule: Konzeption und Realität
3.1 Zur Lebenswelt und Ausgangssituation von Hauptschülern
3.2 Die Shell-Studie 2002: Werte und Wertetypen unter Jugendlichen
3.2.1 Idealisten
3.2.2 Unauffällige
3.2.3 Macher
3.2.4 Materialisten
3.2.5 Demographische und soziale Struktur der Wertetypen
3.3 Die Erwartungen der Wirtschaft an Hauptschüler
4. Berufsorientierung in der Hauptschule
4.1 Die Rolle der Bundesagentur für Arbeit
4.2 Das Betriebspraktikum
5. Berufsorientierung und Lebensplanung
5.1 Berufsorientierung und Lebensplanung in der Grundschule
5.2 Defizite der schulischen Berufsorientierung
5.3 Lebensplanung als Erweiterung der Berufsorientierung
5.3.1 ICH-Bildung
5.3.2 Selbsterfahrung
5.3.3 Erkundung der Arbeits- und Berufswelt
5.4 Exkurs: Leben und arbeiten außerhalb der Erwerbsarbeit
6. Lokales Kapital für Soziale Zwecke „LOS“
6.1 Allgemeines
6.2 LOS in Kassel Oberzwehren
6.3 Konzepte der Arbeitsgemeinschaften
6.3.1 Voraussetzungen
6.3.2 Die Durchführung
6.3.3 Perspektive des Projektes
7. Berufsorientierungs- und Lebensplanungsseminare des Werra-Meißner-Kreises
7.1 Allgemeines
7.2 Exkurs: Warum Seminare zur Berufsorientierung und Lebensplanung außerhalb der Schule?
7.3 Seminartypen
7.4 Seminarablauf für eine achte Hauptschulklasse
7.4.1 Wer bin ich?
7.4.2 Fähigkeitenparcours
7.4.3 Was will ich werden?
7.5 Seminarablauf für eine neunte Hauptschulklasse
7.5.1 Bewerbungstraining
7.5.2 Vorbereitung auf das Vorstellungsgespräch
7.5.3 Rollenspiele
7.5.4 Vorstellungsgespräch
8. Literatur
1. Einleitung
Die aktuelle Diskussion im Deutschen Bildungswesen hat nach der PISA-Studie, durch die sich schwer wiegende Mängel des deutschen Schulwesens auftaten, die Hauptschule erreicht. Nun erwartete Deutschland voller Spannung die neue OECD-Studie „Bildung auf einen Blick“, in der die zusammengeschlossenen 30 Industrienationen jährlich auf ihr Bildungswesen hin untersucht werden. Die Ergebnisse der aktuellen Studie wurden in Deutschland in der Öffentlichkeit rege diskutiert; die Tages- und Wochenpresse war voll von Beiträgen zu diesem Thema. So stellte etwa Kahl (2004a) heraus:
„23 Prozent der 15-Jährigen gehören zur so genannten Risikogruppe, bei denen es fraglich ist, ob sie je einen Beruf bekommen ... Während die OECD-Länder durchschnittlich 12,7 Prozent der öffentlichen Haushalte für Bildung aufwenden (Tendenz steigend), verharrt Deutschland seit 1995 unverändert bei 9,7 Prozent.“
Betroffen von dieser Situation sind die Schüler aller in Deutschland existierenden Schulformen, vor allem aber Hauptschulabgänger. Lehmann und Füller stellen fest: „Auf der Strecke bleiben immer noch sozial Schwache.“ (Lehmann, A.; Füller, C. 2004b, S. 3) Während in allen Ländern sowohl bei der PISA- als auch der OECD-Studie 2004 die Länder Spitzenpositionen belegen, in denen ein Gesamtschulsystem existiert, welches die Schülerinnen bis zur neunten oder zehnten Klasse vereinigt, hält Deutschland an seinem dreigliedrigen Schulsystem fest. Bundesbildungsministerin Edelgard Bulmahn geht sogar so weit, es als siebengliedrig zu bezeichnen, indem sie neben Gymnasien, Realschulen und Hauptschulen auch diverse Sonderschulformen und Förderstufen mit einbezieht (vgl. ebd.). Hieraus, so Lehmann und Füller, ergebe sich ein echtes „Schulwirrwar“. Jutta Almendinger vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung stellt fest:
„Die Ausleseverfahren, die wir uns in unserem dreigliedrigen Schulsystem leisten, führen weder zu einer breiten Spitze von Eliteschülern, noch verhindern sie, dass wir beinahe 25 Prozent gering Gebildeter produzieren.“ (Füller, C. 2004a, S. 18.)
Welche Perspektiven ergeben sich daraus für eine hoch entwickelte Industrienation wie die Bundesrepublik Deutschland? Wie können 25 Prozent, also ein Viertel eines Altersjahrgangs, in die Gesellschaft unseres Landes integriert werden und wie kann man sie auf diesen Prozess vorbereiten? Einen zentralen Stellenwert nimmt der Beruf bei der Teilhabe an der Gesellschaft ein. Der Zugang aber wird von den Leistungen, welche in der Schule erbracht wurden, also vom Schulabschluss bestimmt. Zudem macht der aktuelle Strukturwandel in Wirtschaft und Gesellschaft die Eingliederung von Absolventen der unteren Bildungsabschlüsse in die Wirtschafts- und Arbeitswelt schwierig.
Das Schulfach „Arbeitslehre“ soll eine Vorbereitung auf diese veränderte Wirtschafts- und Arbeitswelt leisten, doch ist es nicht in allen Bundesländern vertreten. Bisher wird das Fach nur in der Haupt-, Gesamt- und Sonderschule angeboten, doch Dedering forderte es nach der PISA-Studie für alle Schulformen, da es „... für eine umfassende Bildung des Menschen unverzichtbar und zudem eine angemessene Antwort auf den Strukturwandel in Wirtschaft und Gesellschaft (ist)“ (Dedering, H. 2002a).
Wie kann das Fach Arbeitslehre in unserer heutigen Situation die Schüler auf ihr Leben in Beruf und Gesellschaft vorbereiten? Wie kann das Fach auf die neuen Anforderungen reagieren? Und wie kann es den Schülern, die mit geringen Chancen das Schulsystem verlassen, Hilfestellungen geben? Bei den eingangs beschriebenen Defiziten des Deutschen Schulsystems und der daraus resultierenden Ungleichheit der Bildungschancen muss nach neuen Formen der Vorbereitung auf die Arbeits- und Wirtschaftswelt gesucht werden.
Als die Hauptschule Mitte der sechziger Jahre entstand, wurden hier noch die meisten Schüler eines Altersjahrganges vereint (vgl. Spiewak, M. 2004). Heute hat sich die Hauptschule zu einer „Restschule“ entwickelt, was nach einer fundierten und umfangreichen Vorbereitung der Schüler auf die neuen Anforderungen verlangt. Die vorliegende Arbeit will untersuchen, inwieweit die Hauptschule die Vorbereitung auf die Arbeits- und Wirtschaftswelt leistet. Dazu werden die Werte, die Lebenswelt sowie Ausgangsbedingungen und Erwartungen der Schüler und Schulabgänger überprüft und inwiefern eine Orientierung auf den Beruf stattfindet, ob diese noch zeitgemäß ist und wie die Orientierung ggf. zu erweitern wäre. Zudem wird ein Blick auf die Beteiligten und deren Beitrag geworfen.
Neben dem aktuellen Stand der Diskussion um diesen Themenkomplex, der aus der vielfältigen Literatur zur Berufsorientierung in der Hauptschule herausgefiltert wird, soll ein historischer Abriss die Entwicklung des auf die Arbeits-, Wirtschafts- und Gesellschaftswelt vorbereitenden Unterrichts aufzeigen, um den heutigen Stellenwert der Orientierungshilfe ermessen zu können.
Insgesamt soll deutlich werden, dass die Schüler und Schülerinnen, welche die Hauptschule mit oder ohne Abschluss verlassen, heute mehr denn je konkrete Hilfestellungen zur eigenen Lebensgestaltung und -planung brauchen, denn die Wirtschafts-, Arbeits- und Gesellschaftswelt empfängt sie nicht mit offenen Armen. Ihnen müssen Mittel und Möglichkeiten an die Hand gegeben werden, um in dieser Umwelt bestehen zu können. Es soll überprüft werden, ob dazu entsprechende Mittel und Möglichkeiten zu finden sind und ob sie in der Schule oder an anderen Lernorten vorhanden sind.
Der Autor arbeitet seit zwei Jahren als Lehrperson an Seminaren zur Berufsorientierung und Lebensplanung des Werra-Meißner-Kreises mit und ergänzte damit ein Team, das bis dahin vornehmlich aus Sozialarbeitern bestand, auch mithilfe der Kenntnisse aus dem Studium des Lehramtes im Fach Arbeitslehre. Nachdem noch ein Wirtschaftspädagoge in Ausbildung dazustieß, unternahm das nun neue Team eine Neukonzeption des bisherigen Seminaraufbaus. Im Laufe der Zeit konnte festgestellt werden, dass die Inhalte bei den Schülern auf fruchtbaren Boden fielen und die Auseinandersetzung mit der eigenen Persönlichkeit in dieser Art und Weise für viele neu war, aber gut angenommen wurde. So tauchte die Frage auf, warum die Inhalte der Seminare nicht auch im Schulfach „Arbeitslehre“ Anwendung finden können. Die Relevanz von lebensplanenden Inhalten im Schulunterrichts konnte der Autor zudem durch seine Mitwirkung an der AG „Fit fürs Leben“ an der Georg-August-Zinn-Schule/Europaschule in Kassel-Oberzwehren erfahren, an der er als Leiter einer Arbeitsgemeinschaft mitwirkte. Beide Projekte richten sich an Hauptschüler der achten oder neunten Klasse. Deren Probleme im Hinblick auf den baldigen Schulabschluss und die große Sorge, ob sie dann einen Ausbildungsplatz finden können, führten den Autor zum Thema der vorliegenden Arbeit, zumal er selbst nach seinem Hauptschulabschluss 1991 eine Ausbildung zum Industriemechaniker Maschinen und Systemtechnik absolvierte.
2. Schulische Berufsorientierung im historischen Kontext
Der Themenkomplex der Berufsorientierung war schon immer politisch okkupiert und die Hinführung zur Arbeitswelt ein von den verschiedenen politischen Strömungen sehr unterschiedlich instrumentalisierter Prozess. Hofsäss stellt fest: „Das Bildungssystem erhält ... die Funktion der beständigen Brauchbarmachung der Gesellschaftsmitglieder für wirtschaftliche und machtpolitische Verwertbarkeit, also der Herstellung optimal verwertbaren ‚Humankapitals‘.“ (Hofsäss, T. 2002, S. 19f.) Heute spricht man eher von einer Hinführung zur Befähigung des Einzelnen, sich zum eigenen und gesellschaftlichem Wohl zu betätigen. Warum aber wurde sich so schwer damit getan, Berufsorientierung als Unterricht an allgemein bildenden Schulen einzuführen? Dammer wirft dazu folgende Fragen auf:
„warum bis heute weder die Arbeitslehre noch irgendein anderes einheitliches Berufswahlorientierungskonzept für alle allgemein bildenden Schulformen gleichermaßen verbindlich eingeführt werden konnte,
warum es nie zu einer – in der Sache zweifellos sinnvollen – organisatorischen Zusammenarbeit zwischen beruflichen und allgemein bildenden Schulformen kam und
warum Schulformprestige und Berufswahlorientierung sich umgekehrt proportional zueinander verhalten, d. h. warum mit zunehmenden Prestige der Schulform der Berufswahlorientierung geringere Bedeutung beigemessen wird.“ (Dammer, K. H. 2002, S. 34)
Zur Beantwortung der Fragen sollen im Folgenden die Wurzeln der schulischen Berufsorientierung, also des Faches Arbeitslehre betrachtet werden.
Bereits im 18. und 19. Jahrhundert, beim Übergang von der ständischen in die bürgerliche Gesellschaft (vgl. Beinke, L. 1977, S. 23ff.), wurden im Zuge der einsetzenden Industrialisierung Forderungen nach einer beruflichen Vorbildung laut, die man bis dahin nicht kannte. Die Stände und Zünfte verloren mehr und mehr ihre integrative und gesellschaftlich stützende Funktion. Eine Beratung der Heranwachsenden im Hinblick auf ihre spätere berufliche Ausbildung wurde obligatorisch. Hier wurde geprüft, ob der Jugendliche die notwendige Begabung für den angestrebten Beruf aufwies und ob dieser ihm ein späteres Auskommen ermöglichte (vgl. ebd., S. 24f.). Zudem wurde der beruflichen Ausbildung mehr Inhalt, ein systematischer Aufbau sowie die Kontrolle von beidem verliehen (vgl. ebd.). Die sich verändernde Wirtschaftswelt brachte neue Heraus- und Anforderungen an den Beruf mit. Die den kleinen Handwerksbetrieben nun gegenübergestellten Großbetriebe forderten – interessanterweise ebenso wie heute, wo sich die Arbeitswelt erneut stark wandelt, – mehr Flexibilität, d. h., man war nicht mehr wie früher auf einen eng umrissenen Beruf festgelegt, sondern musste mit Änderungen rechnen.
Das heute übliche Bild von einer ehedem übersichtlichen Berufswelt ist nicht korrekt (vgl. ebd., S. 27), bereits im 13. Jahrhundert weist eine Liste aus Frankreich 101 Berufe aus, welche man erlernen konnte. Diese Anzahl stieg im Laufe der Jahre stetig weiter an. So wurde eine Orientierung für die Berufswelt notwendig. Als Konsequenz bildeten sich in Deutschland ab dem 18. Jahrhundert Schulmodelle, die den Veränderungen im Zuge der industriellen Revolution Rechnung trugen und die notwendige berufliche Orientierung anboten. Dedering verweist darauf, dass die Wurzeln der Arbeitslehre zunächst in der von dem Schweizer Johann Heinrich Pestalozzi (1746–1827) maßgeblich geprägten Industrieschule (18./19. Jahrhundert), in der Unterricht, Produktion, Lernen und Arbeiten miteinander verbunden waren, und später in der bürgerlichen und der sozialistischen Arbeitsschule (zu Beginn des 20. Jahrhunderts) zu suchen sind (vgl. Detering, H. 1994, S. 178ff. und 183).
In der Elementarschule der damaligen Zeit war es üblich, theoretischen mit praktischem Unterricht zu kombinieren. In der Industrieschule sollten wichtige Arbeitstugenden vermittelt werden, durch Entlohnung der Schüler wurde deren wirtschaftliche Situation und die der Eltern entscheidend entschärft. Diese Entlohnung wurde durch den Verkauf von hergestellten Gütern finanziert, die Schulen waren größeren Betrieben angeschlossen, welchen sie zuarbeiteten (vgl. Dedering 1994, S. 184f.). Damit sollte der Schüler auf seine zukünftige berufliche Tätigkeit vorbereitet werden. Ziel war es außerdem, die Heranwachsenden charakterlich zu festigen und sie moralisch und sittlich verwerflichen Einflüssen zu entziehen (vgl. ebd., S. 184). Die Industrieschule verbreitete sich rasch über ganz Deutschland, gerade auch aufgrund der starken staatlichen Unterstützung. Dedering drückt die Gründe folgendermaßen aus:
„Es wurden fleißige und geschickte Arbeitskräfte gewonnen, verwertbare Produkte hergestellt, neue Beschäftigungsbereiche eingeführt, die Heranwachsenden auf ihre zukünftige Berufsarbeit vorbereitet, die bettelnden Kinder von der Straße geholt und das Problem der Armenfürsorge entschärft. In den Industrieschulen standen Handarbeiten in der Landwirtschaft (Gartenarbeit, Seidenraupenzucht, Bodenveredelung, Züchtung von Sämereien u. a.), im Textil- und Wollgewerbe (Spinnen, Zwirnen, Stricken, Stopfen, Weben, Nähen, Häkeln, Klöppeln u. a.) und im Handwerk (Herstellung von Produkten, wie z. B. geflochtene Pantoffeln oder Tapeten aus Stoffresten) im Mittelpunkt.“
(Dedering, H. 1994, S. 185)
Die ökonomischen Aspekte der Industrieschule wurden immer wichtiger, wodurch man sich immer weiter vom Ideal Pestalozzis entfernte, der unter dem Begriff Industrie nicht die Massenproduktion verstand, sondern folgendes Ideal in ihr verwirklicht sah:
„... die Industrie mache den Menschen vielseitig, sie fördere die Selbsttätigkeit und das rationelle und selbstständige Denken des Menschen, sie sei die eigentliche Antriebskraft, die ihn zu immer neuen Handlungen treibe, sie forme die Gesamtpersönlichkeit, bedinge eine besondere Lebenshaltung und trage zur allgemeinen Menschenbildung bei.“ (Vgl. Kaiser, F.-J. 1974, S. 20f. zit. n. Dedering, H. 1994, S. 185)
Aufgrund von sich ändernden Produktionsweisen (vgl. Dedering, H. 1994, S. 185) und dem stetig wachsenden Grad an Mechanisierung konnten sich die Industrieschulen nicht mehr finanzieren. Das Interesse der Wirtschaft und des Staates an ihnen verblasste, und sie wurden zu üblichen Elementar- oder Volksschulen.
Anfang des 19. Jahrhunderts setzte sich dann ein neues Bildungsverständnis durch. Der deutsche Bildungstheoretiker Alexander von Humboldt sprach sich für eine konsequente Trennung von beruflicher und allgemeiner Bildung aus:
„Alle Schulen aber, deren sich nicht ein einzelner Stand, sondern die ganze Nation oder der Staat für diese annimmt, müssen nur allgemeine Menschenbildung bezwecken. Was das Bedürfnis des Lebens oder eines einzelnen seiner Gewerbe erheischt, muss abgesondert und nach vollendetem allgemeinen Unterricht erworben werden. Wird beides vermischt, so wird die Bildung unrein und man erhält weder vollständige Menschen noch vollständige Bürger einzelner Klassen.“ (Humboldt, W. v. 1964, S. 188, zit. n. Dammer, K.-H. 2002, S. 35.)
Hier haben wir also eine Begründung für die eingangs beschriebene Geringschätzung der beruflichen Bildung in der Schule. Man meinte, dass nur die Kinder des Proletariats es nötig hatten, sich beruflich schulen zu lassen, und dass nur bei ihnen die wirtschaftliche Notwendigkeit bestand, eine Industrieschule zu besuchen. Die allgemein bildende Schule hingegen klammerte explizit den Beruf aus und konzentrierte sich auf eine idealistisch ausgerichtete Funktion als „Buchschule“ (Dedering, H. 1994, S. 190). Mit der Auflösung der Industrieschulen war das Ende von Berufsorientierung im allgemeinen schulischen Rahmen vorerst erreicht. Die gehobene Schulbildung bekam durch Humboldt den Platz zugewiesen, den sie noch heute innehat (vgl. Dammer, K.-H. 2002, S. 37). Das Gymnasium mit anschließendem Abitur gilt nach wie vor als höchstes Ziel. Darauf baut die Dreigliedrigkeit des deutschen Bildungswesens auf (vgl. ebd., S. 38), ein Aspekt, der für diese Arbeit noch von zentraler Bedeutung sein wird.
Die von Georg Kerschensteiner Ende des 19. Jahrhunderts und Beginn des 20. Jahrhunderts geforderte Arbeitsschule mit ihrer starken Ausrichtung auf die spätere Arbeitswelt wurde später zwar dahingehend kritisiert, dass sie von den Akteuren in Staat und Wirtschaft instrumentalisiert werden konnte, um fügsame angepasste Arbeiter/Angestellte zu erhalten (vgl. Detering 1994,S. 192f), doch Kerschensteiner formulierte das Ziel wie folgt: „Es sollen Menschen erzogen werden, die den Zweck und den Segen des Staatsverbandes an der Wurzel erfassen lernen und ihm in Dankbarkeit ihre Dienste widmen.“ (Kerschensteiner, G. 1954, S. 107, zit. n. Detering, H. 1994, S. 190) Kerschensteiner, der als Lehrer das Bedürfnis der Schüler nach praktischer Betätigung kannte, sah den dringenden Reformbedarf der „verkopften“ Schule des ausgehenden neunzehnten und beginnenden zwanzigsten Jahrhundert. Er forderte eine Schule, die
„Raum gibt für die Selbsttätigkeit der Schüler: Die Schule muss ‚ein reiches Feld für manuelle Arbeit‘ bieten;
auf die gegenwärtige und zukünftige Lebenspraxis der Kinder bezogen ist: Es sind Arbeitsgebiete einzurichten, die mit dem außerschulischen Leben der Kinder in Verbindung stehen (berufliche und häusliche Arbeitswelt der Eltern u. a.), z. B. in der (Holz- und Metall-)Werkstatt, im Laboratorium (für den Physik- und Chemieunterricht), in der Schulküche, im Schulgarten, im Zeichen- und Musiksaal;
die Einordnung in eine Gemeinschaft („Arbeit im Dienste der Mitschüler“) ermöglicht: es sollen Arbeitsgemeinschaften erschaffen werden, in denen soziale Einstellungen und Verhaltensweisen (Mitverantwortungen, Selbstbeherrschung u.a.) wachsen können.“ (Dedering, H. 1994, S. 190)
Kerschensteiner sieht den Sinn der „Arbeitsschule“ in der Erziehung zum „brauchbaren Staatsbürger“ (vgl. ebd., S. 191), der in der Lage ist, seinen Platz im Gefüge des Staates einzunehmen. Damit ebnete er den Weg für die Berufsorientierung in den allgemein bildenden Schulen.
Nach dem Ersten Weltkrieg verlor die Idee der Arbeitsschule an Bedeutung (vgl. ebd., S. 193), erst die Nationalsozialisten verankerten wieder praktischen Unterricht in Form der Fächer Werken für Jungen und Textilarbeit für Mädchen in der Volksschule.
Einen interessanten Ansatz zur beruflichen Vorbildung und der Orientierung in der Arbeits- und Berufswelt bietet im nachrevolutionären Russland die sozialistische Arbeitsschule nach Pawel Petrowitsch Blonsky (1848-1941). Dieser Schultyp wurde umgesetzt, später aber unter Stalin wieder verworfen (vgl. ebd., S. 196). Die sozialistische Arbeitsschule orientierte sich an der Marx’schen Bildungskonzeption und sollte eine Vorbereitung der Schüler auf eine „klassenlose Gesellschaft“ gewährleisten (vgl. ebd., S. 198). Somit erfüllte sie ähnliche Aufgaben wie die bürgerliche Arbeitsschule nach Kerschensteiner, nur unter anderen ideologischen Voraussetzungen: Hier sollten keine ergebenen Staatsbürger im monarchistischen Sinne erzogen werden (vgl. ebd., S. 191), sondern der „neue Mensch“ des Sozialismus. Die sozialistische Arbeitsschule bietet dazu ein geschlossenes Konzept zur arbeits- und berufsorientierten Bildung. Vom 3. bis zum 18. Lebensjahr lebten und arbeiteten die Schüler gemeinsam. Die Eingangsstufe bildet der Kindergarten, in dem spielerisch die Tätigkeiten der Erwachsenen nachgeahmt werden (vgl. ebd., S. 197). In der anschließenden Elementarschule wird ein Überblick über die einzelnen Arbeitsbereiche gegeben, die Kinder lernen anhand praktischer Tätigkeiten Ackerbau, häusliche Arbeit und das Bearbeiten von verschiedenen Materialien (Holz, Metall u. Ä.) kennen. Ab dem 14. Lebensjahr besuchen die Jugendlichen die Jugendarbeitsschule, sie arbeiten einen Teil der Schulzeit mit den Erwachsenen in den Betrieben und Fabriken, den anderen Teil verbringen sie mit wissenschaftlichen Studien, treiben Sport und beschäftigen sich mit Literatur und Kunst.
Dedering meint, die sozialistische Arbeitsschule gehe noch wesentlich über die bürgerliche Arbeitsschule hinaus und bezieht sich auf Folgendes:
„die wechselseitige didaktische Durchdringung von betrieblicher und schulischer Arbeit (in Form von Betriebspraktika, schulischen Propädeutika u. a.);
die allgemeine Berufsvorbereitung durch praktische Arbeit in verschiedenen Berufs- und Wirtschaftsbereichen;
die pädagogisch gestaltete Arbeit als empirisches und didaktisches Mittel zum Verständnis und zur Verbesserung der Betriebsarbeit;
die Ausprägung einer positiven Einstellung des Jugendlichen zu Technik, Rationalisierung und Arbeitsteilung und eines positiven Selbstbewußtseins des Arbeitenden als Antriebskraft für eine Humanisierung der Arbeit;
die Anerkennung des objektiven Arbeitswertes an sich (neben der erzieherischen Wirkung auf das Subjekt);
die positive Beurteilung der betrieblichen Mitbestimmung und des Miteigentums;
die Möglichkeit zur fruchtbaren Kooperation zwischen Lehrern, betrieblichen Ausbildern und Eltern in pädagogisch gestalteten Arbeitssituationen.“ (Dedering, H. 1994, S. 199)
Zusammenfassend muss festgestellt werden, dass der Bedarf an beruflicher Bildung und einer Orientierung Heranwachsender in der Wirtschafts-, Arbeits- und Berufswelt einerseits erkannt und in verschiedenen Schulformen auch umzusetzen versucht wurde (Industrieschule, bürgerliche Arbeitsschule, sozialistische Arbeitsschule), andererseits wurde berufliche Bildung instrumentalisiert und den jeweilig vorherrschenden politischen Dogmen unterworfen. Die Entwicklung der Berufsorientierung im heutigen Sinne setzte erst in den fünfziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts ein.
2.1 Berufsorientierung in der Schule nach 1945
Nach dem Zweiten Weltkrieg machte zunächst der Mangel an Ausbildungs- und Arbeitsplätzen eine berufliche Orientierung nötig (vgl. Dedering, H. 2002, S. 17). Die bald einsetzenden Veränderungen der Arbeits- und Berufswelt kamen hinzu. Ab der Mitte der 50er-Jahre herrschten andere Verhältnisse, nun bestand ein Überangebot von Lehrstellen; im Jahr 1960 blieben 250 000 Lehrstellen unbesetzt (vgl. Stooß, F. 1999, S. 225), die Betriebe nahmen jeden Schulabgänger auf, und 300 000 Schüler und Schülerinnen gingen ohne Berufsausbildung sofort von der Schule in den (ungelernten) Beruf (vgl. ebd.). In den sechziger Jahren gab es im Schnitt nur 20 000 meist kurzfristig arbeitslose Berufsschulpflichtige (vgl. ebd., S. 226).
Das Allgemeinbildungskonzept nach Humboldt verlor erst in den sechziger Jahren wieder an Relevanz, vor allem weil man nach der nationalsozialistischen Diktatur und dem Zweiten Weltkrieg wieder Anschluss an die Sozialforschung anderer Länder fand (vgl. Kahnsitz, D.; Ropohl, G.; Schmid, A 1997, S. 5). Die neueren Forschungen stellten die sozialisatorische Interaktion und das soziokulturelle Milieu der Heranwachsenden mehr in den Mittelpunkt (vgl. ebd.). 1953 wurde der Deutsche Ausschuss für das Erziehungs- und Bildungswesen eingerichtet, der aus ehrenamtlichen unabhängigen Fachleuten bestand. Bis zum Jahr 1965 verabschiedete er eine Reihe von Gutachten und Vorschlägen. Durch seine Zusammensetzung, die von vornherein auf Kompromissfindung aus war, wurden die meisten der Vorschläge übernommen (vgl. Rekus, J; Hintz, D.; Ladenthin, V. 1998, S. 217).
Der Deutsche Ausschuss verstand die Hauptschule als „Eingangsstufe des beruflichen Bildungsweges“ mit dem „Beruf als didaktisches Zentrum“ (DA 1964/1966, S. 381; 7/8, S. 21, zit. n. Rekus, J; Hintz, D; Ladenthin, V. 1998, S. 220). 1964 forderte er die Einrichtung eines Fachs Arbeitslehre, in welchem die Vorbereitung auf eine selbstständige Berufswahl geleistet werden sollte (vgl. Bigga, R. 2001, S. 65).
1969 definierte die Kultusministerkonferenz die Arbeitslehre als Fach, in welchem eine „Hinführung zur Berufswahl“ erreicht und „auf der Grundlage praktischen Tuns ... am Ende der 9. Klasse eine revidierbare Berufsentscheidung stehen soll“ (KMK 1969, S. 29; zit. n. Dedering, H. 2002, S. 20). Als ein Kernbestandteil wurde die Vermittlung von Arbeitstugenden angesehen. Ebenfalls im Jahr 1969 wurde die damalige Bundesanstalt für Arbeit im Berufsbildungsgesetz zur Zusammenarbeit mit der Schule verpflichtet. Seit diesem Zeitpunkt arbeiten beide im Berufswahlvorbereitungsunterricht zusammen, insbesondere der Berufsberatung kommt dabei die Aufgabe zu, Kontakt zu Schulen und Lehrern zu halten (vgl. Dedering, H. 2002, S. 21). Damit sollte die berufliche Orientierung an allgemein bildenden Schulen im Fach Arbeitslehre eingebettet sein.
Damit kam nach Ansicht der Kultusministerkonferenz der Hauptschule folgende inhaltliche Aufgabe zu:
„Allgemeine Orientierung über die Wirtschafts- und Arbeitswelt. Die Darstellung der Strukturen und Leistungsanforderungen der Wirtschafts- und Arbeitswelt soll unter technischen, wirtschaftlichen und sozialen Gesichtspunkten erfolgen.
Einführung zur Berufswahl. Die Orientierung über Berufsfelder, Berufsgruppen und Berufe soll Berufsentscheidungen ermöglichen.
Dabei wurden drei Aggregationsebenen gesellschaftlicher Institutionalisierung (Rolle, Organisation, Gesamtsystemebene) unterschieden:
Beruf (erwähnt wurde u.a. Berufsorientierung, Berufswahl, Aufstieg und Fortbildung),
Betrieb (u.a. Arbeitsorganisation, Betriebshierarchie, Kooperation und Konflikt, Arbeitszeit) und
Markt (u.a. Konkurrenz, Interessenverbände).“
(KMK 1969, S. 78f., zit. n. Kahnsitz, D.; Ropohl, G.; Schmid, A. 1997, S. 7f.)
3. Die Hauptschule: Konzeption und Realität
Auf Empfehlung des Deutschen Ausschusses sollte in der Hauptschule der Beruf im Zentrum stehen. Außerdem war mit der Namensgebung „Haupt-Schule“ verbunden, dass diese Schulform von einer Mehrzahl der Schüler und Schülerinnen besucht wird (vgl. Zenke, K. G. 2003, S. 83). In den fünfziger Jahren besuchten tatsächlich 80 Prozent eines Altersjahrganges die siebte Klasse der Volksschule (vgl. ebd.). Folgende Minimalanforderungen wurden vom Deutschen Ausschuss an die neue Hauptschule gestellt:
1. „Nach einer für alle Kinder gemeinsamen Förderstufe in den Klassenstufen 5 und 6 sollte die Hauptschule als vierjährige Sekundarstufe eingerichtet werden, also die Stufen 7 bis 10 umfassen.
2. Mittelpunkt des Curriculums sollte die bereits skizzierte Orientierung an Berufs- und Arbeitswelt sein. Dafür sollte – gleichsam als weiteres Hauptschulfach – Arbeitslehre als Integration fachtheoretischer und praktischer Gegenstände eingerichtet werden. Didaktisch innovativ war dabei u. a. der Gedanke, die Bereiche Technik, Werkarbeit, Wirtschaftslehre einschließlich der auf Haus und Familie bezogenen ökonomischen, ökologischen und ernährungswissenschaftlichen Grundfragen sowie Politik und Sozialkunde zu verknüpfen, also den einzelfachlichen Horizont des Lehrplans problemorientiert und fächerübergreifend zu erweitern.
3. Die Hauptschule sollte nach Größe, nach personeller, räumlicher und sächlicher Ausstattung so eingerichtet werden, dass der Vielfalt an Lernvoraussetzungen, Lerninteressen, Lerngeschwindigkeiten und Bildungsperspektiven innerhalb der großen Mehrheit der Jugendlichen in Deutschland in einem System der Differenzierung nach inhaltlichen Profilen, Leistungsniveaus und Abschlüssen entsprochen werden könne. In einer zeitgemäßeren Formulierung könnten wir heute sagen: Lernen in heterogenen Gruppen, aus den Unterschieden der Schülerinnen und Schüler Nutzen für alle ziehen, diese Grundsätze waren der Hauptschulpädagogik gleichsam in die Wiege gelegt.
4. Als Regelziel sollte dieser Bildungsgang einen mittleren Abschluss führen, der nach Erfüllung bestimmter Kriterien auch den Übertritt in die gymnasiale Oberstufe eröffnen sollte. Deshalb war es selbstverständlich, dass ab Klasse 5 eine Fremdsprache in den Lehrgang aufzunehmen war.
5. Die Lehrerbildung für diese Hauptschule sollte im Vergleich zur tradierten Volksschullehrerausbildung wesentlich verbessert werden. Nach Dauer, Qualität und Abschluss des Studiums an einer Universität sollten die Hauptschullehrer und -lehrerinnen den so genannten akademischen Lehrämtern gleichgestellt werden, ebenso im Hinblick auf Besoldung und die Ausstattung der Deputate.“ (Zenke, K. G. 2003, S. 83f.)
Aus der Hauptschule sollten sich für alle Bereiche der Wirtschaft Nachwuchskräfte rekrutieren. Die neue Schule sollte außerdem dem ständisch orientierten Statusdenken im Bildungsbereich entgegenwirken (vgl. ebd., S. 84f.).
Doch die Hauptschule hat dies nicht leisten können. Der Druck der alten Bildungsvorstellungen und die noch verstärkte Chancenungleichheit im deutschen Bildungswesen haben sie zu dem schrumpfen lassen, was sie heute ist: Aus der Volksschule mit einer Vereinigung von 80 Prozent eines Altersjahrganges wurde eine „Restschule“, die nur noch von 22,6 Prozent besucht wird. Hauptschüler weisen extreme schulische Defizite auf. Die PISA-Studie brachte endgültige traurige Gewissheit über den Zustand der heutigen Hauptschule. Sie unterteilte in fünf Kompetenzstufen in den Bereichen Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften. Diejenigen Schüler, welche nicht über die Kompetenzstufe beispielsweise im Bereich Lesen hinauskommen, werden
„... nicht in der Lage sein, bei der Industrie- und Handelskammer einen einfachen Test für die Berufseinstellung zu bestehen ...
... sie sind nicht in der Lage, auch schlicht formulierte Zeitungsartikel so zu verstehen, dass sie sich selber eine politische Meinung bilden können ...
... sie haben keine hinreichende Lesefähigkeit, um einen eigenen Fortbildungsprozess zu betreiben ...“ (Tillmann, K.-J. 2003, S 119f.)
Folgt man den Ergebnissen, haben 56 Prozent aller Hauptschüler am Ende ihrer Schulzeit keine ausreichende Lesekompetenz (vgl. ebd., S. 120). Somit sind sie nach den Maßstäben der PISA-Studie nicht fähig, einen Test zur Aufnahme eines Lehrverhältnisses zu bestehen, und damit nicht in der Lage, sich in die Arbeits-, Wirtschafts- und Berufswelt unserer Gesellschaft zu integrieren. Eine Berufsorientierung und Lebensplanung wird somit dringend notwendig.
Die Hauptschule steht nach Engelhardt generell zur Disposition (vgl. Engelhardt, H. 2000, S. 107), was er an sinkenden Schülerzahlen und den Entwicklungen in den neuen Bundesländern festmacht. Hier ist in vier der fünf neuen Länder keine Hauptschule im herkömmlichen Sinne mehr vorhanden. Entweder ist sie in anderen Schulformen aufgegangen (Sachsen: Differenzierte Mittelschule, Sachsen-Anhalt: Sekundarschule, Thüringen: Regelschule), oder sie ist wie in Brandenburg in die Gesamtschule eingeflossen (vgl. ebd., S. 106).
Engelhardt beschreibt, dass sich die Hauptschule zu einem Ort mit überproportional hohem Ausländeranteil und einem Sammelbecken für Jugendliche aus sozial schwachen Verhältnissen entwickelt hat (vgl. ebd., S. 107f.). Die Schulform Hauptschule hat bei den Eltern ein äußerst schlechtes Image. Wenn Eltern, unabhängig davon, welche Schulform ihre Kinder besuchen, den einzelnen Schulformen Noten geben dürften, würden im Westen und Osten Deutschlands 36 Prozent von ihnen die Hauptschule mit vier bis sechs bewerten. Die Gesamtschule schneidet nur unwesentlich besser ab, im Westen bewerten sie 27 Prozent mit vier bis sechs, im Osten 23 Prozent (vgl. ebd., S. 117). Auch wenn die Eltern keinen Einblick in die Vorgänge innerhalb der Schulform haben, schneidet sie trotzdem schlecht ab.
Hier zeigt sich ein generelles Akzeptanzproblem, eine Stigmatisierung der Schulform sowie der darin untergebrachten Schüler und Schülerinnen. Bei den Eltern, welche ein oder mehrere Kinder auf der Hauptschule haben, schneidet diese hingegen relativ gut ab: 40 Prozent der Eltern geben an, ein gutes Vertrauensverhältnis zu den Lehrern ihres Kindes zu haben, 44 Prozent betonen, dass sich die einzelnen Hauptschulen bemühen, ihre Kinder zu fördern, und 81 Prozent sehen keine Unterforderung ihrer Kinder. In allen anderen Schulformen sind diese Werte niedriger (vgl. ebd., S. 118). Die Eltern scheinen also durchaus zufrieden mit den Hauptschulen ihrer Kinder zu sein.
Im Gegensatz dazu steht das Urteil der Hauptschüler selbst: Sie geben ihrer Schule zu 26 Prozent die Note vier bis sechs.
Weiterhin gibt es im Vergleich zu anderen Schulformen in der Hauptschule die höchste Anzahl von Schülern, die nicht gern zur Schule zu gehen (vgl. ebd., S. 120). Dieser Umstand wird, ebenso wie das niedrige Selbstwertgefühl von Hauptschülern, im Folgenden noch eingehender behandelt.
Fragt man indes nach konkreten Verhältnissen innerhalb der Schule – etwa nach dem Vertrauensverhältnis zu den Lehrern, ob die Schüler ihren Unterricht mitgestalten können oder ob ihnen die Lehrer auch schwierige Sachverhalte näher bringen können –, schneidet die Hauptschule gemeinsam mit der Gesamtschule am besten ab (vgl. ebd., S. 121).
Werden die Lehrer aller Schulformen nach den Bewertungen aller Schulformen gefragt, so schneidet auch hier die Hauptschule am schlechtesten ab. Wird die Befragung jedoch auf die jeweils eigene Schulform angewendet, so bewerten immerhin 54 Prozent der Hauptschullehrer und -lehrerinnen ihre Schulform mit einer Eins oder Zwei. Stellt man konkrete Fragen über das pädagogische Anliegen wie „‚das Bemühen um eine gezielte Förderung der Schüler‘ oder ‚das Eingehen auf die Erfahrungen und Probleme der Schüler‘, schneidet die Hauptschule im Lehrerurteil sogar erheblich besser ab als die Realschule und das Gymnasium“ (ebd., S. 123).
Mit dem Imageproblem der Hauptschule haben vor allem die Schüler dieser Schulform zu kämpfen. Engelhardt führt das schlechte Renommee vor allem auf die negative öffentliche Meinung zurück (vgl. ebd., S. 122). Denn richtet man den Blick auf die Stimmungslage der einzelnen Beteiligten der Hauptschule (Eltern, Schüler, Lehrer), so fällt bei allen Akteuren auf, dass sie selbst „ihre Schule“ eher positiv bewerten, ganz im Gegensatz zu den Außenstehenden.
3.1 Zur Lebenswelt und Ausgangssituation von Hauptschülern
Jeder, der schon einmal mit Hauptschülern im Unterricht zusammengearbeitet hat, sieht sich zwangsläufig mit folgenden Aussagen konfrontiert: „Ich bin/Wir sind doch eh nur Hauptschüler“ und, wenn etwas nicht so funktioniert, wie es sich der Unterrichtende vorstellt: „Was erwarten Sie? Wir sind hier in der Hauptschule.“
Die Aussagen zeigen, dass den Schülern ihre Situation mehr als deutlich bewusst ist, sie schrauben die Erwartungen an sich selbst herunter oder versuchen andere durch solche Aussagen dazu zu bringen, die Erwartungen an sie selbst zu reduzieren. Doch wo liegen die Gründe für diese Einstellung, warum stigmatisieren sich die Schüler in diesem Maße selbst, welche Umstände bringen sie dazu, ein derartiges Selbstbild aufzubauen, das mit dem Bild des regen, flexiblen, durchsetzungsstarken Menschen unserer modernen Leistungsgesellschaft absolut nicht konform geht?
Bei der Analyse der Berufsorientierungshilfe für Hauptschüler, die in unserer Arbeits- und Wirtschaftswelt eine sinnvolle Lebensplanung und einen realistischen Entwurf der eigenen zukünftigen Lebenswelt beinhalten und selbstständige Gesellschaftsmitglieder hervorbringen soll, muss man sich deren aktuelle Lebenswelt ansehen und in welchem gesellschaftlichen Kontext sie stehen.
Der Wahl der Ausbildungsform und der damit verbundenen Positionierung in Bezug auf den zukünftigen Status in der Gesellschaft kommt heute eine weit größere Bedeutung zu als früher. In vorindustrieller Zeit spielte die familiäre Herkunft die entscheidende Rolle (vgl. Linssen, R.; Leven, I; Hurrelmann, K. 2002, S. 53f.). Im Gegensatz dazu wird heute die spätere Teilhabe an der Gesellschaft durch die Qualifikationen und Legitimationen des jeweiligen Schulsystems bestimmt (vgl. ebd., S. 54). Es erscheint nur logisch, dass die Qualifikationsmöglichkeiten am unteren Ende dieses Systems (Haupt- und Sonderschule) diejenigen Gesellschaftsmitglieder hervorbringt, welche am wenigsten an gesellschaftlichen Prozessen teilhaben können.
Bereits am Bildungshintergrund der Eltern lässt sich zumeist festmachen, zu welcher Statusgruppe die Jugendlichen später zählen werden. Als Statusgruppen sind hier Unterschicht, untere Mittelschicht, Mittelschicht, obere Mittelschicht und Oberschicht gemeint (vgl. ebd.). Der Unterschicht gehören 10 Prozent und der unteren Mittelschicht 27 Prozent der Jugendlichen zwischen 12 und 25 Jahren in Deutschland an. Die Shell-Jugendstudie stellt dazu fest, dass sich die „Bildungschancen nicht unabhängig vom Bildungshintergrund der Eltern ...“ betrachten lassen. „Mithin kann von einem durchlässigen, jedoch nicht durchmischenden Schulsystem die Rede sein ...“(Ebd., S. 55)
Generell lässt sich feststellen, dass Mädchen mittlerweile die Jungen in höher qualifizierenden Schulabschlüssen überrundet haben: Im Gymnasium sind 43 Prozent aller Schülerinnen und 39 Prozent aller Schüler versammelt. Genau umgekehrt stellt sich das Bild in der Haupt- und Sonderschule dar: 19 Prozent aller Schülerinnen steht ein Jungenanteil von 24 Prozent gegenüber (vgl. ebd., S. 63). Die Abhängigkeit vom soziokulturellen Hintergrund lässt sich auch daran erkennen, dass 49 Prozent der Haupt- und Sonderschüler aus der Unterschicht und 33 Prozent aus der unteren Mittelschicht stammen (vgl. ebd.). Damit kommen 82 Prozent aller bundesdeutschen Haupt- und Sonderschüler aus benachteiligten, durch die Gesellschaft stigmatisierten Schichten der Bevölkerung. Daraus lässt sich schließen, dass ein Großteil des anfangs erwähnten Minderwertigkeitsgefühls bereits von der häuslichen Umgebung mitgebracht wird. Wie stark sich das Prestige der mittleren oder oberen Schulbildung in den Köpfen der Schüler der Hauptschule festgesetzt hat, zeigt die Aussage eines Drittels der Hauptschüler, wonach sie einen mittleren oder höheren Bildungsabschluss anstreben, also einen höheren als den Hauptschulabschluss, auf welchen sie zurzeit hinarbeiten (vgl. ebd., S. 65). Das wiederum zeigt, wie wenig sich die Jugendlichen mit der von ihnen besuchten Schulform identifizieren. Sie streben nach einem höheren Abschluss, ob sich dies aber im Blick auf das einzelne Individuum wirklich realisieren lässt, sei dahingestellt. Im Rahmen der in dieser Arbeit beschriebenen Projekte stellte sich oft heraus, dass die Möglichkeiten des Einzelnen doch meist dem Wunsch nach einem höheren Bildungsabschluss entgegenstand. Eine Hauptschülerin, deren Versetzung stark gefährdet ist, spricht vom Realschulabschluss, als hätte sie bereits mit ihrer jetzigen Bildungsform abgeschlossen und erst danach beginne ihr eigentlicher schulischer Werdegang. Umso härter muss diese Schülerin am Ende ihrer Schulzeit die Realität treffen. 25 Prozent aller Schüler in der Hauptschule haben bereits eine Klasse wiederholt, bei 32 Prozent ist die Versetzung gefährdet (vgl. ebd., S. 68f.). Das daraus resultierende Gefühl, selbst am unteren Ende der Skala nicht mithalten zu können, verstärkt das ohnehin allgegenwärtige Minderwertigkeitsgefühl.
Die meisten Eltern wünschen sich einen guten Schulabschluss und damit eine bessere Positionierung ihrer Kinder in der Berufs-, Wirtschafts- und Arbeitswelt sowie den damit verbundenen gesellschaftlichen Status. So entsteht noch mehr Druck auf die einzelnen Schüler, der nicht unterzubewerten ist (vgl. ebd., S. 68). Auch Hurrelmann und Jeske sehen „Gefahren wie die Schwächung des Selbstwertgefühls, somatische oder psychische Gesundheitsstörungen oder Stigmatisierungen“ (Hurrelmann, K. 1997; Jeske, W. 1981 zit. n. Linssen, R.; Leven, I; Hurrelmann, K. 2002, S. 68).
Zur Selbstwertkrise vieler Hauptschüler kommt bei einem beträchtlichen Teil auch noch eine real begründete Versagensangst hinzu. Es ist klar, das diese Schüler sich in der Schule nicht wohl fühlen können und nur ungern zur Schule gehen. Hier wird ihnen schließlich immer ihre Unzulänglichkeit vor Augen geführt.
Ein wesentlicher Unterschied in der Selbstwahrnehmung zwischen Hauptschülern und etwa Real- und Gymnasialschülern besteht in Hinsicht auf die eigene Zukunftsperspektive. Hauptschüler sind sich unsicherer als Real- und Gymnasialschüler, ob sie das angestrebte Ziel erreichen werden (vgl. ebd., S. 73f.). Und 40 Prozent der Hauptschüler sind sich unsicher, ob sie ihren Wunschberuf wirklich ergreifen können, am Gymnasium sind es nur 20 Prozent (vgl. ebd., S.74). Diese Unsicherheit ist, wie sich am Ende der Schulzeit zeigt, leider oftmals begründet: 12 Prozent der 12- bis 25-Jährigen, welche die Schule verlassen haben, sind arbeitslos, 64 Prozent haben entweder keinen (45 Prozent) oder den Hauptschulabschluss (19 Prozent).
[...]
- Arbeit zitieren
- Lehrer für das Lehramt an Haupt- und Realschulen Sven Krugmann (Autor:in), 2004, Berufsorientierung und Lebensplanung für Hauptschüler. Projekte und Konzepte, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/34326
Kostenlos Autor werden



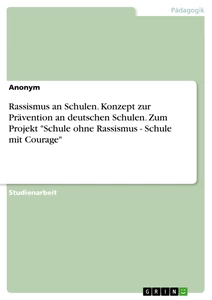


















Kommentare