Leseprobe
INHALTSVERZEICHNIS
1. DIE WELT DER WORTE - EINE EINLEITUNG
2. DIE SPRACHE ALS MEDIUM
2.1 Das göttliche Wort
2.2 Der Welt auf den Versen: Originalgetreue Imitationen
2.3 Die Vorstellung der Romantiker
2.3.1 Onomatopoetische Verschränkung
2.3.2 Lesbare Natur: Die Chiffre
2.3.3 Dichter, Detektive und Dolmetscher
2.3.4 Grenzen des Sagbaren
3. DER ZERFALL DER SPRACHE
3.1 Philosophischer Skeptizismus
3.2 Die Bürde der Konvention - Kritikpunkte
3.2.1 Obsolete Kongruenz
3.2.2 Der Universalienstreit
3.2.3 Dynamische Welt und statische Worte
3.3. Die Liquidierung in Hofmannsthals Brief
3.3.1 Moder, Rost und morsch
3.3.2 Flüssige und überflüssige Worte
3.3.3 Von Unendlichkeit und Ozeanischem
3.3.4 Verflüssigen und erstarren
3.3.5 Verwässerung als Verwandlung
4. AUTONOMIE UND METHODISCHE LIQUIDIERUNG DER SPRACHE
4.1 Die Erben der Sprachskepsis
4.1.1 Literarische Renegaten
4.1.2 Experimentelle Pioniere
4.1.3 Beginn der Autonomie
4.2 Chaos - Liquidierung der Ordnung
4.2.1 Das polemische Programm der Futuristen
4.2.2 Befreiung und Restriktionen - ein Paradox?
4.2.3 Liquidierung im Dadaismus
4.2.3.1 Alltägliche und fremde Worte
4.2.3.2 Verse ohne Worte
4.2.3.3 Semantische Undurchschaubarkeit
4.2.4 Narrenfreiheit der Avantgarden?
4.2.5 Der alte Traum von Unmittelbarkeit
4.2.6 Liquidierung im Surrealismus
4.2.6.1 Sprache in Trance
4.2.6.2 Eruptive Worte
4.2.6.3 Der flüssige Agent
4.2.6.4 Rausch und Rauschen
4.2.7 Konkrete Poesie
4.2.7.1 Eine eigene Realität
4.2.7.2 Himmlische Worte: Die Konstellation
5. PRAKTISCHE LIQUIDIERUNG DER SPRACHE
5.1 Das Fragment und die Reduktion
5.1.1 Eremitische Worte
5.1.2 Teile und wieder Teile
5.1.3 Eremitische Buchstaben
5.1.4 Zeichenalchemie
5.2 Allgemeine formale Liquidierungsansätze
5.2.1 Die Architektur des Textes: Syntax und Fläche
5.2.2 Orthografie und Interpunktion
5.2.3 Diffusität der Worte
5.2.3.1 Handschrift und Individualität
5.2.3.2 Überschreiben
5.2.3.3 Auslassung und Auslöschung
5.3 Arbitrarität als kreative Technik
5.4 Ausblicke
5.2.2 Poetische Möglichkeiten der Technik
5.2.3 Moderne Chiffren der Linguistik
6. ZUSAMMENFASSUNG
7. QUELLENVERZEICHNIS
7.1 Literaturverzeichnis
7.2 Abbildungsverzeichnis
Vorwort
Die vorliegende Masterarbeit untersucht die methodische und programmatische Liquidierung der Sprache in der avantgardistischen Literatur als Reaktion auf die Sprachkrise zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts. Hinter diesen Prozessen steckt das gemeinsame Motiv der Befreiung der Sprache aus ihrer konventionellen Form und Verwendung als Referenz bzw. Abbild der Wirklichkeit. Sie etabliert sich im Zuge dessen als autonomes, experimentelles Gestaltungsgebiet für Kreativität.
Im ersten Teil werden traditionelle Dichterkonzepte und Sprachverständnisse veranschaulicht, welche im Zuge der Sprachskepsis allmählich liquidiert werden. Im Hauptteil wird die konzeptionelle Entwicklung der Liquidierung über verschiedene literarische Avantgarden aufgezeigt und wie sich diese jeweils konkret in der experimentellen Dichtung niederschlägt.
Ein grosser Dank geht an Prof. Dr. Philipp Theisohn, welcher die wissenschaftliche Begleitung der Arbeit übernommen und mir wertvolle fachliche Unterstützung gegeben hat.
Zürich, den 28.04.2016 Mike Wunderlin
1. DIE WELT DER WORTE - EINE EINLEITUNG
„Ich lese Verse, die nichts weniger vorhaben, als: auf die Sprache zu verzichten.“1 Hugo Ball
Seit dem antiken Verständnis von Welt und Schrift bis hin zu den Romantikern der Moderne galt die Sprache als Abbildungswerkzeug der Wirklichkeit. Sie diente u.a. im christlichen Kontext als Medium des Göttlichen (Bibel), wurde in wissenschaftlicher Hinsicht zur kategorischen Abbildung der Welt verwendet (Enzyklopädie) und galt in der Philosophie als epistemologisches Instrument der Realität. In der Literatur der Antike galt der „inspirierte“ Dichter noch als Sprachrohr von Götter und Musen, und war deshalb, in seiner Aufgabe des Dolmetschers den ästhetischen Idealen Genauigkeit und Echtheit verpflichtet. Später, im mittelalterlichen Europa, stand die Literatur im gleichen Sinn ganz im Zeichen der Religion und ihrer strikten Prinzipien. In der Epoche des Sturm und Drang und der Romantik wich das Göttliche dann dem allgemeinen Mystischen und der Natur. In der Folgezeit geriet schon bald der (emotionale) Mensch selber in den Fokus des dichterischen Schaffens. Noch vor dem Ende des 18. Jahrhunderts aber beginnt sich jedoch eine skeptische Tendenz gegenüber der Sprache zu entfalten, die ein Jahrhundert später in einem totalen und irreversiblen Bruch des traditionellen Verständnisses, dass sie zur Abbildung der Welt fähig sei, mündete.
Im Zuge dieses Auseinanderbrechens von Welt und Wort bildeten sich besonders in Europa künstlerische Gruppen, die mit ihren radikalen Ideologien und experimentellen Ansätzen ein neues Verständnis von Sprache etablierten. Auch im Dialog mit der bildenden Kunst führt dies zu einem radikalen Paradigmenwechsel: Von nun an sollte nicht mehr die Sprache der Natur, sondern die Natur der Sprache kultiviert werden. Die literarischen Avantgarden forderten deshalb die Befreiung des Wortes und die Autonomie der Sprache. Um diese verlangte Freiheit sicherzustellen, war es primär nötig mit den traditionellen (als Restriktionen empfundene) Konventionen zu brechen. Durch den Fokus auf die verschiedene Wesenselemente der Natur der Sprache und der Schrift (wie Fläche, Materialität, Form, etc.) eröffneten sich unzählige neue Möglichkeiten für die schriftliche, bildliche und sprecherische Inszenierung des Sprachinventars. Die Sprache, vor allem aber auch die Schrift, wurde zerlegt, vermischt, verschmiert und bis zur Grenze ihrer Erkennbarkeit verunstaltet. Hauptsächlich wird im Folgenden die Tendenz dieser programmatisch vorwärtsgetriebenen Liquidierung von Sprache, Schrift, Worte und Buchstaben aufgezeigt. Der dabei verwendete, zentrale Begriff der Liquidierung lehnt sich an die verwendete Wasser-Symbolik in Hugo von Hofmannsthals Brief von 1902 (dem wohl wichtigsten literarischen Dokument der Sprachkrise) an. Darin erlebt die fiktive Figur des Lord Chandos den Bruch zwischen der Sprache und der Welt, indem seine Worte unaufhaltsam zerfallen, verwässern oder sich letztendlich vollständig auflösen. Dieser Prozess der Liquidierung wird in der avantgardistischen Dichtung sichtlich zur programmatischen Methode um dichterische Konventionen zu strapazieren und zu brechen, die Sprache weg von ihrer Referenzfunktion an die Grenzen der Erkennbarkeit und dadurch letztendlich in die Freiheit zu führen.
Untersucht man die Auswirkungen der Sprachkrise auf die literarischen Avantgarden des 20. Jahrhunderts, so zeigt sich die stetige Auseinandersetzung mit dem konventionellen Sprach- verständnis von der Sprache als natürliches Abbild der Realität. Um aufzeigen zu können, welche traditionellen Sprach-Konventionen liquidiert werden, müssen diese zu Beginn erläutert werden, um später als Bezugspunkte im Kontrast zur neuen, innovativen Dichtung zu dienen.
2. DIE SPRACHE ALS MEDIUM
Vom Mittelalter an beginnt sich über die Jahrhunderte ein Verständnis zu entwickeln, nach dem der Autor vom strickten Empfänger und Übersetzer des göttlichen Wortes immer mehr vom Geschöpf zum eigenen Schöpfer der Sprache wird. Nach und nach empfindet der Dichter nicht mehr das transzendente Göttliche als Quelle der Offenbarung und Inspiration, sondern die lebendige Natur. Mit der Sprache versucht er festzuhalten, was diese vermeintliche Sprechende ihm mitzuteilen versucht. Die dadurch erweckte Empfindsamkeit zieht schon bald die gesamte Aufmerksamkeit auf sich und lässt. Durch die Sprache versuchen die Dichter die inneren Emotionen herauszuarbeiten und festzuhalten, wobei sie immer wieder durch Thematik des Unendlichen oder einem „ozeanischen“ Innern an die Grenzen des Sagbaren stossen.
Diese historischen Entwicklungen bis zu den ersten kritischen Einwänden der Sprachskepsis sollen im Folgenden, beginnend mit dem göttlichen Ursprung der Worte, aufgezeigt werden.
2.1 Das göttliche Wort
In vielen Religionen hatte die Sprache bzw. die Schrift einen göttlichen Ursprung:
„Jede Hieroglyphe war für die Ägypter Bild eines Gotteswortes. Für die Juden hatte Buchstabe und Schrift nicht nur einen göttlichen Ursprung. Sie führten - symbolisch und kombinatorisch - auf Gott zurück. Der Buchstabe Aleph ] zum Beispiel bedeutet ganz bildhaft Gott.“2
In der christlichen Religion galt die „heilige“ Schrift als Medium zwischen dem Menschen und Gott. Selbst für Luther war die Sprache noch immer „eine göttliche Schöpfung, mit deren Hilfe man spekulativ zur Anschauung und der Erkenntnis von Dingen gelangen zu können glaubte, die jenseits der Erfahrung lagen.“3 In diesem Sinne attestiert Walter Benjamin den Worten eine „schwache messianische Kraft“4, welche sich durch die Lektüre zu entfalten sollte. Gerade die Theologie als rationale Disziplin sieht sich „seit jeher damit konfrontiert, diese Transzendenz, das prinzipiell Unsagbare, immanent vermittelbar und also sagbar zu machen.“5 Die Schrift als Medium vereint deshalb zwei Wesenszüge in sich: Zum einen muss sie ein Teil von beiden zu vermittelnden Extremen (Instanzen) haben6, gleichzeitig muss sich das Medium jedoch auch von den spezifischen Extremen unterscheiden7. Dieses scheinbare Paradox bleibt jedoch weiterhin unbehelligt: Noch Harsdörffers Sprachtheorie des 17. Jahrhunderts war der festen Überzeugung, dass „die Wörter ein Teil der Dinge sind, welche sie bedeuten […].“8
In dieser doppelten Charakteristik des Mediums liegt das religiöse Spannungsfeld zwischen Transzendenz und Immanenz: „Es geht darum, eine Brücke zum Ursprung zu schlagen und über sie, trotz dessen unhintergehbarer Ferne, die Energie des Ursprungs ins Hier und Jetzt fließen zu lassen.“9 Bereits in dieser Aussage klingt aber die Erkenntnis an, dass jedweder (paradoxe) Versuch durch das Medium eine unmittelbaren Verbindung zum Ursprung zu schaffen, ein Ding der Unmöglichkeit ist10.
An der Schrift zu zweifeln käme jedoch einem ketzerischen Nicht-Glauben gleich und zwar nicht nur im Christentum: „Im Islam findet sich die Lehre, daß Gott selbst die Buchstaben schuf [...]. Der Glaube daran, daß die Buchstaben in der Zeit, zumal durch menschliche Erfindung, entstanden seien, wird noch heute von orthodoxen Islamisten als Ketzerei gebrandmarkt.“11 Nur durch den frommen Glauben und der unhinterfragten Hinnahme der göttlichen Sprache lässt sich Gott erschliessen, weil die Logik der irdischen Sprache nicht ausreicht um das Göttliche nachzuvollziehen. Schon eine geringfügige Abweichung oder Extraktionen aus der (holistischen) heiligen Schrift stellt ein Vergehen dar, weil dadurch die immanente göttliche Authentizität verfälscht würde, wie ein anonymer Klosterbruder mahnend festhält:
„Es ist […] in gar keiner Weise zu vergessen, daß nicht etwa bloß ein ganzer Vers der Heiligen Schrift oder zehn Worte mehr oder weniger, sondern auch schon ein einziges Wort und sogar ein einziger Buchstabe einen guten, richtigen und christlichen Sinn und einen Inhalt so schlimm und so schädlich verdirbt und verhunzt, daß er unrichtig oder falsch und sogar ketzerisch wird [...].“12
Dieses indoktrinierte, unkritische Denken ist noch für das Mittelalter äusserst prägend.
Auf einer generelle Ebene verkörpert das Göttliche damit exemplarisch das Unsagbare (auch: das Inkommensurable), welches unmittelbar mit dem Konzept um sprachliche Grenzen zusammenhängt. Das Unsagbare, als einer der grossen literarischen Topoi, verkörpert an sich ein „darstellungs-theoretisches Oxymoron“13. Die Vorwegnahme dieser Thematik dient spezifisch dem Verständnis der literarischen Zeit nach der Aufklärung, in der nicht mehr Gott, sondern die Natur in den Fokus der Betrachtungen gerückt wird.
2.2 Der Welt auf den Versen: Originalgetreue Imitationen
In der Zeit der Aufklärung sollte an die Stelle des unmündigen Glauben das emanzipierte Wissen treten. Die Sprache diente dabei primär als „natursezierendes und analysierendes“14 Erkenntnisinstrument und ist deshalb den Idealen „Genauigkeit“ und „Richtigkeit“ verschrieben15, und wurde im Sinne der Wissenschaft als „Mitteilung einer objektiv verbindlich geglaubten Wahrheit über die Welt und die Menschen begriffen […].“16 Eine weitere Konsequenz der progressiven Förderung des Verstandes war, dass Sprache aufhörte „aus einer göttlichen Quelle zu fließen, weil der Mensch als ihr Erfinder entdeckt wurde […].“17 Noch ganz im Sine der Aufklärung forderte Gottsched in seinem Versuch einer critischen Dichtkunst 1730 immer wieder, „daß Gedichte «Nachahmungen der Natur» zu sein hätten […].“18 Die Aufgabe der Dichter folgte demzufolge dem allgemeinen Bestreben „die spürbar gewordene Kluft zwischen Welt und Individuum zu überbrücken […].“19 Der bildhafte Begriff der Ü ber-br ü ckung evoziert dabei die fundamentale Vorstellung einer Verbindung zweier getrennter Sphären; die eine ist der Verstand des Menschen (als Empfänger), und die andere umfasst das Göttliche (als Autor), an dessen Stelle nun allmählich und nachhaltig die Natur und das Mystische treten. In diesem Sinne oktroyiert diese prozedurale Hierarchie dem Dichter theoretisch die passiven Rolle eines handwerklichen Nachbildners noch ganz im Sinne Platons Ideenlehre:
„Nemlich da es von Allem Ideen gibt, und die Dinge Abbilder derselben sind, so verfertigt jede nachahmende Kunst nur wieder Abbilder jener Abbilder und steht also in dritter Linie von dem wahren Sein entfernt, durch den Schein die Unwissenden bezaubernd. […] hätten die Dichter wirklich ein Wissen, so würden sie doch lieber den höheren Ruhm einärndten, als bloß Nachahmer zu sein.“20
Diese Ansicht wird von der folgenden Epoche des Sturm und Drang vehement verworfen: „Der Begriff von schöner Natur, den die Aufklärungsästhetik kultiviert hatte, hatte die Spontaneität des produktiven Künstlers unterdrückt. […] Für diese schöpferische Energie des Künstlers benutzt der Sturm und Drang das Wort Genie […].“21 Der Begriff „Genie“ etabliert sich dabei um 1750 und verkörpert einen kreativen Autor, der „nicht Mustern folge, sondern selbst Muster schaffe“22. Oftmals wird dies im Zusammenhang mit einer „Gottähnlichkeit“ erwähnt, u.a. bei Herder, der den Künstler als Erschaffenden hierarchisch über den Philosophen erhebt, weil er „mit Götterkraft begabt“23 ist. „Das Genie wird somit selbst Natur.“24, und der Künstler wird vom Geschöpf zum Schöpfer. Dies beginnt bei ganz grundsätzlichen Feststellungen: Als Literat und Sprachtheoretiker zugleich, beschreibt Karl Philipp Moritz im Jahr 1793 den Dichter als einen Menschen, welcher grundsätzlich Begebenheiten aus ihrem Zusammenhang schneidet und in neuen Verbindungen zusammensetzt„ die sie in der Natur nicht haben.“25 Diese Autonomie des Dichters ist methodisch noch nicht ausgereift, sondern beginnt sich erst allmählich zu entfalten. Sie deutet sich beispielsweise erst in den freien Rhythmen Klopstocks an26, oder in der Kultivierung der Empfindsamkeit als Ergänzung zur aufklärerischen Ratio 27, indem als Legitimation eingeräumt wird, dass die Natur rational eben nicht vollständig ausdefiniert werden kann28. So ist z.B. der von Johann Jakob Bodmer benannte „poeta vates“29 durchaus dazu imstande das Unsichtbare oder das Übernatürliche in die Dichtung einfliessen zu lassen.
Der Prozess des Überbrückungsversuchs bleibt stets derselbe: Ausgehend von einer emergenten Energie scheint sich eine unbestimmte Instanz der Sinneswahrnehmung mitteilen zu wollen, wobei die literarische Aufgabe in der Metamorphose vom Sprachlosen in Worte liegt. Die dichterische Sprache zeichnete sich demnach durch ihre Ideale der „Echtheit“ und individuellen „Originalität“ aus.30
2.3 Die Vorstellung der Romantiker
Für die Epoche der Romantik sind besonders die Vorstellungen Johann Gottfried Herders noch bestimmend, nach welchen der Menschen durch seine Wahrnehmung mit der Natur in Verbindung tritt:
„Der Mensch ist also als ein horchendes, merkendes Geschöpf zur Sprache natürlich gebildet […]. […] die Natur wird sich ihm durchs Ohr offenbaren: tausend Geschöpfe, die er nicht sehen kann, werden doch mit ihm zu sprechen scheinen […]. Wenn die Blätter des Baumes dem armen Einsamen Kühlung herabrauschen, wenn der vorbeimurmelnde Bach ihn in den Schlaf wieget und der hinzusäuselnde West seine Wangen fächelt […]. Der Baum wird der Rauscher, der West Säusler, die Quelle Riesler heißen. Da liegt ein kleines Wörterbuch fertig und wartet auf das Gepräge der Sprachorgane.“31
Aus diesen Motiven ist besonders der Wald als geheimnisumwitterte Sphäre der Wirklichkeit ein bevorzugtes Thema der damaligen Literaten.32 Diese Vorstellung einer in „unartikulierten Lauten sprechenden Natur“33 kann als wegbereitendes Verständnis einer sich-mitteilen-wollenden Stimme, die sich hinter den Naturgeräuschen verbirgt, aufgefasst werden.
2.3.1 Onomatopoetische Verschränkung
Dem „Rauschenden“ und „Säuselnden“ versucht der Dichter nun durch onomatopoetische Nachbildung Bedeutungen abzugewinnen.34 Dieses Konzept der ästhetisch-imitierenden Approximation hat dabei eine lange Tradition. In der Erzählung Ovids über die lykischen Bauern beispielsweise, welche als Bestrafung in Frösche verwandelt wurden, inszeniert er diese - noch bevor man erfährt, in was sie verwandelt worden sind - bereits als transformiert: „Quamvis sint sub aqua, sub aqua maledicere temptant“35 („ Obwohl unter Wasser, versuchen sie doch weiter zu schm ä hen “). Der Text wird dabei plötzlich „selbst zu einem lautmalerischen Gequake, das aus den Wörtern plötzlich unbekannte Dimensionen freisetzt […].“36
Ein weiteres Beispiel findet sich im polemischen Tautogramm des Quintus Ennius (239-169 v. Chr), das er dem vermeintlichen Despoten Titus Tatius widmete: „O Tite, tute, Tati, tibi tanta, tyranne, tulisti.“37 („Oh Titus Tatius, du Tyrann, so Grosses hast Du Dir selbst angetan!“). Durch die Repetition des Plosivlautes „t“ soll dabei durch die direktive Aussprache dem Adressaten sprichwörtlich ins Gesicht gespuckt werden38. Durch dieses performative Element beläuft sich der Kunstgriff damit nicht auf die blosse Nachahmung eines Geschehnisses, sondern generiert durch die onomatopoetische Performanz ein weltliches Phänomen sui generis. Im Allgemeinen wird jedoch beabsichtigt, dass Inhalt und Form eine Ähnlichkeitsbeziehung eingehen, um die Versinnbildlichung authentischer zu machen:
„Das geht bis zum onomatopoetischen Extremismus einer puren Buchstaben-lyrik, sozusagen einem Lettrisme avant la lettre. So preist Tesauro die ‹metrischen Noten›[[39]] seines Zeitgenossen Mario Bettini, dessen Nachtigall-Gedicht, nach welchem man nicht mehr wisse, ob dieser Vogel ein Dichter sei, oder der Dichter ein ‹rosignuolo› [ital. Nachtigall ].“40
Das eigentliche (kontemplative) Erleben der natürlichen Phänomene entbehrt jedoch noch der konventionellen Sprache, was in den Anfangszeilen von Eichendorffs Gedicht Abend (1826) versinnbildlicht wird: „Schweigt der Menschen laute Lust: / Rauscht die Erde wie in Träumen […].“41
Die Problematik besteht weiterhin im sprachlichen Brückenschlag, der das Erlebte in authentische Worte zu fassen versucht:
„Da die Suchenden […] [die] Natur ausschließlich zum Objekt ihrer Beobachtungen machen, statt sich in ihre Gestalt lauschend zu versenken, bleibt ihre dem Logozentrismus verpflichtete Gedanken- und Sprachwelt letztlich doch nur Gegenstimme zur Natur.“42
In dieser erlebnisvollen Nähe selbst entfaltet sich hingegen eine unmittelbaren Beziehung zur Natur. Aus diesem intimen Verhältnis entspringt die Idee einer neuen Authentizität der Sprache: „Durch diese Anerkennung der Lebendigkeit der Natur als eines aus Körper und Stimme bestehenden ‚seelenvollen’ Leibes […] läßt sich die ursprüngliche Einheitssprache neu gewinnen.“43 Das Konzept einer solchen paradiesischen Einheitssprache (auch: Adamitische Sprache) steht im Zusammenhang mit der schöpferischen (kreativen) Potenz der Worte:
„Der paradiesische Mensch wiederholt also die Namen, die im Schöpfungsbefehl Gottes vorgekommen waren. Diese sind die wahren Namen der Dinge, bei denen sie zu rufen bedeutet, daß sie genauso gehorchen, wie sie im Schöpfungsakt gehorcht haben, aus dem Nichts hervorzutreten.“44
Das Bewusstsein um diesen Verlust beklagt beispielsweise Novalis, der sich jedoch die Hoffnung bewahrte, die Einheitssprache eines Tages vielleicht wiederherstellen zu können.45 Diese Wunschvorstellung ist vergleichsweise auch beim spanischen Dichter Jiménez festzustellen, indem er für seine Lyrik fordert: „Verstand, gib mir / Den wahren Namen der Dinge! / … Damit mein Wort / das Ding selbst sei […]“46 Novalis selbst war noch der Überzeugung, dass sobald „man nur die rechten Namen hat, so hat man die Idee mit.“47 Die Sache selbst liege demzufolge im Kompetenzbereich ihres Begriffes. Ausgehend von dieser evozierender Macht des Wortes schreibt er: „Jedes Wort ist ein Wort der Beschwörung […] [welches einen] Geist ruft
- ein solcher erscheint.“48 Im modernen Sinne verwehrt sich Inger Christensen gegen diese Ansicht, indem sie rational den „Geist“ in Realität und Erinnerung unterteilt:
„Kann ich etwa allein dadurch, daß ich das Wort »Rose« nenne, sogleich irgendwo eine Rose registrieren? Nein, natürlich kann ich nicht »Rose« sagen, und sogleich, Hokuspokus, entsteht eine Rose in der sichtbaren Welt. […]. Dafür aber schafft in dieser inneren Welt [Phantasie] das Wort, was es nennt. In dieser Vorstellungswelt kann ich »Rose« sagen, und wenn ich die Augen schließe, wird vor meinem inneren Blich eine Rose entstehen, vielleicht nicht ganz so sichtbar, wie wenn sie in einem Garten stünde, aber sichtbar, […].“49
Christensen veranschaulicht dadurch die eidetische Potenz der Sprache, und führt gleichzeitig die vermeintliche Verbindung zur Realität ad absurdum. Eine Möglichkeit, bei welcher Natur und Begriff aber dennoch zu konvergieren vermögen, sehen die Romantiker im Konzept der „Chiffre“. Hinter diesem scheinbar widersprüchlichen steckt aber ein intrikates Plädoyer für die Identifikation des Dichters mit der Natur. Dies soll im folgenden Kapitel verdeutlicht werden.
2.3.2 Lesbare Natur: Die Chiffre
„Mannigfache Wege gehen die Menschen. Wer sie verfolgt und vergleicht, wird wunderliche Figuren entstehen sehn; Figuren, die zu jener großen Chiffernschrift zu gehören scheinen, die man überall […] [sogar in den] Konjunkturen des Zufalls, erblickt.“50
Novalis
Durch die Chiffre wird das Konzept der Einheits sprache zum Konzept der Einheits schrift modifiziert. Diese „Urschrift, mythischer Anfang von Schrift überhaupt, ist daran kenntlich, daß sie (noch) keine Schrift ist. Niemand könnte sie schreiben oder lesen, diese ‚Schrift ohne Alphabet’, in der Zeichen, Signifikanten und Signifikate identisch sind.“51 Dabei impliziert der Begriff der Chiffern schrift konventionell den Aspekt der Lesbarkeit. Dies führ in der Konsequenz zu der Überzeugung, dass die Welt als solche lesbar ist.52 Die „Leselust“ an der Natur erhält zeitgleich einen zusätzlichen Motivations-schub durch die voranschreitende Naturwissenschaft der Genetik.53
Die Problematik besteht darin, dass die natürliche Chiffre keiner konventionellen Semantik unterliegt, was bedeutet, dass sie vom Dichter de-chiffriert werden muss. Das Konzept der Chiffre greift damit erneut die Idee von der Welt als Buch auf, welche beispielsweise Baltasar Gracián bereits 1657 mit El mundo descifrado betitelte. Darin schreibt er: „Derjenige habe gut gesprochen, der als das beste Buch der Welt die Welt selbst bezeichnet habe […]. Dieses Buch sei in leuchtenden Schriftzeichen […] geschrieben und leicht zu lesen, obwohl sich einige schwer zu lösende Rätsel darin fänden.“54 Die Chiffre steht damit in engem Zusammenhang zur Hieroglyphe.55 Die Welt ist dem Dichter ein offenes (aber noch kryptisches) Buch56. Der nachhaltigste Vertreter dieser Ansicht ist Novalis, indem er schreibt, dass der Poet ein „Wahrsager aus Chiffern [sei]; Letternaugur.“57 In diesem Sinne versteht er auch „die Natur besser wie der wissenschaftliche Kopf.“58 Die Ambition des Dichters richtet sich, getrieben von der Faszination für die Naturphänomene hinter welchen er eine latente, verborgene Grammatik erahnt, auf die poetische Festhaltung derselben:
„Ob als Chiffre des Numinosen, als Offenbarung der rätselhaft wirkenden Natur, ob als Spur der verschütteten Ursprache oder Ausdruck einer unbeschreiblichen Sehnsucht des sprachlich verfaßten Subjekts - die in den Wäldern vernommenen Geräusche verwandeln sich unter den Federn der Literaten in Lebendiges, wenn auch unverständliches Murmeln und Flüstern.“59
Das synästhetisch bestimmte, lesende Horchen der geräuschhaften Natursprache charakterisiert Novalis in Die Lehrlinge zu Sais (1802) folgendermassen: „In ihnen ahndet man den Schlüssel dieser Wunderschrift, […] allein die Ahndung will sich selbst in keine feste Formen fügen, und scheint kein höherer Schlüssel werden zu wollen.“60 Die Chiffre entzieht sich damit aber gleichzeitig wieder ihrer Lesbarkeit. Darin besteht die Botschaft der Lehrlinge zu Sais: „Die »Chiffre« ist per Definition ein leeres Zeichen, zu dem die Lehrlinge im Texten den »Schlüssel« suchen.“61 Die ganze Überlegung mündet reflexiv in eine hermeneutische Paradoxie: „Die Sprachlehre besteht in den Lehrlingen aus einer Lehre über die Unlesbarkeit von Zeichen […].“62 Der Widerspruch der Chiffre wird von Blumenberg weiter ausgeführt:
„Den Vorgriff der Vertraulichkeit dann wieder zu ernüchtern, erfordert einen so ärgerlichen Zusatz wie den, ein Buch sei die Natur zwar, aber ein in Hieroglyphen, in Chiffren, in mathematischen Formeln geschriebenes - das Paradox eines Buches, das sich dagegen verwahrt, Leser zu haben.“63
In den Lehrlingen ist somit das Bestreben um die Dechiffrierung zur zeitgenössischen Pose erstarrt. Die Chiffre bleibt jedoch ihrem „eingegrabenen“64 und letztlich unverständlichen Wesen unabänderlich verhaftet.
2.3.3. Dichter, Detektive und Dolmetscher
„Meine Zeitungen: Spuren im Schnee.“65
Mascha Kal é ko
Wird Lesbarkeit aus der Perspektive seiner etymologischen Bedeutung her, als „den Schriftzeichen folgend“66, interpretiert, so gleicht der Vorgang einem detektivischen Verfahren. Das Wesen des Detektiven ergründet sich primär in diesem Offenlegen (lat. de-tegere: aufdecken) der Wahrheit (griech. Aletheia, a-lethe: un-verborgen). Das Lesen der Natur wird dadurch mit einem akribischen Deuten von Hinweisen gleichgesetzt, durch welches sich der Lesebegriff sehr stark verallgemeinern würde.
Der Elitegedanken in Verbindung mit der Chiffre bestand hauptsächlich in der Fähigkeit des Dichters mit der Natur in einen emotionalen und kommunikativen Dialog zu treten, und in den Texten gleichsam selbst zu Wort kommen zu lassen, ohne jedoch die eigene Autorschaft aus den Augen zu verlieren. Dies kommt besonders deutlich im Dinggedicht zum Ausdruck, in dem die Essenz der Gegenstände überhaupt erst durch die „heraufbeschwörende Kraft des dichterischen Worts” in Erscheinung tritt.67
Der Dichter fungiert dabei „lediglich“ als Dolmetscher der Natur, indem er die Natursprache z.B. in ein ästhetisches und verständliches Gedicht übersetzt. Dieser Selbstauffassung begegnet man u.a. beim portugiesischen Nationaldichter Fernando Pessoa: „Bin ich doch nur etwas Verwerfliches wie ein Dolmetscher der Natur, / Denn es gibt Menschen, die ihre Sprache nicht verstehen, / Da ihre Sprache keine Sprache ist…“68
Konvergieren diese zwei Sinnbilder des Detektiven und Dolmetschers, so besteht die literarische Kunst folglich in der ästhetischen Ausarbeitung respektive einem Lesbar-Machen für jene, denen die Natursprache nicht geläufig ist. Dieses Übersetzen bzw. Herausarbeiten kann dabei entweder durch die Kunst des Hinzufügens oder diejenige des Weglassens erfolgen:
„In der Malerei beispielsweise entsteht die Schönheit eines Werkes, indem man ausgewählte Farben auf eine weiße Leinwand aufträgt und diesen eine Form gibt. In der Bildhauerei hingegen liegt das Werk bereits im Stein, und man entdeckt es indem man die Teile des Steins entfernt, die verhindern, dass sich seine Schönheit in den Augen des Betrachters zeigt.“69
Diese Vorstellung der Figur, die bereits im Stein verborgen liegt (ähnlich der Natursprache, welche nur noch übersetzt werden muss) wurde in verschiedenen Varianten z.B. von Meister Eckhart, Leon Battista Alberti und Michelangelo überliefert.70 Ein ähnliches Konzept, dass Worte in anderen Worten verborgen liegen, findet sich später in der sogenannten „Subprose Poetry“ (Abs. 5.1.2).
Wie im folgenden Kapitel gezeigt wird, beginnt gerade aber in der Epoche der Romantik ein Verdacht zu keimen, der sich in der rückläufigen sprachlichen Ausdrucksfähigkeit äussert.
2.3.4. Grenzen des Sagbaren
„Ein Alkahest scheint über die Sinne der Menschen ausgegossen zu sein.“71
Novalis
Was die letzte grosse Epoche, welche die Integrität der Sprache noch nicht als unwiderruflich kompromittiert empfand, in puncto Sprachrezeption auszeichnete, war das wachsende Gefühl der mangelhaften Ausdrucksfähigkeit. Als Ursache dieser Tendenzen wurde (zu Beginn72 ) die eigene Sprachkompetenz angesehen.
Während dieser Epoche findet in der Literatur eine Verlagerung statt, in deren Zuge sich die Natur sukzessive von der Sprache zu entziehen scheint.
In diesem Sinne lässt bereits Büchner seinen Schriftsteller-Protagonisten Lenz (1839) in beinahe fiebriger Ektase suchend durch die Wälder streifen:
„[E]r stand, keuchend, den Leib vorwärts gebeugt, Augen und Mund weit offen, er meinte, er müsse den Sturm in sich ziehen, alles in sich fassen, er dehnte sich aus und lag über der Erde, er wühlte sich in das All hinein, es war eine Lust, die ihm wehe tat; oder er stand still, und legte das Haupt ins Moos und schloss die Augen [...]. Aber es waren nur Augenblicke, und dann erhob er sich nüchtern, fest, ruhig als wäre ein Schattenspiel vor ihm vorübergezogen, er wusste von nichts mehr.“73
In diesem kontemplativen Akt erfährt Lenz eine Versenkung in der Natur, deren Zauber er nicht in den „nüchternen“ Zustand hinüberzuretten vermag: Verstört, enttäuscht und wortlos zieht er weiter. Noch etwas früher, in Novalis Heinrich von Ofterdingen (1802), setzt sich der gleichnamige Protagonist mit seiner Aphasie auseinander:
„Dass ich auch nicht einmal von meinem wunderlichen Zustand reden kann! Es ist mir oft so entzückend wohl, und nur dann, wenn ich die Blume nicht recht gegenwärtig habe, befällt mich so ein tiefes, inniges Treiben […]. Ich glaubte, ich wäre wahnsinnig, […]. Ich hörte einst von alten Zeiten reden; wie da Tiere und Bäume und Felsen mit den Menschen gesprochen hätten. Mir ist gerade so, als wollten sie allaugenblicklich anfangen, und als könnte ich es ihnen ansehen, was sie mir sagen wollten.“74
Abermals wird hier auf die adamitische Ursprache Bezug genommen (vgl. Abs. 2.3.1), die sich jedoch dem Verständnis des jungen Dichters gänzlich entzieht. Auch J.P. Jacobsen lässt dieses vergebliche Haschen von seinem Schriftsteller Protagonisten im gleichnamigen Roman Niels Lyhne (1880) beschreiben:
„Es gibt nichts erbärmlicheres, als Künstler zu sein; […] ich kann sehen, mein Blut ist heiß und reich, mein Herz pocht, meinem Verstande fehlt nichts, und ich will arbeiten; aber ich kann nicht, ich kämpfe und greife nach etwas Unsichtbarem, das sich nicht greifen lassen will […].“75
Obwohl die drei Beispiele beinahe 80 Jahre auseinanderliegen, kennzeichnet sie jedoch eine grundlegende Gemeinsamkeit: eine Ohnmacht angesichts unbestimmter Mächte, die sich ins Erzählen drängen. Ihre Worte vermögen es nicht, eine Brücke zu den Erlebnissen zu schlagen: „[C]haracters try and ostensibly fail in their efforts to fling linguistic bridges across the abyss. But the abyss widens or deepens and the ballistic potential of […] language is again outdistanced.“76 Die lähmende Erkenntnis der eigenen Unfähigkeit das Mystische ans Licht der Sprache zu zerren hinterlässt dabei ein frustrierendes Vakuum.
Damit bahnt sich in der Romantik eine Sprachskepsis an, bei der schrittweise der „Glauben an eine magische Verbindung von Wort und Sache“77 aufgelöst wird. Besonders in den Fragmenten von Novalis zeichnet sich das Bewusstsein um diese Aufspaltung ab, indem er polemisch konstatierte, dass die Bücherwelt „ in der Tat nur die Karikatur der wirklichen Welt [ist].“78
Zudem formuliert er überspitzt er die Fremdheit der Welt mit der Materialität der Schrift: „Die Bezeichnung durch Töne und Striche ist eine bewundernswürdige Abstraktion. Vier Buchstaben bezeichnen mit Gott; einige Striche eine Million Dinge. Wie leicht wird hier die Handhabung des Universums, wie anschaulich die Konzentrizität der Geisterwelt!“79 An dieser exemplarischen Bemerkung zeichnet sich bereits eine Skepsis ab, die das Fundament der Sprache provokativ zu untergraben beginnt.
3. DER ZERFALL DER SPRACHE
„[D]ecken sich die Bezeichnungen und die Dinge? Ist die Sprache der adäquate Ausdruck aller Realitäten?“80 Friedrich Nietzsche
Gegen Mitte des 19. Jahrhunderts beginnt die Literatur und etwas später die Philosophie ernsthaft am der Abbildungsfähigkeit der Sprache zu zweifeln. Einer der ersten Aufsätze, derr den theoretischen Diskurs der Sprachskepsis eröffnet81, ist Nietzsches Essay Ü ber Wahrheit und L ü ge im au ß ermoralischen Sinne (1873). Noch konkreter verfolgt Fritz Mauthner in seiner Kritik Beitr ä ge zu einer Kritik der Sprache (1901/1902) die Thematik der unverwandten Beziehung zwischen Wort und Welt .
In der Literatur lassen sich besonders bei Novalis, später Rilke und endlich bei Hofmannsthal Anhaltspunkte finden, an denen sich eine Sprachnot abzeichnet. Bereits Goethe gab diesbezüglich, vielleicht aber nur durch Zufall, seinem Roman Wilhelm Meisters Wanderjahre (1796) den Untertitel Die Entsagenden, (griech. Aphasía: Sprachlosigkeit)82. Obwohl schon Novalis den Verlust des Konnexes zwischen der Sprache und den Dingen erlebte, wurde die Sprachkrise, zumindest bei den Frühromantikern83, noch nicht als genuin unüberwindbar empfunden. Erst durch Hofmannsthals beunruhigende Schilderungen in Ein Brief von 1902 führen zu einem nachhaltigen Verlust des Vertrauens in die Worte.
3.1 Philosophischer Skeptizismus
Wenn im 17. Jahrhundert nach der Ansicht Harsdörffers (Abs. 2.1) und Wilhelm Humbold die Sprache trotz einiger Einschränkungen das Potenzial alles auszudrücken habe84, so scheint diese Überzeugung im wissenschaftlichen Diskurs des 19. Jahrhunderts immer weniger haltbar zu sein. Durch kritische Fragen und Vergleiche werden immer mehr Mängel der Worte aufgedeckt, die letztlich in ein vollständiges Verstummen mündet.
Besonders ist dabei Nietzsches Beitrag hervorzuheben: „Wir glauben etwas von den Dingen selbst zu wissen, wenn wir von Bäumen, Farben, Schnee und Blumen reden, und besitzen doch nichts als Metaphern der Dinge, die den ursprünglichen Wesenheiten ganz und gar nicht entsprechen.“85 Im direkten Anschluss dazu folgt die berühmte Aussage, dass die Wahrheit ein „bewegliches Heer von Metaphern, Metonymien, Anthropomorphismen [ist].“86 Im Anschluss taucht der Begriff „Wahrheiten“ paradoxerweise im Plural auf, was vermutlich die hinfällige Idee der (sprachlichen) Objektivität verdeutlichen soll: […] die Wahrheiten sind Illusionen, von denen man vergessen hat, daß sie welche sind […].“87 In der epistemologischen Philosophie wird die Sprache damit als unvollkommenes Instrument der Erkenntnis angesehen. Deshalb wird die Sprache laut Mauthner zu etwas das überwunden werden soll:
”Im Anfang war das Wort." Mit dem Worte stehen die Menschen am Anfang der Welterkenntnis und sie bleiben stehen, wenn sie beim Worte bleiben. Wer weiter schreiten will, […] muss sich vom Worte befreien und vom Wortaberglauben, der muss seine Welt von der Tyrannei der Sprache zu erlösen versuchen.88
Das poetische Renommee der Sprache droht als Konsequenz dieser polemischen Vorwürfe endgültig zu verschwinden: „Sprache, das Medium von Poesie, ist abstrakt, spricht über Dinge, sie weckt oder reproduziert Vorstellungen, aber sie kann[…] die Ebene der konkreten Gegenstände und Sachverhalte, auf die sie verweist, nicht erreichen.“89
Diese eklatante Schieflage kann am Beispiel des Rauschens verdeutlicht werden:
„Auch wenn Literatur die physikalischen Realitäten wie etwa ein Rauschen nicht in ihrer Unmittelbarkeit zur Darstellung bringen kann, so kann sie mit ihrer schriftlichen Verarbeitung eben solcher literarisch nicht nachahmbaren Phänomene doch immerhin Auskunft darüber erteilen, auf welche spezifische Weise diese der Wahrnehmung erscheinen […].“90
Die literarisch darstellende Sprache bleibt unlösbar mit ihrem abstrakten schriftlichen Notationssystem verhaftet: „Aber so sehr sich eine solche literarische Sprache auch dem Rauschen anzuverwandeln versucht - und das kann sie nur als gesprochenen Sprache -, bleibt sie dennoch als eine Sprache erkennbar, die so tut, als wäre sie keine mehr.“91
Diese Erkenntnis stellt einen zentralen Aspekt der Skepsis dar, hinter dem sich jedoch weitere generelle kritische Überlegungen verbergen. Diese werden in den folgenden Abschnitten erläutert.
3.2 Die Bürde der Konvention - Kritikpunkte
„Worte sind hart, man geht über sie wie über schlechtes Pflaster.“92 Franz Kafka
Die Einwände beziehen sich auf einige spezifische Punkte, deren Hinterfragung sich ebenfalls avantgardistische Strömungen stellen, um die Restriktionen zu überschreiten und überwinden. Die Natur der Sprache wird im Verlauf der philosophischen Betrachtungen der Sprache der Natur entgegengehalten, wobei im Zuge dessen durch die progressive Aufdeckung immer weiterer kritischen Streitpunkten als Verstärker der Skepsis fungieren.
Die drei zentralen Kritikpunkte erheben legitime Einwände gegen die (1) Idee der Substituierbarkeit eines Gegenstand durch dessen Bezeichnung, des Weiteren gegen die (2) verallgemeinernde Normierung der Worte (Universalienstreit) und (3) die leblose Starrheit der Sprache im Gegensatz zur Lebendigkeit der Realität, die sie zu beschreiben trachtet.
3.2.1 Obsolete Kongruenz
„Es gibt nichts mehr zu lesen, wenn Bedeutung und Bedeutendes identisch werden.“93 Hans Blumenberg
In Die Lesbarkeit der Welt spricht Blumenberg die grundsätzliche Problematik offen an:
„Zwischen den Büchern und der Wirklichkeit ist eine alte Feindschaft gesetzt. Das Geschriebene schob sich an die Stelle der Wirklichkeit in der Funktion, sie als das endgültig Rubrizierte und gesicherte überflüssig zu machen. Die geschriebene und schließlich gedruckte Tradition ist immer wieder zur Schwächung von Authentizität der Erfahrung geworden.“94
Das Paradox besteht darin, dass bei der Annahme, dass sowohl Wort, als auch Ding restlos identisch, damit substituierbar und dennoch unterschiedlich sind (im Gegensatz zur Adamitischen Sprache; vgl. Abs. 2.3.1). So würden beim Sprechen simultan zwei kongruente respektive identische Realitäten existieren. Dieser Widerspruch wird im folgenden Beispiel karikiert:
„Und stets wird es uns gehen, wie in der berühmten Erzählung von Jorge Luis Borges, der Erzählung von der Landkarte, die immer größer und ausführlicher gezeichnet wird, bis sie schließlich genauso groß ist wie die ganze Welt und das bedeckt, was sie eigentlich aufdecken sollte.“95
Im Akt des Schreibens vollzieht sich generell der Versuch, „die Realität zu (re)konstituieren.“96 Auch die heutige Poesie verfällt oft wieder dem gleichen Atavismus: „Gedichte sind […] die Bemühungen dessen, der […] mit seinem Dasein zur Sprache geht, wirklichkeitswund und Wirklichkeit suchend.“97 Den „nomadischen“ Worten ist es jedoch verwehrt, je ans Ziel, an die Grenzen der Realität (und darüber hinaus) zu gelangen.
Im Bezug auf diese seltsame Konkurrenz ist der Terminus „Hyperrealismus“ treffend: „Die Realität geht im Hyperrealismus unter, in der exakten Verdoppelung des Realen, vorzugsweise auf der Grundlage eines anderen reproduktiven Mediums - Werbung, Photo etc. -, und von Medium zu Medium verflüchtigt sich das Reale.“98
In der bildenden Kunst wird diese Verdoppelung z.B. durch René Magrittes La condition humaine karikiert (Abb. 1). In der Literatur findet sich bei Pessoa, passend zur Karten-Thematik, ein mahnender Aufruf gegen die entfremdende Unterwerfung der Natur, welche durch das Abfassen in Worte erfolgt: „Arme Menschenseelen, die alles ordnen, / die von Ding zu Ding Linien ziehen, / Namensschilder an durch und durch richtige Bäume heften/ und Längen- und Breitengrade zeichnen, / Selbst auf die Erde, die unschuldig ist […].“99 Das Bild der Karte verfolgt vergleichsweise auch Eugen Gomringer, der Erfinder der Konkreten Poesie, in geografie (Abb. 2) weiter. Er führt den Zweck der Karte aber gerade durch die Brechung von Konventionen ad absurdum, indem die skizzenhafte Landkarte klar als Europa zu identifizieren ist, jedoch die Namen von Orten und Ländern scheinbar wahllos verstreut worden sind. Die Arbitrarität der Namen kann als Hinweis auf die brüchig gewordene Referenzfunktion der Sprache gedeutet werden100. „In einer menschlichen Dimension muß die Karte eine Abkürzung sein. Und auf dieselbe Art und Weise muß die Sprache eine Abkürzung für die Lesbarkeit der Welt als solche sein.“101 Worte können und dürfen demzufolge (ganz im Sinne der Voraussetzungen für das Medium; vgl. Abs. 2.1) nicht mit der Sache selbst identisch sein.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1 René Magritte: La condition humaine (1933)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2 Eugen Gomringer: geografie(1970)
3.2.2 Der Universalienstreit
Bereits Platons Ideenlehre102 (z.B. im Phaidon, oder der Staat) erklärt das hierarchische Verhältnis von der Idee (griech. Idéa: Urbild) zu den konkreten Gegenstände und der weiteren Abbildung durch den Künstler. Reflexionen und kritische Ansätze dieser Thematik blicken auf eine lange Tradition zurück.103
Der prekäre Kern des Universalienproblems liegt in der Kritik der Subsumierung von Gegenständen unter einem einzigen Begriff bzw. einer Kategorie (wie z.B. „Mensch“), bei dessen einschränkender Definition (durch Eigenschaften und Konnotationen) sich die Verallgemeinerung und konkrete Ausnahmefälle gegenüberstehen. Nietzsche bringt dazu folgendes Gleichnis:
„So gewiß nie ein Blatt einem andern ganz gleich ist, so gewiß ist der Begriff Blatt durch beliebiges Fallenlassen dieser individuellen Verschiedenheiten […] gebildet und erweckt nun die Vorstellung, als ob es in der Natur außer den Blättern etwas gäbe, das „Blatt“ wäre, etwa eine Urform, nach der alle Blätter gewebt, gezeichnet, abgezirkelt, gefärbt, gekräuselt, bemalt wären, aber von ungeschickten Händen, so daß kein Exemplar korrekt und zuverlässig als treues Abbild der Urform ausgefallen wäre.“104
Moderne linguistische Ansätze der siebziger Jahre lösten dieses Dilemma (auf der Grundlage der Saussureschen Signifikant-Signifikat-Beziehung) mit dem kognitiven Konzept der Prototypensemantik, nach der jeder Mensch individuell eine dominante, allgemein-abstrakte Vorstellungen eines Gegenstandes (einen „Prototypen“) hat, und diesem mehr oder weniger deutliche Konturen und Eigenschaften zuordnet. Durch das notwendige Kriterium der Konvention entfernen sich die (abstrakten) Begriffe stetig weiter von den realen Gegenständen: Der Preis der Normierung ist zu bezahlen mit dem Verlust der Individualität der Dinge.
Auch der Versuch durch präzise Betrachtung eines einzelnen Gegenstandes diesen folglich möglichst exhaustiv (und dadurch authentisch) zu beschreiben, ufert in eine sinnlose Danaidenarbeit aus. Dies bedeutet an sich jedoch nicht, dass keine Aussagen möglich sind, sondern dass das Aussagen zu keinem Ende kommt. Aus dieser Erkenntnis folgt die Konsequenz, dass dem Prozess der Verflüssigung nicht beigekommen werden kann: „Auf die Atomisierung der Welt kann die Sprache nur mit Regression oder Verstummen antworten.“105
3.2.3 Dynamische Welt und statische Worte
„Nichts Festeres als eine Statue, nichts Unfesteres als die Musik.“106 Michel Serres
Eine weitere unüberbrückbare Hürde stellt der notwendig statische Charakter der Sprache dar. Verwundert darüber wie Worte eine Bewegung in sich zu bannen vermögen, so beschreibt Rilke in seinem Gedicht Tanagra 107 (1906) die kleine Statue, welche ein tanzendes Mädchen verkörpert: „als wäre die Gebärde / einer Mädchenhand / auf einmal nicht mehr vergangen“. Auf dieselbe Weise unterschlagen die Worte (abgesehen vom etymologischen Bedeutungswandel) die Komponente der Veränderung bzw. der Zeit. Die lebende Natur vermögen Worte ebenso wenig einzufangen, wie die einzelne Fotografie eine ganze Szene wiederzugeben vermag108. Wie bei einer Kinofilmrolle besteht das Lebendige in der Veränderung, in der Differenz von Bild zu Bild.
Walter Benjamin sieht dieselbe Problematik in der Geschichtsschreibung:
„Es gibt ein Bild von Klee, das Angelus Novus heißt. Ein Engel ist darauf dargestellt, […]. Der Engel der Geschichte muß so aussehen. Er hat das Antlitz der Vergangenheit zugewendet. […]. Er möchte wohl verweilen, die Toten wecken und das Zerschlagene zusammenfügen. Aber ein Sturm weht vom Paradiese her […]. Dieser Sturm treibt ihn unaufhaltsam in die Zukunft, der er den Rücken kehrt, während der Trümmerhaufen vor ihm zum Himmel wächst. Das, was wir den Fortschritt nennen, ist dieser Sturm.“109
Das Wort verbleibt im festen Aggregatzustand und vermag die „vorbeihuschende“110, ephemere Realität nicht festzuhalten: „Wir leben also in einer Wirklichkeit, mit der unsere Sprache nicht Schritt gehalten hat […].“111 Dass Gedichte trotzdem immer wieder einen optimistischen Vorstoss machen, jedoch bei der Rückkehr (in der Notation) an medialen Bedingungen scheitert, zeigt sich an der folgenden Stelle:
„... dass Gedichte also am ehesten lokale Fluxusphänomene, vorüber- gehend materiale Sprachereignisse, Sedimentationen dessen sind, was einem durch den Kopf und das will heißen: durch den ganzen Körper geht […]. Dauerreanimationen, […] und kollabierende Gegenwarten […]. [D]och stets ist nur die Spur von etwas, zu dem wir zu spät hinzukommen […].“112
Das hierbei angeklungene Bedauern hat aber noch nicht das lähmende Ausmass der Beunruhigung angenommen, das in Hugo von Hofmannsthals Brief zur Entfaltung kommt.
3.3 Die Liquidierung der Sprache in Hofmannsthals Brief
„[D]ie abstrakten Worte […] zerfielen mir im Munde wie modrige Pilze.“113 Hugo von Hofmannsthal
Als beunruhigender Eckpfeiler, der die Atmosphäre der Sprachskepsis versinnbildlicht, erweist sich Hugo von Hofmannsthal durch seinen literarisch virtuosen Text Ein Brief (1902)114. Darin berichtet die fiktive, aporetische Figur des Philipp Lord Chandos dessen Freund Lord Francis Bacon von seinem Zerfall der Sprache. Auffällig ist dabei die durchgehend verwendete Wasser- Metaphorik115 und die damit verbundene Liquidierung, die für den Zerfall der Sprache verantwortlich ist. Anhand einer bemerkenswerten Vielfalt von illustrativen Situationen schildert Lord Chandos sein wiederholtes Erleben der kompromittierten Tragfähigkeit der Sprache, im Zuge dessen ihm die Fähigkeit abhanden kommt, „über irgend etwas zusammenhängend zu denken oder zu sprechen.“116, sein Dasein geistlos und gedankenlos dahinfliesst117 bis es zuletzt in vollständiger Aporie endet.
Die Prozesse der Liquidierung können dabei in die Aspekte Zersetzung, Verw ä sserung und Aufl ö sung gegliedert werden.
3.3.1 Moder, Rost und morsch
„Es heißt / ein Dichter / ist einer / der Worte / zusammenfügt // Das stimmt nicht // Ein Dichter / ist einer / den Worte / noch halbwegs / zusammenfügen // wenn er Glück hat // Wenn er Unglück hat / reißen die Worte / ihn auseinander“118
Erich Fried
Die Begriffe, welche Lord Chandos zu verwenden gedenkt, verlieren ihre Aussagekraft über einen Gegenstand und damit ihren Selbstzweck, indem sie sich in seinem Geist unwiderruflich von der Welt abgekoppelt haben.
Er vergleicht seine stets misslingenden Versuche etwas in Worte zu fassen folgendermassen: „Ich empfang ein unerklärliches Unbehagen, die Worte »Geist«, »Seele«, oder »Körper« nur auszusprechen. Ich fand es unmöglich, […] ein Urteil herauszubringen. […][D]ie abstrakten Worte […] zerfielen mir im Munde wie modrige Pilze.“119 Dieses Beispiel zeigt exemplarisch, dass das Wasser Schuld an den Verfallsprozessen ist: Pilze verfaulen120, der „Rost“121 der Skepsis befällt seine sprachliche Ausdrucksfähigkeit, und die „morschen Bretter“122 in den Dielen seines Zuhauses müssen ersetzt werden.
In einem Gespräch, das er früher ohne weiteres hätte bewältigen können, gerät er nun dadurch in Bedrängung, dass ihm die Begriffe zwar zuströmen, aber im selben Moment „ineinander überfliessen“123 und ihn damit überfordern. Der Kontrast zur souveränen Handhabung der Sprache seiner antiken Vorbilder („Wasserspiele der Alten“124 ) lässt ihn seine eigene Unfähigkeit umso prekärer erfahren.
Der destruktive Einfluss des Wassers zeigt sich bei jeglichem Kontakt mit den Gegenständen und führt letzten Endes zu deren Zerfall: Um dies wieder auf eine konkrete Ebene zurückzuführen, kann gesagt werden, dass sich die Begriffe Lord Chandos entziehen, indem sie sich verwässern, und dadurch ihren eindeutigen Bezug verlieren: „Es zerfiel mir alles in Teile, die Teile wieder in Teile, und nichts mehr liess sich mit einem Begriff umspannen.“125 Die bedrohliche Dimension der Liquidierung wird besonders auch an der folgenden Stelle deutlich: „Die einzelnen Worte schwammen um mich; […] Wirbel sind sie, in die hinabzusehen mich schwindelt, die sich unaufhaltsam drehen und durch die hindurch man ins Leere kommt.“126 Die tödliche Bedrohung welche dem Wasser attestiert wird, besteht darin, dass die Worte gleichsam wie Haie um Chandos kreisen und er zuletzt hilflos von einem Strudel verschlungen wird.
3.3.2 Flüssige und überflüssige Worte
„Jedes Wort hat fliessende Grenzen.“127
Arthur Schnitzler
Die bislang überschaubare und allgemeine Benennung der Gegenstände kollidiert mit seiner Einsicht, dass jeder Gegenstand, bei gründlicherem Betrachten, in seinem Detail- und Facettenreichtum einzigartig ist und somit nicht in die abstrakte Form der Sprache gegossen und dadurch fassbar gemacht werden kann. Dies wird beispielsweise an Folgender stelle deutlich: „Mein Geist zwang mich, alle Dinge […] in einer unheimlichen Nähe zu sehen […]. Es gelang mir nicht mehr, sie mit dem vereinfachten Blick der Gewohnheit zu erfassen.“128.
Indem die einzelnen Begriffe selbst zu karg scheinen, um Gegenstände und Sachverhalte in ihrer Vollumfänglichkeit zu umspannen, sind sie als Referenz letztendlich komplett unzureichend. Je allgemeiner sie sind, d.h. je mehr Gegenstände sie in sich zusammenfassen, desto weiter entfernen sie sich von den Einzeldingen, werden zunehmend abstrakter. Im Zuge dessen verlieren sie immer mehr ihre eindeutigen Konturen, und verwässern sich damit so sehr, dass deren Aussagegehalt letztendlich inhaltsleer geworden ist.
3.3.3 Von Unendlichkeit und Ozeanischem
Während seiner Betrachtungen durchschauert Lord Chandos die Zusammensetzung von Nichtigkeiten mit einer „Gegenwart des Unendlichen“129. Dieses unfassbare Gefühl angesichts einer unendlich grossen unbestimmten Masse findet sich ebenfalls bei Sigmund Freud, der diese spezifische Empfindung als „ozeanisch“ bezeichnet: „[D]ie Empfindung der »Ewigkeit« […] ein Gefühl wie von etwas Unbegrenztem, Schrankenlosem, gleichsam »Ozeanischem«.“130 Schon Johann Gottfried Herder hegt in seinem Werk zur Abhandlung ü ber den Ursprung der Sprache (1772) Hoffnung für eine solche Methode: „Der Mensch beweist Reflexion, wenn die Kraft seiner Seele so frei würket, dass sie in dem ganzen Ozean von Empfindungen, der sie durch alle Sinne durchrauschet, eine Welle, […] absondern, sie anhalten, die Aufmerksamkeit auf sie richten […] [kann].“131 Ein Versuch, bestimmte „Wellen“ festzuhalten, wird von Surrealisten des 20. Jahrhunderts in der É criture automatique unternommen (Abs. 4.2.6.1).
Die unermüdliche (jedoch noch euphorische) Suche nach dem „Unendlichen“ war ebenfalls für die Epoche der Romantik äusserst charakteristisch.
Einem ähnlich erfolglosen Unterfangen Realweltliches durch Worte aus dem diffusen Ozeanischen zu bergen, begegnet man bei Robert Musil:
“Sobald wir etwas aussprechen, entwerten wir es seltsam. Wir glauben in die Tiefe der Abgründe hinabgetaucht zu sein, und wenn wir wieder an die Oberfläche kommen, gleicht der Wassertropfen an unseren bleichen Fingerspitzen nicht mehr dem Meere, dem er entstammt. Wir wähnen eine Grube wunderbarer Schätze entdeckt zu haben, und wenn wir wieder ans Tageslicht kommen, haben wir nur falsche Steine und Glasscherben mitgebracht; und trotzdem schimmert der Schatz im Finstern unverändert.”132
Von einem ähnlichen Misslingen wird Hofmannsthal heimgesucht, indem sich ihm die irdischen Begriffe entziehen133. Er vergleicht sein im Vornherein zum Scheitern verurteiltes Vorhaben mit des Erhaschens eines Regenbogens (als Spiel aus Luft und Wasser). Es gelingt ihm also nicht, eine Brücke zu den wirklichen Dingen zu schlagen134. Hier deutet sich ein expliziter Zusammenhang zu Nietzsches Also sprach Zarathustra (1884) an, indem nun Zarathustra selbst die rhetorische Frage stellt: „[S]ind nicht Worte […] Regenbögen und Scheinbrücken zwischen Ewig- Geschiedenem?“135
Lord Chandos vergleicht im selben Absatz sein Leiden mit den sagenhaften Tantalusqualen: „Wie soll ich es versuchen, Ihnen diese seltsamen geistigen Qualen zu schildern, […] dies Zurückweichen des murmelnden Wassers vor meinen dürstenden Lippen?“136 Diese Metonymie legt die Vermutung nahe, dass hier das Wasser als Substanz der Genesung inszeniert wird. Um allfällige Widersprüche zu vermeiden ist jedoch klarzustellen, dass vielmehr die Fassbarkeit des Wassers bzw. dass die verwässerten Worte selbst abermals (be)greifbar werden als Ziel herbeigesehnt wird.
Der metaphorische Durst nach Wasser stellt somit Chandos unstillbaren Wunsch nach einer erneuten Harmonie, eine erfolgreiche Überbrückung zwischen der Welt und den Worten dar, dem er nichts entgegenzuhalten weiss, ausser seine Aporie ausführlich zu beschreiben. In seiner Skepsis verliert er nicht nur die Fähigkeit, sich entsprechend auszudrücken, sondern befindet sich generell in einem Zustand, in welchem ihm das Denken generell abhanden kommt. Doch gerade die Sprache sollte, laut Ferdinand de Saussure, durch ihren konventionellen und konkreten Zeichencharakter der Schwammigkeit des Denkens entgegenwirken:
„Psychologisch betrachtet ist unser Denken, wenn wir von seinem Ausdruck durch die Worte absehen, nur eine gestaltlose und unbestimmte Masse. Philosophen und Sprachforscher waren immer darüber einig, dass ohne die Hilfe der Zeichen wir ausser Stande wären, zwei Vorstellungen dauernd und klar auseinander zu halten. Das Denken, für sich allein genommen, ist wie einen Nebelwolke […] nichts ist bestimmt, ehe die Sprache in Erscheinung tritt.“137
Dies kann generell so ausgelegt werden, dass die Wahrheit erst durch Sprache in Erscheinung treten kann, dadurch aber (als Begriff) sogleich wieder verfälscht wird.
3.3.4 Verflüssigen und erstarren
Das Sprachverständnis des Lord Chandos hält (zu Beginn seiner Skepsis) noch an der Hoffnung fest, dass es sich bei der Beziehung zwischen den Wörtern und den realen Einzeldingen (die bei seiner Betrachtung in immer kleinere Teile zerfallen bzw. semantisch sukzessive liquidiert werden) lediglich um unterschiedliche Aggregatzustände desselben Sache handelt. Im Verlauf des Briefes wird zunehmend deutlich, dass aber das Flüssige (als das Ungeordnete und Dynamische) nicht exhaustiv in der starren Form der Worte festgehalten werden kann. Die vergebliche Suche nach den Dingen im Wasser, also in der Sprache verdeutlicht, dass die Empfindungen Chandos auf dessen Oberfläche bleiben, und es nicht vermögen, in diese einzudringen. Damit schwimmt er, ähnlich dem Schwimmkäfer in der Giesskanne138 uferlos hin und her. Auf dem verlorenen Posten der Erkenntnis, dass sich das Flüssige nicht endgültig in starre Konventionen bannen lässt, beschränkt er sich auf den kontemplativen Akt. Er erhofft sich dabei selbst zu jenem Gefäss der Offenbarung zu werden, in welchem sich das „höhere Leben“, das „göttliche Gefühl“139 anzusammeln vermag.
3.3.5 Verwässerung als Verwandlung
Das fatale Element der Transformation zeigt sich beim Übertragungs-Versuch der (lebendigen) Welt in starre Begriffe. Im Brief wird dies anhand der Metamorphosen veranschaulicht: Genannt werden u.a. der junge Jäger Akt ä on, der von der Göttin Diana in ein Hirsch verwandelt wurde, die Sirenen (als verführerische und gleichzeitig verheerende Meeres-Mischwesen), Perseus, der dem petrifizierenden Fluch der Medusa entkam, und besonders Narziss, welcher sein eigenes Spiegelbild im Wasser nicht zu fassen vermochte. All diese Verwandlungen endeten tödlich oder beinhalten zumindest ein zerstörerisches Potential.
An diesen Beispielen wird deutlich, dass das Lebendige im flüssigen Zustand, in der Wandlung selbst liegt, während bei der starren Abstraktion (Bezeichnung) die Dinge in dieser leblosen Reduktion verenden. In den Schlusszeilen seines Gedichtes Ich f ü rchte mich vor der Menschen Wort (1898) warnt Rilke davor alles gedankenlos mit Begriffen zu etikettiert. Dadurch büssten die Dinge ihren Zauber bzw. ihre Lebendigkeit ein: „Die Dinge singen hör ich so gern. / Ihr rührt sie an: sie sind starr und stumm. / Ihr bringt mir alle die Dinge um.“140 Demselben Drang wirkt Pessoa entgegen, indem er die stetige Anmassung die Welt in Worte zu fassen vehement zu verwirft, weil der Obolus der „Über-setzung“ schlichtweg zu hoch ist:
„Ach laßt uns diese Dinge nicht vergleichen; laßt uns hinsehen. / Wozu Analogien, Metaphern, Simile. / Ein Ding mit einem anderen vergleichen heißt dieses Ding vergessen. / Kein Ding erinnert an ein anderes, betrachten wir es näher. / Jedes Ding erinnert nur an das, was es ist.“141
In diesem fatalen Unvermögen, die Dinge durch Worte fassbar zu machen, ergründet sich Lord Chandos ganzes Unglück:
„Wer […] in der Sprache das Dinghafte sucht, der wird ins Leere greifen, nur Schall finden. Die Kritik an der Sprache erwächst aus der Verzweiflung der vergeblichen Suche nach jenem vermeintlich Festen, Gewissen, dass die Wörter nicht zu geben vermögen: Es gibt keine unmittelbare Beziehung zwischen Sprache und Welt, sie gelangen nie zur abbildhaften Deckungsgleichheit.“142
Durch diese Dementierung der Verbindung von Wirklichkeit und Sprache wird ihr gleichzeitig ihre Funktion als soziale Kommunikationsform aberkannt. Was in der Verzweiflung übrig bleibt, ist lediglich noch Lord Chandos (paradoxe) rhetorische Eloquenz, mit der er seine Sprachlosigkeit virtuos beschreibt:
„Im Schatten der thematisch werdenden Sprachskepsis […] zeichnet sich eine doppelte Schrift ab, die vordergründig ihre eigene Unmöglichkeit beklagt und auf einer höheren Ebene diese Klage durchstreicht, indem sie sie als bloßen Anlaß für ihr Fortschreiten begreift. Die doppelte Schrift will den Eindruck unmittelbarer Verzweiflung über sich selbst erwecken, aber sie ist zugleich eine kunstvolle Inszenierung solcher Spontaneität unter dem Mantel der Sprachnot.“143
Was mit Novalis begonnen hatte und noch „in den Diensten einer Romantisierung der Welt“144 stellte, endet in Hofmannsthals auswegloser Situation, dem Verlust der Sprache: „Lyrik hat sich ins Exil des Verstummens zurückgezogen.“145
4. AUTONOMIE UND METHODISCHE LIQUIDIERUNG DER SPRACHE
„Die vollendete Skepsis ermöglicht auch die vollendete Freiheit.“146 Hugo Ball
Das Prinzip der methodischen Liquidierung in der Literatur, das im Folgenden thematisiert wird, umspannt begrifflich den Prozess der Verflüssigung bis hin zur vollständigen Auslöschung der Sprache. Unter dem Motiv der Befreiung von Sprache aus ihren traditionellen Konventionen entsteht die Tendenz einer sukzessiven Liquidierung bei verschiedenen avantgardistischen Strömungen. Um dies zu veranschaulichen werden insbesondere beim Futurismus, Dadaismus, Surrealismus und zuletzt bei der konkrete Poesie spezifische Ansätze der Liquidierung aufgezeigt. Die terminologische Anlehnung zu Hofmannsthals (Lord Chandos) Schilderungen über den Zerfall der Sprache ist deshalb offensichtlich sinnvoll, weil bei den ambitionierten experimentellen Literaten dieselbe Zersetzung aus dem Motiv der Befreiung und Etablierung der Autonomie von Sprache zum kreativen Programm wird.
4.1 Die Erben der Sprachskepsis
Das Vertrauen der Literaturschaffenden in die Sprache wurde durch die Skepsis auf ein rudimentäres Minimum zurückgedimmt:
„Daß sich Welt und Dinge mit Worten nicht angemessen erschließen lassen, ist im beginnenden 20. Jahrhundert nahezu herrschende Meinung unter Intellektuellen und Literaten und wird je nach Perspektivierung dieses Problems als Sprach-, Wahrnehmungs-, oder auch Bewußtseins- und Wirklichkeitskrise verstanden.“147
Als verätztes Relikt namhafter Dichter einer vergangenen Zeit stellte sie aufgrund ihrer vermeintlich irreversibel Entkopplung von der Wirklichkeit ein nutzloses Erbe dar. Auf welchem Weg konnte der Gordische Knoten der Sprachskepsis nun zerschlagen werden? War es überhaupt möglich das Renommee der Sprache wieder herzustellen?
4.1.1 Literarische Renegaten
„Wir stehen auf dem äußersten Vorgebirge der Jahrhunderte!
... Warum sollten wir zurückblicken, wenn wir
die geheimnisvollen Tore
des Unmöglichen aufbrechen wollen?“148
F.T. Marinetti
Der radikalen Paradigmenwechsels der Sprache in der Literatur bestand im folgenden darin, dass sich diese, wie das Kunstwerk, von ihrer Abbildfunktion zu lösen begann und von nun an eigene „Inhalte“149 schafften sollte. In allen Teilen Europas formten sich im Zuge dessen resolute nichtmimetische Künstler-Gruppen150, die durch experimentelle (oft auch mechanische) Methoden das Potenzial der Kunst auszuloten begannen: „Dieser experimentelle Grundzug der modernen Literatur akzentuiert den Primat des Machens und Versuchens […].“151
Damit sich diese neue Freiheit der Sprache entfalten konnte, mussten noch mit alten, konventionellen Sprachvorstellungen gebrochen werden, welche durch ihre Restriktionen diesem Prozess im Wege standen. Die folgende Emanzipation der Sprachwelt bedeutet aber gleichzeitig eine Entfremdung von der Dingwelt152. Was für Hofmannsthal (Lord Chandos) fatal war, stellte für die sprachlichen Pioniere des neuen Jahrhunderts hingegen eine Befreiung dar.
4.1.2 Experimentelle Pioniere
Einen ersten avantgardistischen Ansatz (obwohl diese teilweise bereits vorhanden waren153 ) verkörperte Stephan Mallarmés Text Un Coup de D é s 154 von 1897. Besonders auffällig ist dabei die Verwendung der Fläche als konstitutives Element des Textes155. Der inhaltliche Schwerpunkt gründet sich auf dem Begriff der „Konstellation“, welcher symbolisch die sprachliche Abstraktion weltlicher (nicht zusammenhängender) Dinge verkörpert. Diese natürliche Inkohärenz bewertet z.B. Pessoa folgendermassen: „Eine wirkliche, wahre Gesamtheit / Ist eine Krankheit unserer Ideen. / Die Natur, das sind Teile ohne ein Ganzes. / Dies ist vielleicht das Geheimnis, von dem sie reden.“156 Auf die zentrale Bedeutung der Konstellation in der avantgardistischen Literatur, besonders innerhalb der konkreten Poesie, wird im Unterkapitel
4.2.7.2 genauer eingegangen.
Die typografische Verflüssigung in Mallarmés Text eröffnete den experimentellen Diskurs mit der Schrift (bzw. der Materialität von Sprache):
„Das Wort verliert die Eindeutigkeit, der Raum zwischen den Wörtern gewinnt an Bedeutung, was dazu führt, dass die Lesegeschwindigkeit und die Linearität des Lesens unterbrochen werden. Die Wörter gewinnen so eine räumliche Plastizität, eine eigene Gestalt, die nicht nur durch ihren Sinn geformt wird.“157
Nur wenige Jahre danach, chronologisch gesehen aus der Zeit nach Hofmannsthals Brief, entstand ein Gedicht, das deutlich die konservativen, literarischen Konventionen brach: Christian Morgensterns Fisches Nachtgesang aus seinem Gedichtband Galgenlieder von 1905 (Abb. 3).
Durch die Substitution der Sprache (mit Ausnahme des Titels) anhand der bildhaften Elemente, in diesem Fall die metrischen Symbole für Senkung ( ) und Hebung (—), (re)konstituiert das Gedicht durch seine Inexplizitheit das Phänomen „Gesang“ ohne den Umweg über Worte. Dadurch, dass zur künstlerischen Inszenierung der Schrift vor der Sprache priorisiert wird, etabliert sich in diesem Gedicht eine revolutionäre Umstrukturierung in der konventionellen Hierarchie, bei welcher die Schrift bloss als mediale Notationsform (oder ergänzender, grafischer Ornatus) des Inhaltes herhält.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 3 Christian Morgenstern: Fisches
Nachtgesang (1905)
Durch den Titel deutet sich ein eindeutiger Bezug zur Natur an. Dabei wird die Absenz weiterer Worte bei gleichzeitiger Erfahrbarkeit abstrakter Zeichen eine Musterhaftigkeit imitiert, welche den Kerngedanken der Skepsis satirisch aufzugreifen scheint.
Das Prinzip der Liquidierung findet hier ausgehend von der vermeintlichen Wasserthematik, die der Titel evoziert, im Bezuglos-Werden der semantisch Ebene statt. Gleichzeitig deutet die visuelle Textform ikonisch einen Fisch (inkl. Schuppen) hin. Durch die optische Ästhetik drängt sich unmittelbar ein alternativer, formaler (nicht inhaltlicher) Referenz-Aspekt auf. Dadurch nimmt Morgenstern ein wesentliches Element der konkreten Poesie der fünfziger Jahre vorweg, nach welcher der ganze Text „auf einen blick seine struktur [preisgibt][…], statt sich erst in der vorstellung des lesers allmählich aus dem gelesenen erinnerten aufzubauen.“158 Das Gedicht verkörpert exemplarisch den literarischen Paradigmenwechsel nach der Sprachskepsis, im Zuge dessen die Sprache autonom wird.159
4.1.3 Beginn der Autonomie
Cecil A. M. Noble, der sich intensiv mit der Sprachskepsis und deren Auswirkung in der Kunst befasste, stellt fest, dass die dichterische Sprache, die gezwungenermaßen ihre Essenz nicht mehr mitteilen kann, sich auf sich selbst besinnt und dadurch zu ihrem eigenen Gegenstand wird160. In dieser Entwicklung sieht er das grosse innovative Potenzial der Literatur: „Der Gewinn der sprachlichen Eigenwelt als Medium der literarischen Konstruktion ist […] die auffallendste Eigenschaft der modernen Dichtung […].“161 Besonders die darauffolgenden Entwicklungen wie beispielsweise in der dadaistischen Avantgardebewegung führen dazu, dass Sprache „nicht als Medium zur Repräsentation von Inhalten […], sondern in ihrer Medialität selbst inszeniert [wird].“
Daraus erwächst in der Konsequenz eine Revision des konventionellen Sprachverständnisses: „Die Vorstellung von Wirklichkeit, die hinter dem Text steht und diesem […] erste Substanz verleihen würde, ist gewissermaßen eliminiert.“163
Dadurch erhöht sich nun Anspruch an den Dichter selber. Die authentische Kreativität wird ins Zentrum des literarischen Schaffensprozesses rückt. In diesem Sinne wird der Dichter vom Detektiven (Abs. 2.3.3) zum Pionier; vom Auf-decker der Sprache der Natur zum Ent-decker in der Natur der Sprache, zu einem „Abenteurer in bisher unbetretenen Sprachfeldern.“164 Dieses innovative Vorhaben verlangt aber eine gewisse Kühnheit, wie beispielsweise André Breton im Manifest des Surrealismus (1924) konstatierte: „Kolumbus mußte mit Verrückten ausfahren, um Amerika zu entdecken. Und seht nur, wie diese Verrücktheit Gestalt gewonnen hat - und Dauer.“165 Bis sich dieses Verständnis in der Öffentlichkeit etabliert, wird besonders auch Geduld benötigt: „Der Dichter ist nie der › Einzige ‹. Dann wäre er wertlos, ein Seelen-Freak! Er ist der › Erste ‹. Er fühlt es, er weiß es, daß die anderen nachkommen, weil sie bereits in sich verborgen die Keime seiner eigenen Seele tragen!“166
Im Zuge dessen gewinnt der Begriff der „poetischen Realität“ an Bedeutung, und nicht nur in der Literatur; Picasso hielt diesbezüglich einer Kritik gegen eines seiner kubistischen Werke entgegen: „Die Natur ist eine Wirklichkeit, aber meine Leinwand ist auch eine Wirklichkeit.“167 Insofern wird die Vorstellung des mimetischen Handwerkers vom poetischen Genie (vgl. Abs. 2.2) verdrängt.
Was die folgenden literarischen Generationen zudem auszeichnen sollte, war der Drang nach Freiheit des Ausdrucks. Voraussetzung dafür war aber, dass der erlebte Bruch von Sprache und Welt mit der expliziten Kappung von konservativen, als restriktiv empfundenen Sprach- Konventionen besiegelt werden. Als Startschuss können die radikalen Maximen der Futuristen gesehen werden, welche durch F.T. Marinettis Manifest (1905) das Krisengebiet Sprache zum Kriegsgebiet erklärten.
4.2. Chaos - Liquidierung der Ordnung
„Das Chaos wird als Urgrund aller Dinge gepriesen und soll durch künstliche Zerstörung wiederhergestellt werden, denn nur im Spiel des Chaos ist der Mensch wirklich frei.“168
Alfred Liede
Aus dem Motiv der Befreiung weichen die literarischen Avantgarden möglichst weit von der alten Norm ab. Dieses Streben lässt sich mit ein spezifischen Prinzip aus der Thermodynamik in Verbindung bringen: die Enthropie 169 . Diese gilt als Mass für Unordnung170, und reflektiert die avantgardistische Tendenz konventionelle Normen sukzessive bis hin zum Formlosen zu demontieren. Das geschieht unter den allgemeinen Motiven der Freiheit und der Auslotung des kreativen Potenzials. Hugo Ball beschreibt dazu treffend: „Man kann fast sagen, daß, wenn der Glaube an ein Ding oder an eine Sache fällt, dieses Ding und diese Sache ins Chaos zurückkehren, Freigut werden.“171
Durch verschiedene Prozesse der Liquidierung werden die Worte und Buchstaben befreit.
Bis zu diesem Punkt wurden bereits einzelne Ansätze verschiedener avantgardistischen Strömungen gestreift, welche versuchen die Sprache als autonomes System zu etablieren. Beginnend mit den Futuristen soll im Folgenden nun aufgezeigt werden in welchen theoretischen und formalen Aspekten sich die Liquidierung bzw. die Befreiung äussert.
4.2.1 Das polemische Programm der Futuristen
Der Akt der Befreiung der Sprache, welchen sich die italienische Strömung der Futuristen (welche von 1909 bis 1916 Hochkonjunktur feierten172 ) zum Ziel gemacht hatten, zeigt sich in der revoltierenden Absage an bisherige Konventionen, gegen die „Tyrannei der Sprache“173. In Marinettis Manifest von 1909 wird diesbezüglich proklamiert: „Mut, Kühnheit und Auflehnung werden die Wesenselemente unserer Dichtung sein.“174 Des Weiteren wird die phlegmatische Gesinnung der konventionellen Dichtung und deren sprachlichen Stupor angeprangert: „Bis heute hat die Literatur die gedankenschwere Unbeweglichkeit, die Ekstase und den Schlaf gepriesen. Wir wollen preisen, die angriffslustige Bewegung […] die Ohrfeige und den Faustschlag.“175 Durch diese euphorische Aggression, welche in der Art der Formulierung einer Kriegserklärung gleicht, sollen die restriktiven Schranken überschritten und überwunden werden, die sich kontraproduktiv auf das kreative Potenzial ausgewirkt hatten. Das romantische Streben nach Harmonie werden konsequent von der Verherrlichung der Kriegsästhetik verdrängt: „Schönheit gibt es nur noch im Kampf. […]. Die Dichtung muß aufgefaßt werden als ein heftiger Angriff auf die unbekannten Kräfte, um sie zu zwingen, sich vor dem Menschen zu beugen.“176 Diese „unbekannten Kräfte“ sollen durch rohe Gewalt unterworfen werden. Auch darin ist die explizite Vorstellung eines unbekannten Sprachlosen, das es gewaltsam in Worte zu bannen gilt, deutlich zu erkennen. Gerade durch diese aggressiven pragmatischen Operationsmaximen wird das literarische Schaffen schlagartig mit einer neuen Energie aufgeladen, die letztlich durch ihre Radikalität die Suche nach neuen Sprachformen voranzutreiben hilft.
Versucht man herauszuarbeiten mit welchen konkreten Mitteln die „ Parole in Libert à ! “ („Freiheit der Worte“, Marinetti) sichergestellt werden soll, stösst man auf scheinbar paradoxe, einander zuwiderlaufende Tendenzen, indem Freiheit durch neue Restriktionen etabliert wird.
4.2.2 Befreiung und Restriktionen - ein Paradox?
Sprache ist „die schlimmste Konvention [von allen]“177.
Andr é Breton
Bei vielen avantgardistischen Strömungen manifestiert sich die Etablierung neuer Ideen zur Umsetzung der sprachlichen Freiheit paradoxerweise in der Festlegung von Restriktionen. Es stellt sich die Frage wie diese Beobachtungen zu erklären sind.
„Worte in Freiheit!“, lautet der euphorische Wahlspruch der Futuristen (Abb. 4), der vor allem das polemische Leitmotiv der Befreiung betont, und sich in der radikalen Liquidierung traditioneller und konservativer Textstrukturen äussert.
Dem entgegen bestehen die programmatischen Forderungen hauptsächlich in der Aufstellung weiterer Restriktionen. Dies kann dahingehend aufgelöst werden, als dass die neue Regeln (wie z.B. die Forderung der Futuristen nach der Eliminierung der Adverbien, Adjektive und Interpunktion178 ) an sich Methoden der Liquidierung verkörpern, d.h. mehrheitlich Leitsätze eines generativen Verfahrens darstellen. Die Sprache wehrt sich gegen strukturelle Einschränkungen, kann sich aber nicht gänzlich von seiner formellen (konventionellen) Notationsform lösen. Das primäre Bestreben gilt der Aufsprengung dieser allzu starren literarischen Strukturen. Was noch die Anhänger des Sturm und Drang ausgezeichnet hatte, dass sie mehr wussten wogegen sie revoltierten, als wof ü r 179 , scheint besonders auch für die futuristischen Avantgarden zu gelten, wobei bereits der allgemeine Terminus „Avantgarden“ diese polemische Komponente signalisiert. Einen alternativen revolutionären Weg der Befreiung findet sich bei den Dadaisten.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 4 F. T. Marinetti: Apr è s la Marne, Joffre visite le front en auto (Nach der Marne, Joffre besuchte die Front per Auto, 1915)
4.2.3 Liquidierung im Dadaismus
„Ich will keine Worte, die andere erfunden haben. Alle Worte haben andere erfunden.“180 Hugo Ball
4.2.3.1 Alltägliche und fremde Worte
Kennzeichnend für den Dadaismus ist die Aversion gegen den inflationären Gebrauch der Worte. Bereits im Gründungsmanifest von Hugo Ball wird die Thematik aufgegriffen: „Diese vermaledeite Sprache, an der Schmutz klebt wie von Maklerhänden, die die Münzen abgegriffen haben.“181 Ein ökonomisches Mittel, um der Inflation Einhalt zu gebieten, liegt in der Einführung einer neuen Währung. Aus denselben Motiven strebt der Dadaismus nach einer neuen, revolutionären und innovativen Poetik, deren Worte nicht inflationär ge- und verbrauch werden: „[D]ie Logorrhöe des Geredes überschwemmt die Gegend. […] die Worte haben ihre Strahlen verloren.“182
Diesem warnenden Gestus begegnete man noch bei Rilke (vgl. Abs. 3.3.5), der jedoch mehr davor warnte, die unendlich facettenreichen Dinge nicht einfältig durch ihre Namen zugrunde zu richten. Ball jedoch versucht Worte von ihrer alltäglichen Patina und zu befreien, indem sie neu komponiert werden.
4.2.3.2 Verse ohne Worte
Einen ersten Impuls verkörpert Morgensterns Gedicht Das gro ß e Lalul ā 183, welches sich trotz Pseudo-Worten (z.B. Zeile eins: „Kroklokwafzi? Semememi!“) in einen formell Konventionelle Gedichtform (und Rhythmisierung) eingliedert. Darin liegt das verflüssigende Motiv, bei welchem Worte sich gänzlich von ihrer Referenz lösen und gleichsam eine Fremdsprache bilden, welche nicht einmal mehr ihr Urheber zu übersetzen vermag. Als weiteres Beispiel, das nun im zeitlichen Kontext der Dadaisten eigebettet ist, kann das Gedicht Karawane (Abb. 5) von Hugo Ball, aufgeführt werden, bei dem nur der Titel einen konventionellen Begriff darstellt.
Die traditionelle Musterhaftigkeit der Form wird auf der Inhaltsebene durch die eigens komponierten Worte durchgestrichen. Zudem stellt sich die Alternierung der Schrifttypen einem kohärenten Verständnis des Textes entgegen. Die sprachliche Zersetzung findet deshalb sowohl auf der Textoberfläche, als auch auf der inhaltlichen Ebene statt. So proklamiert Ball: „Ich habe eine neue Gattung von Versen erfunden, «Verse ohne Worte» oder Lautgedichte […].“184 In Anlehnung an das Konzept der Lesbarkeit wird die Sprache hier selbst zur Chiffre, jedoch nicht zur „Schrift ohne Alphabet’“185, sondern mehr zu einer Sprache ohne Wörterbuch.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Ab . 5 Hugo Ball: Ka ra wa ne [ Ga dj i beri bimba ] (1917)
4.2.3.3 Semantische Undurchschaubarkeit
Einem vergleichbaren Prinzip, das hingegen weiterhin als Referenz fungiert, findet sich bei H. C. Andersens Märchen «Das stumme Buch», wie auch in der Erzählung Peter Bichsels «Ein Tisch ist ein Tisch». Die Gemeinsamkeiten beruhen in der auffälligen Akzentuierung des persönlichen Zugangs, der „individuellen“ Sprache. Andersen liebevolle Geschichte handelt von einem Verstorbenen Akademiker, der ein Buch voller verwelkten Blumen besessen hatte, die jede für sich an ein Kapitel seines Lebens geknüpft war186 und ihn bei dessen besinnlicher Durchsicht in solchem Masse nostalgisch stimmen konnte, dass ihm die Tränen über die Wangen liefen187. Die konservierten Blüten waren ihm, dadurch, dass sie persönlich gewählt wurden und direkt aus dem ursprünglichen Moment entstammten, als effektive partes-pro-toto eine authentischere Repräsentation als konventionelle Worte.
Bichsels Protagonist vermag es dagegen, dass durch sein Verrückungs-Verfahren, die nun individuelle Sprache oberflächlich von der ursprünglichen Konvention nicht zu unterscheiden ist: „Dem Bett sagte er Bild. Dem Tisch sagte er Stuhl. […].“188 „Seine“ Sprache ist wortwörtlich „ver-rückt“: Es sind paradoxerweise immer noch Worte in deutscher Sprache, jedoch mit alterniertem Verhältnis von Signifikat zu Signifikanten. Die Spielerei verunmöglichte die Kommunikation. Hugo Balls Wortkompositionen haben dagegen nicht die Eigenschaft, wieder entschlüsselt werden zu können, weil sie generell auf nichts referieren. Typografisches Pendant dazu stellt Paul Klees abstrakte Handschrift dar (Abb. 6). Diese ist eine inhaltsleere Nachahmung der Notation einer Sprache; aus der Perspektive der konventionellen Sprache eine Pseudo - Schrift, aus der avantgardistischen hingegen eine neue und vor allem echte Schrift. Durch das ramponierte, unleserliche Erscheinungsbild rückt die Ästhetik der Individualität (im Kontrast zur Normierung der Sprache) und der Schreibprozess selbst in den Vordergrund. Was an der Kreativität betont wird, ist hier die Fähigkeit etwas Individuelles erschaffen zu können, was generell eines der tiefsten menschlichen Grundbedürfnisse darstellt:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 6 Paul Klee: abstracte Schrift (1931)
„Die tiefsten Probleme des modernen Lebens quellen aus dem Anspruch des Individuums, die Selbstständigkeit und Eigenart des Daseins gegen die Übermächte der Gesellschaft, des geschichtlich Ererbten, der äußerlichen Kultur und Technik des Lebens zu bewahren […].“189
Diese optische Diffusität führt zu einer semantischen Undurchschaubarkeit, wodurch der Fokus unmittelbar auf die Textoberfläche gelenkt wird. Die Zunahme der optischen Liquidierung hat die Konsequenz, dass der Inhalt ebenfalls sukzessive eliminiert. Dies führt dazu, dass neue Möglichkeiten hinsichtlich der Sprachematerialität eröffnet werden. Eine dieser möglichen Umsetzungen zeigt sich in der unkonventionellen Performativität der Sprache. Besonders die neue Gattung der Lautgedichte erhält damit eine neuwertige, transzendentale Dimension. Von dieser berichtet Hugo Ball im Zusammenhang mit seiner öffentlichen Vortragung von „Karawane“:
„Wie sollte ich’s aber zu Ende führen? Da bemerkte ich, daß meine Stimme, der keinen anderen Weg mehr blieb, die uralte Kadenz der priesterlichen Lamentation annahm, […]. Ich weiß nicht, was mir diese Musik eingab. Aber ich begann meine Vokalreihen rezitativartig im Kirchenstile zu singen […].“190
Der hypnotisierende Trance-Zustand bleibt ihm noch bis nach der luziden, fiebrigen Aufführung der Glossolalie bestehen: „Da erlosch, wie ich bestellt hatte, das elektrische Licht, und ich wurde vom Podium herab, schweißbedeckt als ein magischer Bischof in die Versenkung getragen.“191 Durch diesen Erschöpfungszustand scheint Ball jener Forderung des Futurismus zu entsprechen, nach welcher sich der Dichter „glühend, glanzvoll und freigebig verschwenden [muss], um die leidenschaftliche Inbrunst der Urelemente zu vermehren.“192 Was durch diese „Verse ohne Worte“ angestrebt, und dennoch nicht vollständig erreicht wird, ist die höchste und reinste Stufe des kontemplativen Aktes, welche erst dann erreicht wird, „wenn man gelernt hat, die Sprache ganz hinter sich zu lassen.“193 Balls Lyrik geht demnach weit über die Wortbedeutungen hinaus und zielt „verstärkt auf Reaktionen, die Affekt und Intuition statt Intellekt und Reflexion betreffen.“194 In diesem Aspekt wird ersichtlich, dass es sich dabei nicht um eine bloss kindische Spielerei mit Buchstaben, Worten und Sprache handelt: „Je wirklichkeitsfremder bzw. sprachferner ein solches Gedicht also klingt, desto größer scheint das zu entbindende Bedeutungspotenzial zu sein.“195
4.2.4 Narrenfreiheit der Avantgarden?
„Dabei aber gehört der Nonsense zu den ernstesten Dingen dieser Welt und ihrer Poesie, denn er will vermittels des Gelächters befreien […].“196
Wilhelm H ö ck
Der aus klassischer Sicht poetische Dilettantismus der Avantgarden versucht prinzipiell durch experimentelle Verfahren das Potenzial der Sprache auszuloten und zu sondieren. Der verflüssigende Charakter der damaligen Literatur zeigt sich im „Prozeß des aktuellen, immer neuen überraschenden, experimentierenden Formulierens […] mit dem Medium, dem Instrumentarium der Sprache in fluidem Aggregatzustand […].“197 Derweil oszillieren die literarischen Experimente zwischen Spielerei und poetischem Ernst, oder sind manchmal lediglich bestimmt durch eine „Überlust am Formalen“198.
Das spielerische Motiv und der Unsinn sind wesentliche Bestandteile des Experiments:
„Der Unsinn […] durchbricht, verletzt, führt ad absurdum, was man als sinnvoll zu denken gewohnt ist; Kausalitäten werden auseinandergerissen, Logik wird verhöhnt, mißachtet oder überstrapaziert, Spannungen lösen sich nicht oder im falschen Augenblick, Erinnerungen an vertraute Zusammenhänge, wie sie die Sprache tradiert, sehen sich getäuscht, »Formen« und »Inhalte« klaffen auseinander, eine »verkehrte« Welt richtet sich auf: Aus Wörtern, auch aus solchen, die es nicht gibt.“199
Gerade im Dadaismus liegt die kreative, philosophische Essenz im Spiel verborgen: „Gewiß, solche Sprachspielgedichte nehmen die Worte leicht, um hinter deren Maske einen Ernst zu verbergen, der nicht zur Sprache finden kann. Oder sie machen das Wort zum musikalischen Element und führen es zurück zum fast kindlichen Lallen […].“200 Doch gerade in dieser besonderen Form tastet sich das Spiel an eine alte Vorstellung heran.
4.2.5 Der alte Traum von Unmittelbarkeit
„Jede Sache hat ihr Wort; da ist das Wort selber zur Sache geworden.
Warum kann der Baum nicht Pluplusch heißen, und Pluplubasch, wenn es geregnet hat? Und warum muß er überhaupt etwas heißen?“201
Hugo Ball
Durch den Fokus auf die Klangform bei der Aufführung wird abermals die Vorstellung einer Ursprache aufgegriffen. Im Gedicht „Karawane“ wird beispielsweise gleichzeitig eine Rückbesinnung auf afrikanische Wurzeln202 ersichtlich, wie auch das „lautmalerische Geplapper von Kindern“203. Dadurch lassen die Dadaisten eine neue, „authentische” Sprache entstehen, welche ganz nach der Utopie des Lord Chandos „eine natürliche Verwandtschaft mit den Dingen haben und ihr Wesen ausdrücken sollte […].”204
Laut Blumenberg sind der Laie und das Kind generell als Figuren der Unmittelbarkeit zu betrachten205. Während sich der Laie z.B. durch Analphabetismus auszeichnet, geht das Kind eine Verbindung ohne jegliche Worte mit den Gegenständen ein. Von dieser Unmittelbarkeit träumte noch Lord Chandos, durch die Vorstellung, dass man eines Tages dazu imstande wäre „mit dem Herzen denken“206. Fernando Pessoa versucht diesem „undichtenden“ Aspekt in seiner Dichtung hervorzuheben:
„Ich glaube an die Welt wie an ein Tausendschönchen, / […] Aber ich denke nicht nach über sie, / Denn denken heisst nicht-verstehen… / Die Welt wurde nicht geschaffen, damit wir über sie nachdenken / (Denken heisst augenkrank sein), / Sondern damit wir sie ansehen und im Einklang sind mit ihr.“207
Die Sprache ist demzufolge ein selbstauferlegtes Hindernis, das es zu überwinden gilt. Die pragmatischen Methoden der avantgardistischen Liquidierung der Sprache verkörpern damit den Versuch, diese erlernte (und ererbte) Mittelbarkeit schrittweise wieder abzuschaffen: „Eine Lehrzeit des Verlernens“208.
Der Wunsch nach Unmittelbarkeit kristallisiert sich ebenfalls bei Marinetti heraus, der aus denselben Motiven im Jahr 1921 den sogenannten Taktilismus begründet: „Der Taktilist wird mit lauter Stimme verschiedene Empfindungen ausdrücken, die er durch die Reise seiner Hände empfängt. Seine Wiedergabe wird wortlos sein, d.h. befreit von jeglichem Rhythmus, Syntax und Prosodie, möglichst synthetisch, wenig menschlich.“209 Diese Vision führte den Begriff Ästhetik wieder auf seine Ursprungsbedeutung der (sinnlichen) Wahrnehmung zurück, indem „die Wahrnehmung der Materialien und Energien des Lebens durch den Tastsinn [erfahren werden].“210 Unmittelbar ist der Taktilismus ebenfalls, weil man durch die Berührung mit dem Gegenstand selbst verschmelze211.
Ball konstatiert dem Ziel der Unmittelbarkeit folgend: „Ich lese Verse, die nichts weniger vorhaben, als: auf die Sprache zu verzichten […].“212 Gleichzeitig soll die Sprache als autonomes Gebilde hervorgehoben werden. Auf diese Dialektik wird noch im Unterkapitel 5.2.3.3 eingegangen.
4.2.6. Liquidierung im Surrealismus
„Was weiss der Mensch eigentlich von sich selbst? Ja, vermöchte er auch nur sich einmal vollständig, hingelegt wie in einen erleuchteten Glaskasten, zu percipieren?“213
Friedrich Nietzsche
Die methodische Förderung der authentischen Freiheit der Sprache bestand bei den Futuristen und Dadaisten in der Liquidierung konventioneller Muster und Bezüge der Sprache und der gleichzeitigen Innovation von Worten. Dahingegen wird beim Surrealismus ein konventionelles Sprachverständnis restituiert. Sies attestiert den Worten wieder eine authentische Abbildung- Funktion zurück. Die Quelle ist fortan nicht mehr die sprachlose Natur, sondern der menschliche Geist selbst.
Den Zugang zum „Verborgenen“ sehen die Surrealisten dabei nicht in der mystischen Natur, sondern in der Auflösung der Grenze zwischen Traum und Wachzustand durch die literarische Adaption des psychotherapeutischen Verfahrens der É criture automatique, durch welches „ein Bereich der geistigen Welt wieder ans Licht gehoben […]“214 werden kann. Im Gründungsmanifest von 1924 konfrontiert André Breton die damalige Herrschaft der Logik 215 mit der surrealen Sphäre des Traums, in welcher das wilde Unterbewusstsein eine eigene Wirklichkeit konstituiert. Aus dieser Sphäre an der Grenze des Wachzustandes soll in einem Akt der Trance gleichsam destilliert werden: „Wenn die Tiefe unseres Geistes seltsame Kräfte bergen, die imstande sind, die der Oberfläche zu mehren oder gar zu besiegen, so haben wir allen Grund, sie einzufangen […].“216
Die Ekstase und der Schlaf, welche von den Futuristen noch als Sinnbild schmählicher Trägheit der Literatur vehement verworfen wurden217, versucht der Surrealismus erneut fruchtbar zu machen bzw. als primäre Quelle authentischer Gedanken zu etablieren.
4.2.6.1 Sprache in Trance
Die Bergung der innersten Gedanken, welche durch den Trance-Zustand erreicht werden soll, gründet auf dem Verständnis, dass die diffusen Denkstrukturen des Unbewussten bereits nahe verwandt mit der sprachlicher Natur sind und sich damit grösstenteils in Worte fassen lassen. In diesem Sinne wird die Sprache als zwingend notwendiges Werkzeug autorisiert um das „Denken“ des Traumes (welches nahe an die utopische Vorstellung des „denkenden Herzens“218 herankommt) da festhalten zu können.
Speziell im Zustand der sowohl narkotischen als auch luziden Extase (als Schnittstelle zwischen Traum und Wachzustand), der durchaus mit Halluzination und Kontemplation vergleichbar ist, dient der dabei zugängliche Traum als Katalysator für die Herauslösung freier Assoziationen bzw. spontaner Kreativität, die eben nicht derselben Logik des Wachzustandes unterworfen sind. Der Dichter ist also nicht mehr das Sprachrohr der Götter oder der Dolmetscher der Natur, sondern wird zum Aufzeichner seines quecksilberhaften Unterbewusstseins: zu einem Seismographen der Seele.
Einem geistesverwandten Vertreter in der Malerei, Wassily Kandinsky, strebte ebenfalls anstelle der Darstellung der äusseren Welt, diejenige der inneren Welt vor, worin er die oberste Aufgabe der Kunst sah219.
Im Zuge dessen wird der dichterische Drang der sprachlichen Wohlgeformtheit apodiktisch verworfen, welche nach ebenjener vollendeten Form strebt, die der Freiheit der unterbewussten Wahrnehmungen in fataler Weise abtrünnig ist. Der Surrealist sei beim Verfahren „voller Verachtung [gewesen] für das, was literarisch dabei herauskommen würde.“220 Demselben Verständnis des unkommerziellen Potenzials begegnet man noch bis in die Gegenwart, wie beispielsweise in Rocko Schamonis «Sternstunden der Bedeutungslosigkeit» (2007):
„Heute wieder nur fünf Stunden geschlafen. Wenn ich sehr früh aufwache, versuche ich die Zeit mit Gedichten totzuschlagen, manchmal gelingt mir dann etwas, manchmal wache ich mit sonderbaren Bildern auf, komische Psychovisionen, fremden Worten, Fetzen aus einer anderen Welt, aus neuen, unbekannten Sprachen, die Mauer ist ganz dünn und ich kann etwas von drüben klauen: […]. […] Das Hirn entlädt sich und wirft Schemen an die Küste der Wachen. Ich klaube sie auf. Strandgut der Psyche, das sich auf keinem Markt der Erde verkaufen lässt.“221
Auch hier werden Worte als Fragmente einer amorphen, ozeanischen Masse inszeniert, welche gleichsam durch die „dünne Mauer“ diffundieren bzw. ergattert werden können. Seine hauptsächliche Quelle ebenfalls im Traum begreifend, so habe ein Dichter in Saint-Pol-Roux ein Schild vor seine Haustür gehängt, auf welchem stand: «Der Dichter arbeitet.»222:
„Damit meinte er nicht, man solle ihn nicht beim Nichtstun stören, sondern beim Träumen. Denn nicht der «wache», seinen Stoff bewusst organisierende und beherrschende Autor sei der richtige Dichter, sondern der träumende. Der, der gleichsam gedichtet wird.“223
Die formale Notationsstruktur charakterisiert sich dabei durch die Loslösung der Idee einer korrekten Orthografie, Grammatik, Syntax, Interpunktion und eindeutige Kohärenz, im Allgemeinen also von der ästhetischen Maxime der sprachlichen Wohlgeformtheit, zu Gunsten der kreativen Authentizität. Das Aufgeschriebene wirkt oft bruchstückhaft, und fördert somit die sprachliche Sensibilität für das Fragmentarische, worauf im Kapitel 5.1 noch genauer eingegangen wird.
4.2.6.2 Eruptive Worte
„Laß die Moleküle rasen, […] heilig halte die Ekstasen.“224 Christian Morgenstern
Das Ziel der Unmittelbarkeit und der daraus resultierenden authentischen Begriffe wird also durch die Annäherung an diejenige Sphäre zu erreichen versucht, deren Zugriff dem Verstand im Wachzustand verwehrt bleibt. Dieser Zustand geht oft einher mit einem kreativen „ Flow “, bei welchem die (emotionalen) Gedanken eruptiv zum Vorschein kommen und die betreffende Person gleichsam über fluten. Breton selbst zitiert dabei ein solch ekstatisches Erlebnis:
„Es war, als sei eine Ader in mir aufgesprungen, ein Wort folgt dem anderen, die Worte ordnen sich im Zusammenhang, bilden sich zu Situationen; Szene häuft sich auf Szene, […] Gedanken kommen so plötzlich über mich und strömen weiterhin so reichlich, daß ich eine Menge Nebensächlichkeiten verliere […].“225
Auffällig ist auch hier die Metaphorik der Verflüssigung („Ader“, „strömen“) im Bezug auf Kreativität und Inspiration. Die Anschwellung dieser Wortflut im fiebrigen Wahn stellt dabei das Gegenstück zum unstillbaren Durst und der Ebbe sprachlicher Ausdrucksmöglichkeiten dar, an welchen Lord Chandos im Brief Hofmannsthals erlitt.
4.2.6.3 Der flüssige Agent
„Verflüssigungen sind Allegorien der Aneignung und Umformung ästhetischen Materials.“226
Christoph Zeller
Um an die Schnittstelle zwischen flüchtigem Traum und fester Wirklichkeit, an den Horizont des Verstandes zu gelangen, muss sich der Schreibende vorübergehend selber zum Medium verflüssigen. In seiner Aufgabe der Vermittlung gleicht er damit einem Agenten in seinem etymologischen Ursprung: „ ›Agens‹ ist die treibende Kraft, das wirkende, handelnde Prinzip […]. Agenten sind demnach Medien, der lateinischen Bedeutung des Wortes nach ›Dazwischen- Stehende‹, die Botschaften übermitteln, Botschaften empfangen […].“227 In dieser Eigenschaft gleicht der Agent wiederum dem Übersetzer bzw. dem Dolmetscher (vgl. Abs. 2.3.3).
Sein mediales Wesen untersteht dabei den in Abs. 2.1 erwähnten Maximen, dass er teilweise mit beiden Sphären übereinstimmt, und gleichzeitig nicht identisch sein darf. Im religiösen Kontext wird dies durch Jesus veranschaulicht, welcher ein absolutes Medium darstellt, indem er gleichzeitig sowohl das Göttliche, als Auch das Menschliche in sich vereint: „[...] soweit er Mensch ist, soweit ist er Mittler; soweit er das Wort ist, steht er nicht nur in der Mitte, denn er ist Gott gleich, und Gott bei Gott und zugleich der einige Gott.“228 Im ekstatischen Zustand der Écriture automatique gelingt es ihm jedoch (kurzfristig), Traum und Realität zu verbinden. Dadurch offenbart er seine „Wandlungsfähigkeit, seine Anpassung an das jeweilige Medium, mit dem er kommuniziert und über das er sich schließlich selbst zum Medium macht, sich verflüssigt.“229 Deshalb scheint es sinnlos bei der Notation pedantisch auf Korrektheit und Ästhetik des formalen Ausdrucks zu achten, weil sie Inhibitoren des Verfahrens darstellen, bei welchem es hauptsächlich darum geht den Inhalt der rhapsodisch vorbeifliessenden Emotionen zu kanalisieren. Das Ergebnis ist deshalb oft fragmentaler Natur (vgl. Abs. 4.2.6.1).
Der revolutionäre Ansatz besteht letztlich in Bretons Utopie einer nachhaltigen Verbindung dieser beiden Sphären: „Ich glaube an die künftige Auflösung dieser scheinbar so gegensätzlichen Zustände von Traum und Wirklichkeit in einer Art absoluter Realität, wenn man so sagen kann: Surrealität.“230
4.2.6.4 Rausch und Rauschen
Die Ekstase als sprachliche Grenzerfahrung verkörpert im Surrealismus einen Rauschzustand, in welchem der Dichter als verflüssigtes Medium direkt mit den ebenso flüssigen, emotionalen Denkstrukturen seines Unterbewusstseins verbunden ist. Rauschzustände signalisieren generell eine Verwandlung, und solche Verwandlungen werden eben durch Flüssiges angezeigt231. Ein solcher Rauschzustand äussert sich ebenfalls in der kontemplativen Dimension der Performanz dadaistischer Lautgedichte (vgl. Abs. 4.2.3.2), wie auch im Wunsch des Lord Chandos, er möge doch selbst zu einem Gefäss werden, dass bis zum Rand mit dem „göttlichen Gefühl“ gefüllt wird (vgl. Abs. 3.3.4), oder bis zurück zu Büchners Lenz, welcher sich durch das All hinein wühlt (vgl. Abs. 2.3.4). In allen Beispielen sind die Protagonisten (noch) nicht dazu Imstande, sich während dieser Ektase durch konventionelle Begriffe auszudrücken. Dass diese emotionalen Zustände von einer fiebrigen Intensität begleitet werden, äussert sich ebenfalls in den darauffolgenden, teils sehr körperlastigen Erschöpfungszuständen.
In diesem surrealistischen Schwebezustand, in welchem Traum und Wirklichkeit miteinander verschränkt sind, ist die Sprache noch von einer ziemlich fragmentalen, vergänglichen und ungeordneten Natur. Diese Deformationen sind für die inhaltliche Diffusität verantwortlich, und führen vom Rauschzustand unmittelbar zum gleichnamigen Phänomen: „Im Rauschen werden Texte auf verschiedene Weise semantisch undurchsichtig.“232
Das Rauschen an sich steht deshalb „als unstrukturiertes Geräusch steht es für den Gegensatz zur Sprache, Struktur und Ordnung, und gilt damit auch als Synonym für Chaos, Unordnung oder gar Störung.“233 Wo jedoch noch die Romantiker im Rauschen der Bäume eine Nachricht vermuteten (vgl. Abs. 2.3.2), bemühen sich beispielsweise die Dadaisten selber ein Rauschen in Lautformen zu kreieren, d.h. selber zu rauschen, oder in der konkreten Poesie (welche im folgenden Abschnitt thematisiert wird) ein Rauschen durch ein schriftliches Phänomen entstehen lässt, und damit ein eigenes Phänomen, ein Stück Realität erschafft.
4.2.7 Konkrete Poesie
„Der Dichter soll schreiben statt beschreiben.“234 Christina Weiss
Eugen Gomringer, der Gründervater der konkreten Poesie, hat folgendes Verständnis gegenüber den Worten235:
„ich sage: worte sind schatten. denn worte, die das schweigen brechen, sind gegenstände. worte sind druckerschwärze, worte sind wellen, worte sind projektionen, worte sind taten, worte sind gestalten, worte haben formen. man sagt auch: worte haben gewicht.“236
Die Sprache und das Wort werden in der konkreten Poesie expliziter denn je nicht mehr als Medium, sondern selber als Phänomen inszeniert werden. Dadurch nimmt die Materialität der Schrift (als notwendige Bedingung der Existenz) ein hegemoniale Position einnimmt. Durch dieses charakteristische Motiv sucht die konkrete Kunst „den letzten Schritt zur Befreiung der Kunst von ihr fremder Wirklichkeit.“237 In motivischen Belangen finden sich dennoch Parallelen zu ihren Vorgängern, wie z.B. dass die konkrete Poesie „[…] die schönheit des materials und die abenteuerlichkeit des zeichens [verherrlicht].“238
Obwohl sie paradoxerweise historisch aus der Abstraktion hervorging, ist sie ihrer Philosophie nach strikt davon zu trennen239, denn „während die abstrakte Kunst […] noch vom Gegenständlichen ausgeht […], hat sich die konkrete Kunst davon befreit.“240 Das Ziel ist folglich nicht mehr die Sprache der Natur festzuhalten, sondern die Natur der Sprache selbst zu Wort kommen zu lassen: „Erst im Wort wird die eigentliche Wirklichkeit gewonnen; das Wort verwandelt nicht nur die Welt, sondern bringt sie erst in neuer, eigentlicher Gestalt hervor.“241 Dadurch lehnt es die konkrete Poesie vehement ab, als „ventil für allerlei gefühle und gedanken“242 zu fungieren: „an stelle des mystikers und des metaphysischen schwadroneurs ist der a-theistische, also der rationale und methodische autor getreten, dessen augenmerk der sprache, den materialien gilt […].“243 Die Sprache soll dadurch endgültig zum experimentellen und damit lebhaften Gestaltungsgebiet werden: „zweck der neuen dichtung ist, der dichtung wieder eine organische funktion in der gesellschaft zu geben […].“244
4.2.7.1 Eine eigene Realität
„daß wir lernen, auf worte zu achten, worte zu sehen, worte zu hören, daß wir freude haben an worten, daß wir heiter werden mit worten, dies ist des dichters anteil an den tätigkeiten der menschen.“245 Eugen Gomringer
Eine Problematik dabei besteht jedoch in der Interpretation: Ein roter Akzent auf einer weissen Leinwand kann z.B. (abstrakt) als Darstellung eines Sonnenunterganges interpretiert werden, oder (konkret) als roter Akzent.246 Sich diesbezüglich konsequent auf das Kriterium der Ikonizität (Peirce) zu berufen, scheint jedoch ebenso Problematisch, weil sich viele konkrete Gedichte dieses Prinzip ansatzweise zunutze machen. Dies soll anhand von mehreren Wind-Gedichten veranschaulicht werden. Das erste stammt von Gomringer selbst (Abb. 7).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 7 Eugen Gomringer: wind (1953)
In einem an Gomringer adressierten Brief einer Primarschul-Lehrerein, wird gefragt, ob die Ansicht richtig sei, dass sich darin ein umgekehrter Wetterhahn vermuten lässt247. Der Autor selbst antwortet darauf:
„[…] ich habe selber nie gemerkt, dass sich aus wind, umgekehrt gesehen, ein wetterhahn ergibt (was tatsächlich ja stimmt). das ist also zufall - der für mich umso schöner ist, weil das ganze gebilde ja kalkuliert ist. […] da sehen die kleinen leser eben mehr. und so war es ja immer gemeint vom autor: es sind gebilde, die assoziationen wecken sollen.“248
Mit diesen „Gebilden“ wird im konkreten Verständnis nachdrücklich nicht auf weltliche Dinge, i.e. Wind, referiert, sondern das Gedicht ist Wind, f ü hrt hier eine Windbewegung vor 249. Das Lexem „Wind“ entfaltet zudem in dieser syntaktischen Isolation eine Vielzahl von Bedeutungsmöglichkeiten, welche innerhalb eines Satzverbandes wahrscheinlich getilgt worden wären250 (dieser Aspekt gilt spezifisch für die Reduktion; vgl. Abs. 5.1). Obwohl das Gedicht natürlich Assoziationen mit realweltlichen Begebenheiten weckt und wecken soll, stellt es diese aber nicht dar, sondern ist durch seine meditative Kraft grundsätzlich eine Aufforderung 251. Diese Aufforderung entwächst besonders auch dem im Allgemeinen unverbindlichen Charakter, welche den Kontext nur bedingt festlegt, und damit die Sinngebung „ins Bewußtsein des Lesers verlegt.“252 Dies führt dazu, dass so manche konkrete Texte zu regelrechen „Meditations- vorlagen“253 werden.
Am prägnantesten wird bezüglich der Konstellation (vgl. Abs. 4.2.7.2) formuliert: „mit der konstellation wird etwas in die welt gesetzt. sie ist eine realität an sich und kein gedicht über…“254 Dieselbe Meinung findet sich auch bei Paul Klee: „Kunst gibt nichts Sichtbares wieder, Kunst macht sichtbar.“255
Dies gilt ebenfalls für Claus Bremers Gedicht, welches durch seine typografisch-spielerische Zerstreuung (in alle Windrichtungen) beim das Lesen eine Wind bewegung vorführt (Abb. 8).
Dadurch, dass „Wind“ ein populäres Motiv hier ist (vgl. Abb. 9 und 10), deutet sich die Vermutung an, dass die konkrete Poesie eine hohe Affinität zum konventionell Unsagbaren zu haben scheint, welches immer noch zwangsweise dem Abbildungsgedanken verpflichtet ist:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 8 Claus Bremer Ü ber sich hinaus / lieben / sich fallen lassen / in den Aufwind
„Der Raum des >Unsagbaren< kann damit aber auch zu einem verheißungsvollen Zielpunkt für ein anderes, neues Sprechen werden, welches den paradoxen Anspruch, das Unsagbare dennoch sagen zu wollen, zu einem utopisch poetologischen Programm erhebt […].“256
Dieser Verdacht erhärtet sich durch eines der berühmtesten konkreten Werke Gomringers Schweigen (Abb. 11). Dieses würde eben in der Analogie zur mimetischen Kunst eine „illegale Grenzüberschreitung“257 verkörpern, generiert aber aus der sprach- autonomen Perspektive (besonders beim Vortragen des Gedichtes) ein Schweigen sui generis. Gerade darin wird das Wesen des konkreten Poeten deutlich: „der dichter ist einer, der ein schweigen bricht, um ein neues schweigen zu beschwören. […] ein wort sagen, ein schweigen brechen - der dichter beginnt.“258 Das Unsagbare ist wie das Schweigen sozusagen der „blinde Fleck“259 der Literatur, was im (optischen) Bezug auf Gomringers Gedicht äusserst treffen ist. Durch die typografische Aussparung260 wird uns die Absenz der Sprache sprichwörtlich „weiss“ gemacht: „[D]as Unsagbare, das Weiße zwischen den Worten […] man schreibt darum herum. Man umstellt es.“261 die gebrochene Kontinuität wird die weisse,Durchkonstitutive Fläche zu einer ostentativen Leerstelle, wobei in eben jenem Leerraum das stattfindet, was verhandelt wird.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 11 Ivo Vroom: winden (1971)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 9 Josef Hiršal und Grögerová Bohumila: vitr (1965).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 10 Eugen Gomringer: Schweigen (1953).
Weil die Worte selber die Gegenstände (Phänomene) sind, welche sie verkörpern, sieht beispielsweise Heinz Gappmayr darin erneut die Möglichkeit einer Sprache, die „das Gedachte mit dem Sein der Dinge in eins [setzt]“262. Dies wird bereits bei Apollinaires Kaligrammen (1918)263 erprobt, wie z.B. bei Il pleut 264, bei welchem sich Inhalt und Form harmonisch ergänzen und erweitern. Dass jedoch der Inhalt das Dargestellte subversiv unterlaufen kann, wird z.B. bei Claus Bremers Piktogramm Die Sitzende (Abb. 12) deutlich, wo der Text keine klare Aussage hat: „[Es ist] Naivität zu glauben, die Frau wird gelesen. Der Blickfang ist alles. […] Nichts von Gleichsetzung von Form und Inhalt.“265 Eine weitere Möglichkeit, um die natür- liche Arbitrarität der Sprache methodisch zu inszenieren liegt im konkreten poetischen Konzept der Konstellation.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 12 Bremer, Claus: Di e Si tz en de (1983)
4.2.7.2 Himmlische Worte: Die Konstellation
„[…] die konstellation ist das letztmögliche absolute gedicht.“266 Eugen Gomringer
Der Begriff der Konstellation, auf welchen sich Gomringer bezieht 267 , hat seinen Ursprung im zusammenhängenden Satz Mallarmés aus Un Coup de d é s (1897): „Nichts / wurde zur Wirklichkeit / als zufällige Wirklichkeit / ausser / vielleicht / ein Sternbild [constellation]“268. Durch die Konstellation wird verdeutlicht, dass natürlichen Begebenheiten (Sternen) eine sinnvolle Ordnung oktroyiert wird, welche ihre natürliche Unverbundenheit hinfällig werden lässt. In Rilkes Sonette an Orpheus (1923) wird dieser arbiträre Charakter der Bezeichnung für ein Sternbild hinterfragt: „Heißt kein Sternbild "Reiter"? / […] Ist nicht so, gejagt und dann gebändigt, / diese sehnige Natur des Seins?“269 Dadurch entsteht erneut die Anschuldigung, das Worte die Natur zu „bändigen“ versuchen, indem sie sie auf einen einzigen beliebigen und der Sache fremden Begriff reduzieren und dadurch verfälschen.
Gomringer restituiert den Begriff in der konkreten Dichtung, indem er das Konzept auf die Materialität der autonomen Sprache anwendet. Dabei werden Worte oder Lettern auf einer Fläche so verteilt, dass sie (gleich den Sternen) keine offizielle Verbindung eingehen und damit selbst eine beliebig chaotische Wirklichkeit bilden: „mit der konstellation wird etwas in die welt gesetzt. sie ist eine realität an sich und kein gedicht über…“270 Durch die Verteilung der Worte respektive die Liquidierung der syntagmatischen Beziehungen entfalten die Textbilder „optische dimension von text, die gewöhnlich übersehen werden.“271
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 13 Eugen Gomringer: baum kind hund haus (1953)
Franz Mon erläutert bezüglich der Darstellung einen Zusammenhang mit der Notation chemischer Formeln272, wobei in der konkreten Poesie der Dichter als „literarischer Ingenieur“273 mit Worten eine eigene synthetische Natur erschafft (Abb. 13). In dieser spezifischen Konstellation deutet sich durch die Wiederholung der wenigen Begriffe und den formelhaften Algorithmus ein minimales Permutationsverfahren an, was den ingenieurhaften Dichter bestätigt: „man erkennt, daß die kombinatorik ein hilfsmittel der konstellation ist: ein direkterer einfluß auf die dichtung war der mathematik nie möglich.“274 In diesem Sinne können die Bemühungen der Oulipoten, die Allianz der Mathematik und der Poesie zu erneuern275, als Erweiterung dieses mathematischen Gedankens angesehen werden. Ihre Methodik beschränkt sich auf die Festlegung bestimmter Axiome (Contraintes), welche als Restriktionen dem Autor einen kreativen Rahmen auferlegen, und damit vor eine zu lösende Aufgabe stellen, welche gleichermassen seine mathematisches als auch seine sprachliche Kompetenzen herausfordern.
Die Anmut der Konstellation besteht jedoch in ihrer Schlichtheit, durch welche (zusätzlich zu ihrer Unverbundenheit) die Individualität der verwendeten Begriffe hervorgehoben wird.
Im historischen Verlauf über die verschiedenen Strömungen hinweg, wird die Sprache und besonders die Schrift durch experimentelle Verfahren von ihrer konventionellen Form und Funktion abstrahiert. Durch ihre kreativen Ansätze der Abstraktion, deren (theoretische) Beweggründe in den Manifesten fixiert worden sind, etablieren die literarischen Avantgarden die Sprache als ein autonomes, ästhetisches System.
5. PRAKTISCHE LIQUIDIERUNG DER SPRACHE
„Die heutige Poesie konzentriert Sprache auf das Wort,
auf die buchstäbliche Existenz des Wortes.“276
Franz Mon
Bislang wurden hauptsächlich die verschiedenen theoretischen Motive und für die Liquidierung bei unterschiedlichen literarischen Avantgarden erläutert. In den folgenden Kapiteln wird aufgezeigt, wie sich diese Beweggründe in praktischen kreativen Methoden niederschlagen, die sich u.a. spezifisch in der Reduktion, der Zergliederung, der Atomisierung und der Auslöschung der Sprache, der Schrift und der Buchstaben äussern.
5.1 Das Fragment und die Reduktion
Was Mallarmé und Apollinaire durch ihre Arbeiten, mit verschiedener Absicht, bezweckten, war es „durch komplizierte typographische anordnungen, das einzelne wort aus der eingeebneten syntax zu lösen und ihm - oder der einzelnen letter - das eigengewicht und die individualität zurückzugeben.“277 Die Forderung bestand darin, dass das Wort aus dem Schatten der Satzverbindung hervortreten sollte, bei welchem jenes in „verbindungen mit anderen worten seinen absoluten charakter [verliert]. Das wollen wir in der dichtung vermeiden […].“278
Die konkrete Dichtung versucht dieselbe Individualität von einer syntaktischen und aussagengeladenen Verbindung zu lösen, indem sie sich den Grundbausteinen, d.h. dem Wort, den Buchstaben und sogar der schwarzen wie auch der weissen Fläche, widmet. Dadurch fördert diese Art der Poesie eine „ästhetische Sensibilität“279 für das Konzentrierte, Verdichtete und Fragmentarische.
Im Gegensatz zum Dadaismus, der die Worte in ihrer Bedeutung abstrahiert, versuchen die konkreten Dichter den Worten ihr Eigengewicht, ihre Individualität und Schönheit zurückzugeben, die sich erst in der Reduktion bzw. paradoxerweise der kontext-unabhängigen Isolation zu entfalten vermag: „Ja gerade der fragmentarische Charakter des modernen Gedichts konnte sogar die Frage nach der Schönheit dringlicher werden lassen, als die selige Harmonie des alten (falls es die überhaupt gegeben haben sollte).“280 Diesem Credo folg auch Wassily Kandinsky in der Malerei: „Bei diesem Reduzieren des ‚Künstlerischen’ auf das Minimum klingt die Seele des Gegenstandes am stärksten heraus […].“281
In der Dichtung bedeutet Reduktion primär die Störung des gewohnten Schriftablaufs, um sich den „beteiligten Elemente[n] neu zu versichern, um sie neu und vollständiger erfahren zu können.“282
Speziell im Surrealismus erhält das verschliffene Fragment insofern einen Sonderstatus, als dass sich in ihm bestimmte Emotionen und Denkstrukturen verdichten: „Da es aber nun einmal ein menschliches Gebilde ist, spiegelt es auch den Menschen, dem es sein Dasein verdankt.“283 Gerade in seinem ramponierten, zerrütteten Wesen und in der Entrücktheit der alltäglichen Sprache liegt seine Besonderheit: „[D]ort gewinnt von fernher das Fragment den Glanz des Richtigen, wird das fast zerbrechende Gedicht in einer zerrüttet-künstlichen Sprache zum Gleichnis für etwas, das zu beschreiben das »natürliche« Wort nicht hinreicht […].“284 In seiner Abgeschiedenheit lädt es gleichsam zu einer meditativen Askese über die eigene Materialität ein, was symbolisch „für das Geheimnis menschlichen Existierens überhaupt“285 angesehen werden kann.
5.1.1 Eremitische Worte
„[E]in Gedicht zu schreiben / das nur bestünde / aus dem Wort / Mund“286 Sascha Garzetti
Durch den absoluten und souveränen Charakter eines einzelnen oder allenfalls weniger Worte auf einer Fläche entstehen ostentative Minimal-Kompositionen, welche eine ganz neue Erfahrung mit Poesie eröffnen, indem diese im wahrsten Sinne „beim Wort genommen“ werden. Speziell die konkrete Dichtung gründet auf Konzentration und Einfachheit287. Dieser Wesenszug ist besonders den Konstellationen inhärent (vgl. Abs. 4.2.7.2).
Im Prozess der Liquidierung stellt die Reduzierung auf Worte nur ein erster Zwischenschritt dar. Das Wort zerfällt des Weiteren in „Silben, und Buchstaben bzw. kleinste artikulatorische Einheiten, es kann auf den visuellen Gehalt seiner Elementarteilchen oder ihren phonetischen Anteil reduziert werden, es tendiert zum Lettern- oder Klang (Geräusch)-Text.“288 Die Zersetzung schreitet folglich kontinuierlich von der Aufsplitterung der Worte in Textmoleküle voran bis zur Atomisierung in Buchstaben und Satzzeichen.
5.1.2 Teile und wieder Teile
Eine eigenartige Zwischenstufe, welche eine fragmentarischen Zugang zum Wort hat, findet sich in der sogenannten Subprose Poetry. Eines der ersten Werke stellt das Buch Sweethearts (1967) von Emmet Williams dar, in welchem der Inhalt allein in der fragmentarischen Auslegung des Wortes „sweethearts“ besteht (Abb. 14). Dieses Verfahren stellt ein exemplarisches Gedicht dar, bei welchem deutlich wird, dass Buchstaben als Atome der Sprache angesehen werden können. Damit eröffnet die Erfahrung Hofmannstahls, dass alles in „Teile, [und] die Teile wieder in Teile“289 zerfällt, in der Subprose Poetry ein neues kreatives Potenzial der Sprache, indem durch ein (fragmentales) anagrammatisches Verfahren neue Worte aus den Worten selbst gewonnen werden. Vorgänger dieser Methodik sind die Oulipoten der sechziger Jahre, deren Texte jeweils eigens verfassten Axiomen unterworfen sind (vgl. Abs. 4.2.7.2). Die Fragmentierung eröffnet damit neue Bedeutungszusammenhänge, welche dem Wort selbst inhärent sind, und vom Autor (gleich dem Bildhauer) lediglich noch herausgearbeitet werden müssen. Damit wird das romantische Konzept der Chiffre tangiert, nach dem die Sprache bereits latent in der Natur vorhanden sei: Die „Natur“ ist hier die Sprache selbst, und die destillierte Nachricht besteht aus der potenziellen Kombination deren Bestandteile (Buchstaben).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 14 Emmet Williams: ohne Titel (1967)
5.1.3 Eremitische Buchstaben
„in den buchstaben wird die sprache zum zweiten mal erfunden […].“290
Franz Mon
Die Tendenz der Befreiung aus dem Schrift-Verbund zeichnet sich bereits bei den Futuristen ab, indem sie die „Befreiung des Buchstaben aus der Knechtschaft des Wortes“291 fordern. Dazu sind drastische Massnahmen notwendig, welche „die Materialität der Sprache zertrümmern und das einzelne Zeichen aus seinen Strukturellen Einebnungen herausschlagen, um ihm seine Autonomie […] zurück zu geben […].“292 Einer der konsequentesten Vertreter diesbezüglich ist Hansjörg Mayer, der in unzähligen Typogrammen die formale Ästhetik der Buchstaben adelt (Abb. 15 und 16).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 15 Hansjörg Mayer: ohne Titel [k](1967)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 16 Hansjörg Mayer: ohne Titel [Z] (1967)
Der Buchstabe ist hierbei jeweils nicht nur ohne Bindung an das Wort, d.h. ohne semantische Verpflichtung293, sondern veranschaulicht durch seine Independenz besonders das oberflächliche, ästhetische Potenzial. Dadurch verschwindet die Sprache unter der Schrift294.
5.1.4 Zeichenalchemie
Eine andere avantgardistische Strömung, welche die Individualität des Buchstabens zu ihrem Programm erkoren hat, ist der 1945 von Isidore Isou gegründete Lettrismus. Dieser zielt in erster Linie auf die Materialität der Grapheme ab295, zerlegte und kombinierte die Buchstaben konsequent noch in weitere Bestandteile. Dabei verschwimmen die klaren Konturen, durch welche die Buchstaben noch als solche identifizierbar waren. Ähnlich dem Dadaismus, welcher aus der konventionellen Perspektive Pseudo- Worte kreierte, entwerfen die Lettristen Pseudo- Buchstaben und - Zeichen (Abb. 17 und 18). In dieser Art der Reduktion liegt wiederum ein neues Spektrum der literarischen Freiheit, worauf der kommentierende Titel von bei Dotremonts Textbild anspielt: „trop peu, c’est aussi un excès“ (Abb. 19).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 16 Robert Sabatier: Hyperographie (1965).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 17 Maurice Lemaître: Plus loin que Mondrian (1973).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 19 Christian Dotremont: trop peu, c’est aussi un excès (1976)
Der in den letzten vier Kapiteln aufgezeigte kontinuierliche Prozess der Liquidierung bzw. der leidenschaftlichen Zerlegung der Schrift in ihre Bestandteile führt schrittweise zu einer Kultivierung der Sensibilität gegenüber dem oberflächlichen, formalen und ästhetischen Wesen der Sprache. Neben diesen zersetzenden Methoden, welche sich stetig weiter auf spezifische Bestandteile der Schrift fokussieren, gab es auch technische Liquidierungsverfahren, welche den Text oder die Worte als Ganzes bis an die Grenzen der Erkennbarkeit aufzulösen vermochten. Diese werden nun im Einzelnen aufgezeigt.
5.2 Allgemeine formale Liquidierungsansätze
Wie für Hofmannsthal das Verflüssigen der Worte noch fatale Folgen hatte, machte sich die avantgardistische Literatur das Prinzip immer wieder zur Methode des Experimentes. Das Flüssige wird diesbezüglich nicht mehr als Bedrohung angesehen, sondern stellt laut Gomringer für Sprache einen experimentellen „Reinigungsprozess“296 dar.
Die theoretischen Ansätze der jeweiligen literarischen, avantgardistischen Strömung wurden in den verschiedenen Kapiteln aufgezeigt und partiell (wie im vorigen Kapitel) schon mit expliziten Werken, welche die Aspekte durch formale Methoden zum Ausdruck bringen, unterlegt. Im folgenden Abschnitt werden formale literarische Methoden der Liquidierung aufgezeigt, welche nicht einem spezifischen -Ismus inhärent sind, sondern bei mehreren Strömungen zu beobachten sind. Diese konvergieren unter dem gemeinsamen Credo der Freiheit der Sprache und der Experimentierfreudigkeit sämtlicher (literarischer) Avantgarden. Die anarchistischen Ansätze schlagen sich in der teils streng technischen Seite der formalen Liquidierung nieder. Eine solch stereotypische Beobachtung liegt beispielsweise in der bereits erläuterten Tendenz der Reduktion (vgl. Abs. 5.1), welche in vielen Werken und bei verschiedensten avantgardistischen Strömungen vorkommt. Weitere Tendenzen, in welchen sich die Prinzipien der Liquidierung kanalisieren, finden sich in der Auseinandersetzung mit Syntax und Fl ä che, Orthografie und Interpunktion und der Diffusit ä t, die sich in der Erkennbarkeit der einzelnen Zeichen und Worte äussert.
5.2.1 Die Architektur des Textes: Syntax und Fläche
Ein Merkmal der avantgardistischen, autonomen Poesie äussert sich im stereotypischen Verzicht auf Reimformen. Diese zählt eindeutig zu den strengen Restriktionen, indem sie der Freiheit des einzelnen Wortes besonders klanglich eine Verbindung zu anderen Begriffen auferlegt. In keinem der vorliegenden Manifeste findet sich eine explizite Klausel dieser Formalen Richtlinie. Diese konsequente Verwerfung scheint implizit aber umso deutlicher durch die allgemeinen Forderung nach Autonomie der Sprache bzw. des Wortes festgelegt worden zu sein.
Des Weiteren wird etwas, das schon bei Mallarmé erkennbar wurde, bei den Futuristen zum Programm: Die Syntax soll dadurch zerstört werden, dass die Substantive „aufs Geratewohl“ auf der Fläche verteilt werden sollen, „so wie sie entstehen.“297 Damit wird die Architektur des Textes polemisch dekonstruiert.
Auch bei Apollinaire ist die Einbringung der spatialen Komponente deutlich, die aber nicht aus den Motiven der Zerstörung, sondern der Vereinfachung der Syntax298 kultiviert wird. Die Verflüssigung findet dabei auf der visuellen Ebene statt, indem die Sätze und Begriffe (durch eine unkonventionelle Schreib- richtung a priori) aus dem Verbund der kohäsiven Syntax gelöst werden, und dadurch mit linearen Lesegewohnheiten brechen. Dies tangiert das (folglich) konstitutive Element der Fläche. Die Liquidierung liegt also in der Dislozierung spatial-gebundener Textmoleküle. Besonders prominente Beispiele sind einzelne futuristische Textbilder (Abb. 20), oder natürlich die Konstellation der konkreten Poesie, die besonderen Wert auf ihre räumliche Unverbindlichkeit legen. Durch die Liquidierung des Schriftbildes und der Einräumung mehrerer Lesemöglichkeiten werden damit „Wort-Labyrinthe“299 erzeugt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 18 Nannetti Vieri: Giardino Publico (1917)
5.2.2 Orthografie und Interpunktion
Eine konsequente, formelle Lockerung besteht im Bezug auf Orthografie und Interpunktion. Der Futurismus sieht spezifisch in der Zeichensetzung einen bedrohenden Inhibitor der Lebendigkeit des Textes. Im technischen Manifestes wird proklamiert, dass Kommas und Punkte „absurde Unterbrechungen“300 sind, und allenfalls gegen Signale einer Dynamik (i.e. mathematische und musikalische Zeichen301 ) ausgetauscht werden sollen. Im Surrealismus wird diesbezüglich generell eine formale Korrektheit der Worte zugunsten einer möglichst ungehinderten (authentischen) Notation des Inhaltes verworfen (vgl. Abs. 4.2.6.3). Im Dadaismus kommt der Interpunktion ebenfalls einen niederen Stellenwert zu, weil der Fokus insbesondere auf der oberflächlichen Klang-Ästhetik der Worte liegt.
Bei den Konstellationen entsteht die Interpunktionslosigkeit als Folge der räumlichen Verteilung und dem Anspruch nach der unverbindlichen Individualität der Worte (vgl. vorheriges Kapitel). Zusätzlich wird die korrekte Zeichensetzung verworfen. Als eines der deutlichsten Merkmale der konkreten Poesie ist die Abschaffung von Majuskeln. Dies geschieht primär aus dem Motiv der visuellen Ü berschaubarkeit eines Text(-Bildes), welche durch die konsequente Kleinschrift, „das gleichmässigste, angenehmste und rationellste schriftbild“302, am idealsten gefördert wird.
Die orthografische und interpunktuelle Verflüssigung demontiert in anarchistischer Weise formale, korrekte Sprachkonventionen, und führt die Sprache ein Stück weiter in die freie Unordnung, wo sie letztendlich ins Chaos mündet (vgl. Abs. 4.2).
5.2.3 Diffusität der Worte
Unter diesem Punkt lassen sich mehrere typografische Techniken subsumieren, welche der (leserlichen) Identifizierung der Worte entgegenwirken.
Verflüssigung findet hierbei auf zwei Ebenen statt (welch interdependent mit einander verschränkt sind): auf der Inhaltsseite und der Oberfläche.
Im Bezug auf die inhaltliche Identifikation der Worte hebt sich besonders der Dadaismus von den übrigen Gruppierungen ab, indem konventionelle Referenzen liquidiert bzw. Neologismen ohne „Inhalt“ komponiert werden, und dadurch die Sprache gänzlich in der Materialität ihrer Klangästhetik aufgeht (vgl. Abs. 4.2.3.3).
Weitaus vielfältiger finden sich dabei Verfahren der oberflächlichen und unmittelbar ins Auge fallenden Verflüssigung, welche die Sprache abermals unter der Schrift verblassen lassen (vgl. Abs. 5.1.3). Diese Liquidierungsverfahren setzen sich dabei spezifisch mit Ansätzen der Handschrift, der Unsch ä rfe, der Ü berschreibung und der partiellen bis vollständigen Ausl ö schung auseinander. Diese Verfahren werden im Einzelnen in den folgenden Kapiteln anhand verschiedener Werke erläutert.
5.2.3.1 Handschrift und Individualität
Die Handschrift ist zwar keine eigentliche typografische Technik, noch gehört sie spezifisch zu einer der betrachteten Strömungen, dennoch stellt sie besonders im Kontrast zur normierten Typografie eine weitere Möglichkeit zur Entfaltung der Individualität dar. Je weiter der Text graduell von der Normierung abweicht (sich damit auch tendenziell von der Kalligrafie abwendet), umso diffuser, individueller und freier wird er.
In der Forschungsliteratur wird das Phänomen unter dem Begriff der „scripturalen Poesie“303 subsumiert. Diese zeichnet sich u.a. dadurch aus, dass „die codierten Formen der Alphabetzeichen und der Wort- und Satzbilder ständig in der Schreibgestik mit[laufen], auch wenn sie denaturiert, ausgespart oder ›vergessen‹ werden.“304 Einer der prominentesten Vertreter ist Gerhard Rühm, welcher in seinen Werken besonders den Ausdruck betont, der sich am „Wortbild entlang oder über es hinweg“ artikuliert und der „eidetischen Potenz von Sprache“305 entstammt. Dies geschieht z.B. in Rühms Werk Beissen (Abb. 21) bei welchem die Kombination von Schriftbild und Inhalt sich bedeutungsvoll ergänzen und künstlerisch erweitern. Dadurch offeriert der Text (vgl. Wind -Gedichte der konkreten Poesie) eine eindeutige Assoziation mit dem Phänomen Beissen, das er selbst verkörpert.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 19 Gerhard Rühm: Beissen
In einigen Fällen, wie z.B. beim Werk uns innig vs. unsinnig (Abb. 22) des konkreten Poeten Anatol Knotek wird die Verflüssigung mittels der Technik des Verwischens herbeigeführt, wonach die Buchstaben in ihrer eigenen Materialität verschwimmen.
Der bereits erwähnte Lettrismus macht sich diese Unschärfe bei der Eigenkreation seiner Zeichen zunutze, indem diese oftmals sowohl visuell, als auch inhaltlich verwässert vorliegen (vgl. Abs. 5.1.4). In Extremfällen wird die Handschrift also in solchem Grade bis zur Unkenntlichkeit verschliffen, dass sich die Buchstaben gänzlich nicht mehr zu identifizieren sind und sich der Inhalt damit nicht mehr eruieren lässt, wie z.B. bei Paul Klees abstrakter Schrift (vgl. Abs. 4.2.3.3).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 20 Anatol Knotek: uns innig vs. unsinnig
Neben chirografischen Techniken kann die diffuse Opazität von Textbildern auch durch zwei weitere Liquidierungs-Verfahren herbeigeführt werden: Überschreibung und Auslöschung.
5.2.3.2 Überschreiben
Diese Methode des Hinzufügens imitiert eine palimpsestische Ver- fahrensweise, bei welcher das Ursprüngliche aber bestehen bleibt, wodurch die Worte und Buchstaben (als Konkurrenten um die Fläche) sich gegenseitig dekonstruieren.
Ein Autor, der dieses prozessuale Verfahren, im Verlauf von 62 Folgeseiten illustriert, ist Hansjörg Mayer mit seinem Faltbuch Typoaktionen (Abb. 23). Von Seite zu Seite werden mehr Buchstaben hinzugefügt. Dadurch findet beim Durchblättern (ähnlich wie beim Daumenkino) eine sukzessive Überflutung durch die weiteren Buchstaben-Impulse statt. Dasselbe Verfahren, erweitert um den Zusatz der Verwässerung der Substanz (Druckerschwärze), nutzt Mayer bei folgender Kompilation aus verschiedenen Einzelwerken, welche optisch im Hintergrund zusammen verschwimmen (Abb. 24).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 22 Hansjörg Mayer: Typoaktionen (1967).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 21 Hansjörg Mayer: Monotypie (1967).
Desselben Verfahrens bedienen sich u.a. Claus Bremer bei lesbares in unlesbares ü bersetzen (Abb. 25), als auch der tschechische Poet Václav Havel in vyrozum ĕ n í (Abb. 26). Bremer sieht den erheblichen Vorteil darin, dass die optische Eindeutigkeit gleichzeitig interpretative Vieldeutigkeit ermöglicht306.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 23 Claus Bremer: lesbares in unlesbares ü bersetzen (1968)
Er wendet das Prinzip des Über-schreibens in verschiedenen seiner Werke an307. Oftmals laufen dabei die Worte oder Buchstaben in einem einzigen Punkt zusammen (Abb. 27). Er selbst kommentiert diese Dynamik folgendermassen: „Ein Fleck Dunkel enthält all unsere Ausdrucksmöglichkeiten.“308 Wie auch bei Heinz Gappmayr weckt die extreme Verdichtung Assoziationen zum Urknall, aus welchem jegliches Sein zu existieren begann. Das Streben zum Chasos findet ebenso bei zwei weiteren Arten der Liquidierung statt, die sich in diesem Bezug ähnlich sind.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Ab . 26 Václav Havel: vyrozum ĕ n í
5.2.3.3 Auslassung und Auslöschung
Neben der Auslassung a priori ist die Ausl ö schung a posteriori eine effiziente Technik um das Geschriebene sabotageartig unkenntlich zu machen. Im weiteren Verlauf wird dadurch der kommunikative Zweck der Schrift demontiert. Im Folgenden werden exemplarisch verschiedene Stadien des Liquidierungs-Prozesses veranschaulicht, welche letztlich in der vollständigen Unkenntlichkeit, im Chaos münden.
ist diejenige des Durchstreichens, welches bis zur weitergeführt werden kann. Der Inhalt versickert durch die Zunahme des Fragmentarischen, der Diffusität. Bei Dieter Roth sind die Korrekturen vorerst noch geringfügiger Natur (Abb. 28).
Als Mittel der Bedeutungserweiterung wird die Auslöschung bei Manfred Butzmanns Nicht hinsehen genutzt (Abb. 29). Die Modifikation eröffnet dabei einen neuen Interpretations- spielraum wie bei der Subprose Poetry (vgl. Abs. 5.1.2).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 28 Dieter Roth: ohne Titel
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 29 Manfred Butzmann: Nicht hinsehen (1987)
Durch die Tilgung, eine weitere Art der Steigerung, welche demjenigen Verfahren der Überschreibung ähnelt, werden wie z.B. in Franz Mons Streifentext (Abb. 30) die Buchstaben halb verdeckt, wodurch sie zu einer grafischen Komposition verflechtet werden. Der Fokus rückt dabei die Ästhetik des Materials in den Vordergrund.
Durch sein Werk entsinnung I (Abb. 31) schafft Mario Rotter durch die partielle Verdunkelung respektive Abdeckung des Schrift-Materials eine individuelle, potenzielle Sprach- Schablone. Durch die opake Fragmentierung der Zeichen wird die Referenzfunktion beinahe soweit ausser Kraft gesetzt, dass sich eine unvoreingenommen Perspektive auf das Zeichenmaterial entfalten kann.
Vollständige Auslöschung von Worten wird dagegen in Man Rays Lautgedicht (Abb. 32) mittels kompromittierendem Durchstreichen herbeigeführt. Einzig die Musterhaftigkeit der Zeilen, wie auch der Titel deklarieren die Morsecode- haften Zeilen noch als Gedicht, dessen „Inhalt“ sich (ähnlich wie bei Fisches Nachtgesang) durch die sabotierte Form dem Lesen nachhaltig verweigert, welcher höchstens noch Man Ray selbst bekannt ist.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 30 Franz Mon: Streifentext (1965)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 31 Mario Rotter: entsinnung I (1992)
Der letzte Zustand der Entschriftlichung resultiert in der totalen Auslöschung wie z.B. bei Madeleine Waltons Secret Piece (Abb. 33), welches an Bilder von Kasimir Malewitsch erinnert, der seine eigenen Werke dadurch vom „Ballast der Gegenständlichen Welt“309 befreien wollte.
Walton kommentiert ihr Gedicht mit den Worten:
„The content of this text is invisible; the exact character and dimension of the content are to be permanently secret, known only to the writer.“310 Indem der Text hier Schwarz auf Schwarz geschrieben steht, wird der Sprache ebenfalls wieder ihre konventionelle Dimension aberkannt; der Text wird abermals zu einer Chiffre, die Autorin verfügt als einzige über die Kompetenzen das Gebilde zu übersetzen, obwohl der vermeintliche Text vorhanden und damit potenziell lesbar ist (ähnlich wie bei Bichsels Ein Tisch ist ein Tisch; Abs. 4.2.3.2). Die vollständige Liquidierung der Worte innerhalb des Werkes entledigen die Schrift und die Sprache radikal und endgültig von ihrer restriktiven, konventionellen Aufgabe als Referenz.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 32 Man Ray Lautgedicht (1924)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 33 Madeleine Walton: Secret Piece
Eine vollständige Überwindung ihrer selbst ist der Sprache als Sprache jedoch prinzipiell nicht möglich. Dies äussert sich beispielsweise bei Madeleine Walton darin, dass auch der Kommentar Bestandteil des „geheimen“ Gedichtes ist, oder dass bei Gomringers Schweigen die gleichnamigen Worte einen Rahmen für das sprichwörtliche Schweigen bieten. Die Darstellung der Absenz scheint daher undenkbar: „It is probably impossible to write a completly silent poem with words or recognizable fragments of words.“311 Eine solche totale Abwesenheit bedeutete letztlich auch die gänzliche Ausschaltung der eigenen sinnlichen Wahrnehmung312.
Weiterhin besteht jedoch die Hoffnung auf Unmittelbarkeit (wie z.B. bei Svenja Herrmanns Gedicht; Abb. 34), wie auch die Motivation und Ambition durch das Schreiben nicht mehr im ursprünglichen Sinn die Wirklichkeit festzuhalten, sondern ihr vielmehr Eindrücke abzugewinnen und durch das eigene Formulierte selbst etwas Reales zum Ausdruck bringen zu können:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 34 Svenja Herrmann: ohne Titel.
„Wie seine Sprache, dem Verstummen abgerungen […] so stößt [das] Gedicht kurzfristig und in immer neuen Ansätzen ins Dunkel des Sprachlosen vor, um der unverläßlichen, schlechten, abgegriffenen, zum Klischee erstarrten Wirklichkeit und ihrer konventionalisierte Sprache ein Stück lebendigere, weil unverbrauchte Realität hinzuzufügen, um den Menschen etwas genauer über sich selber »aufzuklären« […].“313
Die veranschaulichten technischen Liquidierungsmethoden befreien die verschriftliche Sprache sukzessive von jeglichen konventionellen Formen. Der praktische Prozess der Befreiung erreicht sein Ziel in der vollständigen, kompromisslosen Liquidation, dem letztendlichen Verzicht auf Sprache, welche darin endgültig dem Chaos übergeben wurde.
5.3 Arbitrarität als kreative Technik
Eine weitere (letzte) Art der Liquidierung, welche alternativ auf eine Verflüssigung des Schriftbildes hinausläuft, besteht in der konzeptionellen Methodik des Schaffensprozesses, wie sie von Tristan Tzara vorgeschlagen wird:
"nimm eine zeitung. nimm eine schere. suche einen artikel aus von der länge des gedichts, das du machen willst. schneide ihn aus. dann schneide jedes seiner wörter aus und tue es in einen beutel. schüttele ihn. dann nimm einen ausschnitt nach dem anderen heraus und schreibe ihn ab. das gedicht wird sein wie du."314
Indem bei dieser kreativen Methode die Komposition der Textmoleküle315 dem Zufall überlassen wird, indem sich die Aufgabe des „Schreibenden“ lediglich auf die Vorauswahl des Materials und die mechanische Methode beschränkt, findet eine systematische Liquidierung der autoritären Dichterinstanz statt. Das letztendliche, inhaltlich ästhetische Resultat tritt dabei hinter der Beliebigkeit der Komposition zurück: wie beim Surrealismus, wird primär nicht auf Wohlgeformtheit und syntagmatische Korrektheit des konkreten Resultates abgezielt. Das Verfahren liefert eine triviale Anleitung um Kreativität spielerisch durch ein mechanisches Verfahren zu kanalisieren, ohne dabei direkt ästhetisch-konventionellen syntagmatischen Prinzipien unterworfen zu sein. In einer seltsamen Verschränkung sind in an diesem Verfahren Zufall und Kontrolle gleichermassen beteiligt. Die Methode weist dadurch eine eindeutige Parallele zur surrealistischen Écriture automatique auf, wobei der Dichter hier nicht mehr Seismograph seines luziden Unterbewusstseins ist, sondern gleichsam zum Sprachrohr des Zufalls innerhalb der vorgegebenen Parameter wird. Wie im Futurismus werden ebenfalls die Worte aufs Geratewohl angeordnet, so wie sie fallen (vgl. Abs. 4.2.1).
Zugleich wird, durch den Zusatz „das gedicht wird sein wie du“ eine intime Authentizität hervorgehoben, was metonymisch interpretiert vielleicht auf die Arbitrarität des Seins an sich verweist, in dessen Rahmen bestimmte Voraussetzungen (genetisch) vorgegeben sind, das konkrete Ergebnis hingegen das Resultat einer Reihe beliebiger, äusserst chaotischer Zusammenhänge ist. Ein anderer Interpretationsansatz könnte darin bestehen, dass die Dichtung generell in einem oft arbiträren Selektionsverfahren von Worten aus dem Inventar der Sprache besteht, wobei sich dieses Verfahren im Wesentlichen nicht von einem gezielten Auswahlverfahren unterscheidet.
Die hier hervortretende technische Seite des kreativen Prozesses liquidiert dabei die intrikate emotionale Dimension der Autorenposition, indem das resultierende Gedicht als stochastische Komposition eines Mechanischen Verfahrens inszeniert wird.
Die Liquidierung des traditionellen Dichters rundet die praktische Seite der allgemeinen formalen Liquidierung ab. Die Sprache erlebte eine Loslösung von ihrer Referenzfunktion, danach eine Auflösung von sich selber und erfährt im letzten Abschnitt noch eine Lösung vom Menschen bzw. Autor, indem sie zum Schluss dem Chaos und damit letztendlich sich selber übergeben wird.
5.4 Ausblicke
5.4.1 Poetische Möglichkeiten der Technik
Im Zusammenhang mit der Liquidierung der Sprache in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts stellen insbesondere technische Neuerungen ein neues Potenzial zur Inszenierung der Kunst dar. Es wäre folglich zu untersuchen, ob dies z.B. als eine ungebrochene Fortsetzung bzw.
Erweiterung der konkreten Poesie angesehen werden kann. Ein modernes Beispiel zeigt sich beispielsweise in den Animationen Word as Image von Ji Lee (nur als statischer Ausschnitt: Abb. 35), welche bereits vorhandene Konzeptionen der konkreten Poesie aufgreifen (Abb. 36) und um eine zeitliche bzw. dynamische Dimension erweitern. Dieser Ansatz nutzt wie die Subprose Poetry wortinhärente Merkmale, betont aber (ähnlich wie Gomringers „wind“) insbesondere das illustrative Potenzial der formellen Ästhetik.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 35 Ji Lee: Moon (2013)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 36 Ilse Garnier: corps lune (1972)
Eine andere Erweiterung durch den technischen Fortschritt zeigt sich im poetischen Selektionsund Permutationsverfahren der ab 1959 computergenerierte Texten von Theo Lutz oder in den sechziger Jahren von Gerhard Stickel316, welches theoretisch bereits von Tzara entwickelt wurde (vgl. Abs. 5.3). Die dadurch fortschreitende Liquidierung der klassischen Autoren-Position könnte dabei bis hin zur postmodernen Hermeneutik von Roland Barthes (Tod des Autors, 1968) in Verbindung gebracht werden.
Moderne Chiffren der Linguistik
Im Bezug auf die moderne Textlinguistik der siebziger Jahre wäre die These spannend, inwiefern die Idee von der Lesbarkeit der Welt eine Wiederaufnahme in der Forschungsliteratur gelingt. Eine gegenwärtigen Studie von Heiko Hausendorf und Wolfgang Kesselheim befasst sich diesbezüglich z.B. mit der Fragestellung ob Räume Texte sein können (2013)317. Gleichzeitig wird der Begriff der „Lesbarkeit“ erweitert: „Lesbarkeit gibt es auch ausserhalb phonografischer Schriftsysteme, und Schrift und Lesbarkeit konnen letztlich wohl nicht auf ‹geschriebene Sprache› reduziert werden.“318 In dieser Hinsicht ist besonders die Linguistik auf dem Gebiete nonverbaler Kommunikation (beispielsweise der Gestik319 ) dazu bestrebt, die natürliche Bedeutung von menschlichen Zeichen zu entschlüsseln. Darin liegt eine Verwandtschaft mit der Überzeugung des Surrealismus, dass authentische Bedeutung aus unbewussten Sphären bzw. nun über (mehr oder weniger) unbewusste Kanäle vermittelt wird.
6. ZUSAMMENFASSUNG
Diese Masterarbeit zeigt, wie die Sprache von den literarischen Avantgarden des 20. Jahrhunderts als Akt der Befreiung aus ihrer traditionellen und konventionsreichen Verwendung bis zur Sprachkrise methodisch und programmatisch liquidiert wurde. Insbesondere wurde verdeutlicht, wie dies sowohl auf der theoretischen Ebene (Manifesten) geschieht, als auch anhand der literarischen Experimente, die sich alternierend auf verschiedene Bestandteile des natürlichen Inventars der Schrift fokussierten und diese in ihrer individuellen Ästhetik veranschaulicht haben. Ebenfalls konnte gezeigt werden, dass sich über die verschiedenen literarischen Strömungen hinweg eine allgemeine Tendenz in den Liquidierungsverfahren abzeichnet, welche einerseits die endgültige Loslösung von der Welt, andererseits die vollständige Unkenntlichkeit der Sprache anstrebt. In diesem Zustand der vollständigen Liquidierung bzw. ganzheitlichen Entrücktheit der Sprache von ihrer restriktiven formalen Natur erfüllt sich letzten Endes der poetische Traum von der Unmittelbarkeit zur Welt, der noch bis zu den Dichtern der Sprachkrise verfolgt wurde. In dieser vollständigen Überwindung ihrer selbst liegt schliesslich die endgültige Befreiung der Sprache.
7. QUELLENVERZEICHNIS
7.1 Literaturverzeichnis
Albrecht, Michael von (Hg.) (1994): Ovid, Metamorphosen. Ditzingen: Reclam.
Alt, Peter- André (1985): Doppelte Schrift, Unterbrechung und Grenze. Franz Kafkas Poetik des Unsagbaren im Kontext der Sprachskepsis um 1900. In: Jahrbuch der deutschen Schillergesellschaft. Band 29. Hrsg. v. Fritz Martini. 455-490.
Andersen, Hans Christian (1974): S ä mtliche M ä rchen in zwei B ä nden. Bd. 1/2. Hrsg. v. Erling Nielsen. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
Apollinaire, Guillaume (1918): Calligrammes. Po è mes de la paix et de la guerre (1913-1916). Paris: Nouvelle Revue Française. Partiell online unter: https://fr.wikisource.org/wiki/Calligrammes <Stand: 12.01.2016>
Arnold, Heinz Ludwig (Hg.) (1997): Visuelle Poesie. Zeitschrift für Literatur. Sonderband. München: Edition Text + Kritik.
Asholt, Wolfgang / Fähnders, Walter (Hg.) (2005): Manifeste und Proklamationen der europ ä ischen Avantgarde (1909-1938). Stuttgart/Weimar: J.B. Metzler.
Augustinus, Aurelius (2012): Die Bekenntnisse des heiligen Augustinus. Übers. v. Otto F. Lachmann. Hamburg: tredition.
Ball, Hugo (1992 1927 ): Die Flucht aus der Zeit. Hrsg. v. Berhard Echte. Zürich: Limmat.
Baudrillard, Jean (1991 1976 ): Der symbolische Tausch und der Tod. München: Matthes & Seitz.
Benjamin, Walter (1974-1991): Gesammelte Schriften. Hrsg. v. Rolf Tiedemann u. Hermann Schweppenhäuser. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Benjamin, Walter (2010 1940 ): Ü ber den Begriff der Geschichte. In: Texte zur Theorie der Kulturwissenschaft. Hrsg. v. Roland Borgards. Stuttgart: Reclam. 145-158.
Best, Otto F. / Schmitt, Hans-Jürgen (Hg.) (1976): Sturm und Drang und Empfindsamkeit. Reihe: Die deutsche Literatur. Ein Abri ß in Text und Darstellung. Bd. 6. Stuttgart: Reclam.
Bichsel, Peter (1990 1969): Kindergeschichten. Frankfurt a.M.: Luchterhand.
Bies, Michael / Gamper, Michael (Hg.) (2011): » Es ist ein Laboratorium, ein Laboratorium f ü r Worte «. Experiment und Literatur III, 1890 - 2010. Serie: Experiment und Literatur. Göttingen: Wallstein.
Blumenberg, Hans (1981): Die Lesbarkeit der Welt. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Boglione, Riccardo (Hg.) (2014): Crux Desperationis. Zeitschrift. Bd. 5. Montevideo: Gegen.
Online unter: https://issuu.com/cruxdesperationis/docs/crux_desperationis_5 <Stand: 04.11.2015>
Bremer, Claus (1983): Farbe bekennen. Mein Weg durch die konkrete Poesie. Ein Essay. Zürich: orte- Verlag.
Breton, André (1996): Die Manifeste des Surrealismus. 9. Aufl. Übers. v. Ruth Henry. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
Brög, Hans et al. (1977): Konkrete Kunst - konkrete Poesie. Programmatik, Theorie, Didaktik, Kritik: kunstwissenschaftliche, literaturdidaktische und theologische Beitr ä ge aus einem interdisziplin ä ren Seminar. Kastellaun: Aloys Henn.
Bucay, Jorge (2011): Drei Fragen. Übers. v. Stephanie von Harrach. Frankfurt a.M.: Fischer.
Büchner, Georg (2002): Lenz [ein Fragment]. Der Hessische Landbote. Stuttgart: Reclam.
Celan, Paul (1958): Ansprache anl äß lich der Entgegennahme des Literaturpreises der freien Hansestadt Bremen. In: Die Neue Rundschau (1958). Heft 1. Frankfurt a.M.: Fischer. 110-116.
Christensen, Inger (1999): Der Geheimniszustand und das » Gedicht vom Tod «. Essays. Hrsg. v. Michael Krüger. München/Wien: Carl Hanser.
Diderot (2013): Philosophische Schriften. Hrsg. v. Alexander Becker. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Dornseiff, Franz (1925): Das Alphabet in Mystik und Magie. Berlin: Teubner.
Eichendorff, Joseph von: Gedichte. Versepen. In: Ebd. (1987): Werke in sechs B ä nden. Hrsg. v. Hartwig Schulz. Frankfurt a.M.: Deutscher Klassiker Verlag. Bd. 1.
Fähnders, Walter (2010): Avantgarde und Moderne 1890-1933. Lehrbuch Germanistik. 2. akt. u. erw. Aufl. Stuttgart: J.B. Metzler.
Flessner, Berndt (2016): Wenn Algorithmen Dichter werden. In: Neue Z ü rcher Zeitung (31.03.2016), 37.
Flusser, Vilém (1994): Gesten Versuch einer Ph ä nomenologie. Frankfurt a.M.: Fischer.
Freud, Sigmund (1930): Das Unbehagen in der Kultur. Wien: Internationaler Psychoanalytischer Verlag.
Fried, Erich (1995): Gedichte. München: Dtv.
Frisch, Max (1976): Gesammelte Werke in zeitlicher Folge. Hrsg. v. Hans Mayer. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Fromm, Wilmar (2006): An den Grenzen der Sprache. Ü ber das Sagbare und das Unsagbare in Literatur und Ä sthetik der Aufkl ä rung, der Romantik und der Moderne. Freiburg i. Br./Berlin: Rombach.
Gappmayr, Heinz (1971): Konkrete Poesie. Bd. I (=Text und Kritik 25). 2. Aufl. München: Willing.
Garzetti. Sascha (2012): Gespr ä ch in der Manteltasche. Gedichte. Eggingen: Edition Isele.
Gomringer Eugen (1969): worte sind schatten. Die Konstellationen 1951-1968. Hrsg. v. Helmut Heißenbüttel. Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt.
Gomringer Eugen (Hg.) (2001): konkrete poesie. anthologie von eugen gomringer. Stuttgart: Reclam.
Gracián, Baltasar (1657): El Mundo descifrado. In: El Criticón. Bd. 3/4.
Günther, Timo (2004): Hofmannsthal: Ein Brief. München: Wilhelm Fink Verlag.
Hofmannsthal, Hugo von: Ein Brief. In: Ebd (1992 1902 ): S ä mtliche Werke, kritische Ausgabe in 38. B ä nden. Hrsg. von Rudolf Hirsch, Christoph Perels, Heinz Rölleke. Frankfurt a.M.: Fischer. 45-55.
Habermann, Frank (2012): Literatur/Theorie der Unsagbarkeit. Ersch. In: Literatur Kultur Theorie. Hrsg. v. Sabina Becker, Christoph Bode, Hans-Edwin Friedrich, Oliver Jahraus u. Christoph Reinfandt. Bd. 9. Würzburg: Ergon.
Hartung, Harald (1975): Experimentelle Literatur und konkrete Poesie. Göttingen: Vanderhoeck & Ruprecht.
Harsdörffer, Georg Philipp (1945): Frauenzimmer Gespr ä chsspiele. Tübingen: Niemeyer.
Hausendorf, Heiko / Kesselheim, Wolfgang (2013): K ö nnen R ä ume Texte sein? Linguistische
Ü berlegungen zur Unterscheidung von Lesbarkeits- und Benutzbarkeitshinweisen. Arbeitspapiere des UFSP Sprache und Raum (SpuR). 2013/2. Zürich: Universität Zürich.
Herder, Johann Gottfried (1891[1772]): Abhandlung ü ber den Ursprung der Sprache. In: Johann
Gottfried Herder: S ä mtliche Werke. Hrsg. v. Bernhard Suphan. Bd. 5. Berlin: Weidmannsche Buchhandlung.
Höck, Wilhelm (1969): Formen heutiger Lyrik. Verse am Rande des Verstummens. München: Paul List.
Hocke, Gustav René (1987): Die Welt als Labyrinth. Manierismus in der europ ä ischen Kunst und Literatur. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
Hollis, James R. (1970): Harold Pinter: The Poetics of Silence. Carbondale: Southern Illinois University Press.
Jacobsen, Jens Peter (2011 1880 ): Niels Lyhne, die Geschichte einer Jugend. Hamburg: tredition.
Jiménez, Juan Ramón (1987): Herz, stirb oder singe. Übers. u. hrsg. v. Hans Leopold Davi. Zürich: Diogenes.
Kafka, Franz (1958): Briefe 1902-1924. Hrsg. v. Max Brod. Frankfurt a.M.: Fischer.
Kaléko, Mascha (2010[1958]): Verse f ü r Zeitgenossen. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
Kandinsky, Wassily (1963): Essay ü ber Kunst und K ü nstler. 2. Aufl. Hrsg. v. Max Bill. Bern: Benteli.
Keller, Christa / Schmidt, Markus (2014): Spirituelle Philosophie: Wissen der Orden in Asien & Europa. Isaistempler Edition. Norderstedt: Books on Demand.
Kiening, Christian (2008): Zum Geleit. In: Dichten als Stoff-Vermittlung. Formen, Ziele, Wirkungen.
Beitr ä ge zur Praxis der Versifikation lateinischer Texte im Mittelalter. 7-9. Reihe: Medienwandel - Medienwechsel - Medienwissen. Bd. 5. Hrsg. v. Peter Stotz. Zürich: Chronos.
Kiening, Christian (2014): Vorlesungsfolien der Vorlesung: Medialit ä t im Mittelalter. Einführung vom 25.02.2014. Universität Zürich.
Kiesel, Helmuth (2004): Geschichte der literarischen Moderne: Sprache, Ä sthetik, Dichtung im zwanzigsten Jahrhundert. München: C.H. Beck.
Kircher, Hartmut / Klanska, Maria / Kleinschmidt, Erich (Hg.) (2002): Avantgarden in Ost und West: Literatur, Musik und bildende Kunst um 1900. Köln: Böhlau.
Kittler, Friedrich (1987): Aufschreibesysteme 1800, 1900. Zweite erw. Aufl. München: Fink.
Kluge, Friedrich (2011): Etymologisches W ö rterbuch der deutschen Sprache. Berlin: De Gruyter.
Kurz, Paul Konrad (1973): Ü ber moderne Literatur, IV. Standorte und Deutungen. Frankfurt a.M.: Knecht.
Liede, Alfred (1992 1963 ): Dichtung als Spiel. Studien zur Unsinnspoesie an den Grenzen der Sprache. 2. Aufl. Berlin/New York: de Gruyter.
Malewitsch, Kasimir (1962): Suprematismus - Die gegenstandlose Welt. Köln: M. Dumont Schauberg.
Mallarmé, Stéphane (1984 1897 ): S ä mtliche Gedichte. Hrsg. u. übers. v. Carl Fischer. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
Mauthner, Fritz (1923): Beitr ä ge zu einer Kritik der Sprache: Erster Band. Zur Sprache und zur Psychologie. 3., um Zusätze vermehrte Aufl. Leipzig: Felix Meiner.
Mayer, Hansjörg (2014): Typo. Druckprozess-Bilder und typografische Arbeiten aus den 50er und 60er Jahren. Köln: Walther König.
Mon, Franz (Hg.) (1960): Movens: Dokumente und Analysen zur Dichtung, bildenden Kunst, Musik, Architektur. Wiebaden: Limes.
Mon, Franz (1964): Sehg ä nge. Berlin: Fietkau.
Mon, Franz / Neidel, Heinz (Hg.) (1968): prinzip collage. Neuwied/Berlin: Luchterhand.
Mon, Franz (1970): Texte ü ber Texte. Neuwied/Berlin: Luchterhand.
Morgenstern, Christian: (2000[1905]): Die Galgenlieder. Zürich: Haffmans.
Moritz, Karl Philipp (1997[1793]): Die metaphysische Sch ö nheitslinie. In: Karl Philipp Moritz. Werke, in zwei B ä nden. Hrsg. v. Heide Hollmer u. Albert Meier. Bd. 2. Frankfurt a.M.: Deutscher Klassiker Verlag. 950-957.
Musil, Robert (2000): Gesammelte Werke. Hrsg. v. Adolf Frisé. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
Nietzsche, Friedrich (19991873 ): S ä mtliche Werke. Kritische Studienausgabe in 15 B ä nden. Hrsg. v. Giorgio Colli u. Mazzino Montinari. München: Deutscher Taschenbuchverlag.
Nietzsche, Friedrich (2000[1884]): Also Sprach Zarathustra. Ein Buch f ü r Alle und Keinen. Zürich: Manesse.
Noble, Cecil A. M. (1978): Sprachskepsis ü ber Dichtung der Moderne. Zusammenh ä nge der deutschen
Literatur. Bd. 1. Hrsg. v. Heinz Ludwig Arnold. München: Edition Text u. Kritik.
Novalis (1929): Fragmente. Hrsg. v. Ernst Kamnitzer. Dresden: Wolfgang Jess.
Novalis (1997): Gedichte. Die Lehrlinge zu Sais. Hrsg. v. Johannes Mahr. Bibliographisch ergänzte Ausgabe. Stuttgart: Reclam. 61-93.
Novalis (2004): Heinrich von Ofterdingen. Bibliographisch ergänzte Ausgabe. Stuttgart: Reclam.
Ohmer, Anja (2011): Textkunst: Konkretismus in der Literatur. Serie: Aspekte der Avantgarde. Bd. 12. Berlin: Weidler.
Oulipo (1997): La Biblioth è que oulipienne. Paris: Seghers.
Perret, Roger (2013): Moderne Poesie der Schweiz. Eine Anthologie von Roger Perret. Zürich: Limmat.
Pessoa, Fernando (2008): Alberto Caeiro. Poesia - Poesie. Frankfurt a.M.: Fischer.
Pfister, Jonas (Hg.) (2011): Texte zur Sprachphilosophie. Stuttgart: Reclam.
Platon (2012 [380 v. Chr.]): Der Staat (Politeia). Übers. v. Karl von Prantl. Hamburg: Tredition.
Riha, Karl / Wende-Hohenberger, Waltraud (Hg.) (1992): Dada Z ü rich. Texte, Manifeste, Dokumente. Stuttgart: Reclam.
Rilke, Rainer Maria (1951): Duineser Elegien. Die Sonette an Orpheus. Zürich: Manesse.
Rilke, Rainer Maria (1996): Werke. Kommentierte Ausgabe. 4 B ä nde. hrsg. von Manfred Engel, Ulrich Fülleborn, Dorothea Lauterbach, Horst Nalewski u. August Stahl. Frankfurt a.M./Leipzig: Insel.
Rilke, Rainer Maria (2011): Die sch ö nsten Gedichte. Berlin: Insel Verlag.
Rost, Hans (1939): Die Bibel im Mittelalter. Beitrage zur Geschichte und Bibliographie der Bibel. Mit 48
Abbildungen. Westheim bei Augsburg: M. Seitz.
Rotzler, Willy (1977): Konstruktive Konzepte. Zürich: ABC.
Saussure, Ferdinand de (2001[1931]): Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft. 3. Aufl. Hrsg. v. Charles Bally u. Albert Sechehaye. Berlin/New York: Walter de Gruyter.
Schamoni, Rocko (2011): Sternstunden der Bedeutungslosigkeit. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
Schmidt-Bergmann, Hansgeorg (1993): Futurismus. Geschichte, Ä sthetik, Dokumente. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
Schnauber, Cornelius (Hg.) (1989): Deine Tr ä ume - Mein Gedicht. Eugen Gomringer und die konkrete Poesie. Nördlingen: Greno.
Schneider, Sabine (Hg.) et al. (2010): Die Grenzen des Sagbaren in der Literatur des 20. Jahrhunderts. Würzburg: Königshausen & Neumann.
Schnitzler, Arthur (1932): Gedanken ü ber Kunst. Aus dem Nachla ß. In: Die Neue Rundschau, Bd. 43. Frankfurt a.M.: Fischer.
Schweikle, Günther u. Irmgard (Hg.) (1990): Metzler Literatur Lexikon. Begriffe und Definitionen. Stuttgart: Metzler.
Seel, Martin (2000): Ästhetik des Erscheinens. Lizenzausgabe München/Wien: Carl Hanser.
Serres, Michel (1989): Der Hermaphrodit. Übers. v. Reinhard Kaiser. Frankfurt a.M.: Suhrkamp. 49-62.
Simmel, Georg (1995): Gesamtausgabe in zw ö lf B ä nden. Hrsg. v. Otthein Rammstedt. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Solt, Mary Ellen (1970): Concrete Poetry. A World View. Bloomington: Indiana University Press.
Steiner, George (1969): Sprache und Schweigen. Essays ü ber Sprache, Literatur und das Unmenschliche.
Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Stopka, Katja (2005): Semantik des Rauschens: ü ber ein akustisches Ph ä nomen in der deutschsprachigen Literatur. Serie: Forum Kulturwissenschaften 2. München: M press.
Strässle, Thomas / Kleinschmidt, Christoph / Mobs, Johannes (2013): Das Zusammenspiel der Materialien in den K ü nsten : Theorien - Praktiken - Perspektiven. Serie: Image; Bd. 47. Bielefeld : Transcript.
Szymańska, Magdalena. 2009. Dada und die Wiener Gruppe. Hamburg: Diplomica Verlag.
Wagner, Monika (2001): Das Material der Kunst: Eine andere Geschichte der Moderne. München: C. H. Beck.
Wehle, Winfried (Hg.) (2010): 20. Jahrhundert, Lyrik. Tübingen: Stauffenburg.
Weiss, Christina (1984): Seh-Texte. Zirndorf: Verlag für moderne Kunst.
Wiese, Benno von: Die deutsche Lyrik der Gegenwart. In: Wolfhang Kayser (Hg.) (1959): Deutsche Literatur unserer Zeit. Göttingen: Vanderhoeck & Ruprecht. 32-57.
Williams, Emmet (1967): Sweethearts. New York: Something Else Press.
Winter, Astrid (2006): Metamorphosen des Wortes. Der Medienwechsel im Schaffen Ji ř í Kol á ř s. Göttingen: Wallstein.
Wunberg, Gotthard (2000): Die Wiener Moderne. Literatur, Kunst und Musik zwischen 1890 und 1910. Stuttgart: Reclam.
Zanetti, Sandro (Hg.) (2013): Wortdinge/Words as Things/Mots-choses. Reihe: Figurationen (Zeitschrift). Gender - Literatur - Kultur. 2013/2. Köln: Böhlau.
Zeller, Christoph: Hypermedium Literatur. Georg Kleins Poetologie. In: Gansel, Carsten / Hermann,
Elisabeth (Hg.) (2013): Deutschsprachige Gegenwartsliteratur und Medien. Bd. 10.
Entwicklungen der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur nach 1989. Göttingen: V&R unipress. 231-248. 233.
7.2 Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: Magritte, René: La condition humaine (1933). In: Levine, Steven Z. (2008): Lacan reframed: A Guide for the Arts Student. London: I.B. Tauris. 106.
Abb. 2: Gomringer, Eugen: geografie (1970). In: Arnold, Heinz Ludwig (Hg.) (1997): Visuelle Poesie. Zeitschrift für Literatur. Sonderband. München: Edition Text + Kritik. 63.
Abb. 3: Morgenstern, Christian: Fisches Nachtgesang. In: Ebd. (2000[1905]): Die Galgenlieder. Zürich: Haffmans. 26.
Abb. 4: Marinetti, F. T.: Apr è s la Marne, Joffre visita le front en auto (Nach der Marne, Joffre besuchte die Front per Auto, 1915). In: Meazzi, Barbara (2010): Le futurisme entre l'Italie et la France. Chambéry: Université de Savoie. 65.
Abb. 5: Ball, Hugo: Karawane [ Gadji beri bimba ] (1917). In: Perret, Roger (2013): Moderne Poesie der Schweiz. Eine Anthologie von Roger Perret. Zürich: Limmat. 65.
Abb. 6: Klee, Paul: abstracte Schrift (1931). In: Perret, Roger (2013): Moderne Poesie der Schweiz. Eine Anthologie von Roger Perret. Zürich: Limmat. 31.
Abb. 7: Gomringer, Eugen: wind (1953). In: Schnauber, Cornelius (Hg.) (1989): Deine Tr ä ume - Mein Gedicht. Eugen Gomringer und die konkrete Poesie. Nördlingen: Greno. 48.
Abb. 8: Bremer, Claus: Ü ber sich hinaus / lieben / sich fallen lassen / in den Aufwind. Perret, Roger (2013): Moderne Poesie der Schweiz. Eine Anthologie von Roger Perret. Zürich: Limmat. 196.
Abb. 9: Vroom, Ivo: winden (1971). In: Weiss, Christina (1984): Seh-Texte. Zirndorf: Verlag für moderne Kunst. 80.
Abb. 10: Hiršal, Josef / Grögerová, Bohumila: vitr (1965). In: Weiss, Christina (1984): Seh-Texte. Zirndorf: Verlag für moderne Kunst. 79.
Abb. 11: Gomringer, Eugen: Schweigen (1953). In: Ebd. et al. (2001): konkrete poesie - anthologie von eugen gomringer. Stuttgart: Reclam. 58.
Abb. 12: Bremer, Claus: Die Sitzende (1983): Farbe bekennen. Mein Weg durch die konkrete Poesie. Ein Essay. Zürich: orte-Verlag. 46.
Abb. 13: Gomringer, Eugen: baum kind hund haus (1953). In: Ebd. et al. (2001): konkrete poesie - anthologie von eugen gomringer. Stuttgart: Reclam. 55.
Abb. 14: Williams, Emmet: ohne Titel. In: Ebd. (1967): Sweethearts. New York: Something Else Press. Unpaginiert.
Abb. 15: Mayer, Hansjörg: ohne Titel (1967). In: Ebd. (2014): Typo. Druckprozess-Bilder und typografische Arbeiten aus den 50er und 60er Jahren. Köln: Walther König. 86.
Abb. 16: Mayer, Hansjörg: ohne Titel (1967). In: Ebd. (2014): Typo. Druckprozess-Bilder und typografische Arbeiten aus den 50er und 60er Jahren. Köln: Walther König. 93.
Abb. 17: Sabatier, Robert: Hyperographie (1965). In: Girard, Bernard (2010): Lettrisme - l'ultime avant-garde. Dijon: Les presses du réel. 164.
Abb. 18: Lemaître, Maurice: Plus loin que Mondrian (1973). In: Girard, Bernard (2010): Lettrisme - l'ultime avant-garde. Dijon: Les presses du réel. 153.
Abb. 19: Dotremont, Christian: trop peu, c ’ est aussi un exc è s (1976). In: Weiss Weiss, Christina (1984): Seh-Texte. Zirndorf: Verlag für moderne Kunst. 187.
Abb. 20: Vieri, Nannetti: Giardino Publico (1917). In: L ’ Italia Futurista (Zeitschrift). Hrsg. v. Arnaldo Ginna u. Emilio Settimelli. 1917. Nr. 14. 3. Online unter: http://futurismus.khi.fi.it/index.php?id=126&vorschau=true&stelle=&index=&type=sc reen&data=zdb88147-8_-_anno02-014&pos=2&L=999999.9 <Stand: 03.01.2016>
Abb. 21: Gerhard Rühm: Beissen. In: Arnold, Heinz Ludwig (Hg.) (1997): Visuelle Poesie. Zeitschrift f ü r Literatur. Sonderband. München: Edition Text + Kritik. 20.
Abb. 22: Knotek, Anatol: uns innig v. unsinnig. Online unter: http://www.anatol.cc/concrete_poetry/unsinnig.html <Stand: 12.01.2016>
Abb. 23: Mayer, Hansjörg: Typoaktionen (1967). Mayer, Hansjörg (2014): Typo. Druckprozess-Bilder und typografische Arbeiten aus den 50er und 60er Jahren. Köln: Walther König. 98.
Abb. 24: Mayer, Hansjörg: Monotypie (1967). Mayer, Hansjörg (2014): Typo. Druckprozess-Bilder und typografische Arbeiten aus den 50er und 60er Jahren. Köln: Walther König. 94.
Abb. 25: Bremer, Claus: lesbares in unlesbares ü bersetzen (1968). In: Gomringer, Eugen et al. (2001): konkrete poesie - anthologie von eugen gomringer. Stuttgart: Reclam. 29.
Abb. 26: Havel, Václav: vyrozum ĕ n í (tschech.: Benachrichtigung). In: Ebd. (1993[1964]): Antik ó dy. Prag: Odeon. 111.
Abb. 27: Gappmayr, Heinz: alles (1962). In: Gomringer, Eugen et al. (2001): konkrete poesie - anthologie von eugen gomringer. Stuttgart: Reclam. 46.
Abb. 28: Roth, Dieter: ohne Titel. In: Perret, Roger (2013): Moderne Poesie der Schweiz. Eine Anthologie von Roger Perret. Zürich: Limmat. 201.
Abb. 29: Butzmann, Manfred: Nicht hinsehen (1987). In: Kowalski, Jörg: bildSTOERUNG & HEIMATkunde. Bemerkungen zur visuellen Poesie der DDR. In: Arnold, Heinz Ludwig (Hg.) (1997): Visuelle Poesie. Zeitschrift für Literatur. Sonderband. München: Edition Text + Kritik. 130-141. 139.
Abb. 30: Mon, Franz: Streifentext (1965). In: Ohmer, Anja (2011): Textkunst: Konkretismus in der Literatur. Serie: Aspekte der Avantgarde; Band 12. Berlin: Weidler. 203.
Abb. 31: Rotter, Mario: entsinnung I (1992). In: Gomringer, Eugen et al. (1996): visuelle poesie. anthologie von eugen gomringer. Stuttgart: Reclam. 122.
Abb. 32: Ray, Man Lautgedicht (1924). In: Wehle, Winfried (Hg.) (2010): 20. Jahrhundert, Lyrik. Tübingen: Stauffenburg. 66.
Abb. 33: Walton, Madeleine: Secret Piece. In: Boglione, Riccardo (Hg.) (2014): Crux Desperationis (Zeitschrift). IV. Montevideo: gegen. 18.
Abb. 34: Herrmann, Svenja: ohne Titel. In: Perret, Roger (2013): Moderne Poesie der Schweiz. Eine Anthologie von Roger Perret. Zürich: Limmat. 509.
Abb. 35: Lee, Ji (2013): Moon. In: Words as Image. Animationsfilm / eBook. Online unter: http://pleaseenjoy.com/projects/personal/word-as-image/ <Stand: 23.09.2015>
Abb. 36: Garnier, Ilse: corps lune (1972). In: Gomringer (1996): visuelle Poesie. 73.
[...]
1 Hugo Ball: Manifest. In: Riha, Karl / Wende-Hohenberger, Waltraud (Hg.) (1992): Dada Z ü rich. Texte, Manifeste, Dokumente. Stuttgart: Reclam. 30.
2 Hocke, Gustav René (1987): Die Welt als Labyrinth. Manierismus in der europ ä ischen Kunst und Literatur. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt. 310.
3 Vgl. Noble, Cecil A.M. (1978): Sprachskepsis. Ü ber Dichtung der Moderne. Zusammenh ä nge der deutschen Literatur. Bd. 1. Hrsg. v. Heinz Ludwig Arnold. München: Edition Text u. Kritik. 15.
4 Benjamin, Walter (1974-1991): Gesammelte Schriften. Hrsg. v. Rolf Tiedemann u. Hermann Schweppenhäuser. Frankfurt a.M.: Suhrkamp. Bd. I,2, 694.
5 Habermann, Frank (2012): Literatur/Theorie der Unsagbarkeit. Ersch. In: Literatur Kultur Theorie. Hrsg. v. Sabina
Becker, Christoph Bode, Hans-Edwin Friedrich, Oliver Jahraus u. Christoph Reinfandt. Bd. 9. Würzburg: Ergon. 16.
6 Dieser Grundgedanke wird bereits von Thomas von Aquin festgehalten: „[medium] debet habere aliquid de utroque extremorum“ (Pauluskommentar, Super I Tim., cap. 2 l. 1). zit. nach Kiening, Christian (2014): Vorlesungsfolien der Vorlesung: Medialit ä t im Mittelalter. Einführung vom 25.02.2014. Universität Zürich. (unveröffentlicht). 28.
7 Diese Überlegung geht auf den Franziskaner Bonaventura zurück: „medium debet habere differentiam ab extremis“ (Sentenzenkommentar, dist. 19, art. 2, qu. 1). zit. nach Kiening, Christian (2014): Vorlesungsfolien der Vorlesung: Medialit ä t im Mittelalter (Anm. 6), 28.
8 Harsdörffer, Georg Philipp (1945): Frauenzimmer Gespr ä chsspiele. Tübingen: Niemeyer. Bd. 5/8. 23. Zit. n. Noble (Anm. 3), 15.
9 Kiening, Christian (2008): Zum Geleit. In: Dichten als Stoff-Vermittlung. Formen, Ziele, Wirkungen. Beitr ä ge zur Praxis der Versifikation lateinischer Texte im Mittelalter. 7-9. Reihe: Medienwandel - Medienwechsel - Medienwissen. Bd. 5. Hrsg. v. Peter Stotz. Zürich: Chronos. 7.
10 Aus derselben Erkenntnis der Unbegreifflichkeit gilt beispielsweise der Tod „als Grenzfigur schlechthin“: Schneider, Sabine: Einleitung. In: Ebd. (Hrsg.) et al. (2010): Die Grenzen des Sagbaren in der Literatur des 20. Jahrhundert. Würzburg: Königshausen & Neumann. 7-19. 13.
11 Dornseiff, Franz (1925): Das Alphabet in Mystik und Magie. Berlin: Teubner. 4.
12 Zit. n. Rost, Hans (1939): Die Bibel im Mittelalter. Beitr ä ge zur Geschichte und Bibliographie der Bibel. Mit 48 Abbildungen. Westheim bei Augsburg: M. Seitz. 12f.
13 Vgl. Müller Nielaba, Daniel: Zur Sagbarkeit der Grenze. In: Schneider et al. (Anm. 10). 19-30. 25.
14 Vgl. Stopka, Katja (2005): Semantik des Rauschens: ü ber ein akustisches Ph ä nomen in der deutschsprachigen Literatur. Serie: Forum Kulturwissenschaften 2. München: M press. 63.
15 Noble (Anm. 3), 16.
16 Ebd.
17 Ebd.
18 Best, Otto F. / Schmitt, Hans-Jürgen: Einleitung. In: Ebd. (Anm.18), 9-28, 12f.
19 Noble (Anm. 3), 17.
20 Platon (2012 [380 v. Chr.]): Der Staat (Politeia). Übers. v. Karl von Prantl. Hamburg: Tredition. 22f.
21 Best / Schmitt (Anm. 18), 13.
22 Vgl. „Geniezeit“. In: Schweikle, Günther u. Irmgard (Hrsg.) (1990): Metzler Literatur Lexikon. Begriffe und Definitionen. Stuttgart: Metzler. 173.
23 Best / Schmitt (Anm. 18), 14.
24 Ebd.
25 Moritz, Karl Philipp (1997): Die metaphysische Sch ö nheitslinie. In: Karl Philipp Moritz Werke, in zwei Bänden. Hrsg. v. Heide Hollmer u. Albert Meier. Bd. 2. Frankfurt a.M.: Deutscher Klassiker Verlag. 950-957. 952.
26 Vgl. Best / Schmitt (Anm. 18), 18.
27 Vgl. Ebd. 15.
28 Ebd. 14.
29 Noble (Anm. 3), 16.
30 Vgl. Noble (Anm. 3), 17.
31 Herder, Johann Gottfried (1891[1772]): Abhandlung ü ber den Ursprung der Sprache. In: Johann Gottfried Herder: S ä mtliche Werke. Hrsg. v. Bernhard Suphan. Bd. 5. Berlin: Weidmannsche Buchhandlung. 549f. Zit n. Stopka (Anm. 14), 26.
32 Vgl. Stopka (Anm. 14), 22.
33 Ebd. 26.
34 Vgl. Ebd.
35 Albrecht, Michael von (Hg.) (1994): Ovid, Metamorphosen. Ditzingen: Reclam. VI. 313-381, vgl. hier insbesondere 376.
36 Ohmer, Anja (2011): Textkunst : Konkretismus in der Literatur. Serie: Aspekte der Avantgarde. Bd. 12. Berlin: Weidler. 7.
37 Zit. u. übers. n. Liede, Alfred (1992): Dichtung als Spiel: Studien zur Unsinnspoesie an den Grenzen der Sprache. Walter DeGruyter. Bd. 2. 94.
38 Vgl. Ebd.
39 Das besagte Gedicht besteht hauptsächlich aus der Wiederholung des Wortes „Quitó“, oder der auffälligen Zeile „zízízízízízízízí“.
40 Hocke (Anm. 2), 298.
41 Eichendorff: Gedichte. Versepen. In: Ebd. (1987): Werke in sechs B ä nden. Hrsg. v. Hartwig Schulz. Frankfurt a.M.: Deutscher Klassiker Verlag. Bd. 1. 255.
42 Stopka, (Anm. 14), 63.
43 Stopka (Anm. 14), 59.
44 Blumenberg, Hans (1981): Die Lesbarkeit der Welt. Frankfurt a.M.: Suhrkamp. 87.
45 Stopka (Anm. 14), 58
46 Jiménez, Juan Ramón (1987): Herz, stirb oder singe. Übers. u. hrsg. v. Hans Leopold Davi. Zürich: Diogenes. 59.
47 Novalis (1929): Kunstfragmente. In: Novalis: Fragmente. Hrsg. v. Ernst Kamnitzer. Dresden: Wolfgang Jess. 589.
48 Ebd. 664.
49 Christensen, Inger: Alles W ö rter. In: ebd. (1999): Der Geheimniszustand und das » Gedicht vom Tod « . Essays. Hrsg. v. Michael Krüger. München/Wien: Carl Hanser Essays. 57-69. 57.
50 Novalis (1997): Gedichte / Die Lehrlinge zu Sais. Hrsg. v. Johannes Mahr. Reclam Verlag. Stuttgart 1984. Bibliographisch ergänzte Ausgabe. 61 - 93. 61.
51 Kittler, Friedrich (1987): Aufschreibesysteme 1800, 1900. 2. erw. Aufl. München: Fink. 91. Zit. n. Stopka (Anm. 14), 58.
52 Ein ikonisches Werk diesbezüglich stellt Blumenbergs Die Lesbarkeit der Welt dar: Blumenberg (Anm. 44).
53 Ebd. 19.
54 Gracián, Baltasar (1657): El Mundo descifrado. In: El Critic ó n. Bd. 3/4, 118. Zit. n. Blumenberg (Anm. 44), 111f.
55 Zur Bedeutung der Hieroglyphe als göttliche Chiffre vgl. Benjamin, Walter: Der Ursprung des deutschen Trauerspiels. In: Ebd. (Anm. 4), 345-348.
56 In poetischer Anlehnung dazu soll der Schriftsteller Ephraim Kishon angeblich gesagt haben: „Die Frauenseele ist für mich ein offenes Buch - geschrieben in einer unverständlichen Sprache.“
57 Novalis: Kunstfragmente (Anm. 47), 664.
58 Ebd. 607.
59 Stopka (Anm. 14), 23.
60 Novalis: Gedichte. Die Lehrlinge zu Sais (Anm. 50), 61f.
61 Fromm, Wilmar (2006): An den Grenzen der Sprache. Ü ber das Sagbare und das Unsagbare in Literatur und Ä sthetik der Aufkl ä rung, der Romantik und der Moderne. Freiburg i. Br./Berlin: Rombach. 362.
62 Ebd. 364.
63 Blumenberg (Anm. 44), 18.
64 Vgl. Novalis (2004): Heinrich von Ofterdingen. Bibliographisch ergänzte Ausgabe. Stuttgart: Reclam. 37.
65 Kaléko, Mascha: Gesucht: Ein Irgendwo von dazumal In: Ebd. (2010[1958]): Verse für Zeitgenossen. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt. 98f.
66 Vgl. „Lesen“: „Ursprunglich in der Bedeutung ‹aufsammeln›, ‹auflesen›, danach durch Bedeutungsentlehnung aus dem lateinischen legere in der dominanten Bedeutung von ‹den Schriftzeichen folgen›.“ Kluge, Friedrich (2011): Etymologisches W ö rterbuch der deutschen Sprache. Berlin: De Gruyter. 571.
67 Vgl. Kiesel, Helmuth (2004): Geschichte der literarischen Moderne: Sprache, Ä sthetik, Dichtung im zwanzigsten Jahrhundert. München: C.H. Beck. 199.
68 Pessoa, Fernando (2008): Alberto Caeiro. Poesia - Poesie. Frankfurt a.M.: Fischer. XXXI. 67.
69 Bucay, Jorge (2011): Drei Fragen. Übers. v. Stephanie von Harrach. Frankfurt a.M.: Fischer. 122.
70 Wagner, Monika (2001): Das Material der Kunst: Eine andere Geschichte der Moderne. München: C. H. Beck. 174.
71 Novalis: Gedichte. Die Lehrlinge zu Sais (Anm. 50), 61f.
72 „Die Frühromantiker verfluchte die Sprache noch nicht und wagte auch noch nicht, ohne Sprachglauben zu dichten.“ Noble (Anm. 3), 19.
73 Büchner, Georg (2002): Lenz [ein Fragment]. Der Hessische Landbote. Stuttgart: Reclam. 4.
74 Novalis: Heinrich von Ofterdingen (Anm. 64), 9.
75 Jacobsen, Jens Peter (2011[1880]): Niels Lyhne, die Geschichte einer Jugend. Hamburg: tredition. 157.
76 Hollis, James R. (1970): Harold Pinter: The Poetics of Silence. Carbondale: Southern Illinois University Press. 112.
77 Vgl. Noble (Anm. 3), 19.
78 Novalis: Kunstfragmente (Anm. 47), 638f.
79 Novalis: Kunstfragmente (Anm. 47), 664.
80 Nietzsche, Friedrich (1999[1873]): Ü ber Wahrheit und L ü ge im au ß ermoralischen Sinne. In: Nachgelassene Schriften 1870- 1873. Reihe: Friedrich Nietzsche: S ä mtliche Werke in 15 B ä nden. Hrsg. v. Giorgio Colli u. Mazzino Montinari. München: Deutscher Taschenbuchverlag. Bd.1, 873-890. 878.
81 Vgl. Kiesel (Anm. 67), 183.
82 Vgl. Noble (Anm. 3), 19.
83 Vgl. Ebd. 17.
84 Vgl. Kiesel (Anm. 67),181.
85 Nietzsche (Anm. 80), 879.
86 Ebd. 880.
87 Ebd. 880f.
88 Mauthner, Fritz (1923): Beitr ä ge zu einer Kritik der Sprache: Erster Band. Zur Sprache und zur Psychologie. 3., um Zusätze vermehrte Aufl. Leipzig: Felix Meiner. 1.
89 Brög, Hans et al. (1977): Konkrete Kunst - konkrete Poesie. Programmatik, Theorie, Didaktik, Kritik: kunstwissenschaftliche, literaturdidaktische und theologische Beitr ä ge aus einem interdisziplin ä ren Seminar. Kastellaun: Aloys Henn. 26. Zit. n. Weiss, Christina (1984): Seh-Texte. Zirndorf: Verlag für moderne Kunst. 128.
90 Stopka (Anm. 14), 17.
91 Ebd. 15.
92 Kafka, Franz (1958): Briefe 1902-1924. Frankfurt a.M.: Fischer. 9. Zit. n. Noble (Anm. 3), 35.
93 Blumenberg (Anm. 44), 35.
94 Ebd. 17.
95 Christensen (Anm. 49), 22.
96 Noble (Anm. 3), 64.
97 Celan, Paul (1958): „ Ansprache anl äß lich der Entgegennahme des Literaturpreises der freien Hansestadt Bremen “. In: Die Neue Rundschau, Bd. 69. Zit n. Noble (Anm. 3), 65.
98 Baudrillard, Jean (1991[1976]): Der symbolische Tausch und der Tod. München: Matthes & Seitz. 113f. zit. n. Liede (Anm. 37), VI.
99 Pessoa (Anm. 68), XLV, 83.
100 Vgl. Arnold, Heinz Ludwig (Hg.) (1997): Visuelle Poesie. Zeitschrift für Literatur. Sonderband. München: Edition Text + Kritik. 63.
101 Christensen (Anm. 49), 22.
102 Wie beispielsweise in Phaidon oder Der Staat; insbesondere im 10. Buch.
103 Vgl. z.B. Libera, Alain de (2005): Der Universalienstreit: von Platon bis zum Ende des Mittelalters. München: Fink Verlag. Oder: Wöhler, Hans-Ulrich (1992-1994): Texte zum Universalienstreit. 2. Bd. Übers. u. hrsg. v. ebd. Berlin: Akademie- Verlag.
104 Nietzsche (Anm. 80), 880.
105 Noble (Anm. 3), 9.
106 Serres, Michel: Der Hermaphrodit, übers. von Reinhard Kaiser. Suhrkamp Verlag. Frankfurt A.M.. Erste Auflage 1989. 49-62. 55.
107 Rilke, Rainer Maria (1996): Werke. Kommentierte Ausgabe, 4 Bände hrsg. von Manfred Engel, Ulrich Fülleborn, Dorothea Lauterbach, Horst Nalewski u. August Stahl. Frankfurt a.M./Leipzig: Insel. Band 1, 476-479. 477f.
108 Die unterschiedlichen Darstellungskompetenzen von Sprache und Bild beschreibt bereits 1766 Gotthold Ephraim Lessing in seinem Aufsatz Laokoon.
109 Benjamin, Walter (2010[1940]): Ü ber den Begriff der Geschichte. In: Texte zur Theorie der Kulturwissenschaft. Hrsg. v. Roland Borgards. Stuttgart: Reclam. 145-158. 151.
110 Vgl. Ebd. 148.
111 Noble (Anm. 3), 10.
112 Kohm, Andreas (2013): -sda. Ü ber das -hauchen und -tauchen von Dingen in Lufth ü llen. In: Zanetti, Sandro (Hg.): Wortdinge/Words as Things/Mots-choses. Reihe: Figurationen. Gender - Literatur - Kultur (Zeitschrift). 2013/2. 94-100. 96.
113 Hofmannsthal, Hugo von: Ein Brief. In: Ebd (1992 1903 ): S ä mtliche Werke, kritische Ausgabe in 38. B ä nden. Hrsg. von Rudolf Hirsch, Christoph Perels, Heinz Rölleke. Frankfurt a.M.: Fischer. 45-55. 48f.
114 Veröffentlicht wurde er am 18. Oktober 1902 in der Berliner Zeitschrift Der Tag; vgl. Günther, Timo (2004): Hofmannsthal: Ein Brief. München: Wilhelm Fink Verlag. 9.
115 wie z.B. „Meer auftauchen“ (vgl. Hofmannsthal (Anm. 114), 45), „Narziss“ (Ebd. 47), „Regenbogen“ (ebd. 48), „modrige Pilze“ (ebd. 49), „zuströmende Begriffe“ (ebd. 49), „Rost“ (ebd. 49), „Wasserkünste“ (ebd. 50), „Dasein fließt“ (ebd. 50), „Flut des göttlichen Gefühls“ (ebd. 50), „sinkende Sonne“ (ebd. 51), „Fluidum (ebd. 51), „Gießkanne“ (ebd. 51), „Schwimmkäfer“ (ebd. 51), „Spiegel des Wassers“ (ebd. 51), „Stauung“ (ebd. 52), „morsche Bretter“ (ebd. 53), „Quelle“ (ebd. 53), etc.
116 Vgl. Ebd. 48.
117 Vgl. Ebd. 50.
118 Fried, Erich: F ü gungen. In: ebd. (1995): Gedichte. München: Dtv. 85.
119 Hofmannsthal (Anm. 114), 48f.
120 Vgl. Ebd. 49.
121 Vgl. Ebd.
122 Vgl. Ebd. 53.
123 Vgl. Hofmannsthal (1992), 49.
124 Vgl. Ebd. 50.
125 Vgl. Ebd. 49.
126 Vgl. Ebd.
127 Schnitzler, Arthur (1932): Gedanken ü ber Kunst. Aus dem Nachla ß. In: Die Neue Rundschau, Bd. 43. 37f. Zit. n. Noble (Anm. 3), 33.
128 Vgl. Hofmannsthal (Anm. 114), 49.
129 Vgl. Hofmannsthal (Anm. 114), 51f.
130 Freud, Sigmund (1930): Das Unbehagen in der Kultur. Wien: Internationaler Psychoanalytischer Verlag. 6.
131 Pfister, Jonas (Hg.) (2011): Texte zur Sprachphilosophie. Stuttgart: Reclam. 109.
132 Musil, Robert: Die Verwirrungen des Z ö glings T ö rle ß (1906). In: Ebd. (2000): Gesammelte Werke. Hrsg. v. Adolf Frisé. Bd. 2. Reinbek bei Hamburg. 7-140. 7. Zit. n. Biere, Florentine (2010): Unbekanntes, f ü r das man als erster Worte findet: Robert Musils Novellentheorie. In: Schneider et al. (Anm. 10), 53.
133 Vgl. Hofmannsthal (Anm. 114), 48.
134 Die Br ü ckenmetaphorik stellt besonders im Bezug auf Grenzüberschreitungen ein prominentes Sinnbild dar. Vgl. z.B. Kiening (Anm. 9), 7. Oder Noble (Anm. 3), 17.
135 Nietzsche, Friedrich: Der Genesende. In: ebd. (2000 1884 ): Also Sprach Zarathustra. Ein Buch für Alle und Keinen. Zürich: Manesse. III.2, 305.
136 Vgl. Hofmannsthal (Anm. 114), 48.
137 Saussure, Ferdinand de (2001 1931 ): Grundfragen der allgemeinen Sprachwissenschaft. 3. Aufl. Hrsg. v. Charles Bally u. Albert Sechehaye. Berlin/New York: Walter de Gruyter. 78.
138 Vgl. Hofmannsthal (Anm. 114), 51.
139 Vgl. Ebd. 59.
140 Rilke, Rainer Maria (2011): Die sch ö nsten Gedichte. Berlin: Insel Verlag. 48.
141 Pessoa (Anm. 68), 145.
142 Günther (Anm.115), 31.
143 Alt, Peter- André (1985): Doppelte Schrift, Unterbrechung und Grenze. Franz Kafkas Poetik des Unsagbaren im Kontext der Sprachskepsis um 1900. In: Jahrbuch der deutschen Schillergesellschaft 29. S. 457. Zit n. Habermann (Anm. 5), 51.
144 Noble (Anm. 3), 18.
145 Wehle, Winfried (Hg.) (2010): 20. Jahrhundert, Lyrik. Tübingen: Stauffenburg. 66.
146 Hugo Ball (1992): Die Flucht aus der Zeit. Hrsg. v. Berndt Echte. Zürich: Limmat. Zit. n. Liede (Anm. 37), 205.
147 Stopka (Anm. 14), 225.
148 Marinetti, Filippo T. (1909): Gr ü ndung und Manifest des Futurismus. In: Asholt, Wolfgang / Fähnders, Walter (Hg.) (2005): Manifeste und Proklamationen der europ ä ischen Avantgarde (1909-1938). Stuttgart/Weimar: J.B. Metzler. 3-7. 5.
149 Weiss (Anm. 90), 41.
150 Vgl. Ebd. 47.
151 Noble (Anm. 3), 65.
152 Ebd. 31.
153 Vgl. Kircher, Hartmut / Klanska, Maria / Kleinschmidt, Erich (Hrsg.) (2002): Avantgarden in Ost und West: Literatur, Musik und bildende Kunst um 1900. Köln: Böhlau. 122.
154 Mallarmé, Stéphane: Ein W ü rfelwurf niemals ausl ö schen wird den Zufall. Gedicht. In: Ebd. (1984 1897 ): S ä mtliche Gedichte. Hrsg. u. übers. v. Carl Fischer. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft. 155-198.
155 Vgl. Mon, Franz: zur poesie der fl ä che. In: Gomringer Eugen (Hg.) (2001): konkrete poesie. Stuttgart: Reclam. 169-176. 169.
156 Pessoa (Anm. 68), XLVII, 87f.
157 Ohmer (Anm. 36), 9.
158 Vgl. Mon, Franz: zur poesie der fl ä che. In: Gomringer (Anm. 156), 169-176, 170.
159 Vgl. Noble (Anm. 3), 59.
160 Ebd. 13.
161 Ebd. 64.
162 Müller-Wille, Klaus (2011): Laboratorien von Sprache und Schrift? Experimentelle Verfahren in Texten des schwedischen Konkretismus. In: Bies, Michael / Gamper, Michael (Hg.) (2011): » Es ist ein Laboratorium, ein Laboratorium f ü r Worte « . Experiment und Literatur III, 1890 - 2010. Serie: Experiment und Literatur. Göttingen: Wallstein. 383-408. 386.
163 Ohmer (Anm. 36), 21f.
164 Noble (Anm. 3), 68.
165 Breton, André : Erstes Manifest des Surrealismus (1924). In: Ebd. (1996): Die Manifeste des Surrealismus. 9. Aufl. Übers. v. Ruth Henry. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt. 9-44. 12.
166 Wunberg, Gotthard (2000): Die Wiener Moderne. Literatur, Kunst und Musik zwischen 1890 und 1910. Stuttgart: Reclam. 425, zit. n. Fähnders, Walter (2010): Avantgarde und Moderne 1890-1933. Lehrbuch Germanistik. 2. akt. u. erw. Aufl. Stuttgart: J.B. Metzler. 81.
167 Picasso zit. n. Rotzler, Willy (1977): Konstruktive Konzepte. Zürich: ABC. 18.
168 Liede (Anm. 37), 114.
169 Diese Thematik streift Hartung ansatzweise; Hartung, Harald (1975): Experimentelle Literatur und konkrete Poesie. Göttingen: Vanderhoeck & Ruprecht. 13.
170 Ebd.
171 Ball (Anm. 147). Zit. n. Liede (Anm. 37), 205.
172 Vgl. Schmidt-Bergmann, Hansgeorg (1993): Futurismus. Geschichte, Ä sthetik, Dokumente. Reinbek: Rowohlt. 9.
173 Vgl. Mauthner (Anm. 89), 1.
174 Marinetti: Gr ü ndung und Manifest des Futurismus. In: Asholt/Fähnders (Anm. 149), 4.
175 Ebd.
176 Ebd. 5.
177 Breton, André (1920): Dada-Schlittschuhlauf 1920. In: Dada, eine literarische Dokumentation. 36. Zit. n. Szymańska, Magdalena. 2009. Dada und die Wiener Gruppe. Hamburg: Diplomica Verlag. 40.
178 Vgl. Marinetti: Gr ü ndung und Manifest des Futurismus. In: Asholt/Fähnders (Anm. 149), 24f.
179 Vgl. Best, Otto F. / Schmitt, Hans-Jürgen: Einleitung. In: Ebd. (Anm. 18), 9-28, 11.
180 Hugo Ball: Manifest. In: Riha/Wende-Hohenberger (Anm. 1), 30.
181 Ebd.
182 Flusser, Vilém (1994): Gesten Versuch einer Ph ä nomenologie. Frankfurt a.M.: Fischer. 44.
183 Morgenstern, Christian: Das grosse Lalula. In: Ebd. (2000 1905 ): Die Galgenlieder. Zürich: Haffmans. 21. Nebenbei deutet sich in der Lautform des Titels eine Verbindung zum sanskritischen Begriff „Līlā“ an, unter dem das „göttliche Spiel“ verstanden wird, dass in sich das gesamte Konzept des Universum vereinigt und damit besonders den schöpferischen Aspekt des Spiels hervorhebt. Vgl. „Līlā“: Keller, Christa / Schmidt, Markus (2014): Spirituelle Philosophie: Wissen der Orden in Asien & Europa. Isaistempler Edition. Norderstedt: Books on Demand. 160.
184 Ball, Hugo (Anm. 147) 105. Zit. n. Kiesel (Anm. 67), 208.
185 Kittler (Anm. 51), 91. Zit. n. Stopka (Anm. 14), 58.
186 Vgl. Andersen, Hans Christian: Das stumme Buch. In: ebd. (1974): S ä mtliche M ä rchen in zwei B ä nden. Bd. 1/2. Hrsg v. Erling Nielsen. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft. 505-507. 505.
187 Vgl. Andersen (Anm. 187), 506.
188 Bichsel, Peter (1990 1969 ): Ein Tisch ist ein Tisch. In: Ebd. Kindergeschichten. Frankfurt a.M.: Luchterhand. 18-25.
189 Simmel, Georg: Die Gro ß st ä dte und das Geistesleben, Vortrag (190 3). In: Ebd. (1995): Gesamtausgabe in zw ö lf B ä nden. Bd. 7. Hrsg. v. Otthein Rammstedt. Frankfurt a.M.: Suhrkamp. 116-131. 116.
190 Ball (Anm. 147), 105f.
191 Ball (Anm. 147), 106.
192 Marinetti : Gr ü ndung und Manifest des Futurismus. In: Asholt/Fähnders (Anm. 149), 5.
193 Steiner, George: R ü ckzug aus dem Wort. In: Ebd. (1969): Sprache und Schweigen. Essays ü ber Sprache, Literatur und das Unmenschliche. Frankfurt a.M.: Suhrkamp. 44-73. 44.
194 Stopka (Anm. 14), 247.
195 Ebd. 244.
196 Höck, Wilhelm (1969): Formen heutiger Lyrik. Verse am Rande des Verstummens. München: Paul List. 116.
197 Mon, Franz (1970): Texte ü ber Texte. Neuwied/Berlin: Luchterhand. 94. Zit. nach Noble (Anm. 3), 66.
198 Vgl. Höck (Anm.197), 116.
199 Höck (Anm.197), 116f.
200 Ebd. 114.
201 Riha/Wende-Hohenberger (Anm. 1), 30f.
202 Vgl. Stopka (Anm. 14), 243.
203 Ebd. 244.
204 Kiesel (Anm. 67), 209.
205 Vgl. Blumenberg (Anm. 44), 60.
206 Vgl. Hofmannsthal (Anm. 114), 52.
207 Pessoa (Anm. 68), II, 15.
208 Ebd. XXIV, 57.
209 Marinetti: Gr ü ndung und Manifest des Futurismus. In: Asholt/Fähnders (Anm. 149), 222.
210 Kiesel (Anm. 67), 203.
211 Diderot: Brief ü ber den Blinden, zum Gebrauch f ü r die Sehenden (1749). In: Ebd. (2013): Philosophische Schriften. Hrsg. v. Alexander Becker. Frankfurt a.M.: Suhrkamp. 61.
212 Hugo Ball: Manifest. In: Riha/Wende-Hohenberger (Anm. 1), 30.
213 Nietzsche (Anm. 80), 877.
214 Breton: Erstes Manifest des Surrealismus (Anm. 166), 15.
215 Vgl. Ebd.
216 Ebd. 15f.
217 Vgl. Marinetti: Gr ü ndung und Manifest des Futurismus. In: Asholt/Fähnders (Anm. 149), 4.
218 Vgl. Hofmannsthal (Anm. 114), 52.
219 Vgl. Weiss (Anm. 90), 41.
220 Breton: Erstes Manifest des Surrealismus (Anm. 166), 25.
221 Schamoni, Rocko (2011): Sternstunden der Bedeutungslosigkeit. Roman. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt. 65f.
222 Vgl. Breton: Erstes Manifest des Surrealismus (Anm. 166), 18.
223 Vgl. Ebd.
224 Morgenstern (Anm. 184), 16.
225 Zitiert nach der deutschen Übersetzung von Knut Hamsuns Roman „Hunger“ (München 1921). In: Breton: Erstes Manifest des Surrealismus (Anm. 166), 24.
226 Zeller, Christoph: Hypermedium Literatur. Georg Kleins Poetologie. In: Gansel, Carsten / Hermann, Elisabeth (Hg.) (2013): Deutschsprachige Gegenwartsliteratur und Medien. Bd. 10. Entwicklungen der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur nach 1989. Göttingen: V&R unipress. 231-248. 233.
227 Zeller (Anm. 226), 234.
228 Augustinus, Aurelius (2012): Die Bekenntnisse des heiligen Augustinus. Übers. v. Otto F. Lachmann. Hamburg: tredition. 225.
229 Zeller (Anm. 226), 236.
230 Breton: Erstes Manifest des Surrealismus (Anm. 166), 16.
231 Vgl. Zeller (Anm. 226), 233.
232 Seel, Martin (2000): Ä sthetik des Erscheinens. Lizenzausgabe München/Wien: Carl Hanser. 241.
233 Stopka (Anm. 14), 12.
234 Vgl. Weiss (Anm. 90), 56.
235 Auf die Gründe der konsequenten Kleinschreibung bei konkreten Dichtern wird in Abs. 5.2.2 eingegangen.
236 Gomringer Eugen (1969): worte sind schatten. Die Konstellationen 1951-1968. Hrsg. v. Helmut Heißenbüttel. Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt. 54.
237 Weiss (Anm. 90), 52.
238 Gomringer (Anm. 156), 159.
239 Vgl. Winter, Astrid (2006): Metamorphosen des Wortes. Der Medienwechsel im Schaffen Ji ř í Kol á ř s. Göttingen: Wallstein.
28.
240 Schnauber, Cornelius (Hg.) (1989): Deine Tr ä ume - Mein Gedicht, Eugen Gomringer und die konkrete Poesie. Nördlingen: Greno. 17.
241 Wiese, Benno von: Die deutsche Lyrik der Gegenwart. In: Wolfhang Kayser (Hg.) (1953): Deutsche Literatur unserer Zeit. Göttingen: Vanderhoeck & Ruprecht. 32-57. 36. Zit. n. Noble (Anm. 3), 55.
242 Gomringer (Anm. 156), 161.
243 Mon, Franz: zur poesie der fl ä che. In: Gomringer (Anm. 156), 169-176, 167.
244 Gomringer (Anm. 156), 158.
245 Ebd. 54.
246 Vgl. Weiss (Anm. 90), 52.
247 Vgl. Schmieder, Doris / Rückert, Gerhard (1989): Lieber Herr Gomringer. In: Schnauber (Anm. 240), 102-115, 103.
248 Gomringer, Eugen In: Schmieder, Doris / Rückert, Gerhard (1989): Lieber Herr Gomringer. In: Schnauber, (Anm. 240), 102-115, 103.
249 Vgl. Weiss (Anm. 90), 76.
250 Vgl. Ebd.
251 Vgl. Ebd. 78.
252 Hartung (Anm. 170), 41
253 Vgl. Ebd. 44.
254 Gomringer (Anm. 156), 160.
255 Arnold (Anm. 101), 103.
256 Schneider, Sabine / Villiger, Christian: Einleitung: Das Unsagbare sagen. In: Schneider (Anm. 10), 7-19. 8.
257 Vgl. Müller Nielaba, Daniel: Zur Sagbarkeit der Grenze. In: Schneider et al. (Anm. 10). 19-30. 21.
258 Gomringer (Anm. 236), 54.
259 Vgl. Habermann (Anm. 5), 33.
260 Hartung (Anm. 170), 41.
261 Frisch, Max: Tagebuch 1946-1949. In: Ebd. (1976): Gesammelte Werke in zeitlicher Folge. Hrsg. v. Hans Mayer. Frankfurt a.M.: Suhrkamp. 378.
262 Gappmayr, Heinz: Was ist konkrete Poesie? In: Ebd. (1971): Konkrete Poesie. Bd. I (=Text und Kritik 25). 2. Aufl. München: Willing. 5-9. 6. Zit. n. Winter (Anm. 239), 28.
263 Apollinaire, Guillaume (1918): Calligrammes. Po è mes de la paix et de la guerre (1913-1916). Nouvelle Revue Française.
264 Ebd. 62.
265 Bremer, Claus (1983): Farbe bekennen. Mein Weg durch die konkrete Poesie. Ein Essay. Zürich: orte-Verlag. 46f.
266 Vgl. Gomringer (Anm. 156), 159.
267 Vgl. Ebd. 277.
268 Mallarmé (Anm. 155).
269 Rilke, Rainer Maria: Die Sonette an Orpheus. Teil 1, Sonett XI. In: Ebd. (1951): Duineser Elegien. Die Sonette an Orpheus. Zürich: Manesse. 187.
270 Gomringer (Anm. 156), 160.
271 Mon, Franz (1964): Sehg ä nge. Berlin. 24. Zit. n. Ohmer (Anm. 36), 22.
272 Vgl. Mon, Franz: zur poesie der fl ä che. In: Gomringer (Anm. 156), 169-176, 169.
273 Vgl. Kurz, Paul Konrad (1973): Ü ber moderne Literatur, IV. Standorte und Deutungen. Frankfurt a.M.: Knecht. 251.
274 Gomringer (Anm. 156), 160.
275 Arnaud, Noël: Pr é face. In: Oulipo (1997): La Biblioth è que oulipienne. Paris: Seghers. Bd. 1. II.
276 Mon, Franz (Hg.) (1960): Movens: Dokumente und Analysen zur Dichtung, bildenden Kunst, Musik, Architektur. Wiebaden: Limes. 111. Zit. n. Hartung (Anm. 170), 39.
277 Vgl. Gomringer (Anm. 156), 157.
278 Ebd. 159.
279 Hartung (Anm. 170), 44.
280 Noble (Anm. 3), 139.
281 Kandinsky, Wassily (1963): Essay ü ber Kunst und K ü nstler. 2. Aufl. Hrsg. v. Max Bill. Bern: Benteli. 29. Zit. n. Weiss (Anm. 90), 42.
282 Weiss (Anm. 90), 86.
283 Noble (Anm. 3), 139.
284 Ebd. 142.
285 Ebd.
286 Garzetti. Sascha (2012): Ges pr ä ch in der Manteltasche. Gedichte. Eggingen: Edition Isele. 40.
287 Vgl. Gomringer (Anm. 156), 156.
288 Hartung (Anm. 170), 39f.
289 Vgl. Hofmannsthal (Anm. 114), 49.
290 Mon, Franz: zur poesie der fl ä che. In: Gomringer (Anm. 156), 169-176, 175.
291 Ohmer (Anm. 36), 203.
292 Strässle, Thomas / Kleinschmidt, Christoph / Mobs, Johannes (2013): Das Zusammenspiel der Materialien in den K ü nsten : Theorien - Praktiken - Perspektiven. Serie: Image. Bd. 47. Bielefeld: Transcript. 18.
293 Vgl. Ohmer (Anm. 36), 203.
294 Vgl. Mon, Franz: zur poesie der fl ä che. In: Gomringer (Anm. 156), 169-176, 174.
295 Vgl. Müller-Wille (2013): Prophetische Harfen, analphabetischer Illettrismus und Gastrophonie Asger Jorn und die Dinglichkeit der Sprache. In: Zanetti (Anm. 113), 101-115. 110.
296 Gomringer (Anm. 156), 157.
297 Marinetti: Gr ü ndung und Manifest des Futurismus. In: Asholt/Fähnders (Anm. 149), 24.
298 Vgl. Kircher, Hartmut: Guillaume Apollinaire - Ein Avantgardist nicht ohne Tradition. In: Ebd. (Anm. 154), 111-130. 122.
299 Vgl. Hocke (Anm. 2), 295.
300 Vgl. Marinetti: Gr ü ndung und Manifest des Futurismus. In: Asholt/Fähnders (Anm. 149), 25.
301 Vgl. Ebd.
302 Gomringer (Anm. 156), 156.
303 Vgl. Arnold (Anm. 101), 20.
304 Ebd.
305 Ebd.
306 Vgl. Bremer (Anm. 265), 35. (tschech. Benachrichtigung 1964) 27 Hein Ga alle (1962)
307 Vgl. Bremer (Anm. 265), 34. Oder auch bei Mayer Mayer, Hansjörg (2014): Typo. Druckprozess-Bilder und typografische Arbeiten aus den 50er und 60er Jahren. Köln: Walther König. 80 & 173.
308 Bremer (Anm. 265), 35.
309 Malewitsch, Kasimir (1962): Suprematismus - Die gegenstandlose Welt. Köln: M. Dumont Schauberg. 9. Zit. n. Weiss (Anm. 90), 45.
310 Walton, Madleine: Secret Piece. In: Boglione, Riccardo (Hg.) (2014): Crux Desperationis. Zeitschrift. Bd. 5. Montevideo: Gegen. 18.
311 Solt, Mary Ellen (1970): Concrete Poetry. A World View. Bloomington: Indiana University Press. 7. Zit. n. Weiss (Anm. 90), 123.
312 Vgl. Weiss (Anm. 90), 48.
313 Höck (Anm. 197), 137f.
314 Tzara, Tristan In: Mon, Franz / Neidel, Heinz (Hg.) (1968): prinzip collage. Neuwied/Berlin: Luchterhand. 50.
315 Vgl. Strässle, Thomas (2011): Traduktionslabor. Oskar Pastiors oulipotisches Ü bersetzungsexperiment. In: Bies / Gamper (Anm. 163), 432-445, 433.
316 Flessner, Berndt: Wenn Algorithmen Dichter werden. In: Neue Zürcher Zeitung (31.03.2016), 37.
317 Hausendorf, Heiko / Kesselheim, Wolfgang (2013): K ö nnen R ä ume Texte sein? Linguistische Ü berlegungen zur Unterscheidung von Lesbarkeits- und Benutzbarkeitshinweisen. Arbeitspapiere des UFSP Sprache und Raum (SpuR). 2013/2. Zürich: Universität Zürich. 8.
318 Ebd.
319 Vgl. z.B. McNeill, David (1992): Hand and Mind - What Gestures Reveal about Thought. Chicago: Chicago University Press. Oder: Kendon, Adam (1994): Do Gestures Communicate? A Review. In: Reasearch on Language and Social Interaction 27.3. 175-200.
- Arbeit zitieren
- Mike Wunderlin (Autor:in), 2016, Die Befreiung der Sprache durch programmatische und methodische Liquidierung in den literarischen Avantgarden des 20. Jahrhunderts, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/342580
Kostenlos Autor werden


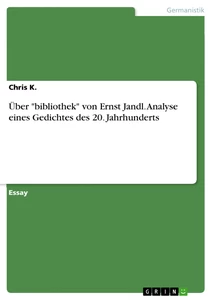













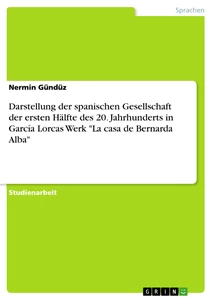





Kommentare