Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Danksagungen/Widmungen
Abstract
Einleitung
Frage zum Thema
I. Theorie zur Angst
1. Was ist Angst?
1.1. Das Phänomen der Angst
1.1.1. Gesunde und pathologische Aspekte der Angst
1.2. Formen von Angststörung
1.2.1 Angststörungen bei Erwachsenen
1.2.2. Formen und Diagnosekriterien von Angststörungen bei Kindern
1.2.3. Zahlen und Fakten zu Angststörungen bei Kindern: Epidemiologie, Komorbidität
1.3. Erklärungsmodelle für Angststörungen:
1.3.1. Neurobiologische Theorien von Angststörungen
1.3.2. Lerntheorien
1.3.3. Die Bindungstheorie
1.3.4. Hypothese Panksepp – Gray
1.3.5. Psychodynamische Theorien
1.3.6. Angstverständnis nach dem individualpsychologischen Ansatz
1.3.7.Angstverständnis nach dem Systemischen Ansatz
2 Therapie der Angststörung
2.1. Psychodynamischer Ansatz
2.1.1. Psychodynamische Therapie bei Erwachsenen
2.1.2. Angstbehandlung nach dem verhaltenstherapeutischen Ansatz
3. Angststörungen bei Kindern aus der Sicht des Psychodramas
3.1. Genetische Dispositionen und daraus resultierende Rollen
3.1.1. Selbstverstärkende Rückkoppelung
3.1.2. Psychodramatisches Entwicklungsmodell
3.1.3. Entwicklungsgeschichtliche Aspekte der Angst
3.1.4. Angststörungen als Folge unsicherer Bindungsmuster
3.1.5. Angststörung als Ausdruck einer Störung in der Autonomieentwicklung
3.1.6. Perfekte Ziele begünstigen Angststörungen
3.1.7. Zusammenfassung der Entwicklung der Angststörung bei Kindern aus psychodramatischer Sicht
4. Psychodramatherapie
4.1. Ziele der Psychodramatherapie
4.1.1 Die Wiederherstellung und/oder Verbesserung des spontanen, schöpferischen Handelns
4.1.2. Förderung der Theory of Mind-Kompetenzen
4.1.3. Wahres zweite Mal – Selbsterkenntnis perfekter Ziele – eingeklemmtes Leben zu befreien ist Therapieziel im Psychodrama
4.2 Instrumente des Psychodramas
4.2.1 Die Bühne
4.2.2. Der/die Protagonist/in
4.2.3.Der/die Psychodramaleiter/in
4.2.4. Die MitspielerInnen oder Hilfs-Ichs
4.2.5. Die Gruppe
4.3. Psychodramatische Kindertherapie
4.3.1 Kinder-Bühne – 3-Bühnen Modell
4.4. Die Behandlung von Angststörungen aus psychodramatischer Sicht
4.4.1. Szenische Arbeit bei Angststörungen nach Karl Grimmer – Dialoge mit der Angst
4.4.2. Strukturbezogenes Vorgehen nach Michael Schacht
II. PRAXISTEIL
1. Vorstellung des Falles:
1.1. Erster Eindruck
1.2. Darstellung der Symptomatik und deren Beginn/Ursprung – Urszene
1.3. Sozialer Kontext
1.4. Familiärer Kontext
2. Hinweise aus dem Erstgespräch
2.1.Perfektes Annäherungsziel
2.2. Autonomie von A. – Überregulierung
2.3. Hinweis auf Ängstlichkeit der Mutter
2.4. Hinweis zu unsicher vermeidender Bindung der Mutter
3. Theoretische Überlegung zum Fall - Ursachen aus psychodramatischen Sicht
3.1. Genetische Disposition von A.
3.2. Ängstlichkeit als imitiertes Verhalten von A.
3.3. Ängstlichkeit als Folge unsicher ambivalenter Bindung von A.
3.4. Ängstlichkeit als Ausdruck einer gestörten Autonomieentwicklung von A.
3.5. Perfekte Ziele und Ängstlichkeit von A.
3.6. Zusammenfassung der Störungsentwicklung von A.
4. Hypothese zur genetischen Disposition von A.:
5. Strategische Vorüberlegungen für die Therapie von A.
5.1 Autonomieentwicklung
5.2 Begegnungsbühne – Schaffung der therapeutischen Beziehung
5.2.1. Beziehungsgestaltung
5.2.2. “Begegnung mit der Angst“
5.3 Erkennen des Problems durch Rekonstruktion der Lage (Symptomatik) und deren „Ur-Szene“
5.4. Stärkung auf der psychosomatischen Ebene
5.5. Nachreifung auf der soziodramatischen Ebene – Niveau 1:
5.6. Realisierung des handlungsleitenden (perfekten) Ziels auf der Spielbühne
5.7. Soziometrische Aufstellung der inneren Anteile in unterschiedlichen Szenen
5.8 Besetzung aller Rollen im „perfekten Spiel“ und Feedback der einzelnen Rollen
5.9. Festigung des Erreichten
5.10. So lassen sich im Nachhinein im Verlauf der Therapie von A. folgende Stationen erkennen:
6. Schlussfolgerung
6.1. Antwort auf Fragestellung
Literaturverzeichnis
Danksagungen/Widmungen
Es ist ein persönlicher Glücksfall, dass ich zum Fachspezifikum Psychodrama gestoßen bin. Ich habe von all meinen Lehrtherapeuten sehr viel gelernt. Stellvertretend möchte ich mich besonders bei meinem Unterstufenleiter Norbert Neuretter, bei meiner Oberstufenleiterin Hildegard Pruckner MSc, bei meiner Lehrtherapeutin für Supervision Dr. Anneliese Schigutt und bei den Vortragenden beim Upgrade Studium Dr. Michael Schacht und Dr. Klaus Ottomeyer, auf das Herzlichste bedanken.
Ein besonderer Dank gilt meinen Kindern, DI (FH) Romana), Mag. Helene, Ing. Maximilian, Valentina und Leon, die für mich in all den Jahren eine unendliche Quelle an Kraft dargestellt haben.
Es ist mir auch ein Anliegen, darauf hinzuweisen, dass ich von meinen PatientInnen bei der Ö3 Kummernummer, im Psychotherapeutischen Zentrum in Mitterdorf und in meiner Praxis gelernt habe, jeden Menschen als eigenes „Universum“ anzusehen und mit allergrößtem Respekt zu behandeln.
Abstract
In der vorliegenden Masterthese habe ich mich erst theoretisch mit dem Thema Angst beschäftigt, speziell mit kindlichen Angststörungen. Von den verschiedensten Erscheinungsformen der Angst und dessen allgemein gültigen Klassifizierungen führt die Arbeit zu den biopsychosozialen Erklärungsmodellen.
Nach den theoretischen Ansätzen der Psychotherapie bei Angststörungen vertiefe ich die Arbeit mit den Herausforderungen in der Kindertherapie bevor ich die Eckpfeiler der Psychodrama-Psychotherapie erwähne, um anschließend auf ein Praxisbeispiel näher einzugehen.
Dabei steht die Frage im Raum, inwieweit die persönliche Entwicklung und die subjektiven Bewertungen, insbesondere die „perfekten Ziele“ für die Aufarbeitung einer Angststörung von Bedeutung sind.
Im Vordergrund des Praxisbeispiels stehen soziometrische Interventionen und Psychodramaspiele, die persönliche Bewertungen und spontane Handlungen im geschützten Raum zulassen, welche vor allem die Autonomieentwicklung günstig beeinflussen.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass mit Hilfe der Psychodrama-Psychotherapie eine kindliche Angststörung innerhalb eines halben Jahres gut aufgearbeitet werden konnte.
The following work is composed for the reaching of the Master of Science. The first part is occupied with the theoretic side of the anxiety, especially the anxiety disorder of children. From the different kinds of anxiety disorder to the various classifications, tend to result in the description of the biological psychological and social models of explanation.
After the basic of the psychotherapy in case of anxiety disorder, I look accurately to the therapy of children. Then come the main parts of the “Psychodrama” psychotherapy before the practical work will be presented.
There is the question posted which role plays the personal development beside the subjective assessment, especially the “perfect aims” for rehabilitation. In the front of the practical work are the sociometric interventions and the Psychodrama interventions, which allow spontaneity in a protected room. The beneficial effect is a good development of autonomy.
Summarized can be said that with the help of “Psychodrama” psychotherapy an anxiety disorder of a child can be removed within half of a year.
Stichworte für die Bibliothek:
Angst, Psychodrama, Kindertherapie, Strukturbezogenes Vorgehen
Einleitung
Jede Psychotherapierichtung hat ihre eigene Theorie zum Thema Angst. Dabei fällt auf, dass bei sämtlichen Therapierichtungen das Augenmerk auf die Entwicklung des Menschen gelegt wird.
In dieser Arbeit versuche ich die Psychodrama-Theorie mit der Praxis zu verschränken und stelle mir die Frage, wie wichtig es ist den einzelnen Entwicklungsstufen Aufmerksamkeit zu schenken. Weiters möchte ich untersuchen, inwieweit das „perfekte Ziel“ bei der Angststörung eine Rolle spielt.
Beginnend mit dem Phänomen der Angst, über die Beschreibung der Angsterkrankungen sowohl bei Kindern als auch Erwachsenen bis zu den Erklärungsmodellen derselben, welche das gesamt biosoziale Feld abzudecken versuchen, reicht der theoretische Bogen. Kurz werden wichtige Therapien zur Angststörung umrissen, um dann die Psychodramatherapie zu fokussieren. Schlussendlich erläutere ich das strukturbezogene Vorgehen nach Michael Schacht, bevor ich zum Praxisteil übergehe.
Mit den vorgestellten Erklärungsmodellen möchte ich einen Blick über den Tellerrand darstellen. Wie andere mit dieser Störung umgehen sehe ich teilweise als Abgrenzung zum Psychodrama und teilweise als Bestätigung.
Die verschiedenen Erscheinungsformen der Angst theoretisch zu beleuchten, ist ein wichtiges Element dieser Arbeit. Besonderes Augenmerk richte ich dabei auf psychodramatische Erklärungsmodelle und erscheint mir in diesem Zusammenhang das entwicklungspsychologische Grundwissen wertvoll, welches von Michael Schacht aus psychodramatischer Sicht erarbeitet wurde; insbesondere seine Schaffung des psychodramatischen Störungsmodells.
Die Erforschung der Autonomieentwicklung, in welcher Michael Schacht die „Unter- und Überregulierung“ näher beschreibt, ist ein weiteres wichtiges Mosaik zur Beleuchtung der Angst aus psychodramatischem Blickwinkel und auch als ergänzender Bestandteil zu sehen.
Schließlich stelle ich im Praxisteil am Beispiel einer 9jährigen Angstpatientin den Versuch der Umsetzung des theoretischen Wissens im therapeutischen Geschehen dar.
Frage zum Thema
Vorweg möchte ich einige Fragestellungen aufwerfen, auf welche ich abschließend eingehen werde.
Inwieweit ist der persönliche Stand der Entwicklung ausschlaggebend für das Auftreten einer Angststörung? Weiters möchte ich ergründen, ob die persönliche Bewertung einer Situation durch das Erleben des „perfekten Ziels“ und das Erleben der „Gegenrolle des perfekten Ziels“ (Nachspüren des Gegenübers) beeinflusst wird.
Besonderes Augenmerk lege ich auf die Gestaltung der Rollen und der damit verbundenen Botschaften. Wie wirkt sich ein Rollenwechsel, der bei dem vorgestellten 9jährigen Kind bereits möglich war, auf die gesamte Verfassung des Kindes aus?
I. Theorie zur Angst
Wenn einer keine Angst hat,
hat er keine Phantasie.
Erich Kästner
1. Was ist Angst?
Das Gefühl der Angst kennt jeder von uns. Es wird in den verschiedensten Zusammenhängen in der Literatur beschrieben. Eingangs möchte ich ein Zitat aus einem Lehrbuch für Psychologie darstellen:
„Angst (1) Allgemein: Begriff für komplexe emotionale Zustände, die von Gefühlen der Furcht und des Schreckens begleitet werden: 2) Nach S. Freud eine intensive emotionale Reaktion, die durch die vorbewusste Wahrnehmung eines Konfliktes entsteht, der ins Bewusstsein aufzusteigen droht – in diesem Sinn ist Angst ein Warnsignal“. (Philip G. Zimbardo, 1992, 505 f)
1.1. Das Phänomen der Angst
Nahezu alle Menschen kennen Angst in irgendeiner Form. In einer epidemiologischen Untersuchung wird angeführt, dass 46% einer Bevölkerungsstichprobe Angstgefühle angeben und bei 16% war die Angst symptomwertig ausgeprägt. Unter Psychotherapie suchenden Patienten wird Angst als Thema von 70% genannt und bei 20 bis 30% hat es die Bedeutung eines Symptoms (Gerd Rudolf 1981). Zu der Diagnose „Angstneurose“ führt das Symptom bei 16% von 731 Patienten der Berliner Psychotherapiestudie (idem. 1981); ähnliche Zahlen nennt Schepank aus dem Zentralinstitut Mannheim (12-23% Angstneurose bei stationär behandelten Patienten). (Schepank, cit Rudolf 1984)
Angst ist neben Freude, Trauer, Wut, Schuld und Scham eines der Grundgefühle, die den Menschen sein gesamtes Leben hindurch begleiten. In den unterschiedlichen Entwicklungsabschnitten ist sie verschieden gestaltet und mit unterschiedlichen Inhalten ausgestattet. Sie wird bewusst erlebt oder wirkt unbewusst. Angst kann ein gesundes Warnsignal vor Gefahren sein oder als unverständliches Symptom hereinbrechen.
1.1.1. Gesunde und pathologische Aspekte der Angst
Rudolf beschreibt Angsterleben wie folgt:
„Im Erleben der Angst wird das Ich angesichts einer äußeren Gefahr emotional, kognitiv und vegetativ in einen Alarmzustand versetzt. Es gilt zu prüfen, ob die eigene Sicherheit und Integrität durch den Angriff böser Objekte oder durch eine bedrohliche Situation gefährdet ist, oder nahestehende Personen (z.B. eigene Kinder) gefährdet sind oder der Verlust von Sicherheit gebenden guten Objekten oder Sicherheit gebenden Situationen droht.“ (ibid. 175)
Wenn der Mensch die Lage als gefährlich einschätzt, kann dies durch reales Handeln im Schema von Kampf oder Flucht beantwortet werden.
Bekanntlich ist es nicht immer möglich, in Angstsituationen entsprechend und zweckmäßig zu handeln. Unter Umständen wirkt Angst lähmend – es gelingt weder aktiv zu werden, noch den Rückzug anzutreten. Im Extremfall ist der Geängstigte „starr vor Angst“, was vom Phänomen her Ähnlichkeiten hat mit dem Totstellreflex bedrohter Tiere. Hierbei handelt es sich also möglicherweise um eine Art von Primitivreaktion: Jemand, der schon tot ist, kann nicht getötet oder gefressen werden.
Freilich gibt es noch eine andere Antwort auf das Erleben der Angst, als das realitätsverändernde Handeln. Ein Schläfer, der von einem Geräusch geweckt wird und sich vor Einbrechern fürchtet, kann „umdenken“ und der Katze das Geräusch zuschreiben, woraufhin er wieder einschläft und der Alarm eingestellt wird.
Es liegt auf der Hand, dass es wichtig ist, das richtige Maß an Realangst verfügbar zu haben. Das bedeutet nicht zu viel Angst zu haben, sodass diese lähmt, aber auch nicht zu wenig, so dass jemand ungewarnt in eine Risikosituation hineinläuft.
Ohne Angst wäre das menschliche Leben nicht zu der jetzigen Existenz gelangt. Damit meine ich, dass die Angst den Menschen zur Vorsicht mahnen kann um drohenden Gefahren zu entgehen.
(Vgl. Rudolf) Die Grenzen zwischen Ängstlichkeit im Bereich des Normalen und symptomwertiger Angst ist fließend. Wenn jemand durch seine ängstlichen Seiten immer stärker eingeschränkt wird, sich nicht mehr unter die Leute wagt, von allen möglichen Aktivitäten Abstand nimmt, sich aber auch zu Hause und in der eigenen Haut mehr und mehr unwohl fühlt, dann wird er seinen Zustand irgendwann als gestört erleben und sein Befinden als symptomwertige Angst definieren.
1.2. Formen von Angststörung
1.2.1 Angststörungen bei Erwachsenen
1.2.1.1 Angstanfall/Panikattacke
„Die Angst wird von einem bedrohten Selbst in einer bedrohlichen derealisierten Umgebung erlebt. Wenn sich die Angst auf den eigenen Körper projiziert, wird häufig auf das Herz projiziert und gestaltet dort das Bild der Herzangstneurose.“ (Vgl. Morschitzky, 2002, 65 )
Eine Panikstörung besteht aus wiederholten Panikattacken. Das ist so verstehbar, dass Angstanfälle nicht auf eine spezifische Situation oder auf ein spezifisches Objekt bezogen sind, sondern treten oft spontan auf. Mit einem Wort, als nicht vorhersehbar bezeichnet werden können. Die Panikattacken sind somit nicht mit besonderen Anstrengungen verbunden, auch gar nicht mit bedrohlichen Situationen.
Eine Panikattacke ist eine einzelne Episode von intensiver Angst oder Unbehaben, die abrupt beginnt und innerhalb von Minuten einen Höhepunkt erreicht und mindestens einige Minuten dauert (meistens nicht länger als eine halbe Stunde).
Zu den vegetativen Symptomen einer Panikattacke gehören Herzrasen, Herzklopfen und/oder erhöhte Herzfrequenz. Weiters können Schweißausbrüche und fein- oder grobmotorisches Zittern entstehen, welche mit der Panikattacke verbunden sind, sowie eine Mundtrockenheit.
Darüber hinaus können Symptome, die den Brust- und Bauchbereich betreffen –Atembeschwerden, Beklemmungsgefühl, Schmerzen oder Missempfindungen in der Brust und auch Übelkeit oder Missempfindungen im Magenbereich (z.B. Unruhegefühl) auftreten.
Die psychische Symptome die bei der Panikattacke hinzukommen sind Schwindel, Unsicherheit, Schwäche und Benommenheit. Bei Wahrnehmungsstörung, welche auch auftreten können, sind die Objekte unwirklich (Derealisation) oder man selbst ist weit entfernt oder „nicht wirklich hier“ (Depersonalisation). Man hat unter Umständen auch Angst vor dem Kontrollverlust, verrückt zu werden oder „auszuflippen“. Die Angst zu sterben steht auch oft im Vordergrund.
Zu den allgemeinen Symptomen zählen Hitzewallungen und Kälteschauer, sowie Gefühllosigkeit und Kribbelgefühle. (Morschitzky, 2002, 65ff)
1.2.1.2. Die Phobien
“Während im Angstanfall etwas Unbekanntes, Ängstigendes über den Patienten hereinbricht und ihn zu vernichten droht, ist die phobische Angst an eine ängstigende Situation, einen Ort, eine Tier etc. gebunden.
Während der Leidensdruck des Angstanfalls durch kaum etwas gemindert werden kann und die Patienten oft bis zur Suizidalität gequält sind, lässt es sich mit der Phobie leben: Der Verzicht auf ein nach außen gerichtetes Leben, die Konzentration auf den engeren häuslichen Bereich und die verlässliche Präsenz eines angstmindernden Begleiters bilden ein Arrangement, das u.U. zusätzlich sekundären Krankheitsgewinn bietet. (z.B. durch die Kontrolle von Familienangehörigen)“ (Morschitzky, 2002, . 65ff)
Man unterscheidet drei Arten von Phobien:
1. Soziale Phobien: diese sind hauptsächlich von der Angst kritischer sozialer Beurteilung gelenkt.
2. Die Agoraphobie wird auch als Platzangst verstanden und von Morschitzky als „multiple Situationsphobie“ bezeichnet. Unter Agoraphobie versteht man die Angst vor offenen Plätzen genauso wie die Angst in Menschenmengen, aber auch davor, sich nicht jederzeit wieder an einen sicheren Platz, wie beispielsweise nach Hause zurückziehen zu können. Dadurch wird der Bewegungsraum zunehmend eingeschränkt.
3. Die spezifischen Phobien: Diese sind eng mit bestimmten, an sich ungefährlichen Objekten und Situationen verknüpft und werden auch als isolierte Phobien bezeichnet. Dabei handelt es sich um Angst vor Tieren, Dunkelheit, bestimmten Speisen, bestimmten Anblicken und vielem anderen. Diese angstauslösenden Situationen werden von den Betroffenen, wenn immer es möglich ist, gemieden. (idem, 2002, 65ff)
1.2.1.3. Generalisierte Angststörung
„Das wesentliche Symptom einer generalisierten Angststörung ist die anhaltende, nicht auf eine bestimmte Situation beschränkte Angst. Die hauptsächlichen Symptome sind, wie auch bei anderen Angststörungen, sehr verschieden, jedoch zählen die folgenden Beschwerden meist dazu: Nervosität, Zittern, Muskelspannung, Schwitzen, Benommenheit, Herzklopfen, Schwindelgefühle, Oberbauchschmerzen.“ (Morschitzky, 2002, 67)
Historisch gesehen handelt es sich bei der generalisierten Angststörung um die Restkategorie der ehemaligen Diagnose der Angstneurose, die sich nach der Abtrennung der Panikstörung ergab. Der eigenständige und eindeutig feststellbare Charakter war lange Zeit nicht anerkannt. Allerdings geht man heute von der gesicherten Erkenntnis aus, dass es sich bei den genannten Symptomen um eine generalisierte Angststörung handelt. Unter psychoanalytischer Orientierung sprach man von Angstneurose. Diese wurde nicht ersetzt, sondern als eigene Störung beschrieben.
Die generalisierte Angststörung wird durch die neuen Diagnoseschemata präziser definiert, als dies bei der recht vagen und umfassenden Charakterisierung der Angstneurose der Fall ist, sodass eine bessere empirische Überprüfbarkeit und eine größere klinische Nützlichkeit gegeben ist. (idem, 2002, 67ff)
Laut Morschitzky besteht im medizinischen Alltag das Hauptproblem bei der Erfassung dieser Störung darin, dass die Betroffenen häufig den Arzt aufsuchen, ohne von Ängsten und Sorgen zu berichten, sondern überwiegend über Schlafstörungen, ständige Anspannung, Kopfschmerzen, Übelkeit, Reizbarkeit, Nervosität und Konzentrationsstörungen klagen, weshalb auch von erfahrenen Ärzten häufig die Fehldiagnose einer Depression gestellt wird. Nach langer Dauer und unzureichender Behandlung der generalisierten Angststörung kann auch eine Depression als Folgesymptomatik auftreten. (Morschitzky, 2002, 67)
Die pathologische Angst zeigt sich bei der generalisierten Angststörung unter anderem in Form von Sorgen und Befürchtungen über zukünftiges Unglück. Diese Sorgen reichen von, „Angehörige könnten demnächst erkranken oder verunglücken“, unbegründete Geldsorgen, bis zu übertriebenen Sorgen um die Leistungsfähigkeit in der Schule oder im Beruf.
Psychisch zeigen sich Symptome wie, Nervosität und ständige geistige Übererregbarkeit mit erhöhter Aufmerksamkeit und Gereiztheit. Angesichts der unkontrollierbaren Befürchtungen, erhöht sich die Schreckhaftigkeit. Konzentrationsschwierigkeiten und/oder Vergesslichkeit gehören ebenso zu den Symptomen der generalisierten Angststörung.
Die motorische Spannung reicht von körperlicher Unruhe, Spannungskopfschmerz, Zittern, bis zum sichtbaren Ausdruck der Muskelanspannung. Auch unwillkürliches Zucken, „wackelig auf den Beinen sein“ und die Unfähigkeit, sich zu entspannen gehören zur generalisierten Angststörung, bei der rasche Ermüdbarkeit und Erschöpfung die Folge sind.
Folgende Befindlichkeiten werden der vegetativen Übererregbarkeit zugeordnet: Schwindelgefühl, Benommenheit, Atemnot, Erstickungsgefühle, Atembeschleunigung, Herzrasen, Schwitzen, Hitzewallungen, Frösteln, feucht-kalte Hände, Magen-Darm-Beschwerden, Übelkeit, Bauchschmerzen, Durchfall, häufiges Wasserlassen (Harndrang), Mundtrockenheit, Schluckbeschwerden, Gefühl, einen „Kloß im Hals“ zu haben, Ein- und Durchschlafstörungen;
1.2.2. Formen und Diagnosekriterien von Angststörungen bei Kindern
Da sich meine Arbeit auf eine kindliche Angststörung bezieht und sich Haase und Zachariah (2001) intensiv mit Angststörungen im Kindes-und Jugendalter beschäftigt haben, erscheint mir ihre Einteilung für die vorliegende Arbeit sinnvoll. Allerdings führe ich zu jeder Form die entsprechende vergleichbare ICD-10- Diagnose an.
1.2.2.1. Emotionale Störungen mit Trennungsangst – Schulphobie
Die Angst vor Trennung ist psychologisch vom Säuglingsalter bis dreieinhalb Jahren normal, was nicht ausschließt, dass die Angst vor Trennung auch in einem höheren Alter sein darf, allerdings immer aus dem Kontext heraus verstanden werden soll. Im Vordergrund steht eine unrealistische und anhaltende Besorgnis über ein mögliches Unheil. Diese kann sich bis zu Katastrophenängsten steigern, die sich entweder auf die Eltern beziehen können, auf andere Bezugspersonen oder auf das Kind selbst. Oft treten zuerst somatische Symptome, wie Kopf-, Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen und abnorme Müdigkeit auf.
Im Verhalten können sich diese Trennungsängste durch Schreien, Wutausbrüche, ständiges Unglücklichsein oder auch Apathie bis zum sozialen Rückzug äußern. Die übermäßig starke Angst zeigt sich in Erwartung einer Trennung oder unmittelbar bei der Trennung. Verweigerung des Kindergartens oder der Schule ist die Folge. Dabei wird die Trennungsangst von der Bezugsperson auf die Schule projiziert. Die unbewusste Angst wird auch gerne verschwiegen. Dabei nützen somatische Beschwerden, um nicht zur Schule gehen zu müssen.
(Vgl. Haase, 2001, 271ff)
Diese Form ist im ICD 10 unter F 93.0 emotionale Störung mit Trennungsangst des Kindesalters zu finden.
1.2.2.2. Schulangst und Schuleschwänzen
Von der Schulphobie müssen Schulangst und Schuleschwänzen unterschieden werden. Bei der Schulangst versucht das Kind der Schule aus Angst vor Leistungsversagen fernzubleiben. Lernschwächen können genauso das Schuleschwänzen erklären, wie Teilleistungsstörungen oder körperliche Gebrechen. Die Vermeidung von Unlust zugunsten lustbetonter Verhaltensweisen steht hier im Vordergrund. Häufig ist dieses Verhalten mit einer dissozialen Störung oder Verwahrlosungsstörung einhergehend. (Vgl. Haase, 2001, 271ff)
Diese Form ist im ICD 10 unter F 93.1 phobische Störung des Kindesalters zu finden.
1.2.2.3. Phobische Störungen
Auch bei Kindern gibt es Agoraphobien, welche mit und ohne Panikanfällen auftreten. „Die ortsbezogene Phobie, die mit einer Panikstörung oder ohne Panikstörung auftreten kann ist auch im Kindesalter diagnostizierbar. Dabei ist die Angst vor offenen Plätzen, vor Menschenmengen genauso relevant wie die Angst, das Haus zu verlassen oder Geschäfte zu betreten. Auch allein in Zügen, Bussen zu reisen wird ein Problem. Die totale Isolation ist die Folge des sozialen Rückzugs durch Vermeidungsverhalten. In diesem Fall sprechen wir vom Rückzug in das sichere Zuhause. Schulbesuch oder Berufstätigkeit ist eingeschränkt und es wird von einem möglich chronischen Verlauf gesprochen, die durch falsche oder keine Therapie begründet wird.“
(Essau, 1999, 32ff, 141)
Diese Form ist im ICD 10 unter F 93.1 phobische Störung des Kindesalters zu finden.
1.2.2.4. Soziale Phobien
Besonders häufig tritt die Soziale Phobie im Schulalter auf. Die Symptome reichen von Erröten, Händezittern, Übelkeit, über Harndrang bis zu Panikattacken. Die Kinder und Jugendlichen zeichnen sich durch Schüchternheit und Selbstunsicherheit aus und sind kritikängstlich. Die Betroffenen haben Angst, sich vor der Klasse zu äußern und Lehrern und Mitschülern zu antworten oder diese direkt anzusprechen. Dadurch fallen sie durch mangelnde Mitarbeit auf. Die Kontaktstörungen und der soziale Rückzug bewirken Isolation. Das dauernde Vermeidungsverhalten hat eine Entwicklungsstörung zur Folge. Diese Ängste und das Unwohlsein können auch zuhause auftreten. Häufig ist dieser Krankheitsverlauf chronisch.
(Vgl. Haase, 2001, 271ff)
Diese Form ist im ICD 10 unter F 93.1 phobische Störung des Kindesalters zu finden und kann differenzialdiagnostisch auch dem Störungsbild F 94.0 elektiver Mutismus zugeordnet werden.
1.2.2.4.1. Spezifische oder auch isolierte Phobien
Die spezifischen Phobien sind auf bestimmte Objekt und/oder auf eine ganz spezielle Situation gerichtet, wie beispielsweise Angst vor unterschiedlichen Tieren, Angst vor der Dunkelheit, Angst bei Befinden in großen Höhen, und Angst von bestimmten Erkrankungen heimgesucht zu werden.
Der Leidensdruck wird durch konstantes Vermeidungsverhalten auf einem geringen Niveau gehalten. Das stellt die häufigste Angststörung bei Kindern zwischen 5 und 10 Jahren dar. Hier gibt es auch günstige Prognosen.
(Vgl. Haase, 2001, 271ff)
Auch für diese phobische Störung bietet sich im ICD 10, F 93.1 phobische Störung des Kindesalters an.
1.2.2.5. Generalisierte Angststörung
Nach Poustka treten generalisierte Angststörungen erst in der späten Kindheit und im Reifungsalter auf. Dabei konzentriert sich die Angst nicht auf bestimmte Objekte oder Situationen, sondern tritt frei flottierend über eine Dauer von mehreren Stunden auf. Diese Angst ist nicht anfallsartig, sondern überdauernd.
„Exzessives Grübeln betrifft emotional negative Gedanken oder Vorstellungsbilder, die relativ unkontrollierbar sind. Die Angst ist meist mit körperlichen Symptomen verbunden. Im Vordergrund stehen oft Befürchtungen über ein zukünftiges Unglück oder übertriebene Sorgen bezüglich alltäglicher Probleme, die von großer Nervosität begleitet werden. Dabei ergeben sich gehäuft Konzentrationsschwierigkeiten, wie auch motorische Spannungen und vegetative Überregbarkeit.“
(Poustka, 1995, 109 ff)
Diese Form ist im ICD 10 unter F 41.1 generalisierte Angststörung zu finden.
1.2.2.6. Panikstörung (oder paroxysmaleAngst)
Anfallsartige Panikattacken sind klar abgrenzbare Episoden intensiver Angst. Die Symptome steigern sich innerhalb weniger Minuten auf ein Maximum und dauern insgesamt nur wenige Minuten an. Die Angst ist nicht an spezifische Situationen oder Umstände gebunden und deshalb auch nicht vorhersehbar und kann folglich zur Erwartungsangst führen. Die Symptome reichen von vegetativen Symptomen (Herzklopfen, Schwitzen, Hyperventilation) bis zur Derealisation und Depersonalisation. Häufig findet man in der Literatur hiezu die Angst verrückt zu werden oder zu sterben. Die vorliegende Beschreibung der Panikstörung bezieht sich auch auf Kinder und Jugendliche und wurde voll inhaltlich aus dem angeführten Buch entnommen:
(Vgl. Haase, 2001, 271ff)
Diese Form ist im ICD 10, unter F 41.0 Panikstörung (episodisch, paroxysmale Angst) zu finden.
1.2.2.7. Posttraumatische Belastungsstörung
Ab circa dem 8. Lebensjahr kann eine posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert werden. Hier handelt es sich um eine lang anhaltende Störung infolge eines massiv belastenden Ereignisses, wie beispielsweise eines Unglücksfalles, eines traumatischen Überfalles, Misshandlungen, Missbrauch, Krieg oder andere Katastrophen.
Zu den Symptomen gehören Schlafstörungen, Trennungsprobleme mit anklammerndem Verhalten, Konzentrationsstörungen, Lernschwierigkeiten, Gereiztheit, Panikattacken, Irritierbarkeit, Schuld- und Verlassenheitsgefühle, „flashbacks“, sowie emotionale Abstumpfung.
(Vgl. Haase, 2001, 271ff)
Diese Form ist im ICD 10, unter F 43.1 posttraumatische Belastungsstörung zu finden.
1.2.3. Zahlen und Fakten zu Angststörungen bei Kindern: Epidemiologie, Komorbidität
1.2.3.1 Epidemiologie
Angststörungen sind die am häufigsten diagnostizierten Störungen bei Kindern und Jugendlichen. Die Prävalenz liegt bei ca. 10 %(Essau, Cecilia, 2003, )
Es sind mehr Mädchen als Knaben betroffen (Bremer Jugendstudie, 1996).
Wenn Angststörungen in der Kindheit auftreten, dann meist erst ab dem 5. – 6. Lebensjahr.
(Lieb, 2000, 86ff)
1.2.3.2 Komorbidität
Bei mindestens 30 % der Kinder treten mehrere Angststörungen kombiniert auf. Bei weiteren 30 % wird zusätzlich eine depressive Störung diagnostiziert. Depressive Störungen bei Kindern und Jugendlichen gehen mit einem 30%igen Anteil an Panikstörungen Hand in Hand. 50 –65% der Kinder und Jugendlichen mit Essstörungen, Alkohol- und Drogenmissbrauch sowie Störungen des Sozialverhaltens und Aufmerksamkeits-und Hyperaktivitätsstörung leiden außerdem unter Angststörungen.
(Lieb, 2000, 86ff)
1.3. Erklärungsmodelle für Angststörungen:
Ich möchte zur Einleitung dieses Kapitels das bio-psycho-soziale Paradigma als Grundvoraussetzung postulieren. Nach dieser Ansicht muss von einer multifaktoriellen Genese ausgegangen werden.
Zu den biologische Faktoren gehören die Erkenntnisse der Gehirnforschung genauso wie die genetische Prädisposition, welche durch Zwillingsstudien, (Fryer, 1993) nachgewiesen wurde. Die sogenannte „Behavioral Inhibition“, so wird eine ängstliche Reaktion des Kindes genannt, signalisiert eine erhöhte Erregungsbereitschaft und beinhaltet neurophysiologische und neuropsychologische Faktoren. Zu den psychischen Faktoren zählen die Temperamentsmerkmale wie Passivität, Schüchternheit, ängstlich vermeidendes Verhalten, Gehemmtheit sowie geringe Emotionsregulation und Impulsivität. Weiters werden hier auch kognitive Merkmale der Wahrnehmung und der Interpretation von Reizen angeführt, welche zu irrationalen Gedanken und Erwartungen führen.
Bei den sozialen Einflüssen stehen die elterliche Persönlichkeit, deren Interaktions- und Erziehungsverhalten und die Bindung zwischen Eltern und Kind im Vordergrund. Allerdings sind auch psychische Störungen der Bezugspersonen, sowie stressreiche oder kritische Lebensereignisse und Umwelteinflüsse wie Wohnsituation und Wohnlage ausschlaggebend. Die Studien sind in den zitierten Quellen in diesem Punkt zum Teil widersprüchlich.
(Lieb, 2000, 86ff)
Dementsprechend versuche ich physiologische Tatsachen genauso anzuführen, wie psychologische Forschungsergebnisse, die natürlich mit der sozialen Komponente eng verbunden sind, In der Folge stelle ich einzelne Erklärungsmodelle vor, die in einem ganzheitlichen Kontext zu betrachten sind.
1.3.1. Neurobiologische Theorien von Angststörungen
1.3.1.1. Das Furchtsystem und Paniksystem
Yaak Panksepp geht davon aus, dass den verschiedenen Emotionen auch entsprechende neuronale Schaltkreise zugrunde liegen, die bestimmte Hirnstrukturen und neurochemische Systeme betreffen.
Laut Emotionstheorie (Panksepp, 1998) sind die Schaltkreise betreffend Angst in der zentralen und lateralen Amygdala (Mandelkern) lokalisiert, sowie im medialen Hypothalamus (Hirnanhangdrüse) und im dorsalen PAG (Periaquäduktales Grau), auch als das "Zentrale Grau" bekannt, ist die graue Substanz der Lage rund um das Aquaeductus cerebri, innerhalb der Haube des Mittelhirns. Es spielt eine Rolle in der absteigenden Modulation von Schmerzen und bei der defensiven Haltung.)It plays a role in the descending modulation of pain and in defensive behaviour.
Nach Panksepp beeinflussen Neuromodulatoren unter anderem Glutamat und zahlreiche Neuropetide der Angst.
Panksepp unterscheidet ein Furchtsystem und ein Paniksystem, welches hirnanatomisch getrennt platziert ist, jedoch in enger Verbindung zueinander und in enger Verbindung zur Aktivierung des Wut und Aggressionszentrums steht.
Das Furchtsystem reagiert auf äußere Bedrohung und aktiviert das sympathische Nervensystem. Der Organismus wird auf Kampf oder Flucht vorbereitet und wenn beides nicht möglich ist, tritt eine Erstarrung ein, welche mit dem Paniksystem beim Erleben einer Trennung in Verbindung gebracht wird; nach dem Modell, „wenn ich schon tot bin, kann mir niemand mehr etwas tun“. Allerdings wäre hier auch die Interpretation; „Hilfe ich kann nichts tun!“- im Sinne eines Appells an die Bezugsperson verständlich. Gerade diese ohnmächtige Hilflosigkeit sehe ich in der Kindertherapie verstärkt bei Angststörungen.
Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass im Mittelhirn nicht nur das Furcht, die Angst und das Paniksystem verankert sind, sondern auch das Bindungsverhalten. Auf Grund der engen Verbindung des Paniksystems mit dem Bindungssystem geht Michael Schacht davon aus, dass die Dynamik von Panikzuständen in erster Linie mit dem Thema Bindung in Zusammenhang steht. Das ist ein wertvoller Hinweis für die Diagnose und die Therapie bei einer Angststörung; insbesondere bei Kindern.
(Schacht, 2009, 165 f)
1.3.1.2 Spiegelneuronen
Im Vordergrund dieser Betrachtung steht das Phänomen, dass sich das Verhalten und der seelische Zustand von einem Menschen auf den anderen Menschen übertragen kann, welches den Spiegelneuronen zugeschrieben wird. Sehr oft wird völlig unwissenschaftlich von ansteckender Angst gesprochen, die sich durch die Spiegelneuronen erklärbar machen.
Spiegelneurone (auch: Spiegelneuronen) sind Nervenzellen, die im Gehirn während der Betrachtung eines Vorgangs die gleichen Potenziale auslösen, wie sie entstünden, wenn dieser Vorgang nicht bloß (passiv) betrachtet, sondern (aktiv) gestaltet würde. Der Italiener Giacomo Rizzolatti hat mit seinen Mitarbeitern 1995 im Tierversuch, genauer gesagt, bei Affen, entdeckt, dass Neuronen im Feld F 5c des Großhirns nämlich dann reagierten, wenn zielorientiert motorische Hand zu Objekt Interaktionen inszeniert wurden, oder sogar bei anderen, welche wenigstens anatomisch ähnlich waren, zumindest bei lebenden Individuen beobachtet. Erst haben Forscher hauptsächlich emotionsneutrale motorische Handlungen genauer beobachtet und sind dann darauf gekommen, sogar bei Handlungen mit emotionaler Einfärbung auch Spiegelneuronen beteiligt sind, beziehungsweise eine sehr wichtige Rolle bei sozialen und kognitiven Aspekten spielen. Beispielsweise bei der Empathie, der Theory of Mind Kompetenz und dem Facial Emotion Processing.
Das ist ein Erklärungsversuch, dass ängstliche Eltern ihre Angst nonverbal weitergeben.
(Bauer, 2010, 13f)
1.3.2. Lerntheorien
1.3.2.1 Klassische Lerntheorien
Das Little-Albert-Experiment belegt die Möglichkeit klassischer Konditionierung von uns Menschen. Im Speziellen beweist es die Erlernbarkeit und die Generalisierbarkeit der Angstreaktionen. Dieses Experiment wurde 1920 von John B. Watson gemeinsam mit seiner Assistentin Frau Rosalie Rayer an der John Hopkins Universität in Baltimore durchgeführt. Damit wollten sie beweisen, dass die Querschnitt Feststellung, welche die Anzahl der Reize betrifft, die emotionale Reaktionen auslösen, durchaus einfach vermehrt werden können.
Die Versuchsperson Albert B., genannt "Little Albert" war der Sohn einer Amme am Harriet-Lane-Hospital.
(Vgl http://education.stateuniversity.com/pages/2543/Watson-John-B-1878-1958.html)
In einer Vorstudie untersuchten Watson und Rayner die Gefühlsreaktionen des neun Monate alten Albert. Dabei wurden ihm kurz und erstmalig in seinem Leben folgendes gezeigt; ein Kaninchen, eine weiße Ratte, ein Hund, eine menschliche Maske mit Haaren und eine ohne, einen Affen, brennende Zeitung und Ähnliches mehr. Auffallend war dabei, dass das Kind nie eine Furchtreaktion zeigte. Im Gegenteil es griff stets interessiert nach diesen Dingen.
Sehr wohl zeigte das Kind allerdings Furcht, wenn es hörte, wie hinter ihm mit einem Hammer auf eine Eisenstange geschlagen wurde.
Watson hat im Experiment dem elfmonatige Albert eine weiße Ratte gezeigt und ihm zeitgleich einen lauten Ton mit einer Eisenstange hören lassen. Daraufhin wimmerte der kleine Albert leise als er die Ratte mit der Hand berührte. Dies wurde zweimal wiederholt, mit dem Ergebnis, dass sich nun der kleine Albert weigerte die Ratte anzufassen. Nach sieben Wiederholungen zeigte er bereits eine massive Angstreaktion beim Anblick der Ratte. Schlussendlich hat der kleine Albert auch beim Anblick von ähnlichen Reizen, wie Fellen oder Baumwollbüschchen und weißen Bärten Angst gezeigt. Deshalb gingen Watson und Ryner davon aus, dass dieses angeeignete bzw. erlernte Verhalten das ganze Leben bestehen bleiben würde und die Persönlichkeit dauerhaft beeinflussen würde. In der Tat war diese kühne Behauptung auf sehr dünnem Eis.
Allerdings erklärt Mowrer in der „Two Factor Theory“ also der Zweifaktorentheorie, dass Phobien eine erworbene Störung sind, die durch eine Vermischung von klassischer und operanter Konditionierung entstehen würden. Dabei wird ein unkontrollierter Stimulus durch Verknüpfung mit einer unkonditionierten Reaktion zu einem erworbenen bzw. konditionierten Stimulus, folglich also zum Angstauslöser. Die operante Konditionierung verschärft den konditionierten Stimulus. Der Mensch versucht die Angst zu verringern, indem er den Stimulus vermeidet.
So kann etwa ein Bienenstich zu Angst vor Bienen führen (klassisches Konditionieren). Dadurch führt das stete Vermeiden von Bienen zu einer Beibehaltung der Angst, so bildet sich eine konstante Phobie, dabei sprechen wir von operanter Konditionierung.
Dies stellt insbesondere für die Therapie von Angststörungen ein großes Problem dar und hat zur Entwicklung von Konfrontationstherapien wie dem Flooding geführt.
Mowrers „Two Factor Theory“ zählt zu den bedeutendsten Modellen der Angststörungen. Diese gilt in heutigen Forschungsansätzen jedoch als ergänzungsbedürftig. Dabei wird erläutert, dass an der Entwicklung von Phobien sowohl die klassische als auch im bestimmten Maße die operante Konditionierung mitwirken.
(http://findarticles.com/p/articles/mi_7650/is_201002/ai_n52370575/ 20.5.2010)
Erst in den frühen 1960er Jahren begann Bandura mit einer Reihe von Artikeln und Büchern von einem Lernen durch Beobachtung zu sprechen. Da gibt es die bekannteste Studie von Bandura, die ‚Bobo doll Studie’, die 1963 entstanden ist, welche zur Verfassung der Theorie des Lernens am Modell führte, bzw. als Beobachtungslernen bezeichnet wurde.
Dies bedeutet dass, das Individuum das Verhalten beobachtet und speichert und bei Bedarf abruft. Das ist auch ein Vorgang, der durch die Spiegelneuronen ermöglicht wird. Damit haben wir eine theoretische Grundlage, dass ein ängstliches Verhalten, beispielweise der Mutter, auch ein ängstliches Verhalten beim Kind hervorruft.
(Vgl. Lerntheorien Hobart_Mowrer 2009)
Querverweis: Die Lerntheorie mit dem Initationslernen bezieht sich auf die biologische Grundlage der Spiegelneuronen, wie oben erwähnt.
1.3.2.2. Moderne Verhaltenstherapien
Wesentliche Beeinflussung hat die moderne Verhaltenstherapie durch Jeffrey Alan Gray erfahren, der das physiologische Verhalten unter Einfluss von Stress und Angst genauer untersuchte und sich an dem psychologischen Konzept von Eysencks Aktivierungstheorie orientiert. Er erkannte bei Läsionsversuchen, dass drei primäre Emotionssysteme im Säugetierhirn vorhanden sind. (Gray, 1987)
Er unterscheidet zwischen dem Behavioral Activation System, welches zur Annäherung im Verhalten führt, dem Behavioral Inhibition System, welches eine Verhaltenshemmung bewirkt und dem Kampf-Flucht-System.
Das Behavioral Activation System setzt voraus, dass Signale, egal ob sie den angeborenen oder konditionierten Furchtreizen entsprechen oder auch neue Reize darstellen, auf jeden Fall einmal im Prüfungsvergleich erkannt werden. Die weitere Verhaltensweise, wie zum Beispiel eine passive Vermeidung, oder ein Einfrieren, genauso wie die Aktiviertheit von Aufmerksamkeit, sind in dieser Phase einzuleiten, die den Kontrollzustand darstellt. Bei nicht Zusammenpassen der Informationen wird das Behavioral Activation System tätig. Dabei werden die Informationen von der gegenwärtigen Situation dem septohippokampalen System, genauso wie von den Informationen der erwarteten und geplanten Ereignisse, die dem Papezkreis zugeordnet sind, vom Behavioral Inhibition System verglichen. Bei Mismatching, also Nichtzusammenpassen der Informationen kommt es zur Hemmung des laufenden Verhaltens durch das subiculum. Dabei ist zu beobachten, dass die sensomotorische Informationssuche mit erhöhter Rezeptorsensität einhergeht und so lange besteht, bis die Diskrepanz zwischen Input und Erwartetem aufgehoben ist. Als Beweis gilt, dass die Läsionen des Hippokampus und des Septums (limbische System) zu einer Einschränkung der Exploration in neuen Situationen führte. Biedermann hat 1990 in verschiedenen Situationen Zusammenhänge zwischen Behavioral Inhibition und einer Angststörung festgestellt. (Biedermann,1990, 21 ff).
Darauf bezieht sich Siebke Sophie Melfsen. Sie stellt sich die Frage, ob es sich um ein spezielles Konzepte des Verhaltens bei Behavioral Inhibition handelt oder ob bereits von einer Angststörung gesprochen werden kann, was bereits im frühen Lebensalter diagnostiziert werden kann. (Siebke Sophie Melfsen, 1999)
Turner, Beidel & Wolff 1996, sowie Kagan und dessen Mitarbeiter vermuten, dass es sich bei Behavioral Inhibition nicht um eine Angststörung handelt. Sie stellen Behavioral Inhibition als eine Temperamentseigenschaft dar, die nicht notwendigerweise unangepasst ist.
1.3.3. Die Bindungstheorie - basics
Der britische Psychiater John C. Bowlby hat in Kooperation mit der Kanadierin Mary S. Ainsworth die Bindungstheorie Grund gelegt und empirisch belegt. Seine Motivation zu diesem Projekt holte sich Bowlby, als er als Kinderpsychiater in England nach dem Krieg arbeitete. Dabei hielt er Kontakt zu vielen Kindern und musste mitanschauen bzw. miterleben, was Trennungen in Kindern auslösen konnte. Hier war das soziale Umfeld innerhalb gewisser Grenzen genauso wichtig, wie das genaue Beobachten der Kinder in frühester Kindheit. Der Schwerpunkt auf die früheste Kindheit schafft eine gewisse Überschneidung in den Ansichten um die Persönlichkeitsentwicklung, wie sie auch in der Psychoanalyse zum Vorschein kommt.
Gleichzeitig grenzt sie sich entschieden von der Lerntheorie ab. Seitens der Bindungstheorie wird Angst bei Kindern mit unterschiedlichen Bindungstypen in Zusammenhang gebracht.
Die Bindungstheorie geht davon aus, dass die Entwicklung einer sicheren Bindung zwischen einem Kleinkind und dessen primärer Bezugsperson die Grundlage für die Ressource ist, gute und stabile soziale Beziehungen als Erwachsene leben zu können. Die Basis stellt eine geglückte Mutter – Kind Beziehung dar, oder eine stabile Beziehung zu einer adäquaten Bezugsperson. Als Bindung wird ein „gefühlvolles Verpflichtet sein“ verstanden, welche als Neigung bereits in den ersten Lebensmonaten grundgelegt wird und über ein Leben lang aufrecht erhalten werden kann. Eine Bindung hat stets eine sehr individuelle Einfärbung und kann nicht durch andere Personen ausgewechselt werden.
Es wird neben Nahrungsaufnahme und Sexualität als primäres angeborenes menschliches Grundbedürfnis gesehen, sichert es dem Säugling doch Nähe, Zuwendung und Schutz einer vertrauten Person. Dies bedeutet, wenn sich ein Mensch einsam, krank, verlassen, ängstlich oder irritiert fühlt, wird die Kompetenz der gespeicherte Grundkommunikation wieder belebt, welche die Zuzeigung und Nähe zur Bezugsperson wieder installieren soll. Damit ein Kind diese Bindung überhaupt entwickeln kann, müssen sein Verhaltensrepertoire und seine sensorischen Fähigkeiten genügend ausgebildet sein. Im Verlaufe der ersten Lebensmonate wird dieses Bindungsverhalten immer spezifischer auf wenige Bezugspersonen ausgerichtet. In der Regel ist die Mutter die wichtigste Bindungsperson, aber auch Väter, Geschwister, Großeltern, die eine enge Beziehung zum Kind aufbauen, kommen in Frage.
Das autonome Verhalten steht reziprok zum individuellen Bedürfnis nach Nähe und Zuwendung. Solange die Nähe und Zuneigung der vertrauten Person vorhanden ist, kann sich der Mensch der Umwelt und deren Erforschung zuwenden.
Sobald eine Gefahr auftaucht, sei es in der äußeren Umwelt oder eigener Kummer, Unsicherheit, Krankheit oder sich eine Einschränkung in der Verfügbarkeit und Reaktionsbereitschaft der Bindungsperson andeutet, überwiegt das Aufsuchen von Nähe und Kontakt.
Es ist nicht von Relevanz in welcher Altersstufe sich ein Individuum befindet, es lässt sich stets dasselbe zu Grunde gelegte Muster an Ich- Du Beziehung, wie in der Kind- Bezugspersonthematik vorlag, anfinden. Den Bindungsforschern zufolge bleibt dieses Muster ein Leben lang gleich.
Ein wichtiger Bestandteil der Bindungstheorie stellt das innere Arbeitsmodell dar. Bindungsforscher wie psychoanalytische Objektbeziehungstheoretiker vereint die Auffassung, dass Kinder durch wiederholte typische Interaktionsmuster Erwartungen hinsichtlich des Musters dieser Interaktionen mit ihren Bindungspersonen ausbilden. Dieses Muster wird zunehmend verinnerlicht und in der individuellen Persönlichkeit integriert. Gegen Ende des ersten Lebensjahres ist das Verhalten des Kindes zielgerichtet und beruht auf spezifischen Erwartungen. Die frühen Erfahrungen des Menschen mit seiner Bezugsperson werden zu einem stellvertretenden System verdichtet, welches Bowlby (1973) als innere Arbeitsmodelle bezeichnete (Internal Working Models). Man spricht auch von mentalen symbolwertigen Repräsentanzen.
Durch die internalisierten Bindungserfahrungen bildet sich ein sicheres oder unsicheres Bindungsmuster heraus. Diese „inneren Arbeitsmodelle“ regulieren das Verhalten des Kindes zur Bezugsperson und strukturieren später das Verhalten und Erleben in allen emotional relevanten Beziehungen, einschließlich der zu sich selbst.
(Daudert, 2001, 6).
Das einjährige Kind setzt sein „Arbeitsmodell“ direkt in seine Bindungsstrategie und damit im Verhalten um. Das sechsjährige Kind verschlüsselt sein Arbeitsmodell bereits in die Art des Dialoges, den es mit seiner Mutter führt. Beim Erwachsenen lässt sich das Arbeitsmodell am besten daran erkennen, wie er über bindungsrelevante Themen spricht.
Es kann als erwiesen angesehen werden, dass ein Mensch unterschiedliche Bindungen zu verschiedenen Menschen haben kann, so z.B. eine unsicher vermeidende Bindung zum Vater und eine sichere Bindung zur Mutter.
Die voneinander unabhängigen Beziehungsmodelle zu seinen Hauptbindungsfiguren entwickelt das Kind durch die jeweiligen Erfahrungen mit den zurückliegenden Interaktionen. Das Individuum lässt sich durch das dominanteste oder eben das bevorzugte Modell beeinflussen.
(Vgl. Holmes, 2002, engl. 1993, 87 ff)
Eine Metaanalyse aller Stichproben ergab folgende Häufigkeitsverteilungen:
55% sichere Bindung
25% unsicher-vermeidende Bindung
10-20% unsicher-ambivalente Bindung
10-20% unsicher-desorganisierte Bindung
(http://www.uni-bielefeld.de/paedagogik/Seminare/moeller02/07bindung2/sub/quali.html 20.5.2010)
1.3.3.1 Sicherer Bindungstyp – gesunde Angst
Bei der Erforschung des Bindungsverhaltens wurde der „Fremde-Situationstest“ angewandt, was so viel bedeutet, dass das Kind bei einer fremden Person von der Bezugsperson zurückgelassen wird.
Mit dem Vertrauen ausgestattet, dass die Bezugsperson verfügbar ist, agieren sicher gebundene Kinder. Während des gesamten Ablaufs bedeutet dies, der „fremden Situation“ zeigen sie ein positives Verhalten gegenüber ihrer Bezugsperson (beispielsweise Mutter). Während der Anwesenheit der Bindungsperson explorieren sie mutig das Umfeld und fühlen sich sicher. Allerdings wird man nicht vermuten, dass das sicher gebundene Kind die Mutter nicht gehen lassen will.
Es wird den empfundenen Stress auch in voller Lautstärke wiedergeben, schreien und toben und alles andere als artig sein. Die Betroffenheit über das Verlassenwerden offen ausdrücken zu können, ist somit ein Kennzeichen der sicheren Bindung. Wenn die Mutter wieder zurückkehrt, wird das Kind großes Interesse spüren und Freude bei der Begrüßung zeigen. Es lässt sich schnell in die Arme nehmen, wenn es auch zuvor geweint hat. Daraufhin können sie ihre Exploration fortsetzen. Diese Kinder können ein Gefühl der Selbstbestimmung entwickeln, weil sowohl ihre Bindungswünsche verstanden, als auch ihre Neugier unterstützt wird. Da das Kind vermittelt bekam, dass es liebenswert ist, kann es sich selbst auch liebenswert sehen und sein Selbst in einem positiven Licht.
Ebenso sind sie ausgeglichener, weinen seltener, zeigen ein gutes Verhältnis zwischen selbstständigem Spiel und Kontaktsuche zur Mutter, sind weniger aggressiv und ängstlich und eher bereit auf Ge- und Verbote zu reagieren. In Bezug auf die Angst heißt dies, dass Kinder verlässlicher die Situation einschätzen können und ihr Angstverhalten im realen Kontext verstehbar ist.
(Vgl. Holmes, 2002, engl. 1993. 99ff)
1.3.3.2. Unsicher vermeidender Bindungstyp – Angst vor Abweisung
Dieser Bindungstyp ist geprägt vom Vermeidungsverhalten. Schon während der Spielphase ist kaum eine Mutter-Kind-Interaktion (wiederum Mutter als Bezugsperson angenommen) oder eine vom Kind ausgehende Kontaktaufnahme sichtbar. Während der Trennungsphase zeigen sie nach außen hin den geringsten Kummer, aber das größte Explorationsverhalten, lassen sich bereitwillig von der fremden Person im Raum trösten und ignorieren die Bindungsperson bei ihrer Rückkehr. Es schaut kurz auf und spielt dann aber weiter. Ein Kennzeichen der unsicher-vermeidenden Bindung stellt eine Begrüßung mit der ‚kalten Schulter’ dar, welche nicht als äußerst vertieftes Spiel missinterpretiert werden wollte. Bereits kleine Kinder sprechen höflich aber distanziert zu ihrer Bindungsperson und beschränken die Kommunikation auf das Nötigste.
Damit senken die Kinder für sich selbst das Risiko erneut zurück gewiesen zu werden und damit zusätzliche Verletzungen ihrer kindlichen Gefühle in Kauf nehmen zu müssen. Die Vermeidung steht hier im Vordergrund. Es will möglichst nichts Eigenes und es vermeidet Gefühle zum Ausdruck zu bringen, wodurch es Konflikten und Kritiken seitens der Eltern aus dem Weg geht, welche wie schmerzvolle Zurückweisungen erlebt werden. Sich einfach nicht zu öffnen, senkt die Wahrscheinlichkeit von der Bindungsperson abgewertet und gedemütigt zu werden. Deshalb fallen unsicher vermeidend gebunden Kinder augenscheinlich wohlerzogen und brav auf. Sie entwickeln die Erwartung, dass ihre Bedürfnisse und Wünsch nicht ernst genommen werden und auch nicht erfüllt, und glauben es nicht Wert zu sein geliebt und unterstützt zu werden. Stresssituationen werden vermieden, weil es Angst hat, dadurch den Stress zu vermehren. Sie sind krampfhaft bemüht alles alleine zu schaffen, damit sie nirgends anecken und dies noch dazu mit der Anstrengung die Unsicherheit nicht zu zeigen. Die innere Haltung ist in keiner Weise positiv, deswegen kann auch keine Integration statt finden, weshalb dadurch der dauerhafte Rückzug von der Umwelt markiert wird. Die Bedürfnisse nach Nähe, Zuwendung und Kontakt werden hinten angehalten und sie genügen sich selbst. Die „unsichtbare“ Wand ist selbst von der Bindungsperson nicht zu überwinden. Die nachhaltig defizitäre Erfahrung an Mangel von Unterstützung und Rückhalt drängt die Kinder in dieses Vermeindungsverhalten. Den Bezugspersonen von unsicher vermeidenden Kindern wird oft eine ärgerliche, grobe und ungeduldige Versorgung ihrer Kinder nachgesagt.
Ebenso können aber auch äußere Umstände wie z.B. die Einweisung in ein Kinderheim oder lang anhaltende Krankenhausaufenthalte in früher Kindheit den Aufbau einer echten Bindungsbeziehung verhindert haben. In Bezug auf die Angst heißt dies, dass gerade das Vermeidungsverhalten dominiert und unsichere Situationen mit Hilfe dieses inneren Modells bewerkstelligt werden.
(Vgl. Holmes, 2002, engl. 1993, 101ff)
1.3.3.3. Unsicher ambivalente Bindung – Spannungsfeld – Vermeidung – Annäherung – kippt leicht
Unsicher ambivalent gebundene Kinder zeigen in der fremden Situation große Unruhe, schon alleine deswegen, weil eine fremde Umgebung und eine unbekannte Person da sind. Am Anfang der Untersuchung sind diese Kinder auf ihren Müttern gehangen und waren schwer zu motivieren ihre Umgebung zu erforschen und das vorhandene Spielzeug zu benützen. Sind die Mütter weg zeigen sie noch starken Kummer über die Trennung und dazu noch ausgeprägte Affekte. Wenn die Mutter zurückkehrt suchen sie zwar Nähe und Kontakt, welcher jedoch von wütendem oder widerstrebendem Verhalten begleitet ist. Sie lassen sich nur äußerst schwer beruhigen und zeigen kaum Explorationsverhalten. Es herrscht eine unzufriedene und quengelige Stimmung.
Kinder dieses Bindungstyps sind sich unsicher, ob die Bindungsperson bei Bedarf verfügbar sein könnte. Daraus ist verständlich, dass diese Kinder ganz viel Energie und Aufmerksamkeit auf die Bindungsperson richten um sich ihr anzunähern und mit der Erwartungsangst, die mit gleichzeitiger Ablehnung beantwortet wird, ist das Spannungsfeld gut beschrieben. Hieraus entsteht eine übermäßige Anhänglichkeit mit Anklammern und Trennungsangst, aber auch Ärger auf die Bindungsperson. Diese Kinder zeigen sich mitunter sehr aggressiv und gestresst und lassen sich auch kaum beruhigen. Dieser Bindungstyp charakterisiert, „es gab schon gute Momente in meinem Leben, allerdings muss ich schon sehr achtsam sein auch in der Zukunft etwas davon ab zu bekommen“.
[...]
- Arbeit zitieren
- MSc MEd Helene Bader (Autor:in), 2011, "Die gute und die schlechte Julia sollten eine Person werden." Psychodramatherapie mit einer kindlichen Angstpatientin, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/341737
Kostenlos Autor werden
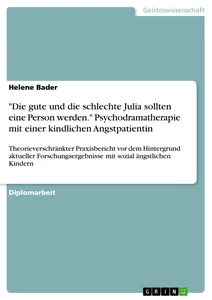
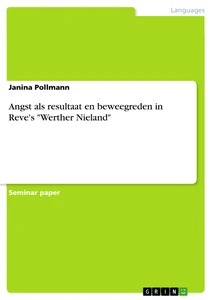














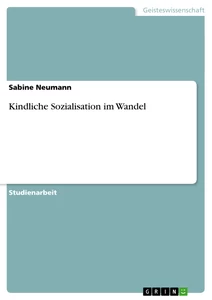



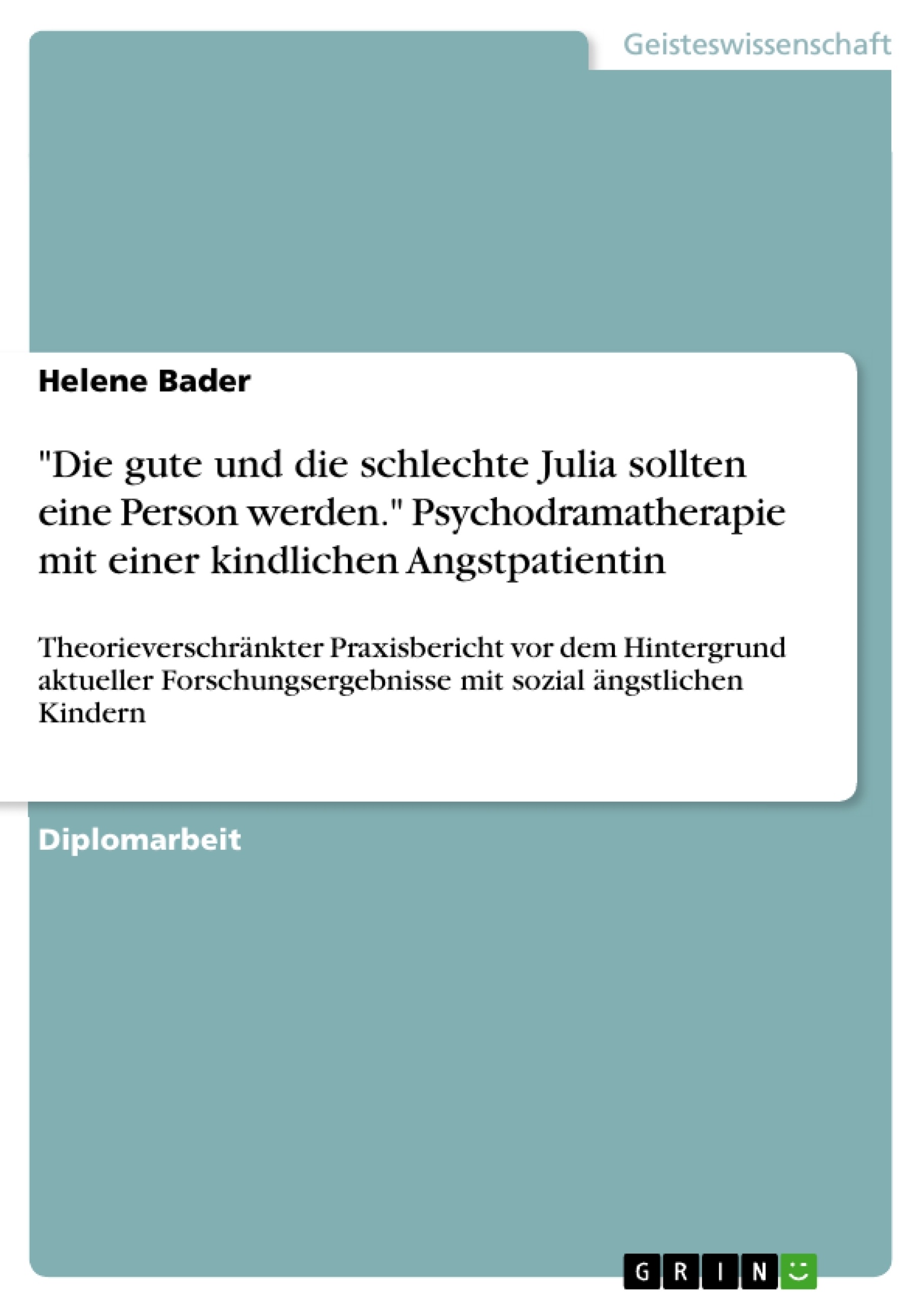

Kommentare