Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Bestimmung des Korpus
2.1 Warum Film?
2.2 Welche Filme?
3 Theorie
3.1 Jugend
3.1.1 Lebensphase
3.1.2 Identität
3.1.3 Schule
3.2 Dramaturgie
3.2.1 Figuren
3.2.2 Dialoge
3.2.3 Reise des Helden
3.3 Bildgestaltung
4 Spurensuche
4.1 Die Feuerzangenbowle
4.1.1 Zeitliche Verortung
4.1.2 Entstehungsgeschichte
4.1.2.1 Drehbuch
4.1.2.2 Film
4.1.3 Detailanalyse
4.1.3.1 Lehrer und Schüler
4.1.3.2 Dramaturgische Struktur
4.1.4 Film als Spiegel des Nationalsozialismus
4.2 The Breakfast Club
4.2.1 Setting und Rezeption
4.2.2 Das amerikanische Schulsystem
4.2.3 Die 1980er
4.2.3.1 Gefühle und Stimmungen
4.2.3.2 Das Kino
4.2.4 The Breakfast Club - Entstehungsumstände
4.2.4.1 Das Brat Pack
4.2.4.2 John Hughes
4.2.4.3 Produktionsbedingungen
4.2.5 Sequenzprotokoll der Exposition
4.2.6 Detailanalyse
4.2.6.1 Auslösendes Ereignis
4.2.6.2 Vernon vs. Bender
4.2.6.3 Erster Wendepunkt
4.2.6.4 Begegnung mit dem Weiblichen
4.2.6.5 Midpoint
4.2.6.6 Im Bauch des Walfischs
4.2.6.7 Rollenübernahme
4.2.6.8 Wendepunkt II
4.2.6.9 Krise
4.2.6.10 Backstorywound
4.2.6.11 Höhepunkt
4.3 Entre les murs (Die Klasse)
4.3.1 Setting des Films
4.3.2 Das französische Schulsystem
4.3.3 Grenzgang zwischen Doku und Fiktion
4.3.4 Detailanalyse
4.3.4.1 Exposition: Lehrerfigur
4.3.4.2 Wendepunkt I
4.3.4.3 Dialektik und Geheimste Höhle
4.3.4.4 Midpoint
4.3.4.5 Grenzüberschreitung als Anstoß
4.3.4.6 Krise
4.3.4.7 Höhepunkt
4.3.4.8 Rückkkehr
5 Fazit
6 Literatur
6.1 Schriften
6.2 Filme
7 Anhang: Interview mit Laurent Cantet
8 Einstellungen zur Voice Over (Exposition)
1 Einleitung
Warum Spurensuche? Für Sybille Krämer ist das Spurenlesen „eine elementare Fähigkeit unseres orientierenden Handelns in der Welt“ (Krämer 2007: 155.). Sie sensibilisiert für eine Bedeutungsvarianz vom allgemein geläufigen Verständnis von Spur, als Indiz für etwas Abwesendes, was aber rekonstruierbar oder einholbar ist, hin zu einem Verständnis von Spur, das den Spurenleser mit „einer uneinholbaren Ferne, einer unüberwindbaren Absens […] oder einem unwider- bringlichen Vergangensein“ (ebd.: 157.) konfrontiert, ein Verständnis von Spur also, das ins Transzendente hineinreicht. Als grundlegende Kennzeichen einer Spur sieht sie a) den Zeitenbruch, d.h. „[es] wird etwas angezeigt, das zum Zeitpunkt des Spurenlesen irreversibel vorbeigegangen […] ist“ (ebd.: 164.) und b) die Unmotiviertheit, d.h. eine Spur liegt vor, „sofern [die Anzeichen] unabsichtlich hinterlassen sind“ (ebd.: 164.).
Handelt es sich bei Filmen um Spuren und ist damit jede Filmrezeption zwangsläufig ein Spurenlesen? David Bordwell versteht sowohl den Herstellungsals auch den Rezeptionsprozess eines Films als Spurenlesen.
The word trace, derived from tractus, a track or course, should remind us that cinema is in part a pictorial art, offering a visual array that marks out a space for our apprehension. Tractus implies both carving a path (as the filmmaker does) and following another`s path, as we do in watching the film (Bordwell 2005: 238.).
Auch Thomas Elsaesser (2009) sieht ‚Kino’ und ‚Spurenlesen’ in einem engen Zusammenhang. Eine epistemologische Verortung des Kinos durch Regisseure wie Renoir, Welles, Rosselini und de Sica sieht er später aufgegriffen und gestärkt durch die Filmkritiker und Filmemacher der Nouvelle Vague, die die Filme als „Realitätsindex und Gedächtnisspur“ (ebd.:18. Sp. 1) verstanden.
Wenn Spurenlesen „eine elementare Fähigkeit unseres orientierenden Handelns in der Welt“ (Krämer 2007: 155.) ist, kommen zwangsläufig auch pädagogische Ziele ins Spiel. Doch ein Spagat zwischen Filmwissenschaft und Pädagogik und zwischen Theorie und Praxis - wird nicht möglich sein, ohne am Ende auch Lücken und unbeantwortete Fragen zurückzulassen. Einiges wird im Rahmen solch einer Arbeit uneinholbar sein. ‚Spurensuche’ meint für mich, dass ich mich von den Spuren der Filme leiten lasse. Ich möchte wissen unter welchen Bedingungen sie entstanden sind, möchte wissen was für eine Geschichte sie erzählen und welches Bild von Schule sie vermitteln.
Noch einmal philosophisch nachgefasst: Krämer pointiert ihre Vorstellung von Spuren, indem sie feststellt, dass sie durch das Suchen konstituiert werden. Nicht das Fassen des Abwesenden ist das Ziel, sondern die Suche selbst. Wie lässt sich diese These auf die Eigenheiten des Mediums Film anwenden? Norbert Grob macht bewusst (unter Bezugnahme auf Edgar Morin), „dass die Wirkung der Bilder in oder zwischen den Bildern selbst [Hervorh. ChB] angelegt sein muss“ (Grob 2008: 95.). Ein Film besteht eben auch aus den Leerstellen zwischen den Einzelbildern, die der Zuschauer in einem individuellen, konstruktiven Prozess füllen muss. Solche Leerstellen können inhaltlich entstehen durch zeitliche und räumliche Sprünge in der Story, in der visuellen Auflösung, aber ebenso entstehen sie rein technisch durch die Bewegung, die ja gerade aus ‚dem dazwischen’ der Einzelbilder entsteht: „Ich sehe das eine, ich sehe das andere, und dazwischen erwarte ich etwas Drittes zu entdecken, das inspiriert ist von beidem“ (Grob 2008: 97.). Jeder Filmrezeption wohnt also qua Technik eine Such- bewegung nach dem ‚dazwischen’ inne.
Begebe ich mich nun auf eine historisch-ästhetische Spurensuche, so ergibt sich zwangsläufig ein analytisches Spannungsfeld: Einerseits kann ich die filmischen Spuren wie Indices verstehen, die mir Rückschlüsse geben, über die Entstehungs- zeit und über Intention von Drehbuchautor und Regisseur, andererseits muss mir bewusst sein, dass meine Interpretationsansätze nur Annäherungen sind, vor denen sich das Medium selbst ein unhintergehbares, ihm innewohnendes Geheimnis bewahren wird. Einerseits muss ich die ‚Gemachtheit’ berücksichtigen und die Gestaltung in Beziehung setzen zur Entstehungszeit, andererseits muss ich die Story als einmalig gefilmte, unveränderlich gesetzte filmische Wirklichkeit wahrnehmen (vgl: Flicker 1998: 77., Mikos 2008: 78-79.). Das widerspricht sich auf den ersten Blick, aber gerade in diesem Widerspruch sehe ich den Reiz dieser Arbeit, weil daraus ein Grenzgang zwischen Medien- und Sozialwissenschaft resultieren kann. In meiner Arbeit möchte ich aus der Perspektive von Machern und Rezipienten argumentieren. Dabei lege ich Wert auf die historische Verortung der Filme, stelle aber gleichzeitig Zusammenhänge zu den Themengebieten der Filmdramaturgie, der Entwicklungspsychologie und Medienpädagogik her. Das Rezeptionsverhalten untersuche ich nicht, weil eine solche eigenständige empirische Untersuchung den Rahmen dieser Arbeit ‚sprengen’ würde.
Ich gehe von folgender Grundannahme aus: Filmschaffende sind beim Schreiben und Drehen eines Films überzeugt, sie könnten Reaktionen und Emotionen des Zuschauers antizipieren und durch die Machart des Films beeinflussen. Gleichzeitig ist allen Beteiligten bewusst: ob die Zuschauer den Film am Ende tatsächlich dann auch annehmen werden, steht in den Sternen. Der bekannte (Dreh-) Buchautor William Goldman hat diese Ungewissheit Anfang der 1980er Jahre mit dem heute geflügelten Wort auf den Punkt gebracht: „Niemand weiss Bescheid“ (Goldman: 1999: 55.).
2 Bestimmung des Korpus
2.1 Warum Film?
Laut JIM-Studie (2011: 9.) zeigt „etwa jeder Zweite zwischen 12 und 19 Jahren […] Interesse an ‚Kino/Filmen’ (49 %)“ und „jeder Vierte interessiert sich für ‚Film-/TV-Stars’ (27 %)“ (ebd.: 9.). Hinzu kommt, dass es mittlerweile „kaum ein[en] Kinofilm […gibt], der neben seiner ‚normalen’ Onlinepräsenz nicht auch in sozialen Netzwerken präsent ist“ (ebd.: 47.). Mehrfachvermarktung und Medienkonvergenz bestimmen den Medienmarkt (vgl. Theunert/Wagner 2006: 57.). Filme sind präsent im täglichen Leben der Jugendlichen, bieten ihnen vielfältige Gesprächsanlässe und oftmals hat ihre Rezeption selbst noch eine gemeinschaftsstiftende Wirkung (vgl. Scherr 2009: 152.). Baacke bringt es auf den Punkt, wenn er davon spricht, dass der Medienkonsum zu einem konstitutiven Element des Alltags geworden sei (Baacke 2009: 257.). Ferchhoff (1999: 238.) betont die „identitätsstiftende Funktionen“ der Medien.
Die Welt der Jugendlichen definiert sich heute durch eine Flut von Bildern. Mikos (2010: 243.) sieht das in Differenz zur früheren ‚Wortkultur’: „Bilder sind […] konkreter als abstrakte Worte, sie vermitteln räumliche Perspektiven, sie sind unmittelbarer und emotionaler, und dabei zugleich in ihrer Bedeutung offener.“
Die Gefühle der Filme sind zu verstehen, als „komplexes Wechselspiel zwischen realen Gegebenheiten und medialen Offerten“ (Theunert/Wagner 2006: 59.), auf der einen Seite die empathischen Gefühle der Zuschauer, auf der anderen Seite die großen Emotionen der Leinwand. Die Zuschauer fühlen mit und sehen „die in den Medien dargestellten Personen als durchaus real an“ (Scherer 1998: 290.). Filme sind dazu gemacht, mitzuleiden, mitzulachen, mitzuempfinden, sie sind „Spiegel der menschlichen Seele“ (Blothner 2003: 9). Anfang der 1990er Jahre wurde das auch wissenschaftlich bewiesen: Spiegelneuronen „gaukeln uns [vor], die Szenen auf der Leinwand tatsächlich zu erleben“ (Gartner 2004., vgl. Eick 2006: 79., Elsaesser 2007: 98-99.).
Filme spiegeln nicht nur Gefühle, es sind regelrechte „Identitätsangebote“ (Wegener 2010: 58.) und „Vorlage[n] zur reflexiven Auseinandersetzung mit der eigenen Person“ (ebd.). Theunert/Wagner (2006: 59.) sehen bei dieser Ausein- andersetzung „Kreativität und Fantasie“ gefordert. Die Schauspieler sind nicht so sehr Vorbilder im klassischen Sinne, die man imitiert, sondern vielmehr „mediale Bezugspersonen“ (Wegener 2004: 23.). Übernommen werden von den Jugend- lichen „bestimmte Teile der medial präsentierten Rollen“ (Rath/Boehncke 2008: 86.), die im Sinne von Goffmans ‚Selbstpräsentation’ als „Möglichkeiten in Form von Inszenierungen [erprobt werden]“ (Spanhel 2006: 200.). Es wird dann „auf der Basis des Selbstkonzepts und der Lebensbedingungen begutachtet, passgerecht umgemodelt oder verworfen“ (Theunert/Wagner 2006: 59.).
Wegener bezieht sich auf Horton/Wohl (1956) und spricht von parasozialer Inter- aktion. Im gleichen Sinne wird der Begriff auch von Marci-Boehncke/Rath (2006: 97.) und Eick (2006: 79.) verwendet. Sie alle verstehen darunter aber eigentlich etwas anderes als Horton/Wohl (2001: 74-104.), die den Begriff vor allem auf das Fernsehen und das wiederholte Sehen gleicher Formate bezogen hatten. Eicks Erklärung des Begriffs ist aber interessant: Er betont, dass der Zuschauer sich im Rahmen einer parasozialen Interaktion zwar identifiziere, aber „nicht gänzlich ‚eins’ wird mit der Figur“. Im schulischen Kontext stellt sich damit verbunden die Frage nach der kritischen Reflexion des Gesehenen, „nach der Kritikfähigkeit am Star“ (Marci-Boehncke/Rath 2008: 87. ebenso: 2006: 98.). Das ist insofern schwierig, weil die Jugendlichen auf ein solches kritisches Hinterfragen schnell mit Ablehnung reagieren, weil sie das Gefühl haben, man wolle ihnen den Filmgenuss ‚madig’ machen. Die negativen Seiten ihrer Stars wollen sie ja gerade nicht sehen. Denn: „Der Star, der Held lebt das aus, was die Jugendlichen gern wollen“ (Marci-Boehncke/Rath 2006: 105.).
Für Thomas Elsaesser (2009: 14. sp. 1) ist „das Bemerkenswerte an unserer heutigen Filmkultur die Sichtbarkeit des Kinos“. Er sieht es nicht länger beschränkt auf Kinosaal und Leinwand, sondern verortet es „in fast allen Lebensbereichen, verbal und visuell“, sieht das populäre Mainstreamkino gar als eine „lingua franca […], ein Esperanto der Weltkultur“ (ebd.). Heutige Genera- tionen sehen, so Elsaesser, „Kino als Welt der Möglichkeiten, und damit - zumin- dest tendenziell - auch als Möglichkeit der Welt.“ (ebd.: 14. Sp. 2). Das Kino befriedige einerseits „ein extrem selbstbezogenes und narzistisches Interesse am bewegten Bild auf der Leinwand“ und stehe andererseits für ein soziales Bedürfnis dabeizusein, dazuzugehören und sich mitteilen zu können. Mikos (2008: 46) räumt der Analyse von Fernsehsendungen und Filmen einen „besonderen Stellenwert” ein. Er hält sie für wichtig, „um die Prozesse des sinnhaften Aufbaus der sozialen Welt zu verstehen, weil sich darüber die Subjekte in der Gesellschaft positionieren” (ebd.).
Nun ist es zweifelsfrei so, dass es nicht allzuschwer ist, für eine Auseinander- setzung mit Filmen von Regisseuren des Neorealismus, der Nouvelle Vague oder des Neuen Deutschen Films eine kulturelle Akzeptanz zu finden. Auch die Werke von Regisseuren wie Hawks, Hitchcock, Ford, Wilder, Allen, Scorsese, Coppola sind bei der Mehrheit der Bevölkerung als Kunst anerkannt. Aber lohnt sich eine wissenschaftliche Untersuchung von Jugendfilmen? Timothy Shary betont, dass das Genre Jugendfilm es nicht nur wert sei, untersucht zu werden, sondern er sieht eine gesellschaftliche Relevanz gegeben: „Youth film […]question our evolving identities from youth to adulthood while simultaneously shaping and maintaining those identities“ (Shary 2002: 11.).
Im angloamerikanischen Sprachraum kursiert für Literatur und für Filme, die sich mit dem Erwachsenwerden befassen der Begriff ‚Coming of Age’.
In simplest terms a coming of age story is one in which a child or a teenager reaches a critical turning point or event that results in a loss of childhood innocence. Not surprisingly, most often this turning point revolves around adolescent sexuality. (Lort 1997: 7.)
Und Schulfilme? „Im Laufe des 20. Jahrhunderts wird Jugendzeit mehr und mehr […] Schulzeit“ (Reh/Schelle 2000: 161.). Ist nicht allein diese Tatsache Grund genug Schulfilmen im Rahmen solch einer Arbeit Aufmerksamkeit zu schenken? Erfahrungen und Erlebnisse der SchülerInnen werden von den Filmen schließlich nicht nur aufgegriffen, sondern gleichzeitig vorbildhaft vermittelt. Schulfilme wirken mit an dem Bild, das sich die Gesellschaft vom Sozial- und Lebensraum Schule macht.
2.2 Welche Filme?
Bei meiner Suche nach geeigneten Filmen orientiere ich mich zunächst an einer Zusammenstellung der Jugendzeitschrift Bravo (2006), die als „coolste“ Schulfilme folgende auflistet: Die Feuerzangenbowle (1944), Die Lümmel von der ersten Bank (1967-1972), Grease (1978), La Boum I + II (1981/82), The Breakfast Club (1985), Ferris macht blau (1986), Can`t buy me love (1988), Club der toten Dichter (1990), Buffy, die Vampirkillerin (1992), Dangerous Minds (1996), Scream (1997), American Pie (1999), Schule (2000), Harte Jungs (2000), Harry Potter (2001), Mädchen, Mädchen (2001) u.a..
In einem ersten Zugriff schließe ich alle Filme aus, bei denen die Thematik ‚Schule’ von einer anderen zu sehr dominiert wird: Bei Grease ist es die Musik, bei Buffy sind es die Vampire und bei Harry Potter die Zauberei. Zweitens habe ich mich zunächst auf einige deutsche Filme beschränkt, weil mir da das Schulsystem bekannt ist.
In den letzten Jahren sind in Deutschland einige Schulfilme junger Regisseure entstanden: Über Marco Petrys Filme Schule (2000) stellt der Kritiker Rüdiger Suchsland (2000) in seiner Kritik fest, dass Petry das „Gymnasium nur als Hintergrund“ für seinen Film benutzt hat und sieht die Stärke des Films allein in seiner Atmosphäre. Silke Schütze (2000) beurteilt den Film noch kritischer. Sie sieht den Blick des Regisseurs von Nostalgie getrübt und urteilt spitz, dass „Petry seine Geschichte in nett-harmlosen Stereotypen [vertändelt]“. In seinem zweiten Film Die Klasse von `99 weckt allein der Titel Schulassoziationen. Tatsächlich handelt er von einem jungen Polizisten, der sich in seine alte Heimatstadt hat versetzen lassen und dort alte Schulkameraden wiedertrifft.
Tomy Wigands Das fliegende Klassenzimmer (2002) halte ich für sehr gelungen.
Doch auch wenn der Film ganz eigene, erfrischende Wege geht, ist er meiner Einsicht nicht ohne den Kontext der Kästner-Vorlage zu untersuchen. Eine solche diachrone Betrachtungsweise - evtl. noch mit Hinzunahme der Verfilmungen von 1954 und 20031 - wäre eine eigene, eine andere Arbeit.
Im Jahre 2002 ist für den Sender Pro7 die Teenagerkomödie seventeen-Mädchen sind die besseren Jungs entstanden. Es geht um das Mädchen Luka, die von ihren Eltern auf ein Internat geschickt wird und dort irrtümlicherweise für einen Jungen gehalten wird. Was sich nach einem faden Aufguss von Charleys Tante anhört, ist eine beschwingte Komödie, die trotz aller Situationskomik die Ängste und Sehn- süchte der Jugendlichen ernst nimmt. Identitätsfragen werden angesprochen und Rollenklischees leichtfüßig hinterfragt. Ein überdurchschnittlich gelungener Fernsehfilm, dessen Erfolg sich in der DVD-Veröffentlichung und einer Spin-Off- Serie niederschlug. Jedoch stehen die Beziehungen der Peergroup im Vordergrund und die Unterrichtsszenen werden eher beiläufig behandelt.
Der Film Mädchen Mädchen (2001) hat zwar sympathische Hauptdarstellerinnen, und die Erzählperspektive aus Sicht der Mädchen ist interessant, aber es geht vor allem um Party und um Sex und nicht um Schule. Der Wald vor lauter Bäumen (2003) erzählt von einer jungen Lehrerin, die von ihrer ersten Stelle und ihrer ersten eigenen Wohnung hoffnungslos überfordert ist. Zwar hat der Film einen interessanten, wirklichkeitsorientierten Ansatz, aber da die SchülerInnen durchweg als bedrohliche, anonyme Menge dargestellt werden, langweilt der Film schnell.
Bei den deutschen Filmen zeigte sich bald, dass Referenzpunkt für alle filmischen Schulfilme immer noch Die Feuerzangenbowle ist. Es ist den deutschen Filmschaffenden in den letzten fast siebzig Jahren nicht gelungen, einen Film zu drehen, der heute ähnlichen Kultstatus genießt. Der Thron, auf den der Film im vorweihnachtlichen Ritual von Studenten gehoben wird, lässt verwundert aufmerken. Noch zu Zeiten der Programmansage stellt Witte (1995: 240.) fest, dass die ‚Bowle’ als „der [Hervorh. ChB] Klassiker des deutschen Filmlustspiels vorgestellt wird, als hätte es Lubitsch nie gegeben.“ Das ist insofern bemerkenswert, da es die amerikanische ‚romantic comedy’ ohne den jüdisch- deutschen Filmemacher Lubitsch vielleicht nie gegeben hätte und es ist doch sonderbar, dass ein Durchhaltefilm der Nazis heute immer noch populärer ist als die viel besseren, viel interessanteren Lubitsch-Filme. Doch Die Feuerzangen- bowle ist ein Kultfilm. Das lässt sich nicht wegdiskutieren. „Wichtiges Kriterium eines Kultfilms ist […] seine Identifikationsmöglichkeit“ (Hahn/Jansen 1998: 11.). Ob der Film politisch korrekt ist, spielt da anscheinend keine Rolle. Ich werde also Die Feuerzangenbowle in meine Untersuchungen einbeziehen.
Wendet man sich dem amerikanischen Schulfilm zu, so ist American Pie (1999) einer der populärsten Filme der letzten Jahre, ein Film dessen Erfolgsrezept mit mehreren Sequels aufgegriffen wurde. Erfolgsrezept meint vor allem: offensiver Umgang mit dem Thema Sexualität, das macht der Film auch gleich zu Beginn unmissverständlich klar. Dennoch: Es werden typische Teenagerprobleme angesprochen wie der Druck der Clique‚ erster Sex, Alkohol, Parties oder die Rolle als Außenseiter. Was mich an dem Film stört: Es findet keine echte Auseinandersetzung mit den Problemen statt, die Probleme dienen nur als Ausgangspunkt für die nächste Pointe. Die Witze mögen dann von Jugendlichen als emotional befreiend empfunden werden, aber für eine wissenschaftliche Analyse scheint mir das zuwenig.
Da ich die Auswahl jedoch nicht vorbei am Geschmack der Jugend treffen will, gehe ich dieser Spur dennoch nach, indem ich einen Vorläufer von American Pie nehme und überprüfe, ob so ein Klassiker einer Analyse eher ‚standhält’. Fast Times at Ridgemont High (1982) ist eine Geschichte, die vom heute bekann- ten Regisseur Cameron Crowe nach eigenen Erfahrungen zunächst als Roman und dann als Drehbuch verfasst wurde. Zwar werden auch hier Fragen nach Sexualität humorvoll behandelt, aber im Gegensatz zu American Pie nimmt dieser Film die Fragen und Probleme der Adoleszenz ernst und die Geschichte dient nicht lediglich dazu, Witze aneinanderzureihen. Das Filmlexikon von Zweitausendeins schreibt: „Mit in diesem Genre seltener Zurückhaltung beschreibt der Film Rollenvorstellungen und Zukunftserwartungen der Schüler und setzt einige soziologisch interessante Akzente.“2 Qualitativ ebenso hervorgehoben werden müssen die Filme Diner (1982) von Barry Levinson und American Graffiti (1973) von George Lucas, jedoch handeln sie nicht so sehr von der Schulzeit, sondern vom Übergang zum Erwachsenwerden bzw. vom Wechsel zum College. Auch Fast Times at Ridgemont High spielt weniger im Klassenraum, sondern in der Mall, im Restaurant, im Auto, im Gang vor den Spinds, am Swimming Pool, zu Hause, beim Arzt - auch hier geht es mehr um die Peergroup als um das Lehrer- Schüler-Verhältnis, weshalb er trotz aller Qualitäten nicht in Frage kommt.
Im Film Dangerous Minds (1995) versucht eine engagierte Lehrerin eine ‚Problemklasse’ mit geringer Bildung, mit vielen Hispanics und Afro- Amerikanern, zum Lernen zu motivieren. SchülerInnen mit Zuwanderungs- geschichte spielen auch in Deutschland eine immer größere Rolle im Schulalltag. So ließen sich durchaus Parallelen finden, aber der Film ist mir einfach zu amerikanisch, zu sehr Mainstream, zu sehr und zu offensichtlich eine Simpson/Bruckheimer-Produktion.
Weil sich die Suche nach dezidierten Schulfilmen schwierig gestaltet, erachte ich es für sinnvoll, auch einen kurzen Blick auf zwei erfolgreiche amerikanische Coming-of-age-Filme der letzten Jahre zu werfen, auch wenn es keine Schulfilme sind, um so etwas wie eine Perspektive zu entwickeln: Little Miss Sunshine (2006) und Juno (2007). Zwar sind die Oscars nicht notwendigerweise Gradmesser für Innovation, aber wenn zwei Jugendfilme hintereinander den Oscar für ihr Drehbuch bekommen, ist das doch Grund genug genauer hinzuschauen:
Little Miss Sunshine (2006) handelt von dem kleinen Mädchen Olive, das vernarrt ist in den Traum, Schönheitskönigin zu werden. Es ist ein Film über den Zusammenhalt einer Familie, über menschliche Wärme und Wertschätzung der Gefühle des anderen. Es ist ein Film voller skuriler und doch lebensechter Charaktere: Der Vater Olives Richard ist ein erfolgloser Erfolgscoach, der Groß- vater ist wegen Drogenmissbrauchs aus dem Altersheim geflogen, der Bruder hat wegen der Lektüre von Nietzsche ein Schweigegelübde abgelegt und der Mutter Sheryl wächst all das langsam über den Kopf. Als wäre die Situation nicht schon kompliziert genug, haben sie jetzt auch noch ihren homosexuellen Bruder aufgenommen, der gerade versucht hat, sich umzubringen. Es ist ein Film über eine Reise, die alle auf sich nehmen, obwohl nicht abzusehen ist, dass der Traum von Olive in Erfüllung geht. Es ist ein Film, der ermutigt, seine Träume ernst zu nehmen und es ist ein kritischer Film, der die schönheitsfixierte Medienwelt Amerikas hinterfragt.
Juno thematisiert eine ungewollte Schwangerschaft der sechzehnjährigen Juno und erzählt in einem ganz eigenen, besonderen Tonfall, wie sich das junge Mädchen dafür entscheidet, das Kind zur Welt zu bringen. Kleingers (2008) konstatiert: „Kein anderer Film der letzten Monate hat in den USA für vergleich- bare kollektive Verzückung bei Publikum und Kritik gesorgt.“ Gleichzeitig nimmt er all jenen Kritikern den Wind aus den Segeln, die in einem ‚breiten Konsens’ automatisch gedankenlosen, einfallslosen Mainstream vermuten: „In seltenen, kostbaren Momenten entsteht Konsens eben nicht durch die allgemeine Beschränkung auf das Mittelmaß, sondern weil die ganz eigene Freude über etwas Originelles, Schönes und Wahres plötzlich Widerhall in den individuellen Erfahrungen anderer findet.“ Kleingers sieht in der Rolle der Juno das schier Unmögliche gelingen: „Als hochschwangere 16-Jährige mit Dickkopf und drastischem Vokabular ein inspirierendes Rollenmodell zu sein“.
Für mich sind diese beiden Filme herausragende Beispiele für gelungene Coming- of-Age-Filme. Auffallend, dass sie gerade nicht in der Schule spielen. Bei der Durchsicht der Filme - auch einiger hier nicht aufgeführter - hat sich bei mir der Eindruck festgesetzt, dass das Genre Schulfilm in einer Sackgasse ist, in Deutschland wie in Amerika, so dass noch einmal ein Blick in die Vergangenheit sinnvoll erscheint. Bei der Durchsicht des Buches Generation Multiplex von Timothy Shary, sowie einiger Kritiken und Nachrufe auf John Hughes komme ich zu der Überzeugung, dass der Film The Breakfast Club von John Hughes prägend für das Genre des Schulfilms gewesen ist und immer noch ist. Christian Heger (2009): „Hughes [räumt] ohne jeden inszenatorischen Firlefanz den Sorgen, Träumen und Erwartungen der jungen Generation breiten Raum ein, und verlässt sich dabei fast ausschließlich auf das authentische Spiel seiner jungen, rasch als ‚Brat Pack’ titulierten Darstellerriege.“ Timothy Shary (2002: 9.) lobt The Break- fast Club, da er „a variety of youth culture styles and types” zeige. Auch Gora (2010: 6.) sieht den Film The Breakfast Club in einer Schlüsselstellung: „But perhaps the film that taught us the most was the one set in a high school library over the course of along day in detention.” Und Thomas A. Christie (2009: 73.) schließlich wertet den Film als „pioneering approach to the teen movie genre“ und versteht das Ergebnis als „redefinition of genre boundaries“ (ebd.: 73.). Gora (2010: 82.) resümiert: „The story of a brain, a beauty, a jock, a rebel, and a recluse spending a day together in detention would go on to become the gold standard in teen cinema, the film to which all other serious movies about young people would be compared.”
Somit habe ich zwei Filme: Die Feuerzangenbowle und The Breakfast Club. Ich würde nun gerne - ausgehend vom reaktionären deutschen Umgang mit der Feuerzangenbowle - zeigen, dass es auch möglich ist, sich aus dem Schatten eines solchen Kultfilms zu lösen. Dafür lohnt es sich, nach Frankreich zu schauen:
Wer in den 1980er Jahren als Junge in Deutschland groß geworden ist, ist an der Liebe zu zwei französischen Filmen nicht vorbeigekommen. Genauer gesagt war es die Liebe zur französischen Hauptdarstellerin Sophie Marceau. Ihre beiden La Boum-Filme fanden den direkten Weg in die Herzen der pubertierenden Zuschauer. Das lag einerseits daran, dass in diesen Filmen die Adoleszenz- probleme ernst genommen werden, im Kleinen wie im Großen: Das Küssen mit Zahnspange, die Beziehungskrise der Eltern, das Verliebtsein in den Lehrer, die erste eigene Boum (Party). Gleichzeitig wurden die Geschichten mit so viel Charme, Witz und Esprit erzählt, dass die Düsternis der eigenen pubertären Wirrnisse wie weggeblasen waren.
Ähnlich wie die Deutschen zwanzig Jahre nach der Feuerzangenbowle einen faden Aufguss infantiler Schülerstreiche mit der Lümmel-Pauker-Reihe drehten, hätte es auch in Frankreich passieren können. Warum nicht einfach das Erfolgsrezept von La Boum aufs neue versuchen? Laurent Cantet ist mit Entre les murs - Die Klasse einen anderen Weg gegangen. Er selbst sagt: „Mein Film ist das Gegenteil vom ‚Club der toten Dichter’“(Cantet 2009). Von der französischen Presse wird der Film gelobt, sie sieht den Film ein Fenster öffnen: «Le titre suggère un enfermement. Le film abat les cloisons, ouvre les fenêtres, fait circuler le courant d`air de l`intelligence, donc des doutes, allume la flamme du cinéma, qui mérite ici qu`on l`appele cinématographe» (Lefort 2008). Der Film ist ein fast dokumentarischer Blick auf den französischen Schulalltag, hat aber gleichzeitig hohen Unterhaltungswert.
Die Feuerzangenbowle, The Breakfast Club und Entre les murs: Warum lohnt sich eine Spurensuche bei gerade diesen drei Filmen? Läuft man nicht unweigerlich Gefahr, hier den sprichwörtlichen Vergleich von Äpfeln und Birnen vorzunehmen? Die Filme stammen aus ganz unterschiedlichen Ländern - Deutschland, USA, Frankreich - mit ganz unterschiedlichen Schulsystemen, sie sind in ganz unterschiedlichen Zeiten entstanden - 1940er, 1980er, 2000 - sie erzählen ganz verschiedene Geschichten in unterschiedlichem Stil, aber doch macht ihre Zusammenschau Sinn.
Wenn sich schon keine Bestandsaufnahme des deutschen Schulfilms lohnt, dann aber doch das Aufzeigen von Möglichkeiten anhand eines archetypischen Musters aus Deutschland, und anhand von neueren Beispielen aus Amerika und Frankreich. Ich möchte mit dieser Arbeit zeigen, dass Kultfilme nicht einfach für alle Zeiten übernommen werden müssen, sondern dass sie danach verlangen, kritisch hinterfragt zu werden und dass sowohl auf Seiten der Macher als auch auf Seiten der Rezipienten Räume für Neues geöffnet werden müssen.
Meine Beweggründe möchte ich noch kurz erklären. Vielleicht hilft ein Vergleich mit der Musik. Allzuleicht wird in der Musik alles in E- und U-Musik eingeteilt. Ernste Musik und Unterhaltungsmusik. Steht das eine für Kultur, so dient das andere lediglich der Entspannung und dem Zeitvertreib. Diese Unterteilung lässt sich beliebig übertragen: Opern sind Kultur, Musical sind Entertainment. Klassiker sind Kultur, Bestseller dienen der Unterhaltung. Auch im Bereich des Films führt Erfolg an der Kinokasse quasi automatisch zum Generalverdacht ‚Das ist bloß Unterhaltung’. Im Jahre 2003 wurden deutsche Filmschaffende, Filmhistoriker, Filmkritiker und Filmpädagogen eingeladen, um gemeinsam einen Filmkanon zu entwickeln. Bei dem entwickelten Kanon fehlen Schulfilme völlig. Das erscheint mir angesichts der Tatsache, dass sich ein solcher Filmkanon ja vor allem an Lehrer und ihre SchülerInnen richtet sehr fragwürdig. Böten nicht gerade Schulfilme gute Anknüpfungspunkte? Die deutsche Ernsthaftigkeit und Überzeugung, nur an Klassikern lernen zu können, versperrt meiner Einsicht nach Wege zum Erfahrungshorizont der SchülerInnen. Ich möchte zeigen, dass Filme wie The Breakfast Club und Entre les murs es allemal wert sind, in der Schule gezeigt zu werden und dass eine Auseinandersetzung gewinnbringend sein kann.
3 Theorie
Um die Schulfilme analysieren zu können, erscheint mir ein theoretischer Einstieg sinnvoll: Was ist eigentlich Jugend? Was macht sie aus? Wie kann sie definiert werden? Wie lässt sich ‚Identität’ fassen? Was ist mit dem Sozialraum ‚Schule’? Wie lässt sich die ‚Gemachtheit’ eines Films entschlüsseln? Wie kann man über ihn reden, ohne sich im Subjektiven zu verlieren?
3.1 Jugend
3.1.1 Lebensphase
Heute ist ‚Jugend’ und ‚Jugendlichkeit’ nahezu omnipräsent, noch 50-jährige wetteifern ohne Selbstzweifel mit ihren eigenen Kindern um den neuesten Look, den angesagtesten Musikact oder die ‚hippste’ Freizeitaktivität (vgl. Baacke 2009: 47.). Dass der ‚Jugend’ heute eine solch große Bedeutung zugemessen wird, ist bemerkenswert, weil die Lebensphase ‚Jugend’ historisch gesehen noch nicht sehr alt ist.
Noch bis zur Industrialisierung galt ein junger Mann oder eine junge Frau nach dem Ereignis der Geschlechtsreife (Pubertät) als voll erwachsen, eine Zwischenphase in Gestalt der Lebensphase Jugend gab es nicht. (Hurrelmann 2006: 33. Sp. 1.)
Wie lässt sich die ‚Jugendphase’ fassen? Unterschiedliche Definitionen je nach Blickwinkel sind möglich:
Vom erziehungswissenschaftlichen Standpunkt lässt sich ‚Jugendphase’ zielorientiert definieren: „Menschen [suchen] in ihr nach Lebensorientierung […, trachten danach], sich in der Gesellschaft zu positionieren […] und beginnen, sich biographisch selbst zu thematisieren“ (Marotzki u.a. 2005: 84.).
Oder man kann ‚Jugend’ psychologisch erfassen, indem man die unterschiedlichen Einflüsse in den Mittelpunkt stellt: Jugend als „Phase innerhalb des Lebenszyklus, die durch das Zusammenspiel biologischer, intellektureller und sozialer Veränderungen zur Quelle vielfältiger Erfahrungen wird“ (Oerter/Dreher 2008: 271.).
Oder man definiert soziologisch, wie Scherr (2009: 24.), der vor allem die Beziehung zur restlichen Gesellschaft in den Fokus rückt. Von ihm wird Jugend verstanden als „eine gesellschaftlich institutionalisierte und intern differenzierte Lebensphase, deren Abgrenzung und Ausdehnung sowie deren Verlauf und Ausprägung wesentlich durch soziale […]Bedingungen und Einflüsse bestimmt ist.“
Ganz gleich von welcher Warte man auf ‚Jugend’ schaut: „Zum ersten Mal im Lebenslauf kommt es zu einer bewussten oder doch zumindest bewusstseinsfähigen Entwicklung eines Bildes vom eigenen Selbst und einer IchEmpfindung“ (Hurrelmann 2010: 28.).
Die zunehmende Sozialisation durch die Medien hat auch Folgen für die früher dominierenden Sozialisationsinstanzen Elternhaus und Schule: „Eine hierarchisch angelegte Autorität, die in allen Dingen das letzte Wort hat, ist Geschichte geworden“ (Kerlen 2005: 163.). Die so gewonnene Freiheit wird aber durch die gleichzeitig länger währende finanzielle Abhängigkeit konterkarriert, „eine merkwürdige Dialektik abgelehnter Autorität bei gleichzeitiger ökonomischer Unterstützung: eine ‚fortschreitende Öffnung der Schere zwischen soziokultureller und sozioökonomischer Selbstständigkeit’“ (Kerlen 2005: 163.).
Möchte man die Jugendphase dennoch zeitlich fassen, so ist allgemeiner Konsens, dass sie mit dem Einsetzen der Pubertät beginnt, festgemacht an dem Eintreten der Geschlechtsreife (z.B. Baacke 2009: 41., Fend 2001: 101., Ferchhoff 1999: 68., Oerter/Dreher 2008: 272., Zimbaro/Gerrig 2008: 370.). Die Bestimmung des Endes variiert. Oerter/Dreher (2008: 272.) nehmen beispielsweise eine Differen- zierung in frühe, mittlere und späte Adoleszenz vor, so dass sich bei ihnen die Adolesezenzphase bis ins dritte Lebensjahrzehnt erstreckt. Baacke sieht dagegen die Altersgruppe der 13- bis 18-Jährigen als „sinnliche Einheit“ (Baacke 2009: 42.), die sich durch „die körperlichen Veränderungen der Adolesezenz, neue Verhaltensweisen und ein[en] atmosphärisch[en] Gesamthabitus“(ebd.) definiert.
Allgemeiner Konsens ist wiederum, dass sich die Jugendphase nicht zuletzt durch den längeren Schulbesuch in den letzten Jahrzehnten mehr und mehr ausgedehnt hat und dass „sich der Übergang ins Erwachsenenalter in eine tendenziell zusammenhanglose Abfolge von Teilübergängen ausdifferenziert“ (Baacke 2009: 49.). Es wird auch von einer Entstrukturierung der Jugendphase gesprochen.
Die Menschen erhalten durch kulturelle Symbole, Zeremonien und gesellschaftliche Bräuche nur noch wenige Anhaltspunkte dafür, in welcher Phase ihres Lebenslaufes sie sich gerade befinden. […] Traditionelle Übergangszeremonien (Initiationsriten) wie Schuleintritt, religiöse Firmung, Berufseintritt und Heirat verlieren ihre Bedeutung. Die Grenzziehung zwischen den einzelnen Lebensabschnitten wird durch die große Zahl der aufeinander folgenden Lebensphasen im Lebenslauf durchlässiger (Hurrelmann 2010: 18.).
Strukturierung von Lebensphasen zu vier historischen Zeitpunkten (Hurrelmann 2010: 17.)
Früher wurde ‚Jugend’ aufgefasst als Transitionspassage, als „ein vergleichsweise kurzschrittiger und mit wenig sozialem und kulturellem Eigengewicht ausgestatteter Lebensabschnitt“. Heute wird ‚Jugend’ vielfach „als Bildungs- moratorium im Lebenslauf“ (Zinnecker 1991: 72-73., vgl. Baacke 2009: 46-47.) verstanden. Auch Hurrelmann (2010) sieht für diese Lebensphase eine „eigen- ständige Bedeutung“ (ebd.: 41.), „obwohl oder gerade weil ihr die gesell- schaftliche Legitimation fehlt, die ursprünglich durch ihren Übergangscharakter mit einem qualifikatorischen ‚Zubringerdienst’ zu den vollwertigen Erwachsenenpositionen gegeben war“ (ebd.: 23.). Wägt man die beiden Begriffe ‚Transition’ und ‚Moratorium’ gegeneinander ab, so ergeben sich je nach Autor unterschiedliche Schwerpunktsetzungen: Während Oerter und Fend eher Havig- hurst folgen und die Transition betonen, ist für Schelsky, Baacke, Zinnecker eher die Auffassung Eriksons vom Moratorium wegweisend, so Hurrelmann (2010: 43.). Er selbst sucht eine Verbindung beider Auffassungen und betont den „Akteurcharakter“ von Jugendlichen, indem er sie „als Produzenten ihrer eigenen persönlichen Entwicklung [versteht], die in der Lage sind, dynamische Beeinflussungsprozesse zwischen sich selbst und ihrer Umwelt herbeizuführen“ (ebd.). Für ihn können „Jugendliche sowohl eine Transitions- als auch eine Moratoriumskonzeption und auch verschiedene Kombinationen dieser Konzeptionen realisieren“ (ebd.: 44.). Sieht er beide Konzepte in seinem Buch ‚Lebensphase Jugend’ in eben einem solchen Gleichgewicht, so diagnostiziert er im Shell-Bericht von 2006 eine Entwicklung zugunsten des Moratoriums:
Die Lebensphase Jugend ist […] heute eine eigenständige Spanne im Lebenslauf, hat aber ihren ursprünglichen Übergangscharakter mit einem qualifikatorischen Zubringerdienst zu den vollwertigen Erwachsenenpositionen verloren. Die sozial- und arbeitsmarktpolitisch in die Länge gestreckte Lebensphase Jugend wird eine Zeit des Moratoriums, des quasi zwecklosen Verweilens in der Gesellschaft, ohne eine feste Perspektive und ohne klare Verantwortung für gesellschaftliche Belange (Hurrelmann u.a. 2006: 35. Sp. 1.).
Charakteristisch für die Jugendphase ist die Konfrontation mit zentralen Entwicklungsaufgaben (Fend 2001: 222 ff., Hurrelmann 2010: 27-28., Oerter/ Dreher 2008: 279 ff..), die die eigene Person, die Beziehung zum sozialen Umfeld und die berufliche Zukunft in vielfältiger Form betreffen. So müssen Jugendliche hinsichtlich ihres sozialen Umfelds nicht nur lernen, „einen Freundeskreis auf[zu]bauen, d.h. zu Altersgenossen beiderlei Geschlechts neue, tiefere Bezieh- ungen her[zu]stellen“ (Dreher & Dreher 1996 nach Oerter/Dreher 2008: 279.), sondern sie müssen ebenfalls auch lernen „engere Beziehungen zu einem Freund bzw. einer Freundin auf[zu]nehmen […und] sich von den Eltern los[zu]lösen, d.h. von den Eltern unabhängig [zu] werden“ (ebd.).
Im Verlaufe der Jugendphase „sind die Gleichaltrigen wichtige Interaktions- partner, die im Verlauf der Kindheits- und Jugendphase immer bedeutsamer werden“ (Oswald 2008: 321.). Im Unterschied zu den Sozialisationsinstanzen ‚Elternhaus’ und ‚Schule’ lernen die Jugendlichen in der Peergroup nicht durch Übernahme von Verhaltensmustern, sondern durch gemeinsame Interaktion, durch „gemeinsame Aneignung von Räumen und Stilen“ (Böhnisch 2008: 158.).
3.1.2 Identität
‚Identität’ lässt sich fassen aus sozialwissenschaftlicher Sicht, aus Sicht der Entwicklungspsychologie, aus Sicht der Sozialpsychologie oder aus Sicht des sozialen Konstruktivismus (vgl. Wegener 2010: 55-57.). Stets wird jedoch ‚Identi- tät’ nicht als unveränderliche Größe verstanden. Meinen Akzent lege ich auf die sozialwissenschaftliche und die entwicklungspsychologische Sicht, den Ansatz der Sozialpsychologie und des Konstruktivismusses benenne ich nur kurz.
Zentral für die sozialwissenschaftliche Rollentheorie George Herbert Meads ist seine Wertschätzung der menschlichen Kommunikation, die er sowohl als Grundprinzip für die gesellschaftliche Organisation des Menschen als auch für die Organisation der menschlichen Identität sieht (vgl. Abels 2006: 255.). Für Mead ergibt sich ein Verständnis von Identität, das sich nicht darin erschöpft „ein mehr oder weniger isoliertes und selbstständiges Element“ (Mead 1973: 207.) zu sein, sondern das verknüpft ist mit „ein[em] bestimmte[n] Verhalten, eine[m] bestimmten gesellschaftlichen Prozeß, der die wechselseitige Beeinflussung verschiedener Individuen voraussetzt“ (ebd.). Anders gefasst: Das Besondere an der menschlichen Kommunikation ist unsere Fähigkeit, auf eigene Äußerungen zu reagieren und mögliche Reaktionen meines Gegenübers in Form einer Rollenübernahme zu antizipieren (vgl. Joas 1991: 138. Sp.1.). Das ‚Ich’ entsteht nach dem Verständnis von Mead in einem sozialen Prozess (ebd.: 138. Sp.2.). Indem wir uns mit den Augen des Anderen sehen, erkennen wir uns selbst.
Erik H. Erikson hat ein entwicklungspsychologisches Modell entwickelt, das aus verschiedenen Stufen besteht, die der Mensch in seinem Leben sukzessive durchläuft und in denen er altersspezifische Aufgaben zu bewältigen hat. Grundsätzlich sieht Erikson (1973: 61.) jedes dieser Stadien als Krisensituation, „weil das einsetzende Wachstum […]Hand in Hand geht mit einer Verschiebung der Triebenergie und zugleich das Individuum in diesem Teil besonders verletzlich macht.“ Fend (2001: 404.) interpretiert Eriksons Modell wie ein Versprechen, als „Stufenfolgen, in denen im glücklichen Fall Stufen des Vertrauens zur Welt und zu sich selber aufgebaut wird.“
Die Phase der Adoleszenz ist nach Erikson gekennzeichnet durch die Krise ‚Identität vs. Rollendiffusion’, eine Krise zwischen dem „entspannte[n] Erleben des eigenen Selbst“ (Zimbardo/Gerrig 2008: 389.) und einer Wahrnehmung, die „bruchstückhaft, schwankend und diffus“ (ebd.) ist. Um dieses Gefühl der Identitätsdiffusion nicht zulassen zu müssen, „werden [Jugendliche oftmals] bemerkenswert exclusiv, intolerant und grausam gegen andere, die ‚verschieden’ sind in Hautfarbe oder Herkunft, Geschmack und Gaben, oft auch nur in ganz winzigen Momenten der Kleidung und Gestik“ (Erikson 1973: 110.). Erikson betont, dass es wichtig sei, „diese Intoleranz als notwendige Abwehr gegen ein Gefühl der Identitätsdiffusion [zu verstehen]“ (ebd.).
Identitätsdiffusion kann sich aber ebenso in der Flucht in eine negative Identität, also in eine Pseudoidentität [zeigen]. Hier wird das Eigene durch die schlichte Wahl des Gegenteils, was andere sind und erwarten, gefunden. Es erfolgt also keine Auseinandersetzung mit Positionen, es reicht, einfach ‚anders’ zu sein (Fend 2001: 406.).
„Erikson nahm an, dass die essenzielle Krise der Adoleszenz [trotz aller Verwirrungen] zur Entdeckung der wahren eigenen Identität führt“ (Zimbardo/Gerrig 2008: 390.).
In postmodernen Debatten kursiert ein anderes Verständnis von Identität. Wissenschaftler die diesen Ansatz verfolgen, sehen „Identitätsentwicklung als fortlaufenden, nie abgeschlossenen Prozess und sehen Identität damit als Weg und nicht als Ziel“ (Wegener 2010: 56.). Einer, der in diese Richtung gearbeitet hat ist Heiner Keupp. Er fasst die Identitätskonstruktion der Jugendzeit als „Projekt- entwurf des eigenen Lebens“ (nach Wegener 2010: 56.) auf, der etwas vorüber- gehendes, vorläufiges hat und dessen Ausgestaltung „die gesamte Lebensspanne umfasst“ (ebd.).
Anhänger des sozialen Konstruktivismus gehen noch einen Schritt weiter. Für sie ist sogar die Idee eines ‚Kerns’ von Identität obsolet geworden. Sie „konstituieren das Subjekt ausschließlich in Form eines Nebeneinanders unzusammenhängender Beziehungen“ (Wegener 2010: 57.). Für dieses Nebeneinander von Beziehungs- mustern gegenüber einer „zunehmend komplexer, mobiler und undurchschaubarer werdende[n] Gesellschaft“ (Thole 2010: 755.) hat sich der Begriff ‚Patchwork- identität’ durchgesetzt (vgl. Abels 2006: 288, Ferchhoff/Neubauer 1997: 115., Ferchhoff 1999: 239., Oerter/Dreher 2008: 308, 335., Thole 2010: 755.).
3.1.3 Schule
Wenn SchülerInnen über Schule reden ist für sie alles von Interesse, „was auf der sozialen Ebene geschieht, es sind individuelle, nicht themenbezogene Hand- lungen, die für [sie] im Vordergrund stehen“ (Hornstein 1990: 65.). Dieser Auf- merksamkeitsfokus hat sich in den letzten Jahren noch einmal verstärkt, da die Schule ihr „Informationsmonopol“ (Fend 2001: 378.) verloren hat und die SchülerInnen ihr Wissen oft nicht mehr aus dem Schulunterricht, sondern aus dem Internet beziehen. Die „Medien [sind] zu den wichtigsten Quellen geworden […], die Welt kennen zu lernen“ (ebd.). Diese Veränderung muss jedoch nicht zwangsläufig bedeuten, dass die Schule als Sozialisationsinstanz weniger wichtig geworden ist. Der „heimliche Lehrplan“ (vgl. z.B. Baacke 2009: 301.) löst den offiziellen ab.
Das Einüben in die Verkehrsformen der Institution (Hierarchie, Konkurrenz) und in das Beziehungsgeflecht der Peergroup (Solidarität, Anerkennung) [ist] für die Persönlichkeitsentwicklung mindestens so wichtig wie der Erwerb des fachlichen Wissens (Horstkemper/Tillmann 2008: 290.).
‚Unterricht’ wird von den SchülerInnen oft ganz pragmatisch betrachtet. Sie erkennen zwar an, dass die Schule die nötigen Zugangvoraussetzungen für Ausbildung oder Universität schafft, aber lassen sich als Person emotional nicht auf den Lehr-/Lernprozess ein. Liegt es vielleicht an der sich langsam ausbreitende[n], lähmende[n] Vermutung, daß Zertifikate und Abschlußzeugnisse in vielen Fällen keine Garantie dafür darstellen, den erhofften Ausbildungs-, Studien- oder Arbeitsplatz auch wirklich zu ergattern (Hornstein 1990: 66., vgl. Fuchs 1983: 341.).
Schon 1990 sah Hornstein nicht nur „eine weitgehende faktische Abkoppelung des Beschäftigungssystems vom Bildungssystem“ (ebd.: 71., vgl. Baacke 2009: 51., Ferchhoff 1999: 186.), sondern auch das Wegbrechen „kulturelle[r] Selbstverständlichkeiten“ (ebd.: 81.). SchülerInnen entwickeln in Opposition zur Schule und zur Gesellschaft eine eigenständige Haltung, die sich von tradierten Werten und Normen entfernt. Fuchs hatte bereits 1983 festgestellt: „Das Lebensalter, das der Vorbereitung auf individuelle Lebensführung dient, wird selbst individualisiert“ (Fuchs 1983: 341.).
3.2 Dramaturgie
Mithilfe der dramaturgischen Begrifflichkeiten wird sowohl ein gezielter Zugriff auf die Schlüsselstellen des Films - Exposition, auslösendes Ereignis, Wendepunkte, Mid-Point usw. - als auch eine Analyse von Figuren, Szenen und Dialogen möglich. Diese dramaturgischen Schlüsselstellen sollen mein Referenz- rahmen sein. Auch aus einem anderen Grund erscheint diese dramaturgische Einführung sinnvoll. Mikos (2008: 50.) betont die Bedeutung der Dramaturgie, weil Narration und Dramaturgie „die Grundlage für die Geschichten in den Köpfen der Zuschauer“ bilden und „deren kognitives und emotionales Verhältnis zur Leinwand“ (ebd.) regeln.
In fiktionalen Filme ist die Unterscheidung von „Story“ und „Plot“ relevant. Nach Thompson/Bordwell (2001: 61.) ist Story „the set of all [sic!] the events in a narrative, both the ones explicitly presented and those the viewers infers“, wohingegen Plot nur das ist, was tatsächlich zu sehen und zu hören ist: „The term plot is used to describe everything visibly and audibly present in the film before us.” Umberto Eco (1987: 128.) definiert ähnlich:
Der Plot […] ist die Geschichte, wie sie tatsächlich erzählt wird, wie sie an der Oberfläche erscheint mit ihren zeitlichen Verschiebungen, Sprüngen, Einblendungen von vorangegangenen und zukünftigen Ereignissen, […] Beschreibungen, Abschweifungen, eingeschobenen Reflexionen.
Für die Organisation des Plots spielt die Dreiaktstruktur eine entscheidende Rolle. Nach Stutterheim/Kaiser (2011: 63.) kann man die dreiaktige Anlage eines Films als Paradigma, als Postulat, ja fast als Dogma auffassen. Seine Ursprünge liegen bei Aristoteles (1994: 25):
Ein Ganzes ist, was Anfang, Mitte und Ende hat. Ein Anfang ist, was selbst nicht mit Notwendigkeit auf etwas anderes folgt, nach dem jedoch natürlicherweise etwas anderes eintritt oder entsteht. Ein Ende ist umgekehrt, was selbst natürlicherweise auf etwas anderes folgt, und zwar notwendigerweise oder in der Regel, während nach ihm nichts anderes mehr eintritt. Eine Mitte ist, was sowohl selbst auf etwas anderes folgt als auch etwas anderes nach sich zieht. Demzufolge dürfen Handlungen, wenn sie gut zusammengefügt sein sollen, nicht an beliebiger Stelle einsetzen noch an beliebiger Stelle enden, sondern sie müssen sich an die genannten Grundsätze halten.
Schon Aristoteles hat also die Notwendigkeit einer kausalen, aufeinander aufbauenden Plotführung betont: Eins ergibt sich aus dem Anderen.
Grundsätzlich gibt es bei der Entwicklung des Plots zwei Bewegungsrichtungen:
„Jede Tragödie besteht aus Verknüpfung und Lösung. Die Verknüpfung umfaßt gewöhnlich die Vorgeschichte […] , die Lösung den Rest“ (Aristoteles 1994: 57.). Zunächst wird also Spannung aufgebaut, es gibt Verwicklungen, auch ‚Schürzung des Knotens’ genannt. Dann kommt es zur Peripetie und der Knoten, die Spannung der Geschichte wird gelöst, es kommt zum Schluss (vgl. Howard 2004: 255., Rabenalt 2004: 68-70., Stutterheim/Kaiser 2011: 76-77.).
In den 1980ern verfestigten sich die Erzählkonventionen (Thompson/Bordwell 2003: 687.) und in den folgenden Jahren wurde die Dreiaktstruktur nicht nur durch die Filme, sondern auch von der überwiegenden Mehrheit der Drehbuch- lehrer und -ratgeber bestätigt und festgeschrieben: Großen Anteil an dieser Festsetzung der Dreiaktstruktur als Standard hat das Buch The Screenwriting Workbook (1984) von Syd Field. Mit Versprechungen wie „Das hier ist ein Arbeitsbuch. Es soll Ihnen die Gelegenheit geben, Ihre Fertigkeiten als Drehbuch- autor auszubauen“ (Field 2000: 35.) hat er viele Interessierte für seine Sicht gewinnen können. Das Buch vermittelt den Eindruck, einen einfachen Weg zum Erfolg weisen zu können. Bei Drehbuchautoren ist dieses Buch nicht gerade als Inspirationsquelle bekannt, aber trotz solcher Relativierungen hat dieses Buch dafür gesorgt, dass Begriffe wie Plot Point oder Midpoint bei den Filmschaffenden fortan zum allgemeinen Sprachgebrauch gehören.
Während Field seine Wahl des Dreiaktmodells nicht weiter problematisiert, begründen Howard/Mabley (1998: 46.) ihre Wahl des Dreiaktmodells mit den Rezeptionsgewohnheiten des Publikums. In ihren Augen liegt der Sinn einer solchen Einteilung vor allem darin, dass sie eine Hilfe für den Autoren bei der „Organisation seiner Ideen“ (ebd.) ist. Schneider (2001: 189.) sieht die „3-Akte- Struktur“ (sic!) als historisch gewachsen und verfolgt ihre Spuren bis in die Antike (s.o.) zurück. Er versteht sie vor dem Hintergrund „der Struktur des Mythos und des Ritus“ (Schneider: 2001: 189.) und plädiert für eine Verknüpfung mit der „Reise des Helden“ ( 3.2.3.), weil man sich so am besten von einer formalisierten Anwendung lösen könne. Robert McKee (2000: 235-237.) sieht die Aktstruktur vor allem als Organisationseinheit, gewissermaßen als „Makrostruktur der Story“ (ebd.: 235.): Während die Beats die Szenen konfigurieren, die Szenen die Sequenzen aufbauen, bilden die Sequenzen den Akt. Die Notwendigkeit der Dreiaktstruktur macht McKee an der emotionalen Notwendigkeit von drei Wende- punkten fest: „[…] drei bedeutende Umschwünge sind das notwendige Minimum für ein narratives Werk in voller Länge, um bis an die äußerste [ChB: emotionale] Grenze zu gelangen“ (ebd.: 237.). Wie Schneider sieht McKee einen solchen „Story-Rhythmus“ schon seit Aristoteles und früher gegeben. (ebd.: 237.) Howard (2004: 255.) fasst die Dreiaktstruktur mit einem Augenzwinkern: „Tell them what you `re going to do, then do it, then tell them what you`ve done.“ Er sieht die Dreiaktstruktur als stetes Grundmuster und andere Einteilungen - wie das 5-Akt-Modell (Gustav Freytag) oder das 8-Sequenzen Modell (Gulino 2004. nach Frank Daniel) - zwar als mögliche Wege, die sich jedoch immer auf das Dreiaktmodell zurückführen ließen (vgl. Howard 2004: 255-256.).
Common Sense ist: Ein Drehbuch besteht aus drei Akten. Der erste Akt ist die Exposition des Films. Hier wird der Zuschauer „über Ort und Zeit der Filmhandlung informiert und mit den handelnden Figuren vertraut gemacht“ (Stutterheim/Kaiser 2011: 114-115.). Dabei werden die nötigen Informationen bestenfalls durch Handlungen der Personen gezeigt und nicht gesagt (Howard 2004: 171-176., Stutterheim/Kaiser 2011: 115.). Man öffnet ein neues Verständnis für die Exposition, wenn man die Rolle der Zuschauer mitberücksichtigt: „Im Verlaufe der Exposition werden für den Zuschauer Spuren gelegt, die ihm bei der weiteren Verarbeitung und Interpretationsleistung des Geschehens helfen“ (Wuss (1993: 77.) zit. nach Stutterheim/Kaiser (2011: 116.) ).
Die Exposition hat aber nicht nur die Aufgabe zu informieren, sondern sie beinhaltet „auch den Anstoß und den ersten Wendepunkt […,] um die Handlung des zweiten Akts vorzubereiten und einzuleiten“ (Stutterheim/Kaiser 2011: 115.). Der Begriff „Anstoß“ geht u.a. zurück auf Seger (1998: 42-43.), die als Anstoß jene Aktion bezeichnet, „die die Handlung vorantreibt: Etwas passiert, oder jemand trifft eine Entscheidung. Die Hauptfigur wird in Bewegung gebracht. Die Geschichte hat begonnen.“ McKee (2000: 196-225.) bezeichnet den Anstoß als Auslösendes Ereignis (inciting incident). Er definiert es als plötzliches, ein- schneidendes Ereignis, das das Gleichgewicht des Protagonisten radikal stört und präzisiert es als einzelnen Vorfall, „der entweder dem Protagonisten direkt zustößt oder vom Protagonisten verursacht wird“ (ebd. 206.). Nach Hant (2000: 80.) muss dieses Auslösende Ereignis [Hant: „Plot-Beginn“] zwingend auf der Leinwand zu sehen sein. Und zwingend notwendig muss der Protagonist auf dieses Ereignis reagieren. (Hant 2000: 80., McKee 2000: 208.) In der Reise des Helden entspricht der ‚Ruf zum Abenteuer’ diesem Auslösenden Ereignis (Hant 2000: 139-140.).
An dieser Stelle wird deutlich, welche Perspektive die Ratgeber zum Drehbuch einnehmen. Sehen Hant, Seger, McKee das Auslösende Ereignis als etwas, das dem Helden zustößt, definiert Howard diesen Beginn der Handlungen bereits aus der Innensicht des Protagonisten: „ […] and his want come into play. Somebody wants something“ (Howard 2004: 257.).
Zurück zur Aktstruktur: Die Einteilung der Akte ergibt sich im klassischen Hollywoodkino durch die beiden großen Wendepunkte (Plot Points), die den Übergang vom ersten zum zweiten und vom zweiten zum dritten Akt markieren. „[Wendepunkte lenken] die Geschichte in eine neue Richtung […], erhalten die Spannung und geben ihr neue Energie“ (Hant 2000: 82.). Sie sollen die „Vorhersehbarkeit […] durchbrechen“(Schütte 2009: 61.). Die große Bedeutung solcher Umschwünge ist unstrittig, ganz gleich ob der Ursprung dieser Umschwünge eher bei den Figuren oder bei der Handlung verortet wird. Auch ist nicht eindeutig festgelegt, ob Plot Point I noch zum ersten Akt gehört oder den Auftakt zum zweiten bildet.
Common sense ist wiederum, dass der zweite Akt eine „dramatische Handlungs- einheit“ (Field 2000: 134.) ist und dass sein Konflikt den großen, alles bestimm- enden Spannungsbogen bildet (z.B. Howard/Mabley 1998: 75., Stutterheim/ Kaiser 2011: 121.). Er findet seinen Höhepunkt im Midpoint. Field (2000: 140.) verortet ihn „auf Seite 60“, was zwar ein Erfahrungswert sein kann, was aber auch noch einmal die ganze Schematik seines Buches offensichtlich macht. Seger argumentiert da substanzieller. Der midpoint strukturiere nicht nur den langen zweiten Akt in zwei Teile, sondern „[bewirke] eine Richtungsänderung für die zweite Hälfte des Akts“ (Seger 1998: 53.).
Stutterheim/Kaiser (2011: 121) fassen diese Richtungsänderung noch genauer:
Der innere Konflikt tritt in den Vordergrund und die emotionale Integrität des Helden entscheidet über den weiteren Verlauf der Handlung. Erst wenn die innere Ebene des Konflikts gelöst ist, wird es dem Helden gelingen, die äußere Ebene des Konflikts zu lösen.
Durch den zweiten großen Wendepunkt (Plot Point II) erfährt die Handlung Ende des zweiten Aktes dann noch einmal eine neue Richtung (Stutterheim/Kaiser 2011: 128.). Die Verfassung des Helden/der Heldin zu diesem Zeitpunkt ist bereits entscheidend für den Ausgang der Geschichte. Geht es ihm gut, so endet der Film in einer Katastrophe - geht es ihm schlecht, so wird am Ende alles gut (ebd.: 128.). Zusammenfassend sehen Stutterheim/Kaiser (2011: 70.) als wesentlichen Grundgedanken eines geschlossenen Dramas, dass alles „auf den Fortgang der Handlung gerichtet [ist]“ und dass „alles, was gezeigt wird, […] der Zuspitzung und Lösung des Konflikts [dient]“
3.2.1 Figuren
Von nahezu allen Drehbuchratgebern wird der Konflikt als wichtiges Grund- element eines guten Films angesprochen. (Egri 2003: 159-278, Howard 2004: 11- 15, Howard/Mabley 1998: 49-51, McKee 2000: 340-355, Rabenalt 2004: 59-66, Schneider 2001: 162-165.). In ihren Darstellungen legen die Ratgeber unterschiedliche Schwerpunkte, mal betonen sie mehr die Konfrontation mit den anatagonistischen Kräften, mal achten sie mehr auf die Beschreibung des Zusammenpralls selbst. Anhand des Beispiels Titanic bringt jedoch Rabenalt (2004: 62.) das für mich dabei Entscheidende auf den Punkt: „Nicht die Kollision von Schiffen und Eisbergen ist die Quelle des Dramatischen, sondern die Kollision von menschlichen Interesen und Handlungen.“ Es sind nicht die äußeren Katastrophen, die uns mitfiebern lassen, sondern das Innenleben der Personen auf der Leinwand, ihre Sorgen und Ängste, ihre Sehnsüchte und Hoffnungen. Mikos stärkt diese Position. Für ihn „stehen Konflikte, die Figuren aktiv werden lassen und [die] die Handlung vorantreiben” (Mikos 2008: 49.) ganz klar im Zentrum der Dramaturgie.
Mikos (2008: 51.) begründet die immense Bedeutung der Figuren eines Films mit der Möglichkeit der Gesellschaft, sich über sie „über ihre Identitäts- und Rollenkonzepte [zu verständigen]“ und er sieht durch sie für den Zuschauer Chancen der „Subjektpositionierung und Identitätsbildung“ (ebd.). Dabei spielen die antagonistischen Kräfte - ganz gleich ob sie innerhalb der Figur selbst liegen oder ob sie sich in einem echten Gegenspieler manifestieren - die entscheidende Rolle für eine positive und umfassende Entwicklung der Hauptfigur. Denn: „Wir tun nie mehr, als wir tun müssen; wir wenden keine Energie auf, wenn es nicht sein muß; wir gehen keine Risiken ein, wenn es nicht sein muß; wir verändern uns nicht, wenn wir nicht müssen“ (McKee 2000: 340.). Ein gutes Pferd springt nur so hoch wie es muss und ein Held entwickelt sich erst im Angesicht der antago- nistischen Kräfte.
Für die Entwicklung der Hauptfigur ist neben diesem Grundkonflikt das eigene Ziel eine feste Größe. Beide stehen in einem wechselseitigen, voneinander abhängigen Verhältnis. Bei dem Ziel unterscheidet die Drehbuchliteratur „stellenweise zwischen einem bewussten und einem unbewussten Ziel. Durchgesetzt haben sich dafür die Termini want und need“ (Eick 2006: 81.) oder übersetzt ‚Ziel’ und ‚Bedürfnis’(Schütte 2009: 22-28.).
Hollywoodhelden haben außerdem oft ein einschneidendes Erlebnis in der Vergangenheit hinter sich, das im Laufe des Films zutage tritt, weil es das „Verhalten in einer Konfliktsituation oder auch im normalen Leben bestimmt“ (Eick 2006: 81.): Die Backstorywound. Krützen (2004: 32.) sieht die Entstehung dieses Stilmittels schon in Verbindung mit dem „Aufkommen des klassischen [Hollywood-]Kinos“ gegeben. Es ist ein Mittel, um Handlungen insbesondere der Hauptfigur zu motivieren. Krützen ist es wichtig, die Filmfachsprache ‚Backstorywound’ abzugrenzen von der Fachsprache der Psychologie. Auch wenn sich deren Begrifflichkeit ‚Trauma’ ähnlich wie ‚Backstorywound’ mit ‚Verletzung’ übersetzen lasse (ebd. 33.), ist für Krützen der Unterschied wichtig:
Das Trauma ist eine lebensweltliche Größe; real existierende Menschen können eine traumatische Erfahrung machen. Die Backstorywound hingegen erfüllt eine narrative Funktion, die audrücklich nicht mit lebensweltlichen Maßstäben gemessen werden darf (ebd.: 35.).
Daraus folgt für sie ein pragmatisches Verständnis der Backstorywound als ein „strukturelles Element“ (ebd.: 39.), das „das Verhalten einer Figur im Rahmen eines Films so plausibel wie möglich […] motivieren [soll]“ (ebd.: 39-40.). Der Begriff ‚Backstorywound’ hat sich nicht allgemein durchgesetzt. Howard (2004), Seger (1999), McKee (2000) sprechen allgemein von der Backstory und Schneider (2001) verwendet entgegen der Differenzierung von Krützen den Begriff ‚Trauma’. Schütte (2009: 35.) gebraucht alternativ den Begriff der ‚Achillesferse’, dem „wunde[n] Punkt einer Figur, wo sie am leichtesten zu treffen ist.“ Gründe dafür sieht er ebenfalls oft „in der Vergangenheit begründet“ (ebd.).
3.2.2 Dialoge
Oliver Schütte (2002: 29-56.) hat zunächst einmal eine funktionale Sicht auf Dialoge. Er sieht einen guten Dialogsatz „mindestens eine der drei folgenden Aufgaben [erfüllen …]: 1. Dialog gibt Informationen. 2. Dialog offenbart die Emotionen der Figur. 3. Die Form (Diktion) sagt etwas über den Sprechenden aus“ (ebd.: 30.). Diese Annahmen mögen stimmen, für ein tiefergehendes Verständnis von dialogischen Wirkmechanismen hilft diese Kategorisierung meiner Einsicht nach jedoch nicht weiter. Ganz anders verhält es sich mit dem Status-Modell, das er vorstellt und das sich gewinnbringend einsetzen lässt, um die Dynamik eines Dialogs zu untersuchen. Schütte beruft sich auf den britischen Theaterautor und -regisseur Keith Johnstone indem er ausführt:
Jeder Mensch hat im Laufe seines Lebens gelernt, einen Status einzunehmen, der ihm den größtmöglichen Schutz gewährt. […] Jeder Dialog ist insofern von dem bewussten oder unbewussten Ziel geprägt, einen Status zu erlangen oder aufrechtzuerhalten. Der Status ist deshalb nicht etwas Fixiertes, sondern kann innerhalb eines Gespräches wechseln. […] Jedem Gespräch liegt somit eine bestimmte Konstellation von Statuszugehörigkeiten zugrunde. Jede noch so neutrale Äußerung ist letztendlich eine Aussage über die eigene Statuszugehörigkeit. […] Schwierig und gleichzeitig interessant wird es, wenn beide Parteien den gleichen Status anstreben oder wenn der Status den sozialen Gegebenheiten widerspricht. […] Jede Figur kann in unterschiedlichen Situationen durchaus einen anderen Status einnehmen (Schütte 2002: 76-77.).
Für diesen Statuskampf hat Seger (1999: 164.) das Bild eines Tennismatches gefunden: „Der Ball bewegt sich zwischen den Spielern hin und her und gleicht einem ständigen Machtspiel, das sexuell, physisch, politisch oder sozial sein kann.“ Sie sieht einen guten Dialog außerdem dadurch gekennzeichnet, dass er „meistens kurz und sparsam“ (ebd.) ist und „sich aufgrund seines Rhythmus leicht sprechen [lässt]“ (ebd., vgl. auch Howard/Mabley 1998: 113.). Sie grenzt guten vom schlechten Dialog ab. Der schlechte Dialog „simplifiziert Menschen, anstatt ihre Vielschichtigkeit zu enthüllen“ (Seger 1999: 169.). McKee behandelt den Dialog relativ kurz, gibt weniger Hilfestellung als dass er Verbote aufstellt: „Leinwanddialog verlangt kurze, einfach konstruierte Sätze - im allgemeinen: Subjekt, Prädikat, Objekt beziehungsweise Substantiv, Verb, Beifügung“ (McKee 2000: 418.). McKee schreibt sogar:
Schreiben Sie niemals etwas, was Aufmerksamkeit erregt als Dialog an sich, etwas, was vom Papier springt und ruft: ‚Was bin ich doch für eine schlaue Zeile!’ Sobald Sie glauben, Sie hätten etwas ganz besonders Schönes und
[...]
1 http://www.imdb.de/find?s=all&q=das+fliegende+klassenzimmer (abgerufen 6.1.2012)
2 http://www.zweitausendeins.de/filmlexikon/?wert=21554&sucheNach=titel (6.1.2012)
- Arbeit zitieren
- Christian Brauckmann (Autor:in), 2012, Das sich wandelnde Lehrer- und Schülerbild in ausgewählten Schulfilmen. Eine ästhetisch-historische Spurensuche, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/340128
Kostenlos Autor werden


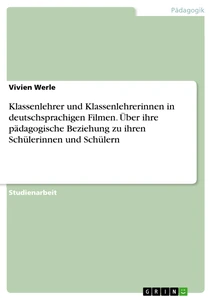






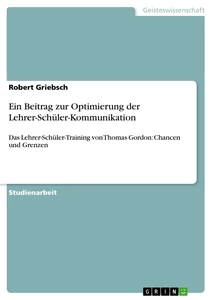












Kommentare