Leseprobe
Inhalt
1. Einleitung
2. Sozialpsychiatrie und Psychiatriereform in Deutschland
3. Leitideen und grundlegende Konzepte Persönlicher Budgets
3.1 Einflüsse auf normativ-ethischer Ebene
3.2 Einflüsse auf professionstheoretisch-fachlicher Ebene
3.2.1 Das Normalisierungsprinzip
3.2.2 "Inklusion versus Integration" (Röh 2009, S. 71)
3.2.3 Das biopsychosoziale Modell der ICF
3.3 Einflüsse auf sozialpolitischer Ebene
3.4 Empowerment als Voraussetzung und Methode
4. Geschichte und Entwicklung des Persönlichen Budgets
4.1 Das Persönliche Budget in Europa
4.1.1 Schweden (Persönliche Assistenz)
4.1.2 Niederlande (Personengebundenes Budget)
4.1.3 Großbritannien (Direct Payments)
4.2 Modellversuche in Deutschland
4.3 Umsetzung und Akzeptanz des Persönlichen Budgets - Forschungsbericht 2012 im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales
5. Rechtliche Grundlagen und Verfahren des Persönlichen Budgets
5.1 Formen des Persönlichen Budgets
5.2 Beteiligte Leistungsträger
5.3 Anspruch auf das Persönliche Budget
5.4 Budgetfähige Leistungen
5.5 Verfahren
5.6 Bedarfsfeststellung und Messung des Budgets
5.7 Zielvereinbarung
5.8 Budgetassistenz und Budgetberatung
5.9 Gesetzliche Betreuung und das Persönliche Budget
6. Chancen und Grenzen des Persönlichen Budgets für Menschen mit seelischen Behinderungen
6.1 Chancen, Risiken und Grenzen aus Perspektive der Budgetnehmenden
6.2 Chancen, Risiken und Grenzen mit Fokus auf professionelle Dienstleister
6.3 Chancen, Risiken und Grenzen aus der Perspektive der Kostenträger
7. Fazit
Abbildungsverzeichnis
Literatur
1. Einleitung
"Jetzt entscheide ich selbst!", so titelt die Broschüre des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales zum trägerübergreifenden Persönlichen Budget, dessen rechtsverbindliche Einführung zum 01.01.2008 häufig mit einem Paradigmenwechsel für Menschen mit Behinderung verbunden wird.
Durch die Einführung des SGB IX im Jahre 2001 erfuhr das Wunsch- und Wahlrecht von Menschen mit Behinderung eine wesentliche Erweiterung. Unter anderem wurden die rechtlichen Voraussetzungen für das Persönliche Budget geschaffen. Leistungsberechtigte können nun anstelle (oder kombiniert mit) einer Dienst- oder Sachleistung die Auszahlung eines Geldbetrages wählen, mit dem sie sich Leistungen zur Teilhabe nach Bedarf selbst einkaufen. Durch diese Möglichkeit soll die Selbstbestimmung behinderter Menschen gefördert werden. Ihnen kommt die Rolle von eigenverantwortlichen Kund*innen und Arbeitgeber*innen zu. Das bisherige Leistungsdreieck zwischen Antragsstellenden, Leistungsträgern und Leistungserbringern wird aufgelöst (vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2014, S. 7).
Während einer Assistenztätigkeit bei einem Menschen mit körperlicher Behinderung im Jahr 2009 hörte ich zum ersten Mal vom Persönlichen Budget. Der Assistenznehmer - mein Arbeitgeber - berichtete mir von dieser Möglichkeit. Obwohl er vertraut mit den Prinzipien der Selbstbestimmt Leben-Bewegung ist, hatte er für seine Zwecke kein Interesse an dieser Leistungsform. Für ihn war das Arbeitgebermodell mit Lohnzahlungsabwicklung über den LVR bequemer.
Später kam ich indirekt bei meiner Arbeit als pädagogische Fachkraft im Ambulant Betreuten Wohnen für Menschen mit psychischen Erkrankungen mit dem Persönlichen Budget in Berührung: im für den Sozialhilfeträger erstellten Hilfeplan IHP3 sollen die Klient*innen bestätigen, dass sie über das Persönliche Budget beraten wurden und Kenntnis darüber haben, dass sie die Leistungen auch in Form eines Persönlichen Budgets in Anspruch nehmen können. Das hieß, dass ich zunächst mich, und anschließend die Klient*innen darüber informieren musste, obwohl mein Arbeitgeber die Zusammenarbeit mit Budgetnehmenden ablehnte. Insgesamt schien mir das Persönliche Budget in der psychosozialen Praxis nicht weit verbreitet zu sein. Zugegeben, ich konnte mir diese Leistungsform nicht bei allen Klient*innen vorstellen.
In der Fachliteratur wird das Persönliche Budget größtenteils positiv bewertet, es gibt jedoch auch einige Kritikpunkte. Auf die Zielgruppe der Menschen mit psychischen Erkrankungen speziell wird weniger eingegangen. In dieser Arbeit werden die Potentiale und Barrieren des Persönlichen Budgets für Menschen mit seelischen Behinderungen im Hinblick auf eine individuelle Lebensführung betrachtet. Dazu wird zunächst der Einfluss von Reformbestrebungen und der Veröffentlichung der Psychiatrie-Enquete auf die Psychiatrie in Deutschland beschrieben. Anschließend wird die Entwicklung des Persönlichen Budgets in einigen Ländern des europäischen Auslands und in Deutschland vorgestellt. Diesbezüglich werden die Ergebnisse zweier Studien mit Fokus auf Menschen mit psychischen Erkrankungen beschrieben. Ein weiterer Teil dieser Ausführungen beleuchtet Hintergründe und Grundlagen des Persönlichen Budgets auf normativ-ethischer, auf professionstheoretisch-fachlicher sowie auf sozialpolitischer Ebene. Des Weiteren wird in diesem Abschnitt Empowerment als Arbeitsansatz vorgestellt. Es folgt eine Auseinandersetzung mit den rechtlichen Grundlagen und der Umsetzung dieser neuen Leistungsform. Anschließend werden Überlegungen zu den Möglichkeiten, Chancen, Risiken und Grenzen, die das Persönliche Budget für die subjektiven biografischen Entwürfe von Menschen mit psychischen Erkrankungen mit sich bringen, angestellt.
Da der Großteil der in Deutschland bewilligten Persönlichen Budgets in den Zuständigkeitsbereich der Sozialhilfeträger im Bereich des SGB XII fällt (vgl. Prognos 2012, S. 18), konzentriert sich diese Arbeit bei der Vorstellung des Verfahrens und weiteren Überlegungen schwerpunktmäßig auf Teilhabeleistungen dieser Kostenträger.
Menschen mit seelischen Behinderungen sind Menschen, die aufgrund außerordentlicher psychischer Probleme in ihrer Fähigkeit zur gesellschaftlichen Teilhabe eingeschränkt sind. Synonym wird in dieser Arbeit der Begriff "psychische Behinderungen" verwendet.
2. Sozialpsychiatrie und Psychiatriereform in Deutschland
Die Sozialpsychiatrie vereint Medizin, Pädagogik, Psychologie und andere sozialwissenschaftliche Disziplinen auf praktischer und fachwissenschaftlicher Ebene. Ihr Kernanliegen ist die Integration psychisch Erkrankter in den Alltag. Sozialpsychiatrische Arbeit dient der Steigerung der Lebensqualität sowie der Erweiterung individueller Kompetenzen der Klient*innen. Dabei wird ressourcenorientierte, beratende Unterstützung in den Bereichen Wohnen, Arbeit, Freizeit, Sozialkontakte und Gesundheit geleistet. Die Sozialpsychiatrie steht für folgende Reformen:
- die Abkehr vom medizinischen Krankheitsbild hin zu einem sozialen Verständnis psychischer Leiden.
- die Einrichtung gemeindenaher, ambulanter psychiatrischer Einrichtungen, ergänzend zu großen Kliniken und stationärer Krisenintervention.
Die sozialpsychiatrische Debatte ist hauptsächlich von drei Perspektiven beeinflusst: der befreiungsorientierten Antipsychiatrie, der modernen Psychiatrie mit klinisch stationärer Ausrichtung und der gemeindenahen Psychiatrie. Letztere integriert psychosoziale Hilfen und Dienstleistungen in die Lebenswelt. (vgl. Quindel 2004, S. 14 ff.). In Deutschland ist der Begriff Sozialpsychiatrie erst seit den Reformbewegungen Ende der 1960er Jahre gebräuchlich (vgl. Bosshard 2010, S. 38). Im Jahr 1971 wird auf Drängen der "Aktion Psychisch Kranke e.V." eine Expertenkommission von der Bundesregierung beauftragt, einen Report über die Situation der Psychiatrie in Deutschland zu verfassen. 1972 entsteht die "Deutsche Gesellschaft für soziale Psychiatrie" als Vereinigung reformorientierter Fachkräfte. Weiter nehmen Veröffentlichungen, z.B. vom Psychiatrieverlag, Einfluss auf eine kritische Diskussion um die Zustände der Psychiatrie in Deutschland, wie sie in anderen europäischen Ländern wie England und Italien längst stattgefunden hat. Anno 1975 wird dann von besagter Expertenkommission ein Bericht, die Psychiatrie- Enquete, vorgelegt. Dargestellt wird die psychiatrische und psychotherapeutisch- psychosomatische Lage der Bevölkerung (vgl. Quindel 2004, S. 21 f.). Bemängelt werden insbesondere fehlende Rechte, unzureichende Unterbringungsmöglichkeiten psychisch Erkrankter, sowie ein Defizit an alternativen Einrichtungen. Auch wird die mangelhafte Versorgung mit Möglichkeiten der Psychotherapie und die nicht gegebene Vernetzung von psychiatrischen Einrichtungen und Diensten kritisiert (vgl. Dörner 1979, S. 31). Die Veröffentlichung der Enquete-Kommission ist letzten Endes der Auslöser für Reformen der Psychiatrie in Deutschland. Ihre Vorschläge werden zunächst in Modellregionen umgesetzt: es entstehen Einrichtungen und Netzwerke nach den Kernideen der Gemeindepsychiatrie. Kritisiert wird an der Enquete neben der technokratisch ausgerichteten, verwaltenden Normierung die Beibehaltung des medizinisch-therapeutischen Krankheitsbildes und die Nichtbeachtung von Betroffenenperspektiven und Selbstbestimmung (vgl. Quindel 2004, S. 23).
Beim Konzept der Gemeindepsychiatrie wird davon ausgegangen, dass ein Großteil der psychisch erkrankten Menschen außerhalb stationärer Einrichtungen, also in der Gemeinde, behandelt werden kann. Die Vernetzung und räumliche Organisation von Personen und ambulanten Einrichtungen spielt eine wichtige Rolle. Dabei geht Gemeindepsychiatrie "primär nicht von den Bedürfnissen der psychisch Kranken, sondern von den Bedürfnissen aller Bürger einer Region aus und berücksichtigt jene in diesem Rahmen" (Dörner 1979, S. 15). Psychische Erkrankungen seien als Krise im biographischen und lebensweltlichen Zusammenhang zu sehen und in diesem Kontext zu ergründen (vgl. Bosshard 2010, S. 40).
Kritisiert wird häufig, dass in der Gemeindepsychiatrie die Abkehr von einem biologisch-medizinischen Krankheitsbild nicht gelungen ist. Weiter bewegen sich viele psychiatrieerfahrene Menschen lediglich in einer Art Subkultur, in der Abhängigkeits- sowie Kontrollverhältnisse der Psychiatrie erhalten bleiben. Das heißt, sie haben überwiegend Kontakt zu anderen Klient*innen, Fachpersonal, Ärzt*innen, im Betreuten Wohnen, Sozialpsychiatrischen Zentrum etc. Inklusion werde in der Gemeindepsychiatrie nicht realisiert (vgl. z.B. Quindel 2004 S. 23 ff., Krisor 2005, S. 12 ff.).
3. Leitideen und grundlegende Konzepte Persönlicher Budgets
In Bezug auf Behinderungen und Behindertenhilfe ist ein Perspektivenwechsel und damit zusammenhängende Einflüsse hin zur Idee des Persönlichen Budgets auf drei Ebenen zu sehen:
- auf normativ-ethischer Ebene
- auf professionell-fachlicher und
- auf sozialpolitischer Ebene ( vgl. Meyer 2011, 45 ff).
3.1 Einflüsse auf normativ-ethischer Ebene
Auf normativ-ethischer Ebene fordern Behindertenbewegungen seit Jahren die Stärkung der Selbstbestimmung und Autonomie von pflegebedürftigen und behinderten Menschen sowie die eigenständige Wahl und Organisation ihrer Unterstützung. Mit diesen Forderungen wird das traditionelle Fürsorgemodell der Behindertenhilfe in Frage gestellt. Weiter wird eine Kritik an Fremdbestimmung und Bevormundung geäußert (vgl. Meyer, S. 49 f).
Bereits in den 1960er Jahren fordert die "Independent Living Bewegung" in den USA eine neue Denkweise bezüglich Behinderungen. Sie tritt ein für die Gleichberechtigung und gegen Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen. Ziel ist es unter anderem, behinderte Menschen nicht nur auf eine Diagnose zu reduzieren, sondern als selbstbestimmt handelnde Bürger*innen zu sehen (vgl. Rothenburg 2009, S. 15).
In Europa entwickelt sich bald darauf die "Selbstbestimmt Leben-Philosophie und Ethik", welche in Deutschland in den 1970ern als "Selbstbestimmt Leben Bewegung" in Erscheinung tritt. Diese wird überwiegend von Menschen mit körperlichen Behinderungen getragen. Gefordert werden Gleichberechtigung, Abkehr vom medizinischen Krankheitsbild, Integration, Peer-Beratung und mehr Kontrolle über Behindertenorganisationen und Dienstleistungsanbieter. Mit Selbstbestimmung ist nicht zwingend Selbstständigkeit gemeint, sondern die Möglichkeit, Entscheidungen frei von personellen, institutionellen und sächlichen Zwängen treffen zu können (vgl. Rothenburg 2009, S. 15).
So entstehen weitere Bewegungen wie "People-First", welche für eine Stärkung der Selbstbestimmung von Menschen mit geistigen Behinderungen eintritt, oder die "Self-Advocacy-Bewegung" (vgl. Meyer 2011, S. 70 f). Für die Rechte von Menschen mit psychischen Erkrankungen engagieren sich Gruppierungen wie "The Icarus Project" in den USA, "The Hearing Voices Project" in England, oder in Deutschland das "Sozialistische Patientenkollektiv" in den 1970er Jahren, oder später die "Irrenoffensive". Sie alle vertreten Positionen der "Antipsychiatrie".
Schwerpunktmäßig vertritt die antipsychiatrische Bewegung eine Ablehnung der Anstaltspsychiatrie, weiter bekämpft sie die Stigmatisierung von Psychiatriebetroffenen und fordert mehr Mitbestimmung und weniger ärztliche Dominanz.
Die Idee des Persönlichen Budgets kann im Zusammenhang mit den Forderungen oben genannter Bewegungen gesehen werden, da es ein Instrument zu mehr Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen sein könnte (vgl. Meyer 2011, S. 72 ff).
3.2 Einflüsse auf professionstheoretisch-fachlicher Ebene
Oben genannte Bewegungen führen zu Veränderungen bzw. wissenschaftlichen Innovationen auf der professionstheoretisch-fachlichen Ebene. Zu nennen sind u.a. folgende Konzepte: Das Normalisierungsprinzip, die Entwicklung von Inklusionsansätzen, sowie die Betrachtungsweisen der ICF. Allen gemeinsam ist eine Abkehr von der defizitorientierten Betrachtung von Behinderungen, sowie die Einsicht, dass "institutionelle Bedingungen" einer individuellen Lebensführung im Wege stehen können. (vgl. Meyer 2011, S. 47).
3.2.1 Das Normalisierungsprinzip
Nach dem "Normalisierungsprinzip" handelt "richtig (...), wer für alle Menschen mit geistigen oder anderen Beeinträchtigungen oder Behinderungen Lebensmuster und alltägliche Lebensbedingungen schafft, welche den gewohnten Verhältnissen und Lebensumständen ihrer Gemeinschaft oder Kultur entsprechen oder ihnen so nah wie möglich kommen." (Bengt Nirje, zitiert nach Rothenburg 2009, S. 16). Angeregt wird es vom dänischen Juristen Niels Erik Bank-Mikkelsen in den 1950er Jahren in Skandinavien, 1959 wird es in ein Fürsorgegesetz übernommen (vgl. Röh 2009, S. 69). Bank-Mikkelsen sieht es als ein Prinzip, welches Menschen mit geistiger Behinderung ermöglicht, "ein Leben so normal wie möglich zu führen." (Thimm 2005, S. 8, zitiert nach Röh 2009, S. 69). Er kritisiert das damalige Bild von behinderten Menschen und damit verbundene Diskriminierungen sowie deren Ausgrenzung und Unterbringung in Anstalten (vgl. Wansing 2006, S. 129).
Der schwedische Psychologe Bengt Nirje konkretisiert und erweitert das Normalisierungsprinzip, und bald wird es auch in vielen westeuropäischen Ländern sowie Teilen Amerikas übernommen (vgl. Röh 2009, S. 69). Nirje definiert für das Normalisierungsprinzip acht Bereiche:
"1. Normaler Tagesrhythmus: Schlafen, Aufstehen, Anziehen, Mahlzeiten, Wechsel von Arbeit und Freizeit - der gesamte Tagesrhythmus ist dem altersgleicher Nichtbehinderter anzupassen.
2. Trennung von Arbeit, Freizeit und Wohnen: Klare Trennung dieser Bereiche, wie das bei den meisten Menschen der Fall ist. Das bedeutet auch: Ortswechsel und Wechsel der Kontaktpersonen. Es bedeutet ferner, täglich Phasen von Arbeit zu haben und nicht nur einmal wöchentlich eine Stunde Beschäftigungstherapie. Bei Heimaufenthalt: Verlagerung der Aktivitäten nach draußen.
3. Normaler Jahresrhythmus: Ferien, Verreisen, Besuche, Familienfeiern; auch bei Behinderten haben solche im Jahresverlauf wiederkehrende Ereignisse stattzufinden.
4. Normaler Lebensablauf: Angebote und Behandlung sollten klar auf das jeweilige Lebensalter bezogen sein (auch der geistig Behinderte ist Kind, Jugendlicher, junger Erwachsener usw.!).
5. Respektierung von Bedürfnissen: Behinderte sollen soweit wie möglich in die Bedürfnisermittlung einbezogen werden. Wünsche, Entscheidungen und Willensäußerungen behinderter Menschen sind nicht nur zur Kenntnis zu nehmen, sondern auch zu berücksichtigen.
6. Angemessene Kontakte zwischen den Geschlechtern: Geistig Behinderte sind Jungen und Mädchen, Männer und Frauen mit Bedürfnissen nach (anders-)geschlechtlichen Kontakten. Diese sind ihnen zu ermöglichen
7. Normaler wirtschaftlicher Standard: Dieser ist im Rahmen der sozialen Gesetzgebung sicherzustellen.
8. Standards von Einrichtungen: Im Hinblick auf Größe, Lage, Ausstattung usw. sind in Einrichtungen für geistig Behinderte solche Maßstäbe anzuwenden, wie man sie für uns "Normale" für angemessen hält" (Thimm 2005, S. 21 f., zitiert nach Röh 2009, S. 69 f.).
Das Normalisierungsprinzip wird in den USA noch einmal durch Wolf Wolfensberger erweitert. Er schlägt vor, den Begriff "Normalisierung" bezüglich der sozialen Rolle von Menschen mit Behinderung durch "Aufwertung" (Valorisation) zu ersetzen (vgl. Röh 2009, S. 70 f.).
Während beispielsweise in Schweden die Beachtung des Prinzips dazu führt, dass Großeinrichtungen für Menschen mit Behinderungen aufgelöst und zu gemeindenahen Wohnmöglichkeiten umgestaltet werden, versucht man in Deutschland eher, den Normalisierungsgedanken innerhalb der bestehenden Großeinrichtungen umzusetzen (vgl. Meyer 2011, S. 82).
3.2.2 "Inklusion versus Integration" (Röh 2009, S. 71)
Inklusion ist das Leitprinzip der EU-Kommission und der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen, welche seit dem 26.03.2009 auch nach deutschem Recht gilt.
Der Begriff scheint in Deutschland noch nicht abschließend diskutiert bzw. definiert, was u.a. mit einer zunächst falschen Übersetzung aus der UN- Behindertenrechtskonvention ins Deutsche zusammenhängt: Inklusion wurde mit Integration oder Einbeziehung gleichgesetzt (vgl. Theunissen 2013, 17). In der Fachwelt allerdings wird zwischen den Konzepten "Integration" und "Inklusion" deutlich unterschieden.
Theunissen übersetzt den Begriff Integration mit "Wiederherstellung eines Ganzen", abgeleitet von lateinischen "integrare", was gemäß Duden "heil, unversehrt machen, wiederherstellen, ergänzen" bedeutet. Er sieht allerdings eine verkürzte Interpretation des Begriffes, da Integration oft nur als gesellschaftliche Eingliederung ausgelegt wird. Er spricht diesbezüglich von einem "Input-Prinzip". Dies setzt wiederum zunächst eine Ausgrenzung voraus, welche z.B. Ausdruck in speziellen Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen wie Sonderschulen oder WfbM findet (vgl. Theunissen 2013, S. 17 f.).
Zudem werde von zwei Welten ausgegangen. Zum einen der als "normal" definierten der Nicht-Behinderten und zum anderen der der Menschen mit Behinderungen. Eine Anpassung aller an die Normalität werde zur Direktive. Bei diesem Prinzip sei eine "Top-Down-Praxis" üblich, d.h., Entscheidungen über Angebote werden von NichtBetroffenen, häufig vorbei an den Interessen der Betroffenen, gefällt. Zudem sei die Einstellung verbreitet, dass Integration beispielsweise über ambulante Angebote lediglich für Menschen mit höherem Selbstständigkeitsgrad geeignet sei. Diese Angebote seien lediglich eine seltenere Alternative bzw. Ergänzung zu stationären Einrichtungen wie Heimen (vgl. Theunissen 2013, S. 17 f.). Die Dominanz des "Normalen" bleibe also erhalten (vgl. Röh 2009, S. 73).
Der Begriff Inklusion ist von "includere" aus dem Lateinischen abgeleitet, was mit "einschließen" übersetzt werden kann. Inklusion als "Eingeschlossensein" ist allerdings gemäß Behindertenrechtskonvention als "unmittelbare gesellschaftliche Zugehörigkeit" zu verstehen und bezieht sich in erster Linie auf Menschen und Gruppen, die leicht benachteiligt und ausgegrenzt werden (vgl. Theunissen 2013, S. 18).
Der Blickwinkel verändert sich von der Sicht auf zwei Welten zur Akzeptanz einer Vielzahl an Lebenswelten. Pluralität wird zur Normalität. Einzelne werden mit ihren Ressourcen, Bedürfnissen und Lebensgewohnheiten wahrgenommen und wertgeschätzt, Individualität ist erwünscht und wird als Bereicherung gesehen (vgl. ebd., S. 18 f.).
Die Vorstellung eines inklusiven Lebens ist eng mit dem Leitprinzip der Barrierefreiheit verknüpft (vgl. ebd. S. 19). Es müssten also Bedingungen geschaffen werden, die allen Bürgern ihre selbstbestimmte Partizipation und damit verbunden einen problemlosen "Zugang zu allen materiellen, sozialen und kulturellen Möglichkeiten und Prozessen einer Gesellschaft" ermöglichen (vgl. Fink 2011, 21). Zu unterscheiden wären in diesem Zusammenhang die Partizipationsprozesse in der "Top-Down"-Praxis der Integration und das "Bottom-Up"-Modell in der Inklusion. Erstere ist eher als professionell-institutionell verordnete Teilnahme zu verstehen, letzteres mehr als Teilhabe, ausgehend von selbstorganisierten Initiativen und Projekten (vgl. Sachs-Pfeiffer 1989, zitiert nach Röh 2009, S. 75).
Die tatsächliche Umsetzung des inklusiven Gedankens bedeutet für die Soziale Arbeit und andere helfende Professionen eine herausfordernde qualitative Veränderung. Mit dem Stichwort Inklusion wird häufig die Utopie einer Gesellschaft verbunden, in der alle Menschen mit Behinderungen bedingungslos willkommen und eingebunden sind. Aufgabe der Behindertenhilfe wird es allerdings zunächst sein, Exklusionsursachen zu relativieren und Ausgrenzungstendenzen weitestgehend zu vermeiden (vgl. Theunissen 2011, S. 19 f).
Durch die Debatte ausgelöste Entwicklungen könnten sich allerdings auch kontraproduktiv auf Inklusion auswirken. Durch eine mögliche steigende Vermarktung und Liberalisierung der Behindertenhilfe wächst die Gefahr von Qualitätsverlusten. Zum einen aufgrund von Ökonomisierung auf staatlicher Ebene und beim Dienstleister. Zum anderen aufgrund eines fehlenden sozialpolitischen Regulativs. Theunissen hält eine Vermarktung der Behindertenhilfe nur dann für inklusionsfördernd, wenn sie mit entsprechenden neueren Ansätzen verknüpft ist - vor allem dem Empowerment (siehe 3.4.) (vgl. Theunissen 2011, S. 20 f.).
3.2.3 Das biopsychosoziale Modell der ICF
Seit den 1980er Jahren versucht die Weltgesundheitsorganisation (WHO), Behinderung als "interdisziplinär zu verstehendes Phänomen" (Röh 2009, S. 54) zu beschreiben. 1980 findet dieses "Phänomen" zunächst in der ICIDH (International Classification of Impairment, Disabilities and Handicap) Ausdruck. Berücksichtigt werden in diesem Modell die Zusammenhänge von Schädigung (impairment) und die damit verbundenen Beeinträchtigungen (disabilities) des Handelns, aus der sich die gesellschaftliche Folge der Behinderung (handicap) ergibt (vgl. Röh 2009, S. 54). Die Gestaltung des SGB IX wird wesentlich durch die ICIDH beeinflusst. Der bis dahin überwiegende Fürsorgegedanke rückt in den Hintergrund. Stattdessen werden Teilhabe und Selbstbestimmung behinderter Menschen und die Anerkennung ihrer Selbstkenntnis berücksichtigt (vgl. http://www.dimdi.de/static/de/klassi/icf/anwendung.htm). Im Jahr 2001 wurde die ICF (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit) herausgegeben. Im Gegensatz zu eher defizitorientierten Klassifizierungen der Folgen einer Erkrankung werden Teilbereiche der Gesundheit kategorisiert: Körperfunktionen, Körperstrukturen, Aktivitäten und Partizipation (Teilhabe) sowie Kontextfaktoren. Die ICF ist ressourcenorientiert und allgemein auf alle Menschen anwendbar (vgl. Internetquelle ebd.). Das in der ICF definierte Bild von Behinderungen wird auch als "bio-psycho- soziales Modell" bezeichnet und kann folgendermaßen dargestellt werden:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1: Wechselwirkung zwischen den Komponenten der ICF (WHO 2005, S. 13).
Die in das Modell integrierten Körperfunktionen und -strukturen entsprechen im Wesentlichen den Diagnosen aus der ICD-101 der WHO. Behinderung wird jedoch nicht mehr nur noch als Einzelschicksal oder individuelles Merkmal im Sinne eines klassischen medizinischen Zuganges wahrgenommen, sondern als vielschichtiges Geflecht von Gegebenheiten, verbunden mit erschwerter Lebenssituation und eingeschränkter Teilhabe am Leben in der Gesellschaft. Auch die soziale Dimension nimmt einen wesentlich höheren Stellenwert ein (vgl. Meyer 2011, S. 52 f). Behinderung ist demnach ein "Zusammenwirken von umwelt- und personenbezogenen Faktoren" (Meyer 2011, S. 54). Sie entsteht erst, wenn sich eine Person nicht an ihre Umwelt, oder die Umwelt nicht an den/die Betroffene*n anpassen kann (vgl. Wacker 2009, 11). Somit verweist das bio-psycho-soziale Modell darauf, dass sich Behinderung aus einem Mangel an Inklusion ergibt (vgl. Meyer 2011, 59).
Dieses Modell hat neben Neuregelungen auf der gesetzlichen Ebene auch Einfluss auf den professionellen Bereich. Es führt zu einem veränderten Verständnis von Unterstützungsbedarf bei Beachtung aller Dimensionen des bio-psycho-sozialen Modells (vgl. ebd., S. 60). Den Konzepten der Teilhabe und Aktivität kommt dabei eine besondere Bedeutung zu, wobei die folgenden Bereiche berücksichtigt werden sollen:
"- Lernen und Wissensanwendung
- Allgemeine Aufgaben und Anforderungen
- Kommunikation
- Mobilität
- Selbstversorgung
- Häusliches Leben
- Interpersonelle Interaktionen und Beziehungen
- Bedeutende Lebensbereiche
- Gemeinschafts-, soziales und staatsbürgerliches Leben" (vgl. WHO 2005, S. 42 ff.).
Mit dem Persönlichen Budget gewinnen Aspekte wie Teilhabe, Selbstbestimmung und Aktivität an Gewicht. Mit seiner Einführung wird individuelle, ressourcenorientierte Unterstützungsplanung unter Berücksichtigung aller Faktoren der ICF möglich (vgl. Meyer 2011, S. 61).
3.3 Einflüsse auf sozialpolitischer Ebene
Mit der Erprobung und Einführung des Persönlichen Budgets lässt sich ein sozialpolitischer Richtungswechsel in Deutschland verzeichnen.
Leistungsempfänger*innen sind nicht länger "Objekt staatlicher Fürsorge" (vgl. Metzler 2007, S. 25), die mit zumeist standardisierten Leistungen versorgt werden. Vielmehr erhalten sie Subjektstellung und somit die Möglichkeit, eine Bewältigung von Lebenslagen eigenverantwortlich und nach ihren Wünschen zu organisieren. Des Weiteren sollen Risiken der Exklusion gemindert und Teilhabe von Menschen mit Behinderung realisiert werden (vgl. Metzler 2007, S. 25).
Mit der Einführung von gesetzlichen Rahmenbedingungen wie dem Behindertengleichstellungsgesetz (BGG), dem Gesetz über eine bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (GsiG) und vor allem dem SGB IX fand im Jahr 2001 eine grundlegende Stärkung der Leistungsempfänger*innen statt, welche im Zusammenhang mit einem veränderten Verständnis von Behinderung steht (vgl. ebd., S. 25).
Ausgangspunkt der Forderung nach einen Paradigmenwechsel war auch die Kritik an einer erlebten "Allmacht" der Leistungsanbieter sowie das Streben nach einer nutzerorientierteren Aufstellung sozialer Dienstleistungen (vgl. Meyer 2011, S. 62). Im SGB IX wird die Stellung behinderter Menschen gestärkt durch die Postulierung des Wunsch- und Wahlrechtes (§ 9 SGB IX) (vgl. Metzler 2007, S. 26), der Selbstbestimmung und der gleichberechtigten Teilhabe (§1, §4 SGB IX) mit dem Ziel der ganzheitlichen Förderung der persönlichen Entwicklung (§ 4 SGB IX).
Das Persönliche Budget ist in diesem Zusammenhang als wichtiges Steuerungsinstrument zu sehen. Der zielgenaue und wirtschaftliche Einsatz von Mitteln kann außerdem zu Einsparungen bei den Kosten der Rehabilitation führen. Gleichzeitig erhofft man sich eine Qualitätssteigerung auf dem Angebotssektor. Vor der Einführung des Persönlichen Budgets wurden Maßnahmen zur Teilhabe oder zur Rehabilitation ausschließlich bei den Leistungsträgern als Sachleistung beantragt, und bei Bewilligung bei Leistungsanbietern in Auftrag gegeben, die durch den Träger festgelegt werden. Die Erbringer informieren die Kostenträger über Qualität und Erfolg ihrer Tätigkeit und rechnen dann mit ihnen ab. Leistungsträger und - erbringer treffen eine Vereinbarung über Ziel, Art, Qualität, Dauer und Berechnung der Leistung (vgl. Metzler 2007, S. 26 f.).
Man spricht vom "klassischen Leistungsdreieck" bei der Sachleistung:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2: Leistungsbeziehungen nach dem Sachleistungsprinzip (vgl. Metzler 2007, S. 27)
Die Leistungsnehmenden haben im oben beschriebenen Verfahren, abgesehen vom Wunsch- und Wahlrecht nach § 9 SGB IX, eine eher passive Rolle.
Dieses Leistungsdreieck löst sich mit Nutzung des Persönlichen Budgets auf. Leistungsberechtigte erhalten nach Bewilligung vom Kostenträger einen Geldbetrag zur Verfügung, um sich selbst einen Anbieter auszusuchen, mit diesem Vereinbarungen im Rahmen einer mit ihnen verabredeten Zielvereinbarung zu treffen und ihn selbst bezahlen zu können. Der/Die Budgetnehmende ist also Kund*in, der Anbieter stellt seine Rechnungen direkt an ihn/sie. Zur Überprüfung von Qualität und Zielen wird der Leistungsnehmer im Bedarfsfall direkt befragt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 3: Leistungsbeziehungen im Rahmen eines Persönlichen Budgets (vgl. Metzler 2007, S. 28)
Metzler spricht in diesem Zusammenhang von einer Verlagerung der "Kräfteverhältnisse" (vgl. Metzler 2007, S. 25 ff.). Diese Verlagerung wird auch Einfluss auf die Angebotslandschaft in Deutschland haben (vgl. Meyer 2011, S. 100).
3.4 Empowerment als Voraussetzung und Methode
Der englische Begriff "empowerment" lässt sich u.a. mit "Befähigung", "Ermächtigung", "Mitwirkungsmöglichkeit" oder "Stärkung" übersetzen (vgl. www.dict.cc).
Empowerment ist aus zwei Perspektiven zu betrachten (vgl. Stark 2002, S. 57):
1. Empowerment beschreibt die Entwicklung von "Einzelnen, Gruppen und Strukturen" zu größerem Einfluss und Handlungspotential (vgl. ebd., S. 57). Das Empowerment-Konzept hat sich in den 1960er sowohl aus den Bürgerrechtsbewegungen der Schwarzen in den USA, der emanzipatorischen Frauenbewegung als auch der Independent Living, oder Selbstbestimmt-Leben- Bewegung, entwickelt. All diese Bewegungen haben den Kampf für soziale Gleichstellung und gegen Diskriminierung in Form von Entrechtung, Ausschluss und Chancenungleichheit gemeinsam. Dies führt innerhalb der Bewegungen zur Zunahme von Selbstachtung und Stolz, mit enormem Einfluss auf die Gesellschaft. Ebenso lassen sich die politischen und gesellschaftskritischen Ansätze der Antipsychiatrie-Bewegung, aus denen sich beispielsweise Selbsthilfegruppen oder wichtige Ansätze der Sozialpsychiatrie entwickelten, als Empowerment deuten (vgl. Quindel 2000, S. 100). Gerade Psychiatriebetroffenen wurde das Recht auf Selbstbestimmung lange Zeit abgesprochen. Behandlungsverweigerung wurde beispielsweise als mangelnde Krankheitseinsicht oder als fehlende Entscheidungskompetenz ausgelegt (vgl. Knuf 2009, S. 32).
Chamberlin definiert Empowerment als "Stärkung der Eigenmacht" psychiatrieerfahrener Patient*innen. Diese Begriffsbestimmung ist der Konsens langer Diskussionen von Aktivist*innen verschiedener Selbsthilfegruppen. Konkret bedeutet sie
"1. die Entwicklung der Fähigkeit, eigene Entscheidungen zu treffen;
2. über den Zugang zu Informationen und Ressourcen zu verfügen;
3. über Handlungsalternativen zu verfügen, unter denen man wählen kann (nicht nur ja/nein, entweder/oder);
4. Durchsetzungsfähigkeit;
5. das Gefühl zu haben, als Individuum etwas bewegen zu können (Hoffnung zu haben);
6. kritisd sowie einen neuen Blick auf die Dinge einzuüben:
a. zu lernen, neu zu definieren, wer wir sind (mit eigener Stimme zu sprechen);
b. zu lernen, neu zu definieren, was wir zu tun vermögen;
c. zu lernen, unser Verhältnis zu institutioneller Macht neu zu definieren;
7. Wut zu erkennen und äußern zu lernen;
8. sich nicht allein zu fühlen, sondern als Teil einer Gruppe zu begreifen;
9. zu der Einsicht gelangen, dass jeder Mensch Rechte hat;
10. Veränderungen im eigenen Leben und im Umfeld zu bewirken;
11. neue Fähigkeiten zu erlernen (etwa die Fähigkeit zur Kommunikation), die der Betroffene für wichtig hält;
12. die Wahrnehmung anderer bezüglich der eigenen Handlungskompetenz
[...]
1 "Die Abkürzung ICD steht für "International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems", die Ziffer 10 bezeichnet die 10. Revision der Klassifikation. Die ICD-10 ist (...) Teil der Familie der internationalen gesundheitsrelevanten Klassifikationen. (...) Die ICD-10 der WHO ist die international am häufigsten eingesetzte Diagnosenklassifikation (überwiegend zur Mortalitätskodierung). " (http://www.dimdi.de/static/de/klassi/icd-10-who/index.htm)
- Arbeit zitieren
- Lars Reuber (Autor:in), 2016, Das persönliche Budget als Wegbereiter individueller Lebensführung für Menschen mit seelischen Behinderungen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/338408
Kostenlos Autor werden














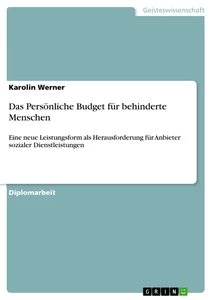




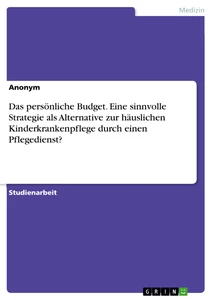
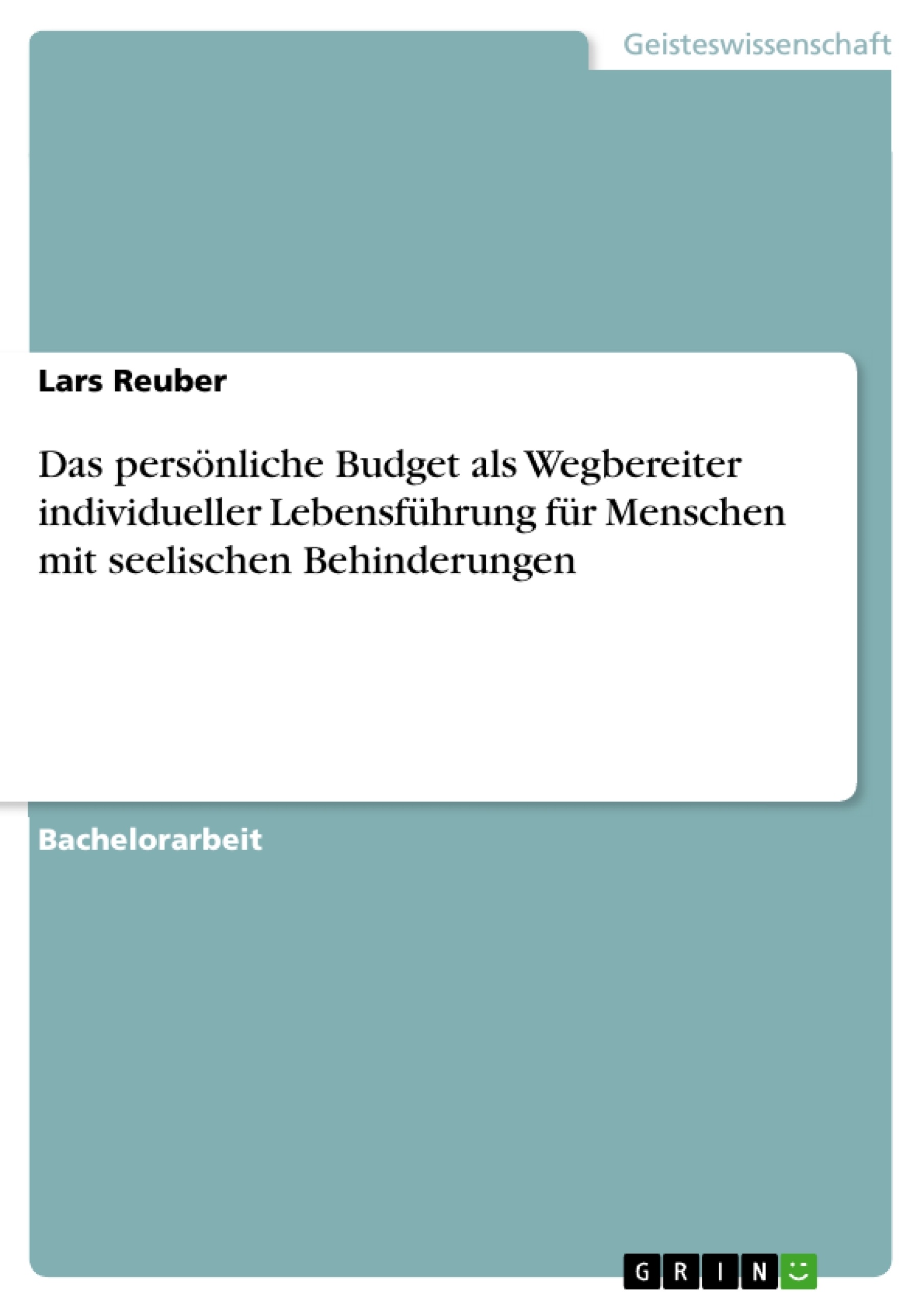

Kommentare