Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1 Hinführung und Relevanz
2 Mögliche Gefährdungen im Kontext von psychischen Erkrankungen der Eltern
2.1 Ausgewählte Krankheitsbilder der Eltern
2.1.1 Angststörungen
2.1.2 Affektive Störungen
2.1.3 Persönlichkeitsstörungen
2.1.3.1 Borderline-Persönlichkeitsstörung
2.1.3.2 Dissoziale Persönlichkeitsstörung
2.1.4 Schizophrenie
2.1.5 Exkurs: Das Münchhausen-by-proxy-Syndrom
2.2 Risikofaktoren für Kindeswohlgefährdung und die kindliche Entwicklung
2.2.1 Genetische Faktoren
2.2.2 Merkmale der Eltern
2.2.3 Merkmale des Kindes
2.2.4 Merkmale der Familie
3 Die Zusammenhänge von psychisch erkrankten Eltern und Kindesmisshandlung sowie die Folgen für die kindliche Entwicklung
3.1 Die Prävalenz zur Entwicklung von psychischen Störungen bei Kindern
3.2 Die Lebenssituation von Kindern psychisch erkrankter Eltern
3.2.1 Unmittelbare Probleme
3.2.2 Folgeprobleme
3.3 Die Formen von Kindesmisshandlung im Kontext von psychisch erkrankten Eltern
3.3.1 Vernachlässigung
3.3.2 Psychische Kindesmisshandlung
3.3.3 Physische Kindesmisshandlung
3.3.4 Sexueller Missbrauch
3.4 Die Auswirkungen von Kindesmisshandlung auf die kindliche Entwicklung
4 Schutzfaktoren für die kindliche Entwicklung
4.1 Resilienz
4.2 Persönliche Schutzfaktoren
4.3 Familiäre Schutzfaktoren
4.4 Soziale Schutzfaktoren
4.5 Besondere Schutzfaktoren für Kinder psychisch erkrankter Eltern
5 Der Umgang mit Kindeswohlgefährdung in der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe
5.1 Kindeswohlgefährdung erkennen und einschätzen
5.2 Prävention und Intervention
5.2.1 Die Hilfen zur Erziehung
5.2.2 Exkurs: Der CHIMPs-Beratungsansatz
6 Ausblick
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
„Eine Gesellschaft offenbart sich nirgendwo deutlicher als in der Art und Weise, wie sie mit ihren Kindern umgeht.
Unser Erfolg muss am Glück und Wohlergehen unserer Kinder gemessen werden, die in einer jeden Gesellschaft zugleich die verwundbarsten Bürger und deren größter Reichtum sind.“
- Nelson Mandela
1 Hinführung und Relevanz
Psychische Störungen sind keine Seltenheit, sondern kommen in der deutschen Gesamtbevöl- kerung häufig vor. Während psychische Erkrankungen vor 20 Jahren noch nahezu bedeu- tungslos zu sein schienen, sind sie heute die zweithäufigste Diagnosegruppe bei Arbeitsunfä- higkeit (vgl. Knieps/Pfaff 2015: 247). Es wird davon ausgegangen, dass etwa 31 % der Er- wachsenen in Deutschland im Laufe ihres Lebens unter einer psychischen Störung leiden, wo- bei häufiger Frauen als Männer betroffen sind (vgl. Mattejat 2014: 69; Plass/Wiegand-Grefe 2012: 18). Bei einer vorsichtigen Schätzung kann davon ausgegangen werden, dass bei etwa einem Viertel der psychisch erkrankten Erwachsenen eine Behandlungsnotwendigkeit besteht (vgl. Mattejat 2014: 70).
Psychisch erkrankte Erwachsene sind nicht weniger häufig Eltern von minderjährigen Kin- dern als psychisch gesunde Erwachsene (vgl. Mattejat 2014: 74): Es existieren zwar keine ge- nauen Angaben über die Anzahl betroffener Kinder, es wird jedoch geschätzt, dass etwa drei Millionen Kinder deutschlandweit im Verlauf eines Jahres einen Elternteil mit einer psychi- schen Störung erleben (vgl. Mattejat 2014: 74 f.). Davon müssen etwa 250.000 Kinder zu ei- nem beliebigen Zeitpunkt die Erfahrung machen, dass sich ein Elternteil in psychotherapeuti- scher oder psychiatrischer Behandlung bzw. Betreuung befindet. Wird die Krankenhausstatis- tik hinzugezogen, lässt sich feststellen, dass etwa 175.000 Kinder pro Jahr die Erfahrung ma- chen, dass ein Elternteil wegen einer psychischen Erkrankung stationär psychiatrisch behan- delt wird (vgl. Lenz/Brockmann 2013: 20; Mattejat 2014: 75). Die Bundespsychotherapeuten- kammer (2007) schätzt, dass etwa 1,5 Millionen Kinder in Deutschland mit einem psychisch erkrankten Elternteil leben.
Diese Kinder sind in vielen verschiedenen Weisen von der Erkrankung ihrer Eltern betroffen - sie erleben u. a. nicht nur besonders häufig Kindesmisshandlung durch ihre Eltern, sondern unterliegen auch einem erhöhten Risiko, selbst einmal eine psychische Störung oder Auffäl- ligkeiten zu entwickeln. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich primär mit diesen Schwer- punkten und bearbeitet im ersten Teil die Fragestellung, wie sich eine psychische Erkrankung der Eltern und Kindesmisshandlung auf die kindliche Entwicklung auswirken können. Ab- schließend werden im letzten Teil dieser Arbeit die Faktoren aufgezeigt, die den Kindern psy- chisch erkrankter Eltern trotz der oftmals schwierigen Lebensumstände eine gesunde Ent- wicklung ermöglichen können und welchen Beitrag die öffentliche Kinder- und Jugendhilfe leisten kann, um alle von der elterlichen Erkrankung betroffenen Familienmitglieder präventiv und intervenierend zu unterstützen, damit das Kind in seinem Wohl geschützt ist und das Risi- ko für eine Selbsterkrankung abgewendet bzw. gemildert werden kann.
2 Mögliche Gefährdungen im Kontext von psychischen Erkrankungen der Eltern
Im folgenden Kapitel wird als Einstieg in die Thematik eine Grundlage durch kurze Definitio- nen ausgewählter Krankheitsbilder geschaffen, um dann auf die von psychisch erkrankten El- tern ausgehenden Risiken eingehen zu können. Da der Schwerpunkt dieser Arbeit auf den Ri- sikofaktoren der Kindesmisshandlung durch psychisch erkrankte Eltern und der Entwicklung von psychischen Störungen und Auffälligkeiten liegt, ist es für die Kinder- und Jugendhilfe im Handlungsfeld Kinderschutz relevant, sich mit den Risikofaktoren für Kindeswohlgefähr- dung (nachfolgend KWG genannt) bzw. für die kindliche Entwicklung zu befassen, da sie da- durch die Belastung(en) der Kinder qualifizierter einschätzen und in Folge dessen gezielter intervenieren können. Für die Kinder besteht ein besonders erhöhtes Risiko für Kindesmiss- handlung und die Entwicklung von Auffälligkeiten oder psychischen Störungen, wenn mehre- re Risikofaktoren zusammenwirken (vgl. Bender/Lösel 2005: 320; Lenz 2014: 43).
2.1 Ausgewählte Krankheitsbilder der Eltern
Bei den ausgewählten Krankheitsbildern handelt es sich zunächst um die der Angststörungen, affektiven Störungen und der Borderline-Persönlichkeitsstörung sowie der dissozialen Persön- lichkeitsstörung, da diese die häufigsten Diagnosen von misshandelnden Eltern darstellen, die psychisch erkrankt sind (vgl. Deneke 2005: 142; Lenz 2014: 49 f.). Letztere Persönlichkeits- störung ist die häufigste Diagnose bei misshandelnden Vätern, die zuvor genannten Krank- heitsbilder stellen die häufigsten Diagnosen von misshandelnden Müttern dar (vgl. Deneke 2005: 142). Angststörungen (16,2 %) und affektive Störungen (11 %) zählen zu den häufigs- ten psychischen Erkrankungen deutschlandweit (vgl. Jachertz 2013: 269). Ein weiterer Grund, weshalb explizit diese Krankheitsbilder genannt werden und weshalb die Erläuterung dieser für die Kinder- und Jugendhilfe relevant ist, resultiert aus dem wissenschaftlichen For- schungsstand, welcher aufzeigt, dass etwa drei Viertel der an Depression und Angststörung er- krankten Eltern (häufiger alleinerziehende Mütter) mit ihren minderjährigen Kindern zusam- menleben (vgl. Lenz/Brockmann 2013: 20). Das Krankheitsbild der Schizophrenie wird be- nannt, da diese Erkrankung zusätzlich zu den aufgeführten Störungsbildern für die Kinder ein signifikant erhöhtes Risiko darstellt, im Laufe ihrer Kindheit und Jugend selbst eine psychi- sche Störung zu entwickeln (vgl. Hebebrand u. a. 2010: 263). Ein Exkurs bildet das Münch- hausen-by-proxy-Syndrom (nachfolgend MbpS genannt), auf welches aufgrund der geringen Aufmerksamkeit in der Forschung und Gesellschaft eingegangen wird.
2.1.1 Angststörungen
Angst ist in der Regel eine angemessene, hilfreiche und sinnvolle Reaktion auf eine gefährli- che Situation und schützt die betroffene Person vor deren Folgen. Berichten PatientInnen von Angst, muss von ÄrztInnen unterschieden werden, ob es sich um „berechtigte“ oder patholo- gische Angst handelt. Laut Reinecker (2003: 110) wird von pathologischer Angst gesprochen, wenn der Grad und die Dauer der Angst in einem Missverhältnis zu den Auslösern stehen und folgende Kriterien zutreffen:
- die Angstreaktion ist der Situation nicht angemessen,
- sie ist chronisch,
- die PatientIn besitzt keine Möglichkeiten zur Erklärung, Reduzierung oder Bewälti- gung der Angst und
- die Angstzustände führen zu einer massiven Beeinträchtigung in der alltäglichen Le- bensführung.
Angst kann in Form von Phobien (Angst vor konkreten Objekten, Situationen und Erlebnis- sen), Panikstörungen (unvorhersehbare objekt- und situationsunspezifische Angst- oder Pa- nikzustände), generalisierten Angststörungen (objekt- und situationsunspezifische, anhaltende Angst bspw. vor Erkrankungen) und Zwangsstörungen (wiederkehrende zwanghafte Gedan- ken und Handlungen) auftreten (vgl. Schone/Wagenblass 2010: 33 f.). Weiterhin treten Angst- störungen selten isoliert auf: über die Hälfte der Betroffenen erfüllt die Kriterien mindestens einer weiteren Störung, die häufigsten Begleiterkrankungen (31 %) sind affektive Störungen (vgl. Hoyer/Helbig/Margraf 2005: 41).
2.1.2 Affektive Störungen
Affektive Störungen können als Störungen der Stimmung und des subjektiven Gefühlszustan- des bezeichnet werden. Es wird zwischen unipolaren (depressive oder manische Krankheits- phasen) und bipolaren (abwechselnde manische und depressive Krankheitsphasen) Störungen unterschieden (vgl. Schone/Wagenblass 2010: 34, verbildlichte Darstellung in Abbildung 1).
Eine Depression äußert sich vor allem in Traurigkeit, Verstimmung und Niedergeschlagenheit. „Depression ist nicht gleich Trauer“ (Arbeitsgemeinschaft der Psychoseseminare o. J.: 6). Die PatientInnen trauern verzweifelt und versuchen zeitgleich der Trauer zu entkommen, was zu einer Distanz vor der eigenen Person führt (vgl. Arbeitsgemeinschaft der Psychoseseminare o. J.: 6 f.). Das ICD-10 unterscheidet leichte, mittelgradige und schwere Depressionen. Schwere depressive Störungen werden meist in stationären Psychiatrien behandelt, während PatientIn- nen mit einer leichten oder mittelschweren Depression häufig in der Primärversorgung und der allgemeinen medizinischen Versorgung betreut werden (vgl. Schone/Wagenblass 2010: 34 f.). Abbildung 2 zeigt die Symptome, die für die Diagnose einer Depression relevant sind. Depressionen verlaufen meist in Episoden, die Wochen, Monate oder Jahre andauern können. Etwa 15 % der PatientInnen mit schweren depressiven Erkrankungen versterben durch Suizid. Schätzungen gehen davon aus, dass ca. die Hälfte der depressiv Erkrankten im Laufe ihres Lebens einen Suizidversuch begehen (vgl. Deutsche Depressionshilfe 2016). Abbildung 3 ver- bildlicht die Suizidraten für das Jahr 2012 nach Geschlecht und Alter unterschieden.
Eine Manie zeichnet sich durch eine situationsunangemessene, erhöhte oder gereizte Stim- mung aus, die mit einer Steigerung im Ausmaß und Geschwindigkeit der körperlichen und psychischen Aktivität verbunden ist. „Manie ist nicht gleich Glück“ (Arbeitsgemeinschaft der Psychoseseminare o. J.: 7). Die PatientInnen sind verzweifelt glücklich. Das Selbstbewusst- sein kann bis zum Größenwahn wachsen und die PatientInnen zeigen häufig maßlosen Opti- mismus (vgl. Dilling u. a. 1999: 132). Abbildung 4 stellt die klassischen Symptome einer Ma- nie dar.
Von einer bipolaren affektiven Störung wird gesprochen, wenn sich Manie und Depression in ihrem Auftreten abwechseln. Manische Episoden beginnen meist abrupt und dauern in der Re- gel zwei Wochen bis zu vier oder fünf Monaten an. Depressive Phasen dauern mit durch- schnittlich sechs Monaten meist länger und können mit zunehmendem Alter häufiger auftreten und länger andauern. Die Wechselhäufigkeit sowie die Verlaufsmuster sind variabel (vgl. Schone/Wagenblass 2010: 37).
Affektive Störungen sind mit einem Lebenszeitrisiko von durchschnittlich 8,3 % keine seltene Erkrankung. Obwohl für Einzelerkrankungen eine gute Prognose besteht, diese erfolgreich zu behandeln, kommt es bei etwa 20 % der Erkrankungen zur Chronifizierung (vgl. Pretis/Dimo- va 2004: 32).
2.1.3 Persönlichkeitsstörungen
2.1.3.1 Borderline-Persönlichkeitsstörung
Seit Ende der achtziger Jahre ist die Borderline-Störung (zu Deutsch: Grenzlinie) den Persönlichkeitsstörungen zugeordnet. Nach der ICD-10 ist die Borderline-Persönlichkeitsstörung ein Typus der emotional-instabilen Persönlichkeitsstörung:
Emotional-instabile Persönlichkeitsstörung (F60.3):
- Impulsiver Typ (F60.30)
- Borderline-Typ (F60.31) (vgl. ICD-Code 2016)
Die Borderline-Störung umfasst mehrere Bereiche der Persönlichkeit und führt mit einer Be- einträchtigung der inneren Ausgeglichenheit zu Störungen in den sozialen Beziehungen der PatientInnen. Für die PatientInnen bestehen in jeder Hinsicht zwei Extreme: gut und böse, Liebe und Hass, schwarz und weiß, entweder-oder (vgl. Schone/Wagenblass 2010: 39). Die Betroffenen sind oft „grenzverletzt“, weil ihre Grenzen von anderen missachtet wurden (vgl. Knuf/Tilly 2014: 14). Symptome, die für eine Diagnose einer Borderline-Persönlichkeitsstö- rung relevant sind, verdeutlicht Abbildung 5. Langanhaltende Depressionen (70 %), depressi- ve Phasen (50 %), Suchtmittelmissbrauch oder -abhängigkeit (30 %) und eine Überlappung mit chronischen und komplizierten Verläufen von posttraumatischen Belastungsstörungen (30 %) sind häufige Begleitsymptome dieses Störungsbildes (vgl. Universitätsklinikum Bonn o. J.). Das Suizidrisiko liegt bei 4-9 % (vgl. Gudlowski 2016: 47). Die häufigsten körperlichen Erkrankungen sind bei Diagnosestellung ernährungsbedingte Störungen, Infektionen und Selbstverletzungsfolgen. Hauptrisikofaktoren für dieses Krankheitsbild sind u. a. ein junges Lebensalter, das weibliche Geschlecht, eine gestörte Schmerzempfindung sowie familiäre Be- lastungen mit psychiatrischen Erkrankungen. Die Diagnose wird mit 75 % überwiegend bei Frauen gestellt (vgl. Universitätsklinikum Bonn o. J.).
2.1.3.2 Dissoziale Persönlichkeitsstörung
Die ICD-10 definiert die dissoziale Persönlichkeitsstörung (F60.2) als eine „Persönlichkeits- störung, die durch eine Missachtung sozialer Verpflichtungen und herzloses Unbeteiligtsein an Gefühlen für andere gekennzeichnet ist“ (ICD-Code 2016). Die PatientInnen zeigen häufig deutliche und andauernde Verantwortungslosigkeit, eine geringe Frustrationstoleranz und eine niedrige Schwelle für aggressives oder gewalttätiges Verhalten. Weitere Diagnosekriterien sind die Diskrepanz zwischen dem eigenen Verhalten und bestehenden sozialen Normen. Das Verhalten der PatientInnen scheint nicht änderungsfähig und sie neigen dazu, andere zu be- schuldigen oder vordergründige Rationalisierungen für ihr Verhalten anzubieten (vgl. ICD- Code 2016). Mit einer Prävalenz bei Frauen von 1-2 % und einer Prävalenz von 3-4 % bei Männern ist die Rate in westlichen Ländern deutlich höher als in anderen Teilen der Welt (vgl. Schmeck/Schlüter-Müller 2009: 20). Vorwiegend leiden die PatientInnen unter einer weiteren Persönlichkeitsstörung, Suchterkrankungen oder somatoformen Störungen (körperliche Be- schwerden ohne eindeutige körperliche Ursache). Die PatientInnen sind der Annahme, sie müssten ihre Autonomie entschlossen verteidigen, ohne auf die Bedürfnisse anderer Rücksicht zu nehmen. Verhaltensweisen anderer deuten sie häufig als unberechenbare, zum Teil physisch gewalttätige Bedrohung (vgl. Tress u. a. 2002: 11 f.).
2.1.4 Schizophrenie
Bei dem Krankheitsbild der Schizophrenie (F20), das sich nochmals in verschiedene Formen unterteilen lässt, sind das Denken, Fühlen und Wahrnehmen der PatientInnen gestört. Dazu gehören die Eingebung von Gedanken, Gedankenübertragung und Gedankenentzug durch Hö- ren von Stimmen, welche die Betroffenen in der dritten Person über sich sprechen hören (vgl. Schone/Wagenblass 2010: 37). Schizophrene Mütter verhalten sich ihren Kindern gegenüber oft „bizarr“, was durch unvorhersehbare, wechselhafte und feindselige Handlungen geprägt ist. Abbildung 6 stellt die Symptome, die für eine Diagnose einer schizophrenen Störung rele- vant sind, dar. Eine Schizophrenie festigt sich überwiegend in der ersten Lebenshälfte. Das Kernalter liegt zwischen dem 18. und dem 35. Lebensjahr (vgl. Faust o. J.: 4). Beide Ge- schlechter sind etwa gleich häufig betroffen, wobei Frauen im Allgemeinen später erkranken (vgl. Scharfetter 1990: 123). Mit 1 % Lebenszeitprävalenz stellt die Schizophrenie ein eher seltenes Krankheitsbild der deutschen Bevölkerung dar. Die Zahl der Neuerkrankungen pro Jahr belaufen sich auf 15-20 PatientInnen pro 100.000 EinwohnerInnen (vgl. Faust o. J.: 4).
2.1.5 Exkurs: Das Münchhausen-by-proxy-Syndrom
Bei dem MbpS (zu Deutsch: Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom) handelt es sich um eine psychische Erkrankung der VerursacherIn, die darauf beruht, dass eine nahe stehende Person (in der Regel die Mutter, vgl. Lorenc 2011: 23; Nowara 2005: 129; Sheridan 2003) bei einem Kind Anzeichen einer Krankheit vortäuscht oder aktiv erzeugt, um es wiederholt zur medizinischen Abklärung vorzustellen (vgl. Noeker/Keller 2002: 1357).
In der Literatur besteht eine Debatte darüber, ob das MbpS als Sonderform der Kindesmiss- handlung oder als Störungsbild der Eltern gesehen werden kann. Kindler (2006d: 7-3) gibt an, dass viele Autoren das MbpS häufig als eine Sonderform von Kindesmisshandlung beschrei- ben, welche nicht nur die Schädigungen und Erfahrungen der betroffenen Kinder einschließe, sondern auch die verursachenden Handlungen der Bezugsperson (vgl. Noeker/Keller 2002: 1357; Rosenberg 2002: 615). In der psychiatrischen Literatur wird das MbpS jedoch als eine Sonderform der artifiziellen Störungen verstanden, weswegen es in dieser Arbeit als ein Krankheitsbild aufgeführt wird (vgl. Sonnenmoser 2010: 417; Nowara 2005: 128). Meines Erachtens handelt es sich um ein Krankheitsbild der betroffenen Person, welches in seiner Folge eine oder mehrere Formen von Kindesmisshandlung zum Ausdruck bringt.
Das MbpS wird nach Noeker und Keller (2002: 1357) durch die folgenden vier Merkmale de- finiert:
- bei einem Kind liegt ein Beschwerdebild vor, das in den meisten Fällen durch die Mutter des Kindes vorgetäuscht und/oder erzeugt worden ist,
- das Kind wird zur medizinischen Untersuchung und umfangreichen Behandlung vor- gestellt, häufig einhergehend mit multiplen Eingriffen,
- die vorstellende Person verleugnet ihr Wissen um die Ursachen des Beschwerdebildes,
- die akuten Symptome und Beschwerden bilden sich zurück, wenn das Kind von der TäterIn getrennt wird.
Die Symptome können simuliert, produziert oder zeitgleich simuliert und produziert werden, wobei bei Letzterem nochmals unterschieden werden muss, ob abwechselnd, gleichzeitig oder progressiv, d. h. steigernd, simuliert und produziert wird (vgl. Rosenberg 2002: 616).
Bekannt ist, dass sich bei den Müttern häufig eine tief greifende Persönlichkeitsstörung finden lässt, einer der häufigsten Diagnosen hierbei waren u. a. Borderline-Persönlichkeitsstörungen (vgl. Bools/Neale/Meadow 1994: 773 ff.). Ebenso konnte festgestellt werden, dass die Mütter häufig unter anhaltenden oder wiederkehrenden Gefühlen von Isolation und Einsamkeit lei- den. Sie berichteten wiederholt von eigenen Misshandlungserfahrungen (welche das Empa- thiedefizit erklären könnten) und häufigen Arztbesuchen sowie Operationen in der eigenen Kindheit, weshalb der Begriff des „Second-Generation-Münchhausen-by-proxy-Syndroms“ entstand (vgl. Parnell/Day 1998: 65; Rosenberg 2002: 622). Die Mütter zeigen sich in der In- teraktion mit Ärzten und Krankenhauspersonal äußerst kooperativ, engagiert und besorgt, weshalb sie meist spät in den Verdacht geraten, die verursachende Person zu sein (vgl. Nowa- ra 2005: 129; Krupinski 2006: 442 f.). Salgo (2015: 7) benennt dieses Phänomen als „Friendly Parent Illusion“. In diesem Fall bedeutet „später Verdacht“, dass durchschnittlich 15 Monate zwischen dem Einsetzen der Symptome und Diagnosestellung vergehen. Je aufmerksamer Ärzte und Krankenhausangestellte auf das Phänomen MbpS werden, desto eher lässt sich die- ser Zeitraum verkürzen (vgl. Rosenberg 2002: 618).
Führende, den Ärzten vorgestellte Symptome, sind Blutungen (44 %, u. a. verursacht durch medizinische Vergiftungen oder Hinzufügen von Farbstoffen zu Stuhl und Urin), Krampfanfälle (42 %, u. a. verursacht durch Erfinden oder Vergiftung), Komazustände/Bewusst- seinseintrübungen (19 %, u. a. verursacht durch Drogen oder Erstickung) und Atemstillstände (15 %, u. a. verursacht durch Erfinden und Erzeugen von Erstickung oder Vergiftung) (vgl. Nowara 2005: 131; Keller u. a. 1997: 1159).
Die Opfer des MbpS sind in der Regel jünger als fünf Jahre (vgl. Rosenberg 2002: 618), Kel- ler u. a. (1997: 1158) werden spezifischer und geben ein Durchschnittsalter von ca. 39,8 Mo- naten bei Diagnosestellung an, was die Brisanz des Themas für die Kinder- und Jugendhilfe verdeutlicht.
Bei dem MbpS sind die Geschwister von MbpS-Opfern häufig in gleicher Weise gefährdet, bzw. viktimisiert (vgl. Rosenberg 2002: 617). Ein Arzt muss damit rechnen, dass nicht nur das ihm vorgestellte Kind, sondern auch seine Geschwister betroffen sein können. Verschiedene Studien belegten dies: In einer Studie von Jureidini (1993: 135) hatten sechs Mütter 19 Kinder, von denen 14 (≈ 74 %) betroffen waren. In einer weiteren Studie von Alexander, Smith und Stevenson (1990: 581 ff.) waren von 18 Kindern aus fünf Familien 71 % betroffen. Freyberger (o.J.: 7) ist der Annahme, dass rund 70 % der Geschwisterkinder sequentiell mitbetroffen sind, welche die vorig genannten Studien bestätigt.
Als Motive der Mütter werden u. a. der Wunsch, im Mittelpunkt zu stehen und damit Aufmerksamkeit, Respekt, Bewunderung oder Fürsorglichkeit zu erregen, der Wunsch nach Zugehörigkeit (der durch den engen Kontakt mit Ärzten und Schwestern gestillt wird), Hassgefühle und Abneigung gegenüber dem Kind sowie Wut auf etwas, das das Kind macht (bspw. schreien) genannt. Ebenso kann ein Motiv sein, den Ehemann oder Partner in der kritischen Zeit an seine Seite zu binden oder umgekehrt, von ihm loszukommen. Weitere Motive sind selbstverständlich möglich (vgl. Rosenberg 2002: 620 f.).
Da es keine klaren Erkennungsmerkmale für ein MbpS gibt, wurden Warnhinweise beschrieben, die für ein MbpS sensibilisieren sollen (Tabelle 1).
2.2 Risikofaktoren für Kindeswohlgefährdung und die kindliche Entwicklung
Psychisch erkrankte Eltern stellen nicht nur eine Risikogruppe für KWG dar, von ihnen gehen ebenso Risikofaktoren aus, welche die kindliche Entwicklung beeinträchtigen können und so- mit die Entwicklung von psychischen Störungen fördern können. Bislang existieren laut Lenz (2014: 51) noch keine größeren Studien, in denen spezifische Merkmalskonstellationen von psychisch erkrankten Eltern untersucht wurden, die zur Erhöhung des Gefährdungsrisikos führen können. Es werden jedoch im Anschluss an die Risikofaktoren für KWG jeweils Bezü- ge zu psychisch erkrankten Eltern hergestellt, die für deren Kinder entwicklungsrelevant sind und die Entstehung von psychischen Störungen oder Auffälligkeiten fördern können. Allge- meine psychosoziale Risikofaktoren für die kindliche Entwicklung wie Armut, finanzielle Probleme und Schulden, Arbeitslosigkeit der Eltern, unzureichende Wohnverhältnisse und ein niedriger Ausbildungs- bzw. Berufsstand der Eltern etc. werden im Folgenden nicht genauer beschrieben, da sie für sich genommen das Gefährdungsrisiko für die Kinder nicht bedeutsam erhöhen (vgl. Lenz 2014: 51). Das bedeutet jedoch nicht, dass sie gänzlich irrelevant sind; aus der Forschung ist bekannt, dass die allgemeinen psychosozialen Risikofaktoren im Zusam- menwirken mit genetischen Faktoren das Risiko für psychische Störungen bei den Kindern er- höhen können (vgl. Lenz/Brockmann 2013: 30). Die Wahrscheinlichkeit für eine KWG steigt auch, wenn mehrere Risikofaktoren kumulieren. Die Risikofaktoren, die sich wechselseitig beeinflussen und nicht isoliert betrachtet werden dürfen, gilt es in der Kinder- und Jugendhilfe zu analysieren, um das Gefährdungsrisiko sowie die kindliche Belastung einschätzen und die gezielteste(n) Hilfe(n) für die gesamte Familie auswählen zu können (vgl. Lenz 2014: 51; Lenz/Brockmann 2013: 25 f.).
2.2.1 Genetische Faktoren
In Bezug auf die Weitergabe von psychischen Störungen dürfen die genetischen Erbfaktoren nicht unberücksichtigt bleiben. Genetische Faktoren und Risikofaktoren wirken in der Entstehung von psychischen Störungen eng zusammen und spielen eine in etwa gleich große Rolle (vgl. Lenz/Brockmann 2013: 25).
In verschiedenen Studien zeigte sich, dass bei Kindern, deren leibliche Eltern an einer Psychose erkrankten und die bei gesunden Pflegeeltern aufwuchsen, doppelt so häufig eine psychotische Erkrankung diagnostiziert wurde als bei Kindern, deren leibliche Eltern psychisch gesund waren und die bei psychisch erkrankten Pflegeeltern aufwuchsen (vgl. Lenz/Brockmann 2013: 23 f.). Es stellte sich jedoch auch bei der Vergleichsgruppe heraus, dass diese einem wesentlich höheren Risiko unterlagen, eine psychische Störung zu entwickeln als die Allgemeinbevölkerung, was bedeutet, dass sie diese nicht vererbt bekommen haben können. Da mehrere Studien zu teils sehr unterschiedlichen Ergebnissen gelangten, können nur ungefähre Angaben zur Vererbbarkeit von psychischen Erkrankungen gemacht werden; Tabelle 2 verdeutlicht diese. Die Gene bestimmen entscheidend darüber, ob sich negative Lebensumstände auf die kindliche Entwicklung auswirken und wie verletzlich und empfindsam das Kind auf diese belastenden Lebensumstände reagiert. Das Kind eines bspw. depressiven Elternteils gehört zu einer genetisch verletzlichen Gruppe, was jedoch nicht bedeutet, dass es dieselbe oder eine andere psychische Störung entwickeln wird (vgl. Lenz/Brockmann 2013: 24).
Genetische Faktoren sind demnach bedeutsam für die Entwicklung von Auffälligkeiten oder einer psychischen Störung und es liegt bei den Kindern eine vererbbare Verletzlichkeit vor, dennoch sind sie nicht die einzigen Faktoren, welche die Entwicklung beeinflussen und müssen immer im Zusammenwirken mit den folgenden Risikofaktoren betrachtet werden (vgl. Lenz/Brockmann 2013: 25).
2.2.2 Merkmale der Eltern
In der Kinder- und Jugendhilfe ist es von hoher Relevanz, im angemessenen Rahmen die Le- bensgeschichte der Eltern zu erfragen. Viele Eltern, die an KWG beteiligt sind, berichteten von selbst erlebten Misshandlungs-, Vernachlässigungs- und sexuellen Missbrauchserfahrun- gen (vgl. NZFH 2009: 15; Kempe/Kempe 1980: 21). Die Rate der Transmission von Gewal- terfahrungen wird auf etwa 30 % geschätzt (vgl. Lenz 2014: 51). Nienstedt und Westermann (2013: 59) bezeichnen dieses Phänomen als „Elend der Wiederholung“. Tsokos und Guddat (2014: 41) geben an, dass etwa 70 % der Eltern, die in ihrer Kindheit Misshandlung erlebten, selbst misshandeln. Von ihnen gehe das höchste Risiko für eine KWG aus. Des Weiteren kann die Erfragung der Lebensgeschichte der Eltern, auch wenn sie Zeit in Anspruch nimmt, in der Arbeit der Kinder- und Jugendhilfe (auf) ein Vertrauensverhältnis aufbauen und dadurch so- wohl die Kommunikation zwischen KlientInnen und SozialarbeiterInnen verbessern, als auch dabei helfen, die geeignetste(n) Hilfe(n) für alle Familienmitglieder zu wählen.
Auch die Persönlichkeit der Eltern beeinflusst die Wahrscheinlichkeit einer KWG. Persön- lichkeitsmerkmale, die bei betroffenen Eltern gehäuft auftreten und beobachtet werden konn- ten und die im Zusammenwirken mit weiteren Belastungen zu einer Gefährdung führen kön- nen, sind eine leichte Auslösbarkeit intensiver negativer Gefühle, erhöhte Ängstlichkeit, emo- tionale Verstimmung und Unglücklichsein, eine hohe Impulsivität und geringe Frustrationsto- leranz sowie eine überwiegende Neigung, Probleme vermeidend zu bewältigen und eine ge- ringe Planungsfähigkeit (vgl. Lenz 2014: 52; NZFH 2009: 15). Der Zusammenhang zwischen Problemen bei der Emotionsregulation der Eltern sowie mangelnde elterliche Reife und dem Misshandlungsrisiko konnte empirisch ebenso belegt werden (vgl. Lenz 2014: 52; Textor 2010: 5).
Misshandelnde und vernachlässigende Eltern unterscheiden sich in ihren Erwartungen, Gedanken und Gefühlen bezüglich der Versorgung und Erziehung ihrer Kinder deutlich von nicht misshandelnden oder vernachlässigenden Eltern. Folgende Merkmale bei Eltern, die nicht zwingend bei allen misshandelnden Eltern vorkommen, gefährden nach Reinhold und Kindler (2006b: 18-3) das Kindeswohl:
- altersunangemessene Erwartungen bezüglich der Fähigkeiten und Selbstständigkeit des Kindes,
- ein eingeschränktes Einfühlungsvermögen in die Bedürfnisse des Kindes,
- überdurchschnittlich ausgeprägte Gefühle der Belastung/der Hilflosigkeit in der Erzie- hung und des Verlustes von Kontrolle durch das Kind,
- feindselige Erklärungsmuster für Problemverhaltensweisen des Kindes und ein negativ verzerrtes Bild des Kindes,
- überdurchschnittlich ausgeprägte Zustimmung zu harschen Formen der Bestrafung und Unterschätzung negativer Auswirkungen kindeswohlgefährdender Verhaltenswei- sen,
- eingeschränkte Fähigkeit oder Bereitschaft, eigene Bedürfnisse zugunsten kindlicher Bedürfnisse zurückzustellen.
Bei vernachlässigenden und misshandelnden Eltern lassen sich häufiger Einschränkungen in ihren Beziehungsfähigkeiten im Umgang mit dem Kind beobachten. Reinhold und Kindler (2006b: 18-4) fassten die Ergebnisse aus 20 Beobachtungsstudien zusammen und legten dar, dass genannte Eltern signifikant häufiger kritische, negative und kontrollierende Verhaltens- weisen gegenüber ihrem Kind zeigten, als die Eltern der Vergleichsgruppe. Werden vernach- lässigende Eltern in der Interaktion mit ihrem Kind in der freien Beobachtung analysiert, wei- sen sie häufig distanziertes, wenig engagiertes und wenig responsives, d.h. auf das Verhalten des Kindes wenig reagierendes, Verhalten auf. Werden den Eltern Anleitungssituationen mit einem bestimmten Ziel vorgegeben, zeigen vernachlässigende, ähnlich wie auch misshandeln- de Eltern, gereizte und ärgerliche Verhaltensmuster. Unterstützendes, feinfühliges und positi- ves Verhalten trat deutlich seltener bei misshandelnden und vernachlässigenden Eltern auf, als bei den Eltern der Kontrollgruppe (vgl. Reinhold/Kindler 2006b: 18-4).
Psychisch erkrankte Eltern stellen eine hohe Risikogruppe für KWG dar. Münder, Mutke und Schone (2000: 95) geben an, dass in einer Stichprobe von Fällen, in denen ein Verfahren nach § 1666 BGB bei Gericht anhängig wurde, Anteile von ≈ 18 % gefunden wurden, bei denen in der betroffenen Familie von der beteiligten ASD-Fachkraft eine elterliche psychische Erkran- kung erfasst wurde.
Bestimmte Merkmale der elterlichen Erkrankung bedeuten für die Kinder ein hohes Entwick- lungsrisiko. Wichtige Risikofaktoren, die nicht zu einer KWG führen müssen, die jedoch für die Kinder mit einem besonders hohen Entwicklungsrisiko verbunden sind, sind krankheitsbe- zogene Faktoren. Dazu zählen: die Diagnose (Persönlichkeitsstörungen sind für die Kinder besonders belastend und beeinträchtigend, vgl. Wiegand-Grefe u. a. 2011: 32), ein hoher Schweregrad der Erkrankung und eine starke Chronizität der Erkrankung (vgl. Hammen/Brennan/Shih 2004: 994 ff.), eine hohe Rückfallhäufigkeit und Begleiterkrankungen (vgl. Plass/Wiegand-Grefe 2012: 37) sowie der Umgang des erkrankten Elternteils mit seiner Krankheit. Ein tabuisierender und verleugnender Umgang mit der eigenen Erkrankung wird als folgenreiches Risiko für die emotionale Befindlichkeit der Kinder betrachtet (vgl. Beards- lee u. a. 2003: 122). Mehrere Untersuchungen zeigten, dass das Störungsrisiko der Kinder umso größer ist, je länger die Erkrankung der Eltern andauert, je häufiger die Krankheitspha- sen bisher vorkamen und je schwerer die Erkrankung ist (vgl. Lenz 2014: 31). Nicht nur miss- handelnde und vernachlässigende Eltern zeigen in der Eltern-Kind-Interaktion
Auffälligkeiten; psychisch erkrankte Eltern zeigen sich häufig im Umgang mit ihren Kindern mit mangelnder Feinfühligkeit, eher passivem Verhalten, einer eingeschränkten Ausdrucksfähigkeit und mit Formen der emotionalen Nicht-Erreichbarkeit, die sich unmittelbar auf die Eltern-Kind-Bindung auswirkt (vgl. Plass/Wiegand-Grefe 2012: 38). Weitere Aspekte, die sich auf die Eltern-Kind-Bindung auswirken und Bindungsstörungen begünstigen können, sind die psychische Labilität der Eltern, Misshandlungserfahrungen in der eigenen Kindheit, eine konflikthafte, elterliche Beziehung bzw. Trennung und Scheidung der Eltern und mangelnde Erziehungskompetenzen (vgl. Plass/Wiegand-Grefe 2012: 39).
Die eingeschränkte Erziehungskompetenz psychisch erkrankter Eltern kann die Kinder ebenfalls in ihrer Entwicklung beeinträchtigen. Dazu zählen u. a. die fehlende Durchsetzungs- und Abgrenzungsfähigkeit, die fehlende Erziehungssicherheit und ein ungünstiger Erziehungsstil (vgl. Plass/Wiegand-Grefe 2012: 41).
2.2.3 Merkmale des Kindes
Das Alter des Kindes ist ein entscheidender Risikofaktor im Kontext von KWG. Im Jahr 2014 gab es deutschlandweit 48.095 Inobhutnahmen, von welchen 4.257 Kinder unter drei Jahren betroffen waren und somit den größten Anteil darstellen, 2.513 Kinder waren im Alter zwi- schen drei und sechs und 2.322 in Obhut genommene Kinder waren im Alter zwischen sechs und neun Jahren (vgl. Statistisches Bundesamt 2015b: 35). Ebenso konnten Münder, Mutke und Schone (2000: 84) nachweisen, dass mit ≈ 25 % vor allem Kinder im Alter zwischen null und drei Jahren betroffen waren. Die Zahlen zeigen: Je jünger das Kind ist, desto höher ist das Gefährdungspotenzial. Die Ursachen für die hohen Zahlen in dieser Alterspanne werden auf- grund der leichteren, körperlichen Verletzbarkeit vermutet sowie der Tatsache, dass diese Kin- der abhängiger von der elterlichen Fürsorge sind (vgl. Reinhold/Kindler 2006a: 17-1). Ein weiterer Grund ist, dass das Jugendamt auf diese Altersgruppe sensibler reagiert (vgl. Kauf- hold/Pothmann 2014: 9). Wird zwischen Vernachlässigung, körperlicher Misshandlung, psy- chischer Misshandlung und sexuellem Missbrauch unterschieden, bestätigt sich der beschrie- bene Alterstrend deutlich für die Vernachlässigung als Form von KWG. Im Gegensatz hierzu ist die altersbezogene Häufigkeit von sexuellem Missbrauch über dem dritten Lebensjahr des Kindes erhöht, da Verdachtsfälle im Grundschulalter, in der mittleren Kindheit und im begin- nenden Jugendalter gehäuft auftreten (vgl. Reinhold/Kindler 2006a: 17-2).
Wird die Geschlechterverteilung in den verschiedenen Formen von KWG betrachtet, wird deutlich, dass Mädchen etwa viermal häufiger wie Jungen von innerfamiliärem sexuellem Missbrauch betroffen sind (vgl. Lamnek u. a. 2012: 142). Geschlechtsunterschiede bei Vernachlässigung und psychischer Misshandlung werden hingegen selten berichtet (vgl. Reinhold/Kindler 2006a: 17-3).
Eine Reihe von Umständen (wie bspw. Alkohol- und Nikotinkonsum oder eine Frühgeburt) können während der Schwangerschaft, bei der Geburt oder kurz nach der Geburt als ein Risi- ko für die weitere Entwicklung des Kindes angesehen werden und zu Geburtsrisiken, Ent- wicklungsrückständen und Behinderungen führen (vgl. Reinhold/Kindler 2006a: 17-3). Dies hat zur Folge, dass die Eltern erhöhten Erziehungsanforderungen gewachsen sein müssen bzw. diesen nicht gewachsen sind. Empirische Befunde hierzu zeigen, dass Frühgeborene häufiger Verletzungen als Folge von Misshandlungen zeigten und auch häufiger durch Miss- handlungen zu Tode kamen (vgl. Gessner u. a. 2004: 9 ff.). Besonders gefährdet sind laut Sta - tistik jedoch entwicklungsbeeinträchtigte und behinderte Kinder (vgl. Sullivan/Knutson 2000: 1261).
Regulations- und Verhaltensstörungen der Kinder können eine erhöhte Belastung für die El- tern darstellen. Gefühle von Angst, Ärger und Hilflosigkeit können die Folge sein und dazu führen, dass die Eltern ihre Kinder überdurchschnittlich häufig misshandeln oder sich von ih- nen zurückziehen und sie in Folge dessen vernachlässigen (vgl. Reinhold/Kindler 2006a: 17-4). Das Misshandlungsrisiko steigt nochmals, wenn die Eltern keine Erklärung oder Dia- gnose für die Verhaltensauffälligkeiten des Kindes haben. Die subjektive Wahrnehmung der Eltern spielt hierbei eine bedeutende Rolle: Die Kinder weisen aus Sicht der Eltern mehr Ver- haltensauffälligkeiten auf als aus der Sicht außenstehender Personen (vgl. Lenz 2014: 55).
Risikofaktoren der elterlichen psychischen Erkrankung können Art, Dauer und Schweregrad derselbigen, sowie die subjektive Belastung des Kindes sein. Je länger ein Kind dem Einfluss der elterlichen psychischen Erkrankung ausgesetzt ist, desto höher ist das Risiko, in der Ent- wicklung beeinträchtigt zu werden (vgl. Plass/Wiegand-Grefe 2012: 42). Die nicht alters- und entwicklungsgerechte Aufklärung des Kindes über die elterliche Erkrankung ist ebenfalls ent- wicklungsrelevant. Erfolgt keine alters- und entwicklungsgerechte Aufklärung über das Krankheitsbild des Elternteils, kann es zu Verunsicherungen kommen (vgl. Mattejat 2014: 94). Tabelle 3 veranschaulicht die Anteile der über die Krankheit der Eltern informierten Kin- der.
2.2.4 Merkmale der Familie
Einer der Risikofaktoren für KWG im Kontext der Familie können die Familienstruktur und die sozioökonomische Situation darstellen. Viele Familien, in denen es zu KWG kommt, sind von Armut betroffen (vgl. Münder/Mutke/Schone 2000: 89, 95; Bender/Lösel 2005: 330). Demgegenüber steht, dass ebenso Kinder in wohlhabenden Familien häufig Entwicklungsbe- lastungen und Gefährdungen ausgesetzt zu sein scheinen, diese jedoch kaum als Gefährdungs- fälle in Erscheinung treten (vgl. Reinhold/Kindler 2006c: 19-1). Ein weiterer Faktor können Erziehungsschwierigkeiten oder Druck durch Schule oder Kindergarten darstellen, welche zu Überforderung in der Familie führen (vgl. Lenz 2014: 56). Das Misshandlungsrisiko ist dann erhöht, wenn die Eltern in solchen Situationen über keine ausreichenden familiären Problemlösemuster verfügen und es in Folge dessen zu Hilflosigkeit und erhöhter Reizbereitschaft kommen kann (vgl. Lenz 2014: 56). Betroffene Kinder erleben häufig aufgrund von Trennung oder Scheidung den Verlust des Kontaktes zu einem Elternteil und müssen sich evtl. an neue Partner der Elternteile gewöhnen. Bei der Entstehung von KWG scheinen eine Scheidung oder Trennung der Eltern jedoch einen geringeren Einfluss auf die Misshandlungsrate zu haben, da zahlreiche Kinder unter diesen Bedingungen leben müssen, ohne von Gefährdung betroffen zu sein (vgl. Reinhold/Kindler 2006c: 19-1)
Während die allgemeine Stressbelastung in einer Familie einen eher geringen Einfluss auf die Entstehung von KWG hat (vgl. Brown u. a. 1998: 1065 ff.), konnte festgestellt werden, dass viele Familien, in denen es zu Misshandlung oder sexuellem Missbrauch kam, im Vergleich zu den Kontrollgruppen, über deutlich weniger soziale Unterstützung berichteten (vgl. Reinhold/Kindler 2006c: 19-2). Misshandelnde Familien verfügen oft über ein kleineres soziales Netzwerk, weniger Kontakten zu Verwandten und sind insgesamt sozial isolierter als die Vergleichsgruppen (vgl. Bender/Lösel 2005: 331).
Anhaltende Partnerschaftskonflikte, insbesondere in Verbindung mit wiederholter Partnerschaftsgewalt, können die Erziehungsfähigkeit beider Partner zeitweise erheblich einschränken. Wiederholte Partnerschaftsgewalt stellt im Hinblick auf Kindesmisshandlung einen der bedeutsamsten Risikofaktoren im familiären Kontext dar, der sich mit 5,9 % stark auf die psychische Gesundheit von Kindern auswirken kann (vgl. Reinhold/Kindler 2006c: 19-2; Christiansen 2011: 22). Als weniger bedeutsamer Risikofaktor für eine anhaltende oder erneut auftretende Gefährdung erwies sich eine langfristige Arbeitslosigkeit, sowohl bei Müttern als auch bei Vätern (vgl. Éthier/Couture/Lacharité 2004: 13 ff.).
Familien können psychologische Merkmale aufweisen, die das Risiko unterschiedlicher For- men von KWG erhöhen. Die Bedeutung von eingeschränkter Selbstorganisation, verminder- tem innerfamiliären Zusammenhalt, ungelösten Familienkonflikten, einem weniger offenem Umgang mit Gefühlen und stärkeren Auftretens von negativen Gefühlen innerhalb der Familie haben einen großen Einfluss auf die Entstehung von KWG (vgl. Lenz 2014: 56 f.). Eine feh- lende klare, innerfamiliäre Grenzziehung zwischen Eltern und Kindern (wie bspw. sexuali- siertes Verhalten oder Rollenumkehr) sind ebenfalls von Bedeutung (vgl. Reinhold/Kindler 2006c: 19-3).
Ein Risikofaktor im Zusammenhang von psychisch erkrankten Eltern und der kindlichen Ent- wicklung kann die transgenerationale Weitergabe von psychischen Störungen innerhalb der Familie darstellen. Die Weitergabe von psychischen Störungen, die durch genetische und psy- chosoziale Faktoren beeinflusst wird, stellt das entscheidende Risiko für die Entwicklung von psychischen Störungen dar (vgl. Plass/Wiegand-Grefe 2012: 41). Auch die Unangemessenheit der familiären Krankheitsverarbeitung stellt ein Risiko für die kindliche Entwicklung dar, sofern sie mit der Tabuisierung oder einem Kommunikationsverbot über die Krankheit einhergeht (vgl. Plass/Wiegand-Grefe 2012: 41).
3 Die Zusammenhänge von psychisch erkrankten Eltern und Kindesmisshandlung sowie die Folgen für die kindliche Entwicklung
Der folgende Teil dieser Arbeit widmet sich zunächst dem Schwerpunkt des erhöhten Risikos der Selbsterkrankung und beschreibt die Prävalenzraten sowie die Lebenssituation und Probleme von Kindern psychisch erkrankter Eltern, die mit der elterlichen Erkrankung einhergehen können, d. h. die Auswirkungen der elterlichen Erkrankung auf ihre Kinder. Anschließend wird der Schwerpunkt Kindesmisshandlung behandelt, in dem die Formen von Misshandlung und die Auswirkungen dieser auf die kindliche Entwicklung erläutert werden.
3.1 Die Prävalenz zur Entwicklung von psychischen Störungen bei Kindern
Die transgenerationale Weitergabe von psychischen Erkrankungen stellt, wie bereits erwähnt, das wesentliche Risiko für die Kinder dar, psychische Störungen und Auffälligkeiten zu entwickeln. Abbildung 7 verbildlicht die Zusammenhänge zwischen der elterlichen Erkrankung und einer psychischen Störung bei dem Kind.
Kinder von Eltern mit Angststörungen haben ein etwa neunfach erhöhtes, spezifisches Erkrankungsrisiko inne. Das Risiko an einer anderen psychischen Störung zu erkranken, ist um das Siebenfache erhöht (vgl. Turner/Beidel/Costello 1987: 232 f.). In einer Stichprobe von Beidel und Turner (1997: 918 ff.) waren sowohl das spezifische als auch das unspezifische Erkrankungsrisiko um das Fünf- bis Sechsfache erhöht.
Die Rate depressiver Erkrankungen bei Kindern depressiver Eltern liegt bei etwa 23-38 % (vgl. Remschmidt/Mattejat 1994: 70). Bei Kindern und Jugendlichen tritt bei 40 % im Kindes- und Jugendalter eine depressive Episode auf (vgl. Beardslee u. a. 1993: 730). Sind beide Elternteile von einer depressiven Störung betroffen, erhöht sich das Lebenszeitrisiko für eine andere psychische Störung bei deren Kindern auf 70 % (vgl. Mattejat 2002).
Kinder mit einem schizophren erkrankten Elternteil haben ein Risiko von etwa 13 % inne, im Laufe ihres Lebens selbst an Schizophrenie zu erkranken. Das Risiko erhöht sich auf etwa 40 %, wenn beide Elternteile erkrankt sind, während das Erkrankungsrisiko in der Allgemeinbevölkerung bei 1 % liegt (vgl. Remschmidt/Mattejat 2008: 413).
Tabelle 4 verdeutlicht, dass der Verwandtschaftsgrad ausschlaggebend für die Höhe des spezifischen Erkrankungsrisikos ist. Dabei sind eineiige Zwillinge mit 50 % am meisten gefährdet, darauf folgen die Kinder, von welchen beide Elternteile an Schizophrenie erkrankt sind. Für Kinder, deren Eltern schizophren erkrankt sind, besteht ebenfalls ein erhöhtes Risiko, krankheitsunspezifische Symptome zu entwickeln. Diese Symptome umfassen kognitive, emotionale, soziale, somatische und neurologische Auffälligkeiten sowie Abnormalitäten der Hirnströme und Aufmerksamkeits- und Denkstörungen (vgl. Plass/Wiegand-Grefe 2012: 49).
Es gilt als empirisch bewiesen, dass Kinder von Eltern mit Persönlichkeitsstörungen am stärksten gefährdet sind, psychische Störungen zu entwickeln (vgl. Wiegand-Grefe 2011: 32; Plass/Wiegand-Grefe 2012: 59). Sie zeigten im Vergleich zu Kindern, deren Eltern an einer anderen psychischen Störung erkrankten, die höchsten Auffälligkeitsraten und den ungünstigsten Entwicklungsverlauf. Weiterhin beschrieben sich die Kinder als weniger selbstbewusst und erlebten ihre erkrankten Mütter als überbehütend (vgl. Barnow u. a. 2006: 966).
Besonders hoch ist das Erkrankungsrisiko bei psychotisch und affektiv erkrankten Eltern, was jedoch nicht bedeutet, dass die Kinder dieselbe Störung entwickeln müssen. Das allgemeine Erkrankungsrisiko für die Kinder von psychisch erkrankten Eltern liegt in etwa bei 60 %, im Laufe ihrer Kindheit und Jugend psychische Störungen oder Auffälligkeiten zu entwickeln (vgl. Lenz/Brockmann 2013: 22). Das spezifische Erkrankungsrisiko ist im Vergleich zur Ge- samtbevölkerung deutlich erhöht, ist jedoch mit 10 % im absoluten Vergleich relativ niedrig (vgl. Mattejat 2014: 79).
3.2 Die Lebenssituation von Kindern psychisch erkrankter Eltern
Für die Soziale Arbeit ist es von hoher Relevanz sich mit den Gefühlslagen, Erlebnisweisen und dem Umgang mit den Alltagsanforderungen der Kinder von psychisch erkrankten Eltern auseinanderzusetzen, um ein Verständnis dafür zu entwickeln, wie sich Risikofaktoren auf das Kind auswirken und wie diese zu psychischen Beeinträchtigungen bis hin zur Entwicklung einer psychischen Störung führen können, um u. a. die geeignete(n) und notwendige(n) Hilfe(n) für die gesamte Familie zu wählen. Um herauszufinden, wie Kinder ihre Situation individuell erleben, ist es unumgänglich, sich mit deren Biographien und eigenen Angaben zum Erlebten zu beschäftigen.
Mattejat (1996: 22) unterscheidet zwischen unmittelbaren Problemen und Folgeproblemen. Die Gewichtung der dieser ist im Einzelfall sehr unterschiedlich und hängt vom Erleben des Kindes ab, wozu bisher wenige Erkenntnisse vorliegen (vgl. Schone/Wagenblass 2010: 155).
3.2.1 Unmittelbare Probleme
Unmittelbare Probleme sind jene, die sich direkt aus dem Erleben der Erkrankung ergeben. Dazu zählen Desorientierung, Schuldgefühle, Ängste, Isolation und Tabuisierung. Kinder nehmen krankheitsbedingte Veränderungen ihrer Eltern sehr genau und früh wahr, da sie eng mit ihnen verbunden sind und ihre Eltern sensibel beobachten (vgl. Plass/Wiegand-Grefe 2012: 23).
Verhält sich ein bspw. psychotisch erkrankter Elternteil plötzlich verwirrt, ist für das Kind nicht mehr ansprechbar oder bezieht das Kind in sein Wahnerleben ein, kann es bei dem Kind zu einer Desorientierung kommen (vgl. Plass/Wiegand-Grefe 2012: 23). Das Kind ist verwirrt und verängstigt, weil es das Verhalten des Elternteils nicht einordnen und verstehen kann (vgl. Mattejat 2014: 88). Der Elternteil, auf dessen Schutz und Fürsorge das Kind angewiesen ist, wirkt ängstlich, hilflos und wird von dem Kind in seinem Wesen als stark verändert und teilweise fremd wahrgenommen. „Die Selbstverständlichkeit des bisherigen Lebens wird aufgebrochen“ (Schone/Wagenblass 2010: 181). Jüngere Kinder reagieren auf diese Form von Veränderung meist aggressiv, um auf diese Weise ihre Überforderung auszudrücken. Ältere Kinder versuchen jede Form von Aufregung in der Familie zu vermeiden. Sie verhalten sich meist ruhig, agieren vorsichtiger und vermeiden es, Forderungen an den erkrankten Elternteil zu stellen, um seine Situation nicht zu verschlechtern (vgl. Lenz/Brockmann 2013: 32).
Für die Kinder sind Schuldgefühle oft sehr zentral und gegenwärtig. Sie glauben, an den psychischen Problemen des Elternteils Schuld zu sein, was oft durch mangelnde Aufklärung über die Krankheit des Elternteils entsteht. Gerade jüngere Kinder beziehen das Aufkommen von Krankheitssymptomen auf sich und fühlen sich dafür verantwortlich, dass es dem Elternteil schlecht geht (vgl. Lenz 2014: 93). In Konflikten kann es ebenso dazu kommen, dass der erkrankte Elternteil dem Kind die Schuld zuweist („Ich bin nur so, weil du nicht lieb bist“). Folgendes Zitat zeigt, wie die Erkrankung eines Elternteils, in Bezug auf Desorientierung und Schuldgefühlen, auf das Kind wirken kann:
„Ich fand für nichts Erklärungen, ich fühlte mich nicht wirklich geliebt, fühlte mich missbraucht von ihrer Krankheit und fühlte mich schuldig, nichts dagegen tun zu können, wenn es ihr schlecht ging“ (Bathe 2014: 29).
Ängste und Sorgen um den erkrankten Elternteil beherrschen die Kinder oft ebenfalls. Jüngere Kinder haben häufig Trennungsängste bei Klinikaufenthalten des Elternteils, Angst, dass sich der Krankheitszustand verschlechtern oder dem Elternteil etwas zustoßen könnte sowie die Angst davor, dass sich der Elternteil etwas antun könnte (vgl. Lenz 2014: 96):
„(...) ich weiß nicht (…) dass sie versucht, sich umzubringen (...) dann habe ich schreckliche Angst und alles (...). So schrecklich so, Herzklopfen. Wenn ich dann mich auf die Schule freue oder auf die Kinderkrippe und ich höre das, dann traue ich mich gar nicht mehr dahin irgendwie, weil ich habe Angst, dass sie dann wirklich mal vor 'nen Zug springt oder mit 'nem Messer“ (Mädchen, 10 Jahre alt; Lenz 2014: 94).
Häufig wird den Kindern ein Kommunikationsverbot der Eltern auferlegt oder sie haben den Eindruck, dass sie mit niemandem über die Familiensituation sprechen dürfen, weil in der Familie auch nicht darüber gesprochen wird. Stigmatisierung und Tabuisierung können dazu führen, dass die meisten Kinder wenig über die Häufigkeit von psychischen Erkrankungen wissen und denken, dass das Problem in ihrer Familie ein höchst ungewöhnliches sei (vgl. Mattejat 2014: 72). Sich niemandem anvertrauen zu können, kann zur sozialen Isolation führen:
„Ungeschriebenes Gesetz war, dass nichts über die Erkrankung meiner Mutter nach außen dringen durfte. Die Stigmatisierung psychisch Kranker ließ meinen Vater die Entscheidung treffen, die Erkrankung meiner Mutter unter allen Umständen zu verheimlichen. (...) Ich merkte auch an den Reaktionen meiner Umwelt auf meine Mutter, dass es besser war, über ihre Krankheit zu schweigen. (...) Ich habe mich oft allein gefühlt, zumal ich mich auch innerhalb der Familie allein fühlte“ (Scherber 2014: 16 f.).
Die Kinder haben oft die Befürchtung, dass sie ihre Eltern verraten, wenn sie mit jemandem über die Familiensituation bzw. -probleme sprechen, was einen Loyalitätskonflikt zwischen Eltern und Umwelt mit sich bringt (vgl. Mattejat 2014: 89).
3.2.2 Folgeprobleme
Dieser Loyalitätskonflikt kann innerhalb der Familie oder nach außen hin auftreten. Innerhalb der Familie werden die Kinder in Konflikte zwischen den Elternteilen einbezogen, wodurch bei ihnen das Gefühl entsteht, sich für einen Elternteil entscheiden zu müssen. Der Loyalitätskonflikt nach außen bezeichnet das Schamgefühl oder das Kommunikationsverbot, sich mit Freunden oder anderen Erwachsenen über die Probleme in der Familie zu unterhalten, was zur Folge haben kann, dass sich die Kinder zwischen Loyalität und Distanzierung hin- und hergerissen fühlen (vgl. Mattejat 2014: 89).
Abwertungserlebnisse können die Scham der Kinder verstärken. Die Kinder erleben als genaue Beobachter ihrer Eltern, dass diese und häufig auch sie selbst von außenstehenden Personen abgewertet werden (vgl. Mattejat 2014: 89):
[...]
- Arbeit zitieren
- Luisa Stortecke (Autor:in), 2016, Die Zusammenhänge von psychisch erkrankten Eltern und Kindesmisshandlung sowie die Folgen für die kindliche Entwicklung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/335926
Kostenlos Autor werden




















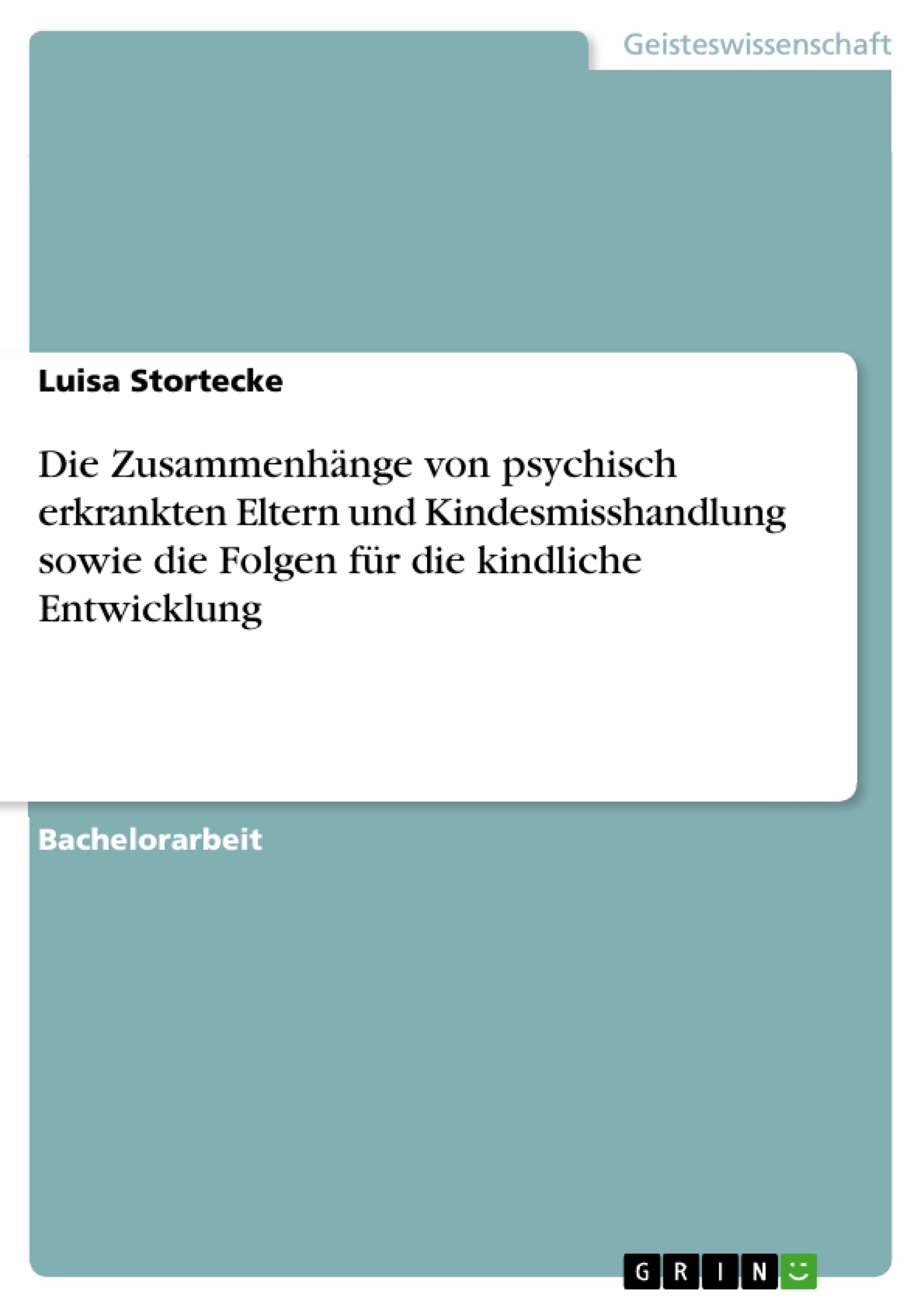

Kommentare