Leseprobe
Gliederung
1. Einleitung
2. Historischer Abriss: Politische Phasen in Lateinamerika seit dem 2. Weltkrieg
3. Die (Nicht-) Beachtung der Zivilgesellschaft – Leonardo Avritzers Kritik der Demokratisierungstheorien
3.1. Avritzers Kritik an der elitistischen Theorie
3.2. Avritzers Kritik an den Transitionstheorien
4. Partizipation durch den öffentlichen Raum: Die Public – Space – Theorie nach Avritzer
4.1. Public Space: Der öffentliche Raum
4.2. Das Konzept der partizipatorischen Öffentlichkeiten (participatory publics)
5. Die Zivilgesellschaft in den neuen Demokratien Lateinamerikas – ein empirischer Befund
6. Schlussbemerkungen
7. Literaturliste
Die Public-Space-Theorie von Leonardo Avritzer: Politische Partizipation durch den öffentlichen Raum? – Eine kritische Analyse der Rolle der Zivilgesellschaft am Beispiel Lateinamerikas
1. Einleitung
Nachdem in Lateinamerika in den 1960er und 70er Jahren mit Ausnahme von Venezuela und Costa Rica fast alle Länder von militärischen, autoritären Regimes regiert wurden, hat in den 1980er Jahren eine Welle der Demokratisierungen um sich gegriffen[1]. Zivilgesellschaftliche Akteure haben in den politischen Umbruchprozessen eine wichtige Rolle eingenommen, die jedoch nach der vollzogenen Transition im Konsolidierungsprozess nicht den von vielen Seiten erhofften Einfluss auf die politischen Entscheidungsmechanismen beibehalten konnte. Heute herrschen in fast allen lateinamerikanischen Ländern formale demokratische Systeme vor, doch bleiben viele Demokratietheoretiker angesichts der Stabilität und der Qualität der demokratischen Institutionen skeptisch.
Leonardo Avritzer wirft der bisherigen Demokratisierungsdebatte Lateinamerikas eine fehlende Wertschätzung der Bedeutung zivilgesellschaftlicher Akteure vor. Er kritisiert die seiner Meinung nach in den meisten Ansätzen implizit oder explizit vorherrschende Elite-Masse-Dichotomie, die ein vollständiges Verständnis des lateinamerikanischen Demokratisierungsprozesses verhindere. In seinem 2001 veröffentlichten Werk „Democracy and the Public Space in Latin America“ fordert er die komplette Auflösung dieser Masse – Elite – Dichotomie und schlägt stattdessen ein Konzept des öffentlichen Raumes vor. Sein Ansatz soll hier veranschaulicht und im Lichte der aktuellen Demokratisierungsdebatte Lateinamerikas kritisch beleuchtet werden. Dabei steht die Rolle der Zivilgesellschaft im Konsolidierungsprozess und ihre Berücksichtigung in den theoretischen Ansätzen im Vordergrund. Vorerst sollen jedoch in einem kurzen historischen Abriss die verschiedenen politischen Phasen in Lateinamerika seit dem 2. Weltkrieg dargestellt werden, um ein besseres Verständnis der theoretischen Diskussion zu gewährleisten.[2] Da sich die einzelnen Länder trotz vorhandener Gleichmäßigkeiten in bestimmten Punkten wiederum stark voneinander unterscheiden, kann hier keine Vollständigkeit der Darstellung angestrebt werden.
2. Historischer Abriss: Politische Phasen in Lateinamerika seit dem 2. Weltkrieg
Nach dem zweiten Weltkrieg ließ sich in Teilen Lateinamerikas eine „schwache Demokratisierungswelle“ beobachten.[3] Die jungen Demokratien wurden jedoch meist schnell im Keime erstickt und durch autoritäre Regime ersetzt.[4] Insgesamt war die politische Landschaft in Lateinamerika instabil. Neben autoritären Regimes gab es zwar demokratisch gewählte Regierungen, die jedoch oft „im Rahmen von undemokratischen Beschränkungen“ hinsichtlich der politischen Partizipation und/oder des politischen Wettbewerbs herrschten.[5] Im Mittelpunkt des politischen Interesses stand in den 1950er Jahren die Industrialisierung, für deren Realisierung eine interventionistische und klientelistische Politik vorherrschte.[6] Die kubanische Revolution im Jahre 1959 kann als Beginn einer neuen politischen Phase in Lateinamerika betrachtet werden. Mit ihr setzte sich eine „politisch-ideologische Polarisierung der nationalen politischen Prozesse“ in Gang, die in Zusammenhang mit der zunehmenden politischen Instabilität die politischen Entwicklungen in Lateinamerika prägte.[7] Demokratische Regierungssysteme gerieten verstärkt unter Druck, nach und nach etablierten sich autoritäre Regime im gesamten lateinamerikanischen Raum.[8] Um der wirtschaftlichen Unterentwicklung Lateinamerikas entgegenzuwirken, rückte immer mehr die Vorstellung in den Vordergrund,
„dass der Staat als zentraler Entwicklungsträger weiter verstärkt werden müsste, um jene Strukturreformen in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik durchzuführen, von denen man sich die erfolgreiche Überwindung der traditionellen abhängigen Einbindung Lateinamerikas in die von den kapitalistischen Industrieländern (allen voran die USA) dominierte Weltwirtschaftsordnung erhoffte.“ (Lauga: S. 25 f.)
Bisher stellte der Einsatz von Militärregimes in Lateinamerika als Übergangslösung eine durchaus legitime politische Variante dar, um ein Land aus einer politischen Krise herauszuführen. Die in den 1960/70er Jahren anerkannte Annahme, „dass diktatorische Regime [in Lateinamerika] günstigere Voraussetzungen für ökonomische Entwicklung bieten und dass erst in einem späteren Zeitraum Demokratie möglich würde“, spiegelte sich u.a. in der Außenpolitik der USA.[9] Die autoritären Regime, die sich in den 1960er Jahren durchgesetzt hatten, strebten jedoch eine unbefristete Herrschaft an.[10] Mit Mitteln größter staatlicher Repression sollten politische Ziele wie nationales Wirtschaftswachstum umgesetzt werden, die von den demokratischen Regierungen nicht erreicht wurden. Doch letztlich führte die Politik der autoritären Regime, die sich vor allem durch eine enorme Staatsverschuldung auszeichnete, nicht zum Erfolg. Im Gegenteil: Ende der 1970er Jahre befand sich Lateinamerika in der „schlimmsten Wirtschaftskrise seit der Großen Depression der dreißiger Jahre“[11]. Die zunehmende Gewalt und die bisher in dem Maße nicht gekannte Unterdrückung, die bis zur physischen Beseitigung zivilgesellschaftlicher Akteure ging (z.B. in Argentinien), zog außerdem internationale Aufmerksamkeit auf sich. Der inner- und außenpolitische Druck wuchs derartig, dass die Militärregime im Laufe der 1980er mehr oder weniger bereitwillig den Weg zur Demokratisierung frei machten. Im Prozess der Redemokratisierung spielten zivilgesellschaftliche Akteure, die sich paradoxerweise während der autoritären Herrschaft teilweise neu herausgebildet hatten, eine entscheidende Rolle:
„Mit ihren Versuchen, die Zivilgesellschaft zum Schweigen zu bringen, trugen die Diktaturen [...] unwillentlich zu einer Stärkung des gesellschaftlichen Pluralismus bei. Gerade in der Auseinandersetzung mit dem autoritären Staat entwickelten sich in der Zivilgesellschaft neue Stile der politischen Auseinandersetzung und veränderten sich die kollektiven Normen im Sinne einer (neuen) Wertschätzung für Bürgerrechte, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie.“ (Birle, S. 249)
Die Transition zur Demokratie zeichnete sich in Lateinamerika „durch die große Zahl der Fälle und den langen Zeitraum“ aus.[12] Die Transitionsprozesse unterschieden sich natürlich abhängig von den jeweiligen Ausgangsbedingungen der Länder. Heute sind alle lateinamerikanischen Länder mit Ausnahme von Kuba formale Demokratien. Die Frage ist, inwieweit demokratische Politik innerhalb des Institutionsgefüges tatsächlich praktiziert wird und nicht lediglich „alter Wein in neuen Schläuchen“ fließt. So lässt sich nach der formalen Redemokratisierung insbesondere bezüglich der im Laufe der Transition als so vielversprechend erscheinenden Partizipationsmöglichkeiten der zivilgesellschaftlichen Akteure in den Demokratien eine allgemeine Ernüchterung konstatieren.[13]
3. Die (Nicht-) Beachtung der Zivilgesellschaft – Leonardo Avritzers Kritik der Demokratisierungstheorien
Seit Beginn der 1990er Jahre erfährt die Zivilgesellschaft im Rahmen der wissenschaftlichen Demokratisierungsdebatte um Lateinamerika eine erhöhte Beachtung. In den verschiedenen theoretischen Ansätzen wird die Zivilgesellschaft in Lateinamerika im Transitionsprozess der 1980er Jahre insbesondere während der Konsolidierungsphase unterschiedlich bewertet. Avritzer zufolge behalten jedoch die meisten Theorien einen Top-down-approach bei, dessen Blickwinkel die Masse – Elite – Dichotomie nicht überwindet, wodurch der Zivilgesellschaft ein zu Unrecht untergeordneter Status im Konsolidierungsprozess der neuen Demokratien zugeordnet wird. Im Folgenden wird die Argumentationslinie Avritzers nachgezeichnet und geprüft, inwieweit sie sich als haltbar erweist.
3.1. Avritzers Kritik an der elitistischen Theorie
Avritzer wirft der elitistischen Demokratietheorie vor, in der politischen Partizipation eine grundsätzliche Gefahr für demokratische politische Systeme zu sehen.[14] Seine Kritik setzt bei Joseph Schumpeters demokratietheoretischen Ansatz an. Die Erfahrungen im zweiten Weltkrieg mit den antidemokratischen Tendenzen der Massenmobilisierungen insbesondere in Deutschland, galten in Sinne der elitistischen Theorie als ein Beweis für die Unabdingbarkeit einer führenden Elite, die für die demokratischen Werte der Gesellschaft stehen und diese gegen die antidemokratischen Tendenzen in der Bevölkerung verteidigen sollte.[15] Während Rousseau in seiner Staatstheorie noch vom vernünftigen, am Gemeinwohl interessierten, moralischen citoyen ausging, wird, so Avritzers Vorwurf, dem Volk nun Rationalität abgesprochen, also die Fähigkeit, „seinen eigenen Handlungen gegenüber methodisch die Prüfungsperspektive zugleich des Experten, des generalisierenden Anderen und des eigenen Selbst im futurum exactum [einzunehmen] und auf diese Weise die Kriterien des Handelns sachlich, sozial und zeitlich [zu validieren]“[16]. Eine direkte Erweiterung formeller Mitbestimmungs- und Partizipationsmöglichkeiten bedeute somit eine Gefahr für die Demokratie, die „nur zur Intensivierung des „verallgemeinerten Partikularismus [führe], d.h. zu jener privilegierten Durchsetzung von lokalen und gruppenspezifischen Sonderinteressen“.[17] Politische Partizipation steht demzufolge im Widerspruch mit demokratischer Herrschaft. Somit müsse laut Schumpeter die politische Partizipation des Volkes auf die Wahl zwischen politischen Eliten, die im Rahmen der politischen Institutionen rationale Entscheidungen für die Bevölkerung treffen, begrenzt werden, um das demokratische System zu schützen.[18] Der Wettbewerb zwischen den politischen Eliten gilt bei Schumpeter als eine Garantie für eine Regierung der Qualifiziertesten.[19] Freie Wahlen und politischer Wettbewerb werden von der elitistischen Theorie demzufolge als Hauptmerkmale für eine Demokratie festgelegt.[20]
Tatsächlich lassen sich die Kritikpunkte Avritzers bei Schumpeter wiederfinden, wie beispielsweise hinsichtlich der Rationalität des Bürgers:
„Insbesondere stehen wir [...] unter der praktischen Notwendigkeit, dem Willen des Individuums eine Unabhängigkeit und eine Rationale Qualität beizulegen, die völlig wirklichkeitsfremd sind. Wenn wir argumentieren, dass der Wille des Bürgers per se ein politischer Faktor ist, der Anspruch auf Achtung hat, so muss er erst einmal existieren. Das heißt, dass er etwas mehr sein muss als nur eine unbestimmte Handvoll vager Triebe, die um vorhandene Schlagworte und falsch verstandene Eindrücke lose herumspielen.“ (Schumpeter: S. 402 f., Hervorhebung im Original)
Allerdings muss hier bedacht werden, in welchem historischen Kontext Schumpeter zu diesen Überlegungen kommt, dessen Werk „Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie“ erstmals im Jahre 1942 erschienen ist, also während des 2. Weltkrieg. In dieser Zeit standen die Erfahrungen einer faschistischen Massenbewegung im Vordergrund. Die Heterogenität der Gesellschaft im Sinne verschiedener zivilgesellschaftlicher Akteure kam in der theoretischen Diskussion kaum vor, vielmehr kannte man die Annahmen der „Masse – Gesellschaft – Theorie“, in der der Großteil der Bevölkerung unter dem Begriff einer homogenen Masse zusammengefasst wurde.[21] Schumpeter betrachtet in seiner Theorie den Bürger als isolierte Größe und lässt „den Bereich der gesellschaftlichen Organisationen zwischen individuellem Bürger und Regierung“ weitgehend außer acht.[22] Er argumentiert vor allem gegen das Vorhandensein eines allgemeinen Willen des Volkes und hebt die Individualität der Bürger und die dadurch notwendige Verschiedenheit ihrer Interessen hervor.[23] Damit widerspricht er der Annahme Rousseaus, der von einem an dem allgemeinen Wohl orientierten Gemeinwillen ausgeht, der aus der „Summe der Sonderwillen“ vieler hervorgeht.[24] Die Erfahrungen des 2. Weltkriegs, sowie die im Vergleich zu heute so gut wie nicht vorhandene praktische Erfahrung hinsichtlich funktionierender Demokratien lassen die Schlussfolgerungen Schumpeters in einem nachvollziehbareren Lichte erscheinen, als wenn man sie zur Erklärung der (Re-) Demokratisierungen der 1980er Jahre in Lateinamerika heranzieht. Avritzer erwähnt hier nicht, dass Schumpeter in Bezug auf seine Betrachtung des Bürgers von den neueren Demokratietheorien bereits als überholt betrachtet wird, wie beispielsweise bei Schmidt deutlich wird:
„Warum sollten unfähige Wähler befähigt sein, die richtigen Führer zu wählen? Dieses Dilemma wird [von Schumpeter] immanent nicht gelöst. Ebenso trifft der Einwand voll ins Schwarze, dass Schumpeter nicht sorgfältig nach unterschiedlichen Ressourcen und Kompetenzen von Wählergruppen differenziert. Ferner ist im Licht der heutigen Partizipationsforschung sein pauschales Negativurteil über die Inkompetenz der Wählerschaft nicht länger haltbar.“ (Schmidt: S. 137)
[...]
[1] Seligson: S. 3.
[2] In Anlehnung an die Einteilung von Martín Lauga (1999): S. 17-51.
[3] Hier werden Demokratisierungswellen im Sinne Huntingtons verstanden als „a group of transitions from non-democratic to democratic regimes that occur within a specified period of time” (Huntington1991: S. 15).
[4] Seligson: S. 3
[5] Ebd..
[6] Lauga: S. 21f..
[7] Lauga: S. 26.
[8] Mit Ausnahme von Costa Rica, Venezuela und Kolumbien, wo jedoch der politische Wettbewerb so gut wie ausgeschaltet war. Siehe Lauga, S. 26.
[9] Berg-Schlosser/Kersting: S. 9.
[10] Birle: S. 242.
[11] Lauga: S. 39.
[12] Ebd.
[13] Birle: S. 251.
[14] Avritzer: S. 11.
[15] Avritzer: S. 14.
[16] Habermas: S. 46.
[17] Habermas: S. 43 f..
[18] Avritzer: S. 15 f..
[19] Avritzer, S. 16.
[20] Walker/Armony: S. xii.
[21] Avritzer: S. 13 f..
[22] Lauga: S. 269.
[23] Schumpeter: S. 399.
[24] Schmidt: S. 70 f..
- Arbeit zitieren
- Jennifer Eggert (Autor:in), 2003, Die Public-Space-Theorie von Leonardo Avritzer: Politische Partizipation durch den öffentlichen Raum?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/33517
Kostenlos Autor werden



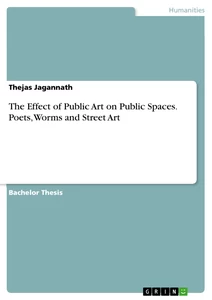




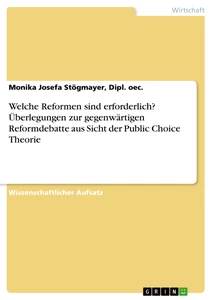


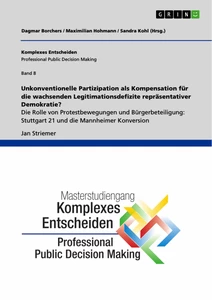










Kommentare