Leseprobe
Inhaltsverzeichnis:
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1. Einleitung
2. Praxisbeispiele
2.1 Sektorisierte Behandlung der Patienten
2.1.1 Ein Beispiel der sektorisierten Versorgung
2.2 Vernetzte Versorgung der Patienten
2.2.1 Ein Beispiel der integrierten Versorgung
3. Vorteile der integrierten Versorgung aus Patientensicht
3.1 Schnellere, kompetentere Behandlung der Patienten
3.2 Bonusregelung bei der Inanspruchnahme der integrierten Versorgung
3.3 Qualitäts- und Kostensteuerung der Behandlungsprozesse mit Case Management- und Disease Management Programmen
4. Risiken der integrierten Versorgung aus Patientensicht
4.1 Eingeschränkte Wahlmöglichkeiten
4.2 Sanktionen bei Inanspruchnahme netzfremder Leistungen
4.3 Unerfüllte Erwartungen- Unsicherheit
4.4 Überforderung
4.5 Datenmißbrauch
5. Konsequenzen für die Organisation von Einrichtungen einer integrierten Versorgungsform
5.1 Ziele und Corporate Identity (Leitbild)
5.2 Leistungsangebote und - steuerung
5.3 Wahl der Netzmitglieder
5.4 Versorgungsprozesse
5.5 Qualitätsmanagement
5.6 Finanzen
5.7 Kommunikations- und Informationsmanagement (Schnittstellenmanagement)
5.8 Netzstruktur (Aufbau- und Ablauforganisation)
5.9 Wahl des Vergütungssystems
6. Schlussbemerkung
Literaturverzeichnis
Anhang
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildungsverzeichnis:
Abbildung 1: Prozesskette im Gesundheitswesen: Stationen einer "Vollversorgung" im Krankheitsfall
Abbildung 2: Übergreifende Versorgungskette S. Staubach KSM 8: Steuerungsinstrumente und Unternehmensstrategien im Gesundheitswesen - 1 10.12.2003
1. Einleitung
Die vernetzten Versorgungs- und Unterstützungsformen werden im Gesundheitswesen zunehmend als geeignete Instrumente zu einer Optimierung der Versorgungsqualität und zur Kostenminimierung angesehen.1
Um den Spielraum zur Umsetzung einer sektorenübergreifenden Patientenversorgung auf der Grundlage von Kooperationen sehr unterschiedlicher Partner zu eröffnen,2 ist mit dem Gesetz zur Reform der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV- Gesundheitsreform 2000) in den neuen §§ 140 a-h des SGB V (siehe Anhang) die Möglichkeit zur integrierten Versorgung gegeben worden.
Die Ziele, die mit der integrierten Versorgung erreicht werden sollen, sind:
- Überwindung der starren Sektorengrenzen
- Optimierung der Patientenbehandlung
- Verbesserung der Zusammenarbeit der Beteiligten in ambulanten und stationären
- Verminderung stationärer Aufnahmen / vermehrte ambulante Behandlungen
- Senkung der Behandlungskosten
- Umfangreiche Versorgung der Versicherten auch in der „Peripherie“ (ländliche Gebiete)3
Als Kooperationspartner innerhalb einer integrierten Versorgungsform braucht man immer mindestens eine Krankenkasse und eine Mindestzahl von Systempartnern unterschiedlicher Sektoren im Gesundheitswesen.
Hier kommen zur Versorgung zugelassene Leistungserbringer, wie niedergelassene Ärzte und Zahnärzte, Krankenhäuser, Reha- Einrichtungen sowie Träger und Gemeinschaften von Leistungserbringern in Betracht, aber auch Rettungsdienste (Notfallversorgung), Sanitätsfachgeschäfte und Partner aus dem Bereich der einschlägigen Industrie (siehe Anhang § 140 b Abs. 2 SGB V).
Der Gesetzgeber lässt den Partnern eines integrierten Versorgungsnetzes (IVN) relativ großen Freiraum in der Gestaltung ihrer Zusammenarbeit.
Die Art des Zusammenschlusses der Mitglieder innerhalb eines IVN kann variieren. S. Staubach KSM 8: Steuerungsinstrumente und Unternehmensstrategien im Gesundheitswesen - 2 10.12.2003
Es kann eine einfache Koordinations- Partnerschaft, ein Kooperationsverhältnis, ein Netzwerk (z.B. GbR), ein Verbundsystem und eine Fusion (GmbH) entstehen.
Je enger die einzelnen Mitglieder des IVN zusammenarbeiten, d.h. je “tiefer“ die Verflechtung zwischen den Mitgliedern ist, desto mehr Regelungen müssen vereinbart werden (z.B. Verträge über Haftungsfragen, Einführung einer standardisierten Kommunikation - einer gemeinsamen “Plattform“, Datenschutz, Kundeninformation).4
Um die Vorteile und die Risiken eines integrierten Versorgungsnetzes aus der Sicht des Patienten darzulegen, soll zunächst ein Beispiel der ursprünglichen sektorisierten Versorgung und danach ein mögliches Beispiel einer integrierten Versorgungsform dargestellt werden.
2. Praxisbeispiele
2.1 Sektorisierte Behandlung der Patienten
„“Sektorisiert“ bedeutet im Zusammenhang mit Leistungsprozessen im Gesundheitswesen, dass bestimmte Bereiche der Versorgung von anderen abgegrenzt und eben nicht integriert angeboten werden. Für das Gesundheitswesen kann man dies in einer Prozesskette deutlich machen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Prozesskette im Gesundheitswesen: Stationen einer "Vollversorgung" im Krankheitsfall5
Ist eine Erkrankung eingetreten, so gibt es bislang, praktisch völlig voneinander abgeschottet, drei große Sektoren der Versorgung:
- Ambulante Behandlung
- Stationäre Behandlung
- Rehabilitation (ambulant und stationär)“6
2.1.1 Ein Beispiel der sektorisierten Versorgung:
Ein alter Mann wird seit vielen Jahren von seinem Hausarzt wegen eines Bandscheibenvorfalls ambulant behandelt. In regelmäßigen Abständen schickt der Hausarzt den Patienten zu einem niedergelassenen Neurochirurgen (Facharzt). Dieser macht von Zeit zu Zeit, um das Fortschreiten der Erkrankung zu kontrollieren, eine Röntgenaufnahme. Ansonsten bekommt der Patient regelmäßig Tabletten, gelegentlich eine Spritze gegen die Schmerzen und außerdem physikalische Therapie. Mit den Jahren schreitet die Abnutzung des Gelenkes voran und die konservative Therapie reicht nicht mehr aus. Wegen starker Schmerzen und einer zunehmenden Bewegungseinschränkung in der Wirbelsäule braucht der Patient eine Bandscheiben- Operation. Der Neurochirurg hat sich vor zehn Jahren niedergelassen und seither nicht mehr operiert. Er schickt den Patient für den Eingriff daher in ein Krankenhaus (stationäre Versorgung). Der Patient begibt sich mit einer Befundtüte unter dem Arm in die Klinik. Er ist etwas erstaunt, dass er nicht gleich operiert wird. „Wir müssen noch eine ganze Reihe von Untersuchungen machen“, wird ihm gesagt. Einige der Untersuchungen kommen ihm ziemlich bekannt vor, aber „die Ärzte werden es schon wissen“, denkt er. Schließlich kommt der Tag der Operation und alles verläuft komplikationslos. Einige Tage später kommt die Sozialarbeiterin an sein Bett und will mit ihm die Anschlussheilbehandlung (AHB) besprechen. Der Patient fühlt sich überfordert, die empfohlene Reha- Klinik ist weit von den Kindern entfernt, diejenige Reha- Klinik in der Nähe sei „nicht so optimal“ für ihn. Der Wunsch des Patienten, sein Haus- Neurochirurg möge doch in die Entscheidung einbezogen werden, ruft im Krankenhaus schallendes Gelächter hervor: „Da hätten wir viel zu tun, wenn wir auch noch die niedergelassenen Fachärzte anrufen müssten.“ Man einigt sich dann endlich auf eine “Kompromiss- Klinik“, der Patient wird verlegt (Rehabilitation) und lernt im vorgerückten Alter das dritte „Neurochirurgie- Team“ in seiner Patientenkarriere kennen. Drei Wochen später hat er auch dies überstanden. Er solle nun gleich zu seinem Haus- Neurochirurg gehen (ambulante Nachsorge), wenn er wieder zu Hause sei, wird ihm noch zum Abschied gesagt, ein ausführlicher Entlassungsbericht würde aber wegen Schreibkräftemangel erst in zwei Wochen dort eintreffen können.7
2.2 Vernetzte Versorgung der Patienten
Im Gegensatz dazu kann der integrierte Prozess der vernetzten Versorgung desselben Patienten folgendermaßen aussehen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: Übergreifende Versorgungskette8
2.2.1 Ein Beispiel der integrierten Versorgung:
Der niedergelassene Hausarzt oder ein Netzmanager (eine ausgebildete Person, die sich des Patienten als “Fall“ annimmt und ihn durch die einzelnen Behandlungsschritte führt) übernimmt vermehrt Verantwortung in der Steuerung und Koordination des Versorgungsprozesses. Er fungiert als Begleitperson oder “Lotse“ für den Patienten, vermittelt die stationäre und die nicht ärztliche Versorgung des Patienten.
Bereits schon vor der Einweisung zur Operation ist klar, wo und wie die Nachbehandlung aussieht. Eine gemeinsame Kommunikationsplattform der Kooperationspartner ermöglicht, dass die Vorbefunde und Entlassungsberichte den Patienten in einer abgestimmten Form zeitgleich, und von allen Partner akzeptiert, begleiten. Dies hilft Doppeluntersuchungen zu vermeiden. Der Hausarzt/ Netzmanager besucht den Patienten im Krankenhaus, spricht mit den dortigen Ärzten und kann auftretende Probleme im Einvernehmen mit dem Patient lösen.9
Anhand des letzt beschriebenen Beispiels werden im nächsten Kapitel die Vorteile und Risiken des integrierten Versorgungsnetzes aus Patientensicht dargestellt.
3. Vorteile der integrierten Versorgung aus Patientensicht
3.1 Schnellere, kompetentere Behandlung der Patienten
Die intensivere Zusammenarbeit der Kooperationspartner führt dazu, dass die Versicherten kompetenter, schneller, umfassender und immer auf der richtigen Ebene des Versorgungssystems nach den neuesten medizinischen Erkenntnissen behandelt und betreut werden.10
Zudem stehen die Leistungsangebote des IVN im Wettbewerb zu denen der gesetzlichen Krankenkassen.
Das IVN ist also darauf bedacht, attraktivere, auf die Wünsche der potentiellen Versicherten maßgeschneiderte Angebote zu kreieren, mit dem Ziel diese für die Teilnahme an ihrem IVN zu gewinnen.
Diese Angebote können wie folgt aussehen:
- Weniger und kürzere stationäre Aufenthalte dank optimierter ambulanter Behandlungsverfahren
- Minimale Wartezeiten aufgrund einer straff organisierten Ablaufplanung der einzelnen Einrichtungen des IVN
- Zusätzliche Behandlungsangebote der Naturheilkunde und Akupunktur
- Erweiterte Praxisöffnungszeiten für Berufstätige
- Fachärztlicher Hintergrunddienst sowie eine Ausweitung des notärztlichen Dienstes in den Abendstunden und an den Wochenenden usw.
Die Versicherten fassen schneller Vertrauen in die sie behandelnden Personen, da diese innerhalb des integrierten Versorgungsnetzes ihre Bezugspersonen darstellen. Die Beziehung zwischen Patient und Therapeuten ist partnerschaftlich und dadurch gekennzeichnet, dass beide sich über die Behandlungsziele, Maßnahmen und Fortschritte so verständigen, dass der Patient seinen eigenen Beitrag leisten kann. Eine gemeinsame Kommunikations- und Informationsplattform, z.B. ein kompatibles elektronisches Datenverarbeitungs (EDV) - System zwischen den Netzpartnern, ermöglicht eine zeitgleiche Übermittlung der patientenbezogenen Daten (Befunde, digitale Röntgenbilder, aktueller Behandlungsplan des Patienten).
Doppeluntersuchungen und Informations- bzw. Behandlungslücken werden dadurch vermieden, Transparenz der Behandlungskosten und - schritte für alle Beteiligten geschaffen.
3.2 Bonusregelung bei der Inanspruchnahme der integrierten Versorgung
„Die Teilnahme der Versicherten an den integrierten Versorgungsformen ist freiwillig.“11 Kein Versicherter wird gezwungen, diese in Anspruch zu nehmen. Entscheidet sich ein Versicherter aber, die integrierte Versorgung und somit deren Teilnahmebedingungen zu akzeptieren, so kann er von der Krankenkasse einen günstigeren Integrationstarif erhalten, wenn er die Teilnahmebedingungen mindestens ein Jahr eingehalten hat12 und (als wichtigste Bedingung) die Versorgungsform zu Einsparungen geführt hat.13 Dies ist als Anreiz zu verstehen.
Die Maximal- und Notfallversorgung außerhalb des gewählten Versorgungssystems muss jederzeit ohne finanzielle Nachteile für den Versicherten möglich sein.14 Nach Ansicht der Verfasserin werden sich, solange die Versicherten jung und gesund sind, diese eher einer integrierten Versorgung anschließen wegen der niedrigeren Beiträge. Im Alter aufgrund der Multimorbidität werden sich die Versicherten dann möglicherweise für die selbst steuerbaren Leistungen der unreglementierten Versorgung entscheiden.
3.3 Qualitäts- und Kostensteuerung der Behandlungsprozesse mit Case Management- und Disease Management Programmen
Behandlungsleitlinien der Diagnostik und Therapie, Case Management Programme und Disease Management Programme (DMP) sind Methoden (Module), die innerhalb der integrierten Versorgung zum Einsatz kommen.
Unter DMP versteht man ein Instrument zur Steuerung der Behandlung und Betreuung von Patienten mit definierten Gesundheitsstörungen. Der Begriff meint verbindliche und integrale Behandlungs- und Betreuungsprozesse über ganze Krankheitsverläufe hinweg, welche aufgrund medizinischer Evidenz festgelegt und bezüglich Qualität, Ergebnissen und Kosten innerhalb definierter Rahmen liegen. Das Ziel besteht darin, die zur Verfügung stehenden Ressourcen (Mitverantwortung des Patienten im Behandlungsverlauf, Nutzung neuester Medizintechnik,...) im Sinne einer qualitativ hochwertigen und zugleich kostengünstigen medizinischen Versorgung möglichst effektiv einzusetzen.15
„Bei DMP werden alle Diagnose- und Therapieschritte wie akute Krankenbehandlung, Rehabilitation oder Pflege über eine gezielte Steuerung aufeinander abgestimmt. Für eine Gruppe von Patienten werden standardisierte Vorgehensweisen (z.B. in Form von verbindlichen Richtlinien) ausgearbeitet und angewandt. Diese zielen auf die Fallführung bei bestimmten, insbesondere chronisch Kranken, wie z. B. mit Diabetes mellitus, Asthma und chronischer Herzinsuffizienz ab.“16
Case Management Programme (Einzelfallführungsprogramme) legen den Focus auf die individuelle Situation des Patienten, die wegen ihres problematischen Versorgungsablaufes auffällig werden.
Solche Auffälligkeiten können z.B. übermäßig intensive oder besonders kostenanfällige Muster der Inanspruchnahme von Leistungsprozessen sein. Der Case Manager versucht herauszufinden, ob und inwieweit die auffälligen Muster z.B. durch Eingliederung des Patienten in einen standardisierten Behandlungsprozess behoben werden können.17
[...]
1 Vgl. Hellmann, Wolfgang: Management von Gesundheitsnetzen, hrsg. von Hellmann, Wolfgang, Stuttgart; Berlin; Köln 2001, S.V.
2 ebenda.
3 Vgl. Schüppel, Reinhart: Studienbrief Diagnostische und therapeutische Leistungsprozesse im Gesundheits- und Sozialwesen, Riedlingen 2002, S. 154.
4 Vgl. Mitschrift aus der Vorlesung Steuerungsinstrument und Unternehmensstrategien im Gesundheitswesen bei Prof. Dr. Spörkel, SRH- Fachhochschule Riedlingen am 29.11.2003.
5 Schüppel, Reinhart: Studienbrief Diagnostische und therapeutische Leistungsprozesse im Gesundheitsund Sozialwesen, Riedlingen 2002, S. 152.
6 ebenda.
7 Vgl. Schüppel, Reinhart: Studienbrief Diagnostische und therapeutische Leistungsprozesse im Gesundheits- und Sozialwesen, 3. Aufl., Riedlingen 2002, S. 152f.
8 Conrad, Hans- Joachim: Integrierte Versorgung- Möglichkeiten und Grenzen der Umsetzung, in: Hellmann, Wolfgang (Hrsg.), Management von Gesundheitsnetzen, Stuttgart; Berlin; Köln 2001, S. 2.
9 Vgl. Schüppel, Reinhart: Studienbrief Diagnostische und therapeutische Leistungsprozesse im Gesundheits- und Sozialwesen, 3. Aufl., Riedlingen 2002, S. 154.
10 Vgl. Rebscher, Herbert: Die Rolle der GKV nach dem 2. NOG und ihr Weg ins Versorgungs- Managementumbau, in: Merke, Klaus (Hrsg.), Umbau oder Abbau im Gesundheitswesen?, Berlin 1998, S. 66.
11 § 140 a Abs. 2 Satz 1 SGB V.
12 § 140 g Satz 1 SGB V.
13 Vgl. Conrad, Hans- Joachim: Integrierte Versorgung- Möglichkeiten und Grenzen der Umsetzung, in: Hellmann, Wolfgang (Hrsg.), Management von Gesundheitsnetzen, Stuttgart; Berlin; Köln 2001, S. 3.
14 o.V. Zitiert von Quelle im Internet. Online im Internet: http://www.masfg.rlp.de/Aktuelles/Reden/VersorgungsstrukturenNeu.pdf. (S. 5) (Stand 02,11.2003)
15 Vgl. Berchtold, Peter; Fischer, Franz-Josef; Fischer, Wolfram; u.a.: Disease Management. Patient und Prozeßim Mittelpunkt, hrsg. von Greulich, Andreas; Berchtold, Peter; Löffel, Nikolaus, 2. Aufl., Heidelberg 2002, S.1f.
16 Schüppel, Reinhart: Studienbrief Diagnostische und therapeutische Leistungsprozesse im Gesundheits- und Sozialwesen, 3. Aufl., Riedlingen 2002, S. 162f.
17 Vgl. Berchtold, Peter; Fischer, Franz-Josef; Fischer, Wolfram; u.a.: Disease Management. Patient und Prozeßim Mittelpunkt, hrsg. von Greulich, Andreas; Berchtold, Peter; Löffel, Nikolaus, 2. Aufl., Heidelberg 2002, S. 3.
- Arbeit zitieren
- Sonja Staubach (Autor:in), 2003, Vorteile und Risiken von vernetzten Versorgungsformen aus der Sicht von Patienten. Konsequenzen für medizinische Einrichtungen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/32507
Kostenlos Autor werden
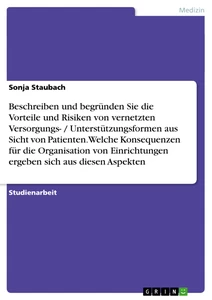


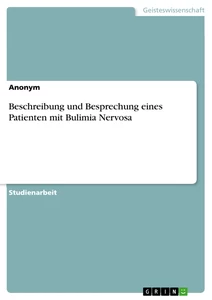
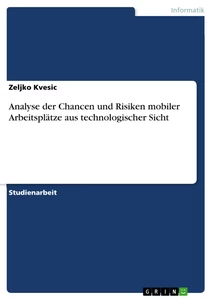




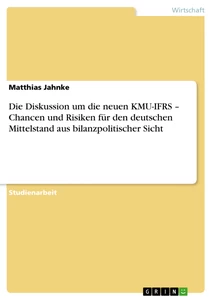






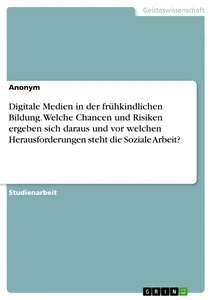

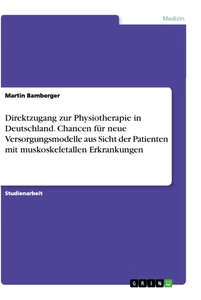
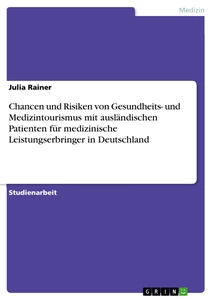
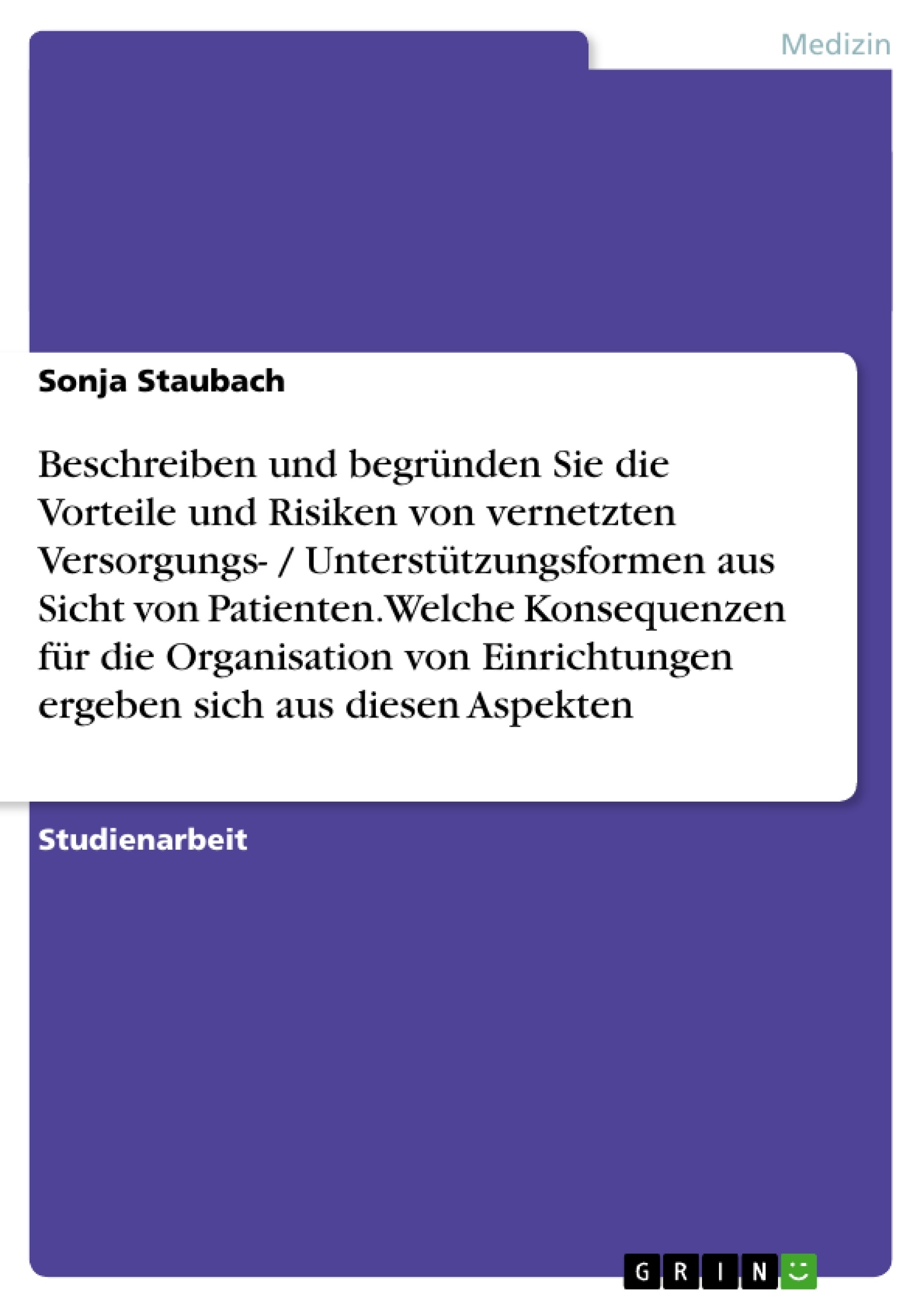

Kommentare