Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
1.1 Problem- und Fragestellung
1.2 Literatur und Quellenlage
1.3 Aufbau und Methodik der Arbeit
2. Finanzwirtschaftliche Situation der Kommunen
2.1 Einnahme- und Ausgabeposten der Kommunen
2.2 Die wirtschaftliche Situation der Kommunen
2.3 Ansätze zur Entlastung der kommunalen Gebietskörperschaften
3. Privatisierungsmaßnahmen als finanzpolitisches Instrument
3.1 Ordnungspolitische Voraussetzungen
3.1.1 Existenz eines Privatisierungspotenzials
3.1.2 Verwendungszweck der Privatisierungserlöse
3.1.2.1 Schuldentilgung
3.1.2.2 Investitionsfinanzierung
3.1.2.3 Konsumausgaben
3.1.3 Nachhaltigkeit
3.2 Argumente für die staatliche Daseinsvorsorge
3.3 Privatisierungshemmnisse
4. Der Verkauf der Osnabrücker Wohnungsbaugesellschaft
4.1 Besonderheiten auf Wohnungsmärkten
4.2 Die OWG und die Norddeutsche Landesentwicklungsgesellschaft
4.2.1 Entstehung der OWG
4.2.2 Ziele und Aufgaben der OWG
4.2.3 Verkauf der OWG an die NILEG
4.3 Gründe für die Veräußerung der OWG
4.3.1 Erfüllung des Gründungszwecks
4.3.2 OWG überschreitet den Bereich staatlicher „Daseinsvorsorge“
4.3.3 Entlastung des städtischen Haushalts
4.4 Kritik an der Veräußerung der OWG
4.4.1 Verlust eines wichtigen wohnungsmarktpolitischen Instruments
4.4.2 Anstieg des Mietpreisspiegels
4.4.3 Einsparungen Instandhaltung und Modernisierung
4.4.3.1 Auftragsrückgang im Handwerk
4.4.3.2 Auftragsrückgang im Baustoffeinzelhandel
4.4.4 Haushaltsbelastung durch steigende Wohn- und Mietkostenzuschüsse
4.4.5 Kritik an den Sozialklauseln
4.4.5.1 Mieterschutz
4.4.5.1.1 Kündigungsschutz
4.4.5.1.2 Begrenzung der Mieterhöhungen
4.4.5.2 Arbeitnehmerschutz
4.4.5.2.1 Kündigungsschutz
4.4.5.2.2 Zusätzliche Altersvorsorge
4.4.6 Geringer Verkaufspreis
5. Die Veräußerung städtischen Wohnraums, ein Sanierungskonzept für kommunale Haushalte?
6. Fazit
7. Literatur- und Quellenverzeichnis
8. Anhang
Dr. Wolfgang Stöckmann
Tabelle 9: Die wichtigsten Sozialkriterien auf einem Blick
Tabelle 10: Verzeichnis der wichtigsten Personen
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1 Anteil der Steuerarten an den gemeindlichen Steuereinnahmen in den alten Bundesländern 2001
Abbildung 2: Anpassungsprozesse auf Wohnungsmärkten
Abbildung 3: Förderung der Wohnraumversorgung
Abbildung 4: Entwicklung des Wohnungsbestandes der OWG im Zeitraum 1950 bis 1993
Abbildung 5: Die Nord / LB Immobilien Holding GmbH
Abbildung 6: Nettokreditaufnahme in Mio. € von 1997 - 2006
Abbildung 7: Aufgaben von Aufsichtsrat und Geschäftsführung
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Gegenstandsbereiche öffentlicher Unternehmen
Tabelle 2: Einflussfaktoren auf das Anbieterverhalten am Wohnungsmarkt
Tabelle 3: Leerstandsquote der Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaften und Genossenschaften in Osnabrück
Tabelle 4: Wohnungsbewerber und Neumieter nach Nationalität von 1999 bis 2001
Tabelle 5: Verwendung des Nettoverkaufserlöses
Tabelle 6: Wohnungsmieten gemäß Mietpreisspiegel 2001-2003
Tabelle 7: Höchstbeträge für Mieten und Belastung gem. § 8 Abs. 1 WoGG
Tabelle 8: Finanzwirtschaftliche Kennzahlen der Osnabrücker Wohnungsbaugesellschaft mbH
Tabelle 9: Die wichtigsten Sozialkriterien auf einem Blick
Tabelle 10: Verzeichnis der wichtigsten Personen
Formelverzeichnis
Formel 1: Formel zur Verkehrswertberechnung von Immobilien
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1. Einleitung
1.1 Problem- und Fragestellung
„Wegbrechende Einnahmen (-2,1 %) sowie gleichzeitig steigende Ausgaben (+1,9 %) prägten die Entwicklung der Kommunalhaushalte im Haushaltsjahr 2001.“[1] Die daraus für viele Kommunen resultierenden Finanzierungslücken wurden zu einem großen Teil über Kassenkredite finanziert, was auf eine unzureichende finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommunen hindeutet.
Neben dem Anstieg der Verschuldung (+1,8% bei kurz- und langfristigen Verbindlichkeiten) wurde die finanzielle Talfahrt der Kommunen zusätzlich durch hohe Steuerausfälle verstärkt. In den alten Bundesländern sanken die Steuereinnahmen der Kommunen um -5,5%, zudem verringerten sich die Zuweisungen in Westdeutschland um rd. 51€ pro Einwohner.[2]
Die Kommunen befinden sich in der Situation, dass sie auf der einen Seite nicht fähig bzw. willens sind ihre Ausgaben radikaler zu kürzen und auf der anderen Seite weiterhin starke Einnahmenausfälle zu verzeichnen haben. Die Forderung nach einer konsequenten Anwendung des Konnexitätsprinzips blieb weiterhin ergebnislos. Die Unternehmensteuerreform und Änderungen des Steuerrechts sorgten nach Ansicht des Deutschen Städte und Gemeindetages für zusätzlichen Druck auf der Einnahmenseite.[3]
Auf Grund dieser Situation sehen sich viele Städte und Gemeinden gezwungen, neue Einnahmequellen zu erschließen, um laufende Kosten bezahlen zu können oder ihre Schuldenlast zu mindern. Ein möglicher Ansatz hierzu ist die Veräußerung von kommunalen Vermögenswerten, was jedoch grundsätzlich das Problem mit sich bringt, dass diese Werte meist unwiederbringlich dem Einsfluss der Kommune entzogen sind. Daher ist dieser Weg häufig mit vielen Problemen und Auseinandersetzungen verbunden.
In der Stadt Osnabrück versuchte die am 9. September 2001 gewählte neue Ratsmehrheit aus CDU und FDP den mit über 200 Mio. € verschuldeten Haushalt durch den Verkauf der Osnabrücker Wohnungsbaugesellschaft zu entlasten. Auf diesem Wege sollten der Schuldenstand reduziert und die laufenden Zinslasten gesenkt werden. Bereits am 20. November 2001 beschloss der Rat, die Verwaltung zu beauftragen, den Verkauf der städtischen Gesellschaft zu prüfen und Rahmenbedingungen auszuarbeiten. Dies stieß unmittelbar auf den Widerstand der Opposition aus SPD und den Grünen. Und erweiterte sich im Verlauf der kontroversen Verhandlungen noch um eine Bürgerinitiative aus Gewerkschaftern und Globalisierungsgegnern, welche den Verkauf vehement ablehnten. Der Hauptkritikpunkt bestand in der Vermutung, der Verkauf würde massive soziale Auswirkungen auf die Mieterschaft der OWG haben. Außerdem würde die Stadt durch einen Verkauf die notwendige Flexibilität zur Unterbringung sozial schwacher Personen verlieren. Aus Sicht der Mehrheitsgruppe im Rat könne der Verkauf jedoch dazu beitragen, den Haushalt deutlich zu entlasten und die laufenden Zinsleistungen zurückzuführen. Auch unter Würdigung aller sozialen Aspekte sei ein Verkauf durchaus sinnvoll und zweckmäßig.
Die vorliegende Arbeit untersucht den Verkauf der Osnabrücker Wohnungsbaugesellschaft unter sozialen und haushaltspolitischen Aspekten. Dabei soll primär die Frage beantwortet werden, ob der Verkauf sozial ausgewogen war und durch den Erlös der Haushalt entlastet werden konnte.
Dabei wird versucht die Maßnahme hinsichtlich ihrer sozialen und finanziellen Auswirkungen sachlich zu bewerten.
Dabei werden die einzelnen Gründe, die für bzw. gegen den Verkauf sprechen, isoliert untersucht. Besonders die einzelnen Kritikpunkte an der Veräußerung sollen analysiert werden, um ihren Einfluss auf den Verkaufsprozess aufzudecken und soziale Auswirkungen darzustellen. Soweit dies möglich ist, sollen zukünftige Entwicklungen prognostiziert werden. Hierbei ist zu beachten, dass hinsichtlich des Untersuchungsobjekts keine oder nur geringe Erfahrungswerte vorliegen. Die Untersuchung der Gründe für einen Verkauf und ihre Gegenargumente sollen eine Erfolgsbewertung des Verkaufsprozesses ermöglichen.
Außerdem sollen die Ergebnisse zu einer allgemeinen Betrachtung abstrahiert werden, um eine Aussage darüber treffen zu können, was allgemein bei der Veräußerung einer Wohnungsbaugesellschaft zu beachten ist. So kann der Verkauf der Osnabrücker Wohnungsbaugesellschaft dazu beitragen, Chancen und Risiken, aber auch fehlerhaftes und fachgemäßes Handeln aufzuzeigen. Dabei wird jedoch nicht der Anspruch erhoben, einen exakten Verfahrensplan für den Verkauf kommunaler Immobilien oder Wohnungsbaugesellschaften zu erarbeiten.
1.2 Literatur und Quellenlage
Die vorliegende Arbeit greift auf eine große Anzahl an unterschiedlichen Quellen zurück. So wurden neben der wissenschaftlichen Basisliteratur auch Zeitungsartikel, Ratsprotokolle, Gesetzestexte, Geschäftsberichte, Studien und mehrere statistische Erhebungen verwandt.
Ein kleiner Teil der Quellen wurde hierbei speziell für diese Arbeit in Form von Befragungen selbstständig erhoben. So sind insgesamt vier qualitative Interviews und eine schriftliche Befragung mit ausgewählten Personen durchgeführt worden. Diese Quellen dienten vor allem dazu, die politischen und ideologischen Meinungen der politischen Akteure zu verstehen. Ihre Funktion für diese Arbeit darf jedoch nicht überbewertet werden, da sie nur einen schmalen Meinungsquerschnitt widerspiegeln.
Bei der wissenschaftlichen Basisliteratur waren für das dritte Kapitel besonders die Veröffentlichungen von HEINZ GROSSEKETTLER [ Privatisierung, Bloßes Instrument der Haushaltssanierung oder ordnungspolitische Notwendigkeit? und Öffentliche Finanzen ] und HERMANN HILL [ Kommunalwirtschaft ] von großer Bedeutung. Bei den theoretischen Grundlagen der Wohnungsmärkte in Kapitel 4.1 waren die Werke von ANETTE MAYER [ Theorie und Politik des Wohnungsmarktes ], sowie LIDWINA KÜHNE- BÜNING und JÜRGEN HEUER [ Grundlagen der Wohnungswirtschaft ] besonders hilfreich.
Neben diesen wissenschaftlich ausgerichteten Texten waren für den Hauptteil der Arbeit insbesondere die Geschäftsberichte der OWG von 2000 und 2001 sowie die von der NIEDERSÄCHSISCHEN LANDESTREUHANDSTELLE FÜR DAS WOHNUNGSWESEN erhobenen statistischen Analysen und Wohnungsmarktbeobachtungen[4] von großem Wert.
Die innerhalb dieser Magisterarbeit verwendeten Zeitungsartikel stammen zum überwiegenden Teil von der NEUEN OSNABRÜCKER ZEITUNG, da sie die einzige tägliche erscheinende regionale Zeitung in Osnabrück ist und folglich am ausführlichsten über den Verkauf der OWG berichtet hat.
Hinzu kommen von Seiten der STADT OSNABRÜCK die entsprechenden Protokolle aus den öffentlichen Ratssitzungen, die Produkthaushalte der Haushaltsjahre 2002 und 2003 sowie Auszüge aus dem Verkaufsvertrag der Stadt Osnabrück mit der NILEG. Die Einsichtnahme in den Vertrag wurde beim Ersten Stadtrat Herrn KARL-JOSEF LEYENDECKER beantragt, jedoch nur für die Sozialkriterien, d.h. für die §§ 11, 12, 13 und 14 des Kaufvertrages genehmigt. Weitere Kenntnisse über den Inhalt des Kaufvertrags wurden aus Zeitungen, Pressemitteilungen, den Interviews und ähnlichen Quellen gesammelt, da der Kaufvertrag nicht veröffentlicht wurde.
Soweit für juristische Bewertungsfragen das Landesrecht maßgeblich war, wurde in der gesamten Arbeit das niedersächsische Landesrecht berücksichtigt. Die verwendeten Gesetzestexte wurden über den gesamten Zeitraum des Analyse- und Erarbeitungsprozesses der Arbeit auf ihre Aktualität hin überprüft.
Außerdem wurden die veröffentlichten Pressemitteilungen und Stellungnahmen von den Parteien bzw. den am Verkaufprozess beteiligten Akteuren, wie z.B. der NILEG oder auch der Bürgerinitiative gegen den Verkauf der OWG, gesichtet.
Auf informationellem Weg wurden spezielle Fragen dieser Arbeit mit betrauten Personen diskutiert.
1.3 Aufbau und Methodik der Arbeit
Die vorliegende Arbeit wurde in vier logisch aufeinander aufbauenden Blöcken konzipiert. Mit Hilfe der vorliegenden Literatur wird im ersten Teil die allgemeine finanzwirtschaftliche Situation der Kommunen dargestellt. Dieser Punkt soll verdeutlichen, warum Kommunen von der Möglichkeit Gebrauch machen, Vermögenswerte zu veräußern bzw. Gesellschaften zu privatisieren oder Beteiligungen aufzulösen.
Im 2.Teil werden Privatisierungsmaßnahmen aus finanzpolitischer Sicht untersucht. Hierbei werden die ordnungspolitischen Voraussetzungen für eine ökonomisch sinnvolle Privatisierung analysiert, um einen angemessenen Bewertungsrahmen zu schaffen. Die hier gewonnen Erkenntnisse finden im 3.Teil, dem Hauptteil der Arbeit, Anwendung. Dabei werden die Begriffe Privatisierung und Veräußerung bzw. Verkauf, synchron verwendet da es sich im hier untersuchten Fall der OWG, je nach Definition, nicht um eine „echte Privatisierung“ handelt.[5] Dennoch können die gesammelten Erkenntnisse auf diesen konkreten Fall weiterhin angewendet werden.
Im eigentlichen Hauptteil der Arbeit wird der Verkauf der Osnabrücker Wohnungsbaugesellschaft mbH untersucht. Dabei werden die vorgebrachten Gründe, die für bzw. gegen den Verkauf sprechen, getrennt analysiert. Ziel ist es, alle Argumente der Gegner wie auch Befürworter der Veräußerung auf ihre Richtigkeit hin zu prüfen. So soll festgestellt werden, ob die vorgebrachten Gründe beider Seiten begründet waren und welche Auswirkungen sie auf den Verkaufsprozess hatten. Hierbei wird versucht gegenwärtige und zukünftige Effekte darzulegen bzw. zu prognostizieren. Zum besseren Verständnis werden im Vorfeld die Besonderheiten von Wohnungsmärkten erörtert. Zudem wird die geschichtliche Entwicklung der OWG ebenso wie ihre Ziele und Aufgaben dargestellt. Die Vorstellung der NILEG als Käuferin der OWG vervollständigt den eröffnenden ersten Abschnitt des Hauptteils.
Mit Hilfe der aus dem Hauptteil erworbenen Kenntnisse sollen im 4.Teil die Ergebnisse abstrahiert werden, um die Frage zu beantworten, ob und unter welchen Bedingungen die Veräußerung von städtischen Wohnungsbaugesellschaften oder Wohnimmobilien zur Sanierung kommunaler Haushalte beitragen kann.
Im Fazit wird noch einmal auf die Kernelemente des Verkaufs der OWG eingegangen und eine Beurteilung des Verkaufs vorgenommen.
Der Anhang beinhaltet die durchgeführten Befragungen und einige zusätzliche Tabellen. Letztere wurden dem Anhang beigefügt, da sie für den gesamten Hauptteil wichtige Informationen liefern und nicht nur für einzelne Gliederungspunkte von Relevanz sind.
„Methoden“ sind die Sammelbezeichnung für die Verfahren des Beschaffens und Aufzeichnens von Informationen sowie des Auswertens und Interpretierens von Informationen.[6] In der Arbeit wurden quantitative und qualitative Analyseansätze[7] verwendet. Dies war notwendig, da eine Beschränkung auf eine Analyseart den zu untersuchenden Punkten nicht gerecht geworden wäre. Soweit es um die Analyse und Klärung von juristischen Sachverhalten ging, wurde die juristische Methode zur Datenanalyse verwendet.[8]
Neben sekundären (fremd erstellten) wurden auch primäre (selbst erstellte) Daten benutzt.[9] Zu den primären Daten gehören die schon erwähnten Befragungen und die im Anhang enthaltenen Tabellen.
Bei allen Befragungen handelt es sich um Expertenbefragungen.[10] Dabei wurden die mündlichen Interviews bezüglich der Befragungstechnik in halbstrukturierter Form mittels eines im Vorfeld erstellten Leitfadens erhoben.[11] Die schriftliche Befragung wurde über einen vorgefertigten Fragebogen durchgeführt. Bei der Formulierung der Fragen wurde darauf geachtet, einfache, kurze und neutrale Fragestellungen zu verwenden. Da die Interviews die Intention hatten, die Einstellungen und Motivation der Akteure einzufangen, wurden ausschließlich offenen Fragen gestellt, die abhängig vom jeweiligen Interviewpartner um weitere speziellere Fragen ergänzt werden konnten. Die mündlichen Befragungen wurden zunächst mit einem Tonband aufgezeichnet und anschließend transkribiert.
Es wurde bei den einzelnen Untersuchungspunkten der Arbeit versucht die auf qualitativen Analysen aufbauenden Aussagen anhand von quantitativen Analyseansätzen zu verifizieren und umgekehrt. Sowohl induktive als auch deduktive Verfahren fanden Anwendung, wobei überwiegend allgemeine Hypothesen operationalisiert wurden, um sie an der Wirklichkeit zu prüfen;[12] somit wurde überwiegend deduktiv gearbeitet.
Im Rahmen der traditionellen Trias der Metatheorien nimmt die Arbeit überwiegend Rückgriff auf den empirisch-analytischen Ansatz,[13] dieser wird bei WELZEL auch als erklärend-analytische Position beschrieben.[14] Als Methode zur Datenanalyse wird bei der Interpretation von bestimmten Sachverhalten allerdings auch auf die Hermeneutik zurückgegriffen.
2. Finanzwirtschaftliche Situation der Kommunen
Im folgenden Kapitel wird zur Einleitung in die Problematik der Magisterarbeit ein Überblick über die finanzwirtschaftliche Situation der Kommunen gegeben. Bei der Darstellung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen werden Einnahmepotentiale und Ausgaben der kommunalen Gebietskörperschaften getrennt voneinander aufgezeigt. Im Anschluss werden ausgewählte Lösungsansätze zur Haushaltsrückführung diskutiert.
2.1 Einnahme- und Ausgabeposten der Kommunen
Einnahmen
Zur Finanzierung ihrer Ausgaben stehen den kommunalen Gebietskörperschaften unterschiedliche Einnahmequellen zur Verfügung. Die erforderlichen Mittel zur Erfüllung ihrer Aufgaben sollen die Kommunen i.d.R. durch Steuern, Gebühren und Beiträge beschaffen.[15] Ergänzt wird die Einnahmeseite durch Finanzzuweisungen, Vermögensveräußerungen, Einnahmen aus wirtschaftlicher Betätigung und Verschuldung.[16]
Die Einnahmeseite setzt sich bei den kommunalen Gebietskörperschaften also im Kern aus folgenden Quellen zusammen:
- Steuern,
- Gebühren und Beiträge,
- Finanzzuweisungen,
- Vermögensveräußerungen,
- Einnahmen aus eigener wirtschaftlicher Betätigung und
- Verschuldung.
Die bedeutendste Einnahmequelle der Städte und Gemeinden sind Steuern. Nach Maßgabe des Art. 106, Abs. 5 & Abs. 5a GG steht den Gemeinden ein Anteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer zu. Hinzu kommt das Aufkommen aus der Grund- sowie der Gewerbesteuer gem. Art. 106, Abs. 6 S. 1 GG und in den niedersächsischen Kommunen zusätzlich die kommunalen Verbrauch- und Aufwandsteuern[17] unter Berücksichtigung des NKAG. Auch wenn es zunächst so scheint, als sei somit eine breite Einnahmebasis vorhanden, konzentrieren sich die steuerlichen Einkünfte der Kommunen insbesondere auf den Anteil an der Einkommensteuer, die Gewerbesteuer und die Grundsteuer, wie aus der folgenden Abbildung hervorgeht. Die anderen Steuereinkünfte sind zum Teil so gering, dass sie kaum ins Gewicht fallen.
Abbildung 1: Anteil der Steuerarten an den gemeindlichen Steuereinnahmen in den alten Bundesländern 2001[18]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Das Aufkommen aus steuerlichen Einnahmen machte 2001 34,1 % der gesamten Einkünfte der Kommunen aus. Auf annähernd dem gleichen Niveau befanden sich die Finanzzuweisungen mit 33%.[19] Diese wirken auf vertikaler Ebene von Bund bzw. den Ländern zu den Gemeinden mit dem Ziel, strukturelle Disparitäten auszugleichen und der kommunalen Selbstverwaltungsgarantie gerecht zu werden.
Etwa 13 % der kommunalen Einnahmen wurden 2001 durch Gebühren und Beiträge erwirtschaftet,[20] diese werden für die individuelle Inanspruchnahme von kommunalen Leistungen erhoben.[21]
Durch Vermögensveräußerungen wurden 2001 rd. 4,8 % der kommunalen Einnahmen erwirtschaftet.
Die restlichen Einnahmen fallen durch die Aufnahme von Krediten, Veräußerungserlöse und die wirtschaftliche Betätigung der Kommunen an.[22]
Grundsätzlich spielt die Kreditaufnahme auf kommunaler Ebene jedoch eine andere Rolle als bei Bund und Ländern. Insgesamt sind Städte und Gemeinden zu einem teilweise sehr unterschiedlichen Grad kreditfinanziert.[23] Das kommunale Haushaltsrecht legt sehr restriktive Maßstäbe für die Schuldenaufnahme an.[24] So ist die Kreditfinanzierung in Niedersachsen nur im Vermögenshaushalt und zudem ausschließlich für Investitionen, Investitionsfördermaßnahmen oder zur Umschuldung zulässig, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich oder wirtschaftlich unzweckmäßig ist.[25]
Ausgaben
Auf der Ausgabenseite konzentrieren sich die bedeutendsten Posten auf die sozialen Leistungen, Investitionen, Personalausgaben, den laufenden Sachaufwand und die Zinstilgungszahlungen.[26]
Die nicht beitragsfinanzierten Sozialhilfeleistungen werden im Wesentlichen von den Kommunen finanziert.[27] Hierbei belaufen sich die Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen[28] auf rd. 72 % der Sozialausgaben, ca. 14 % machen die Jugendhilfeleistungen aus und der Rest entfällt auf die Kriegsopferführsorge (2,4 %), Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz (5,6 %) und sonstige Leistungen.[29] „Die Ausgaben für soziale Leistungen stellen einen beachtlichen „Fixkostenblock“ für die Kommunen dar, dessen ausufernde Entwicklung ihre Konsolidierungserfolge immer wieder zunichte macht.“[30]
Investitionsausgaben sind in vielen Kommunen von besonderer Bedeutung für die regionale Wirtschaft, jedoch werden diese seit Jahren weiter zurückgefahren, da ausreichende Einnahmen nicht vorhanden sind und die Zuweisungen zurückgehen.[31] Besonders die Bauwirtschaft ist von kommunalen Investitionen abhängig. „Gut 27 % aller kommunalen Investitionsmittel fließen in den Erhalt und Ausbau der Straßen, gut 16 % in den Um- und Neubau von Schulen und etwa 12,5 % gehen in die Abwasserbeseitigung. Die Einschränkung kommunaler Bautätigkeit führt daher stets zu unmittelbaren Einschnitten in diesen Bereichen.“[32] „Diese Entwicklung schafft einen Teufelskreis: Zurückhaltung bei den Investitionen verhindert einen Konjunkturaufschwung, schlechte Konjunkturaussichten führen zu pessimistischen Prognosen und damit zu weiterer Zurückhaltung bei Investitionen. […] Die kommunalen Investitionen sind seit 1992 um rd. 11 Mrd. € zurückgegangen!“[33]
„Da bei den Gebietskörperschaften fast ein Drittel der Gesamtausgaben auf Personalausgaben entfällt und sie fast jede zweite Mark des Steueraufkommens beanspruchen, verdienen sie besondere Aufmerksamkeit.“[34] Neben der Gesamtanzahl der Angestellten sind auch die Lohnsteigerungen von besonderer Bedeutung, bereits ein Prozentpunkt Bezügesteigerung im Bereich der Angestellten und Arbeiter verursacht Mehrausgaben i.H.v. 700 Mio. € für die Kommunen.[35] Die Personalausgaben waren auch im Jahr 2001 den Bemühungen der Haushaltskonsolidierung unterworfen, so dass die Personalkosten in den alten Bundesländern auf dem Vorjahresniveau [+ 0,1 %] stagnierten.[36] Seit 1991 wurden in den Kommunen 25 % [rd. 500.000 Beschäftigte] der Mitarbeiter abgebaut, auch um Tarifsteigerungen zu kompensieren.[37]
„Nachdem die Zinsausgaben in den Jahren 1999 und 2000 noch rückläufig waren, verzeichneten die Kommunen im Jahr 2001 erstmals wieder einen Anstieg. In fast allen Bundesländern stiegen die Zinsausgaben der Kommunen über das Vorjahresniveau. Dies liegt zum einen daran, dass seit 1998 – mit Ausnahme des Jahres 2000 – die Verschuldung der Kommunen voranschreitet. Zum anderen ist die Kreditaufnahme für die Kommunen wegen des höheren allgemeinen Zinsniveaus wieder teurer geworden.“[38]
Beim laufenden Sachaufwand handelt es sich um Ausgaben, die im Rahmen der Verwaltung und des Betriebs von Einrichtungen regelmäßig anfallen und i.d.R nicht vermögenswirksam sind, wie etwa Investitionen. Hierzu gehören z.B. Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, Geschäftsausgaben (Bürobedarf, Post usw.) oder auch Mieten und Pachten.[39] In 2001 stieg der laufende Sachaufwand aufgrund aufgestauten Bedarfs und der Euroumstellung (2,5 % i.d. alten Bundesländern).[40]
„Die Aufgaben sind den Kommunen zum weitaus überwiegenden Teil gesetzlich vorgegeben. Lediglich bei freiwilligen Aufgaben verfügen sie - sofern es die Finanzen erlauben - über echte Gestaltungsmöglichkeiten.“[41] Bei den Pflichtaufgaben sind die Kommunen hinsichtlich der Durchrührung noch unabhängig, wohingegen Gemeinschaftsaufgaben (Schulwesen, Polizeiwesen usw.) in Kooperation mit dem Land wahrgenommen werden. Hinzu kommen die Auftragsangelegenheiten (Bauaufsicht, Einwohnermeldeämter usw.), zu denen die Gemeinden unter Weisung von Bund bzw. Land gesetzlich verpflichtet sind.[42] Die Reduzierung der Ausgaben zur Stabilisierung der Kommunalhaushalte ist also a priori einer Beschränkung unterworfen.
2.2 Die wirtschaftliche Situation der Kommunen
Die wirtschaftliche Lage der deutschen Gebietskörperschaften hat sich in den letzten Jahren deutlich verschlechtert. Vordergründig wird dies auf die steigende Ausgabenbelastung durch Bund und Länder, sinkende Einnahmen und die steigende Verschuldung zurückgeführt.
In 2001 wurden rd. ein Drittel der Einnahmen von Gemeinden [57,7 Mrd. € von 152,5 Mrd. €] durch Steuern erwirtschaftet. Dies bedeutete für Städte und Gemeinden einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr um 5,0 %. Insgesamt wies kein bedeutender Einnahmeposten eine Steigungsrate auf. Wohingegen die Ausgaben weiterhin einen Anstieg verzeichneten, auch wenn dieser im Vergleich zum Vorjahr [2,2 %] mit 0,9 % gering ausfiel. Somit konnte 2001 noch ein positiver Finanzierungssaldo i.H.v. rd. 0,4 Mrd. € erwirtschaftet werden.[43]
Diese Zahlen wirken zunächst nicht außerordentlich dramatisch, jedoch ändert sich das Urteil, wenn die negative Konjunkturentwicklung berücksichtigt wird, die zu weiteren steuerlichen Ausfällen führt.
Der SCHWERSTÄNDIGENRAT ZUR BEGUTACHTUNG DER GESAMTWIRTSCHAFTLICHEN ENTWICKLUNG geht in seinem Jahresgutachten 2003 – 2004 von weiterhin sinkenden Einnahmen aus, wobei sich die Ausgaben per Saldo erst ab 2003 verringern sollen.[44] Dies hat zur Folge, dass den Kommunen meist nur die Möglichkeit bleibt, Investitionen zu verringern. Daher sind die kommunalen Investitionen seit 1992 um rd. ein Drittel gesunken, wodurch der konjunkturelle Aufschwung erschwert wird.[45] Die unstetige Entwicklung der Gewerbesteuer und interkommunale Disparitäten bei den Ausgaben, insbesondere der Sozialhilfe, wirken verschärfend auf die Finanzsituation der Städte und Gemeinden.[46]
Zu beachten ist außerdem, wie sich die bisher vorangetriebenen Reformen und Gesetzesänderungen auf die finanzielle Lage der Kommunen auswirken wird. Zwar geht der SACHVERSTÄNDIGENRAT von einer zukünftigen Entlastung der Gemeinden durch die Reformen bei den Steuer- und Sozialgesetzen ab 2004 aus, jedoch könnten sich die zusätzlichen Belastungen der Länder negativ auf die Zuweisungen an die Gemeinden auswirken. Außerdem besteht Unsicherheit bezüglich der erhofften Effekte, da es sich bei der Entlastung um Prognosewerte handelt. Ob die Reformmaßnahmen, wie z.B. die Reform der Gewerbesteuer oder das Gesetz zur Förderung der Steuerehrlichkeit, die erhofften Mehreinnahmen verschaffen, muss sich erst noch zeigen.[47]
2.3 Ansätze zur Entlastung der kommunalen Gebietskörperschaften
Im folgenden Teilabschnitt sollen Lösungsansätze für die kommunalen Gebietskörperschaften erörtert werden, mit deren Hilfe die finanziell schwere Lage vieler Städte und Gemeinden ins Gleichgewicht gebracht werden soll. Hierbei wird auf Strategien, welche die Unterstützung von Bund oder Ländern voraussetzen, verzichtet, da hier nur Ansätze erörtert werden, die von den Kommunen eigenständig verfolgt werden können. Der eigenständig realisierbare Gestaltungsspielraum der kommunalen Ebene ist jedoch stark eingeschränkt.
Grundsätzlich können wirtschaftlich angeschlagene Kommunen zwei Ansätze verfolgen: Auf der einen Seite einen einnahmenorientierte Ansatz, der darauf zielt, die Einnahmen zu erhöhen oder andererseits einen ausgabenorientierten Ansatz, der darauf zielt, die Kosten zu reduzieren. Beide Varianten sind miteinander kombinierbar. Es scheint insgesamt auch sinnvoll, beide Ansätze parallel zu verfolgen, da sie isoliert angewandt weniger wirksam sind.
Auf der einnahmeorientierten Seite gibt es zum einen nur wenige Instrumente zur Erhöhung und Verstetigung der Einkünfte, hierzu zählen z.B.:
1. Steuern, Gebühren und Beiträge,
2. Veräußerungsgewinne,
3. Einnahmen aus wirtschaftlicher Betätigung.
Eine Ertragssteigerung über Steuern in angemessenem Maße ist für Städte und Gemeinden ohne die Unterstützung von Bund und Ländern nicht möglich. Auf ihren Anteil an den Gemeinschaftsteuern wie der Einkommen- und Umsatzsteuer haben die kommunalen Gebietskörperschaften keinen Einfluss, zudem sind sie konjunkturabhängig. Bei der Gewerbesteuer sowie der Grundsteuer steht den Gemeinden gem. Art 106 Abs. 6 S. 2 GG ein Hebesatzrecht zu. Ob hieraus jedoch Einfluss auf das Ertragsaufkommen aus diesen Steuern in bedeutendem Umfang genommen werden kann, ist fraglich. Durch das Hebesatzrecht der Gemeinden besteht faktisch ein Standortwettbewerb unter den einzelnen Gemeinden, steigt der Hebesatz, steigt folglich c.p. auch der Anreiz für Gewerbebetriebe, einen Standortwechsel oder eine Nichtansiedelung in Betracht zu ziehen.[48] Des Weiteren gilt neben der Konjunkturabhängigkeit, dass diese Steuern nur einen geringen Anteil am Gesamtsteueraufkommen ausmachen.
Die Grunderwerbsteuer hat inzwischen stark an Bedeutung verloren, da die Beteiligung der Gemeinden an dieser Steuerquelle fast vollständig abgebaut wurde.[49]
Folglich bleiben nur noch die kommunalen Aufwand- und Verbrauchsteuern, deren Bedeutung weniger fiskalischer Natur als vielmehr Ausdruck des gemeindlichen Steuerfindungsrechts sind (Art. 106 Abs. 6 S. 1 GG).[50] Dies ist jedoch in Niedersachsen durch das Verbot von Getränke- und Schankerlaubnissteuer[51] weiter eingeschränkt als in anderen Bundesländern. Der Anteil dieser Steuern am Gesamtsteueraufkommen der Gemeinden liegt in den alten Ländern bei rd. 1 %.
Somit zeigt sich, dass bezüglich des Steueraufkommens kaum Möglichkeiten für Städte und Gemeinden bestehen, ohne Mithilfe der Bundes- bzw. Landesgesetzgebung ihr Aufkommen zu verstetigen oder zu erhöhen. Eine Ausgabenfinanzierung über eine Erhöhung der Hebesätze ist ohnehin erst bei einer Ausschöpfung der Beitrags- und Gebührenfinanzierung vorgesehen.[52]
„Bei den Gebühren und Beiträgen handelt es sich um das primäre Instrument der Kommunen zur Finanzierung ihrer Aufgaben.“[53] Dabei werden Gebühren für die individuelle Inanspruchnahme kommunaler Leistungen erhoben, wobei unter Verwaltungs- und Benutzungsgebühren unterschieden wird.[54] Für Verwaltungsgebühren gilt, dass das Wertverhältnis zwischen Leistung und Gegenleistung stimmen muss. Für Benutzungsgebühren gilt hingegen gem. §5 Abs. 1 NKAG Kostendeckung.[55] „Gebührenüberschüsse dürfen aber grundsätzlich nicht erwirtschaftet werden.“[56] Zudem orientiert sich die Höhe der Gebühr bei einigen Einrichtungen an sozial-, gesundheits- oder kulturpolitischen Zielsetzungen, wie z.B. bei Bädern, Theatern oder auch Museen.[57]
Beiträge werden als Entgelt für Vorteile ohne Rücksichtnahme auf ihre tatsächliche Inanspruchnahme erhoben.[58] Sie dienen dem Vorteilsausgleich zwischen Gemeinde und Empfänger der vorfinanzierten Leistung. Neben der finanziellen und haushaltspolitischen Bedeutung,[59] bleibt zu beachten, dass Beiträge einen deutlich stärkeren Zwang für den Leistungsempfänger bedeuten, da er auch ohne seine individuelle Nutzung einen Finanzierungsbeitrag zu leisten hat. Wohl auch deshalb handelt es sich bei Beiträgen weitgehend um „Kann-Vorschriften“.[60] Jedoch zeigt sich dass immer häufiger, dass die Möglichkeit der Beitragserhebung vollzogen wird. Beiträge werden i.d.R. mit dem aus der Leistung erwachsenden Vorteil gewichtet, so dass nicht die reine Kostendeckung, sondern vielmehr die Finanzierungsbeteiligung im Vordergrund steht. Beispielsweise richtet sich die Beitragshöhe bei Straßen auch nach dem Nutzen für die Allgemeinheit, wodurch der Beitrag des Anliegers um den Nutzen der Allgemeinheit gemindert werden muss.[61] Insgesamt ist der Spielraum zur Steigerung von Gebühren und Beiträgen gering, zumindest aber begrenzt.
Eine weitere Einnahmequelle der kommunalen Gebietskörperschaften ist die Veräußerung von kommunalen Vermögenswerten, die im Jahr 2001 einen Anstieg von rd. 5,6 % erfuhr. Problematisch ist jedoch, dass dieses Mittel zu Einnahmenbeschaffung im jeweiligen Fall nur einmalig anwendbar ist und somit auch nur einmalig Entlastung schaffen kann. Außerdem ist zu beachten, dass in vielen Kommunen die veräußerbaren Vermögensstände bereits verkauft sind und nur noch Vermögen vorhanden ist welches notwendigerweise ohnehin im Eigentum der Gemeinde stehen muss.[62] Im Verlauf der Arbeit wird im Folgenden noch weiter auf die Bedingungen der Veräußerungen von kommunalem Vermögen eingegangen.
Eine Verbesserung der Kommunalfinanzen über Einnahmesteigerungen bei wirtschaftlichen Betätigungsfeldern der Kommunen ist zweifelhaft. Zwar sollen kommunale Unternehmen einen Ertrag für den Haushalt erwirtschaften[63], dennoch darf hierin nicht der eigentliche Unternehmenszweck liegen.[64] Die Gründung, Übernahme oder Erweiterung von öffentlichen Unternehmen bedarf weiterhin des öffentlichen Zwecks, welcher jedoch nicht von der reinen Gewinnerzielung gedeckt wird.[65] Würde nun das Ziel verfolgt den Gewinn zu erhöhen, stellt sich die Frage inwieweit dem eigentlichen Zweck des Unternehmens noch nachgekommen wird.
Insgesamt sind die autonom durchführbaren Möglichkeiten der Einnahmenerhöhung der Kommunen gering.
Da wie im vorangegangenen schon gezeigt wurde, eine Erhöhung des Einnahmenpotenzials nur sehr begrenzt durchführbar ist, besitzen viele Kommunen zumeist nur noch die Möglichkeit Kosten einzusparen.
Da die Personalkosten den größten Kostenblock der Kommunen darstellen, ist hier zunächst nach Einsparpotentialen zu suchen. Die Städte und Gemeinden sollten zunächst unter Beachtung der demografischen Entwicklung darauf achten, dass sie keine neuen Stellen schaffen, die in naher Zukunft nicht mehr benötigt werden, um so Zukunftskosten abzuwenden.
Auch darf die Diskussion um einen weiteren Abbau von Personal in den Gemeinden nicht unter Hinwies auf den bisher vorangetriebenen Abbau scheitern. Vielfach ist der betriebene Abbau überzeichnet, da das Personal nicht tatsächlich abgebaut, sondern nur durch die Umwandlung von Einrichtungen (z.B. einer Krankenhaus GmbH) nicht mehr zum öffentlichen Dienst gezählt wird.[66]
Auch wenn beim Personal Einsparpotential besteht, so ist jedoch zu beachten, dass dieses auf kommunaler Ebene fast nur durch Abbau des Personalbestandes durchführbar ist. Andere Varianten zur Kostensenkung sind aufgrund beamtenrechtlicher Vorschriften für Städte und Gemeinden meist nicht umsetzbar (Zusatzversorgung, Abschaffung der Frühpensionierung usw.).[67]
Die Sozialausgaben sind neben den Personalausgaben die gewichtigste Ausgabenart.[68] Besonders dieser Aufgabenbereich erschwert gerade in strukturschwachen Regionen die kommunalen Konsolidierungsbemühungen, da es sich um einen weitgehend gesetzlich vorgeschriebenen Leistungskatalog handelt, der nennenswerte Einsparpotentiale kaum zulässt.[69] Da die Kosten für soziale Leistungen seit 1992 um ca. 30 % gestiegen sind, und mit einem weiterhin hohen Niveau an Arbeitslosen, sowie einem großer Sozial- und Jugendhilfeaufwand gerechnet wird, steht der Reformbedarf außer Frage.[70] Jedoch haben die Kommunen beinahe nur die Möglichkeit über Appelle, eine Reform des Katalogs der Pflichtaufgaben herbeizuführen. Dennoch sollte der kleine Bereich der freiwilligen Aufgaben auf dem Prüfstand verbleiben.
Ein weiterhin beträchtliches Einsparpotential besteht beim laufenden Sachaufwand, da dieser Bereich anfällig für Ineffizienzen ist (Öffentliche Verschwendung oder Dezemberfieber). Durch die Einführung eines funktionierenden Controllings, Budgetierung und kaufmännisches Rechnungswesen können Einsparungen verbessert werden. Zudem unterliegen die einzelnen Ausgabenposten des laufenden Sachaufwands i.d.R. keinen vertraglichen oder gesetzlichen Bindungen, was die Aktivierung dieses Potentials erleichtert.[71] In den Städten und Gemeinden Niedersachsens stieg jedoch von 2000 – 2001 der laufende Sachaufwand um 4 %, zwar hängt die zum Teil mit der Euro – Umstellung und Nachholbedarf zusammen, zeigt allerdings auch das dieser Kostenbereich ebenso wie die Personal- und Zinsausgaben erneut gestiegen ist.[72]
Zinsausgaben lassen sich wiederum nur stoppen, wenn die Neuaufnahme besonders bei den Kassenkrediten reduziert und zudem Altlasten getilgt werden. Hierzu müssen aber auch die finanziellen Mittel zur Verfügung stehen, was bedeutet, dass zusätzlich Einsparungen in anderen Bereichen und Einnahmeerhöhungen nötig sind.
Vielfach gehen Erfolge bei der Haushaltskonsolidierung zu Lasten der Investitionen. „Da ein Großteil der kommunalen Aufgaben gesetzlich vorgeschrieben ist (v.a. im Sozialbereich), sind die Kommunen in „schlechten Zeiten“ gezwungen, bei ihren freiwilligen Aufgaben Ausgabenkürzungen vorzunehmen. In erster Linie geht dies stets zu Lasten der Investitionen.“[73] Grund für die sinkenden Investitionsausgaben sind jedoch nicht nur die Konsolidierungsbemühungen der Kommunen, sondern auch geringere Investitionszuwesungen und das Gemeindehaushaltsrecht.[74] So können Verschuldungsspielräume zur Finanzierung von Investitionsprojekten nur in Abhängigkeit zur finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommunen geschaffen werden.[75]
Die Bedeutung der kommunalen Investitionen für die regionale Wirtschaft, den Arbeitsmarkt, das Gemeinwesen und die Lebensqualität, wird zum Teil daran deutlich, dass im Jahr 2000 rd. 59 % der Bau- und sonstigen Sachinvestitionen in Deutschland auf die Kommunen entfiel.[76] Spielraum für eine Senkung der Investitionsausgaben ist nach wie vor vorhanden, auch wenn sich die Politik, zum Teil aus gutem Grunde, wegen der positiven Wirkungen für die regionale Wirtschaft, scheut diesen durchzusetzen.
Festzuhalten bleibt, dass der Handlungsspielraum auf der kommunalen Ebene ohne Mitwirken des Bundes und der Länder, sehr klein ist und allein nicht ausreichen wird, um die kommunalen Finanzen nachhaltig zu stabilisieren. Das bedeutet für die Kommunen, dass sämtliche Einnahmepotentiale und Ausgabenposten konsequent aufgedeckt werden müssen, um sie zu optimieren. Folglich darf auch eine Erhöhung der Einnahmenseite durch Vermögensveräußerungen, nicht aus prinzipiellen Erwägungen verneint werden.
3. Privatisierungsmaßnahmen als finanzpolitisches Instrument
Die Ursachen der kommunalen Finanznot wurden im vorherigen Kapitel schon dargestellt. Ohne konsequente Anwendung des Konnexitätsprinzips (gem. Art. 104a GG) auf Städte und Gemeinden, sind die Kommunen gezwungen Kosten zu reduzieren und weitere Finanzierungsalternativen auszuarbeiten.[77] Insbesondere wenn weitere Reformen des kommunalen Finanzsystems von Seiten der Bundes- und Landesgesetzgebung ausbleiben.
Ein Lösungsansatz zur Reduzierung staatlicher Ausgaben und zur Rückführung des Haushalts, wird durch die Privatisierung und Veräußerung kommunalen Vermögens verfolgt. Vielfach wird diese Strategie jedoch als Angriff auf den Wohlfahrtsstaat und „Verscherbelung des Tafelsilbers“ abgelehnt.[78]
Der folgende Teil der Arbeit soll die ordnungspolitische Vorraussetzungen Privatisierungen zur Diskussion stellen. Kapitel 3.2 soll über eine Analyse der Argumente zur staatlichen Daseinsvorsorge dabei helfen genauere Grenzen für Vermögensveräußerungen zu definieren. Abschließend werden ausgewählte und häufig auftretende Privatisierungshemmnisse untersucht.
3.1 Ordnungspolitische Voraussetzungen
Die Ordnungspolitik bezieht sich auf Eingriffe in Wirtschaftsprozesse, Wettbewerbs- und Mitbestimmungsgesetzgebung sowie auf die Prozess- und Ablaufpolitik.[79] Sie bildet somit die politisch definierten Rahmenbedingungen der Wirtschaftspolitik.
Im weiteren Verlauf sollen Bedingungen aufgezeigt werden unter denen eine ökonomisch sinnvolle Privatisierung abgewickelt werden kann.
Im Folgenden werden ökonomische Vorraussetzungen für eine ökonomisch und zweckmäßige Privatisierung erarbeitet. Aus ökonomischer Sicht gibt es drei grundsätzliche Vorraussetzungen:
1. die Existenz eines Privatisierungspotenzials,
2. die sinnvolle Verwendung der Privatisierungserlöse,
3. sowie ihre nachhaltige Verwendung.[80]
3.1.1 Existenz eines Privatisierungspotenzials
Die Existenz eines Privatisierungspotenzials ist dann gegeben, wenn sich Produktivvermögen ohne ökonomisch legitimen Grund in Staatseigentum befindet.[81]
Hiervon darf ausgegangen werden, wenn die von der öffentlichen Hand durchgeführte Aufgabe von der Privatwirtschaft gleichermaßen effizient und zuverlässig durchführbar ist.
Die These, dass Privatisierungen im Bereich der Eingriffsverwaltung unmöglich, bei der Leistungsverwaltung zumindest diskutabel seien[82], ist aus ökonomischer Sicht nicht haltbar.
GROSSEKETTLER definiert Privatisierungsausnahmen für sensible Bereiche in denen „[…]sich die Bürger mit den Gefahren ungezügelter Macht konfrontiert sehen[…]“[83], also der Eingriffsverwaltung (z.B. Steuerverwaltung, Raumplanung usw.), da die Gesellschaft für diese Bereiche (trotz theoretischer Möglichkeit zur Privatisierung) verwaltungsmäßige, d.h. regelorientierte Entscheidungen erwartet. Dies bedeutet jedoch nicht dass eine Abgrenzung bezüglich der Produktionstiefe unmöglich ist.[84]
Der Bereich der Eingriffsverwaltung ist keine grundsätzliche Privatisierungsausnahme, wie DEIMER es sieht, da zudem auch Teilprivatisierungen möglich sind. Die Leistungsverwaltung hält GROSSEKETTLER ebenfalls grundsätzlich für privatisierbar.[85]
Das kommunale Selbstverwaltungsrecht aus Art. 28 Abs. 2 Satz 1 GG und § 108 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 NGO, bilden den gesetzlichen Rahmen für die Errichtung, Erweiterung und Aufrechterhaltung von öffentlichen Unternehmen.[86]
Aus diesen Regelungen lässt sich zwar nicht im Umkehrschluss eine Privatisierungspflicht herleiten, jedoch dienen sie als Indikator zum Auffinden von Privatisierungspotentialen.
Ökonomisch bedeutet die Existenz eines Privatisierungspotentials, aufgrund des Wegfallens des Wachstumshemmnisses[87], einen positiven Effekt für die Volkswirtschaft.[88] Auf Wettbewerbsmärkten führt das Wachstumshemmnis zum Verlust von Marktanteilen, was folglich dazu führt, dass der Einfluss im Betätigungsfeld marginalisiert wird.
3.1.2 Verwendungszweck der Privatisierungserlöse
Die Erlösverwendung stellt die zweite Vorraussetzung für eine ökonomisch legitime Privatisierung dar. Großes Augenmerk liegt bei der Verwendung der Privatisierungserlöse auf der Zukunftsbelastung.
Es lassen sich insgesamt drei Hauptverwendungsarten unterscheiden:
1. Schuldentilgung,
2. Investitionen von Wachstumsprojekten
3. und Konsumausgaben.
3.1.2.1 Schuldentilgung
„Die Veräußerungserlöse ermöglichen […] dauerhafte Haushaltsentlastungen, wenn sie zur Schuldentilgung verwendet werden. Bei konsequenter Nutzung der vorhandenen Privatisierungsmöglichkeiten kann deshalb maßgeblich zur notwendigen Rückführung des Staatsanteils, der Staatverschuldung und Abgabenbelastung beigetragen werden.“[89]
Ist die Rendite des öffentlichen Unternehmens größer als der Kapitalmarktzins für die öffentlichen Kreditschulden, gilt die Zukunftsbelastung als unverhältnismäßig. In diesem Fall entstünde keine Belastung zur Deckung der Zinslasten, sondern ein positiver Ertrag, welcher bei einer Veräußerung wegfallen würde.
Fließen die Privatisierungserlöse in vollem Umfang in die Schuldentilgung, bleibt zudem die Investitionsquote konstant, da Geldmittel die durch den Kauf dem Kapitalmarkt entzogen wurden, aufgrund der Schuldentilgung wieder zur Verfügung stehen.[90]
„Bei der Privatisierung sollte aber nicht so verfahren werden, dass die Erlöse aus den Veräußerungen zum Stopfen von Haushaltslöchern bzw. zur Finanzierung der überhöhten Ausgaben und sogar noch für zusätzliche Ausgaben herangezogen werden.“[91]
3.1.2.2 Investitionsfinanzierung
Werden die Erlöse für öffentliche Investitionen mit eindeutig positiver Wachstumswirkung verwendet, ist ebenfalls nicht von einer Zukunftsbelastung auszugehen. Eine Zukunftsbelastung ergibt sich i.d.R. wenn die Wachstumswirkung fraglich ist. In einem solchen Fall kann das Investitionsziel sogar vollständig verfehlt werden, wenn private Investitionen, welche durch den Unternehmensverkauf gebunden sind komplett ausbleiben. Die Wachstumswirkung wird gering ausfallen,[92] da die „[…] Privatisierungserlöse in der Zukunft zu einem vergleichsweise geringeren Kapitalstock und einem geringeren Sozialprodukt […]“[93] führen.
Aus diesem Grund wird empfohlen, die Erlösverwendung für „Zukunftsprojekte“ zu unterlassen.[94]
3.1.2.3 Konsumausgaben
Konsumausgaben werden allgemein als zukunftsbelastend eingestuft.[95] Die volkswirtschaftliche Investitionsquote sinkt, da die privaten Investitionen durch den Kauf gebunden sind und diese nicht vom Staat aufgefangen werden. In der Folge kommt es zu einem geringeren Kapitalstock und einem geringeren Sozialprodukt.[96]
Des Weiteren darf davon ausgegangen werden, dass bei rein konsumtiver Verwendung dieser Erlöse, ein nachhaltiger und schonender Umgang mit den finanziellen Ressourcen des Staates auch in Zukunft ausbleibt.
3.1.3 Nachhaltigkeit
Da es sich bei Privatisierungen i.d.R. um die einmalige, zumeist nicht mehr revidierbare Veräußerung von staatlichen Vermögenswerten handelt, ist eine Veräußerung immer vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit zu treffen.
Privatisierungen müssen einerseits unter dem Kriterium der Effizienz,[97] aber auch unter finanziellen Bedingungen sinnvoll und zweckmäßig sein.
Von vielen Seiten wird behauptet, private Anbieter könnten aus Rentabilitätsgründen eine optimale Versorgung mit öffentlichen Gütern[98] nicht gewährleisten. Daraus resultiere, dass private nur in rentablen Bereichen arbeiten würden und der Staat daher auf den unwirtschaftlichen Teilen „sitzen bleibt“.[99]
Unabhängig von dieser Behauptung ist jedoch zu überlegen, ob der Staat sämtliche Aufgaben selbst mit einer eigenen unternehmerischen Infrastruktur erledigen muss oder ob nicht Auftragsvergaben an Fremdfirmen möglich sind. Im Mittelpunkt stehen hierbei erwartete Effizienzsteigerungen durch privatwirtschaftliche Abwicklung, die sich aus dem Leistungswettbewerb bei privaten Unternehmen ergeben. Weiterhin wird die größere Leistungsfähigkeit der Privatwirtschaft mit der (vermeintlichen) Ineffizienz öffentlichen Wirtschaftens[100] begründet.[101]
Nachhaltigkeit bedeutet vor allem, dass zum einen die Aufgabenerfüllung soweit notwendig, weiterhin gewährleistet bleibt, aber auch die finanziellen Bedingungen akzeptabel sind.
Die Rentabilität eines öffentlichen Unternehmens darf jedoch auch nicht in dem Fall, dass Unternehmensgewinne zur Quersubventionierung unrentabler Bereiche verwendet werden, dazu führen, dass aus diesem Grunde eine Privatisierung ausgeschlossen wird. Vielmehr sollte man sich in einer solchen Situation die Frage stellen, wie das subventionierte Unternehmen langfristig finanziell stabilisiert werden kann, bzw. ob weiterhin eine Notwendigkeit zu seiner Unterhaltung besteht.
Die Unterhaltung kommunaler Unternehmen ist an die Verfolgung des öffentlichen Zwecks gebunden.[102] Die reine Gewinnerzielung stellt jedoch keinen öffentlichen Zweck i.S.d. Gesetze dar[103], so dass die Aufrechterhaltung eines öffentlichen Betriebes nicht allein auf dieses Argument begründet werden kann. So kann dem Ausufern staatlicher Tätigkeiten im wirtschaftlichen Bereich Einhalt geboten werden.[104] Im Zusammenhang mit einer Veräußerung sollte geprüft werden, ob unrentable Bereiche mitveräußert oder ausgelagert werden können. Werden öffentliche Aufgaben oder Unternehmen im Rahmen einer Make or Buy- Entscheidung[105] ausgelagert, darf davon ausgegangen werden, dass eine staatliche Bereitstellung als nicht zwingend notwendig anerkannt wurde.[106] Die Erfüllung weiterhin notwendiger Aufgaben muss jedoch gewährleistet bleiben. „Enthebt der Privatisierungsakt die Gemeinde […] nicht von ihrer Verantwortung, so hat die Gemeinde weiterhin für die ordnungsgemäße Aufgabenerledigung einzustehen, d.h. sie muss auch für den Fall Sorge tragen, dass der Private […] ausfällt.“[107] Zur Gewährleistung einer nachhaltigen Aufgabenerfüllung besteht die Möglichkeit der Wiederaufnahme der Tätigkeit oder auch die Weiterübertragung an einen anderen Privaten.[108]
Im Sinne nachhaltigen Wirtschaftens ist es notwendig nicht nur die Kostenstrukturen, sondern auch die Erlösseite im Blickfeld zu behalten. Folglich sind Privatisierungen dann voranzutreiben, wenn es „[…] mit Blick auf das konjunkturelle Umfeld zweckmäßig erscheint […]“[109], denn es gilt günstige Marktsituationen zu nutzen um höchst mögliche Marktpreise zu erzielen.
Nachhaltigkeit bedeutet also gegenwärtige und zukünftige Kosten und Erlöse zu erkennen und zu prüfen, ob diese in einem angemessenen Verhältnis zueinander stehen. In die Überlegungen ist mit einzubeziehen, wie notwendige Aufgaben auch zukünftig gewährleistet werden können.
3.2 Argumente für die staatliche Daseinsvorsorge
Zur Erhaltung und Förderung wirtschaftlicher und sozialer Prosperität, muss die öffentliche Hand Leistungen und Einrichtungen im sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Bereich zur Verfügung stellen.[110]
„Das Recht und die Pflicht des Staates zur Wahrnehmung aller dieser Aufgaben ergibt sich aus dem Sozialstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 1, 28 Abs. 1 GG).“[111]
ERNST FORSTHOFF entwickelte aus dieser historisch gewachsenen Obliegenheit den Begriff der „staatlichen Daseinsvorsorge“[112], welcher Teil der Leistungs- und Lenkungsverwaltung ist.[113] „Er verstand darunter die öffentliche oder verwaltungsmäßige, in politischer Verantwortung liegende Darbringung von Leistungen, auf welche der in die modernen massentümlichen Lebensformen verwiesene Mensch lebensnotwendig angewiesen ist.“[114]
„Die verfassungsrechtlichen Grundlagen für die daseinsvorsorgende Tätigkeit der Gemeinde waren unter Geltung des Grundgesetzes wenig determiniert. Das Grundgesetz selbst kennt diesen Begriff nicht.“[115] Inzwischen allgemein anerkannt, ist der Begriff jedoch hinsichtlich der inhaltlichen Ausgestaltung und juristischen Relevanz umstritten.[116] Beim Begriff Daseinsvorsorge handelt es sich nicht um einen konkreten Rechtsbegriff mit konkreten Rechtsfolgen, sondern vielmehr um ein politisches Leitziel. Damit wird die Frage, ob sich eine Kommune bei wirtschaftlichen Betätigungen im Rahmen der Daseinsvorsorge befindet, irrelevant. Inzwischen hat sich der Begriff stark verselbständigt.[117]
Im Folgenden wird versucht unter Mithilfe des positiven Rechts, einen Rahmen für den Begriff „Daseinsvorsorge“ abzustecken.
Die Versorgung mit Wasser, Gas und Elektrizität, die Bereitstellung von Verkehrsmitteln, kulturelle, soziale und dem Sport dienende Einrichtungen, öffentliche Bibliotheken, Kindergärten, Schwimmbäder usw. umfassen laut PAPIER den Bereich der staatlichen Daseinsvorsorge.[118] Zu beachten bleibt allerdings, dass im gesellschaftlichen, politischen und rechtlichen Kontext die Daseinsvorsorge auch immer ein Stück weit den jeweiligen Zeitgeist widerspiegelt.[119]
In Ermangelung einer gesetzlichen Legaldefinition, empfiehlt es sich den Begriff anhand unterschiedlicher politischer Begründungen zur staatswirtschaftlichen Betätigung einzugrenzen.
Marktversagen, Umweltschutz, die Sicherheit des Angebots, die Gleichmäßigkeit der Versorgung oder auch die teilweise Notwendigkeit von Quersubventionen,[120] bilden oft das argumentative Fundament für die kommunale Betätigung im Rahmen der Daseinsvorsorge.
Aus ökonomischer Sicht sind diese Punkte kaum aufrecht zu halten. Quersubventionen bedeuten, dass die Gewinne eines Unternehmens mit den Verlusten eines anderen verrechnet werden. Die reine Gewinnerzielung ist jedoch nicht erlaubt und zudem muss die wirtschaftliche Betätigung in angemessenem Verhältnis zur wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Gemeinde stehen.[121] Da öffentliche Unternehmen nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu führen sind,[122] kann eine Quersubventionierung keine Begründung für die Daseinsvorsorge sein. Aufgrund des Beihilfeverbots im EG- Vertrag (Art. 81), welches für private und öffentliche Unternehmen gleichermaßen gilt, sind solche Praktiken aus wettbewerbsrechtlicher Sicht ohnehin bedenklich.
Marktversagen kann dazu führen, dass die Sicherheit des Angebots sowie die Gleichmäßigkeit der Versorgung, nicht mehr gewährleistet werden kann. Das bedeutet jedoch nicht, dass der Staat zwingend die Versorgung und Bereitstellung selbst wahrnehmen muss. Die staatliche Wahrnehmung der Aufgaben durch eine Auftragsvergabe ist i.d.R. genauso möglich. „In der Realität ist Marktversagen, das durch die Existenz natürlicher Monopole, öffentlicher Güter, positiver oder negativer Externalitäten sowie asymmetrischer Informationen bedingt ist, sehr viel seltener anzutreffen als es die Häufigkeit vermuten lässt, mit der dieses Argument bemüht wird.“[123]
Aus ökonomischer Sicht stellen Umweltschäden externe Effekte[124] dar. Es bestehen mehrere umweltpolitische Instrumente, die zur Steuerung dieser Probleme beitragen können.[125] Häufig stehen jedoch sachliche und politische Erwägungen einer ökonomischen Lösung entgegen.
Vom ökonomischen Standpunkt aus sind die oben erwähnten Argumente zur staatlichen Daseinsvorsorge nicht haltbar. Somit dürfte die Bedeutung der Daseinsvorsorge deutlich geringer sein als zunächst angenommen.
Unter Beachtung, dass die meisten Argumente für die Daseinsvorsorge ins Leere greifen, bleibt eng definiert nur der Bereich der Transfer- und Sozialleistungen zu denen die Kommune ohnehin von Gesetzeswegen verpflichtet ist. Ergänzend müssen insbesondere essentielle und lebensnotwendige Versorgungsgüter, wie Strom, Wasser, Gas, Abwasserentsorgung usw. in diesen Kanon mit aufgenommen werden. Weiter gefasst können auch bestimmte kulturelle, soziale und bildungspolitische Angebote in hinreichendem und ausgewogenem Maße der Daseinsvorsorge zugerechnet werden.
Politisch entscheidet der Rat als von der Bevölkerung demokratisch legitimiertes Organ,[126] über den tatsächlichen Umfang der Daseinsvorsorge.
Neben den gesellschaftlichen und politischen Argumenten für kommunalwirtschaftliche Betätigung, ist zu überprüfen, inwieweit rechtliche Vorschriften der Argumentation der Daseinsvorsorge entgegenstehen.
Die Gemeindeordnungen bilden den eigentlichen rechtlichen Rahmen für die wirtschaftliche Betätigung im kommunalen Bereich.
Gemäß der niedersächsischen Gemeindeordnung dürfen Gemeinden Unternehmen „[…] nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn und soweit:
1. der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt,
2. die Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinden und zum voraussichtlichen Bedarf stehen,
3. der Zweck nicht besser und wirtschaftlicher durch einen anderen erfüllt wird oder erfüllt werden kann“.[127]
Die Subsidiaritätsklausel [§108 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 NGO] ist in mehrfacher Hinsicht problematisch. Da die Bindung der öffentlichen Hand an die Wettbewerbsregeln allgemein bejaht wird, folgt hieraus von Seiten der Privatwirtschaft zumeist der Vorwurf des unlauteren Wettbewerbs [i.S.d. § 1 UWG].[128] Eine richterliche Entscheidung steht noch aus. Problematisch ist hierbei, dass die Gericht zu entscheiden haben, „ob“ und „wie“ die Kommune tätig werden darf.[129]
Die niedersächsische Gemeindeordnung sieht, wie auch das Grundgesetz [Art. 28 Abs. 2 GG] eine Begrenzung der kommunalen Aktivität auf die „[…] örtliche Gemeinschaft […]“[130] vor.
Die Anwendung der Subsidiaritätsklausel ist schwer weil der Nachweis über die Zweckmäßigkeit eines privaten Anbieters, aufgrund der mangelnden Verfügbarkeit von vergleichbarem Datenmaterial, kaum zu führen ist.[131]
Demnach ist im Vorliegen des öffentlichen Zwecks die eigentliche Grenze für die kommunalwirtschaftliche Betätigung zu sehen. Neben sozialpolitischen, wettbewerbspolitischen und umweltpolitischen Zielen umfasst der öffentliche Zweck auch wirtschaftsfördernde und arbeitsplatzsichernde Maßnahmen. Im Vordergrund hat immer die Förderung des Wohls der Einwohner, gem. §1 Abs. 1 Satz 2 NGO, zu stehen. Die demokratisch legitimierte Gemeindevertretung bringt diese nach außen zum Ausdruck.[132] Die gesetzlichen Beteiligungsverfahren sollten hierbei jedoch nicht unbeachtet bleiben.[133]
Führt man die Ergebnisse zusammen, könnte man den Begriff wie folgt definieren:
Die Daseinsvorsorge umfasst aus politökonomischer Sicht mindestens die Darbringung gesetzlich vorgeschriebener Aufgaben im sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Bereich und endet dort, wo der öffentliche Zweck i.S.d. Gesetzes die Grenze der Gemeinwohlförderung überschreitet.
3.3 Privatisierungshemmnisse
Im Folgenden Teil der Arbeit werden die häufigsten Argumente gegen Privatisierungen untersucht. Hierbei wird gezeigt, dass viele Argumente das Ergebnis ökonomischer Fehleinschätzungen sind. Die Analyse der einzelnen Argumente beschränkt sich auf den ökonomischen Rahmen.
Die nachfolgende Tabelle zeigt einen Querschnitt der unterschiedlichsten öffentlichen Wirtschaftsaktivitäten. Ohne die einzelnen Punkte isoliert zu untersuchen, fällt es bei vielen Aktivitäten insgesamt schwer, plausible Argumente für die staatliche Wirtschaftaktivität zu finden. Dennoch würden bei dem Versuch diese zu reduzieren, von Privatisierungsgegnern immer wieder die gleichen Argumente vorgebracht, die im Folgenden noch näher untersucht werden sollen.
[...]
[1] Dedy/Roßbach (DStGB Nr. 26, 2002). s. S.4.
[2] Vgl: Ebenda. s.S. 4f.
[3] Vgl: Ebenda. s.S. 15ff.
[4] Niedersächsische Landestreuhandstelle für das Wohnungswesen: Wohnungsprognose 2007/2015 – Wohnungsmärkte regional prognostiziert. Hannover. Juni 2003. Und: Niedersächsische Landestreuhandstelle für das Wohnungswesen: Wohnungsmarktbeobachtung – Wohnungsmärkte regional analysiert 2002. Hannover. September 2002.
[5] Grossekettler definiert Privatisierungen als Veräußerung von staatlichem Produktiv- oder Beteiligungsvermögen gegen Entgelt [Grossekettler (2001). s.S. 2]. Nach dieser Definition könnte auch im vorliegenden Fall von Privatisierung gesprochen werden. Vielfach wird jedoch eine Veräußerung von öffentlichem Vermögen oder Beteiligungen nur dann als Privatisierung bezeichnet, wenn privatwirtschaftliche Akteure die Käufer sind [Czada (2002). s.S. 409]. Da die Käuferin der OWG jedoch nicht aus der Privatwirtschaft stammt, soll diesbezüglich, um Irrtümer zu vermeiden, von Veräußerung bzw. Verkauf gesprochen werden. An den Ergebnissen ändert dies jedoch nichts.
[6] Vgl: Patzelt (2003). s.S. 522.
[7] Quantitative Analysen untersuchen Daten mittels mathematisch- statistischen Methoden. Qualitative Analysen bearbeiten Daten zumeist in unstandardisierter Form. Qualitative Methoden wie z.B. die vergleichende Analyse oder Interpretationen sind auf typisierende und verallgemeinernde Erkenntnisse ausgerichtet. [Sommer (1995). s.S. 374.]
[8] Vgl: Patzelt (2003). s.S. 169.
[9] Vgl: von Alemann/Forndran (1995). s.S. 69.
[10] Vgl: Patzelt (2003). s.S. 155.
[11] Vgl: Ebenda. s.S. 156f.
[12] Zu Induktion und Deduktion: z.B. v. Alemann/Forndran (1995). s.S. 52. v. Alemann/Tönnesmann (1995). s.S. 33f.
[13] Vgl: Alemann/Forndran (1995). s.S. 47ff.
[14] Vgl: Welzel (2001). s.S. 396f:
[15] Vgl: § 83 Abs. 2 NGO
[16] Vgl: Karrenberg/Münstermann (1998). s.S. 440, 447f & S. 455f.
[17] Wie z.B. Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Jagdsteuer usw. gem. § 3 Abs. 2 und 3 NKAG.
[18] Eigene Darstellung nach Angeben Dedy/Roßbach (DStGB Nr. 26, 2002). s. S. 22.
[19] Vgl: Scherf/Hoffmann (2003). s.S. 320.
[20] Vgl: Ebenda.
[21] Vgl: § 83 Abs. 2 Nr. 1 NGO.
[22] Vgl: Scherf/Hoffmann (2003). s.S. 320.
[23] Vgl: Karrenberg/Münstermann (1998). s.S. 455. Scherf/Hoffmann (2003). s.S. 320.
[24] Siehe: § 92 NGO.
[25] Vgl: § 92 Abs. 1 NGO i.V.m. § 83 Abs. 3 NGO.
Problematisch ist das Umgehen der restriktiven Regelungen zur Kreditaufnahme durch Kassenverstärkungskredite (Kassenkredite) von vielen Kommunen. „Kassenverstärkungskredite dienen dem Ausgleich vorübergehender Schwankungen der Kassenlage, die entstehen, weil Ausgaben regelmäßig fließen, während Einnahmen wegen der nicht stetigen Steuertermine unregelmäßig eingehen.“ [Henneke (2000). s.S. 193.] Die Aufnahme solcher Kassenkredite ist für die Gebietskörperschaft deutlich einfacher, da hierbei die Leistungsfähigkeit der Kommune keine Rolle spielt. [§ 94 Abs. 1 NGO.] „Leider dient der Kassenkredit faktisch inzwischen zahlreichen Kommunen als „dauerhafte Liquiditätsspritze“, ohne die es ihnen nicht möglich wäre, die laufenden Ausgaben zu decken. Insofern ist der rasante Anstieg der kommunalen Kassenkredite ein ernstzunehmendes Indiz für die angespannte Haushaltslage der deutschen Kommunen.“ [Dedy/Roßbach (DStGB Nr. 26, 2002). s. S. 13.].
[26] Vgl: Karrenberg/Münstermann (1998). s.S. 456ff.
[27] Vgl: Thiebaut (2002). s.S. 463.
[28] Sozialausgaben innerhalb von Einrichtungen sind Leistungen wie z.B. Pflegeheime, zu den Leistungen außerhalb von Einrichtungen zählen unter anderem laufenden Hilfen zum Lebensunterhalt.
[29] Vgl: Michel (DStGB Nr.19). Siehe Anhang S. 16.2. [Die genannten Daten beziehen sich auf die westdeutschen Gemeinden im Jahr 2000.]
[30] Dedy/Roßbach (DStGB Nr. 26, 2002). s. S. 28.
[31] Vgl: Schäfer/Landsberg (DStGB Nr. 22, 2002). s.S. 5ff.
[32] Dedy/Roßbach (DStGB Nr. 26, 2002). s. S. 28.
[33] Ebenda. s.S. 5.
[34] Stern/Werner (1998). s.S. XXII.
[35] Vgl: Landsberg (2002). s.S. 489.
[36] Dedy/Roßbach (DStGB Nr. 26, 2002). s. S. 26.
[37] Vgl: Landsberg (2002). s.S. 489.
[38] Ebenda. s.S. 26.
[39] Vgl: Karrenberg/Münstermann (1998). s.S. 458.
[40] Vgl: Dedy/Roßbach (DStGB Nr. 26, 2002). s. S. 27.
[41] Färber/Fugmann-Heesing/Junkernheinrich (2003). s.S. 30.
[42] Vgl: Brümmerhoff (1996). s.S. 508f.
[43] Vgl: Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2003). s.S. 172.
[44] Vgl: Ebenda.
[45] Vgl: Mohn (2002). s.S. 122.
[46] Vgl: Hendricks (2002). s.S. 115.
[47] Vgl: Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2003). s.S. 185ff.
[48] Vgl: Reding/Müller (1999). s.S. 324.
[49] Vgl: Schwarting (1999). s.S. 152f.
[50] Vgl: Ebenda. s.S. 143.
[51] Vgl: § 3 Abs. 3 NKAG.
[52] Vgl: § 83 Abs. 2 Nr. 2 NGO.
[53] Scherf/Hoffmann (2003). s.S. 321.
[54] Vgl: Ebenda.
[55] Vgl: Schäfer/Glufke-Redeker (2003). s.S. 144.
[56] Karrenberg/Münstermann (1998). s.S. 453.
[57] Vgl: Ebenda. s.S. 454.
[58] Vgl: Klein (1993). s.S: 52.
[59] Vgl: Erhart/Schwarz-Jung/Welge (1994). s.S. 60.
[60] § 83 Abs. 2 Nr. 2 S. 2 NGO; § 6 Abs. 1,2,3 & 4 NKAG; § 7 S. 1 NKAG; § 8 S. 1 NKAG; § 9 Abs. 1 NKAG und § 10 Abs. 1 S.1& Abs. 3 S. 1 und 2. Ausnahmen bilden § 127 Abs. 1 Bau GB und § 6a Abs. 1 NKAG i.V.m. § 149 Abs. 6 S. 4.
[61] Vgl: § 6 Abs. 5 S. 5 NKAG.
[62] Vgl: Mohn (2002). s.S. 121.
[63] § 114 Abs. 1 S.1 NGO.
[64] Vgl: Hill (1998). s.S. 49.
[65] Vgl: Ebenda. Siehe auch: § 108 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 NGO.
[66] Vgl: Stern/Werner (1998). s.S. 67.
[67] Vgl: Ebenda. s.S. 115ff.
[68] Vgl: Stern/Werner (1989). s.S. 132.
[69] Vgl: Dedy/Roßbach (2002). s.S. 5.
[70] Vgl: Mohn (2003). s.S. 300.
[71] Vgl: Stern/Werner (1989). s.S. 133f.
[72] Vgl: Dedy/Roßbach (2002). s.S. 11, 12 & 13 Anhang.
[73] Vgl: Ebenda. s.S. 27.
[74] Vgl: Dedy/Roßbach (2002). s.S. 27.
[75] § 92 Abs. 2 S. 3 NGO.
[76] Vgl: Statistisches Bundesamt (2002). s.S. 227.
[77] Vgl: Wulff (2002). s.S. 5.
[78] Vgl: Czada (2002). s.S. 412.
[79] Vgl: Andersen (2002). s.S. 578.
[80] Vgl: Grossekettler (2001). s.S. 2ff.
[81] Vgl: Ebenda. s.S. 2.
[82] Vgl: Deimer (1978). s.S. 101.
[83] Grossekettler (2001). s.S. 13f.
[84] Die Produktionstiefe soll im Rahmen einer klassischen Make- or Buy Entscheidung gefällt werden, d.h. es wird eine Entscheidung darüber getroffen, ob Teilleistungen selbst erstellt oder über den Markt bezogen werden. I.d.R. ist der Bezug über den Markt kostengünstiger, da hier spezialisierte Anbieter ihre Leistungen anbieten. Dennoch bestehen für den Staat Transaktionskosten (Nebenkosten der Auftragsvergabe, wie z.B. Ausschreibungen u.ä.), diese müssen den Kontrollkosten bei Eigenproduktion gegenübergestellt werden. [Grossekettler (1995). s.S. 550ff.]
[85] Vgl: Grossekettler (2001). s.S. 13f.
[86] Vgl: Schäfer/Glufke Redeker (2003). s.S. 148.
[87] Das Wachstumshemmnis beschreibt die Tatsache, dass öffentliche Unternehmen den Wachstumsprozess überwiegend durch Eigenkapital finanzieren müssen und nicht oder nur begrenzt Fremdkapital aufnehmen können. Private Unternehmen können jedoch durch die Aufnahme von Fremdkapital schneller wachsen. [Grossekettler (2001). s.S.3]
[88] Vgl: Grossekettler (2001). s.S. 3.
[89] Stern/Werner (1998). s.S. 331.
[90] Vgl: Grossekettler (2001). s.S. 5. Diekheuer (1998). s.S. 125 ff.
[91] Stern/Werner (1998). s.S. 386.
[92] Vgl: Grossekettler (2001). s.S. 5.
[93] Ebenda.
[94] Vgl: Stern/Werner (1998). s.S. 386.
[95] Vgl: Hill (1998). s.S. 10. Stern/Werner (1998). s.S. 331 ff. Grossekettler (2001). s.S. 5.
[96] Vgl: Grossekettler (2001). s.S. 5.
[97] Zur Effizienz siehe: Fritsch/Wein/Evers (2002). s.S. 117f.
[98] Öffentliche Güter zeichnen sich durch Nichtrivalität im Konsum und Nicht- Ausschließbarkeit vom Konsum aus. Folglich können alle Individuen das Gut nutzen, ohne vom Konsum ausgeschlossen zu werden (bspw. Deich, Straßenbeleuchtung u.ä.) und ohne hierfür zu zahlen. Deshalb soll der Staat die Nachfrage nach solchen Gütern organisieren, um eine Trittbrettfahrerposition der Nutzer zu verhindern und die Versorgung mit dem Gut sicherzustellen. [Berg (1999). s.S. 193.]
[99] Vgl: Hillenbrand (1995). s.S. 17.
[100] Die Property- Rights- Theorie erklärt die Ineffizienz öffentlichen Wirtschaftens mit dem Auseinanderfallen von Eigentums- und Verfügungsrechten. [Fritsch/Wein/Evers (2002). s.S. 6 – 10 und S. 354ff.] Aus Sicht der Principal- Agent Theorie, liegen Informationsasymmetrien vor, die die Effizienz staatlicher Aufgabenerfüllung hemmen. [Fritsch/Wein/Evers (2002). s.S. 282 ff und S. 311ff.]
[101] Vgl: Glatfeld (1997). s.S. 95.
[102] Vgl: § 114 Abs. 1 S.1 NGO.
[103] Vgl: Hill (1998). s.S. 49f.
[104] „Beispielhaft werden etwa die Stadtwerke Wuppertal genannt, die nicht nur die bundesweite Wartung ungarischer Ikarus- Busse übernommen hätten, sondern auch ins Autorecycling eingestiegen seien und mit einem eigenen öffentlichen Abschleppdienst Falschparker verfolgen wollten.“ [Hill (1998). s.S. 21].
[105] Die Gemeinde geht hierbei der Frage nach, inwieweit die Leistungserbringung vollständig in eigener Regie unternommen werden muss oder ob Teile ausgegliedert werden können, so dass die Kommune lediglich mittelbar für die Bereitstellung im Rahmen ihrer Gesamtverantwortung sorgt.
[106] Vgl: Hill (1998). s.S. 40.
[107] Tomerius/Breitkreuz (1. April 2003). s.S. 431.
[108] Vgl: Ebenda. s.S. 432.
[109] Grossekettler (2001). s.S. 6.
[110] Vgl: Maurer (2000). s.S. 15ff.
[111] Ebenda. s.S. 16.
[112] Forsthoff (1971). s.S. 75ff.
[113] Vgl: Wolffgang (2000). s.S. 395.
[114] Fuest (2001). s.S. 21.
[115] Papier (1. Juni 2003). s.S. 687.
[116] Vgl: Maurer (2000). s.S. 17.
[117] Vgl: Hill (1998). s.S. 28.
[118] Vgl: Papier (1. Juni 2003). s.S. 687f.
[119] Vgl: Ebenda. s.S. 686.
[120] Vgl: Fuest (2001). s.S. 5f.
[121] Vgl: § 108 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 NGO.
[122] Vgl: § 110 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 114 Abs. 2 NGO.
[123] Fuest (2001). s.S. 24.
[124] Externe- Effekte sind Kosten bzw. Vorteile die nicht in die Entscheidungskalküle der Akteure eingehen und nicht vom Preismechanismus verrechnet werden. Sie sind eine Ursache für Marktversagen. (Beispiel: Bei der Produktion eines Gutes entstehen zusätzliche Kosten durch Umweltschäden für die Gesellschaft, die aber nicht in den Preis mit eingerechnet werden, so dass die Gesellschaft auf diesen Kosten hängen bleibt [negative Externalität].) [Berg (1999). s.S. 193 ff.]
[125] Ge- und Verbote, Auflagen, Subventionen zur Reduzierung von Umweltschäden, Verhandlungslösungen, Umweltzertifikate oder auch das Haftungsrecht.
[126] Vgl: Hill (1998). s.S. 38.
[127] § 108 Abs. 1 Satz 2 NGO. (Die Nummer 3 des § 108 Abs. 1 Satz 2 NGO, stellt die so genannte Subsidiaritätsklausel dar.)
[128] Vgl: Papier (1. Juni 2003). s.S. 689f.
[129] Vgl: Papier (1. Juni 2003). s.S. 690.
[130] § 108 Abs. 1 S. 1 NGO.
[131] Vgl: Hill (1998). s.S. 32.
[132] Vgl: Ebenda. s.S. 34f.
[133] Diese Beteiligungsverfahren sind z.B. der Einwohnerantrag § 22a Abs. 1 NGO oder Bürgerbegehren und Bürgerentscheid gem. § 22b NGO auch andere Verfahren wie Anregungen und Beschwerden (§ 22c NGO), die Bürgerbefragung (§ 22d NGO) und die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen (§ 22e NGO) sind zu berücksichtigen.
- Arbeit zitieren
- M.A. Eike Senger (Autor:in), 2004, Haushaltssanierung in Osnabrück - Das Beispiel der Wohnungsbaugesellschaft OWG, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/32282
Kostenlos Autor werden




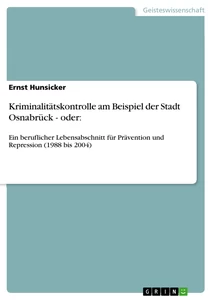












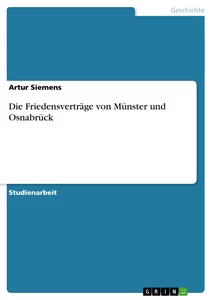




Kommentare