Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
I. Einleitung
II. Das Sozialkapital
1. Der Begriff des Sozialkapitals
2. Wie wird das Sozialkapital gemessen?
III. Theorien des Sozialkapitals
1. Sozialkapital in der Theorie von Pierre Bourdieu
1.1 Der soziale Raum
1.2 Der Habitus
1.3 Kulturelles Kapital
1.3.1 Inkorporiertes kulturelles Kapital
1.3.2 Objektiviertes kulturelles Kapital
1.3.3 Institutionalisiertes kulturelles Kapital
1.4 Sozialkapital
1.5 Transferierbarkeit des Kapitals
1.6 Kapital und Reproduktionsstrategien
2. Sozialkapital in der Theorie von James S. Coleman
2.1 Formen des Sozialkapitals
2.1.1 Verpflichtungen und Erwartungen
2.1.2 Informationspotenziale
2.1.3 Soziale Normen und wirksame Sanktionen
2.1.4 Herrschaftsbeziehungen
2.1.5 Soziale Organisationen
2.2 Sozialkapital als Kollektivgut
2.3 Sozialkapital und Vertrauen
2.4 Sozialkapital in Bezug auf andere Kapitalarten
3. Sozialkapital in der Theorie von Robert D. Putnam
3.1 Formen des Sozialkapitals
3.1.1 Formelles und informelles Sozialkapital
3.1.2 Sozialkapital mit hoher und geringer Dichte
3.1.3 Innenorientiertes und außenorientiertes Sozialkapital
3.1.4 Brückenbildendes und brückenbindendes Sozialkapital
3.2 Sozialkapital und Vertrauen
3.3 Sozialkapital in Bezug auf andere Kapitalarten
IV. Ein Vergleich der Theorien von Bourdieu, Coleman und Putnam
1. Strukturelle Ebene des Sozialkapitals
1.1 Mikroebene
1.2 Mesoebene
1.3 Makroebene
2. Sozialkapital – Entstehung und Zugangsberechtigung
3. Funktionen und Auswirkungen des Sozialkapitals
3.1 Positive Auswirkungen des Sozialkapitals
3.2 Negative Auswirkungen des Sozialkapitals
4. Sozialkapital und Vertrauen
5. Operationalisierung des Sozialkapitals
V. Zusammenfassung
VI. Literaturverzeichnis
I. Einleitung
Seit Mitte der neunziger Jahre ist die Zahl der Forschungen zum Thema Sozialkapital drastisch gestiegen (s. Euler 2006, 13). Das Forschungsinteresse für das Sozialkapital ist in vielen wissenschaftlichen Bereichen ersichtlich (s. Putnam/Goss 2001, 18f.). Diekmann spricht in Bezug auf seine steigende Popularität von „Sozialkapital-Fieber“ (s. Diekmann 2007, 47). Über Sozialkapital wird in verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen wie Soziologie, Politikwissenschaft und Wirtschaftswissenschaften geforscht (s. Franzen/Pointner 2007, 66). Entscheidend für die Erklärung seiner Konjunktur ist aber weniger die Frage, in welchen wissenschaftlichen Bereichen es alles untersucht wird, sondern warum.
„Sozialkapital galt lange Zeit als universell einsetzbares Allheilmittel“ (Geißler/Kern/Klein/Berger 2004, 9). Es werden ihm zahlreiche positive Auswirkungen zugeschrieben. Sie reichen von seinem positiven Einfluss auf die Wirtschaft, die Kriminalitätsbekämpfung und physische Gesundheit, bis hin zu seinen positiven Auswirkungen auf die Qualität öffentlicher Verwaltungen und die Demokratie (s. Putnam/Goss 2001, 19). Auf der anderen Seite gibt es Autoren, die mit dem Sozialkapital auch negative Auswirkungen verbinden, wie die Integrationsverhinderung und Exklusion (s. Geißel/Kern/Klein/Berger 2004, 9). Das Sozialkapital kann sowohl als privates als auch als kollektives Gut existent sein. Es kann „sowohl als Merkmal von Individuen bzw. Beziehungen zwischen Individuen wie auch als Merkmal von Kollektiven“ aufgefasst werden, was nicht zuletzt der Grund dafür ist, dass es in unterschiedlichen Zusammenhängen angewendet werden kann. Dies hat wiederum eine „Vielzahl an Definitionen und Operationalisierungen“ zur Folge (s. Jungbauer-Gans 2006, 17). Es gibt keine einheitliche Theorie des Sozialkapitals, sondern mehrere unabhängig voneinander existierende Forschungsparadigmen (s. Haug 2007, 86). Der Gegenstand vorliegender Arbeit ist ein systematischer Vergleich der Sozialkapitaltheorien. Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass es keine einheitliche Sozialkapitaltheorie gibt, stellt sich hier die Frage, welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede es zwischen verschiedenen Sozialkapitaltheorien gibt. Herrscht Einigkeit darüber, wie das Sozialkapital entsteht und wem es zugänglich ist? Haben die Theoretiker die gleichen Auffassungen darüber, welche Funktion das Sozialkapital erfüllt und welche Auswirkungen es hat? Das sind Fragen, die in vorliegender Arbeit beantwortet werden sollen.
Als wissenschaftshistorisch wichtigste Sozialkapitalansätze werden die Arbeiten von Pierre Bourdieu, James S. Coleman und Robert D. Putnam erachtet (s. Roßteutscher/Westle/Kunz 2008, 21).
Aus diesem Grund richtet sich die vorliegende Arbeit im Rahmen des systematischen Vergleichs der Sozialkapitaltheorien auf ihre Sozialkapitalansätze. Im Kapitel II wird in einem ersten Schritt zunächst auf die Frage eingegangen, was unter dem Begriff „Sozialkapital“ verstanden werden kann sowie ein kurzer Einblick in seine Entstehungsgeschichte gewährt. Im zweiten Schritt wird erläutert, wie das Sozialkapital gemessen werden kann. Im darauffolgenden Kapitel werden die Sozialkapitaltheorien von Bourdieu, Coleman und Putnam ausgearbeitet.
Das Sozialkapital wird bei Bourdieu als eine Kapitalform neben dem kulturellen und ökonomischen Kapital erachtet (s. Bourdieu 1983, 184f.), die auf beide Kapitalarten zwar nicht reduziert werden kann, doch gleichzeitig niemals völlig von diesen unabhängig ist (s. Bourdieu 1983, 191). In der Theorie von Bourdieu stehen aber nicht nur einzelne Kapitalformen in einem engen Verhältnis, sondern der Begriff des Kapitals allgemein ist an Begriffe „Sozialer Raum“ und „Habitus“ eng verknüpft (s. Bourdieu/Wacquant 1996, 125). Aus diesem Grund erachte ich es als wichtig, bevor auf das Sozialkapital in seinen Funktionen und Auswirkungen in der Theorie von Bourdieu eingegangen wird, sein Konzept des sozialen Raums und des Habitus darzustellen. Nachdem das Konzept des sozialen Raums und darauffolgend das Konzept des Habitus von Bourdieu vorgestellt wird, wird auf kulturelles und soziales Kapital eingegangen, um abschließend Eigenschaften des Kapitals Konvertibilität und Reproduzierbarkeit zu erläutern.
Darauffolgend wird im Abschnitt 2 die Sozialkapitaltheorie von Coleman vorgestellt. In seiner Theorie handelt es sich um eine Verbindung von soziologischen und ökonomischen Elementen (s. Coleman 1988, 96). Mit Hilfe des Sozialkapitalkonzepts wird das Prinzip des rationalen Handelns in die Analyse sozialer Systeme einbezogen (s. Coleman 1988, 97). Nachdem zur Einführung die Grundideen zu seinem Sozialkapitalkonzept und einige von ihm dazu aufgeführte Beispiele vorgestellt werden, wird im Abschnitt 2.1 auf die von Coleman differenzierten Formen des Sozialkapitals eingegangen. Er unterscheidet diesbezüglich zwischen Verpflichtungen und Erwartungen (s. Coleman 1995, 396), Informationspotenzialen (s. Coleman 1995, 402), Normen und wirksamen Sanktionen (s. Coleman 1995, 403), Herrschaftsbeziehungen und sozialen Organisationen (s. Coleman 1995, 404). Nach der Erläuterung einzelner Sozialkapitalformen wird im darauffolgenden Abschnitt die Konzipierung des Sozialkapitals als Kollektivgut in der Theorie von Coleman vorgestellt. Im Abschnitt 2.3 wird auf die Frage eingegangen, welche Bedeutung dem Vertrauen in seinem Sozialkapitalansatz beigemessen wird, um abschließend im Abschnitt 2.4 auf die Frage einzugehen, in welche Verbindung das Sozialkapital mit anderen Kapitalarten gebracht werden kann.
Putnam gilt als ein Theoretiker des Sozialkapitals, durch dessen empirische Untersuchungen dieser Begriff popularisiert wurde (s. Grimme 2009, 20). Der erste Schritt in der Ausarbeitung seiner Sozialkapitaltheorie ist es, im Abschnitt 3 zunächst darzustellen, welche positive Auswirkungen dem Sozialkapital Putnam zufolge zukommen sowie einen kurzen Einblick in seine empirische Untersuchungen „Making Democracy Work“ (1993) und „Bowling Alone“ (2000) zu gewähren, denen die Popularität seines Sozialkapitalkonzepts zu verdanken ist. Anschließend wird im Abschnitt 3.1 dargestellt, was Putnam zufolge als Sozialkapital aufgefasst werden kann. Putnam unterscheidet zwischen vier Typologien des Sozialkapitals: formelles und informelles Sozialkapital (s. Putnam/Goss 2001, 25), Sozialkapital mit hoher und geringer Dichte (s. Putnam/Goss 2001, 26), innenorientiertes und außenorientiertes Sozialkapital (s. Putnam/Goss 2001, 27) und brückenbildendes und brückenbindendes Sozialkapital (s. Putnam/Goss 2001, 28). Die von Putnam herausgearbeiteten Typologien werden in Abschnitten 3.1.1 bis 3.1.4 vorgestellt. In den letzten zwei Abschnitten wird, wie bei der Ausarbeitung der Sozialkapitaltheorie von Coleman, auf Sozialkapital und Vertrauen sowie auf Sozialkapital in Bezug auf andere Kapitalarten eingegangen.
Im Kapitel IV werden die herausgearbeiteten Sozialkapitaltheorien von Bourdieu, Coleman und Putnam einem systematischen Vergleich unterzogen. Ziel des systematischen Vergleichs ist es, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der jeweiligen Sozialkapitaltheorien herauszuarbeiten. In einem ersten Schritt werden die Sozialkapitalansätze in Bezug auf die strukturelle Ebene des Sozialkapitals verglichen, d. h. in Bezug auf die Frage, auf welchen strukturellen Ebenen das in ihren Theorien konzipierte Sozialkapital vorgefunden werden sowie seine Wirkungen entfalten kann. Hierzu wird die strukturelle Ebene in Mikro-, Meso- und Makroebene gegliedert. Nach der begrifflichen Klärung einzelner Ebenen werden die definitorischen Elemente des Sozialkapitals sowie seine einzelne Formen in jeweiligen Sozialkapitalansätzen einzelnen Ebenen zugeordnet. Im darauffolgenden Abschnitt wird erläutert, wie das Sozialkapital in den jeweiligen Theorien entsteht sowie unter welchen Bedingungen der Zugang zum Sozialkapital erlangt wird. Im Fokus steht die Frage nach der Abgrenzung gegenüber bestimmten Personengruppen, so dass bestimmte Sozialkapitalformen nicht jedem zugänglich sind. Darüber hinaus werden die Theoretiker nach ihrem Standpunkt zur Geschlossenheit bestimmter Gruppen verglichen, d. h. nach der Frage, ob sie die Gruppengrenzen als positiv oder negativ beurteilen. Wird in diesem Abschnitt die Frage nach der Beurteilung der Gruppengrenzen als positiv oder negativ gestellt, wird im darauffolgenden Abschnitt diese Frage auf Sozialkapital generell bezogen gestellt. In diesem Abschnitt werden die Sozialkapitaltheorien nach den dem Sozialkapital zugesprochenen Funktionen und Auswirkungen verglichen. Dabei bezieht sich der Vergleich im Abschnitt 3.1 zunächst auf die positiven Auswirkungen des Sozialkapitals, im darauffolgenden Abschnitt werden die Theorien nach den dem Sozialkapital zugewiesenen negativen Auswirkungen verglichen. Ziel dieses Vergleichs ist es, außer, die Sozialkapitaltheorien auf die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu untersuchen, die Frage beantworten zu können, ob in jeweiligen Sozialkapitaltheorien das positive oder negative Bild vom Sozialkapital überwiegt. Abschnitt 4 befasst sich mit der Vertrauensproblematik. Da Bourdieu in seinem Sozialkapitalansatz keine Angaben zum Vertrauen macht (s. Keller 2007, 88), ist dieser Abschnitt auf den Vergleich in Bezug auf die Vertrauensproblematik in den Sozialkapitaltheorien von Coleman und Putnam beschränkt. Im Rahmen dieses Vergleichs wird das Vertrauen sowohl auf der Mikro- als auch auf der Makroebene in Betracht gezogen. Im Abschnitt 5 werden die Sozialkapitaltheorien in Bezug auf die Operationalisierung des Sozialkapitals verglichen. Hier wird untersucht, ob in jeweiligen Theorien Konzepte zur Messung des Sozialkapitals vorliegen sowie, wenn ja, welche Indikatoren zur Messung herangezogen werden.
Im Kapitel V werden abschließend die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit zusammengefasst.
II. Sozialkapital
Die Arbeiten von Bourdieu, Coleman und Putnam zum Sozialkapital werden als wissenschaftshistorisch wichtigste Sozialkapitalansätze erachtet (s. Roßteutscher/Westle/Kunz 2008, 21). Dennoch kann keiner von ihnen als „Entdecker“ des Sozialkapitalbegriffs gelten, denn der Begriff wurde bereits 1916 erstmalig erwähnt (s. Putnam/Goss 2001, 16). Im Folgenden wird auf den Begriff „Sozialkapital“ und auf seine Entstehungsgeschichte sowie auf die Möglichkeiten seines Messens eingegangen.
1. Der Begriff des Sozialkapitals
Die Konjunktur des Begriffs des Sozialkapitals beginnt Mitte der neunziger Jahre (s. Euler 2006, 13), dennoch ist er keineswegs neu. Er wurde bereits Anfang des 20. Jahrhunderts eingeführt (s. Lippl 2007, 421). 1916 wurde der Begriff erstmalig von Hanifan geprägt, um einen positiven Zusammenhang zwischen Gemeinschaftsengagement und Demokratie hervorzuheben (s. Putnam/Goss 2001, 16). Zum Nutzen des Sozialkapitals äußert er sich wie folgt:
„Die ganze Gemeinschaft wird von der Zusammenarbeit ihrer Teile profitieren, und der Einzelne wird infolge seiner Verbindungen Vorteile wie Hilfeleistungen, Mitgefühl und den Gemeinschaftsgeist seiner Nachbarn erfahren … Wenn die Menschen in einer Gemeinschaft miteinander vertraut und ihnen gelegentliche Versammlungen für Unterhaltungszwecke, zum geselligen Austausch oder zum persönlichen Vergnügen zur Gewohnheit geworden sind, kann dieses Sozialkapital durch geschickte Führung leicht zur allgemeinen Verbesserung der Wohlfahrt der Gemeinde eingesetzt werden“ (Hanifan 1916, 130, zitiert nach Putnam/Goss 2001, 17).
Der Begriff des Sozialkapitals wurde dadurch nicht bekannt und geriet in Vergessenheit. Putnam spricht von einer sechsmaligen Neuerfindung des Begriffs seit seiner erstmaligen Rezeption bis zum Ende des 20. Jahrhunderts (s. Putnam/Goss 2001, 17). Der Begriff wurde in den 1960er Jahren in der Stadtforschung von Jane Jacobs benutzt (s. Putnam/Goss 2001, 18).
„If self-government in the place is to work, underlying any float of population must be a continuity of people who have forged neighborhood networks. These networks are a city´s irreplaceable social capital” (Jacobs 1961,138, 1966, 89, zitiert nach Haug 1997, 5).
Das Auftauchen des Begriffs in den 1970er Jahren in Pierre Bourdieus Werk macht ihn Schultheis zufolge zum Urheber der aktuellen Debatte um das Sozialkapitalkonzept (Schultheis 2008, 17). Bourdieu definiert das Sozialkapital wie folgt:
„Das Sozialkapital ist die Gesamtheit der aktuellen und potenziellen Ressourcen, die mit dem Besitz eines dauerhaften Netzes von mehr oder weniger institutionalisierten Beziehungen gegenseitigen Kennens oder Anerkennens verbunden sind“ (Bourdieu 1983, 190; Hervorhebungen im Original).
Mit anderen Worten handelt es sich hierbei nach Bourdieu „um Ressourcen, die auf der Zugehörigkeit zu einer Gruppe beruhen“ (s. Bourdieu 1983, 190f.; Hervorhebungen im Original). Über Loury fand der Begriff des Sozialkapitals 1977 erstmalig den Weg in die wirtschaftswissenschaftliche Diskussion (s. Euler 2006, 12).
„In Lourys Terminologie ist mit sozialem Kapital die Menge der Ressourcen gemeint, die in Familienbeziehungen und in sozialer Organisation der Gemeinschaft enthalten sind, und die die kognitive oder soziale Entwicklung eines Kindes oder Jugendlichen fördern“ (Loury 1977,1987, zitiert nach Coleman 1995, 389).
Auf Loury bezieht sich Coleman (s. Coleman 1995, 389), durch den der Begriff des Sozialkapitals „in den späten 1980er Jahren endgültig und unverrückbar auf die wissenschaftliche Tagesordnung“ gesetzt wurde (s. Putnam/Goss 2001, 18). Das Sozialkapital in der Theorie von Coleman kann als eine Zusammensetzung verschiedener Ressourcen verstanden werden. Sie gehören aber nicht exklusiv den Akteuren, sondern sind eine Eigenschaft der Sozialstrukturen (s. Coleman 1995, 392). Obwohl der Begriff des Sozialkapitals vor fast hundert Jahren erstmalig erwähnt wurde, wurde er erst durch empirische Untersuchungen von Putnam popularisiert (s. Grimme 2009, 20). Der Begriff des Sozialkapitals wird bei Putnam auf der gesellschaftlichen Ebene angesiedelt (s. Jungbauer-Gans 2006, 22). Er bezieht sich nicht auf den individuellen Akteur, sondern auf „die Gemeinschaft als Ganzes wie Städte, Regionen oder ganze Länder“ (s. Kriesi 2007, 27). Das Vertrauen, die Normen sowie soziale Netzwerke sind Eigenschaften sozialer Organisation, die Putnam unter dem Begriff Sozialkapital zusammenfasst (s. Putnam 1993, 167). Der Begriff des Sozialkapitals birgt verschiedene Aspekte sozialer Kooperation in sich (s. Diekmann 2007, 48). Dieser Eigenschaft des Sozialkapitals verdankt Grimme zufolge das Sozialkapitalkonzept seine Nützlichkeit und Attraktivität (s. Grimme 2009, 20).
2. Wie wird das Sozialkapital gemessen?
Bei der Messung des Sozialkapitals werden zwei Aspekte unterschieden: „strukturelle und kulturelle Aspekte“ (s. Jungbauer-Gans 2006, 25). Bei der strukturellen Seite des Sozialkapitals handelt es sich um soziale Netzwerke, die ihre Wirksamkeit durch dauerhafte Beziehungen zwischen Akteuren erlangen (s. Kunz, Westle, Roßteutscher 2008, 42). Kulturelle Aspekte beziehen sich auf „prosoziale Wertorientierungen, Gemeinsinn beziehungsweise Verpflichtungen und Pflichtgefühle der Gemeinschaft gegenüber sowie das allgemeine Vertrauen in Menschen“ (s. Lippl 2007, 422). Hinzu kommt das Vertrauen in Institutionen (s. Franzen/Pointner 2007, 71). Die Auswahl der Indikatoren für die Messung der Sozialkapitaldimensionen wird Lippl zufolge seitens der Forschenden nach Kriterien wie konkretes Erkenntnisinteresse, die verfügbare Datenbasis und teilweise auch nach ihren „Vorlieben“, getroffen (s. Lippl 2007, 422). Die Auswahl der Dimensionen des Sozialkapitals, die gemessen werden, ist ebenso vom Forschungsbereich und somit vom Forschungsinteresse des Forschers abhängig, und kann somit in jeder Studie zum Sozialkapital anders ausfallen (s. Haug 1997, 27). Strukturelle Aspekte, die Putnam zur Messung des Sozialkapitals einbezieht, sind die Teilnahme am Gemeinschaft- und Organisationsleben, öffentliches Engagement wie zum Beispiel die Wahlbeteiligung, die Freiwilligentätigkeiten sowie informelle Zusammenkünfte mit Freunden (s. Putnam 2000, 291). Gleichzeitig verweist er auf eine wegen der besseren methodischen Erfassbarkeit Konzentrierung von Forschungsarbeiten auf formelle Vereinigungen, was aber nicht heißt, dass sie wichtiger als informelle Zusammenkünfte seien (s. Putnam/Goss 2001, 25f.). Eine häufige Frage, anhand derer das Vertrauen in andere Menschen gemessen wird, ist die Frage, ob allgemein gesehen den meisten Menschen vertraut werden kann oder im Umgang mit anderen Menschen eher Vorsicht geboten ist (s. Putnam 2000, 137). Im Rahmen der Untersuchung des World Value Survey 2005–2006 gab es zu dieser Frage zwei Antwortvorgaben. Erstens konnte angegeben werden, dass den meisten Menschen vertraut werden kann, und die zweite Antwortvorgabe lautete, dass man sehr vorsichtig sein soll (s. WVS 2005–2006 Wave, Root Version, 3). Ein üblicher Vorgang bei der Messung des Vertrauens in Institutionen ist die Übergabe einer Liste mit „Organisationen und Institutionen wie politische Parteien, Gewerkschaften, die Kirche, das Erziehungssystem usw.“, woraufhin die Befragten angeben, wie viel Vertrauen sie in jeweils einzelne Einrichtungen haben (s. Franzen/Pointner 2007, 75f.). Als ein Schema zur Messung von sozialen Werten und Normen in einer Gesellschaft bieten sich die Daten des World Value Surveys an (s. Kunz/Westle/Roßteutscher 2008, 45). Die Messung aus dem World Value Survey von 2005–2006 erfolgte durch das Auflisten von 11 Verhaltenstatbeständen, denen gegenüber anhand einer Zehnpunkteskala die Befragten ihre Ablehnung bzw. die Zustimmung ausdrucken konnten. Einige Beispiele für die aufgelisteten Verhaltenstatbestände sind unter anderem die unberechtigte Inanspruchnahme von Staatsleistungen, das Schwarzfahren, Steuerhinterziehung und Bestechung (s. WVS 2005–2006 Wave, Root Version, 17). Das Sozialkapital wird sowohl in theoretischen als auch in empirischen Studien „in gänzlich unterschiedlichen Kontexten“ verwendet (s. Haug 1997, 30). Aus der Literatur ergibt sich ein sehr unterschiedliches Verständnis des Sozialkapitalbegriffs (s. Franzen/Pointner 2007, 86). In Bezug auf das Verhältnis von strukturellen und kulturellen Elementen des Sozialkapitals weisen Kunz, Westle und Roßteutscher darauf hin, dass unabhängig davon, welche Sozialkapitalebene analysiert wird, im Sozialkapitalansatz von einer engen und positiven Beziehung zwischen beiden Elementen ausgegangen wird (s. Kunz, Westle, Roßteutscher 2008, 46). Franzen und Pointner dagegen weisen auf die Ergebnisse ihrer Untersuchung über das empirische Verhältnis von Mitgliedschaften, Nachbarschaftsnetzwerken, Freundesnetzwerken und des generalisierten Vertrauens hin, die eine schwache Korrelation zwischen unterschiedlichen Sozialkapitalelementen belegen (s. Franzen/Pointner 2007, 86). Auch in Bezug auf das Verhältnis von Normen und Netzwerken sei eine positive Korrelation zwar gegeben, sie falle jedoch gering aus (s. Franzen/Pointner 2007, 87).
Zusammenfassend lässt sich somit schließen, dass es nicht nur Unterschiede in Bezug auf die Definition und die Messung des Sozialkapitals, sondern auch verschiedene Auffassungen darüber gibt, in welchem Verhältnis strukturelle und kulturelle Elemente des Sozialkapitals zueinander stehen.
III. Theorien des Sozialkapitals
Im Folgenden werden die Sozialkapitaltheorien von Bourdieu, Coleman und Putnam ausgearbeitet, bevor sie im nächsten Schritt auf die Gemeinsamkeiten und Unterschiede systematisch verglichen werden.
1. Sozialkapital in der Theorie von Pierre Bourdieu
Bourdieu definiert das Kapital als „akkumulierte Arbeit, entweder in Form von Materie oder in verinnerlichter, ‚inkorporierter‘ Form“ (s. Bourdieu 1983, 183).
„Als vis insita ist Kapital eine Kraft, die den objektiven und subjektiven Strukturen innewohnt; gleichzeitig ist das Kapital – als lex insita – auch grundlegendes Prinzip der inneren Regelmäßigkeiten der sozialen Welt“ (Bourdieu 1983, 183).
In seiner Kapitaltheorie richtet sich Bourdieu gegen die Reduktion des Kapitalbegriffs auf das ökonomische Kapital, wie es in den Wirtschaftswissenschaften üblich ist. Charakteristisch für diesen Kapitalbegriff ist die Orientierung auf Profitmaximierung sowie der Eigennutz. Dieses Kapitalverständnis impliziert Bourdieu zufolge zugleich die Annahme, alle anderen Formen sozialen Austauschs seien uneigennützig. Im Gegensatz zu dieser Annahme betont Bourdieu aber, dass auch scheinbar unverkäufliche Dinge ihren Preis haben. Die Umsetzung in Geld ist deshalb schwierig, weil der ökonomische Charakter solcher Austausche ausdrücklich verneint wird. Dabei denkt er an alle Praxisformen, deren objektiver ökonomischer Charakter nicht erkannt wird und nicht erkennbar ist. Das Nichterkennen des ökonomischen Charakters bildet zugleich die Voraussetzung für die Verwirklichung solcher Praxisformen (s. Bourdieu 1983, 184). Um „der Struktur und dem Funktionieren der gesellschaftlichen Welt gerecht zu werden“, müsse man „den Begriff des Kapitals in allen seinen Erscheinungsformen “ einführen. (s. Bourdieu 1983, 184; Hervorhebungen im Original). Bourdieu unterscheidet dabei drei grundlegende Arten des Kapitals: das ökonomische Kapital, das kulturelle Kapital und das soziale Kapital (s. Bourdieu 1983, 184f.). Das kulturelle Kapital kann Bourdieu zufolge in drei Formen existent sein: als inkorporiertes, d. h. verinnerlichtes Kapital in Form von Wissen, als objektiviertes Kapital „in Form von kulturellen Gütern, Bildern, Büchern, Lexika, Instrumenten oder Maschinen“ und als institutionalisiertes Kapital in Form von Bildungstiteln (s. Bourdieu 1983, 185). Hinzu kommt das symbolische Kapital, zu dem jede Kapitalart gerechnet werden kann, insofern sie von Individuen wahrgenommen und anerkannt wird (s. Bourdieu 1998, 108). Eine wichtige Eigenschaft des Kapitals ist die Konvertibilität. Konvertibilität des Kapitals bedeutet, dass verschiedene Kapitalsorten ineinander transformiert werden können (s. Bourdieu 1983, 185). So können z. B. kulturelle Güter mit ökonomischem Kapital erlangt werden (s. Bourdieu 1983, 188); die Aneignung des Wissens und somit auch der Erwerb von Bildungstiteln bedarf neben einer Zeitinvestition ebenso der Aufwendung des ökonomischen Kapitals (Bourdieu 1983, 186). Die Bildungstitel können wiederum in ökonomisches Kapital umgewandelt werden (s. Bourdieu 1983, 190). Das Sozialkapital ist Bourdieu zufolge unter bestimmten Voraussetzungen ebenfalls in ökonomisches Kapital konvertierbar (s. Bourdieu 1983, 185). Vor dem Hintergrund dieser Eigenschaft des Kapitals wird ersichtlich, warum Bourdieu nicht nur die Reduktion aller Kapitalarten auf das ökonomische Kapital durch den „ Ökonomismus “ ablehnt, sondern ihm zufolge ebenso die durch den „ Semiologismus “ vertretene Betrachtungsweise, die alle sozialen Austauschbeziehungen auf Kommunikationsphänomene reduziert, bekämpft werden soll (s. Bourdieu 1983, 196; Hervorhebungen im Original). Das Sozialkapital eines Akteurs kann Bourdieu zufolge zwar nicht darauf zurückgeführt werden, über wie viel ökonomisches und kulturelles Kapital Akteure besitzen, mit denen er in Verbindung steht, doch es ist nie völlig unabhängig davon (s. Bourdieu 1983, 191). Das Sozialkapital eines Akteurs ist ebenso wenig von seiner Verfügungsmacht über ökonomisches und kulturelles Kapital unabhängig, denn im von Bourdieu konstruierten sozialen Raum kann nicht jeder mit jedem zusammengebracht werden, ohne auf ökonomische und kulturelle Unterschiede zu achten (s. Bourdieu 1995, 14). Um den Sozialkapitalansatz von Bourdieu zu erläutern, ist es deshalb wichtig, das Sozialkapital nicht isoliert von anderen Kapitalarten zu analysieren. Weiterhin schreibt Bourdieu dem Kapital „eine Überlebenstendenz“ zu, so kann es „ebenso Profite produzieren wie sich selbst reproduzieren oder auch wachsen“ (s. Bourdieu 1983, 183). Reproduktion des Kapitals erfolgt durch die Übertragung des Kapitals von einer Generation auf die andere. Bourdieu spricht diesbezüglich von Reproduktionsstrategien. Darunter sind unterschiedliche Praktiken zu verstehen, die bewusst oder unbewusst von Akteuren mit dem Ziel der Erhaltung oder Mehrung des Besitzstandes und der damit einhergehenden Wahrung oder Verbesserung der sozialen Stellung vorgenommen werden (s. Bourdieu 1992, 210). Dies hat schließlich zur Folge, dass „Kapital zu Kapital kommt“, und mit der Reproduktion des Kapitals sich die soziale Struktur reproduziert (s. Bourdieu 1998, 35). Um den Einfluss des Kapitals auf die gesellschaftliche Welt zu verdeutlichen, macht Bourdieu einen Vergleich mit dem Glücksspiel. Bourdieu nennt hierfür das Beispiel des Roulette- Spiels, in dem in kürzester Zeit ein Vermögen gewonnen und damit ein neuer sozialer Status erlangt werden kann. Dieses Vermögen kann aber wieder aufs Spiel gesetzt und in kürzester Zeit verloren werden. Während das Roulette Bourdieu zufolge „ziemlich genau dem Bild eines Universums vollkommener Konkurrenz und Chancengleichheit, einer Welt ohne Trägheit, ohne Akkumulation und ohne Vererbung von erworbenen Besitztümern und Eigenschaften“ entspricht, bildet die gesellschaftliche Welt genau das Gegenteil dazu (s. Bourdieu 1983, 183). Da Kapital in der Theorie von Bourdieu an die Begriffe Habitus und Feld eng verknüpft ist und die Definition einzelner Elemente nur innerhalb des von ihnen gebildeten theoretischen Systems möglich ist (s. Bourdieu/Wacquant 1996, 125), werden diese Elemente in die Analyse der Sozialkapitaltheorie von Bourdieu mit einbezogen.
1.1 Der soziale Raum
Die soziale Welt lässt sich Bourdieu zufolge in Form eines mehrdimensionalen Raums darstellen (s. Bourdieu 1995, 9). In einer ersten Dimension verteilen sich die Akteure nach dem Gesamtvolumen des Kapitals, das sie besitzen (s. Bourdieu 1998, 18). Bourdieu versteht darunter die Gesamtheit des ökonomischen, kulturellen und sozialen Kapitals (s. Bourdieu 1992, 196). Eine zweite Dimension stellt die Zusammensetzung dieses Kapitals dar. Das heißt, auf der zweiten Dimension verteilen sich die Akteure nach dem spezifischen Gewicht der einzelnen Kapitalsorten, bezogen auf das Gesamtvolumen (s. Bourdieu 1995, 11). Hinsichtlich des Gesamtkapitals verteilen sich die Akteure im Raum von den am besten mit Gesamtkapital ausgestatteten, bis zu den Akteuren, die am wenigsten ökonomisches und kulturelles Kapital besitzen. Die Außerachtlassung der zweiten Dimension hätte zur Folge, dass die Unterschiede bezüglich kultureller Fähigkeiten und materiellen Eigentums der Akteure ausgeblendet wären und auf diese Weise sonst unterschiedliche Akteure eine gleiche Position im sozialen Raum beziehen würden. Da sich auf der zweiten Dimension die Frage stellt, wie viel ökonomisches und wie viel kulturelles Kapital ein Akteur jeweils besitzt, kommt es hier zu einer weiteren Verteilung (s. Bourdieu 1992, 196f.). Hinzu kommt die zeitliche Entwicklung des Kapitalvolumens und der Kapitalstruktur als dritte Dimension des sozialen Raums (s. Bourdieu 1992, 195f.). Innerhalb eines sozialen Raums gibt es verschiedene Felder, wie z. B. das politische Feld (s. Bourdieu 1995, 30), das wissenschaftliche Feld (s. Bourdieu 1993b, 107), das ökonomische – und das kulturelle Feld (s. Bourdieu 1998, 50). Innerhalb einzelner Felder kommt es zu einer weiteren Differenzierung, so gibt es z. B. innerhalb des kulturellen Feldes weitere Felder: das Feld der Malerei, das Feld der Literatur, das Feld des Theaters usw. (s. Bourdieu 1992, 365). Die soziale Stellung eines Akteurs bestimmt sich anhand seiner Stellung innerhalb einzelner Felder (s. Bourdieu 1995, 10). In jedem Feld dominiert eine bestimmte Kapitalart, die Bourdieu zufolge als Machtmittel eingesetzt werden kann, um damit eine Positionierung im sozialen Raum zu erhalten oder zu verbessern (s. Bourdieu 1995, 10). Das heißt, dass nicht alle Kapitalarten gemeinsam und gleichzeitig in einem bestimmten Feld effizient sind (s. Bourdieu 1992, 194). Jedes Feld produziert eine andere Form von Interesse, das von Akteuren verfolgt wird (s. Bourdieu 1998, 150). So fallen zum Beispiel die Motive, die Akteure zur Konkurrenz treiben, im wissenschaftlichen und ökonomischen Feld völlig unterschiedlich aus (Bourdieu 1998, 149). Bourdieu beschreibt soziale Felder als „Kraftfelder, aber auch Kampffelder, auf denen um Wahrung oder Veränderung der Kräfteverhältnisse gerungen wird“ (s. Bourdieu 1995, 74). Jedes Feld ist autonom und hat ein eigenes „Grundgesetz“ (s. Bourdieu 1998, 148). Seine Hauptthese hierbei ist, dass, je nach Art des Feldes, in dem dieser „Kampf“ ausgetragen wird, unterschiedliche Interessen verfolgt werden können (s. Bourdieu 1998, 149). Hiermit richtet er sich gleichzeitig gegen die utilitaristische Sichtweise, dass allem menschlichen Handeln nur das ökonomische Interesse zugrunde liegt. Dieser Sichtweise zufolge liegen allen Handlungen von Akteuren bewusst gesetzte Zwecke zugrunde, die darauf ausgerichtet sind, „den größten Nutzen mit den geringsten Kosten“ zu erzielen, wobei unter Nutzen hier das ökonomische Kapital zu verstehen ist (s. Bourdieu 1998, 144). Diese Reduktion ist Bourdieu zufolge das Ergebnis der vom Ökonomismus vertretenen Ansicht, dass das im ökonomischen Feld geltende „Grundgesetz“ auf alle Felder anwendbar sei (s. Bourdieu 1998, 148). Entgegen diesen Annahmen aber sind Bourdieu zufolge die im „Spiel“ getätigten Einsätze weder bewusst getätigte Investitionen, deren Ziel es ist, mit geringsten Kosten einen möglichst hohen Nutzen zu erzielen, noch lassen sich die Interessen, die Akteure zu Handlungen motivieren, auf das ökonomische Interesse reduzieren (s. Bourdieu 1998, 144). Die Reduktion auf das ökonomische Feld ist zugleich der Hauptkritikpunkt Bourdieus an der marxistischen Klassentheorie. Demnach werden Akteure in Eigentümer und Nichteigentümer von Produktionsmitteln geteilt, woraus sich zugleich ihre Positionierung im sozialen Raum ergibt. Diese eindimensionale Sicht von sozialer Welt hat zur Folge, dass andere wichtige wie z. B. kulturelle und soziale Gegensätze, die ebenso zur Konstruktion des sozialen Raums beitragen, außer Acht gelassen werden (s. Bourdieu 1995, 31). Die Ausdifferenzierung von Kapitalarten nach ihrer Dominanz hat neben der Verteilung vom höchsten zum geringsten Umfang des Gesamtkapitals eine weitere Verteilung im sozialen Raum zur Folge, nämlich die Verteilung „von der dominanten Kapitalsorte zur dominierten“ (s. Bourdieu 1992, 219f.). Je näher sich Akteure im sozialen Raum stehen, desto mehr Gemeinsamkeiten weisen sie auf, und sie sind umso verschiedener, je weiter sie im Raum voneinander entfernt sind (s. Bourdieu 1998, 18). Ausgehend von verschiedenen Stellungen im sozialen Raum lassen sich nach Bourdieu dementsprechend verschiedene Klassen „herauspräparieren“ (s. Bourdieu 1995, 12). Alleine durch den Umfang und Struktur des Kapitals lässt sich Bourdieu zufolge eine soziale Klasse aber nicht definieren (s. Bourdieu 1992, 182). Zu den Merkmalen, wie Beruf, Einkommen oder Ausbildungsniveau kommen Bourdieu zufolge weitere Nebenmerkmale hinzu, wie z. B. Geschlecht und ethnische Zugehörigkeit. Solche Nebenmerkmale können Bourdieu zufolge bei einem Auswahlverfahren wie z. B. bei der Besetzung einer Stelle, als „reale und förmlich genannte Auslese- oder Ausschließungsprinzipien funktionieren“, doch sie werden als solche nicht erkannt, weil sie durch offizielle Kriterien, wie z. B. Ausbildungsniveau getarnt werden. So kann Bourdieu zufolge ein bestimmtes Diplom bedeuten, dass eine bestimmte gesellschaftliche Herkunft vorausgesetzt wird (s. Bourdieu 1992, 176). Eine soziale Klasse lässt sich nach Bourdieu aber auch nicht durch die Summe von oben genannten Haupt- und Nebenmerkmalen definieren:
„Eine soziale Klasse ist definiert weder durch ein Merkmal (nicht einmal das am stärksten determinierende wie Umfang und Struktur des Kapitals), noch durch eine Summe von Merkmalen (Geschlecht, Alter, soziale und ethnische Herkunft – z. B. Anteil von Weißen und Schwarzen, von Einheimischen und Immigranten, etc. – Einkommen, Ausbildungsniveau, etc.), noch auch durch eine Kette von Merkmalen, welche von einem Hauptmerkmal (der Stellung innerhalb der Produktionsverhältnisse) kausal abgeleitet sind. Eine soziale Klasse ist vielmehr definiert durch die Struktur der Beziehungen zwischen allen relevanten Merkmalen, die jeder derselben wie den Wirkungen, welche sie auf die Praxisformen ausübt, ihren spezifischen Wert verleiht“ (Bourdieu 1992, 182; Hervorhebungen im Original).
Wenn Bourdieu von der Existenz einer Klasse aber spricht, dann nicht von einer Klasse im Sinne von einer kampfbereiten Gruppe, sondern von einer theoretischen Klasse, die nur auf dem Papier existiert (s. Bourdieu 1995, 12). Die aus dem sozialen Raum „herauspräparierbaren“ theoretischen Klassen sind Bourdieu zufolge keineswegs mit realen Klassen gleichzusetzen, wie im Sinne von Marx (s. Bourdieu 1997, 112). Um von einer theoretischen zur realen Klasse zu kommen, müsse man Bourdieu zufolge eine politische Mobilisierungsarbeit leisten. Demnach ist eine reale Klasse nichts anderes als das Ergebnis eines Kampfs zur Durchsetzung bestimmter Ansichten bezüglich sozialer Welt, d.h., bezüglich dessen, wie sie und die Klassen in der Realität konstruiert und wahrgenommen werden (s. Bourdieu 1998, 25). Eine theoretische, nur auf dem Papier existente Klasse nennt Bourdieu auch „eine wahrscheinliche reale Klasse“, da die dazugehörigen Akteure, aufgrund ihrer Ähnlichkeiten alle Prädispositionen zu einer Mobilisierung besäßen (s. Bourdieu 1997, 113; Hervorhebung im Original). Dementsprechend lässt sich mittels theoretischer Klassen, Bourdieu zufolge, auch die Wahrscheinlichkeit eines Zusammenschlusses zu praktischen Gruppen, wie z. B. Familien und Vereinen, erklären (s. Bourdieu 1995, 12 f.). An dieser Stelle stellt sich zunächst aber die Frage, wie es kommt, dass Akteure mit ähnlichen Stellungen auch ähnliche Interessen und Praktiken aufweisen. Was bestimmt Interessen und Praktiken von Akteuren? Wenn man sich den sozialen Raum als ein Kräftefeld vorstellt, in dem Akteure um den Erhalt oder Verbesserung ihrer Positionen kämpfen (s. Bourdieu 1995, 74), könnte man aber leicht dazu verleitet sein, Akteure als bewusst nach dem Profit strebende, interessengeleitete Individuen zu begreifen.
Bourdieu zufolge produziert jedes Feld eine andere Form von Interesse, das von Individuen verfolgt wird (s. Bourdieu 1998, 150). Die Einsätze aber, die Akteure im Kampf um den Erhalt oder die Verbesserung von Positionen im sozialen Raum einsetzen, d. h., die Einsätze in gesellschaftlichen Spielen sind Bourdieu zufolge keineswegs bewusst getätigte Investitionen (s. Bourdieu 1998, 144). An dieser Stelle gilt es zunächst zu erläutern, was Bourdieu unter Interesse versteht. Das Interesse heißt nichts anderes als an einem Spiel teilzunehmen sowie anzunehmen, dass sich die Teilnahme lohnen würde. Anders ausgedrückt handelt es sich beim Interesse um die Anerkennung sowohl des Spiels als auch der darin getätigten Einsätzen (s. Bourdieu 1998, 141). Sich auf das Spiel einzulassen, bedeutet jedoch auch, in die Einsätze zu investieren (s. Bourdieu 1998, 141 f.), wobei sich die Frage danach, ob sich die Investition lohnt, Bourdieu zufolge schon deshalb nicht stellt, weil dem Akteur das Spiel als selbstverständlich erscheint (s. Bourdieu 1998, 141). Interessant und wichtig findet ein Akteur aber nur Spiele, von denen er selbst erfasst ist, Spiele, die er versteht, weil die in Spielen vorhandenen Strukturen mit den in seinem Habitus verinnerlichten Strukturen übereinstimmen, oder anders ausgedrückt, weil die Spiele „in Gestalt dessen, was man den Sinn fürs Spiel nennt, in den Kopf gesetzt wurden, in den Körper“ (s. Bourdieu 1998, 141). Ein guter Spieler ist Bourdieu zufolge „Körper gewordenes Spiel“ (s. Bourdieu 1998, 145). Wenn ein Akteur das Spiel nicht versteht, so kann er es nicht anerkennen und kann sich infolgedessen für das Spiel nicht interessieren, er ist Bourdieu zufolge „indifferent“. Somit ist die „Indifferenz“ ein Gegensatz zum Begriff „Interesse“. Des Weiteren nennt Bourdieu „Interessenfreiheit“ als einen weiteren Gegensatz zum „Interesse“, denn auch wenn ein Akteur nicht „indifferent“ ist, d. h. das Spiel kennt und sich für das Spiel interessiert, kann er „doch frei von Interessen sein“ (s. Bourdieu 1998, 141). Um die Frage beantworten zu können, was die Praktiken und Interessen von Akteuren bestimmt und damit auch nach welcher Logik die Einsätze in Feldern getätigt werden und wie es darüber hinaus zur Übereinstimmung innerhalb sozialer Klassen kommt, wird im Folgenden auf das Konzept des Habitus eingegangen. Um die Frage beantworten zu können, warum die soziale Welt notwendig so sein muss, wie sie ist, deutet Bourdieu darauf hin, dass die Praxis von „objektivierten und einverleibten Ergebnissen der historischen Praxis, von Strukturen und Habitusformen“ bestimmt wird (s. Bourdieu 1993a, 98).
1.2 Der Habitus
„Der Habitus stellt die universalisierende Vermittlung dar, kraft derer die Handlungen ohne ausdrücklichen Grund und ohne bedeutende Absicht eines einzelnen Handlungssubjekts gleichwohl ,sinnhaftʻ, ,vernünftigʻ sind und objektiv übereinstimmen (…)“ (Bourdieu 1979, 179).
Dispositionen des Habitus werden durch Lernen erworben (s. Bourdieu 1993b, 113). Bourdieu zufolge funktioniert Habitus wie eine „ Handlungs-, Wahrnehmungs- und Denkmatrix “, das alle früheren Erfahrungen integriert (s. Bourdieu 1979, 169; Hervorhebungen im Original). Alle gegenwärtigen Praktiken erfolgen Bourdieu zufolge unter Zugriff auf diese Matrix. Je länger eine Praktik ausgeführt wird, desto sicherer wird sie im Zeitverlauf, und zwar sicherer als alle formalen Regeln und expliziten Normen (s. Bourdieu 1993a, 101). Als Beispiel hierfür bietet sich das Erlernen von bestimmten Verhaltensweisen. Von klein auf lernen die Kinder, wie sie sich in bestimmten Situationen zu verhalten haben, welche Verhaltensweisen in bestimmten Situationen aus Sicht der Erwachsenen „richtig“ und welche „falsch“ sind. Nach diesen von Erwachsenen erlernten Verhaltensweisen richten sie dann ihre zukünftigen Handlungen. Nachdem die Verhaltensweisen im Habitus aber inkorporiert worden sind, brauchen die Akteure, um regelkonform zu handeln, nicht mehr vor jeder Handlung zu überlegen, wie sie sich zu verhalten haben, um nicht eine Verhaltensregel zu verletzen. Ein Beispiel hierfür ist die Verinnerlichung von der für jede Situation „passenden“ Begrüßungsform, so müssen die Akteure beispielsweise vor jedem Geschäftstreffen nicht überlegen, ob der Geschäftspartner per Handschlag oder Umarmung zu begrüßen ist.
Die Praktiken, die unter Zugriff auf die Matrix hervorgebracht werden können, werden in der Matrix aber nicht einzeln und bis ins Detail festgelegt, sondern Bourdieu spricht diesbezüglich von übertragbaren Schemata, unter deren Zugriff, „Probleme gleicher Form“ gelöst werden können (s. Bourdieu 1979, 169). So kann zum Beispiel in einer Interaktionssituation auf die Verhaltensregel, zum Interaktionspartner einen bestimmten Abstand zu halten, zugegriffen werden, unabhängig davon, mit wem und über was man sich unterhält.
Bourdieu zufolge sind es aber nicht neue Erfahrungen, die die alten verdrängen und den Habitus immer wieder neu definieren, sondern die Ersterfahrungen sind es, die von Vorwegnahmen des Habitus viel zu hoch gewichtet werden (s. Bourdieu 1993a, 101). Dementsprechend bezeichnet Bourdieu den Habitus auch als das „durch die primäre Sozialisation jedem Individuum eingegebene immanente Gesetz“ (s. Bourdieu 1979, 178). Bourdieu spricht dem Habitus zwei Leistungen zu, so erzeugt er zum einen klassifizierbare Formen von Praxis und Werke, und zum anderen dient er der Unterscheidung und Bewertung dieser Formen und Werke (s. Bourdieu 1992, 278). Er bezeichnet Habitus als einen sozialisierten und strukturierten Körper, der die Einverleibung der immanenten Strukturen oder bestimmter Felder einer Welt darstelle und gleichzeitig die Wahrnehmung dieser Welt sowie das Handeln in dieser Welt strukturiere (s. Bourdieu 1998, 145). Vor diesem Hintergrund spricht Bourdieu vom Habitus als strukturierter und gleichzeitig strukturierender Struktur (s. Bourdieu 1992, 279). Der Habitus ist also als Produkt der sozialen Welt anzusehen, die über Habitus in Akteuren verkörpert ist. Befindet sich ein Akteur in der sozialen Welt, deren Produkt sein Habitus ist, oder anders ausgedrückt, in seiner „vertrauten“ Umgebung, dann erscheint ihm diese soziale Welt als selbstverständlich, oder wie Bourdieu es ausgedrückt hat, bewegt sich sein Habitus in ihr „wie ein Fisch im Wasser“ (s. Bourdieu/Wacquant 1996, 161). Jeder „Positionenklasse“ im sozialen Raum entspricht Bourdieu zufolge eine „Habitusklasse“, die von den mit der entsprechenden Position verbundenen Konditionierungen erzeugt wird (s. Bourdieu 1998, 20 f.). Anders ausgedrückt: Unterschiedliche Existenzbedingungen bringen unterschiedliche Formen des Habitus hervor (s. Bourdieu 1992, 278). So wie es verschiedene Positionen im sozialen Raum gibt, so gibt es dementsprechend auch verschiedene Habitus (s. Bourdieu 1998, 21). Da Habitus aus den Lebensbedingungen hervorgebracht wird und er wiederum die Praxisformen und Werke eines Akteurs bestimmt, werden Praxisformen und Werke eines Akteurs mit den Praxisformen und Werken aller Angehörigen derselben Klasse übereinstimmen, weil ihre ähnliche Lebensbedingungen einen ähnlichen Habitus hervorgebracht haben, und nicht, weil eine bewusste Abstimmung vorliegt (s. Bourdieu 1992, 281).
„Der Habitus ist das generative und vereinheitlichende Prinzip, das die intrinsischen und relationalen Merkmale einer Position in einen einheitlichen Lebensstil rückübersetzt, das heißt in das einheitliche Ensemble der von einem Akteur für sich ausgewählten Personen, Güter und Praktiken“ (Bourdieu 1998, 21).
Die im Rahmen des Sozialisationsprozesses verinnerlichten Dispositionen sind Bourdieu zufolge nicht nur an Praktiken und Denkweisen von Akteuren erkennbar (s. Bourdieu/Wacquant 1996, 173), sondern auch am Körper, denn auch Körperhaltungen, Gesten, Redeweisen etc. werden im Sozialisationsprozess erworben (s. Bourdieu 1979, 190). Die Grundlage für die Wahl all dessen, was ein Akteur besitzt, aber auch dessen, was er für die anderen ist, dessen, womit er sich selbst einordnet und von anderen eingeordnet wird, bildet Bourdieu zufolge der Geschmack, der nichts anders ist, als eine Dimension von Habitus und somit wie der Habitus, seinen Ursprung in den Lebensbedingungen eines Akteurs hat. In Bourdieus Theorie ist wie der Habitus, so auch der Geschmack als seine Dimension, nicht als angeborene, sondern als angeeignete Disposition zu verstehen (s. Bourdieu 1992, 104). Auch wenn nicht bestritten werden kann, dass Praktiken von den für die Zukunft gesetzten Zielen oder Plänen determiniert zu sein scheinen, so sind sie Bourdieu zufolge doch von den Lebensbedingungen, aus denen der Habitus entstanden ist, derart determiniert, dass sie die Tendenz aufweisen, diese objektiven Bedingungen zu reproduzieren (s. Bourdieu 1979, 165). Vor diesem Hintergrund spricht Bourdieu vom Habitus als einem Produkt der Geschichte, der zugleich Geschichte macht (s. Bourdieu 1979, 182). Im Habitus wird eingeprägt, welche Praktiken unter Berücksichtigung von objektiven Bedingungen für einen möglich und welche unmöglich sind, d. h., welche mit diesen Bedingungen vereinbar sind, so dass die Akteure sich ohne jegliche Prüfung von Handlungsmöglichkeiten unter die bestehende Ordnung unterwerfen und dementsprechend das ohnehin Unvermeidbare wollen und das Undenkbare verwerfen (s. Bourdieu 1993a, 100). Bourdieu spricht diesbezüglich von der zur Tugend erhobenen Not (s. Bourdieu 1992, 285). Auch wenn es auf den ersten Blick scheinen mag, dass Akteure, die eine bestimmte Handlung vornehmen, ohne zu prüfen, ob eine andere Handlung für einen bestimmten Zweck besser wäre und somit, wie Bourdieu es ausgedrückt hat, handeln, „ohne Kombinationen, Pläne, Projekte zu machen“, so handeln sie Bourdieu zufolge dennoch nicht unvernünftig. Die objektiven Chancen, die sich einem Akteur bieten, sind aufgrund eines langwierigen und komplexen Prozesses im Habitus von Akteuren verinnerlicht, so dass im Habitus damit eingeprägt ist, was in bestimmten Situationen zu tun ist, was zu einem passt bzw. nicht passt, welche Handlung vernünftig bzw. nicht vernünftig ist. D. h., die Akteure handeln nicht, ohne ihr Handeln an die objektiven Chancen anzupassen, doch statt sie vor jeder Handlung immer wieder neu zu überprüfen, richten sie ihr Handeln nach dem Habitus, in dem ohnehin das ganze Handlungsrepertoire, angepasst an die objektiven Chancen, eingeprägt ist (s. Bourdieu/ Wacquant 1996, 163 f.). Bourdieu betont, dass, wenn auch nicht die einzige, so doch die häufigste Form des Handelns sei (s. Bourdieu/ Wacquant 1996, 165). Nicht auszuschließen sind Bourdieu zufolge aber auch die Handlungen, denen strategische Berechnungen zugrunde liegen (s. Bourdieu/ Wacquant 1996, 165). Kommt es zu einer Veränderung von Lebensbedingungen, dann entsprechen neue Umstände nicht mehr den Lebensbedingungen, aus denen der Habitus hervorgegangen ist (s. Bourdieu 1979, 168). Beim Habitus handelt es sich um eine dauerhafte Disposition (s. Bourdieu 1979, 165). Unter diesen Voraussetzungen erscheinen die von einem Habitus produzierten Handlungen nicht immer vernünftig. Ein von Bourdieu diesbezüglich angeführtes Beispiel ist der von ihm in Algerien beobachtete Fall des Übergangs von einer vor- zur kapitalistischen Gesellschaft, indem ein vorkapitalistischer Habitus mit einer kapitalistischen Gesellschaft konfrontiert worden war (s. Bourdieu/Wacquant 1996, 164). Bourdieu nennt diesbezüglich noch ein weiteres Beispiel, nämlich „historische Situationen vom revolutionären Typus“, in denen die objektiven Strukturen so schnell verändert werden, dass sie die mentalen Strukturen, d. h. den Habitus überholen. Beiden Beispielen ist es gemeinsam, dass der aus den alten Bedingungen herausgebildete Habitus nicht neuen Bedingungen entspricht, er aber die Handlungen immer noch nach den alten Schemata hervorbringt, sie jedoch unter neuen Bedingungen als „unzeitgemäß“ und „unsinnig“ erscheinen (s. Bourdieu/Wacquant 1996, 164). Dementsprechend können auch Handlungen, die den „neuen“ Bedingungen entsprechen, vom Habitus, der aus „alten“ Lebensbedingungen hervorgegangen ist, als undenkbar und skandalös erfahren werden, während der Habitus, der aus den objektiven Bedingungen der „neuen“ Lebensumstände herausgebildet worden war, dieselbe Handlung als natürlich und vernünftig erfährt. Bourdieu postuliert diesbezüglich, dass es bei den Generationenkonflikten dementsprechend nicht um einen Aufeinanderprall von durch natürliche Eigenschaften geschiedenen Altersklassen, sondern um einen Aufeinanderprall von unterschiedlichen „Habitusformen“ gehe (s. Bourdieu 1979, 168). Da es sich Bourdieu zufolge beim Habitus um eine dauerhafte Disposition handelt (s. Bourdieu 1979, 165), stellt sich diesbezüglich immer die Frage, ob der Habitus demzufolge als eine starre Determinante verstanden werden darf, die nicht in der Lage ist, sich an neue Lebensumstände anzupassen. Wie bereits ausgeführt, können nach Bourdieu neue Erfahrungen die alten nicht verdrängen und immer wieder neu definieren (s. Bourdieu 1993a, 101), das heißt jedoch nicht, dass die neuen Erfahrungen unbedeutend wären. Bourdieu versteht Habitus als eine chronologisch geordnete Serie von Strukturen (s. Bourdieu 1979, 188), was gegen Habitus als eine starre Determinante spricht. Demzufolge spezifiziert die Struktur eines bestimmten Ranges die ihr vorausgegangene Struktur und wiederum strukturiert sie die nachkommende Struktur. Zur Verdeutlichung nennt Bourdieu als Beispiel die Strukturierung der schulischen Erfahrungen, deren Strukturierung der in der Familie erworbene Habitus zugrunde liegt, durch schulische Aktion kommt es aber zur Transformation des Habitus. Der so transformierte Habitus unterliegt wiederum der Strukturierung aller späteren Erfahrungen (s. Bourdieu 1979, 188 f.). Der Habitus soll Bourdieu zufolge somit nicht als ein unveränderbares Schicksal verstanden werden. Er wird zwar als ein Produkt der Geschichte stark von ihr geprägt und ist vor diesem Hintergrund als dauerhafte Disposition zu verstehen. Er wird aber auch mit neuen Erfahrungen konfrontiert und von ihnen beeinflusst (s. Bourdieu/Wacquant 1996, 167f.). Dass der Habitus verinnerlichte Geschichte ist, wird Bourdieu zufolge negiert, und zwar deshalb, weil er „zu Natur gewordene Geschichte“ ist, damit als solche vergessen wurde und daher einem unbewusst ist (s. Bourdieu 1979, 171). Unter dieser Voraussetzung der Unbewusstheit lässt sich ein Akteur von Dispositionen seines Habitus leiten. Bourdieu zufolge ist es aber auch möglich, vorausgesetzt einem Akteur wird bewusst, dass seine Wahrnehmungen und Reaktionen von Dispositionen seines Habitus agiert werden, sich von eigenen Dispositionen zu distanzieren. Bourdieu spricht diesbezüglich von der bewussten Beherrschung des Verhältnisses zu den eigenen Dispositionen und einer freien Wahl zwischen Agieren von Dispositionen oder einer Hinderung derselben. Dafür müsse aber ständig eine systematische Aufklärungsarbeit geleistet werden. Ist dies nicht der Fall, würde man das unbewusste Agieren der Dispositionen unterstützen. Dieses gehe Hand in Hand mit dem Determinismus (s. Bourdieu/Wacquant 1996, 170 f.). Wichtig diesbezüglich ist aber, an Bourdieus Betonung festzuhalten, dass die vom Habitus hervorgebrachten Handlungen eine häufige Handlungsform sind (s. Bourdieu/ Wacquant 1996, 165). Er betont dementsprechend auch, dass das Hervorbringen von Handlungen nach bewusst aufgestellten Entwürfen oder Plänen eine Ausnahme bilde (s. Bourdieu/Wacquant 1996, 172). Die vom Habitus hervorbrachten praktischen Tätigkeiten können zum einen als Präsenz der Vergangenheit in der Gegenwart aufgefasst werden, und zum anderen, darf abgesehen von Ausnahmen, davon ausgegangen werden, dass in der Gegenwart ausgeführte praktische Tätigkeiten auch in Zukunft verrichtet werden (s. Bourdieu/Wacquant 1996, 172). Die im Habitus verinnerlichten Dispositionen werden von einer Generation auf die andere übertragen (s. Bourdieu/Wacquant 1996, 173). Vor diesem Hintergrund, und weil sich aus ähnlichen Existenzbedingungen ähnliche Dispositionen des Habitus ergeben, und dementsprechend auch aus ähnlichen Habitus ähnliche Praxisformen und Werke hervorgebracht werden, bekommen Praktiken und Werke von Akteuren auf diese Weise „ Regelmäßigkeit “ und „ Objektivität “ verliehen, die zugleich in deren Augen als „ evident oder selbstverständlich “ erscheinen lässt; dies aber nur in deren Augen (s. Bourdieu 1979, 172; Hervorhebungen im Original). Auf das Beispiel von erlernten Verhaltensregeln zurückzukommen, heißt, dass die in unserem Habitus inkorporierten Verhaltensweisen für uns als selbstverständlich erscheinen. Wie selbstverständlich für uns die soziale Welt erscheint, deren Strukturen den in unserem Habitus inkorporierten Strukturen entsprechen, wird uns klar, wenn wir uns in eine Gesellschaft begeben, deren Struktur eine andere ist als die in unserem Habitus verinnerlichte. Das Händeschütteln, das in unserer Gesellschaft als eine selbstverständliche Begrüßungsform angesehen wird, unabhängig von der Geschlechtszugehörigkeit, verliert ihre Selbstverständlichkeit, wenn wir uns in eine Gesellschaft begeben, in der sie nur zwischen Männern praktiziert wird. Konfrontiert mit neuen Regeln, Sitten und Verhaltensweisen, müssten wir in diesem Fall vor jeder Handlung überlegen, ob sie konform oder nicht konform ist, während die Akteure, deren Habitus das Produkt der Strukturen dieser Gesellschaft ist, ihre Handlungen mit gleicher Selbstverständlichkeit verrichten, wie wir es in unserer Gesellschaft tun.
[...]
- Arbeit zitieren
- Dipl. Soziologin Valentina Tomic (Autor:in), 2011, Theorien des Sozialkapitals von Bourdieu, Coleman und Putnam. Ein systematischer Vergleich, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/322621
Kostenlos Autor werden


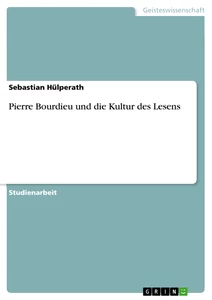

















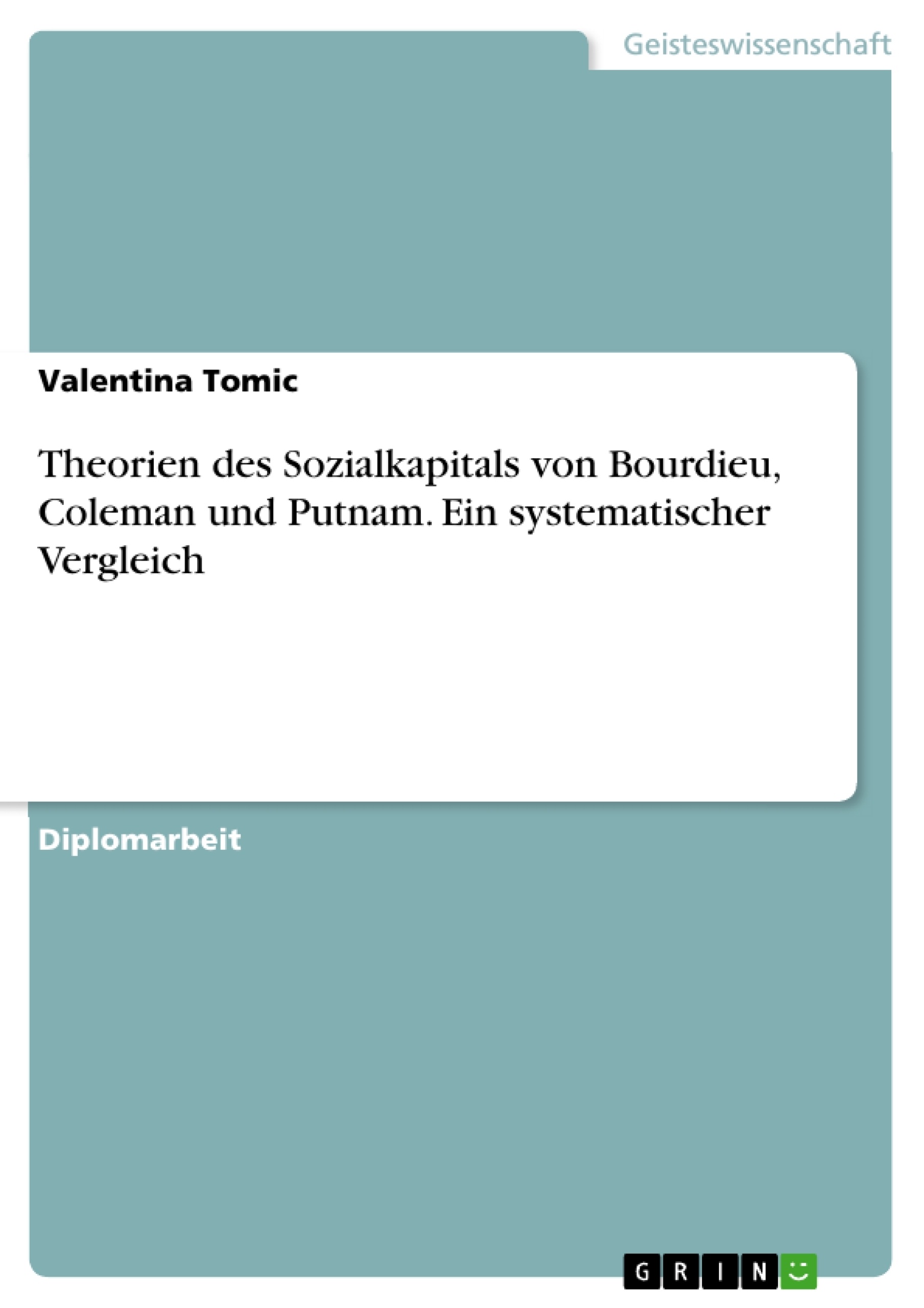

Kommentare