Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Einleitung
1. Anthropologische Überlegungen zur Begründung einer Musikdidaktik
1.1 Mensch und Musik
1.1.1 Anthropologie und Musikdidaktik
1.1.2 Das Elementare Spiel – Spielräume öffnen
1.2. Carl Orff und das Elementare
1.3. Der reformpädagogische Ansatz
1.4. Musikerleben im neuronalen Netzwerk
1.5. Persönlichkeits-und Intelligenzentwicklung durch Musik
1.6. Musik und Lernen
1.7. Musik – mit allen Sinnen spielen
1.7.1. Der visuelle Sinn
1.7.2.Der auditive Sinn
1.7.3. Der taktile Sinn
1.7.4. Der vestibuläre und kinästhetische Sinn
1.8 Ganzheitliches Lernen mit Musik
1.8.1 Kind und Bewegung
1.8.2 Kind und Wahrnehmung
1.8.3 Kind und Stimme/Sprache
1.8.4 Kind und das Spiel auf elementaren Instrumenten
1.8.5 Kind und kreatives Gestalten
2. Musikpädagogische Konzepte in Anlehnung an anthropologische Dimensionen
2.1.Aussagen des österreichischen Lehrplans in Musikerziehung
2.1.1. Der Lehrplan für Musikerziehung in der Primarstufe
2.1.2 Der Lehrstoff für Musikerziehung in der Grundstufe 1 (6 bis 8 – Jährige)
2.1.3. Lehrstoff für Musikerziehung in der Grundstufe 2 (8 bis 10-Jährige)
2.1.4 Didaktische Grundsatzformulierungen
2.1.5. Musikerziehung als Aufgabe
2.1.6. Musikvermittlerische Aspekte des Lehrplans
2.2. Musikunterricht in der Unterrichtspraxis
2.2.1. Rahmenbedingungen und Organisationsmuster
2.2.2. Unterrichtsmaterialien im Musikunterricht
2.2.3. Spiel mit elementaren Instrumenten
2.2.4. Unterrichtsmethoden und Methodenvielfalt
2.2.5. Nachhaltigkeit einer Musikpädagogik
3. Ausbildung an den Pädagogischen Hochschulen
3.1. Curriculare Inhalte und Zielformulierungen in Musik
3.2. Ausbildung und Qualifikation im Bereich Musik an den Pädagogischen Hochschulen
3.2.1. Curriculum NEU
3.2.2. Schwerpunktausbildung im Curriculum NEU
3.2.3 Lehrerfortbildungen
3.2.4. Musik und Alltag
3.2.5. Weiterbildungsmaßnahmen
3.2.6. Erlernen eines Instruments
3.3. Vermitteln von musikalischen Grundkompetenzen
4. Musikvermittlung als Unterrichtsprinzip
4.1. Vermittlung und Unmittelbarkeit
4.1.1. Musikvermittlung – Zugänge zur Musik öffnen
4.1.2. Musikvermittlung in der musikpädagogischen Gegenwart
4.1.3. Musikvermittlung und soziale Kompetenz
4.1.4 Pädagoginnen und Pädagogen als Musikvermittler/Musikvermittlerinnen
5. Musikvermittlung in der Schulpraxis
5.1.1. Unterrichtsbeispiel 1
5.1.2. Unterrichtsbeispiel 2
6. Zusammenfassung
7. Literaturverzeichnis:
7.1. Gedruckte Quellen
7.2. Internetquellen
7.3. Bildquellen
Vorwort
Wenn gegenwärtig Elternhaus und Schule immer weniger die Fähigkeit und Lust zu singen tradieren, dann erhält die berufliche Vorbereitung künftiger Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen einen völlig neuen Stellenwert.[1]
Immer weniger Schüler und Schülerinnen beschäftigen sich vor und nach der Grundschule mit Musik, erlernen ein Instrument oder besuchen eine weiterführende Schule mit musikalischem Schwerpunkt. Das eigene Musizieren ist unmodern, die Interpreten auf CD können das ja doch viel besser.
Die musikalischen Fähigkeiten und Fertigkeiten vieler Kinder sind eingeschränkt und haben nur noch wenig familiäre Ursachen. Bei vielen Kindern wird zu Hause kaum mehr gesungen und ihre Stimme ist wenig trainiert. Auch das gemeinsame Singen, Musizieren, Bewegen und Tanzen hat heute nur mehr wenig Stellenwert in vielen Elternhäusern.
Dabei ist gerade das Alter von der Geburt bis zum zehnten Lebensjahr für die Entwicklung des Kindes von größter Bedeutung. Es ist später kaum mehr irgendwann so hoch motiviert und interessiert zu lernen wie in dieser Zeit. Dies trifft natürlich auch auf das musikalische Lernen zu.
Bildungsvergleiche wie PISA richten sich hauptsächlich auf kognitive Fächer und die künstlerischen Fächer geraten immer mehr ins Abseits. Nur vereinzelt lässt sich ein Trend in Richtung musikalischer Bildung beobachten. Hier wird auch der Musik ein großes Förderpotential und hohe Transferleistung zugestanden.
Bedanken möchte ich mich vor allem bei meinen beiden Betreuern, Dr. Hans Georg Nicklaus und Dr. Constanze Wimmer. Ihre Gedanken zu verschiedenen Themen haben mich meine Sichtweisen neu überdenken lassen und Zugänge geöffnet. Ein großes Dankeschön auch zusätzlich noch an Georg Nicklaus, der mich durch diesen Schreibprozess geführt hat und mir mit wertvollen Tipps und Ratschlägen zur Seite gestanden hat.
Einleitung
Qualitätssicherung im Unterricht, Evaluation, Forschung, Didaktik, Pädagogik etc. sind die Schlagwörter denen sich Pädagoginnen und Pädagogen Tag für Tag stellen müssen. Alle Welt redet davon, was in der Schule verändert und verbessert werden müsse, doch keiner weiß genau, wie das funktionieren soll. Dabei ist die internationale und deutschsprachige Unterrichtsforschung in den vergangenen Jahren ziemlich vorangeschritten. Dadurch können heute viel deutlicher Kriterien angegeben werden, die lernförderlich sind oder umgekehrt Kriterien, die auf Lernvorgänge störend einwirken. Die Schule als Ort des Erforschens und Entdeckens darf nicht nur Wissen vermitteln, sondern sie ist auch ein Ort des emotionalen Austausches, ein Ort indem eine Lern- und Arbeitshaltung vermittelt wird und soziale Handlungsfähigkeit aufgebaut werden soll. Kinder sollen in der Schule Beziehungen erleben, die dem Lernen und der Entwicklung der eigenen Persönlichkeit dienlich sind. Deshalb werden heute den sogenannten soft skills, wie Teamgeist, Flexibilität, Kommunikationsfähigkeit, Kreativität, Konfliktfähigkeit und Stressresistenz im Unterricht große Bedeutung beigemessen. Die genannten Faktoren haben positiven Einfluss auf Entfaltungsprozesse wodurch Kinder befähigt werden, ihr Leben selbst zu bestimmen und erfolgreich zu gestalten.
Ziel dieser hermeneutischen Arbeit ist es aufzuzeigen, wie durch ganzheitliche musikalische Bildung mehr Nachhaltigkeit erlangt werden kann und Inhalte intensiver wahrgenommen werden – Nachhaltigkeit im Sinne eines bewussten Auseinandersetzens mit Musik.
In dieser Arbeit wird im Kapitel 1 der Versuch gemacht den Menschen unter dem anthropologischen Aspekt zu betrachten. Es wird auf Voraussetzungen und Grundlagen eingegangen, die in der menschlichen Konstitution verankert sind und nur darauf warten bewusst eingesetzt zu werden. Weiteres wird daran gegangen, dass Musik und musikalisches Handeln an konkrete psychophysische Bedingungen gebunden ist, sei es die sinnliche Ausstattung, die Atmung oder der Körper an sich.
Im Kapitel 2 wird über Musikdidaktik geschrieben, über Rahmenbedingungen und Organisationsmöglichkeiten, die im österreichischen Lehrplan für Grundschulen angeführt sind und die einen produktiven Musikunterricht möglich machen.
Auch die Bedeutung der Person der Lehrerin und des Lehrers werden im Hinblick auf deren Ausbildung und Qualifizierung im Kapitel 3 beleuchtet.
Wie Lehrerinnen und Lehrer musikalische Werke in der Primarstufe vermitteln können, wird in Kapitel 4 genau erklärt.
Im Kapitel 5 werden praktische Unterrichtsbeispiele zur ganzheitlichen Musikvermittlung angeführt.
In der Zusammenfassung werden alle Aspekte noch einmal miteinander übersichtsweise verbunden und die Bedeutung einer ganzheitlichen und nachhaltigen Musikdidaktik aufgezeigt.
1. Anthropologische Überlegungen zur Begründung einer Musikdidaktik
1.1 Mensch und Musik
Warum macht der Mensch Musik und warum braucht er sie? Darüber haben sich Anthropologen, Philosophen und Musikwissenschaftler viele Gedanken gemacht. Musik gleicht einem Phänomen, das den Menschen von innen und außen beeinflusst und dessen Einfluss er sich nicht verschließen kann. Überall im Alltag begegnet der Mensch verschiedensten Klängen, Geräuschen und Signalen. In ihm werden dadurch Stimmungen, Gefühle und Emotionen ausgelöst. Manche Laute regen ihn zum Nachahmen an, andere empfindet er als unangenehm. Schon das Rauschen der Blätter im Wind, das Plätschern des Wassers im Bach oder das Trommeln der Regentropfen auf das Dach, auf eine Dose, lässt einen Hauch von Musik spüren und weckt Neugierde. Auch dort, wo keine musikalische Absicht vorliegt.
Ebenso gibt es in manchen Kulturen Musikalisches, wo sogar ein eigenständiger Begriff für Musik fehlt. Sie tritt in diesem Fall in Form von einem Sprechgesang, in einem religiös-kultischen Kontext oder als Tanz in Erscheinung. Musik scheint irgendwie stets doppelt begründet und verankert zu sein in „Natur“ und „Kultur“. Der Mensch braucht und gebraucht sie im Alltäglichen, sie ist etwas Lebensnotwendiges für ihn.
Auch der steirische Musikästhetiker Friedrich von Hausegger ging von der These aus, dass Musik Ausdruck sei und im Menschen selbst verankert ist. Aus anthropologischer Sicht wird Musik als hochspezialisierte Form von menschlichem und zwischenmenschlichem Handeln aufgefasst. Dieses Handeln wird dem Menschen auf Grund seiner Ausstattung ermöglicht. Er besitzt primär musikhafte Potentiale, die ihren Sitz in Stimme, Muskulatur, Wahrnehmungsapparat, Motorik und in den körpereigenen Rhythmen haben. Dieses musikbezogene Handeln steht im Zentrum pädagogischen Interesses.
Das handelnde Kind, welches Laute, Klänge, Geräusche und Töne wahrnimmt, versucht diese nachzuahmen, nachzuspielen oder mit dem Körper darzustellen. Es drückt damit verbundene Empfindungen in seinen Bewegungen aus, die es im Inneren beim Erklingen verspürt und bringt dadurch seine Emotionen nach außen. So werden innere und äußere Bewegtheit zum Ausdruck gebracht. Die auf diese Wiese gemachte eigene Erfahrung und die Erlebnisse durch Kontakte mit anderen Kindern können zu ästhetischen Wahrnehmungen führen, die mit dem Medium Musik fest verbunden sind.
Soll Musik erfahren werden, muss sie erlebt werden, muss sie mit dem ganzen Körper, mit den Sinnen wahrgenommen werden. Nur so kann sie als Ganzes aufgenommen werden und im Inneren sowie im Äußeren wirksam werden.[2]
1.1.1 Anthropologie und Musikdidaktik
Die anthropologische Sichtweise der Musik und ihre Begründung im Menschen können dann nur mit folgender Frage anschließen. Wie können Musikpotentiale im Kind optimal erschlossen, genützt und gefördert werden?
Hier wird davon ausgegangen, dass das Musiklernen im Rahmen der ästhetischen (Selbst-)Bildung so organisiert sein muss, dass Erfahrungsräume geöffnet werden. Gerade da ist das Geschick der Lehrenden gefordert. Kinder sind von ihrem Wesen her offen für Neues und lassen sich in einer vertrauten Umgebung gerne auf unbekannte Themen und Inhalte ein. Sie wollen und sollen ihr Lebensumfeld ergründen und erweitern. Als Fünf- bis Sechsjährige haben sie bereits einen kleinen Lebensraum erschlossen, welcher sich stets vergrößern soll und in dem immer wieder neue Lebensaspekte einfließen sollen. Hier bieten sich im Besonderen das Spiel oder spielerisch gestaltete Interaktionen an um das Kind behutsam in neue Lebensbereiche einzuführen. Alle Kinder spielen gern und erschließen sich auf diesem Wege ihre Umwelt. Über das Spiel gelingt es ihnen auch in unbekannten und unvertrauten Situationen Sicherheit zu gewinnen und Stolpersteine zu überwinden.
In diesem Bewusstsein sollen also Pädagoginnen und Pädagogen musikalische Aktionen so setzen, dass diese mit vielen Sinnen erschlossen, erprobt, verworfen oder bestätigt werden können. Über das Handeln und Erproben gelangen die Kinder zu ihren Erfahrungen, zum eigenen Können, zu Wissen und zu Produkten. Manchmal entstehen dabei Situationen, die vielleicht gar nicht von vornherein geplant waren oder anders vorgesehen waren. Auch das hat seine Berechtigung.
Das Auseinandersetzen mit Materialien und Gegenständen bewegt Kinder zuweilen zu Handlungen, die zwar kreativ, aber nicht immer einschätzbar sind. Und trotzdem oder gerade deswegen verbirgt sich hinter diesem Vorgehen eine künstlerische Arbeitsweise, manchmal aber auch nur ein Verständnis, welches als „Lernen“ bezeichnet werden kann.[3]
Den Höhepunkt des Lernens durch Erproben und Erkunden erreicht ein Kind etwa im Alter zwischen dritten und zehnten Lebensjahr. Genau in diesem Zeitraum liegt der Schuleintritt eines Kindes in die Primarstufe.
1.1.2 Das Elementare Spiel – Spielräume öffnen
Jeder, der Kinder kennt, der mit Kindern zu tun hat, weiß wie gerne sie spielen, sei es das Spiel mit den Puppen, mit Autos, mit Karten oder mit elektronischen Spielsachen.
Dieser angeborene Spieltrieb ist in ihnen angelegt und steuert ihr Handeln. Sie bewegen sich singend und tanzend im Eigenrhythmus durch den Raum und vergessen die Zeit, ihre unmittelbare Umwelt und geben sich ganz dem eigenen Spiel hin. Sie verlieren sich regelrecht in diesem Spiel. Was sie dabei erleben und empfinden nehmen sie über ihre Wahrnehmungsorgane auf und teilen es den anderen über das Sprechen, über einen Gesang oder über eigene Bewegungen mit. Ihre Spiellust ist ungebremst, wenn sie den nötigen Freiraum haben oder sich selbst den Freiraum schaffen können.
Pädagoginnen und Pädagogen sollten daher ihre Bemühungen darauf richten, Spielsituationen im Unterricht anzuregen und Unterricht auf diesem Prinzip stattfinden zu lassen. Der Pädagoge und Philosoph Otto Friedrich Bollnow spricht in diesem Zusammenhang davon, dass Räume geschaffen werden müssen, insbesondere der Spielraum, den der Mensch braucht, um sich frei bewegen zu können. Räume schaffen ist eine Sache. Sie müssen aber dem Sicherheitsbedürfnis eines Kindes entsprechen, sodass Spielhemmungen überwunden werden können. Gleichzeitig sollten sie einladend wirken und eine positive Spielatmosphäre anbieten.
Es braucht aber auch in freien Räumen Spielregeln. Das Kind sollte im Zuge der Erweiterung des Spielraums an Spielregeln gewöhnt werden und Grenzen anerkennen. Vereinbarte Spielregeln regeln das Tun innerhalb eines Spielverlaufs und geben Richtung und Orientierung an. In diesem Zusammenhang könnten die Spielregeln als eine Art Widerstand verstanden werden, der dem Kind hilft, seine gewonnenen Fähigkeiten und Fertigkeiten besser einzuschätzen. Für die Pädagogin und den Pädagogen bedeutet dies, sensibel Spielräume zu gestalten und zu öffnen, damit jedes Kind sich im gewählten Rahmen bewegen und Zuwächse in seiner Entwicklung erlangen kann. Manchmal spielen Kinder einfach so vor sich hin und ihr Spiel scheint keine Absichten zu verfolgen. Es sieht so aus, als ob nur zum Zeitvertreib gespielt, gebaut oder Neues erfunden wird. Auch hier bedarf es der richtigen Einschätzung dieser Handlungen. Es muss nicht jedes Spiel für pädagogische Absichten nutzbar sein.[4]
Auch in der Vergangenheit wurde immer wieder auf die Bedeutung der Musik für die Entwicklung und Erziehung des Kindes von großen Pädagoginnen und Pädagogen hingewiesen. Ihr Wert zur Entfaltung der Sinne, der eigenen Stimme, sowie in Bezug auf die Koordination von Bewegungen, wird betont. Einer der ersten war Johan Amos Comenius, der im 17. Jahrhundert Unterrichtsmethoden entworfen hat, die bis heute nicht an Aktualität verloren haben.[5] Seiner Ansicht nach sollte jedem Mensch gewährt werden Einsichten zu gewinnen in universelle Zusammenhänge. Zentrales Anliegen seiner Didaktik war das entdeckende Lernen, die Sinnesschulung und der aktive Umgang mit den Dingen, den Materialien selbst. In seiner Schrift: „Der Mutter Schul“ aus dem Jahre 1636 geht er bereits näher auf die musikalische Betätigung der Kinder in den ersten Lebensjahren ein und beschreibt sie folgendermaßen:
Musica ist uns die natürlichste. Den sobald wir zur Welt geboren werden, fangen wir bald an das Paradeißliedlein zu singen, a. a. e. weinen, sage ich, und klagen ist unser erste Musica, welche man Kindern nicht verwehren kann, und wenn es auch müglich were, soll mans nicht thun, weil es zur Gesundheit dienet. …. Im anderen Jahr fängt die eusserliche Musica den Kindern anmutig zu werden, nemlich das singen, geigen, … und andere Instrumenta musicalia. Darumd soll man ihnen solche mittheilen, damit ihre Ohren und Gemüt zur melodien gewohnen. Im dritten Jahr bestehet der Kinder Musica auch noch im zuhören. … Im vierdten Jahr bey etlichen Kindern das singen nicht unmüglich ding: bey denen aber die langsamer sind Musicam zu begreiffen, kann es auffgeschoben werden. Es kann auch den Kindern ( sonderlich den Knaben) zugegeben werden eine Pfeiffe, Pauke, Geiglein. Daß sie lernen pfeiffen, klümpern, und also ihr Gehör zu allerley melodien angeführt werde. Im fünfften Jahr (wofern es im vierdten nicht angefangen ist) wird es zeit sein, daß sie ihren Mund mit geistlichen Liedern und Gesängen auffthun und afangen mit ihrer Stimme GOTT ihren Schöpfer zu loben[6]
Dazu verfasste Comenius kleine Verse und Liedtexte für Eltern und Erzieher, dass diese mit den Kindern zu verschiedenen Anlässen gesprochen und gesungen werden. Comenius erkannte damals schon die Notwendigkeit der frühen Förderung des Kindes durch das Elternhaus und war der Überzeugung, dass das Kind von Geburt an bildungsfähig ist und altersspezifisch Erkenntnisse erlangen kann.[7]
Auch der Schweizer Pädagoge Heinrich Pestalozzi setzte die Musik unterstützend beim Einprägen von Wissensstoff ein und gestand der Musikerziehung damals schon große Transferwirkung zu.[8]
1.2. Carl Orff und das Elementare
Der bedeutende und anerkannte Komponist und Elementardidaktiker Carl Orff prägte bereits 1932 folgenden Leitgedanken:
Die Musik fängt im Menschen an, und so die Unterweisung. Nicht am Instrument, nicht mit dem ersten Finger oder mit der ersten Lage, oder mit diesem oder jenem Akkord. Das Erste ist die eigene Stille, das In-sich-Horchen, das Bereit-Sein für die Musik, das Hören auf den eigenen Herzschlag oder Atem. So grundlegend sollte das Hinführen zur Musik beginnen, so allgemein, so umfassend, so von innen heraus, für Kinder wie für die Großen, Es sei, um alle Missverständnisse von vornherein auszuschließen, betont, dass hier von keiner musikalischen Fachbildung gesprochen wird, sondern von den Gegebenheiten und der grundlegenden Stufe, die dem eigentlichen Musikunterricht und aller Musikübung vorausgehen sollte, von der Vorbereitung, dem Weg zur Musik, und der ersten Rodung, die für jeden Menschen, dem Musik etwas bedeuten soll, gleich wichtig ist.[9]
Zudem betonte er auch immer, dass es für ihn nicht um Musik allein ginge, sondern um „Menschenbildung“.
Seine Aussagen haben bis heute nichts an Aktualität eingebüßt. Im Gegenteil! Heute haben die engen Zusammenhänge zwischen (Menschen-)Bildung und Musik wieder an Bedeutung gewonnen und werden in enge Beziehung zueinander gebracht.
Carl Orff selbst war überzeugt, dass seine Sicht von irgendwelchen Trends unabhängig ist.
Immer wieder beobachtete er Kinder in ihrem Spiel, wie sie sich unbewusst der Musik nähern. Sei es durch Singen während des Spiels, durch Erfinden eigener Reime und Texte zu ihrem Spiel oder sei es durch singendes Begleiten von Bewegungen, von Hüpfen oder von selbst kreierten Tänzen. Er beobachtete, wie sie ihre Umwelt erkundeten und erforschten, wie sie Gegenstände in das Spiel miteinbezogen, Materialien untersuchten und durch Greifen und Ertasten das Objekt begreiflich machten.
Das Schlagen, Klopfen, Hämmern und dann das Klingen lösen beim Kind Freude aus. Selbst Geräuschen aller Art sind sie zugetan und auch dem Lärm kann das Kind Positives abgewinnen. Das Angreifen von Gegenständen, das Hantieren damit und das Untersuchen des Gegenstandes auf seine Einsatzmöglichkeiten machen den Gegenstand begreiflich. Wurde der Gegenstand begriffen, kann der Begriff aufgenommen und aktiv angewandt werden.
Jedes Kleinkind musiziert auf seine ganz individuelle Art. Gedacht ist hier an das willkürliche Bewegen einer Kleinkindrassel, das Freude auslöst oder das Fallenlassen eines Spielzeugs, welches ein Geräusch verursacht.
Es musiziert aus seinem Innersten heraus, erprobt seine Stimme, indem es lallt, schreit, trällert, krächzt und Laute ausstößt. Dabei beansprucht es seinen gesamten Körper auf unbewusste Weise. Es nützt die ihm gegebene Muskulatur, seinen Wahrnehmungsapparat, setzt die Atmung ein und musiziert damit mit Einsatz seiner gesamten Körperlichkeit. Denn der Grundrhythmus zu seinem Musizieren schlägt ihm sein eigenes „Herz“.
Das Spüren des eigenen Herzschlages ist etwas sehr Ergreifendes, es gehört nur zu dieser Person, nur zu diesem Kind und ist einzigartig. Der eigene Puls und der damit verbundene Herzschlag durchströmt diesen kleinen, zarten Körper ein ganzes Leben lang mit einer solchen Kraft, dass der gesamte Körper in Bewegung gebracht werden kann und damit die Grundstimmung seines Lebens bestimmt.
Der Mensch steht also von Anbeginn seines Daseins mit der Musik in enger Beziehung. Sofort mit der Entstehung seines Seins entwickelt sich ein Körper und damit Organe, die es ihm ermöglichen Töne, Klänge, Geräusche und Rhythmen zu erzeugen. Er ist ausgestattet mit einem Instrumentarium, das auf körperlich-seelischer Natur beruht und ihm ein Musizieren ermöglicht, welches unabhängig ist von einem gestaltenden Instrument.
Aufgrund seines beweglichen Körpers ist es möglich, in die Hände zu klatschen oder zu patschen und mit den Füßen zu stampfen. Gesten und Bewegungen werden zu Klanggesten und lassen dem Kind den eigenen Körper als Instrument entdecken. Sie ermöglichen es ihm seine innere Bewegtheit äußerlich zum Ausdruck zu bringen und so mit seiner Umwelt zu kommunizieren.
Um die Übertragung solcher körperlich-seelischer Impulse auf Instrumente auf einfache Weise zu ermöglichen, hat Carl Orff aus den verschiedensten Ländern und Kontinenten, wie Afrika, Asien, Amerika Instrumente gesammelt, umgebaut und modifiziert. Ihre leichte Spielweise sollte ein Musizieren aus dem Körper heraus ermöglichen. Sie werden damit zu Ausdrucksorganen der inneren Bewegtheit. Gleichzeitig wird durch dieses vereinfachte Spiel eines Instruments das kreative Experimentieren und Improvisieren am Instrument induziert.
Wird solch ein Spiel noch von Lauten, Tönen und Singen begleitet, so äußert das Kind seine „Stimmung“ des Herzens und die Musik kommt von ganzem Herzen. Selbst die allergrößte Perfektion würde ohne diese innere Stimmung unvollkommen bleiben.[10] Alle diese Beobachtungen ermutigten Orff zu seiner Aussage: „Die Musik fängt im Menschen an“ - und daher hat der Musikunterricht im Menschen zu beginnen.[11]
Ein Mensch also, der von seinem inneren Rhythmus bestimmt und geleitet ist, ist ein elementar bewegter Mensch. Um den Begriff „elementar - Element“ zu deuten, hilft es auf das alte Wort „Elan“ zurückzugreifen. Dies kommt vom griechischen Wort „ela-ynein“ und kann übersetzt werden mit: „aus sich hervorbringen“. Für das elementare Musizieren könnte es heißen, das was der Mensch aus sich herausbringt, was durch ihn wirkt, was aus ihm entwächst, sich aus ihm ereignet und ihm Gestalt gibt.
Die menschliche Sprache verliert in diesem Zusammenhang ihren allgemein gültigen Sinn. Die so verstandene Musik, also eine Sprache des Herzens und des Körpers entsteht auf einer anderen Ebene, sodass jegliche Kunstausübung unvollkommen bleibt, entspringt sie nicht dem Innersten eines Menschen.[12]
1.3. Der reformpädagogische Ansatz
Um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert ließen sich weltweite Veränderungen sowohl in politischer, gesellschaftlicher, sozialer und vor allem in menschlicher Hinsicht beobachten. Ganz Europa war in Reformbewegung und es breitete sich ein neues Lebensgefühl aus, das gegen die Missstände der bürgerlichen Gesellschaft rebellierte. Dazu begann sich auch das bis dahin gültige naturwissenschaftliche Weltbild neu zu ordnen. Pädagogische Ideen wurden neu formuliert, Schulformen reformiert und reformpädagogische Maßnahmen wurden auf den Plan gerufen. Das Kind wurde im neuen Erziehungsgedanken in den Mittelpunkt gestellt und als eigenständiges Wesen fassbar gemacht. Ideen wurden entwickelt, wie das Kind frei wachsen kann. In seinem Wesen ist alles angelegt für das spätere Menschsein.[13]
Die schwedische Reformpädagogin Ellen Key[14] formuliert dies mit folgenden Worten:
Der Kindergarten ist nur eine Fabrik, und dass die Kinder dort „modellieren“ lernen, anstatt nach eigenem Geschmack ihre Lehmkuchen zu bilden, ist typisch für das, was das kleine Menschenmaterial selbst durchmacht [15]
In Italien machte die Reformpädagogin Maria Montessori als erste weibliche Ärztin frühe Erfahrungen in der psychiatrischen Abteilung der römischen Universitätsklinik mit verhaltensauffälligen (gestörten) Kindern. Ihre Aussagen über das Kind erregten internationales Interesse in der Pädagogenschaft aber nicht nur in diesem Bereich. Sie beschrieb in ihren Beobachtungen, dass Kinder zu bestimmten Zeiten zugänglicher sind, bestimmte Fähigkeiten zu entwickeln. In diesen sogenannten sensiblen Phasen, deren Dauer begrenzt ist, erwirbt das Kind auf natürliche Weise Zuwächse. Maria Montessori spricht hier von zyklischen Phasen, in denen das heranwachsende Kind aufnahmebereit ist. Sie deutet dies als Ergebnis einer inneren Kraft und macht dafür eine innere Lebenskraft dafür verantwortlich. Das sind für die Pädagoginnen und Pädagogen, Eltern und Lehrenden undurchschaubare elementare Vorgänge, die von außen nicht beeinflussbar sind.
Die ganze Entwicklungsarbeit, die das Kind leistet, wird von Gesetzen bestimmt, die wir nicht kennen, und folgt dem Rhythmus einer Aktivität, die uns fremd ist. Wir versuchen nicht, diese geheimnisvollen Kräfte zu ergründen, sondern achten sie als ein Geschenk im Kind, das nur ihm allein gehört.[16]
Sie polarisiert zwischen dem entwicklungspsychologischen Ansatz bei Erwachsenen und Kindern und beschreibt ihn folgendermaßen: Das Kleinkind lernt und erwirbt Fähigkeiten, indem es einfach lebt, während der Erwachsene mit Willenskraft, Mühe und Anstrengung Leistungen erbringt. Die langjährigen Beobachtungen, die Maria Montessori als Ärztin gemacht hat, erhebt sie später zum erzieherischen Prinzip. Entwicklungen, die im Kind vorgehen, gelangen durch schöpferische Energien zur Reife, wenn äußere Einflüsse diese Entfaltung nicht stören und durch Zuführen geistiger und seelischer Nahrung gestützt werden.[17]
1.4. Musikerleben im neuronalen Netzwerk
In den beiden vergangenen Jahrzehnten veränderten Forschungsergebnisse der Neurowissenschaft und der Neurobiologie die bisherige Sicht des Gehirns. Hielt sich bis dorthin die Ansicht, dass es sich beim Gehirn um ein eher statisches, wenig veränderliches Organ handelt, so wird heute die Ansicht vertreten, dass das Gehirn formbar ist und sich auf gegebene Bedingungen und Gegebenheiten der Umgebung immer wieder neu einstellt.
Der Neurobiologe Manfred Spitzer erklärt dies an Hand des folgenden Beispiels:
Eine Person, die Blindenschrift lernt, bewirkt bei sich, dass ein minimaler Teil der Großhirnrinde oft beansprucht wird. Nervenzellen, die sich dort befinden erhalten Impulse vom rechten Zeigefinger, werden dadurch erregt und ihre Anzahl nimmt sichtlich zu. Diese Anpassung des Gehirns an veränderte Situationen wird als Neuroplastizität bezeichnet. Sie gibt es auf verschiedenen Ebenen. So erreicht ein Impuls ein Neuron, ausgehend von einem anderen Neuron über eine Synapse. Die Stärke dieser Verbindung ist ausschlaggebend für die Lernvorgänge. Aus neurobiologischer Sicht vollzieht sich Lernen in der Veränderung der Stärke der Verbindungen zwischen Nervenzellen.
Dieses neuroplastische Phänomen lässt sich auch auf weite Bereiche der Großhirnrinde übertragen. Sie enthält Neuronen, die dann aktiv werden, wenn ein bestimmter Input von den Sinnesorganen gemeldet wird. Der von der Haut aufgenommene Reiz verzweigt sich im Kortex bis zu 10.000-fach und kann dadurch mit vielen Nervenzellen in Kontakt treten. Nur eine kleine Teilmenge der Zellen erreicht aber den beanspruchten Teil im Kortex und ist nicht nachweisbar. Daher werden solche Verbindungen auch stille Verbindungen genannt. Im Kortex entstehen durch die einlangenden Signale landkartenartige Systeme.
Dazu ein Beispiel: Wer z. B.: Violine oder Gitarre lernt, verändert den kortikalen Bereich, der für die Finger der linken Hand beim Greifen zuständig ist. Es vergrößert seine Länge auf 1,5 bis zu 3,5 cm. Wobei der letzte Wert nur erzielt werden kann, wenn vom frühen Kindesalter an viel geübt wird.[18]
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Das menschliche Gehirn
Nach heutigem Erkenntnisstand ist der Kortex so angelegt, dass er aufgrund seiner Struktur und Funktionsweise gar nicht anders kann, als Landkarten anzulegen. Das lässt die Vermutung zu, dass in der Großhirnrinde, die ja größtenteils gleich aufgebaut ist, im Kortex überall Landkarten abgespeichert sind. Sie unterscheiden sich nur durch die verschieden abgespeicherten Inhalte.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: Landkarten im Kortex
Diese Erkenntnis hat auch für den Bereich Musik große Bedeutung. Praktisch ausgedrückt heißt dies, dass jede Form von gehörter oder erzeugter Musik Veränderungen im zentralen Nervensystem bewirken, die vermutlich in absehbarer Zeit auch nachweisbar werden. Diese Neuroplastizität ist nach Spitzer auch dafür verantwortlich, dass Musik letztendlich nur durch das Hören oder Musizieren, sowie das Produzieren von Musik in die Köpfe der Menschen gelangt, was durch die Arbeitsgruppe um Pantev in den vergangenen Jahren mit Hilfe der Magnetenzephalographie, kurz MEG, nachgewiesen werden konnte.[19]
Noch von etwa zwei Jahrzehnten gingen amerikanische Neurochirurgen davon aus, dass kognitive Aufgaben auf die rechte und linke Gehirnhälfte verteilt werden. Sie durchtrennten bei Epilepsie-Patienten, mit schwerer Krampfsymtomatik, die Verbindung zwischen der rechten und der linken Gehirnhälfte. Die Tests, die dann durchgeführt wurden, führten zu Erkenntnissen über die bewusste und vorbewusste Informationsverarbeitung. Unter anderem fanden sie heraus, dass die Verarbeitung von einigen Wahrnehmungsreizen, z. B.: die Verarbeitung von Tonfolgen, von dem Ohr abhängig ist, mit dem zugehört wird. Aufgrund dieser Erkenntnisse wurde die Verarbeitung von sprachlichen Inhalten der linken Gehirnhälfte zugeordnet und die Musik, als emotionales Pendant der rechten Gehirnhälfte, was aber keinesfalls zutreffend war. Insgesamt kann bei dieser Studie davon ausgegangen werden, dass die durchaus interessanten Ergebnisse überinterpretiert wurden. Es führten Überlegungen in diesem Zusammenhang auch dahingehend, dass das Lernen sprachlicher Inhalte das Gehirn ungleich auslastet, dies aber durch Lernen mit Musikhören kompensiert werden kann. Zu all diesen Erkenntnissen muss deutlich hervorgehoben werden, dass an jedem Wahrnehmungsprozess und jeder Weiterverarbeitung von Umweltreizen immer das ganze Gehirn beteiligt ist. Dennoch gibt es unter den Pädagoginnen und Pädagogen noch immer eine Anzahl an Anhängern dieser Theorie der Hemisphärendichotomie, da diese Konzepte hohe Lernerfolge bei wenig Aufwand versprechen. Auch im Konzept des hirngerechten Lernens von Manfred Spitzer finden sich Effekte, bei denen Musik als Lernhilfe wirksam wird. Es darf aber davon ausgegangen werden, dass die aufgezeigten Wirkungen, nicht alleine vom Musikhören beeinflusst sind, sondern dass dies eine Variable von mehreren ist, die zusammenwirken und dann positiven Einfluss auf den Lernerfolg haben. Grundsätzlich empfiehlt es sich Transfertheorien mit einem kritischen Blick zu begegnen und Nachweise zu erbringen, bevor weitere Annahmen entwickelt werden. Musik lernen verlangt eben auch viel Ausdauer und Übung.[20]
1.5. Persönlichkeits-und Intelligenzentwicklung durch Musik
Immer wieder wird der Versuch gemacht, Musikerziehung in Bezug zur Intelligenz, zu Sozialverhalten und guten Schulleistungen zu setzen. Einer der bekanntesten Forscher auf diesem Gebiet war Hans Günther Bastian[21], der mit seiner Langzeitstudie (2002) an einer Berliner Grundschule dies nachzuweisen versuchte. Er fand in seinen Untersuchungen heraus, dass Kinder mit regelmäßigem Musikunterricht in Bereichen wie Sozialverhalten, Intelligenz, Psychomotorik und Wahrnehmungsfähigkeit im Vergleich zu Gleichaltrigen, die nicht musizieren, in ihrer Entwicklung begünstigt waren.
Die Gründe dafür waren physiologischer Natur. Die Studie zeigte, dass das Musizieren vor dem siebten Lebensjahr Entwicklungsprozesse und Repräsentanzstrukturen zwischen den beiden Gehirnhälften fördert.
Dabei wird die linke Gehirnhälfte wie schon erwähnt der Sprache, der Mathematik, der Kommunikation und dem Erfassen von Details zugeordnet und die rechte Gehirnhälfte ist für die Verarbeitung der Kreativbereiche, wie Musik, Rhythmus, bildhaftes Denken und Emotionen, sowie für die Raumwahrnehmung zuständig.
Das Testverfahren dieser Studie war ein Grundintelligenztest, der zur Gruppe der Culture Fair Intelligence Tests zählt. Die Konzeption des Tests erhebt den Anspruch, intellektuelle Fähigkeiten unabhängig der Schichtzugehörigkeit und kultureller Gegebenheiten von Personen zu testen. Dieses ursprünglich amerikanische Testverfahren wurde dann in Deutschland auch bei Kindern zwischen 5 und 3, bzw., 9 und 5 Jahren entwickelt. Es soll wesentliche Aspekte intelligenten Verhaltens bestimmen und vorherige Lernerfahrungen ausklammern.
Ziel und Zweck ist die Bestimmung der Grundintelligenz, womit die Fähigkeit des Kindes gemeint ist, in neuartigen Situationen, Regeln zu erkennen, Beziehungen herzustellen, Merkmale zu identifizieren und schnell wahrzunehmen. Es wurde getestet, bis zu welchem Komplexitätsgrad das Kind in der Lage ist, Problemstellungen zu erfassen und zu lösen.
Nach vier Jahren erweiterter Musikerziehung in der Grundschule konnte ein mittlerer Effekt zugunsten musizierender Kinder festgestellt werden, d.h. die IQ-Differenz war tatsächlich gegeben. Belegt konnte in der Studie auch werden, dass Intelligenz keine lebenslang unveränderliche Größe ist, sondern dass sie sich während des Lebensalters durch Lernen steigern oder auch verringern kann.
Unterdurchschnittlich begabte Kinder profitieren langfristig von der musikalischen Förderung gegenüber jenen Kindern, die nicht im Bereich Musik gefördert werden.[22]
Der Bastian-Studie wurde in den Medien lange Zeit große Aufmerksamkeit geschenkt und sie sorgte auch in der Fachwelt für kurze Dauer für großes Interesse. Dennoch unterlagen diese Aussagen von Anfang an einer gewissen Skepsis auf Grund der angewandten Verfahren und Vorgehensweisen, z. B.: das Fehlen einer Kontrollgruppe. Insgesamt werden an dieser Studie drei wesentliche Kritikpunkte festgemacht Das ist einerseits die methodische Vorgehensweise, dann die Interpretation der Studienergebnisse und zuletzt die Präsentation der Ergebnisse, die bemängelt und in Frage gestellt werden.[23]
1.6. Musik und Lernen
Für Wilfried Gruhn beginnt Lernen mit dem Wahrnehmen. Der Wahrnehmungsapparat eines Säuglings ist schon voll funktionstüchtig ausgebildet. Dennoch müssen Sehen, Hören, Tasten Bewegen, geübt werden. Es geht um Zuweisen von Bedeutungen. Zum Beispiel erscheint ein Ton erst tief, wenn in seiner Umgebung viele hohe Töne sind. Der gleiche Ton würde in einer Umgebung von tiefen Tönen an Tiefe verlieren.
Das wichtigste Differenzierungsmittel beim Unterscheidungslernen ist die Imitation. Dies gilt auch beim musikalischen Lernen. Ein Kind hört einen Klang und versucht eben diesen Klang zu produzieren. Es probiert solange, bis der gehörte Ton mit dem produzierten übereinstimmt. Dazu sind viele Wiederholungen notwendig. Mit diesen wiederholenden Übungen erwirbt es Handlungsmuster, die so nach und nach internalisiert und automatisiert werden. Automatisierte Handlungsweisen führen durch Üben und durch Imitation zu mentalen Repräsentationen. Diese sind dann vorhanden, wenn das Kind die nächsten Töne oder den weiteren Tonverlauf einer musikalischen Abfolge antizipieren kann.
Kann also ein Kind die weiteren Töne einer Melodie oder die Schläge eines Rhythmus vorausdenken oder innerlich voraushören, bevor die Lehrerin oder der Lehrer sie vorgibt, ist eine Repräsentation schon vorhanden. Das heißt, das Kind weiß bereits, welcher Ton nachfolgen wird. Der Übergang von Imitation zur Antizipation zeigt auf, dass etwas gelernt und im Bewusstsein repräsentiert ist. Eine Untersuchung von Faller W. zu diesem Thema zeigt auf, dass ein begrenztes Fenster, indem die Imitation eines gehörten Tones in Antizipation umschlägt, definiert werden kann. Je genauer die Kinder den Rhythmus wiedergeben, desto näher sind sie der Antizipation.[24]
1.7. Musik – mit allen Sinnen spielen
Schon in der Antike wurde den Sinneserfahrungen große Bedeutung zugemessen. Es wurde davon ausgegangen, dass die Sinne und deren Entwicklung die Basis jeglichen Lernens sind und erfahren heute durch die veränderten Lebensbedingungen erneut großer Aufmerksamkeit. Unsere Sinne ermöglichen uns die Wahrnehmung unserer Umwelt und das Kommunizieren mit ihr. Kinder erforschen unsere Welt durch die sinnliche Wahrnehmung. Sie lernen sie über ihre Wahrnehmung kennen und können so Teil dieser Ordnung werden. Bekanntermaßen lernen Kinder immer mit allen Sinnen. Sie tasten, singen und horchen sich in die Welt. Sie versuchen sie mit Herz, Hand, Auge und Ohr zu er-greifen und zu be-greifen.
Um diese Sinne weiter entfalten zu können, brauchen sie eine Vielzahl an Möglichkeiten, die Sinne zu erproben. In diesem Greifen und Be- greifen erkunden sie die Welt und die Wirklichkeit. Dabei lernen sie sich selbst kennen und ebenso ihre Mitmenschen. Diese gemachten Sinneserfahrungen beeinflussen dann ihre seelische, geistige und körperliche Entwicklung.
Viele Kinder wachsen heute in einer sinnesarmen Umgebung auf, die aber gleichzeitig gekennzeichnet ist von totaler Reizüberflutung, in der ihr Hör-und Sehsinn überbeansprucht sind. Dadurch werden nicht selten die elementarsten Sinne vernachlässigt. Kindgerechte Anregungen fehlen und Medienüberflutungen bringen das Kind aus der Balance. Dieses Ungleichgewicht schlägt sich bei Kindern in Aggression, in Unruhe oder in Hyperaktivität nieder. Konzentrationsstörungen bei Kindern in der Schule und im Alltag sind oft die Folge. Sie können ihre Wahrnehmung nicht richtig zuordnen, können Lernangebote nicht annehmen und es fällt ihnen schwer mit anderen in Kontakt zu treten. Das oftmals lange Verweilen vor dem Fernsehapparat und dem Computer verändert deren Körperwahrnehmung und die Integration von ankommenden Reizen ins Gehirn ist gestört.[25]
1.7.1. Der visuelle Sinn
Für die Aufnahme optischer Reize aus der Umwelt ist das Auge verantwortlich. Es nimmt Licht, Farben, Formen, sowie Muster wahr und vermittelt uns Raumlagen. Über diesen „Gesichts-Sinn“, wie ihn Kurt Tucholsky[26] nennt, entwickelt sich aber auch eine ganz persönliche Sichtweise der Dinge. Jeder Mensch wählt für sich aus der Vielfalt der visuellen Reize die aus, die ihm wichtig erscheinen. Was und wie viel jeder wahrnehmen möchte hängt von den eigenen Interessen und der jeweiligen Stimmung ab. Es ist das Ermessen jedes Einzelnen, wie seine Außenwelt wahrgenommen wird. Optische Sinneseindrücke werden demnach von der Netzhaut an die optischen Verarbeitungszentren im Hirnstamm weitergeleitet. Dort werden diese dann mit vestibulären, kinästhetischen und taktilen Informationen zueinander in Beziehung gesetzt. Diese Koordination der Informationen vermittelt Grundkenntnisse über das Umfeld und der Objekte darin.
In der heutigen Zeit ist der visuelle Sinn der am meisten beanspruchteste. Kinder sind durch die Nutzung der Vielfalt der Medien mit visuellen Reizen überschwemmt. Durch die schnelle Abfolge von Bildern wird ein aufmerksames Betrachten verhindert. Kinder können nicht mehr konzentriert etwas beobachten und diese Beobachtungen kommunizieren. Das führt in weiterer Folge zu einem verarmten Sprachgebrauch und zur Isolation.[27]
1.7.2.Der auditive Sinn
Dieses Sinnessystem hat besonders für die Musik große Bedeutung. Der Hörsinn ist bereits vor der Geburt aktiv und funktionstüchtig. Schallwellen werden in Form von Schwingungen in das Innenohr weitergeleitet. Dort werden sie in elektrische Impulse umgewandelt und über Nervenleitungen in den Hirnstamm transportiert, wo sie mit anderen sensorischen Bereichen gekoppelt werden. Dieses Sinnesorgan ermöglicht uns Klänge, Töne und Geräusche wahrzunehmen, zu differenzieren und zu interpretieren.
Es ist eine Orientierungshilfe in einer lärmgeprägten Welt, die sowohl auf leiseste Reize reagieren soll, wie auch auf hohe und lautstarke Geräusche. Das Wahrnehmen der Richtung, aus der der Schall hervortritt und das Orten der Entfernung sind Aufgaben des Sinns. Auch eine sich bewegende Schallquelle kann wahrgenommen werden und in einem Gewirr von Geräuschen entschlüsselt werden, z. B.: in der Klasse.
Das Hören erfordert viel Aufmerksamkeit und Zeit, um sich weiter entwickeln zu können. Es wird mit Inhalten versehen und erlangt in diesem Zusammenhang Bedeutung. Gehörte Worte verbinden sich, werden verstanden und können über die Sprache kommuniziert werden. Das Wechselspiel von Mitteilen, Hören und Wiedergeben endet in der Kommunikation.[28]
[...]
[1] Peter Brünger, Singen im Kindergarten, Augsburg 2003, S. 59.
[2] Vgl. Christoph Khittl, Die Musik fängt im Menschen an, Bern 2007, S. 19–25.
[3] Vgl. Christoph Khittl, S. 29–30.
[4] Vgl. Ulrike E. Jungmair, Das Elementare, Mainz 2010, S. 200–204.
[5] Vgl. Juliane Ribke, Elementare Musikpädagogik, Regensburg 2010, S.16.
[6] Ebenda, S. 17–18.
[7] Vgl. ebenda, S. 15–18.
[8] Vgl. ebenda, S. 19.
[9] C. Orff, „Gedanken über die Musik mit Kindern und Laien“, in Die Musik-Zeitschrift, 24. Jahrgang (1932), S. 6–7.
[10] Vgl. Ulrike E. Jungmair, Das Elementare, Mainz 2010, S. 2.
[11] C. Orff, „Gedanken über die Musik mit Kindern und Laien“, in Die Musik-Zeitschrift, 24. Jahrgang (1932), S. 6.
[12] Vgl. Ulrike E. Jungmair, Das Elementare, Mainz 2010, S. 201–202.
[13] Vgl. ebenda, S. 26–34.
[14] * 11. Dezember 1849; † 25. April 1926.
[15] Ellen Key, Das Jahrhundert des Kindes, Berlin 1926, S.34.
[16] Ulrike E. Jungmair, Das Elementare, Mainz 2010, S. 30.
[17] Ebenda, S. 29–34.
[18] Manfred Spitzer, Musik im Kopf, Stuttgart 2009, S. 174–197.
[19] Vgl. Herbert Bruhn, „Musikrezeption aus der Sicht der Musikwirkungsforschung“, in Gerhard Gensch, Eva Maria Stöckler, Peter Tschmuck (Hrsg.), Musikrezeption, Musikdistribution und Musikproduktion, Wiesbaden 2008, S. 57–82.
[20] Vgl. ebenda.
[21] * 22. Juni 1944; † 11. Juli 2011.
[22] Vgl. Hans Günther Bastian, Kinder optimal fördern- mit Musik, Mainz 2007, S. 76–82.
[23] http://www.dirk-bechtel.de/wiki/index.php/Bastian-Studie#Diskurs_und_Kritik (04.10.2015)
[24] Vgl. Wilfried Gruhn, Kinder brauchen Musik, Weinheim und Basel 2003, S. 80 – 83.
[25] Dorothée Kreusch-Jakob, Jedes Kind braucht Musik, München 2012, S. 11.
[26] * 9. Januar 1890; 1944; † 21. Dezember 1935.
[27] Vgl. Dorothée Kreusch-Jakob, S.16.
[28] Vgl. Manfred Spitzer, S. 55–63.
- Arbeit zitieren
- Susanne Freynschlag (Autor:in), 2015, Musik als ganzheitlich bildende Kraft im Entwicklungsprozess eines Kindes. Musikvermittlung in der Primarstufe, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/321885
Kostenlos Autor werden


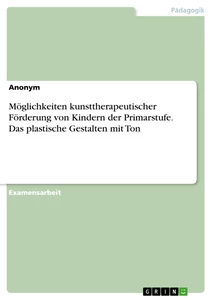














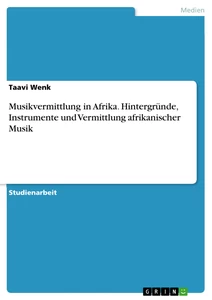


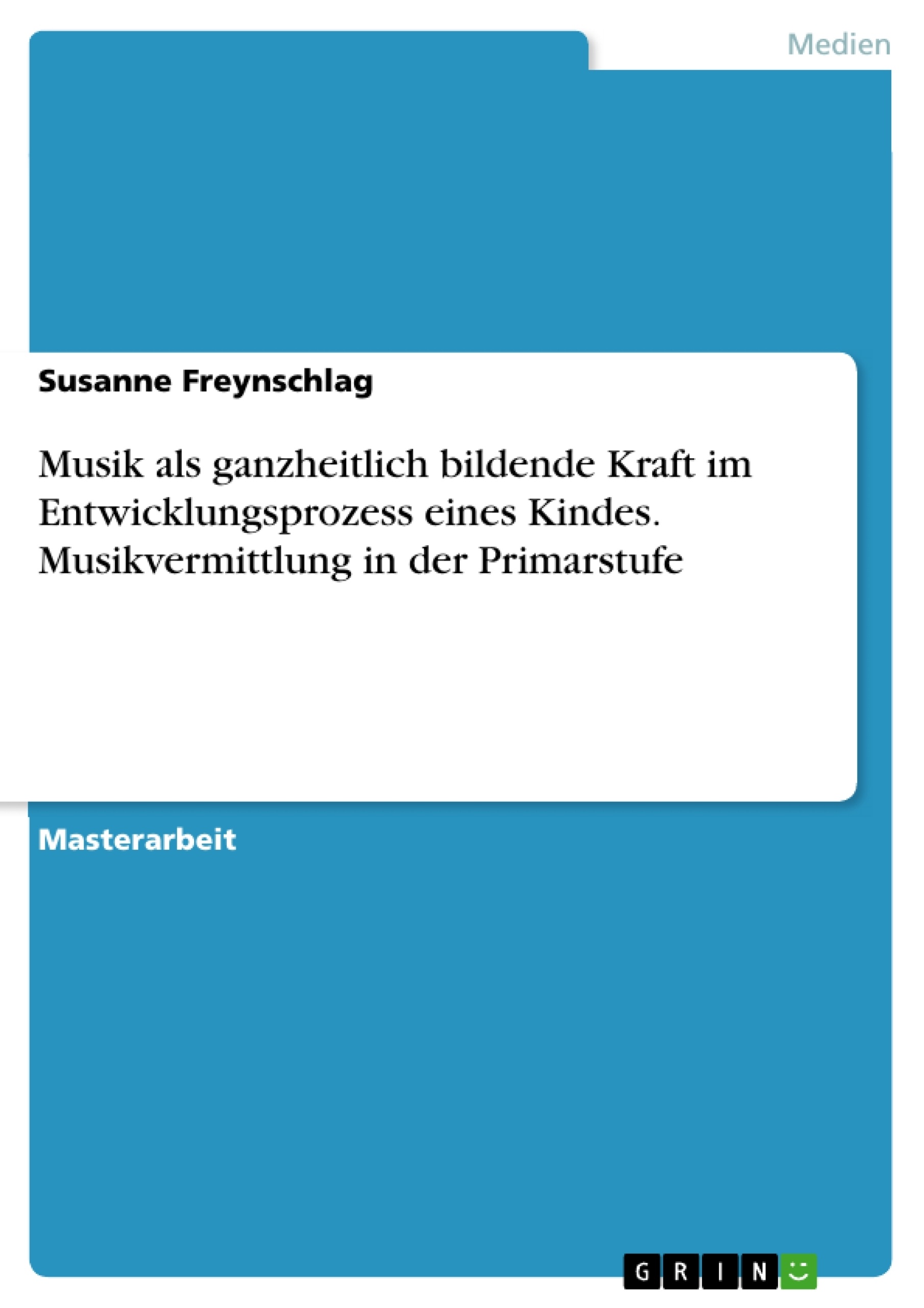

Kommentare