Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Partizipation in der Schule
2.1 Zur Definition des Behinderungsbegriffs
2.2 Der Weg zum gemeinsamen Lernen
2.3 Integration versus Inklusion
2.4 Konzepte zum Umgang mit Vielfalt in der Schule
3. Stand der inklusiven Entwicklung im Land Sachsen Anhalt
4. Kinder und Jugendliche mit Gefühls- und Verhaltensstörungen
4.1 Ausgangslage
4.1.1 Persönliche Dimension
4.1.2 Dimension des sozialen Umfelds
4.1.3 Gesellschaftliche Dimension
4.2 Begriffsklärung
4.3 Ursachen von Gefühls- und Verhaltensstörungen
4.4 Die Schule für Erziehungshilfe
4.4.1 Zielgruppe der Schule für Erziehungshilfe
4.4.2 Ziele und Aufgaben der Schule für Erziehungshilfe
4.5 Sonderpädagogischer Förderbedarf beim Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung
4.5.1 Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs
4.5.2 Formen sonderpädagogischer Förderung
5. Entwicklung eines Konzepts einer inklusiven Schule mit besonderer Berücksichtigung von Kindern und Jugendlichen mit Gefühls- und Verhaltensstörungen
5.1 Die Schule für Alle
5.1.1 Raum und Zeit
5.1.2 Beziehung
5.1.3 Schulleben
5.1.4 Profession
5.1.5 Ernährung
5.1.6 Gestaltung des Unterrichts
5.1.7 Benotung
5.1.8 Außerschulische Angebote
5.1.9 Kooperation
5.1.10 Neue Aufgabe der Diagnostik
5.2 Zusammenfassung
6. Schulentwicklung in der Praxis am Beispiel des Schulversuchs der Integrativen Gesamtschule Halle/Saale
6.1 Die Ausgangslage integrativer Entwicklungen
6.2 Rahmenbedingungen des Landesschulversuchs
6.3 Die Schulentwicklung während des Landesschulversuchs
6.3.1 Verlauf des Schulversuchs
6.3.2 Wissenschaftliche Begleitung
6.3.3 Ergebnisse des Schulversuchs aus Sicht der Schüler, Lehrer und Eltern
6.4 Fazit des Schulversuchs
7. Diskussion
Quellenverzeichnis
Literaturverzeichnis
Internetquellen
Filmquellen
1. Einleitung
Im Jahr 2009 hat die deutsche Regierung die UN-Behindertenkonvention der Vereinten Nationen unterschrieben und sich damit verpflichtet mehr Kinder und Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf in Regelschulen zu unterrichten und auch dort den individuellen Ansprüchen dieser Schülerinnen und Schüler gerecht zu werden. Das deutsche Schulsystem befindet sich demnach in einem Wandlungsprozess und muss sich mit neuen Herausforderungen auseinandersetzen.
Auch Kinder und Jugendliche mit Gefühls- und Verhaltensstörungen sind ein Teil dieses Prozesses und treten mit ihren Bedürfnissen und Anforderungen an die Institution Schule immer mehr in den Vordergrund. „Die Zahl der Kinder und Jugendlichen mit Verhaltensstörungen nimmt stetig, wenn auch nur langsam, im Bundesdurchschnitt, zu.“ (Mutzeck 2000, S. 11). Wer meint, diese Prognose von 2000 sei nicht mehr aktuell, irrt. Aktuelle statistische Erhebungen der Kultusministerkonferenz zeigen, dass diese Tendenz immer noch hochaktuell ist. Im Jahr 2010 wurden in Deutschland 486.600 Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf unterrichtet und davon 62.692 mit Gefühls- und Verhaltensstörungen (vgl. KMK 2012, III). Seit 2001 ist ein deutlicher Zuwachs an Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Bereich soziale und emotionale Entwicklung zu verzeichnen, nicht nur in Sachsen-Anhalt sondern im gesamten Bundesgebiet (vgl. KMK 2012, S. 25/ S. 29). Waren es statistisch gesehen 2001 noch 38.477 Schülerinnen und Schüler, so hat sich die Zahl 2010 fast verdoppelt. Hierbei handelt es sich um alle Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Bereich soziale- und emotionale Entwicklung unabhängig von Alter, Klassenstufe und Schulform. Es wird aber auch ein anderer Trend deutlich, denn nicht nur die Zahl der Schülerinnen und Schüler mit Sonderpädagogischem Förderbedarf im Bereich soziale und emotionale Förderung die in einer Förderschule unterrichtet werden steigt, sondern auch die Zahl der Kinder und Jugendlichen mit diesem Förderbedarf die in den Allgemeinen Schulen unterrichtet werden (vgl. KMK 2012, S. 3/ S. 10). Bei einer genaueren Analyse der Störungsformen wird erkennbar, dass neben externalisierenden Störungen (wie Hyperaktivität, Aggression, Delinquenz oder Aufmerksamkeitsstörungen), die in der öffentlichen Diskussion eine große Aufmerksamkeit erzielen, auch die internalisierenden Störungen(wie Angst- und depressive Störungen), eine hohe Verbreitung aufweisen (Esser & Ihle 2002, S. 163).
Die Frage nach einer effektiven Förderung sozialer- und emotionaler Kompetenzen sowie nach den Bedürfnissen dieser Kinder und Jugendliche gegenüber der Schule wird vor dem Hintergrund dieser aktuellen Statistiken und Tendenzen immer häufiger gestellt. Inklusion zählt genauso zu einer großen, pädagogischen Herausforderungen, wie der Umgang mit Kindern und Jugendlichen mit Gefühls- und Verhaltensstörungen. Bisher bestand die pädagogische Förderung unter anderem aus der Aufgabe Schüler und Schülerinnen im Entwickeln ihrer individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten zu unterstützen. Durch die Inklusion kristallisiert sich eine zweite Aufgabe heraus: die soziale Teilhabe.
Angesichts der aktuellen Debatte um Inklusion soll in dieser Arbeit eine gezielte Betrachtung der Anforderungen an die Institution Schule von Schülerinnen und Schülern im Hinblick auf soziale und emotionale Förderung vorgenommen werden. Das Ziel dieser Arbeit ist es herauszufinden welche konkreten Ansprüche Kinder und Jugendliche mit Gefühls- und Verhaltensstörungen aufgrund ihrer Lebenssituationen haben und welche Bedingungen sich daraus ergeben die in einer Schule geschaffen werden müssen um den Ansprüchen gerecht zu werden und ihnen eine angemessene schulische Umgebung zu bieten.
Die Betrachtungen zu diesem Thema beziehen sich auf die inklusive Entwicklung in Deutschland und im Speziellen auf die Entwicklung in Sachsen-Anhalt.
Die vorliegende wissenschaftliche Hausarbeit gliedert sich im Wesentlichen in vier Teile.
Im ersten Teil dieser Arbeit werde ich auf den Begriff und das Konzept Inklusion genauer eingehen. Dazu werde ich den Behinderungsbegriff erläutern und anschließend das Konzept der Inklusion vom Konzept der Integration abgrenzen. Rechtliche Grundlagen dieses Konzepts sowie die verschiedenen Formen schulischer Inklusion werden diskutiert. Abschließend erfolgt eine genaue Betrachtung des Standes der inklusiven Entwicklung in Sachsen-Anhalt.
Im zweiten Teil der Arbeit werden die Lebenslagen von Kindern und Jugendlichen mit Gefühls- und Verhaltensstörungen genau analysiert und dargestellt. Ausgehend von den Lebenswelten der Kinder und Jugendlichen wird versucht den umstrittenen Begriff Gefühls- und Verhaltensstörungen zu klären und die Ursachen von Gefühls- und Verhaltensstörungen werden besprochen. Im Anschluss wird die Schule zur Erziehungshilfe vorgestellt, denn diese Schule ist auf den Umgang mit Schülerinnen und Schülern mit dem Förderschwerpunkt soziale und emotionale Entwicklung spezialisiert. Aus dem Konzept dieser Schule lassen sich viele Informationen über die Bedürfnisse dieser Kinder und Jugendlichen ableiten. Dazu werden neben der Zielgruppe auch die Ziele und Aufgaben der Institution betrachtet.
Auf Grundlage der vorangegangenen Erkenntnisse und Betrachtungen wird im dritten Abschnitt dieser Arbeit ein eigenes Konzept für eine inklusive Schule entwickelt. Dieses Konzept orientiert sich vor allem an den besonderen Bedarfslagen der Kinder und Jugendlichen mit Gefühls- und Verhaltensstörungen und soll die Frage klären, welche speziellen Bedingungen in einer inklusiven Schule für diese Schülerinnen und Schüler geschaffen werden müssen um ihren Ansprüchen gerecht zu werden.
Da dieses entwickelte Konzept in der Realität aber nicht nachprüfbar ist und sich lediglich am Idealzustand orientiert, wird das Schulkonzept und damit verbunden der Landesschulversuch der IGS-Halle/Saale im vierten Teil der Arbeit untersucht. Die Ergebnisse dieses Landesschulversuchs sollen genutzt werden um das eigene erarbeitete Schulkonzept mit Praxiserfahrungen zu überarbeiten.
Abschließend folgt eine Diskussion der wesentlichen Erkenntnisse.
2. Partizipation in der Schule
Menschen mit einer Behinderung treten zunehmend mit ihren Forderungen nach Selbstbestimmung, Gleichstellung und Teilhabe an die Öffentlichkeit, was zusätzlich durch rechtliche Bestimmungen wie das Diskriminierungsverbot des Grundgesetzes, das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, die Gleichstellungsgesetze in Bund und Ländern und das Übereinkommen über die Rechte behinderter Menschen der Vereinten Nationen unterstützt wird. Dieser Trend wird nicht nur in der Gesellschaft deutlich, sondern damit verbunden auch im System Schule. Somit erhält auch die Schule eine neue Aufgabe: allen Schülerinnen und Schülern die gleiche Teilhabe am schulischen Alltag ermöglichen.
2.1 Zur Definition des Behinderungsbegriffs
Da ich im Folgenden sehr oft von Behinderung sprechen werde, möchte ich diesen Begriff zunächst ausführlich besprechen.
Genau definiert wird der Begriff der Behinderung in § 2 BGG LSA darin heißt es: „Menschen mit Behinderungen […] sind Menschen mit nicht nur vorübergehenden körperlichen, seelischen, geistigen oder Sinnesbeeinträchtigungen, die sie in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft hindern können. Als nicht nur vorübergehend gilt ein Zeitraum von mehr als sechs Monaten“ (BGG LSA 2010, §2).
Im Vordergrund dieser Definition steht der Zusammenhang zwischen der Schädigung und den dadurch verursachten Beeinträchtigungen. Diese Definition bezieht alle Arten von Behinderung mit ein. Die Dauerhaftigkeit, die in der Definition zum Tragen kommt, und die damit verbundenen Einschränkungen im Alltag unterscheidet eine Behinderung von einer Krankheit. Eine Störung hingegen (z.B. Verhaltensstörung oder Lernstörung) ist partiell (auf einen Bereich begrenzt z.B. Verhalten oder Lernen), weniger schwerwiegend als eine Behinderung (tritt in nicht so vielen Lebensbereichen auf) und ist oftmals zeitlich begrenzt.
2.2 Der Weg zum gemeinsamen Lernen
Jahrhunderte lang wurden Menschen mit Behinderung und psychischen Erkrankungen aufgrund von Aberglauben, Religion oder Unwissenheit aus dem gesellschaftlichen Leben ausgegrenzt und separiert. Trotzdem zeigen einige wenige Beispiele wie die Belgische Kleinstadt Geel, dass die soziale Integration kein Phänomen der Neuzeit ist. Mit Beginn der Aufklärung änderte sich langsam das Bild über Menschen mit Behinderung. Im Werk "Didactica magna" erklärte Comenius erstmals, dass alle Kinder zu unterrichten sind. Der Pädagoge Pestalozzi setzte sich erstmals für die Erziehung schwacher Kinder ein und versuchte Heimplätze für verwahrloste und behinderte Kinder zu schaffen (vgl. Speck 1998, S. 14). In den Zeiten des Nationalsozialismus in Deutschland wurden Menschen mit Behinderung verfolgt und systematisch getötet. Nach dem Ende des 2. Weltkrieges 1945 hört die Verfolgung zwar auf, an ein Bildungskonzept für Alle ist hier trotzdem noch nicht zu denken. Menschen mit Behinderung wurden auch nach dem 2. Weltkrieg im geteilten Deutschland teilweise in Heimen oder Anstalten unter unzumutbaren Bedingungen untergebracht, wie das berühmte Beispiel der „Hölle von Ückermünde“ (vgl. Klee 1993) zeigte.
Hauptsächlich Elterninitiativen sorgen in den 70er und 80er Jahren des 20. Jahrhunderts dafür, dass behinderte Kinder auch in allgemeinen Schulen unterrichtet werden. Die Empfehlungen des Deutschen Bildungsrates von 1973 wurden zwar mit dem Ziel veröffentlicht Möglichkeiten und Grenzen eines gemeinsamen Unterrichts auszuloten um die parallel verlaufenden Schulsysteme der Sonder- und der Regelschule einander näher zu bringen(vgl. Speck 2010, S.31), führten aber nicht zu dem gewünschten Ziel.
Eine Wende in der Geschichte der Sonderpädagogik zeichnet sich erst 1994 an, als die Kultusministerkonferenz die „Empfehlungen zur sonderpädagogischen Förderung in den Schulen in der Bundesrepublik Deutschland“ herausbrachte, durch die der sonderpädagogische Förderbedarf nicht mehr institutionell an die Sonderschule gebunden war (vgl. KMK 1994, I). Die Bildung behinderter Kinder und Jugendlichen wird laut KMK nun zukünftig als gemeinsame Aufgabe der Sonderpädagogik und der allgemeinen Pädagogik angesehen. Aber auch diese Empfehlungen führten nicht dazu, dass Kinder und Jugendliche ganz selbstverständlich in einer Regelschule unterrichtet werden. Es entwickelte sich ein „Entweder-Oder-System“ (vgl. Heimlich/Jacobs 2001, S.11). Zunächst prüfte man ob eine Beschulung in der allgemeinen Schule möglich ist, war das nicht der Fall wurde das Kind in die Förderschule eingeschult.
Der stärkste Antrieb für die Inklusionsbewegung war wohl die UN-Behindertenrechtskonvention im Jahr 2009 die ein Menschenrecht auf „inklusive Bildung“ verankerte und somit auch die inklusive Entwicklung in Deutschland vorantrieb. Mit dieser Menschenrechtskonvention erklären sich alle Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen (auch Deutschland) bereit die Menschenrechte aller Menschen (auch Menschen mit Behinderung) anzuerkennen und zu sichern, sowie Benachteiligungen und Diskriminierungen gegenüber Menschen mit Behinderung zu verhindern. Zum ersten Mal wird mit dieser UN-Konvention ein völkerrechtlicher Vertrag geschlossen, der speziell Menschenrechte von Behinderten betrifft. In diesem Fall kann von einem beispiellosen Ereignis gesprochen werden. Im Vordergrund sollen fortan nicht mehr nur die soziale Fürsorge und die Rehabilitation von Menschen mit Behinderung stehen, sondern Gleichberechtigung, Selbstbestimmung und die soziale Teilhabe (vgl. Deutsches Institut für Menschenrechte 2012). Diese Konvention soll auch die Rechte von Schülerinnen und Schülern mit Behinderung und von Eltern mit behinderten Kindern stärken, wenn es um die Auswahl des Schulortes geht.
2.3 Integration versus Inklusion
Das Wort Integration stammt vom Wortursprung her aus dem lateinischen “integratio“, was so viel bedeutet wie „Herstellung eines Ganzen“ oder „Zusammenschluss“(vgl. Speck 2010, S. 18). Das ursprüngliche Ziel der Integration ist die "Überwindung aussondernder Einrichtungen sowie deren pädagogischer Konzeptionen zugunsten gemeinsamen Lernens und Lebens" (Eberwein 1997, S. 55). Das Festhalten an der Aussonderung „behinderter“ Kinder in Sonderschulen ist daher nicht vertretbar (Eberwein 1997, S. 66).
Die „Zielgruppe“ von Integration sind aber schon lange nicht mehr nur behinderte Menschen die in das Leben mit nicht-behinderten Menschen integriert werden sollen. Auch die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund wird in diesem Zusammenhang diskutiert.
Im Vordergrund der Integrationspädagogik steht die gesellschaftliche Teilhabe über Institutionen und Anbieter der beruflichen Rehabilitation hinaus und die soziale Teilhabe aller Menschen mit Behinderungen oder gesundheitlichen Einschränkungen einschließlich anderer Randgruppen. Genauer geht es im schulischen Kontext um die Eingliederung behinderter Kinder in die allgemeine Schule. Diese Eingliederung geht einher mit speziellen Differenzierungssystemen je nach Schädigung, Schaffung besonderer Ressourcen für Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarf, Sonderpädagogischer Unterstützung und der Kontrolle durch Experten (vgl. Boban/Hinz 2003, S. 5). Es wird deutlich, dass die Integration an einer Zwei-Gruppen-Theorie festhält. Trotz der Integration eines behinderten Kindes in eine Regelschulklasse, wird eine Ausgrenzung durch verschiedene Organisationsformen vorgenommen. Die Eingliederung erfolgt hier meist nur auf institutioneller Ebene.
Integration stellt hier aber keineswegs das Ziel bzw. das Ende dar, sondern einen Prozess(vgl. Hinz 1990, S. 4). Integrative Prozesse lassen sich laut Klein in fünf verschiedene Ebenen einteilen. Diese sind die innerpsychische, interaktionelle, didaktisch- methodische, institutionelle und normative Ebene (vgl. Hinz 1990, S. 4). Besonders im Vordergrund steht hierbei die innerpsychische Ebene, denn sie bildet die Grundlage und somit wären alle Wirkungen der anderen Ebenen ohne Erfolg. Im Vordergrund dieser Ebene steht die Wahrnehmung über sich selbst und die eigene Behinderung. Die interaktionelle Ebene, welche die Grundlage für die didaktisch- methodische Ebene, also das Unterrichtskonzept, ist, beschäftigt sich mit dem Umgang mit sich selbst und der Umwelt. Die institutionelle Ebene hingegen geht nicht mehr von dem Menschen selbst aus, sondern von den administrativen Rahmenbedingungen des Lernortes. Bei der normativen Ebene steht hingegen die Umwelt mit ihrer Wertorientierung im Vordergrund. Alle diese Aspekte haben Einfluss darauf, wie gut eine Person in eine Gruppe und die Gesellschaft integriert werden kann und wenn eine dieser Ebenen auch geringe Fehler ausweist, so liegen der Integration große Hindernisse im Weg, die in der nächsten Zeit aus dem Weg geräumt werden müssen, um über das Ziel der Integration hinaus zu gehen. Das Konzept der Inklusion dagegen stellt die Frage nach den verschiedenen Ebenen dieses Prozesses gar nicht mehr, denn Inklusion ist kein Prozess des Einfügens, sondern des Umdenkens und Akzeptierens.
Doch unterscheidet sich das Konzept der Inklusion wirklich vom Konzept der Integration? Otto Speck kritisiert „Während die einen von einer „Schule für alle“ träumen und dies mit der Abschaffung der Förderschulen gleichsetzen, ersetzen andere lediglich das Adjektiv „integrativ“ durch „inklusiv“ und gedenken, den bisherigen „integrativen“ Kurs fortzuführen bzw. zu optimieren.“ (Speck 2010, S. 7). Aus diesem Grund ist es besonders wichtig beide Begriffe genau voneinander abzugrenzen.
Seit etwa den 1990er Jahren wird der Integrationsbegriff maßgeblich durch den Inklusionsbegriff abgelöst (vgl. Speck 2010, S. 56). Der Begriff „Inclusion“ wird in der internationalen Debatte schon seit der Salamanca-Konferenz von 1994 verwendet, die zur wesentlichen Verbreitung des Sprachgebrauchs beigetragen hat (vgl. Sander 2002, S.144). Steckt hinter dem neuen Begriff nun nur die deutsche Anpassung an internationale Standards oder eine Überarbeitung des Integrationskonzepts. Die Kritik am Integrationskonzept ist groß und soll mit dem neuen Begriff überwunden werden. Die Integration finde nur auf institutioneller Ebene statt, verharre in der Zwei-Gruppen-Theorie und leiste nicht mehr als die Zuweisung von sonderpädagogischem Förderbedarf und die damit verbundene Ressourcenzuweisung (vgl. Boban/Hinz 2003, S. 4). Seit der Einführung des Integrationskonzepts durch den Deutschen Bildungsrat 1973 kam es nicht zur erhofften Herstellung einer integrativen Bildungslandschaft, sondern eher noch zu einer Ausgrenzung auf einer neuen Ebene(vgl. Speck 2010, S. 57). Der Gemeinsame Unterricht hat sich nicht wie erhofft zu einem ersetzenden System etabliert, sondern ist zu einem ergänzendem System geworden (vgl. Boban/Hinz 2003, S.3). Die Entwicklung Schritt nicht voran, weil die Sonderpädagogik versuchte „von außen“ auf das allgemeine Schulsystem einzuwirken (vgl. Speck 2010, S.56). Der Inklusionsansatz erhofft sich dieses Problem zu überwinden indem er das Schulsystem als Ganzes verändert.
Die neue Begrifflichkeit soll die alten Probleme überwinden und nicht nur zu einer Umstrukturierung des Schulsystems führen, sondern zu einem Umdenken der Gesellschaft. Viele positive Ideen der Integration wie das gemeinsame Leben und Lernen werden im Inklusionsgedanken fortgesetzt und es wird versucht alte Fehler zu bereinigen.
Inklusion heißt die Heterogenität willkommen heißen und als Normalität ansehen. Die wichtigste Erweiterung im Inklusionsbegriff gegenüber dem Integrationsbegriff findet sich darin, dass nun alle Kinder mit ihren individuellen Bedarfslagen in den pädagogischen Vordergrund treten und nicht nur Kinder mit einer Behinderung. Es soll eine Lernumgebung der Akzeptanz, Toleranz und Solidarität gegründet werden. Ziel der Inklusion ist es nicht den Schüler oder die Schülerin mit Behinderung zu integrieren, ihm oder ihr einen Förderbedarf zuzuweisen um im Anschluss bestimmte Ressourcen zu mobilisieren, sondern es sollen Ressourcen für alle Kinder einer Klasse bereitstehen damit alle gemeinsam lernen und leben können. Ziel der Inklusion ist die Entwicklung einer „Schule für Alle“(vgl. Hinz 2002, S. 359). Dieses Verständnis von Inklusion wird für die folgende Ausarbeitung dieser Arbeit übernommen. Durch diese Begriffsauffassung ist es eigentlich nicht mehr nötig von Behinderung oder von Kindern und Jugendlichen mit Störungen zu sprechen, da jedes Kind und jede/r Jugendliche/e individuell nach den jeweiligen Voraussetzungen unterrichtet wird. Da es sich jedoch um eine Arbeit handelt die Kinder und Jugendliche mit speziellen Bedarfslagen in das Zentrum der Betrachtungen rückt, wird fortan trotzdem nicht auf den Begriff verzichtet.
Der Weg zur Inklusion ist lang und sollte bereits im Kindesalter Eingang in den Alltag bekommen. Alfred Sander hat deshalb die Entwicklung hin zur Integration in fünf Etappen eingeteilt (vgl. Sander 2001, S.144ff). Das Modell dient der Beobachtung von schulischer Förderung. Der Ausgangspunkt sei laut Sander die Exklusion, also der Ausschluss von Menschen mit Behinderung aus dem Bildungssystem (wie in Abschnitt 2.2 bereits beschrieben), danach folgt die Segregation, was getrennte Bildungswege von behinderten und nichtbehinderten Menschen beschreibt. Die nächste Phase ist die Integration, welche die aktive Aufnahme Behinderter in die „normalen“ Bildungseinrichtungen meint. Die Inklusion hingegen geht vom „selbstverständlichen Vorhandensein aller, die gleich und unterschiedlich sind und die einen Anspruch haben, als Gleichgestellte partizipieren zu können und anerkannt zu werden. Hier ist eine fixierte allgemeine Normalität nicht mehr vorhanden.“ (Boban/Hinz 2003, S. 7). Als Zukunftsszenario schlägt er vor der allgemeine Pädagogik zu folgen, in der es keine spezifischen Ansätze und Konzepte für Behinderte und Nichtbehinderte mehr gibt.
Inklusion verzichtet auf die Zwei-Gruppe-Theorie (im Vergleich zur Segregation), wobei die Unterschiede der Schülerinnen und Schüler nicht ignoriert, sondern als normal wahrgenommen werden sollen. In einer inklusiven Schulpraxis bedeutet das, dass jedes Kind von vornherein ein Teil der Gruppe ist und es nicht erst werden muss. Inklusion bezieht sich aber nicht nur auf den schulischen Bereich und auf Menschen mit einer Behinderung, sondern auf alle gesellschaftlichen Minderheiten(vgl. Hinz 2002, S. 359). Die Gesellschaft bzw. das System muss verändert werden und nicht der Einzelne.
Um die Entwicklung hin zur Inklusion in Gang zu bringen, spielen drei Dimensionen eine Rolle: die inklusiven Kulturen, Strukturen und Praktiken, die aus dem Index für Inklusion stammen (vgl. Boban/Hinz 2003, S. 9). Wichtig ist hierbei, dass das gesamte Umfeld betrachtet wird und Inklusion nicht nur auf zum Beispiel den Bereich der Bildung beschränkt ist. Die erste Dimension geht von allen Mitgliedern der Bildungseinrichtung aus, wobei eine sich gegenseitig achtende und akzeptierende Gemeinschaft entstehen solle, die individuell bestmögliche Leistungen erzielen solle (vgl. Boban/Hinz 2003, S. 9). Beim Aufbau inklusiver Strukturen hingegen sollen sich die Lern- und Partizipationsräume aller Schülerinnen und Schüler erweitern, indem aus ihrer Sichtweise alle Arten von Unterstützung in einen Rahmen gebracht werden. Um inklusive Praktiken zu schaffen, sollen die anderen zwei Ebenen zusammengebracht werden und so „Aktivitäten innerhalb und außerhalb[…] [der Schulräume] die Partizipation aller […] [Schülerinnen und Schüler] anregen und ihre Stärken, ihre Talente, ihr Wissen und ihre außerschulische Erfahrungen einbeziehen.“ (Boban/Hinz 2003, S. 9).
„Wenn wir über "Integrationsklassen" reden, haben wir das Bild im Kopf, dass es auch andere, dass es auch "normale" Klassen gibt. Wenn wir von "Integration" reden, haben wir im Kopf, dass es auch die Segregation gibt. Wenn wir von "Sonderpädagogischem Förderbedarf" reden, wissen wir, dass es Kinder mit und ohne Sonderpädagogischem Förderbedarf gibt. Wenn wir von Sonderpädagogik reden, wissen wir, dass es auch die sogenannte Allgemeine Pädagogik gibt.“ (Wilhelm/ Bintinger 2001, S.44). Daher sollten sowohl Integration als auch Inklusion – und das haben beide Begriffe gemeinsam - als Übergangsbegriffe von der Segregation hin zur Vielfalt als „Normalfall“ verstanden werden.
Boban und Hinz fassen zusammen, dass es bei beiden Konzepten – Integration und Inklusion – darum geht einen Weg hin zur allgemeinen Pädagogik zu finden und beide Konzepte somit den Weg dorthin darstellen (vgl. Boban/Hinz 2003, S. 7).
2.4 Konzepte zum Umgang mit Vielfalt in der Schule
Bevor wir Formen schulischer Inklusion betrachten ist es zunächst einmal wichtig zu klären, wie eine Schule diese Formen entwickelt. Grundlage für die inklusive Schulentwicklung in Deutschland ist der Index für Inklusion.
Die drei Dimensionen die Boban und Hinz vorgeben um Inklusion zu entwickeln wurden bereits (vgl. Punkt 2.3) besprochen und dienen als Grundlage weiterer Ausführungen.
„Ein inklusiver Unterricht trägt der Vielfalt von unterschiedlichen Lern-und Leistungsvoraussetzungen der Kinder und Jugendlichen Rechnung. Alle Kinder und Jugendlichen erhalten Zugang zu den verschiedenen Lernumgebungen und Lerninformationen. Es werden die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass sie sich über eine Vielfalt an Handlungsmöglichkeiten selbstbestimmt und selbstgesteuert in ihren Entwicklungsprozess einbringen. „(KMK 2011, S. 9). Der Beschluss der Kultusministerkonferenz von 2011 manifestiert außerdem Eckpunkte inklusiven Unterrichts. So soll das Konzept des handlungsorientierten und ganzheitlichen Unterrichts verwirklicht werden, individuellen Kompetenzen der Lernenden gefördert und die Aktivität und Teilhabe in einem barrierefreien Unterricht gewährleistet werden. Inklusiver Unterricht soll dabei nach den Standards und Zielsetzungen für die allgemeinen schulischen Abschlüsse ablaufen und durch Individuelle Lernplanungen und Förderpläne unterstützt werden(vgl. KMK 2011, S. 9ff).
Aufgrund des Föderalismus in Deutschland gibt es kein einheitliches Konzept, wie inklusiver Unterricht in Schulen umgesetzt wird. Daher haben sich im Laufe der Zeit die verschiedensten Formen von inklusivem Unterricht entwickelt. Diese verschiedenen Unterrichtsformen lassen sich außerdem als Ergebnis von verschiedenen Potentialen auffassen und zeigen wie mit Vielfalt in Deutschland umgegangen wird. Im Folgenden möchte ich vier Formen vorstellen, die sich in den letzten Jahren entwickelt haben. Es gibt natürlich noch viele andere Formen inklusiven Unterrichts und auch die drei vorgestellten Formen werden auf die vielfältigste Weise umgesetzt, trotzdem beschränke ich mich auf die Betrachtung von Inklusionsklasse, Regelklassen mit sonderpädagogischer Unterstützung und die Kooperationsklassen.
Integrationsklassen
Bei Integrationsklassen handelt es sich um Regelklassen in allgemeinbildenden Schulen, die einen oder mehrere Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf aufnehmen. Häufig wird in diesen Klassen die Anzahl der Schülerinnen und Schüler minimiert. Die Kinder werden zum großen Teil im Zwei-Pädagogen-System unterrichtet, d.h. ein Regelschul- und ein Sonderschullehrer arbeiten gemeinsam als Team mit den Schülerinnen und Schülern zusammen. Dieses Konzept kommt auch im Schulversuch der IGS-Halle/Saale zum Einsatz über das im Abschnitt 6 berichtet wird.
Regelklassen mit sonderpädagogischer Unterstützung
Der Unterschied einer Regelklasse mit sonderpädagogischen Unterstützung zu einer Integrationsklasse ist, dass hier die sonderpädagogische Unterstützung extern angegliedert ist. Das heißt das es keinen Sonderschulpädagogen gibt der gemeinsam mit dem Regelschullehrer unterrichtet, sondern es wird mit Beratungseinrichtungen, Förderzentren oder externen Sonderschullehrern kooperiert. Die Hilfen für die Kinder und Jugendlichen mit Sonderpädagogischem Förderbedarf stehen also nicht täglich zur Verfügung.
Kooperationsklasse
Es gibt auch Förderschulklassen die zu einer Regelschule gehören. Das bedeutet dass eine Klasse vollständig aus Kindern mit Sonderpädagogischem Förderbedarf (meist der gleichen Behinderungsart) besteht und in einer Regelschule von einem Sonderpädagogen unterrichtet wird. Die räumliche Nähe soll zu einer einfachen Kooperation zwischen der Sonderschulklasse und den Regelschulklassen führen(vgl. Kultusministerium des Landes Sachsen-Anhalt, Modellversuch, S. 103). Diese Kooperationsklassen bieten die dauerhafte „Betreuung“ durch einen Sonderpädagogen/Sonderpädagogin und schaffen Kontakt zwischen SchülerInnen mit und ohne Sonderpädagogischem Förderbedarf.
Diese drei Formen des Unterrichts haben sich im Zuge der Inklusion zwar entwickelt und sind so oder in abgewandelter Form in Schulen in Deutschland anzutreffen, entsprechen aber offensichtlich nicht dem Kerngedanken der Inklusion, denn in allen drei Formen kommt es immer noch zu einer Sonderstellung der Kinder und Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf.
Gemeinsamer Unterricht
Der gemeinsame Unterricht zeichnet sich dadurch aus, dass Schülerinnen und Schüler mit und ohne Behinderung gemeinsam lernen. Der gemeinsame Unterricht wurde als Antwort auf den UN-Behindertenrechtskonvention entwickelt. Kinder und Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf bekommen durch den gemeinsamen Unterricht die Möglichkeit in einer allgemeinen Schule mit sonderpädagogischer Unterstützung unterrichtet zu werden. Durch individuelle Unterrichtsziele und –inhalte und -formen, die Unterstützung von ausgebildeten, qualifizierten Lehrkräften und die inhaltliche, methodische und organisatorische Einbeziehung pädagogischer Maßnahmen wird für alle Schülerinnen und Schüler eine optimale Förderung gewährleistet (vgl. KMK 1994, S. 14). Um die Schülerinnen und Schüler mit Unterstützungsbedarf zu fördern, wird von den Pädagogen ein Förderplan für das jeweilige Kind erstellt indem alle Förderziele und Maßnahmen festgehalten werden. Im gemeinsamen Unterricht können sowohl Abschlüsse der allgemeinbildenden Schule als auch Abschlüsse des jeweiligen Förderschwerpunkts absolviert werden.
Nur das Konzept des gemeinsamen Unterrichts wird dem Inklusionsgedanken gerecht und beachtet die Bedürfnisse aller Schülerinnen und Schüler im Unterricht. Die anderen Konzepte sind Ergebnisse von den Schulentwicklungen der letzten Jahre, entsprechen aber im Kern nicht dem Inklusionsgedanken.
3. Stand der inklusiven Entwicklung im Land Sachsen Anhalt
Bis 2008 hatte Sachsen-Anhalt die höchste Förderschulquote im gesamten Bundesgebiet und im Jahr 2008/09 belegt Sachsen-Anhalt mit 8,6% einen der hinteren Plätze im Ranking der Inklusionsanteile der Kinder mit sonderpädagogischen Förderbedarfslagen (vgl. Kultusministerium des Landes Sachsen-Anhalt, Modellversuch, S. 7). Andreas Hinz hat im Länderbericht zur Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen einen Blick auf den Bildungsbereich Sachsen-Anhalts geworfen und kritisch zusammengefasst, dass die Entwicklung des Gemeinsamen Unterrichts zwar „von niedrigem Niveau aus kontinuierlich zunimmt, wenngleich vor allem im Grundschulbereich und mit zielgleicher Ausrichtung“ (Hinz 2011), dass die Bemühungen zur Umsetzung der UN-Behindertenkonvention hierzulande jedoch insgesamt mit der Befürchtung verbunden seien, nur eine begrenzte Tragweite zu haben.
Da die Bundesrepublik Deutschland durch den Föderalismus geprägt ist, ist es jedem Bundesland selbst überlassen ein eigenes Inklusionskonzept für den Bereich Schule zu erarbeiten. Das Konzept „Gemeinsamer Unterricht als Baustein inklusiver Bildungsangebote„ des Landes Sachsen Anhalt folgt dem Auftrag der Bundesregierung „§1 Abs. 2 des SchulG durch geeignete Maßnahmen, die Benachteiligung von Menschen mit Behinderung auszugleichen und für sie eine gleichberechtigte Teilhabe zu ermöglichen“ (Günther 2013, S. 3) und damit verbunden den Richtlinien der UN-Behindertenkonvention.
Die Etablierung des Gemeinsamen Unterrichts in allgemeinbildenden Schulen soll laut dem Konzept des Landes durch die flexible Schuleingangsphase, einen Stundenpool, den Mobilen Sonderpädagogischen Diagnostischen Dienst und die Aus-, Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte gesichert werden (vgl. Günther 2013, S. 7).
In der flexiblen Schuleingangsphase sollen alle schulpflichtigen Schülerinnen und Schüler eingeschult werden und dort eine individuelle Förderung erhalten. Kinder können je nach ihren Lernbedingungen und Lernfortschritten zwischen 1 und 3 Jahre in dieser Eingangsphase bleiben. Für den gemeinsamen Unterricht wurde vom Land Sachsen-Anhalt ein sogenannter Stundenpool eingerichtet. Das heißt eine Regelschule erhält für die Kinder mit Sonderpädagogischem Förderbedarf die im gemeinsamen Unterricht unterrichtet werden einen bestimmten Stundensatz an Unterstützung (meist von einem Sonderschulpädagogen) die die Schule individuell für ihre Bedürfnisse nutzen kann. Der Mobile Sonderpädagogische diagnostische Dienst ist weiterhin für die Anfragen von Schulen zuständig, wenn es um die Beratung oder um die Feststellung sonderpädagogischen Förderbedarfs geht. Durch Aus-, Fort- und Weiterbildungsangebote soll es auch Lehrkräften möglich sein sich Sonderpädagogische Kompetenzen anzueignen und sich über neue Konzepte der Inklusion zu informieren.
Verbindlich für alle Bundesländer ist außerdem der Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 20.10.2011, welcher die inklusive Bildung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung in Schulen regelt. Auch dieser Beschluss orientiert sich an den Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen. Ziel ist es allein einen gleichberechtigten Zugang zu Bildung zu verschaffen und Barrieren zu überwinden (vgl. KMK 2011, S. 3). Es wird als eine grundsätzliche Aufgabe angesehen sich an den individuellen Voraussetzungen der Kinder und Jugendlichen zu orientieren und an ihnen die Schule auszurichten.
Der Modellversuch „Grundschulen mit Integrationsklassen“ der Schuljahre 2009/10 und 2010/11 im Land Sachsen-Anhalt, der vom Kultusministerium Sachsen-Anhalt initiiert wurde, versuchte Handlungskonzepte zu gewinnen um die Inklusion im Land umzusetzen. Es ging in diesem Versuch nicht darum zu klären ob es möglich ist alle SchülerInnen gemeinsam zu unterrichten, sondern unter welchen Bedingungen es möglich ist, damit ein effektives Lern- und Unterstützungsangebot geschaffen werden kann (vgl. Kultusministerium des Landes Sachsen-Anhalt, Modellversuch, S. 16). Außerdem soll sichergestellt werden, dass Teilhabe- und Entwicklungschancen gewährleistet sind.
Um diese Informationen zu erhalten nahmen von Beginn des Schuljahres 2009/10 bis Ende des Schuljahres 2010/11 insgesamt 22 ausgewählte Grundschulen und somit 144 Kinder mit Sonderpädagogischem Förderbedarf im Land Sachsen-Anhalt am Modelversuch teil. Die Grundschulen mussten eine mehrjährige Erfahrung im Gemeinsamen Unterricht bzw. in der Arbeit mit Kooperationsklassen nachweisen. In den Grundschulen musste es außerdem mindestens 1 Integrationsklasse mit 3-5 Kindern mit Sonderpädagogischem Förderbedarf geben (Maximalschülerzahl 18) und die Schule musste mit mindestens einem regionalen Förderzentrum kooperieren. Während des Modellversuchs erhielten die Grundschulen zusätzliche Unterstützung in Form einer Förderschullehrkraft (10h/Woche), Angebote zur Weiterbildung für das Lehrpersonal, Konsultations- und Beratungsstützpunkte wurden eingerichtet und die Lehrkräfte wurden wissenschaftlich begleitet (vgl. Kultusministerium des Landes Sachsen-Anhalt, Modellversuch, S. 16).
Die Erhebung der Ergebnisse fand über verschiedene Fragebögen, die Methode des kreativen Feldes, ergebnisorientierter Meinungs- und Erfahrungsaustausch während der Fortbildungsangebote und die Erfahrungsberichte von Schulleitern und LehrerInnen statt. Durch eine Checkliste wurde außerdem die Barrierefreiheit der Schulen getestet und somit Entwicklungspotenzial festgestellt (vgl. Kultusministerium des Landes Sachsen-Anhalt, Modellversuch, S. 29).
[...]
- Arbeit zitieren
- Maria Schmidt (Autor:in), 2013, Ausgewählte Konzepte von Inklusion in der schulischen Praxis. Wie können Kinder und Jugendliche mit Gefühls- und Verhaltensstörungen bestmöglich gefördert werden?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/321429
Kostenlos Autor werden












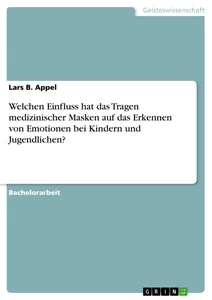









Kommentare