Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Forschungsstand und Theorie
2.1 Wortschatz
2.1.1 Begriff und Forschungsstand
2.1.2 Mentales Lexikon
2.1.3 Wortschatzarbeit
2.1.4 Modelle der Wortschatzvermittlung: Textorientierte Wortschatzarbeit und wortschatzdidaktischer Dreischritt
2.2 Schülermotivation
2.2.1 Motivation
2.2.2 Lernmotivation
2.2.3 Motivation und Emotion
2.2.4 Interesse
2.3 Kompetenzfeld Wortschatzarbeit im Rahmen der Kompetenzvorgaben, erfasst auch in der didaktischen Literatur
2.4 Praxis der Wortschatzarbeit im konkreten Fall
2.4.1 Analyse der schulinternen Lehrpläne
2.4.2 Wortschatzarbeit im Grundkurs Deutsch Jahrgangsstufe 9 der GM – Gesamtschule
2.5 Theoretisches Modell der Fallstudie
2.6 Fragestellungen und Erwartungen
3 Methode der Statusermittlung
3.1 Untersuchungsdesign
3.2 Stichprobenkonstruktion
3.3 Instrumente und Messgeräte
3.3.1 Sprachtest
3.3.2 Übungen zur transversalen Wortschatzvertiefung und Informationsblatt zum mentalen Lexikon
3.3.3 Fragebögen
3.3.4 Interview mit der Fachlehrerin
3.4 Datenanalyse
4 Durchführung der Studie
4.1 Stichprobenbeschreibung - Deutsch-Grundkurs der Jahrgangsstufe 9 in der GM-Gesamtschule
4.2 Verlauf der Fallstudie
4.3 Auswertung des Sprachtests
4.4 Auswertungen der Daten
4.4.1 Fragebögen
4.4.2 Übungen
4.4.3 Interview
4.5 Ergebnisse zu den Fragestellungen
5 Diskussion
5.1 Analyse der Ergebnisse
5.2 Bewertung des Designs und der Methode
5.3 Fazit und Ausblick
Literaturverzeichnis
Graphik- und Tabellenverzeichnis
1 Einleitung
„Gestern standen wir vor dem Abgrund, heute sind wir einen Schritt weiter.“(Holzer 2007)
Warum lässt diese Aussage uns schmunzeln und nicht den Rettungsdienst rufen? Die Kombination von bildlicher Vorstellung und Metapher, in Verbindung mit der Tatsache, dass der Sprecher gesund und munter vor den Journalisten steht, ist paradox und wird so auch von den Hörern/Lesern interpretiert. Doch die Fähigkeit, derartige Doppeldeutigkeiten und Wortspiele zu erkennen, nimmt offensichtlich ab. Laut Professor Gerhard Wolf (Bayreuth) sei die junge Generation kaum noch in der Lage, „einen Gedanken im Kern [zu] erfassen und Kritik daran [zu] üben. Hier schlage sich der schwindende Wortschatz nieder.“ Andererseits „verwenden die jungen Studenten in ihren Arbeiten immer häufiger Begriffe, die sie mal gehört haben, ohne aber zu wissen, was sie eigentlich bedeuten.“ Dies bezeichnet Wolf als „Jargonhaftigkeit“ (Wolf 2012 in der Süddeutschen Zeitung). Auch Winfried Ulrich, Professor für Deutsche Sprache und Literatur und ihre Didaktik (Kiel) würde diesen Mangel mit der unzureichenden Beherrschung des Wortschatzes begründen und erneut fordern, dass die Wortschatzarbeit in Kombination mit Wortbildungslehre und Grammatik in den Lehrplänen der Schulen verstärkt Beachtung findet.
Allerdings könnte dies für die Schülerinnen und Schüler bedeuten, dass weitere Anteile sprachtheoretischer Übungen und Fördermaßnahmen, ähnlich den häufig ungeliebten Grammatikeinheiten des Deutsch- und Fremdsprachunterrichtes (vgl. Ulrich 2001: S. 11), auf sie zukommen. Für die hier vorgelegte Fallstudie in einer 9. Klasse einer Gesamtschule sollen daher zunächst die theoretischen Grundlagen von Wortschatz und Wortschatzarbeit kurz dargestellt werden, besonders im Zusammenhang mit Ulrichs These, dass Sprachreflexion, die die Strukturen des mentalen Lexikons nachzeichnet und durchsichtig macht, sowohl der Wortschatzerweiterung als auch der Wortschatzvertiefung dient (Ulrich 2007: 34). Da es sich hier um metasprachliche Kenntnisse handelt, die theoretisch vermittelt und praktisch exemplarisch eingeübt werden, ist die zentrale Frage, der mit dieser Studie nachgegangen werden soll, ob und inwieweit die Schülerinnen und Schülern die metasprachliche Ebene der Übungen erkennen und der Erwerb dieser Kenntnisse ihre Lernbereitschaft und die Lernfreude steigert. Daher werden in einem zweiten Schritt kurz die Grundlagen und der Stand der Forschung im Bereich von Motivation und Emotion in Lern- und Leistungssituationen dargestellt. Anschließend werden die Kernlehrpläne des Landes NRW in Verbindung mit einigen Lehrbüchern der Didaktik für das Fach Deutsch analysiert, um den Stellenwert von Wortschatzarbeit bei der Unterrichtsplanung einzuschätzen. In diesem Zusammenhang werden auch die Kernlehrpläne der betreffenden Gesamtschule betrachtet.
Mit der Fallstudie sollen dann zwei Aspekte der Wortschatzarbeit untersucht werden:
Da es sich bei der Durchführung der Studie um die Vermittlung einer abstrakten Ebene der Wortschatzarbeit handelt, wird mit Hilfe von wöchentlich auszufüllenden kurzen Fragebögen in einem Untersuchungszeitraum von ca. sechs Wochen, in denen mehrmals wöchentlich Übungen zur Förderung des Wortschatzes durchgeführt werden, speziell der Frage nachgegangen, welche emotionale und motivationale Einstellung die Schülerinnen und Schüler dabei entwickeln.
Zum anderen soll mit Hilfe der Fragebögen ermittelt werden, ob den Schülerinnen und Schülern (im Folgenden SuS) der Klasse deutlich wird, welches Ziel die im Untersuchungszeitraum verstärkte Wortschatzarbeit verfolgt und ob sie die Übungen als hilfreich für die Entwicklung ihres Wortschatzes ansehen. Dies soll dazu beitragen, die SuS umfassend für den Gebrauch, und zwar den möglichst treffenden und nuancierten Gebrauch, von Wörtern für ihre Texte zu sensibilisieren und befähigen. Damit könnte dann erreicht werden, dass sich ein vertieftes Sprachbewusstsein entwickelt, was auch den didaktischen Zielen entspricht, die aus den Bildungsstandards der Kultusministerkonferenz (KMK) abgeleitet werden (vgl. Rezat 2014: S. 289). Zusätzlich wird mittels eines Kompetenztestes vor und nach dem Untersuchungszeitraum geprüft, ob sich Steigerungen der Kompetenz Wortschatz feststellen lassen. Zu diesem Zweck wird auch die Fachlehrerin eine Einschätzung abgeben, die zur Diskussion der Ergebnisse beitragen soll.
Nach der Darstellung des Untersuchungsmodells, der Methode und der Stichprobe werden die Ergebnisse analysiert und diskutiert. Auch wenn eine Fallstudie mit einer Lerngruppe sicherlich nicht zu eindeutigen Ergebnissen bezüglich Ulrichs These führen kann und kein zu verallgemeinerndes Ergebnis der Befragung abzuleiten sein wird, könnten sich Fragestellungen und Hypothesen ergeben, denen in einer weiterführenden Arbeit in einem größeren Rahmen nachgegangen werden kann, besonders in Bezug auf die Entwicklung einer vertieften Sprachbewusstheit, die im Rahmen dieser Arbeit eher am Rande betrachtet wird. Zudem erhofft sich die Fachlehrerin der 9. Klasse, dass die Fallstudie Erkenntnisse für eine effektive Förderung ihrer Schüler ergibt, die sie bei einer merklichen Steigerung der Ausdrucksfähigkeit im Anschluss an die Studie für die Arbeit mit der Klasse nutzen will.
2 Forschungsstand und Theorie
Mit der Betrachtung und Untersuchung des Wortschatzes rückt eine Teilkompetenz der „sprachlichen Basisqualifikation“ (Ehlich 2013: 129) in den Mittelpunkt, die sowohl die Schriftlichkeit als auch die Mündlichkeit betrifft. An dieser Stelle soll diese allerdings schwerpunktmäßig in Verbindung mit der Schriftlichkeit untersucht werden, wodurch Umfang und Beherrschung des Wortschatzes als eine Teilkompetenz der Schreibkompetenz erscheint. Nicht nur Prof. Wolf klagt hier über mangelnde Kompetenzen der Studenten, sowohl bei der Rezeption und Interpretation, als auch bei der Produktion von Texten. Auf die Textproduktion bezogen gibt es eine Fülle von Modellen, in denen das komplexe Zusammenwirken von verschiedenen Kompetenzen veranschaulicht werden soll. Mit der PISA-Studie 2000 und anderen internationalen Vergleichsstudien wurde deutlich, dass basale Fähigkeiten nicht ausgebildet sind, die die Grundlage für eine erfolgreiche Rezeption, Interpretation und Produktion von Texten sind. Es zeigt sich, dass schon im Gespräch, und folglich dann auch beim Lesen und Schreiben von Texten, die Lernenden Schwierigkeiten haben, andere genau zu verstehen und sich selbst klar und eindeutig verständlich zu machen. Mit dem Ansatz, dass der Erwerb von Schreibkompetenz dadurch unterstützt werden kann, indem einzelne Fähigkeiten durch gezieltes Training von Kenntnissen, beispielsweise anfangs Schriftkenntnisse inklusive der entsprechenden feinmotorischen Fähigkeiten, aufgebaut und gefördert werden können, kann die Komplexität dieses Prozesses in einzelne Teilprozesse unterteilt werden, die möglicherweise einzeln aufgebaut, zumindest aber gezielt gefördert werden können. Die folgende schematisierte Darstellung eines Schreibprozesses macht deutlicher, wie der Prozess in getrennten Teilprozessen dargestellt werden könnte.
Anhand der folgenden Graphik lässt sich feststellen: Auch wenn Teilkompetenzen wie Lexik – Semantik und Stilistik nur zwei von vielen sind, ist die Beherrschung der anderen Kompetenzen ohne entsprechenden Wortschatz nicht denkbar, bis hin zur Generierung von Ideen. Obwohl nicht sicher ist, ob der Mensch zum Denken Sprache benötigt, ist doch die Benennung von Konzepten durch Sprachzeichen eine Hilfe, die wahrgenommene Welt geistig in Ordnung zu bringen, und unerlässlich für die Kommunikation mit anderen. Werden beispielsweise Begriffe und Ideen mittels eines Mindmapping - Verfahrens geordnet, muss der Schreiber über einen entsprechenden geordneten Wortschatz verfügen, der es ihm erlaubt, unterschiedliche Gedanken und Bereiche zu bezeichnen. Adressatenbezogenes Schreiben nimmt auch die Wortwahl in den Blick, um Interessen und Anspruch des Adressaten zu bedienen. Erzeugen von Textkohärenz erfordert ein spezifisches Vokabular, das passend eingesetzt werden muss. Die Berücksichtigung formaler Vorgaben setzt einen entsprechenden funktionalen Wortschatz voraus. Treffende eindeutige Formulierungen erfordern einen vertieften Wortschatz, ebenso wie die Fähigkeit der Textrevision. Und - last, but not least – muss für orthographische und grammatikalische Korrektheit das Sprachzeichen auch mit seinem Schriftbild und syntaktischen und syntagmatischen Merkmalen abgespeichert sein, um korrekte Wortbildungen und Satzkonstruktionen zu gewährleisten.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Graphik 1:Schema der Teilprozesse nach Fix (2006: 26ff)
Ergänzend sei hier die Unterscheidung der Kompetenzen nach Ulrich erwähnt. Er unterscheidet sieben Teilkompetenzen der Schreibkompetenz: kognitive Kompetenz, metakognitive Kompetenz, linguistische Kompetenz, Textsortenkompetenz, pragmatisch-kommunikative Kompetenz, metakommunikative Kompetenz und multimediale Kompetenz (vgl. Ulrich 2011: 127). Hier wird noch deutlicher, dass Schreibkompetenz mehr ist als die Beherrschung von Schreibtechniken, indem sie zudem kognitive und metakognitive Bereiche umfasst, die für den effektiven Gebrauch von Sprache grundlegend sind und durch Sprache erst zugänglich werden.
2.1 Wortschatz
Treffend auf den Punkt bringt es in diesem Zusammenhang Winfried Ulrich: Eine Verständigung ohne einigermaßen korrekte Verwendung der syntaktischen Regeln ist schlecht möglich, ohne Wortschatz aber ist sie unmöglich. Ohne Wörter ist man sprachlos (vgl. Ulrich 2007: 3). Ausgehend von der Elementargröße ‚Wort‘, deren genaue Definition im Deutschen über die Schrift bestimmt ist, wobei das Leerzeichen (Spatium) Beginn und Ende des - schriftlich - wiedergegebenen Wortes bezeichnet, steht die Metapher ‚Wortschatz‘ für die Menge der Wörter einer Sprache.
2.1.1 Begriff und Forschungsstand
Allerdings befindet sich der Wortschatz einer modernen Sprache in einem unaufhörlichen Wandel, da Wörter neu gebildet oder aus anderen Sprachen übernommen oder entlehnt werden. Andere hingegen verschwinden aus der mündlichen und/oder schriftlichen Kommunikation oder wandeln ihre Bedeutung und erscheinen in neuen Kontexten (hier sei an das Wort geil erinnert, dessen ursprüngliche Bedeutung ‚sexuell erregt oder erregend‘ in den Hintergrund getreten ist und das inzwischen Bedeutung und teilweise auch Position des Wortes ‚super‘ übernommen hat). Die aufzählende Zusammenfassung der Gebrauchswörter in Lexika erfasst jedoch nur einen Teilbereich des Wortschatzes, überwiegend der schriftlichen Kommunikation. Zum Beispiel wird bei einer alphabetisch geordneten Liste die Bedeutungsseite der Wörter nicht beachtet; bei einer systematischen Anordnung ist es nicht möglich, einzelne Wörter nachzuschlagen (vgl. Ehlich 2013: 131f). Zudem wird der Bereich der Varietäten einer Sprache nur teilweise erfasst oder erfolgt in speziellen Wörterbüchern.
Ehlich weist für das Verständnis dessen, was Wörter und Wortschatz sind und welche Rolle sie für die Entwicklung des Menschen spielen, darauf hin, dass große Teile des Wissens begrifflich organisiert und über Wörter zugänglich sind. Wörter sind für die Organisation unseres Wissens von grundlegender Bedeutung (vgl. Ehlich 2013: 134). Wenn also die Wörtersammlungen einer Sprache nicht ausreichen, um das Phänomen „Wortschatz“ zu fassen, rückt ein Speichermedium ins Blickfeld, dass den Wortschatz des Individuums fasst und organisiert, so dass bei einem kompetenten Sprecher im Bruchteil einer Sekunde ausreichend mit Wörtern verbundene Konzepte zur Rezeption und/oder Produktion von gesprochener oder geschriebener Sprache zur Verfügung stehen: das mentale Lexikon. Unterschieden werden muss hier zwischen dem größeren rezeptiven und dem deutlich kleineren produktiven Wortschatz.
2.1.2 Mentales Lexikon
Aufbauend auf verschiedene forschungsleitende Metaphern (z.B. die Computermetapher), die als Analogien das komplexe System des mentalen Lexikons veranschaulichen sollen, entwickelten Forscher die unterschiedlichsten Modelle, wie Wörter gespeichert, organisiert und aktiviert werden könnten (vgl. Rickheit/Strohner 2003: 268ff). Mit Hilfe der Modelle werden Strukturen und Abhängigkeiten im mentalen Lexikon deutlich, die sich auch in der Praxis beobachten lassen, beispielsweise in der Bereitstellung alternativer Wörter zur Verwendung in einem bestimmten Kontext, Reaktionen/Assoziationen in Bezug auf bestimmte Reizwörter und besonders bei der Beobachtung der frühkindlichen Entwicklung. Die in der Linguistik erprobte Einteilung der Sprachproduktion in Pragmatik, Semantik, Syntax und Phonologie (Rickheit/Strohner 2003: 278) bietet ebenfalls die Möglichkeit, das Prinzip des mentalen Lexikons darzustellen. Im pragmatischen Prozess wird festgelegt, wozu und in welcher Weise eine Information einem bestimmten Partner übermittelt wird. Die Produzenten einer kommunikativen Handlung stimmen diese sehr genau auf den Empfänger ab, was sich am Ende auch in der Wortwahl und den syntaktischen Strukturen erkennen lässt. Der semantische Aspekt der Sprachproduktion bezieht sich ebenso wie der pragmatische auf die Herstellung von Sinn; ersterer als kommunikativer Sinn, letzterer der der lokalen und globalen semantischen Kohärenz. Hier geht es um die Gewichtung, Abstimmung und Umsetzung der Intentionen sowie um die Referenzproduktion, wobei der Produzent die Konzepte auswählt, die zur Darstellung seiner Vorstellung und seiner Intention geeignet sind. Im Idealfall sind diese mit entsprechenden Sprachzeichen, Wörtern und/oder festen Wendungen, verbunden. Hier ist die Schnittstelle zum mentalen Lexikon. Durch die Auswahl eines oder mehrerer lexikalischer Konzepte wird der intendierte Inhalt der Äußerung festgelegt (vgl. Meyer/Schriefers 2003: 483ff). Im Anschluss werden ein Lemma oder mehrere Lemmata, syntaktische Worteinheiten, auf der Grundlage des lexikalischen Konzeptes ausgewählt (lexikalische Selektion). Damit werden die syntaktischen Merkmale des Wortes für den Aufbau der syntaktischen Struktur zugänglich (vgl. Meyer/Schriefers 2003: 485). Parallel dazu findet eine syntaktische Strukturierung der Handlung statt, um komplexe Zusammenhänge zu kontrollieren. Die abschließenden phonologischen und artikulatorischen Aspekte können an dieser Stelle vernachlässigt werden, obwohl die Betonung, eine Geste oder ein Blick manchmal mehr sagt als 1000 Worte (vgl. Rickheit/Strohner 2003: 278ff). Mit der Sprachproduktion wird ein Kompetenzbereich betrachtet, dessen Grundlagen sich bereits in den ersten Lebensmonaten des Kindes herausbilden, unter Umständen sogar schon vor der Geburt, und der sich in einem lebenslangen Prozess entwickelt, verfeinert und zu einem Kernbereich der menschlichen Persönlichkeit und Identität herausbildet (vgl. Grimm/Wilde 1998: 446). Auch wenn der Sprachlernprozess zu Beginn affektiv motiviert ist und auf assoziativen Verknüpfungen im sozial-interaktiven Lernkontext beruht, gewinnt er zunehmend eine kognitive Dimension. Hier hat das Wort bei dem entwicklungspsychologisch-funktionalen Deutungsansatz eine zentrale Rolle als Entwicklungsbarometer (vgl. Grimm/Wilde 1998: 447). Jüngere Kinder bauen Wortrepräsentationen auf, die noch nicht vollständig sind, was sich in Übergeneralisierungen, bzw. Überdiskriminierungen zeigt. Diese Wortrepräsentationen, in die als mentale Konzepte oder Begriffe im Verlauf der Entwicklung eine Vielzahl von Erfahrungen integriert wird, basieren auf einer Zusammenfassung von Objekten, Personen oder Ereignissen nach ihrer Ähnlichkeit in Bezug auf gemeinsame Merkmale (vgl. van der Meer/Klix 2003: 337). Veränderungen beim Gebrauch der Wörter deuten daher auf eine Reorganisation des Lexikons hin, zum Beispiel auf die Umstrukturierung in eine hierarchische Organisation der semantischen Wortfelder (vgl. Grimm/Wilde 1998: 461). Mit zunehmender Beherrschung der Sprache übernimmt diese dann selbst einen exponierten Einfluss auf die Begriffsbildung durch
- Differenzierung gebildeter Begriffe,
- Vermittlung neuer Begriffe, die die Weitergabe von Informationen ermöglicht
- Neubildung komplexer, vielfältig vernetzter Begriffsstrukturen, die zur Generierung neuer Wissensstrukturen führen
- Stabilisierung der Ergebnisse kognitiver Prozeduren, Ermöglichen eines erneuten Zugriffs auf Gedächtnisbesitz (vgl. van der Meer/Klix 2003: 339f).
Dabei ist davon auszugehen, dass jeder Mensch mit dem Erwerb der Muttersprache auch lernt, wie der Wortschatz geordnet wird (vgl. Bohn 1999: 86) und dies im Rahmen des eigenaktiven Lernens optimiert (vgl. Eichler 2008: 144). Auch wenn den Modellen für das mentale Lexikon teilweise sehr unterschiedliche Grundannahmen zugrunde liegen, kann zusammenfassend festgestellt werden, dass es sich um ein komplexes, mehrdimensionales Netzwerk handelt, in dem die im mentalen Lexikon gespeicherten Informationen zu einem Lexem in verschiedene Richtungen weisen und sich auf unterschiedliche Merkmale beziehen: phonetisch-phonologische bzw. graphematische, morphosyntaktische, vor allem aber auf semantische. Die Lexeme werden nicht isoliert gespeichert, sondern zusammen mit bedeutungsverwandten ‚Nachbarn‘, mit denen sie ein strukturiertes System sich gegenseitig beeinflussender Elemente bilden. Ulrich unterscheidet eine Makro- und Mikrostruktur des mentalen Lexikons (Ulrich 2007: 22f). Die Makrostruktur ordnet Lexeme nach Verwendungsmerkmalen, nach syntagmatischen und paradigmatischen Bedeutungsbeziehungen und Wortfeldern (Speicherung mit bedeutungsverwandten ‚Nachbarn‘). Die Mikrostruktur, durch die weitere Dimensionen hinzukommen, ordnet den Lexemen entsprechend ihrer Lesarten ein Netz von Bedeutungen zu, wovon bei der Verwendung im Kontext die passende Lesart ausgewählt wird. Das umfangreiche Bedeutungspotential, graphisch zum Beispiel durch einen Wortstern darstellbar, wird ständig erweitert, wenn neue Lesarten aufgenommen oder sogar selbst konstruiert werden. Es entstehen Nebenbedeutungen, wenn bei der Konzeptualisierung, der Wahrnehmung der Wirklichkeit und der geistigen Verarbeitung von Wahrnehmung, zwischen zwei Erscheinungen Gemeinsamkeiten (‚Familienähnlichkeit‘) (s. o.) entdeckt und sprachlich zum Ausdruck gebracht werden (vgl. Ulrich 2008: 134). Auf diese Weise ist das lexikalisch-semantische Netzwerk ein dynamisches System, das sich dauernd verändert. Dabei wird sprachökonomisch agiert, indem bei neuen Konzepten auf bekannte Lexeme mit teilweise deckungsgleichen Merkmalen zurückgegriffen wird und es so im Rahmen einer konzeptionellen Verschiebung zu einer Vergrößerung der Lesarten kommt (vgl. Ulrich 2008: 136, 2011: 36). In der Alltagskommunikation kommt es trotz dieser komplexen Struktur nicht zu Schwierigkeiten, da das mentale Lexikon Lexeme und Lesarten im Voraus bereitstellt, deren Auftreten im weiteren Kontext eine hohe Wahrscheinlichkeit aufweist (vgl. Ulrich 2011: 42). Der Begriff der „semantischen Kompetenz“, wie er sich bei Pohl (2011: 159) findet, beschreibt die Fähigkeit eines Menschen, dieses System, ein Subsystem des mentalen Lexikons, ökonomisch und sinnvoll zu nutzen. Es umfasst ein Kenntnissystem, das unser Bedeutungswissen repräsentiert, und ein System von Prozeduren (Mechanismen), die dieses Bedeutungswissen aktivieren können. Unsere semantische Kompetenz ermöglicht also das Verstehen und Produzieren von sinnvollen Äußerungen, aber auch das Erkennen und Einordnen von Bedeutungsrelationen, die sprachliche Bezugnahme auf die Welt und die Fähigkeit, Sätze nach ihrem Sinn und Wahrheitsgehalt zu beurteilen (nach Schwarz/Chur 2004 in Pohl 2011: 159). Für die Wortschatzarbeit ist daher die Frage zentral, welchen Stellenwert das semantische Wissen in der Kognition hat und wie die Annahmen über die kognitiven Strukturen und Prozesse in praktisch verwertbare Formen der Wortschatzvermittlung und der Optimierung der semantischen Kompetenz umgesetzt werden können (Bachmann-Stein 2011: 58). Hierfür müssen auch Modelle für den lexikalischen Zugriff auf das mentale Lexikon betrachtet werden, auf die bei der Darstellung von Wortschatzarbeit Bezug genommen wird.
2.1.3 Wortschatzarbeit
Der Erwerb von Wortschatz, der kognitiven und kommunikativen Kompetenz, sprachlich angemessen und verständlich zu handeln, ist ein Prozess, der schon vor der Geburt beginnt. Es ist ein „Prozess zunehmend differenzierender Konzeptualisierung von Welterfahrung“ (Ulrich 2007: 31). Dies geschieht beiläufig und ungesteuert, indem mit dem Kind gesprochen und ihm vorgelesen wird und es die kommunikativen Handlungen seiner Umwelt verfolgt. Die Entdeckung von verschiedenen Bedeutungslesarten eines Lexems führt zur Wortschatzvertiefung. Die Überführung von Lexemen in den produktiven Wortschatz ist ein gleitender Prozess, allerdings werden viele Lexeme nicht oder nur teilweise davon erfasst (vgl. Ulrich 2007: 31). „Wer viel weiß, kennt viele Wörter; und wer einen großen Wortschatz besitzt, verfügt auch über ein umfangreiches Wissen“ (Ulrich 2007: 29). Intelligenztests wie der Wortschatztest (WST) dienen zur Erhebung des ursprünglichen Intelligenzquotienten bei Patienten, deren Krankheit die Intelligenz beeinträchtigt, wie zum Beispiel Demenz. Das mentale Lexikon ist Teil des Langzeitgedächtnisses, sodass diese Kompetenzen länger erhalten bleiben als andere. Die Schwierigkeiten der Schüler bei Leseverständnis und Ausdruck, die sich in den Lernstanderhebungen zeigen, und die nicht nur Ulrich unter anderem auf einen zu kleinen und undifferenzierten Wortschatz zurückführt, verlangen nach einer intensivierten Wortschatzarbeit. So wird das beiläufige (inzidentelle) und implizite Lernen von Wörtern und ihren Bedeutungen unterstützt und verstärkt durch zielgerichtetes, gesteuertes (intentionales) Lernen. Ulrich stellt die These auf, dass wir durch Bewusstmachen der Bedeutungsstrukturen des mentalen Lexikons unseren Ausdrucksspeicher im Gedächtnis funktionstüchtiger machen (Ulrich 2008: 129), und dass ein bewusst gemachtes, erhelltes und durchschautes semantisches Netzwerk besser verfügbar ist als ein undurchschautes. Die Erkenntnisse aus Forschung und Praxis, besonders die Erkenntnisse der kognitiven Semantik, sind die Grundlagen dazu. Es geht nicht nur um quantitatives Wachstum, sondern auch um Vertiefung/Reichweite, also qualitative Wortschatzvertiefung. Dies erhöht den Gebrauchswert des mentalen Lexikons und der einzelnen Lexeme, wodurch Überdehnung, d.h. Übergeneralisierung, vermieden werden kann und die „Chance für immer detailliertere semantische Profilierung“ (Ulrich 2007: 30), eine zunehmend feinfühlige und nuancierte Textrezeption und Textproduktion besteht. Ulrich formuliert als Ziele der Wortschatzarbeit:
1. Beherrschen eines möglichst umfangreichen rezeptiven Wortschatzes
2. Verfügen über einen möglichst umfangreichen produktiven Wortschatz
3. möglichst detaillierte Kenntnis der Bedeutungsprofile der Lexeme
4. möglichst umfassende analytische und konstruktive Wortbildungskompetenz
5. Einsicht in die Prozesse der Bedeutungserweiterung und der Metaphernbildung
6. Sensibilisierung für Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen mehreren Lexemen und ihren Lesarten
7. Bereitschaft und Fähigkeit zur Beseitigung semantischer Unklarheiten im Lexikon, Test und Sprachhandlung (Nachschlagetechniken, …) (Ulrich 2007: 35f).
Hier betont Ulrich die Verbindung mit syntaktischen Informationen: „Die traditionelle Einteilung in Semantik, Syntax und Pragmatik wird beim Lexikonerwerb und Lexikonausbau wenigstens teilweise aufgehoben“ (Ulrich 2007: 30). Um das Interesse und die Lernbereitschaft der Schüler zu wecken und zu erhalten, empfiehlt sich eine Doppelstrategie, indem die zu lernenden Wörter häufig wiederholt und in möglichst vielfältiger Kontextualisierung angewendet werden. Anregungen und Übungen zu metasprachlicher Kommentierung (erklären, paraphrasieren) vertiefen die Vernetzung, denn die Anreicherung und Erweiterung des impliziten Bedeutungswissens erfolgt nicht allein durch Folgebegegnungen mit einem neuen Lexem in anderen Kontexten und Verwendungssituationen, sondern eben auch durch Untersuchung der semantisch-lexikalischen Vernetzung, zu den Synonymen in einem Wortfeld, zu Antonymen, zu Ober- und Unterbegriffen usw.; also durch den Erwerb expliziten Bedeutungswissens (Ulrich 2007: 34). Die Bearbeitung und Bewältigung der drei Phasen beim Erlernen von Wörtern (labelling, packaging, network building) führen nicht nur zu einer Sensibilisierung für feinere Bedeutungsunterschiede, was sich auf die Rezeption und Produktion von Texten auswirkt. Außerdem wird eine zielgenauere Speicherung neu erworbener Lexeme und Lexem-Lesarten erreicht, da die zunehmende Strukturiertheit des Wortschatzes Flexibilität in Form von Neu- und Umstrukturierungen sowie einen leichteren und schnelleren Abruf dieser Lexeme bei Ausdrucksbedarf zur Folge hat (vgl. Ulrich 2007: 34 und Kilian 2011: 138). Implizites Wissen geht in explizites über, wenn die Aufmerksamkeit der Lernenden auf den Wortschatz gerichtet ist, denn Untersuchung von und Reden über Bedeutungen schärft die Wahrnehmungsfähigkeit (vgl. Ulrich 2008: 127).
Allerdings umfasst die Beherrschung des Wortschatzes einer Sprache mehr als
- die Kenntnis der semantischen Merkmale von Wörtern,
- die Fähigkeit, die Position von Wörtern im Netzwerk des Lexikons zu bestimmen,
- die Kompetenz, Wörter aufgrund ihrer Kollokationen und Gebrauchsbeschränkungen in Sätze einzugliedern,
- die Fähigkeit, gute und schlechte Exemplare einer Kategorie von ihrem Prototyp zu unterscheiden,
- das Vermögen, die Beziehungen zwischen verschiedenen Lesarten eines Lexems zu durchschauen (vgl. Ulrich 2007: 38).
Auch wenn im Unterricht nur exemplarisch gearbeitet und nicht jedes Lexem untersucht werden kann, ist dies ausreichend für den Kompetenzaufbau, denn so entsteht ein neues Sprachbewusstsein und wird ein anderer Umgang mit Sprache möglich, da Lernen ein von vorhandenem Wissen ausgehendes konstruktives Handeln ist. Dessen Erkennen und Training ermöglicht eigenständiges Lernen in weiteren Kontexten. Speziell lexikalisches Lernen ist als interaktiver Prozess zu verstehen, der erstens durch sprachliche Impulse von außen, zweitens durch die vorhandenen allgemein-kognitiven Fähigkeiten des Lernenden und drittens durch erworbene lexikalische Erwerbsstrategien gesteuert wird. (vgl. Ulrich 2007: 34f)
Konkret folgt aus diesen Überlegungen eine Einteilung der Lexeme in drei Gruppen:
1. Lexeme, die aus einem Morphem bestehen, sind arbiträr und müssen gelernt werden.
2. Lexeme, die aus mehreren Morphemen bestehen, werden nicht nur aus den Bedeutungen der Einzellexeme konstruiert und sind dann durchsichtig, sondern können durch Wortbildungsprozesse und Bedeutungsverschiebung undurchsichtig werden. Sie werden Gegenstand von Untersuchungen, wobei vorhandene Motiviertheit, und ggfs. ihre Rekonstruktion, als Lernhilfe dienen. Hierzu wird auf die semantische Struktur komplexer Wörter eingegangen, was die analytische und konstruktive Wortbildungskompetenz fördert.
3. Lexeme, die aus verknüpften Wortgruppen bestehen (Phraseologismen), werden als arbiträre Elemente abgespeichert, aber für sie gilt ebenso wie für komplexe Wörter, dass sie zerlegt werden können, da auch sie aus verschiedenen einzelnen Morphemen bestehen. Es wird aber deutlich, dass es sich bei der Bedeutung nicht um die Summe der Einzelbedeutungen handelt, sondern noch zusätzliche Verknüpfungsmerkmale hinzukommen, wobei es sich beispielsweise auch um Konnotationen oder Metaphern handeln kann (vgl. Ulrich 2007: 38f).
Eine wichtige Aufgabe des Sprachunterrichtes ist es, die „Familienähnlichkeit“ zwischen Lesarten eines Lexems aufzudecken, die bei der geistigen Verarbeitung von Wahrnehmung, der Konzeptualisierung, als Nebenbedeutungen entstanden sind, da sprachökonomisch auf bekannte semantische Beziehungen und Bezeichnungen mit ähnlichen semantischen Merkmalen zurückgegriffen wird. Die Untersuchung der Vagheit der Lexeme und der Polysemie einzelner Lexeme, die um die prototypische Kernbedeutung herum die verschiedenen Bedeutungsvarianten und Lesarten in alle Richtungen ausstrahlt, führt dazu, dass der Lernprozess ein aktiver Prozess der Informationsverarbeitung wird. (vgl. Ulrich 2008: 133f)
Abschließend folgt an dieser Stelle eine Zusammenfassung der neueren Vorschläge zur Wortschatzarbeit nach Ulrich (2011: 540ff und Ulrich 2007: 36 ff, 44):
1. Als theoretischen Orientierungsrahmen die Erkenntnisse über die Strukturen des mentalen Lexikons nutzen!
2. Textorientierung anstreben: von der Textanalyse zur Textproduktion! Bearbeitung „defekter“ Texte
3. Über Regelverstöße Regeln entdecken! Entdeckendes Lernen als induktive Methode
Ladendiebstahl → `“Diebstahl eines Ladens“
4. Verknüpfung der Lexeme in ihrem morphologisch - semantischen Netzwerk erhellen (von der Wörterliste zum Wörternetz)!
5. Lernende eine produktive Rolle übernehmen lassen: Selbstbefragung und Benutzung von Wörterbüchern verbinden und einüben! Untersuchung des eigenen inneren Lexikons
6. Wortmaterial sammeln, ordnen, graphisch darstellen!
7. Unterschiede zwischen konkurrierenden, bedeutungsähnlichen Ausdrucksweisen!
Wir kommen vierzehntägig/ vierzehntäglich einmal zur Chorprobe.
8. Wortfelder strukturieren! Erarbeitung semantischer Merkmale und Merkmalbündel
9. Die kommunikative Leistung der Lexeme würdigen!
Du hast vergessen, frische Brötchen vom Bäcker mitzubringen!
Du hast aber vergessen, frische Brötchen vom Bäcker mitzubringen!
10. Hierarchische Beziehungen zwischen Lexemen untersuchen! Durchleuchten lexikalischer Strukturen wie Synonymie, Antonymie, Hyponymie, Partonymie
Strukturierung in Ober- und Unterbegriffe:
Kartoffel, Birne, Pflaume, Kürbis, Tomate,...
11. Erkenntnisse neuer Semantiktheorien nutzen!
12. Kollokationen und feste Redewendungen in die Wortschatzarbeit einbeziehen!
Betrachten lexikalischer Verträglichkeiten und Unverträglichkeiten von Lexemen bei Satz- und Textbildung
Sport machen → Sport treiben
13. Mehrdeutigkeit der Lexeme und Kontextabhängigkeit der Bedeutungen erfassen!
Befragung des Kontextes zur semantischen Bestimmung eines Lexems (Kontextanalyse, kontextangemessene Wortwahl)
14. Lesarten eines Lexems als Beziehungsgeflecht verstehen! Zusammenstellung von Lexemen nach ihren semantischen Beziehungen
15. Wortschatz und Lexembedeutung als dynamische, sich ständig verändernde Systeme begreifen!
Polz (2011: 117) legt generell Wert darauf, dass jegliche Wortschatzarbeit nicht ohne Funktionsbezüge auskommt. Isoliertes Betrachten von einzelnen Wortfeldern oder Wortfamilien berücksichtigt nicht, dass Wörter und Wendungen im Kontext bedeutsam werden und zu deuten sind, auch in welcher Funktion sie stehen. Die effektivste Wortschatzarbeit verbindet explizite semantische Instruktionen mit inhaltlich und sprachlich anregenden mündlichen und schriftlichen Texten (vgl. Ulrich 2007: 40).
2.1.4 Modelle der Wortschatzvermittlung: Textorientierte Wortschatzarbeit und wortschatzdidaktischer Dreischritt
Daraus folgt dann, dass „Wortschatzarbeit […] immer der Förderung der Fähigkeit [dient], Texte zu verstehen und zu verfassen“ (Ulrich 2007: 45). Es handelt sich um den wechselseitigen Bezug zweier Kompetenzbereiche, und zwar der Textkompetenz und der Wortschatzkompetenz, wobei nicht eindeutig klar ist, ob Wortschatzkompetenz Teil der oder Voraussetzung für Textkompetenz ist. Jedenfalls sind diese beiden Kompetenzen eng miteinander verzahnt, so dass Wissen über Texte zur Wortschatzerweiterung und -vertiefung beiträgt und textbezogene Wortschatzkenntnisse Einsichten in die Differenziertheit von Textkommunikation vermitteln (vgl. Hoffmann 2011: 143). Für die Wortschatzarbeit wesentlich ist die Unterscheidung zwischen Systemwort (Lexem) und Textwort, das im Rahmen des Textes gezielt für kommunikative Zwecke eingesetzt, abgewandelt und umgedeutet wird. Es handelt sich um Wörter in kommunikativer Funktion, die umgekehrt Einfluss auf das System nehmen und zu neuen Lesarten eines Lexems werden. Hier betrachtet die textorientierte Wortschatzarbeit einen speziellen Bereich, der sich nach Hoffmann aus mehreren Teilkompetenzen zusammensetzt, wo dann auch wesentliche Aspekte der Wortschatzkompetenz erscheinen: Themenstrukturierungskompetenz, Textgestaltungskompetenz, Sinngebungskompetenz, Textsortenkompetenz, Diskurskompetenz und Interpretationskompetenz. Wie hier ersichtlich wird, finden sich viele dieser Kompetenzen auch in den Modellen zum Schreibprozess. Hoffmann betrachtet diese Kompetenzen im Rahmen zweier textdidaktischer Modelle, des Anweisungsstrukturmodells und des Handlungsanalysemodells, sowie des Wortgrammatikkonzeptes. Er erarbeitet für die jeweiligen Kompetenzen auf der Basis der Modelle verschiedene Anregungen für die Umsetzung im Unterricht (vgl. Hoffmann 2011: 144ff). Zur Steigerung der wortschatzorientierten Textsortenkompetenz beispielsweise können textsortentypische Einzelwörter und Wortgruppen in Lückentexte eingesetzt werden. Ein Beispiel dafür wären attributiv verwendete Adjektive, die mit der jeweiligen Textsorte zusammenhängen. Lexikalische Einheiten können nach den Qualitätskriterien der Textsorte vertextet werden, so dass Textschablonen mit thematisch bzw. funktional gekennzeichneten Bausteinen erarbeitet werden. Die Neuvertextung lexikalischer Einheiten im Rahmen eines Textsortenwechsels führt zu einer reflektierten Anwendung des speziellen Wortschatzes (vgl. Hoffmann 2011: 155f). Bezogen auf die Textsortenkompetenz unterscheidet auch Steinhoff (2011: 578) zwischen thematischem und funktionalem Wortschatz. Er schlägt für die Erarbeitung eines funktionalen Wortschatzes beispielsweise das Trainieren von Wörtern und Wendungen als Werkzeuge der Textproduktion und die lexikalisch orientierte Schulung narrativer und deskriptiver Textkompetenzen vor. Der Erfolg der Arbeit orientiert sich am Output der Schüler, wo sich Kompetenz und deren Zunahme messen lassen. (vgl. Steinhoff 2011: 577) In Bezug auf den funktionalen Wortschatz formuliert er den Begriff der „Textschlüsselwörter“. Das sind Wörter und Wendungen, die dazu dienen, zentrale Textfunktionen zu realisieren. Für die Textsorte „Argumentation“ wäre dies beispielsweise eine „zwar-aber“- Konstruktion, mit der der Produzent der sprachlichen Äußerung ein Werkzeug an der Hand hat, dem der Zweck des Argumentierens sozusagen „eingeschrieben“ ist: die Überzeugung des Adressaten mittels einer dialogisch angelegten, die eigene Position stärkenden Inbezugsetzung von Gegenargument und eigenem Argument (Steinhoff 2011: 579).
Für die unterrichtspraktische Umsetzung kann das Modell des „wortschatzdidaktischen Dreischritts“ nach Kühn (2000 in Steinhoff 2011: 578, 582-585) Anwendung finden, das unten kurz zusammengefasst ist. Es umfasst die folgenden drei Schritte, denen jeweils praktische Umsetzungsvorschläge zugeordnet sind.
a) Semantisierung: entschlüsseln und reflektieren
- vergleichende Textrezeption: Vergleich von zwei qualitativ unterschiedlichen Texten: Isolieren der Mittel, die die Qualität des Textes steigern
- kommentierende Textrezeption: vorbereitete Arbeitsbögen, Fragelawine, Textlupe
- eigenaktive Textrezeption: Unterstreichen, Randnotiz, Umformulierung, Neuformulierung
- Wörterbücher nutzen: besonders für semantisch komplexe Erzählwörter
- Wortlisten erstellen, erarbeiten von „Wortprofilen“, Lieblingswörter entdecken
- Lückentexte bearbeiten, ggfs. Wortfelder vorgeben oder zuvor erarbeiten, besondere Sensibilisierung für Funktionswörter
b) Vernetzung: untersuchen, ordnen, ergänzen
- Cluster, Mindmaps, Tabellen erstellen
- Netze und Felder konstruieren
- Textschaubilder
c) Reaktivierung: in eigenen Texten verwenden (intentions-, adressaten-, situationsspezifisch)
Im Anschluss an Anregungen zur Gestaltung einer effektiven Wortschatzarbeit stellt sich die Frage nach der Akzeptanz und der daraus resultierenden Motivierung der SuS für eine entsprechende Förderung. Da diese für Quantität und Qualität sowohl der Bearbeitung von Übungen als auch der Verarbeitung von theoretischem Wissen von Bedeutung ist, wird im Folgenden dieser Frage nachgegangen.
2.2 Schülermotivation
Für die Umsetzung und, dieser vorausgehend, für die Frage nach der Umsetzbarkeit der Theorie, soll an dieser Stelle eine wesentliche Rahmenbedingung untersucht werden. Renkl (2008) kommt zu dem Schluss: „Die Lernmotivation darf als eine wichtige Zieldimension von Unterricht unter anderem auch deshalb nicht außer Acht gelassen werden, da sie eine wichtige Bedingung längerfristigen Kompetenzerwerbs ist“ (Renkl 2008: 11) Dabei wird betont, dass vor allem die Interpretation der Schülerinnen und Schüler von Geschehnissen im Unterricht von Bedeutung ist. Wenn also mit dieser Studie nach Interesse und Lernfreude der SuS in Bezug auf spezielle Maßnahmen zum Aufbau und zur Förderung der Wortschatzkompetenz und auf Wissensinhalte zum Aufbau und zur Funktion des mentalen Lexikons gefragt wird, muss zunächst der Begriff „Motivation“ und die entsprechenden Theorien und Konzepte der Motivationsforschung kurz dargestellt werden.
2.2.1 Motivation
Aus der eigenen Schulzeit wird manchem noch der als trocken und realitätsfern empfundene Grammatikunterricht in Erinnerung geblieben sein und die ablehnenden Reaktionen auf die Ankündigung des Lehrers/der Lehrerin: „Wir machen dieses Halbjahr Grammatik“. Aussagen wie „Ich setze ein Komma nach Gefühl“ zeigen, dass das damals vermittelte Regelwerk im Alltag offensichtlich nicht präsent ist, auch wenn sich ein „Gefühl“, vielleicht auch als Sprachbewusstsein zu bezeichnen, entwickelt hat. Inwieweit dies durch das in der Schule erworbene Wissen oder durch die sprachliche Umwelt geschehen ist, wäre ein interessantes Forschungsprojekt. Wie groß der Anteil an theoretischer Sprachvermittlung, genannt Grammatik, in den Schulen von heute ist, wird an anderer Stelle dargestellt (s.u.). Inzwischen hat sich die pädagogische Psychologie des Aspektes von Schülermotivation und -emotion in Lern- und Leistungskontexten angenommen, auch um deren Auswirkung auf die Haltbarkeit und Anwendbarkeit von in der Schule erworbenem Wissen zu untersuchen. Emotionen, insbesondere Prüfungsangst, oder die Leistungsmotivation sind in den vergangenen Jahren schon intensiv erforscht worden und die Frage nach der Möglichkeit, Schüler zu motivieren, bewegt schon Generationen von Pädagogen.
Der Begriff „Motivation und -emotion in Lern und Leistungskontexten“ aus der pädagogischen Psychologie bezieht sich jedoch nur auf einen kleinen Teilbereich der Motivationsforschung.
Das Wort „Motivation“ selbst ist abgeleitet von dem lateinischen Verb „movere“ = bewegen.
Motivation hat insofern mit Bewegung zu tun, als der Begriff dasjenige bezeichnet, was uns zu einer Handlung veranlasst oder uns in Bewegung versetzt. Motivation kann im Rahmen einer weit gefassten Begriffsbestimmung definiert werden als die Gesamtheit der Prozesse, die zielgerichtetes Verhalten auslösen und aufrechterhalten (Rudolph 2013: 1). Allgemeinere Ziele wären dann Wiederherstellung und Bewahrung innerer Zustände (z.B. energetische Versorgung), also Aufrechterhalten des inneren Milieus, und die Herstellung, Erringung und Erhaltung äußerer Sachverhalte (Werke, soziale Position, soziale Beziehungen), also Ziele in der dinglichen und sozialen Umwelt und im Verhältnis der handelnden Person zur Umwelt (vgl. Schneider/Schmalt 2000: 11). Dabei wird Motivation als hypothetisches heterogenes Konstrukt gesehen, etwas gedanklich Konstruiertes, mit dem die Zielgerichtetheit des menschlichen Handelns erklärt werden soll, und das in viele Komponenten untergliedert ist. Einige dieser Komponenten sind Erwartungen, Werte, Selbstbilder, Willensprozesse, Affekte/Emotionen sowie neurohormonelle Prozesse, wodurch deutlich wird, wie komplex das Konstrukt „Motivation“ ist. (vgl. Vollmeyer 2005: 9f). Schon in der Antike befassten sich Philosophen wie Epikur damit, wie und womit sich menschliches Handeln begründen lassen kann (z.B. das Lust-Unlust-Prinzip, der Hedonismus) (vgl. Rudolph 2013: S. 2). Jedoch zeigte sich schnell, dass mit Hilfe einzelner Theorien zwar das Verhalten von Menschen in bestimmten Situationen erklärt werden kann, diese an anderen Stellen dafür jedoch nicht ausreichen. Zwar können viele Handlungen anhand von unbewusst ablaufenden Prozessen erklärt werden, wo die handelnde Person durch das Zusammenwirken von Motiven und Anreizen zu einem bestimmten Verhalten gelenkt wird. Es gibt jedoch Fälle, in denen entgegen oder trotz einer angeregten Motivation gehandelt wird oder werden muss. Solche Vorgänge werden mit „Wille“, bzw. mit „Volition“ bezeichnet. Den bewussten Triebaufschub und Triebverzicht bezeichnete beispielsweise Freud als Voraussetzung, an die die Entwicklung der menschlichen Kultur gebunden ist (vgl. Schneider/Schmalt 2000: 32f).
Motive werden als zeitstabile Personenmerkmale konzipiert und stellen eine Neigung dar, bestimmte Themen oder Gegenstände positiv oder negativ zu bewerten (vgl. Vollmeyer 2005: 10). Dabei sind sie, ebenso wie Motivation, gedankliche Konstrukte, mit deren Hilfe die unüberschaubare Zahl von Zielen, die mit Verhalten/Handlungen verfolgt werden, zu wenigen Klassen zusammengefasst und mit der individuellen personseitigen Bewertung zusammengeführt werden, also eine Bewertungsdisposition. (vgl. Schneider/Schmalt 2000: 12) Ein Motiv besteht demnach wiederum aus mehreren Komponenten. Neben allgemeinen Motivsystemen beispielsweise für Hunger, Sexualität, Neugier und Aggression finden sich weitere Motivklassen, von denen drei in fast allen alltäglichen Situationen angeregt werden könnten und die daher besonderes Forschungsinteresse auf sich gezogen haben und auch für die Lernmotivation von besonderer Bedeutung sind: das Leistungsmotiv, das Machtmotiv und das Anschlussmotiv. Unter Leistungsmotiv versteht man, wenn Personen das Ziel haben, sich mit einem Gütemaßstab auseinanderzusetzen. Personen mit Machtmotiv haben das Ziel, das Erleben und Verhalten anderer Personen zu beeinflussen und Menschen mit einem Anschlussmotiv verfolgen das Ziel, wechselseitige positive Beziehungen zu anderen Personen herzustellen (vgl. Vollmeyer 2005: 11)
Motive drängen zu Handlungen, bedingen Zielsetzungen und determinieren die Bewertung der angestrebten Ziele und anderer handlungsrelevanter Momente, z.B. die Beurteilung von Realisierungschancen (vgl. Schneider/Schmalt 2000: 12). Neben Motiven, die das Überleben des Organismus sichern, biogen sind, müssen andere im Rahmen der Sozialisation erlernt werden, wobei eine Wechselwirkung zwischen den Werthaltungen und Bedürfnissen des Individuums und der Gesellschaft besteht. Sie werden jedoch nicht zu jedem Zeitpunkt verhaltenswirksam, sind also nicht immer aktiviert, sondern müssen durch Situations-merkmale (Anreize) angeregt werden. Diese signalisieren die Möglichkeit, dass Ziele erreicht bzw. verfehlt werden könnten, und müssen zu einem Motiv passen, wobei diese Passung individuell verschieden ist. Nicht jeder Anreiz führt bei jeder Person zur gleichen oder gleich starken Aktivierung des gleichen Motivs (interindividuelle Unterschiede). Auch von derselben Person lassen sich zu unterschiedlichen Zeiten bei gleichen Anreizen unterschiedliche Ziele identifizieren, die dann im Verhalten sichtbar werden (intraindividuelle Unterschiede) (vgl. Schneider/Schmalt 2000: 12). Der Aufforderungscharakter (Valenz) eines Anreizes entsteht, wenn ihm auf der Organismusseite ein momentanes Anliegen oder ein Motiv entspricht. Dadurch kommt es zu einer individuellen affektiven Aufladung der an sich neutralen Gegebenheit, die bei potentieller Zielerreichung positiv und bei potentieller Zielverfehlung negativ getönt ist. Motivierende Eigenschaft gewinnt der Anreiz also dadurch, dass der Organismus Zieloptionen einschließlich der bei Zielerreichung (oder Zielverfehlung) entstehenden Affektkonsequenzen anbietet, um sie zeitlich vorwegzunehmen, sie zu antizipieren. Die Wirkung von Anreizen ist abhängig von Lernerfahrungen, kulturellen und sozialen Faktoren und den gegenwärtigen Umständen (vgl. Schneider/Schmalt 2000: 18).
Zudem lassen sich zwei Arten von Anreizen unterscheiden, je nachdem ob sie in der Tätigkeit selbst liegen oder die Folge der Handlung sind (Tätigkeitsanreiz (= intrinsisch) und Folgenanreiz (= extrinsisch) (vgl. Engeser/Vollmeyer 2005: 59). Sie haben eine unterschiedliche Veranlassungsstruktur: Bei Tätigkeitsanreizen führt die affektive positive Tönung der Handlung (Spaß, Freude) zum Handlungsvollzug. Hier können zwei verschiedene Anreizquellen unterschieden werden, die themenbezogene und die tätigkeitsbezogene. Bei einem themenbezogenen Anreiz, der besonders für die Lernmotivation von Bedeutung ist, beruht dieser zum Beispiel auf Interesse am Gegenstand bzw. Thema. Bei Folgenanreizen ist die Veranlassungsstruktur komplexer. Sie werden durch die Erwartungen an die Ergebnisse und deren Folgen ausgelöst. Zur Verdeutlichung der komplexen Zusammenhänge, die dann zu motiviertem Verhalten führen, wird unter dem Gesichtspunkt der Lernmotivation das Erwartung-Wert-Modell betrachtet.
2.2.2 Lernmotivation
Die Beschränkung auf die Motivation im Zusammenhang mit Lehr- und Lernprozessen ermöglicht an dieser Stelle, Erkenntnisse der Motivationsforschung direkt auf die hier relevanten Aspekte zu beziehen und dadurch zu konkretisieren. Das Erwartung-Wert-Modell beispielsweise wird in einer erweiterten Form in der pädagogischen Psychologie häufig genutzt, da mit ihm gut die Entstehung und Entwicklung von Lernmotivation dargestellt werden kann (vgl. Möller 2008: 267). Im Rahmen dieser Arbeit wird davon ausgegangen, dass es eine integrative Gesamtschau der verschiedenen theoretischen Modelle und Konstrukte der pädagogischen Psychologie erlaubt (z.B. kognitive Motivationstheorien, Attributionstheorien, Zieltheorien) (vgl. Möller 2008: 293, Fischer 2006: 7), sodass für die Entwicklung des theoretischen Modells der Studie damit eine ausreichende theoretische Grundlage dargestellt werden kann.
Anhand der folgenden Graphik wird deutlich, welche Faktoren zu motiviertem Verhalten beitragen.
Wesentliche Faktoren, die die Motivation determinieren, sind die Wahrnehmung des sozialen Umfelds und die Attributionen der bisherigen Lernerfahrungen. Diese werden zwar von den realen Gegebenheiten beeinflusst, müssen aber nicht mit ihnen übereinstimmen. Hat Bildung und Lernen in den wichtigsten Bezugsgruppen einer Person einen hohen Stellenwert, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass diese Person dies ebenso einschätzt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Graphik 2: Erwartung-Wert-Modell der Lernmotivation (zitiert nach Möller 2008: 267)
Resultierend aus bisherigen Erfahrungen, die zu einem großen Teil aus schulischen Leistungsrückmeldungen beruhen, entwickelt die Person über die Attributionen, die subjektiven Ursachenzuschreibungen von Erfolgen oder Misserfolgen, ein Selbstkonzept, das neben der Zielorientierung, die aus der Wahrnehmung der sozialen Umwelt resultiert, die motivationalen Überzeugungen prägt. In der jeweils aktuellen Situation beeinflussen die motivationalen Überzeugungen den Aufgabenwert und die Erfolgserwartungen. Sie werden demnach in eine Erwartungs- und eine Wertkomponente unterschieden.
Mit der Wertkomponente sind individuelle Interessen und Zielorientierungen verbunden. Da sie für die vorliegende Studie von besonderer Bedeutung sind, wird später darauf näher eingegangen. Beeinflusst wird die Wertkomponente von der Erwartungskomponente, denn nur wenn zu erwarten ist, dass das betreffende Ziel auch erreicht werden kann, behält es seinen Wert (vgl. Möller 2008: 268). Ist die Person überzeugt, dass sie ein solches Ziel nicht erreichen kann, fehlt ihr jede Motivation, es auch nur zu versuchen. Wie an der Graphik gut zu sehen ist, sind die Ausdauer und die Anstrengungsbereitschaft von der Lernmotivation direkt abhängig. Wenn die Motivation sinkt, weil einer der Faktoren neu bewertet wird, beispielsweise der Aufwand, die Kosten, als zu hoch eingeschätzt wird, kann es zum Abbruch des Verhaltens, der Handlung, kommen. Dies wäre beispielsweise dann der Fall, wenn der Aufwand, die Kosten, als zu hoch eingeschätzt wird. Das Individuum nimmt ständig Anstrengungskalkulationen vor und entscheidet sich dann für die Handlungsalternative, bei der es mit möglichst geringem Aufwand einen möglichst hohen Ertrag erzielt (vgl. Schnotz 2011: 102) Dabei werden Wert und Kosten der Handlung ausbalanciert. Es zeigte sich, dass eine intrinsische Motivation nicht nur die Anstrengungsbereitschaft, sondern auch die Qualität der Tätigkeit beeinflusst und mit einer tiefer gehenden Verarbeitung des Lernmaterials einhergeht, da die Tätigkeit mit positiven Emotionen (Spaß, Freude) verbunden ist (vgl. Schiefele/Schaffner 2015: 165).
Daher kommt Spinath (2005: 217) zu dem Ergebnis, dass im Zusammenhang mit der Förderung von Motivation als Kompetenz, Lernende dazu befähigt werden können, den Prozess der motivationsbezogenen Handlungssteuerung aktiv zu beeinflussen. Allerdings sei es weitaus effektiver, eine Verbesserung der Voraussetzungen für positive Emotionen beim Lernen zu bewirken, speziell für das Flow-Erleben, was eine besondere Form von zeit- und selbstvergessendem Aufgehen in einer Tätigkeit darstellt. Dies ist meist verbunden mit einer intrinsischen Motivierung. Es kann aber auch bei extrinsisch motivierten Tätigkeiten auftreten, wenn die handelnde Person sich trotzdem als selbstbestimmt und kompetent wahrnimmt und der Tätigkeit einen entsprechenden Wert beimisst. Dies entspricht der Selbstbestimmungstheorie von Deci und Ryan (1993: 229). Die psychologischen Grundbedürfnisse nach Kompetenz, Selbstbestimmung und sozialer Bezogenheit bilden die gemeinsame Grundlage für das Auftreten intrinsisch motivierten Verhaltens. Da ihre Wahrnehmung positiven Erlebniswert besitzen, können sie dazu führen, dass eine Tätigkeit auch ohne äußere Motivierung durchgeführt wird. Weitere handlungsimmanente Anreize sind, neben dem Flow-Erleben, handlungsbegleitende Emotionen wie Freude und situationales Interesse (vgl. Schiefele/Schaffner: 2015: 157). Eine auf Interesse beruhende Lernmotivation wird als selbstbestimmt und insofern als intrinsisch erlebt (vgl. Krapp 2005: 23). Emotionen beeinflussen demnach die Motivation, weshalb im Folgenden der Zusammenhang näher betrachtet werden soll.
2.2.3 Motivation und Emotion
Emotionen sind innere, psychische Prozesse und durch ein für sie typisches psychisches Erleben gekennzeichnet, die auch als ihr „affektiver Kern“ bezeichnet werden. Affektives Erleben ist notwendig und hinreichend für eine Emotion. Emotionen lassen sich entlang der Dimension Valenz in „positiv“ bzw. „negativ“ einordnen und haben einen stark wertenden Charakter. Sie sind mehrdimensionale Konstrukte, die aus affektiven, physiologischen, kognitiven, expressiven und motivationalen Komponenten bestehen.
Neben der Ordnung von Emotionen in der Dimension Valenz muss auch die Dimension der Aktivierung/Erregung (niedrig bis hoch) einbezogen werden. Zudem können Emotionen in Kategorien unterschieden werden, wo zwischen einer Vielzahl von diskreten Emotionen unterschieden wird. Dabei werden unter dem Aspekt „Basisemotionen“ besonders häufig die Emotionen Freude, Überraschung, Trauer, Ärger, Angst und Ekel genannt. (vgl. Frenzel/Pekrun et al. 2015: 202f). Wesentlich für die Lernmotivation sind auch Gefühle wie Stolz bzw. Scham und Langeweile und Interesse. Eine weitere wichtige strukturelle Eigenschaft von Emotionen liegt darin, dass „sie zum einen als momentane Zustände und zum anderen als dispositionelle Reaktionstendenzen betrachtet werden können“ (Frenzel/Pekrun et al. 2015: 203f). Allgemein werden Emotionen als situative momentane Zustände beschrieben (sog. emotionale States), wobei durch die kurze Dauer des Zustandes eine Unterscheidung von der Stimmung notwendig wird, die länger anhält und meist weniger intensiv ist. Dies ist für die Erhebung eines Meinungsbildes in der Retrospektive notwendig. In der Betrachtung von Unterschieden zwischen Individuen zeigt sich jedoch eine Neigung, in verschiedenen Situationen mit bestimmten Emotionen zu reagieren, also eine Disposition. Diese Disposition bezeichnet man als Traits, die als relativ stabile Persönlichkeitseigenschaften beschrieben werden und im Vergleich zu State-Angaben wohl in einem größeren Ausmaß unser Denken über Dinge widerspiegelt (vgl. Frenzel/Pekrun et al. 2015: 204).
Tobinski/Fritz (2010) beschreiben subjektives Emotionserleben als Folge der kognitiven Bewertung einer zunächst unspezifischen Erregung, die situativ ausgelöst worden ist. Es gibt für das Auslösen einer Emotion Antezedensbedingungen, also eine emotional relevante Situation mit internen und externen Stimuli, die zu einem bestimmten Ausdrucksverhalten und emotionalen Erleben führen (vgl. Tobinski/Fritz 2010: 207). Emotionen haben demnach auch eine motivationale Komponente (s.o.). Der Mensch ist in der Lage, neben einer Interpretation des Ausdrucksverhaltens eines Gegenübers, über diese Prozesse bei anderen und bei sich selbst zu reflektieren und sie zu beschreiben, sowie teilweise auch zu regulieren. Diese Reflexionsleistung ist vor allem auch bei Lernprozessen notwendig, um diese auch der emotionalen Situation entsprechend zu steuern (Leistungsmotivation, Ausdauer oder Konzentration). Dabei ist ein wichtiger Aspekt die Fähigkeit des Menschen, erwartete Emotionen vorwegzunehmen und zu antizipieren, was ihn zu Verhalten motiviert, zu dem er normalerweise nicht motiviert wäre (s.o.).
Um zu erklären, warum Menschen auf gleiche Situationen unterschiedlich reagieren, wurde in der Emotionsforschung von Lazarus/Smith der Appraisal-Ansatz entwickelt, welcher von der emotionsauslösenden Interpretation einer an sich neutralen Situation ausgeht. Dabei wird beurteilt, ob die Situation/der Gegenstand persönlich bedeutsam und konsistent/inkonsistent mit den persönlichen Bedürfnissen ist (positiv/negativ). In einem zweiten Schritt wird gewertet, ob die Situation fremd- oder selbstbestimmt zustande gekommen ist, ob genügend Ressourcen zur Bewältigung vorhanden sind oder die Situation sich möglicherweise ändert (vgl. Frenzel/Pekrun et al. 2015: 212).
Mit der Darstellung von nur einigen Komponenten des Konstruktes „Emotion“ wird die hohe Komplexität des Konstruktes deutlich. Deshalb soll bei der Betrachtung der Relation von Emotionen zu anderen Konstrukten der Schwerpunkt auf das Lernen gelegt werden.
Gläser-Zikuda (2001) konstatiert, dass die Pädagogik sich erst spät mit der Analyse von Emotionen auseinandersetzt, die im Zusammenhang mit Lehr- und Lernprozessen stehen. Erst in den 90er Jahren setzte eine verstärkte Forschung ein, wobei Unterricht und Lernen als vielfältig strukturierter Interaktionsprozess verstanden wird, der neben kognitiven und sozialen Aspekten auch individuell-emotionale Aspekte der Persönlichkeitsbildung umfasst und interessierte Teilnahme am Unterricht fördern soll (Gläser-Zikuda 2001: 63f). Lernsituationen sind Situationen, in denen man sich intentional mit einem inhaltlich definierten Lerngegenstand mit dem Ziel auseinandersetzt, seine Kompetenzen und Wissensbestände in diesem Gegenstandsbereich zu erweitern. Da es sich bei Lernsituationen immer auch um Leistungssituationen handelt, sind Lernemotionen als eine Teilgruppe von Leistungsemotionen zu betrachten (vgl. Frenzel/Pekrun et al. 2015: 207). Um diese theoretisch zu ordnen, können die Kriterien Valenz (s.o.), Objektfokus und zeitlicher Bezug berücksichtigt werden. Anhand des Objektfokus wird unterschieden, ob die Emotionen primär auf die Aktivität oder auf das Leistungsergebnis dieser Aktivität gerichtet sind. Dies entspricht der Unterscheidung von Tätigkeitsanreiz und Folgenanreiz (s.o.). Götz et al. (2004: 59) unterscheiden zwischen intrinsischer Valenz (Spaß an der Sache), extrinsischer (Wertigkeit durch Bedeutung) und Leistungsvalenz (Wert einer Leistung in diesem Bereich). Der zeitliche Bezug berücksichtigt, ob der Fokus beim Erleben der Emotion eher auf die Zukunft, die gegenwärtige Tätigkeit oder die Vergangenheit gerichtet ist (vgl. Frenzel/Pekrun et al. 2015: 207, Pekrun et al. 2006: 585) Ist der Fokus auf die Aktivität ausgerichtet, ist der zeitliche Bezug grundsätzlich die Gegenwart. Beispiele sind Emotionen wie Lernfreude, Langeweile oder Frustration beim Lernen.
[...]
- Arbeit zitieren
- Ada von der Mühlen (Autor:in), 2015, Forschungsstand, Theorie und Methoden der Wortschatzarbeit. Fallstudie in einer 9. Klasse einer Gesamtschule, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/321053
Kostenlos Autor werden


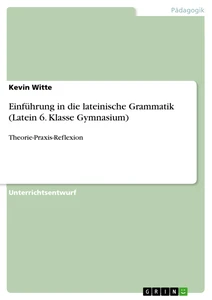






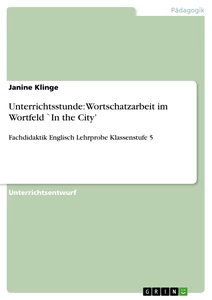










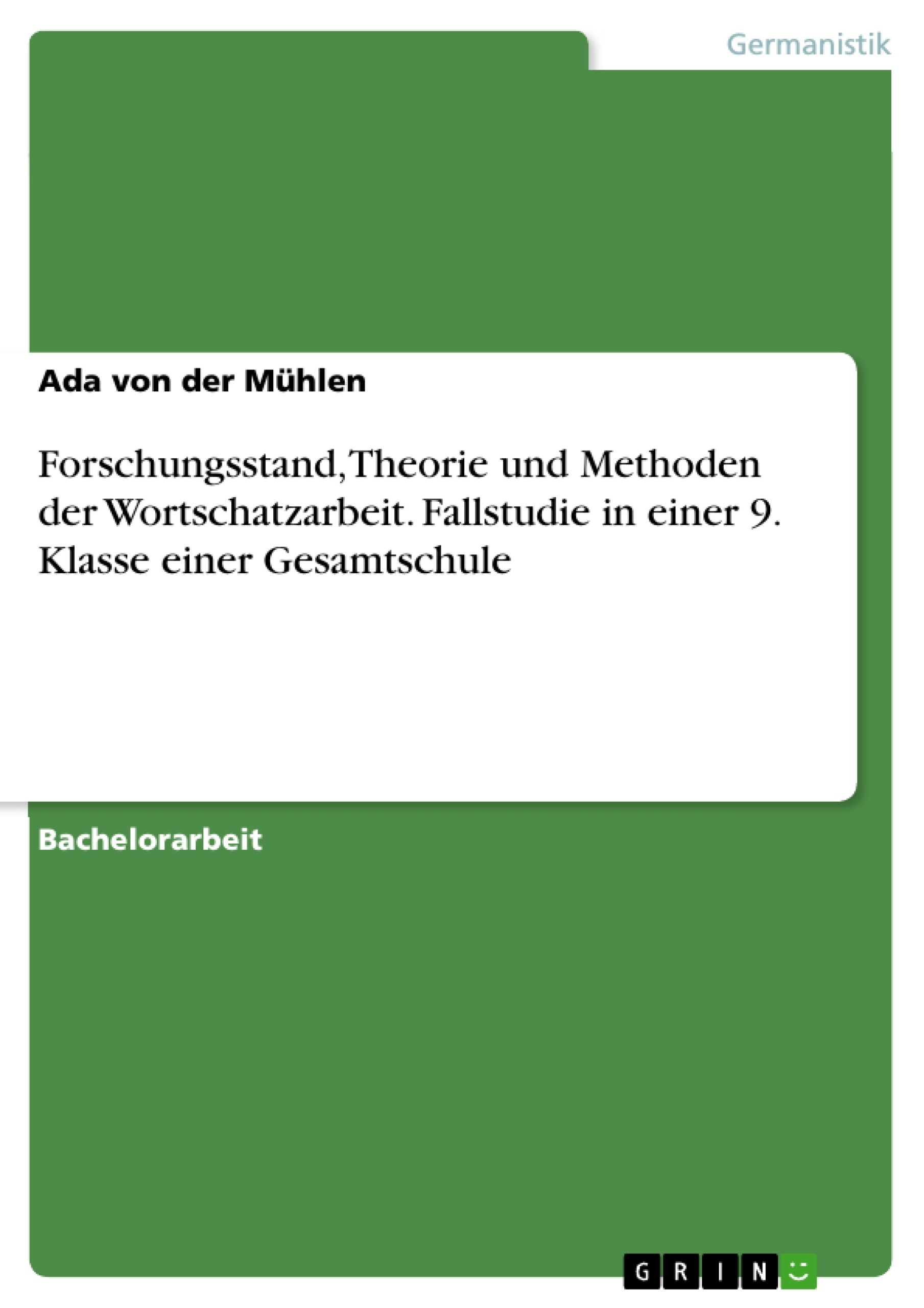

Kommentare