Leseprobe
Inhalt
Einleitung
1. Die Mitgliederentwicklung der SPD
2. Folgen der Mitgliederentwicklung für die Parteiorganisation
3. Parteireformen in der Gegenwart
3.1. SPD 2000
3.2. Demokratie braucht Partei
3.3. Erfolge und Misserfolge der Parteireformen
3.4. Herausforderungen für die SPD in den kommenden Jahren
4. Schlussbemerkung: Wandel der SPD, Wandel des Parteiensystems?
Bibliographie
Einleitung
Mit einer Galaveranstaltung feierte die SPD im Mai 2003 ihr 140jähriges Bestehen, die Gründung des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins durch Ferdinand Lasalle im Jahr 1863, dem Vorläufer der Sozialdemokratischen Partei. Doch auch die Festveranstaltung konnte nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich die Partei derzeit organisationspolitisch in einer ihrer schwierigsten Phasen befindet. Hatte der ehemalige Bundesgeschäftsführer Matthias Machnig das Ende der Mitgliederpartei schon vorausgesehen, so hat sich insbesondere nach dessen Abgang, im Zuge der Diskussion um das Reformprogramm „Agenda 2010“ der Bundesregierung, der Mitgliederschwund in erheblicher Weise fortgesetzt. Dies stellt die Organisationsebene der SPD vor besondere Herausforderungen, nicht nur aufgrund der besonderen Bedeutung der Mitgliedsbeiträge, sondern weil der abnehmende Organisationsgrad in vielen Bundesländern auch den Kampf um Einfluss und Mandate erschwert, ergo die unmittelbare politische Bedeutung der größten deutschen Partei auf dem Spiel steht.
Ohne Zweifel ist die Situation der Partei im Jubiläumsjahr auch eine Herausforderung an die Politikwissenschaft, deren exponierte Vertreter sich mit neuen Veröffentlichungen zu Wort gemeldet haben. Sie sollen in dieser Hausarbeit ebenso Erwähnung finden, wie Parteipolitiker und Praktiker der Parteiorganisation. Im Mittelpunkt der Arbeit soll die Frage stehen, ob die SPD notwendige Reformmaßnahmen ergreifen kann, um Mitgliederpartei zu bleiben, oder ob sie sich zwangsläufig zu einem losen Zusammenschluss von Wählern weiterentwickeln wird. Von besonderer Bedeutung ist dabei, dass die SPD auch exemplarisch für die deutschen Parteien stehen kann, die größtenteils mit ähnlichen Problemen und Entwicklungen zu kämpfen haben. Wird sich also in den kommenden Jahrzehnten auch das Parteiensystem in Deutschland wesentlich verändern?
1. Die Mitgliederentwicklung der SPD
Ihren Ruf als Mitgliederpartei bezieht die SPD zu Recht sicher aus dem besonderen Engagement ihrer Parteimitglieder, die mit viel Einsatz und Arbeitskraft für die Stärke der Organisation verantwortlich sind. Aber auch was die Mitgliederzahlen angeht, nimmt die SPD eine Ausnahmestellung unter den deutschen Parteien ein. Als einzige demokratische deutsche Partei hat sie mehrfach die Grenze von einer Million Mitgliedern überschritten, u.a. in den Jahren 1914 bis 1923, 1929 bis 1931 sowie zuletzt 1976 und 1977. Ihren Mitgliederhöchststand erreichte die Partei im Jahr 1923 mit 1,261 Millionen Mitgliedern. Sie ist damit die erste Massenpartei der deutschen Geschichte. Bereits seit 1976 sind die Mitgliederzahlen der Partei allerdings rückläufig, in günstigen Jahren, z.B. im Zuge der Wiedervereinigung oder im Wahljahr 1998 stagnierte die Entwicklung bestenfalls.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle: ausgewählte Mitgliederzahlen der SPD, Quelle: SPD-Parteivorstand
Größtes Problem der Partei ist ihre Überalterung. Seit 1990 überstieg zwar in mehreren Jahren die Anzahl der Parteieintritte die Anzahl der Parteiaustritte. Doch selbst im Erfolgsjahr 1998 mit fast 30 000 Neueintritten wurde kein positiver Saldo erreicht und die Mitgliederzahl sank um 1147 Mitglieder. Die Mitgliederverluste durch Todesfälle können also nicht mehr aufgefangen werden. 1974 waren rund 30,9 Prozent der Parteimitglieder unter 35 Jahren, nur 22,6 Prozent über 60 Jahre. Der Blick auf die Vergleichszahlen von 2002 macht die dramatische Entwicklung deutlich. Nur noch 8,5 Prozent der Mitglieder sind heute unter 35 Jahre alt, doch knapp 40,5 Prozent gehören der SPD-Arbeitsgemeinschaft „60plus“ an, haben also das sechzigste Lebensjahr vollendet. Im Zuge der Diskussion um das Reformprogramm der Bundesregierung „Agenda 2010“ haben im Jahr 2003 bereits mehr als 25 000 Mitglieder ihr Parteibuch zurückgegeben, so dass die Mitgliederzahl inzwischen auf rund 670 000 gesunken ist. Nur wenige positive Anzeichen sind zu erkennen: Auf niedrigem Niveau ist die SPD wieder vermehrt für junge Leute interessant geworden. Im Jahr 2002 waren rund 6400 der Neueintritte unter 35 Jahre alt, dies entspricht einer Quote von 35 Prozent. Für 2003 sind ähnliche Zahlen zu erwarten. Ähnlich gute Werte erreichte die Partei in diesem Altersbereich zuletzt zum Ende der achtziger Jahre. Der Altersdurchschnitt der im Jahr 2003 ausgetreten Mitglieder ist nach Auskunft des SPD-Parteivorstands außergewöhnlich hoch, so dass sich zum Jahresende 2003 möglicherweise der Anstieg des Durchschnittsalters gegenüber den Vorjahren etwas verlangsamt.
2. Folgen der Mitgliederentwicklung für die Parteiorganisation
Die negative Mitgliederentwicklung hat für die SPD drei wesentliche Folgen: Den Verlust von Mitgliedsbeiträgen und den Verlust von kostenloser Arbeitskraft, die kommerziell ersetzt werden muss, sowie eine schlechter werdende Auswahlmöglichkeit für politisches Personal. Ein Vergleich zwischen Ende 1997 und Ende 2002[1] macht die Dramatik deutlich. Die Partei verlor in diesem Zeitraum 84005 Mitglieder, das sind 10,8%. Legt man einen ungefähren Durchschnittsbeitrag von etwas mehr als sechs Euro im Jahr 1997 und knapp sieben Euro im Jahr 2002 zugrunde, lässt sich leicht errechnen, dass die Partei im Jahr 2002 mehr als zwei Millionen Euro weniger Beiträge eingenommen hat als 1997. Verstärkt wird diese Entwicklung durch erhebliche Verluste bei der staatlichen Parteienfinanzierung bedingt durch die schlechten Wahlergebnisse bei den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, Hessen und Niedersachsen, bei denen rund 1,35 Millionen Stimmen verloren gingen. Im Bund verlor die Partei 1,7 Millionen Stimmen bei der Bundestagswahl 2002 gegenüber 1998. Die SPD reagiert darauf vor allem mit Personalabbau. „Tausende von Menschen“[2] beschäftigt sie in ihren Büros schon lange nicht mehr. Stattdessen ist die Anzahl der Hauptamtlichen zwischen 1997 und 2002 um rund zehn Prozent auf 970 gesunken[3].
3. Parteireformen in der Gegenwart
Zu Beginn der neunziger Jahre wurde erstmals nach dem Ablauf der politischen und finanziellen Glanzzeiten der siebziger Jahre die Notwendigkeit organisatorischer Veränderungen deutlich. Dies lag nicht zuletzt in der Wiedervereinigung begründet, die für die SPD auch fünf neue Landesverbände mit geringen Organisationsgraden mit sich brachte. Seit der unter Peter Glotz angestoßenen Diskussion um innerparteiliche Reformen im Jahr 1981 waren kaum weitere Ansätze zu erkennen, doch die zweijährige Amtszeit Björn Engholms als Parteivorsitzender brachte die Debatte entscheidend voran. Auf dem Bremer Parteitag 1991 wurde eine Arbeitsgruppe eingesetzt, deren wesentliche Ergebnisse schon zwei Jahre später Eingang in die Parteistatuten fanden. Ziel der maßgeblich von Engholms Bundesgeschäftsführer Karlheinz Blessing vorangetriebenen Reformen war es, die Partizipationsrechte einzelner Mitglieder zu stärken, um die Partei attraktiver zu machen. Als Nebeneffekt sollten so Entscheidungen auch aus den eingefahrenen Zirkeln der Funktionäre heraus verlagert werden. Die beschlossenen Reformen reichten aber nicht weit. Bereits zum Ende der neunziger Jahre wurde, unter neuen Vorzeichen (Regierungspartei, abnehmende Kampagnenfähigkeit in den Kommunen) erneut die Notwendigkeit struktureller Reformen deutlich. Ganz wesentlich war dabei die Statuierung des Amtes eines Generalsekretärs. Der ehemalige Bundesgeschäftsführer Franz Müntefering übernahm dieses Amt und veröffentlichte 1999 sein Diskussionspapier „Demokratie braucht Partei“, in dem er u.a. Vorwahlen, den leichteren Seiteneinstieg und eine Jugendquote forderte. Zum Ende der neunziger Jahre änderte aber ein Teil der Partei, wesentlich vertreten von Bundesgeschäftsführer Matthias Machnig, seine Meinung und sah die Zukunft der SPD weniger als Mitgliederpartei und mehr als Netzwerkpartei. Das Ziel, Mitgliederpartei sein zu wollen, wurde freilich offiziell nicht aufgegeben.
3.1. SPD 2000
Mit der Parteireform „SPD 2000“ sollten vier wesentliche Ziele erreicht werden. Erstens sollte die Aktivenquote erhöht und die Mitgliederwerbung verstetigt werden, damit die SPD Mitgliederpartei bleibt. Zweitens sollte die Beteiligung der Mitglieder und ihre Mitwirkung an politischen Entscheidungen verbessert werden. Drittens sollten neue Formen der politischen Arbeit entwickelt werden, damit die Mitarbeit in der SPD auch Spaß macht und viertens sollten die notwendigen Schritte unternommen werden, um die Mehrheitsfähigkeit der SPD zu organisieren und Wahlen gewinnen zu können.[4] Die vom Bremer Parteitag 1991 eingesetzte Arbeitsgruppe, der u.a. Björn Engholm, Karlheinz Blessing, Ulrich Maurer, Christoph Zöpel, Inge Wettig-Danielmeier und vier Mitarbeiter der Parteizentrale angehörten, hat eine Reihe von Erkenntnissen und Vorschlägen vorgelegt. Zwei der organisationspolitischen Vorschläge sind besonders bedeutsam, weil sie auf dem Parteitag 1993 in Wiesbaden in das Organisationsstatut aufgenommen wurden.
Die Urwahl von Funktionsträgern und Kandidaten für politische Ämter kann seitdem die Entscheidung von Parteigremien, in der Regel also von Delegierten auf Parteitagen, ersetzen. Das Statut sieht keine Briefwahl vor. Die Wahlparteitage werden seitdem vielerorts zu Mitgliederversammlungen bzw. Vollversammlungen umfunktioniert, auf denen alle Mitglieder Stimmrecht haben. Die Entscheidung, ob per Urwahl oder nach dem Delegiertenprinzip abgestimmt wird, liegt allerdings in der Hand der jeweiligen Parteivorstände, sie ist zwei Jahre vor einer Wahl zu treffen. In der Praxis hat sich die Urwahl von Landtagskandidaten und Bundestagskandidaten in den meisten Unterbezirken und Stadtverbänden der Partei durchgesetzt. Da zudem die kommunalen Kandidaten im Regelfall von Mitgliederversammlungen der Ortsvereine nominiert werden, kann man in Bezug auf die Kandidatenauswahl heute von einer starken Beteiligung einfacher Parteimitglieder sprechen. Während formal von einer höchst demokratischen Einrichtung gesprochen werden kann, zumal auch auf den Vollversammlungen selbst neue Kandidaten antreten können, sieht die politische Lage dennoch heute so aus, dass nur in den seltensten Fällen eine wirkliche Auswahl stattfindet. Auf der höchsten Parteiebene hat sich die Urwahl kaum durchgesetzt. Lediglich in Berlin und Bremen entschieden die Mitglieder auf der Ebene eines Landesverbandes über eine Spitzenkandidatur, in Bremen unmittelbar nach dem Wahlsieg dann auch über die Koalition. Obwohl auch die Urwahl von Kanzlerkandidaten durchaus vorgesehen war, wurde dieses Mittel weder 1994 noch 1998 oder 2002 eingesetzt. Die Abstimmung über den Parteivorsitzenden 1993 machte zwar das Instrument der Urwahl populär, weil die Art der Entscheidungsfindung weit über die deutschen Grenzen hinaus Beachtung fand. Tatsächlich handelte es sich aber hier nur um eine konsultative Mitgliederbefragung, weil das Ergebnis, das Rudolf Scharping vor Gerhard Schröder und Heidemarie Wieczorek-Zeul sah, schließlich von einem Parteitag bestätigt werden musste. Scharping verlor sein Amt 1995, vom Parteitag bestimmt, an Oskar Lafontaine. Gerhard Schröder beerbte 1999, ebenfalls durch Delegierte gewählt, wiederum Lafontaine. Das Instrument von Mitgliederbefragungen und Urwahlen hat sich also gerade auf der höchsten Parteiebene nicht durchgesetzt, genau dort also wo einfache Parteimitglieder gern Mitspracherechte wahrnehmen würden.
[...]
[1] Alle folgenden Angaben vom SPD-Parteivorstand.
[2] Vgl. Machnig, Matthias: Organisation ist Politik - Politik ist Organisation, S. 37, in: Forschungsjournal Neue Soziale Bewegungen, Jg. 14, Heft 3, 2001.
[3] Nach Angaben des SPD-Parteivorstands.
[4] Vgl. Engholm, Björn: Vorwort, in: Blessing, Karlheinz: SPD 2000. Die Modernisierung der SPD, Marburg 1993.
- Arbeit zitieren
- Diplom-Politikwissenschaftler Dennis Buchner (Autor:in), 2003, Erfolge und Misserfolge sozialdemokratischer Organisationspolitik und ihre Auswirkungen auf die Partei und das Parteiensystem, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/32002
Kostenlos Autor werden


















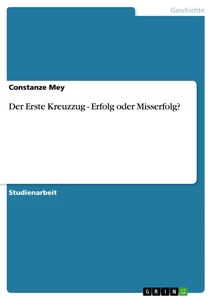
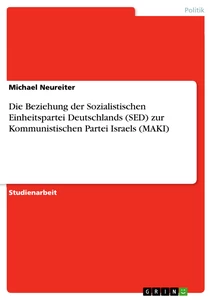
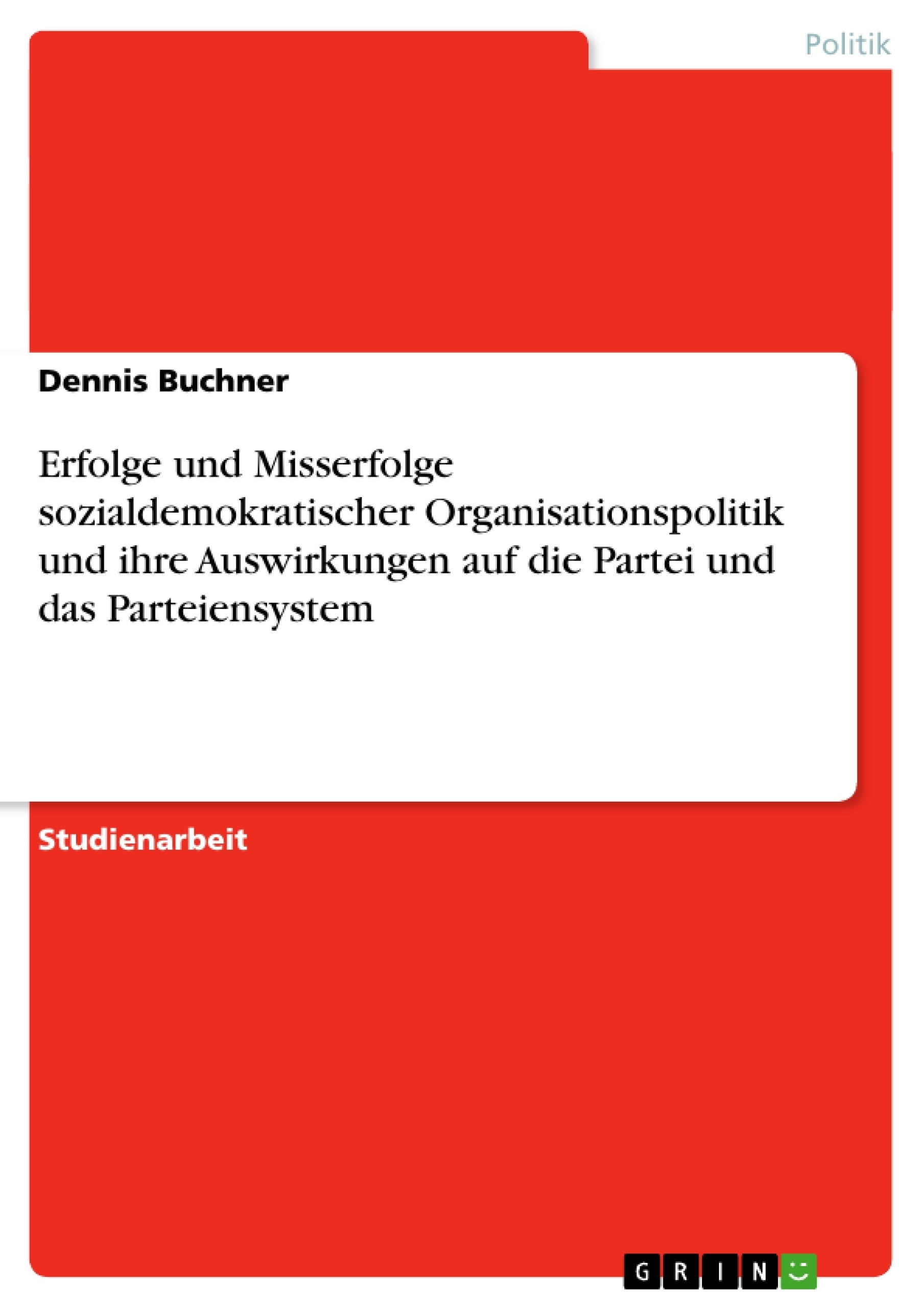

Kommentare