Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
0. Abbildungsverzeichnis
1. Einleitung
2. Definition und Grundlagen zum Begriff Transition und Kooperation
2.1. Transition, Übergang
2.2. Kooperation
2.2.1. Definition
2.2.2.Gesetzliche Lage und Nutzen der Kooperation
2.2.3. Motive der Kooperationsproblematik
3. Übergang vom Kindergarten in die Grundschule
3.1. Theorien zum Übergang in die Grundschule
3.1.1. Übergang aus ökopsychologischer Sicht
3.1.2. Übergang aus ökosystemischer Sicht
3.1.3. Übergang bedeutet psychischer Stress
3.1.4. Übergang als kritisches Lebensereignis
3.1.5. Übergang als ko-konstruktiver Prozess
3.1.6. Der Übergang in Anbetracht der Risiko- und Schutzfaktoren
3.1.7. Zusammenfassung
3.1.8. Diskontinuität vs. Kontinuität
3.2. Forschung zum Übergang in die Grundschule
3.2.1. Überblick über die Forschung zum Übergangsprozess und -bewältigung ..
3.2.2. Überblick über die Forschung bezüglich Kooperation im Übergang
3.2.3. Zusammenfassung
4. Modellprojekt „Das letzte Kindergartenjahr als Brückenjahr zur Grundschule“
4.1. Entwicklung/Aufbau
4.2. Orientierungslinien
4.3. Exkurs: „Frühes Lernen“ in Bremen
5. Fragestellung
6. Empirie
6.1. Stichprobe
6.2. Methodische Reflexion
6.3. Durchführung
6.4. Deskription und Ergebnisse
6.5. Interpretation und Diskussion
7. Ausblick
8. Literatur
9. Anhangsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
1. Lazarus kognitiv-motivational-emotives System Aus: Schützwohl, 2002: (Internetquelle) Anhang 1
2. Transition als ko-konstruktiver Prozess Aus: Griebel/Niesel (2005b): 225; rote Markierung nachträglich eingefügt
Übersicht über die Stichprobe Selbst entworfen Anhang 3
Beispiel für eine SWOT Matrix Selbst entworfen, in Anlehnung an Lombrser/Abplanalp (2005): 198
1. Einleitung
Jan ist ein sechs Jahre alter Junge und kommt in zwei Monaten in die Schule. Er möchte jedoch nicht, denn all seine Freunde bleiben entweder noch ein Jahr im Kindergarten oder gehen auf eine andere Schule. Zudem sagen seine Eltern immeröfter zu Jan, dass mit der Schule der Ernst des Lebens beginne, und sein Freund berichtet von seiner strengen Klassenlehrerin. Jan befindet sich zu diesem Zeitpunkt auf der einen Seite einer Brücke, die erüberqueren muss
- an einigen Stellen fehlt das Geländer und auch einige Holzbretter auf dem Boden sindmorsch. Jan ist unsicher, ob es ihm gelingt diese Brücke zuüberqueren.
Diese Situationsbeschreibung zeigt in einer Metapher, wie schwer der Schulbeginn für Kinder sein kann. Unsicherheit und Unlust auf Schule kann zu einer misslungenen Übergangsbewältigung führen, welche wiederum negative Auswirkungen auf das Indi- viduum und seine Zukunft haben kann. Eine gelungene oder missglückte Übergangs- bewältigung besitzt eine Bedeutung für die Beschreitung nachfolgender Übergänge und somit für die weitere biografische Entwicklung des Menschen (vgl. Franken, 2004; Kieinig, 2002). Folglich ist eine erfolgreiche Bewältigung dieser Übergänge sehr be- deutsam. Wie bei Jans Situation zu vermuten, wurde in Studien herausgefunden, dass dem Kind nahestehende Personen negativen, aber auch positiven Einfluss auf seine Übergangsbewältigung haben können (vgl. Griebel/Niesel, 2004; Beelmann, 2006).
Gerade der Übergang vom Kindergarten1 in die Grundschule ist u.a. laut Kienig (2002) sowie Griebel und Niesel (2004) besonders bedeutend in Bezug auf die weitere Ent- wicklung und die Bewältigung der nachfolgenden Übergänge. Ein gelungener Schulbe- ginn kann positive Auswirkungen auf den Schulabschluss und somit Einfluss auf die Zukunftschancen haben. Egal, ob das Kind bereits zuvor eine Kindertageseinrichtung besucht hat oder vom Elternhaus direkt in die Schule eintritt: jedes Kind ist ab einem gewissen Alter in Deutschland schulpflichtig und muss den Schuleintritt bewältigen. Der Schulanfang stellt für das Kind „eine vielschichtige biografische Erstsituation dar“ (Schneider, 2004: 202), die ein hohes Entwicklungspotential für das „Selbst“ aufweist. Auf individueller Ebene erfährt das Kind eine Rollen- und Zustandsänderung und somit eine Identitätsveränderung. Neben dem Kind selbst stellen nun auch Lehrer und Eltern (neue) Ansprüche an jenes. Hinzu kommt, dass sich die äußeren Alltagsumstände des Kindes stark ändern: Die Art des Lernens, die Raum- und Zeitstruktur unterscheiden sich erheblich zu denen im Kindergarten, bekannte Rituale werden durch andere er- setzt und auch auf sozialer Ebene sind Veränderungen zu verzeichnen: Das Kind muss seine Rolle in der Klassengemeinschaft finden, neue Freundschaften werden ge- schlossen, alte beendet. Zudem ändert sich die Bezugsperson des Kindes innerhalb der Einrichtung (vgl. Beelmann, 2006). Diese Veränderungen erfordern Kraft, um sie zu verarbeiten und sich ihnen anzupassen. Wenn dem Kind nicht genügend Ressourcen zur Verfügung stehen, kann der Übergang häufig nicht erfolgreich bewältigt werden.
Einige Autoren, darunter auch Beelmann (2000, 2006), stellen fest, dass Übergänge sowohl Chancen als auch Risiken bergen können: Die neuen Anforderungen, resultie- rend aus dem neuen Lebensabschnitt, können sich einerseits positiv auf die Weiter- entwicklung des Kindes auswirken, andererseits können durch die Erfahrung des Scheiterns jedoch auch kritische Entwicklungen entstehen oder verstärkt werden. Die Kinder, bei denen sich der Übergang als eine kritische Entwicklungsaufgabe erweist, benötigen besonders die Unterstützung aus ihrem nahen Umfeld. In aktueller Literatur wird nahezu einstimmig betont, dass bei dem Eintritt in die Grundschule die Kooperati- on von Kind, Elternhaus, Kindergarten und Grundschule eine entscheidende Rolle spielt, um bereits vor dem eigentlichen Übergang das Kind schrittweise auf die Schule vorzubereiten (vgl. u.a. Beelmann, 2000; Broström 2002; Franken, 2004). Die Aufgabe, das Kind im Übergang zu unterstützen und somit der sozialen Chancenungleichheit entgegenzuwirken, kann weder der Kindergarten, noch die Grundschule allein bewälti- gen, eine Zusammenarbeit beider Institutionen muss daher erfolgen.
Im Hinblick auf die Unterstützung im Übergang in die Grundschule wurden in den letzten Jahren in allen Bundesländern Projekte entwickelt, mit dem Ziel, den Übergang von der Elementar- in die Primarschule, oftmals in Verbindung mit einer Kooperation dieser beiden Institutionen, zu erleichtern und somit die Anschlussfähigkeit von Bildungsprozessen zu optimieren - umfassend evaluiert werden diese allerdings nur vereinzelt (vgl. Ramseger/ Hoffsommer, 2008). Zudem wurde die Zusammenarbeit beider Einrichtungen u.a. im Grundschulerlass gesetzlich verordnet.
Der internationale mathematisch naturwissenschaftliche Test TIMSS und die IGLU- Studie im Jahre 2006 belegen jedoch weiterhin Schwächen im deutschen Bildungs- und Sozialsystem. Daneben zeigt auch die hohe Zurückstellungsquote - 2002/2003 lag sie bei 6,2% - bestehende Übergangsprobleme auf (vgl. Faust/Roßbach, 2004). Trotz der aufgrund solcher Ergebnisse entfachten Debatten, welche neben der stärkeren Gewichtung der Entwicklung der pädagogischen Arbeit im Kindergarten die Zusam- menarbeit von Kindergärten und Grundschulen thematisieren, bestehen zum jetzigen Zeitpunkt bei beiden Problematiken keinerlei erfolgreiche und allgemein einheitliche Regelungen in Deutschland.
Der noch immer mangelnden Annäherung von Kindergärten und Grundschulen und dem u.a. damit verbundenen mittelmäßigen Abschneiden Deutschlands in internationa- len Vergleichen wie PISA und IGLU wird seit 2007 in Niedersachsen versucht, mithilfe des Modellprojekts „Das letzte Kindergartenjahr als Brückenjahr zur Grundschule“, kurz Brückenjahr, entgegenzuwirken. Zweimal werden für jeweils zwei Jahre die einzelnen Projekte, welche i.d.R. aus ein bis drei Kindergärten und einer Grundschule bestehen, gefördert. Das Hauptziel ist, durch Maßnahmen der Kooperation den Kindern den Übergang in die Grundschule zu erleichtern - also die „Brücke von Jan“ zu reparieren. Auf den ersten Blick scheint das Brückenjahr als idealer Weg für die Optimierung der Übergangsbewältigung der Kinder. In dem Konzept werden unter anderem Maßnah- men wie verstärkte Kooperation durch Bildung eines gemeinsamen Bildungsverständ- nisses, gegenseitige Hospitationen in der jeweils anderen Einrichtung sowie die Ent- wicklung eines gemeinsamen Beobachtungsverfahrens durchgeführt. Doch gelingen solche Aktivitäten und Maßnahmen in der Praxis tatsächlich? Evaluationen und Stu- dien, die eventuelle Problematiken innerhalb der Kooperation sowie die Wirksamkeit der Maßnahmen in Bezug auf die Übergangsbewältigung der Kinder aufzeigen, wurden jedoch zum jetzigen Zeitpunkt (noch) nicht veröffentlicht.
Aus diesem Grunde soll in der vorliegenden Arbeit eine Bestandsaufnahme aller Ol- denburger Projekte von 2009-2011 erfolgen und das Konzept auf Basis von Befragun- gen der teilnehmenden Fachkräfte nach den Stärken und Schwächen im Hinblick auf die Gegenwart und Zukunft und auf Grundlage der Theorie extern systematisch kritisch reflektiert werden. Im Vorfeld der empirischen Erhebung stellt sich nun folgende Frage:
Welche gegenwärtigen Stärken, Schwächen und zukünftigen Chancen, Risiken und Verbesserungsmöglichkeiten des Modellprojekts„Brückenjahr“können auf Grundlage derBefragungen der elementar- und primarpädagogischen Fachkräfte verbunden mit derÜbergangstheorie und -forschung aufgezeigt werden?
Mithilfe von Interviews der Fachkräfte aus den fünf Projekten soll ermitteln werden, welche positiven Veränderungen wahrgenommen wurden, aber auch welche Koopera- tionshindernisse und Übergangshindernisse in Bezug auf die Kinder bestehen bzw. aus Sicht der am Projekt beteiligten Fachkräfte bestehen könnten. Es handelt sich hierbei um eine explorative Studie, da das Projekt aktuell noch keine Evaluation veröf- fentlicht hat und der Bereich demnach noch relativ unbekannt ist und nur vage spezifi- sche Vermutungen über die Struktur und der sozialen Handlungen vorliegen.
Das Hauptziel des Projektes ist die Übergangsunterstützung der Kindergartenkinder. Auf das Kind bezogen, spielt der Faktor des Übergang bzw. der Transition eine bedeu- tende Rolle. Die Methode bildet dabei die Kooperation der Fachkräfte beider Institutio- nen, der Eltern und Kinder. Um diese Begriffe in der Arbeit verwenden zu können, be- nötigt es zunächst, neben einer konkreten Begriffsklärung beider, weiteren Grundla- genwissens. Hierunter fällt auch die Anführung möglicher Faktoren für die Probleme der Kooperation beider Einrichtungen. Diese Grundlagen werden daher im zweiten
Kapitel näher erläutert. Im darauffolgenden dritten Kapitel wird speziell der Übergang vom Kindergarten in die Grundschule näher betrachtet. Um die Übergangsthematik, und teilweise auch -problematik, begreifen zu können, ist es notwendig, zunächst die theoretischen Grundlagen des Übergangsprozesses vom Kindergarten zur Grundschu- le genauer zu beleuchten. Griebel und Niesel (2004) greifen in ihrem Transitionsansatz auf einige Theorien zurück. Zudem existieren einige internationale sowie nationale Forschungen in Bezug auf die Übergangsbewältigung des Kindes und die Kooperatio- nen von dem Elementar- und Primarbereich während des Übergangs, auf die im fol- genden Teil eingegangen wird. Die Forschung dieser Arbeit bezieht sich auf das nie- dersächsische Modellprojekt Brückenjahr und soll die Vor- und Nachteile bzw. Proble- matiken des Projektes aufwerfen. Im vierten Kapitel werden daher der Aufbau und die Inhalte des Projektes detailliert erläutert und mit dem Projekt „Frühes Lernen“ aus Bremen verglichen. Im fünften Kapitel wird die Notwendigkeit der Arbeit begründet und die konkrete Fragestellung erläutert. Darauffolgend wird im sechsten Kapitel die hier vorliegende Studie näher geschildert: neben der Beschreibung der Stichprobe wird zudem die Methode der SWOT Analyse näher beschrieben, auf die das verwendete leitfadenorientierte Interview aufbaut, um anschließend die inhaltlichen Ergebnisse auf Basis der Theorie und Empirie zu beschreiben und zu interpretieren. Auf Grundlage der Ergebnisse folgt darauf im letzten Teil, dem siebten Kapitel, ein Ausblick.
2. Definition und Grundlagen zum Begriff Transition und Kooperation
2.1. Transition, Übergang
Sucht man in Lexika nach dem Begriff „Übergang“, so sucht man meist vergebens. Trotz dem - besonders in den letzten Jahren - steigendem pädagogischen Interesse an und der Diskussion über Übergänge, „hat sich der Terminus als Fachbegriff bisher nicht in den Lexika festgesetzt“ (Däschler-Seiler, 2004: 15). Fest steht allerdings: Ein Übergang liegt zwischen etwas. Im wörtlichen Sinne bedeutet er eine physikalische Überschreitung, eine Unwegsamkeit oder aber eine Methode oder Anlage, welche es ermöglicht diese zu überschreiten, wie etwa eine Brücke. Übergang in diesem operati- ven Sinne bedeutet in Bezug auf die Schule den bloßen Ortswechsel von dem Kinder- garten in die Grundschule und die damit verbundenen Veränderungen und Maßnah- men (vgl. Carle/Samuel, 2007). Diese operative Betrachtung des Übergangs wird je- doch seiner Bedeutung nicht gerecht. Im pädagogischen Sinne sind Übergänge lang- andauernd und bringen umfassende Veränderungsprozesse mit sich, die sich auf ver- schiedenen Ebenen abspielen. Für Cowan etwa bedeuten Übergänge „longterm processes that result in a qualitative reorganization of both inner life and external be- havior“ (1991: 5). Zudem kommt den Übergängen „im Lebenslauf eine Mittlerfunktion zwischen der zurückliegenden, strukturbestimmten und der prinzipiell strukturoffenen, zukünftigen Lebensphase zu“ (Carle/Samuel, 2007: 12). In Übergangsphasen lässt das Individuum das vertraute Leben zurück und begibt sich in eine neue, ungewohnte Le- benssituation, welche häufig mit Risiken, aber auch mit Chancen verknüpft sein kann. Charakteristisch für solche Phasen sind lernintensive Veränderungen. Das Individuum steht vor einer Bündelung von Belastungen, da es sich auf verschiedenen Ebenen wie (soziale, psychische etc.) anpassen muss. Bei der Anpassung steht das Individuum vor der Aufgabe, das Vergangene in das Jetzige zu integrieren (vgl. Griebel/Niesel 2004).
Laut Welzer (1993) forscht die Transition an der Schnittstelle von individueller Bewälti- gung und den gesellschaftlichen Handlungsanforderungen, welche an das Individuum gestellt werden. Wassilios Fthenakis weist daraufhin, dass bei Transitionen Verände- rungen auf der individuellen, interaktionalen und kontextuellen Ebene stattfinden (vgl. Hense/Buschmeier, 2002). Finden die Veränderungen und Neuerungen nicht auf die- sen drei Ebenen statt, so handle es sich nicht um eine Transition. Es ist demnach nicht das Lebensereignis als solches, das eine Transition darstellt, sondern die Verarbeitung und Bewältigung von jenem. Weiteres hierzu ist Kapitel 3.1.5. zu entnehmen.
Die Begriffe „Übergang“ und „Transition“ werden oftmals in einem Atemzug genannt. Laut Kluczniok und Roßbach (2008) könne der aus dem Englischen stammende Begriff „Transition“ auf einen wissenschaftlichen Forschungsbezug zurückgreifen, der Begriff „Übergang“ hingegen werde häufig ohne einen Forschungszusammenhang oder einer -fundierung im Hinterkopf verwendet. Entgegen dieser Meinung spricht Däschler-Seiler (2004) davon, der neuerdings vermehrt verwendete Begriff „Transition“ sei gleichbe- deutend mit dem „Übergang“ und bringe somit keinen Erkenntnisgewinn. Auch im wis- senschaftlichen Kontext wird oftmals von Übergängen gesprochen oder beide Begriffe scheinbar wahllos benutzt. Griebel und Niesel (2004) verwenden den entwicklungspsy- chologisch gestützten Fachbegriff „Transition“ lediglich im Hinblick auf ihren teilweise entwicklungspsychologisch fundierten Transitionsansatz. Im Rahmen der Arbeit wird, angelehnt an Griebel und Niesels Vorgehen, der Begriff „Übergang“ verwendet und lediglich in Bezug auf den Transitionsansatz die Bezeichnung „Transition“ verwendet.
Einige Autoren wie Broström und Wagner (2003) unterscheiden zudem zwischen vertikalen und horizontalen Übergängen. Ein alltäglicher Wechsel im Tagesablauf, etwa von der Familie in den Kindergarten und zurück in die Familie, wird als horizontaler Übergang bezeichnet, wohingegen ein vertikaler ein Wandel im Lebenslauf bedeutet. Die im Kapitel 3 angeführten Untersuchungen und Theorieansätze beziehen sich hierbei ausschließlich auf vertikale Übergänge. Auf die horizontale Form wird sich in dieser Arbeit nicht weiter bezogen, da sich das Brückenjahr auf einen vertikalen Übergang, vom Kindergarten in die Grundschule, bezieht.
2.2. Kooperation
2.2.1. Definition
Der Begriff „Kooperation“ wird in der Literatur als gängige Methode in Bezug auf das Hauptanliegen, den Kindern den Schuleintritt zu erleichtern, genannt. Doch was genau wird bezogen auf die Kooperation von vorschulischen und schulischen Einrichtungen unter dem Begriff „Kooperation“ verstanden?
„Kooperation ist bewusste, von allen Beteiligten verantwortete, zielgerichtete, gleich- wertige und konkurrenzarme Zusammenarbeit“ und „fällt nicht vom Himmel, sondern findet im Kontext konkreter struktureller Bedingungen statt und muss auf sachlicher, persönlicher und der Beziehungsebene von den beteiligten Personen immer wieder neu erarbeitet werden“ (Lütje-Klose/Willenbring, 1999; zit. in Hense/Buschmeier, 2002:
9). Kooperation ist demnach eine Zusammenarbeit von mindestens zwei Personen, in der alle Partner gleichberechtigt sind und gemeinsam ein Ziel verfolgen. Zudem soll sie allen Partnern Gewinn bringen und findet in einem gewissen strukturellen Rahmen statt. Zudem ist sie ein Prozess, sie verändert sich stetig und entwickelt sich weiter - und ist somit auf Dauer angelegt. Haeberlin et al beziehen sich in ihrer Definition konk- reter und zusammenfassend auf die Kooperation der Institutionen Kindergarten und Grundschule: Kooperation ist „(1) ein vom Demokratiegedanken bewusst geprägter und vom Bemühen aller beteiligter Personen getragener dynamischer Prozess, der (2) im pädagogischen Handlungsfeld eines [...] Kindergartens oder einer [...] Regelklasse stattfindet, wo Persönlichkeits-, Sach-, Beziehungs- und Organisationsprobleme die Zusammenarbeit erschweren, mittels (3) dessen nach dem Modus der Annäherung eine befriedigende Einigungssituation hergestellt werden soll, (4) mit dem Ziel, im ge- meinsamen Lernprozess Handlungsspielräume zu erweitern und damit Entwicklungs- und Sozialisationsprozesse optimal zu unterstützen“ (1992: 24).
Durch Unterschiede in vielen Bereichen steht die Kooperation von Kindergarten und Grundschule in einem Spannungsverhältnis, so dass für eine erfolgreiche Kooperation auf beiden Seiten Kompromisse zugelassen werden müssen (vgl. ebd.). Die Inhalte dieser Zusammenarbeit sind unterschiedlich. Eine erfolgreiche Kooperation zwischen beiden Institutionen charakterisiert sich aber dadurch, dass sie langfristig angelegt ist und auf eine anhaltende Weiterentwicklung zielt. Zudem bezieht sie lokale Gegeben- heiten mit ein, greift auf eine Erziehungspartnerschaft mit den Eltern zurück, setzt eine gleichwertige Partnerschaft voraus und beachtet die gesetzlichen Grundlagen (vgl. Bertelsmann Stiftung, 2007). Im Zentrum der Kooperation sollte stets die Unterstützung und somit das Wohl des Kindes stehen. Um den Kindern einen kontinuierlichen Über- gang in die Schule zu ermöglichen, müssen sich beide Einrichtungen austauschen und teilweise gemeinsam arbeiten. Weitere und konkretere Notwendigkeiten ergeben sich aus den im 3. Kapitel beschriebenen Theorien und Studien bezüglich des Übergangs.
2.2.2.Gesetzliche Lage und Nutzen der Kooperation
Die institutionelle Kooperation ist in Deutschland gesetzlich verankert. Bereits seit 1988 ist diese etwa in der Grundschulordnung in Rheinland-Pfalz vorgesehen und im Jahre 1994 wurde eine gemeinsame Richtlinie aller Länder zur Kooperation verfasst. Seit neuerer Zeit liegen in jedem Bundesland Empfehlungen zur Gestaltung der Zusam- menarbeit vor. Der niedersächsische Orientierungsplan für Bildung und Erziehung (vgl. Nds. Kultusministerium, 2005) sieht u.a. vor, dass der vorschulische Bereich transparenter für die Eltern und den Primarbereich werden soll. Dieser dient jedoch, wie bereits der Name vermuten lässt, lediglich der Orientierung und wird nicht mit einer solchen Intensität verfolgt, wie es vermutlich der Fall wäre, wenn die Maßnahmen kont- rolliert werden würden. Zudem finden laut Roßbach (2006) kaum Evaluationen statt, so dass offen bleibt, ob der Inhalt der Pläne tatsächlich umgesetzt wird und ob die angest- rebten Ziele erreicht werden.
Im Erlass des Niedersächsischen Kultusministeriums 2004 für die Arbeit an der Grundschule wird eine Kooperation beider Einrichtungen gefordert: „Um die Kontinui- tät der Bildungs- und Erziehungsarbeit sicher zu stellen, arbeitet die Grundschule mit dem Kindergarten zusammen“ (Niedersächsisches Kultusministerium, 2004: 3.5.). Ob- wohl der Erlass gesetzlich verankert ist, besitzen auch diese Bestimmungen häufig lediglich einen empfehlenden Charakter. Dies ist bedauerlich, da die Kooperation bei- der Einrichtungen sowohl Vorteile für die Erzieher und Lehrer, als auch für die Kinder und deren Eltern birgt. Der Nutzen für die Fachkräfte liegt darin, dass sie voneinander lernen können, sie gemeinsam mehr Einfluss auf Politik haben und die Lehrkräfte die Kinder am Übergang „abholen“ können, indem sie bereits ein differenziertes Bild des Kindes haben. Für die Kinder ist eine enge Kooperation beider Einrichtungen von Vor- teil, da sie „abgeholt“ werden, sich nicht in einem Schwebezustand zwischen beiden Einrichtungen befinden, sie bereits vor dem Schuleintritt die neue Umgebung kennen- lernen, soziale Kontakte knüpfen können und das Schulleben für sie transparenter er- scheint, was zu mehr Vertrauen und Sicherheit führen kann. Die Form der anschluss- fähigen Bildung und Erziehung unterstützt die Kinder, was sich positiv auf ihre Schul- leistung und somit auf die weitere Entwicklung auswirken kann (vgl. Franken, 2004).
2.2.3. Motive der Kooperationsproblematik
Die Kooperation der beiden Einrichtungsformen ist also gesetzlich verankert und ver- pflichtend. Doch warum laufen trotz rechtlicher Grundlage die Kooperationsbemühun- gen in Deutschland schleppend voran? Ein Grund könnte in der geschichtlichen Ent- wicklung beider Institutionen liegen: Das Verhältnis der Institutionen Kindergarten und Grundschule kann seit Beginn ihrer Existenz vielmehr durch Abgrenzung als durch Annäherung beschrieben werden. Anfang des 19. Jahrhunderts wurden die jüngeren Kinder aus der Schule ausgegrenzt, um die älteren Schüler störungsfrei unterrichten zu können. Daraus resultierend entstanden so genannte „Kleinkinderschulen“, die etwa ein Jahrhundert lang existierten. Diese hatten lediglich den Sinn einer „Bewahranstalt“ der jüngeren Kinder ärmerer Schichten, von denen beide Elternteile erwerbstätig war- en, und waren nicht als Bildungseinrichtungen (für alle Kinder) zu bezeichnen. Fried- rich Fröbel richtete jedoch bereits 1840 den ersten Kindergarten ein, der offen für Kin- der aller Schichten war und zudem eine Bildungsfunktion besaß. In seinem Konzept war erstmals ein Bezug zwischen Kindergarten und Grundschule erkennbar, denn Frö- bel schrieb dem Kindergarten eine Vermittlerrolle zu, indem in jenem die Kinder von ihrer kindlichen zu einer strukturierten Bildung geführt werden sollten. Somit war Fröbel einer der ersten Pädagogen, der dem Vorschulalter eine Bedeutung auf die weitere Schullaufbahn beimaß. Zur Zeit der Weimarer Republik wurden 1920 beide Einrichtun- gen (weiterhin) getrennt, indem der Kindergarten der Kinder- und Jugendhilfe und die Grundschule dem Bildungssystem zugeordnet wurden. Diese Trennung der Träger- schaft besteht bis in die heutige Zeit und trägt zu der noch immer bestehenden struktu- rellen Trennung beider Institutionen bei (vgl. Roßbach, 2006; Kluczniok/Roßbach, 2008). Der vorschulische Bereich muss im Gegensatz zum schulischen Bereich auf- grund seiner Zuschreibung bis heute um gesellschaftliche Legitimation kämpfen.
Die Problematik bei der Annäherung und Kooperation kann zudem weitere strukturel- le Gründe haben, wie etwa die Tatsache, dass in einigen Bundesländern wie Bayern für beide Institutionen verschiedene Ministerien zuständig sind. Viele der Gründe resul- tieren aus der geschichtlichen Entwicklung beider Einrichtungen. Beide Bildungsberei- che sind bisher nicht auf Anschlussfähigkeit konzipiert, aufgrund von Unterschieden in vielen Bereichen. Unter anderem besteht eine Differenz in der betriebenen Pädagogik beider Einrichtungen: In den Kindergärten wird vermehrt Sozialpädagogik und informel- le Bildung betrieben, in der Grundschule hingegen wird bildungspädagogisch gelehrt und gelernt. Dort wird mit einem stoffbezogenen Bildungsbegriff gearbeitet und die Notenvergabe ist an eine Leistungsorientierung geknüpft. Im Elementarbereich hinge- gen vollzieht sich aktuell eine Wandlung zu subjektorientierter Pädagogik. „Der sub- jektorientierte Bildungsansatz betrachtet das Kind in seiner Ganzheitlichkeit, löst sich von der Vorstellung der Verwertbarkeit des Individuums und forciert Chancengleich- heit“ (Geene/Borkowski, 2009: 160): In Erziehungspartnerschaften sollen alle Akteure das Kind auf seinem Weg begleiten und unterstützen. In der Grundschule hingegen ist die subjektorientierte Pädagogik aktuell selten zu finden. Neben der unterschiedlichen Pädagogik existieren Unterschiede in der Ausbildung der Fachkräfte: Erzieher absol- vieren häufig noch immer eine Ausbildung an einer Fachschule, wohingegen Lehrer ein Hochschulstudium abschließen, was zu unterschiedlichen pädagogischen Ideologien führt (vgl. Franken, 2004). Folgen sind neben der schlechteren Bezahlung zudem eine geringere gesellschaftliche Anerkennung der vorschulischen Arbeit, aus welchem teil- weise ein Hierarchiegefälle in der Kooperation resultiert (vgl. Geene/Borkowski, 2009). Weitere Ursachen für die Kooperationsproblematik könnten zudem auf personeller (keine Vertretungskräfte), zeitlicher (unterschiedliche Tagesabläufe, keine geregelte Freistellung) und örtlicher (Einrichtungen liegen weit voneinander entfernt) Ebene zu finden sein (vgl. Griebel, 2003). Zudem existieren durch mangelnde Kommunikation teilweise Vorurteile und Missverständnisse seitens beider Einrichtungen: So befürchte der vorschulische Bereich laut Neuman (2002) durch eine Kooperation mit der Schule den Druck der Verschulung und laut Geene und Borkowski (2009) sehe er seine inno- vativen pädagogischen Ansätze wenig gewürdigt. Die Lehrkräfte hingegen seien häufig der Meinung, der vorschulische Bereich bereite die Kinder zu wenig auf die Schule vor. Die Definition von Kooperation, nämlich dass alle Beteiligten verantwortlich sind, sie zielgerichtet ist und eine gleichwertige und konkurrenzarme Zusammenarbeit erfolgt, verdeutlicht bereits die wesentlichen Barrieren der Kooperation.
In Bezug auf die Struktur der Kooperation gelten keine festgelegten Muster: „Da der Übergangsprozess [..] nicht standardisiert wurde, und Freiräume zur Ausgestaltung der gemeinsamen Arbeit belassen wurden, ist in der Praxis die Verunsicherung stellenwei- se sehr groß, sorgen unterschiedliche Interpretationen der Rechtsgrundlagen und die unterschiedliche Besetzung der Begriffe für Unstimmigkeiten“ (Geene/Borkowski, 2009: 157). Andererseits bietet der Freiraum auch die Möglichkeit, dass beide Seiten ge- meinsam ein individuelles Kooperationskonzept entwickeln können, was sich ferner positiv auf das Engagement innerhalb der Kooperation auswirken könnte (vgl. ebd.).
Dass die Übergangsbewältigung bedeutsam für die Entwicklung des Kindes ist, stand bereits früh fest: Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden einige Reformversuche wie eine Erhöhung des Einschulungsalters zur Erleichterung des Übergangs vorgenommen (vgl. Roßbach, 2006). Während der Bildungsreform Ende der sechziger Jahre wurde partiell die „alte“ Eingangsstufe eingeführt, in der die Kinder in zwei Jahren vom spielerischen zum schulischen Lernen gelenkt werden. Diese wurde allerdings aus politischen Grün- den und dem Streben der Elementarpädagogik gegen eine Verschulung bereits in den siebziger Jahren wieder abgeschafft (vgl. Horn, 1991). Auch in den neunziger Jahren gab es zahlreiche „Modellversuche und neue gesetzliche Regelungen, die den Über- gang qualitativ verbessern sollten“ (Franken, 2004: 23). Die heutigen Lösungsansätze beziehen sich noch auf die im Zuge der Bildungsreform entwickelten Vorschläge. All- gemeines Ziel war es, einen möglichst „gleitende[n] Übergang“ (Bund-Länder- Kommission für Bildungsplanung, 1976: 7) zu schaffen. Das Ziel gilt laut Griebel und Niesel(2004) jedoch als nicht umsetzbar und sollte nicht Ziel der Kooperation sein.
Selbst in der heutigen Zeit scheitern viele Kooperationen an den bereits zuvor genann- ten Unterschieden beider Institutionen in Bezug auf die Ausbildung, Ziele und Metho- den, auf örtliche Faktoren sowie in Bezug auf den Mangel an Zeit- und Personalres- sourcen (vgl. Flender, 2006). Und auch eine bereichsübergreifende Verwendung diag- nostischer Instrumente findet eher selten statt (vgl. Knauf/Schubert, 2005). Häufig ar- beitet jede Einrichtung für sich allein, die Leidtragenden sind dabei die Kinder. „Erreicht wurde [...] bis heute weder eine Eingliederung des Kindergartens in das Bildungssys- tem noch eine Angleichung der pädagogischen Konzepte von Kindergarten und Grundschule“ (Franken, 2004: 23).
Daher ist es interessant zu erforschen, ob sich auch die Fachkräfte des Brückenjahres mit jenen Kooperationsproblematiken auseinandersetzen müssen und wie sie versu- chen, diese Problematiken zu minimieren. Zudem soll in dieser Studie erfasst werden, ob die Freiräume des Projektes Brückenjahr zu einer Verunsicherung führen oder posi- tiv genutzt werden und ob gemeinsame Dokumentationsmethoden verwendet werden.
3. Übergang vom Kindergarten in die Grundschule
Der Übergang in die Grundschule ist der erste Übergang, bei dem die Kinder, Eltern, der Kindergarten und die Grundschule zusammenarbeiten (vgl. Hopf/Zill- Sahm/Franken, 2008). Obwohl dieser Übergang besonders bedeutend und die Ums- trukturierung aktuell in der Öffentlichkeit kontrovers diskutiert wird, existieren wenige empirische Forschungen, die sich auf den Schulanfang beziehen. Eine umfassende Theorie, die alle beteiligten Akteure miteinbezieht, liegt derzeit noch nicht vor (vgl. Faust, 2008). Eine erste Richtung gibt jedoch Griebel und Niesels Transitionsansatz. In diesem werden mehrere Übergangstheorien vereint. Neben den Theorien, die unter
3.1. beschrieben werden, existieren international und national Untersuchungen über den Übergang von dem vorschulischen zum schulischen Bereich bezüglich der Kooperation und der Situation aus Sicht aller Beteiligten (in Bezug auf den Hauptakteur: Das Kind). Die Übersicht über aktuelle Forschungen ist in Kapitel 3.2 zu finden.
3.1. Theorien zum Übergang in die Grundschule
Um die komplexen Prozesse, die im Übergang vorgehen, zu verstehen und zu erfas- sen, werden von Menschen verschiedene Modellvorstellungen geschaffen. So erklären Bronfenbrenner und Nickel die Prozesse aus ökologischer Sicht, Lazarus analysiert Übergänge im Hinblick auf den resultierenden Stress und Filipp betrachtet sie als kriti- sche Lebensereignisse. Diese Modellvorstellungen beziehen sich auf eine Perspektive, zusammen betrachtet jedoch entsteht ein differenziertes mehrperspektivisches Bild über die Transitionen (vgl. Carle/Samuel, 2007), welches in Griebel und Niesels Transi- tionsmodell vereint wird. Zudem werden die Prozesse des Übergangs von der Resi-lienzforschung untersucht, welche dem Kind eine individuelle, durch Unterstützungs-maßnahmen jedoch verstärkbare Widerstandskraft zuschreibt. Die empirischen Forschungsansätze beziehen sich zumeist auf Bronfenbrenners ökologischen Ansatz und auf das Modell der kritischen Lebensereignisse nach Filipp.
3.1.1. Übergang aus ökopsychologischer Sicht
Bronfenbrenner (1981), ein bedeutender Psychologe, entwickelte in den späten sech- ziger Jahren die Theorie der „Ökologie der menschlichen Entwicklung“. Übergänge finden statt, „wenn eine Person ihre Position in der ökologisch verstandenen Umwelt durch einen Wechsel ihrer Rolle, ihres Lebensbereichs oder beider verändert“ (ebd.: 43). Besonders in solchen Phasen finde laut ihm eine starke Entwicklung statt. Der Schuleintritt stellt einen ökologischen Übergang dar, da das Kind einen neuen Lebens- bereich durch den Wechsel der Institution „betritt“. Zudem verändert sich seine Rolle in diesem, denn mit dem Wechsel vom Kindergartenkind zum Schulkind werden andere Anforderungen an das Kind gestellt, an die es sich anpassen muss. Es findet eine „fortschreitende[...] gegenseitige[...] Anpassung zwischen dem aktiven, sich entwi- ckelnden Menschen und den wechselseitigen Eigenschaften seiner unmittelbaren Le- bensbereiche“ (ebd.: 37) statt. Grundlage seiner Theorie ist die Annahme, dass das Individuum in verschiedene Systeme eingebettet ist, die sich gegenseitig beeinflussen und miteinander vernetzt sind. Auch das Individuum hat Einfluss auf die Systeme. Wichtig für eine gelungene Entwicklung ist, dass die unterschiedlichen Lebensbereiche bzw. Systeme, also das Mikro-, Meso-, Exo- und Makrosystem, miteinander vereinbar sind. „Ein Mikrosystem ist ein Muster von Tätigkeiten und Aktivitäten, Rollen und zwi- schenmenschlichen Beziehungen, die die in Entwicklung begriffene Person in einem gegebenen Lebensbereich mit dem ihm eigentümlichen physischen und materiellen Merkmalen erlebt“ (ebd.: 38, hervorgehoben). Für das Kind bilden der Kindergarten und die Familie Mikrosysteme. Letzteres besteht aus den verschiedenen Familienmitg- liedern. Diese einzelnen „Elemente“ beeinflussen sich durch ihr Verhalten gegenseitig und führen somit zu einem ständigen Wandel innerhalb der Strukturen des Mikrosys- tems. Das Mikrosystem Familie steht wiederum in wechselseitiger Wirkung mit den Mesosystemen. Diese umfassen diejenigen Wechselbeziehungen zwischen den Le- bensbereichen, an denen das Kind aktiv beteiligt ist. Es existiert demnach eine Verbin- dung über eine Mittelsperson: Ein Beispiel hierfür ist die Mutter-Lehrer-Beziehung. Weitere bedeutende Systeme sind diejenigen, zu denen lediglich einzelne Familien- mitglieder Zugang haben, welche jedoch trotzdem indirekt Einfluss auf alle Familien- mitglieder haben können. Die Arbeitswelt der Eltern bildet etwa in Bezug auf das Kind eines der Exosysteme. Ein noch umfassenderes Umweltsystem ist das Makrosys- tem. Dieses umschließt allgemeine gesellschaftliche Konstrukte wie das Bildungssys-tem oder die Gesetzgebung. Dies kann indirekt Einfluss auf alle Elemente, also auch auf das Kind, haben. Die PISA Ergebnisse sind ein Beispiel für das Makrosystem: Diese führten zu Veränderungen in der Bildungspolitik und hatten u.a. Einfluss auf das Brückenjahr und somit auch auf das Kind.
Während des Übergangs des Kindes von der Familie oder Kindertageseinrichtung in die Grundschule verändern sich die verschiedenen Systeme bezogen auf das Kind nach Bronfenbrenners Theorie stärker. Mit dem Schuleintritt wandeln sich die Rollen des Kindes, die Beziehungen, in denen das Kind eingebunden ist und der Lebensbe- reich. Das Kind verlässt das Mikrosystem Kindergarten und tritt einem sich konstruie- renden Mikrosystem, der Grundschule, bei. Die Wechselbeziehungen zwischen dem Kind und den Mitgliedern des Mesosystems wandeln sich mit dem Übergang dahinge- hend, dass die Beziehungen sich verändern und neue geknüpft bzw. alte beendet wer- den. Bronfenbrenner schreibt den ökologischen Übergängen eine entwicklungsför- dernde Wirkung zu „wenn die Rollenanforderungen in den verschiedenen Lebensbe- reichen miteinander vereinbar sind“ (Bronfenbrenner, 1981: 202). Jedoch können die mit dem Übergang verbundene räumliche, kognitive und soziale Veränderung auch Gefahren für die kindliche Entwicklung bergen. Übergangsschwierigkeiten können besonders in den Mikro- und Mesosystemen auftreten. So kann es dem Kind etwa schwer fallen, das neue System mit dem alten, also der Familie, zu vereinbaren. Das Kind muss sich an die neuen Rollen und Erwartungen anpassen und ist konfrontiert mit neuen Handlungsweisen. Daneben kann der Wechsel der Bezugsperson zu Proble- men führen, wenn das Kind die vertraute Kindergärtnerin verlassen muss und der noch unbekannten Lehrerin nicht vertrauen kann. Bronfenbrenner empfiehlt aufgrund seines Modells, dass Kinder den Übergang in die Schule nicht allein vollziehen sollen. Seine vertrauten Personen sollen es unterstützen, möglichst früh über die gestellten Anforde- rungen und Aktivitäten im Bilde sein und sich austauschen (vgl. Carle/Samuel, 2007). Schneider (2004) folgert daraus, dass es bedeutend sei, bei Einschulungskonzepten die Familienperspektive verstärkt mit einzubeziehen und den Eltern Unterstützung an- zubieten. Bronfenbrenners Empfehlung steht eng zusammen mit der Forderung nach Kooperation aller beteiligten Akteure (vgl. Griebel/Niesel, 2004; Nickel, 1990).
Die ökopsychologische Theorie hat sich in der Übergangsforschung „als sehr fruchtbar erwiesen“ (Griebel/Niesel, 2004: 87). Bronfenbrenner betont, dass der Verlauf der Ent- wicklung des Kindes abhängig von den jeweiligen Umgebungen sei und akzentuiert die Breite an verschiedenen Anforderungen, welche an die Kinder gestellt werden, und weiterer Beteiligter, die zwischen den Systemen wechseln müssen. Neben seinem Erfolg wird Bronfenbrenners Modell auch kritisch betrachtet. So wurde bemängelt, dass Zwischenstufen fehlen (Nachbarschaft, Stadtviertel). Griebel und Niesel kritisieren, dass die Frage, „Wie Diskontinuitäten beim Wechsel zwischen Systemebenen bewäl-tigt werden und welche Kompetenzen dazu erforderlich sind“ offenbleibt, „ebenso wie zwischen Kindergarten und Schule ein „gleitender“ Übergang hergestellt werden soll [...], obwohl Diskontinuitäten zwischen den Systemen bestehen bleiben“ (2004: 87). Besonderes Augenmerk der Kritiker gilt zudem der Tatsache, dass der Begriff "System" nicht eindeutig definiert wird - zum einen sei dieser zu grob, zum anderen weisen die Systeme verschiedene Bezüge auf: das Makrosystem bezieht sich auf Strukturähnlichkeiten, das Mikrosystem hingegen auf konkrete Settings wie dem Kindergarten. Für die Übergangsforschung hat Bronfenbrenner jedoch einen entscheidenden Betrag geleistet. Die Betonung qualitativer Veränderungen und seine Empfehlung der systematischen Beeinflussung durch Förderung ökologischer Übergänge mittels Verbindungen zu Mesosystemen (Kooperationen Kindergarten, Grundschule, Elternhaus) rechtfertigt die Erwähnung Bronfenbrenners Theorie in dieser Arbeit.
3.1.2. Übergang aus ökosystemischer Sicht
Nickel bezog Bronfenbrenners Übergangstheorie auf die Einschulungsprozesse. Schul- fähigkeit sei laut ihm das Resultat von Interaktion mehrerer Ökosysteme wie der Fami- lie, des Kindergartens und der Grundschule. Er ist der Ansicht, dass sich „Der ökologi- sche Übergang, den der Schüler vollziehen muss, [...] aus einem Wechsel des Meso- systems, in dem die familiäre Teilkomponente konstant bleibt, die außerfamiliäre aber wechselt“ (Nickel, 1990: 222) ergibt. Die erfolgreiche Bewältigung dieses Übergangs spielt für die Entwicklung des Individuums eine bedeutende Rolle, da diese die psychi- sche Entwicklung fördert. Übergänge sind jedoch verbunden mit hohen Anforderungen bezüglich der Anpassungsfähigkeit an die in der Grundschule bestehenden sozialen und physischen Umgebungen und sind daher häufig nicht leicht zu bewältigen. Ob es zu einer ungünstigen oder zu einer günstigen Entwicklung aufgrund von erfolgreicher Übergangsbewältigung kommt, hängt laut Nickel von der Art der neuen Anforderungen, ihrer Wechselwirkung und Passung mit den individuellen Ressourcen des Kindes ab. So sind drei Entwicklungsschemata im Übergang möglich:
1. Wenn die Anforderungen im Übergang sowohl qualitativ als auch quantitativ für die individuellen Ressourcen des Kindes zu hoch sind, kann dies zu einer Überforde- rung führen, was sich in Form von Resignation und somit in Wachstumsstillstand des Kindes äußern kann.
2. Wenn die neuen Anforderungen auf beiden Ebenen zu gering sind, wird das Indivi- duum vermutlich wenig bemerken und sich deshalb nicht weiterentwickeln. Somit kann das Entwicklungspotential nicht vollständig ausgenutzt werden.
3. Stimmen die Anforderungen auf beiden Ebenen mit den individuellen Ressourcen des Kindes überein, so kann das Entwicklungspotential optimal genutzt werden und der Übergang als erfolgreich gewertet werden. (vgl. Nickel, 1990)
Nickel schlägt auf Basis dieser Erkenntnis vor, die Schwellen variabel zu gestalten, so dass kein Kind scheitern muss, aber ihm auch kein „zu anspruchsloser“ Übergang beschert wird. Dies kann durch ein Modell, in dem keine Zurückstellungen vom Schulbesuch erfordert werden, geschehen (vgl. Carle/Berthold, 2004) sowie durch eine Kooperation, welche nicht ausschließlich auf Kontinuität ausgerichtet ist und Kinder abhängig von ihren individuellen Fähigkeiten im Übergang unterstützt.
In seinem Schulreifemodell zeigt Nickel das Zusammenwirken der Faktoren für die Übergangsbewältigung zur Schule auf. Der Schüler, die Schule, die Teilkomponente der Ökologie (familiäre, vorschulische und schulische Faktoren) und der gesamtgesell- schaftliche Hintergrund stehen in Wechselwirkung zueinander. Basis für eine erfolgrei- che Bewältigung sei die Kooperation und Unterstützung der drei ökologischen Kompo- nenten. Diese Unterstützung gilt als wichtige Ressource für das Kind in der Über- gangsbewältigung. Emotionale Wärme und Zuwendung der Personen aus den drei Mesosystemen „fördert sowohl die notwendigen sozialen Anpassungsleistungen als auch die kognitive Auseinandersetzung mit der Umwelt und unterstützt wesentlich alle akzidentellen und initiierten Lernprozesse“ (Nickel, 1985: 178). Offen bleibt, wie genau die Unterstützung aussehen sollte (vgl. Griebel/Niesel, 2004).
3.1.3. Übergang bedeutet psychischer Stress
Die Stresstheorie liefert eine Basis für die Erklärung von Belastungsreaktionen. Da der Übergang vom Kindergarten in die Grundschule eine Belastungssituation darstellt und somit Stress auslösen kann, ist auch dieser Ansatz in Bezug auf die hier vorliegende Arbeit von Belang und wird daher im Folgenden kurz zusammengefasst. In seinem transaktionalen Stressmodell geht Lazarus (1995) davon aus, dass psychologischer Stress die Verbindung zwischen einer sich verändernden Situation und einer denken- den und fühlenden Person zeigt. Im Laufe des Lebens wird das Individuum stetig mit solchen Situationen konfrontiert und entwickelt sich durch sie weiter.
In Abb. 1 wird ersichtlich, dass Stress aus der primären Einschätzung der wahrge- nommenen Person-Umwelt-Beziehung von der Person resultieren kann: Die eintreten- den Transaktionen werden individuell (primär) als irrelevant, positiv oder stressreich in Bezug auf das eigene Wohlbefinden und somit die subjektive Bedeutung eingeschätzt. Bei letzterer Einschätzung unterschiedet Lazarus zwischen drei Subtypen: Schädigung bzw. Verlust (bereits eingetretener Ereignisse), Bedrohung (noch nicht eingetreten) und Herausforderung (Ereignis als positive Möglichkeit). Der Prozess der Bewältigung setzt ein, sobald eine Situation als eine dieser Subtypen bewertet wird. In der sekun- dären Bewertung geht es um Zuschreibung der Ursachen und die Einschätzung der eigenen Bewältigungsfähigkeit. Primäre und sekundäre Bewertungen beeinflussen einander bezüglich der Bewertung des Stressausmaßes sowie Qualität der emotiona-len Reaktionen. Durch diesen Bewertungsprozess verändern sich Handlungstenden-zen, die subjektiven Empfindungen und es treten körperliche Veränderungen ein. Wenn keine Zielübereinstimmung wahrgenommen wird, versucht das Individuum häufig, die Person-Umwelt Beziehung so zu verändern, dass sich die Inkongruenz aufhebt. Dies passiert durch den Versuch, die Beziehung anders wahrzunehmen oder anders zu bewerten (e motionsorientierte Be-wältigung), oder durch den Versuch, die Umweltvariablen durch erhöhte Anstrengung zu verändern (problem-orientierte Bewältigung).
Wie die Bewältigung von Veränderun- gen ausfällt, hängt davon ab, ob die Veränderungen von längerer Dauer sind, sie größeren Ausmaßes sind, sie von dem betroffenen Individuum er- Abb. 1: Lazarus kognitiv-motivational-emotives System wünscht sind und ob es jene kontrol- (Vergrößerung: Anhang1)
lieren kann. Zudem ist es von Bedeutung, über welche Ressourcen das Individuum verfügt. Die Bewältigung ist beeinträchtigt und verursacht psychischen Stress, wenn die ersten beiden Faktoren gegeben sind, die nächsten beiden jedoch nicht. Lazarus ist ähnlich wie Nickel und Filipp (Kap. 3.1.4) der Ansicht, dass sich eine erfolgreiche Bewältigung positiv auswirken kann.
Kinder werden bei ihrem Schuleintritt neben den unterschiedlichen Umweltbedingun- gen (wie Unterstützung der Eltern, soziale Kontakte etc.) einen sehr unterschiedlichen Grad an Selbstbewusstsein haben. Somit bilden nach Lazarus Theorie häufig Kinder mit niedrigem Selbstbewusstsein und wenig Unterstützung von nahestehenden Perso- nen die Risikogruppe bei der Übergangsbewältigung. Das Selbstbewusstsein hat gro- ßen Einfluss darauf, ob ein Kind den Übergang als stressreiche Phase erlebt oder nicht. Die Umweltbedingungen können jedoch teilweise so verändert werden, dass das Selbstbewusstsein gestärkt und das Kind mehr unterstützt wird - so fällt der primäre Bewertungsprozess in Bezug auf den Schuleintritt vermutlich weniger negativ bzw. stressreich aus. Für die Kooperation bedeutet dies also, dass das Selbstbewusstsein der Kinder gestärkt und der Aufbau von internen und externen Ressourcen seitens der Eltern und anderer im Übergang einbezogener Personen unterstützt werden muss (die Herangehensweise wird als „Buffering-Effekt“ bezeichnet: vgl. Wills/Cleary, 1996).
Überlastungsreaktionen sind vermeidbar, wenn Veränderungen im Umfeld des Kindes minimiert, vorhersehbar und kontrollierbar gestaltet werden, denn so kann ein Kind mit positivem Selbstbild und hoher Kontrollüberzeugung aktiv auf die Stress erzeugenden Aspekte einwirken und versuchen, diese (auf) zu lösen. Aufgrund dessen kann die Stressforschung laut Griebel und Niesel „als Hintergrund für die Kontinuitätshypothese angesehen werden“ (2003: 138/139; vgl. Kap. 3.1.8). Zudem ist die motivationale Ebe- ne wie Vorfreude oder Angst vor den schulischen Veränderungen zu berücksichtigen.
3.1.4. Übergang als kritisches Lebensereignis
Veränderungen im Lebensumfeld des Kindes, die ihm ein hohes Bewältigungspotential abverlangen, lassen sich im Zusammenhang mit der Entwicklung über die Lebens- spanne als normative kritische Lebensereignisse (vgl. Filipp, 1995; Filipp/Aymanns, 2010) betrachten. Dazu gehört auch der Übergang in die Schule (vgl. Beelmann, 2000). Die entwicklungspsychologische Forschung integriert Aspekte des ökopsycho- logischen Modells sowie der Stresstheorie und untersucht, wie kritische Lebensereig- nisse über die Lebenszeit hinweg auftretende Veränderungen von Personen erklären können. Kritische Lebensereignisse sind „als Eingriff in das [...] Passungsgefüge zwi- schen Person und Umwelt“ (Filipp, 1995: 9) zu verstehen, wenn dieser Eingriff zudem von der Person als emotional bedeutend eingeschätzt wird. Zudem sind sie notwendig für Entwicklung des Individuums und somit Veränderung (vgl. Beelmann 2006). Kriti- sche Lebensereignisse machen eine aktive Neuanpassung von Verhalten notwendig, um das Gleichgewicht zwischen der Person-Umwelt-Beziehung herzustellen. Beim Schuleintritt ändert sich die Kind-Umwelt-Passung, indem die Umwelt „Kindergarten“ in die der „Grundschule“ gewechselt wird - dieser Übergang wird von Kind mit starken Emotionen und Stress erlebt (vgl. Griebel/Niesel, 2004; Lazarus, 1995). Außer Belas- tungen und schädigenden Wirkungen, wenn Bewältigungsressourcen nicht ausreichen und das Kind scheitert, kann ein kritisches Lebensereignis jedoch zudem eine entwick- lungsfördernde Herausforderung darstellen, wenn das Kind den Übergang erfolgreich bewältigt. Aus Befunden folgert Filipp (1995), dass soziale Unterstützung als kontex- tuelle Ressource fungiert. Durch Unterstützung von Eltern und Fachkräften schätzt das Kind das kritische Lebensereignis, den Schuleintritt, positiver ein und bewältigt ihn ak- tiv. Bereits das Wissen um eine konstante Unterstützung erleichtert den Umgang mit Belastungssituationen (vgl. Filipp/Aymanns, 2010; Lazarus, 1995). Ein Vorteil des Le- bensereignisses Schuleintritt ist, dass er feststeht und somit vorhersehbar ist. So kön- nen Unterstützungsmaßnahmen bereits früh geplant und durchgeführt werden.
3.1.5. Übergang als ko-konstruktiver Prozess
Der Transitionsansatz wurde von Cowan (1991) entwickelt, um Übergänge innerhalb der Familie zu beschreiben. Griebel und Niesel (1999; 2003; 2004; 2005a, b) übertru- gen diesen auf den Übergang Kindergarten-Schule, da er sich laut ihnen zur Umset- zung der Transitionsbegleitung eigne. Ziel der Übergangsbetrachtung ist es allerdings nicht ein ausgefeiltes theoretisches Modell zu entwickeln, sondern „der pädagogischen Praxis ein Instrument zur Verfügung zu stellen, das die Grundprinzipien der Über- gangsbewältigung berücksichtigt“ (Griebel/Niesel, 2004: 119). In ihm werden neben den genannten theoretischen Ansätzen (Kap. 3.1.1. - 3.1.4) die Identitätsentwicklung des Einzelnen, sein Selbstkonzept und die Verortung des Selbst in der eigenen Le- bensbiografie bei Übergängen berücksichtigt.
In Anlehnung an den Systemansatz besitzen Systeme im Transitionsansatz Wirkwei- sen, dessen Ereignisse und Reaktionen im Gegensatz zu bloßen Ursache-Wirkungs- Modellen zirkulär verlaufen. Ferner werden die individuellen und sozialen Ressourcen miteinbezogen: Die Bewältigung der Transition kann nicht von dem Kind allein vollzo- gen werden: „Die Entwicklung des Einzelnen wird nur innerhalb des sozialen Kontextes verstehbar“ (Griebel/Niesel, 2004: 93/94). Anforderungen und Normen von Bezugsper- sonen sowie soziale und materielle Umweltbedingungen wirken auf die individuelle Entwicklung des Kindes ein und fördern oder hemmen sie. Das Kind interagiert mithilfe von Kommunikation wechselseitig mit den Umweltbedingungen und setzt somit Ent- wicklungs- und Lernprozesse, sogenannte soziale Konstruktionen, in Gang. Der Über- gang vom Kindergarten in die Schule wird somit als Ko-Konstruktion des Kindes mit seiner Umwelt, den sozialen Systemen, begriffen. Bei der Bewältigung der Transition sind nicht nur die Fähigkeiten des Individuums von Bedeutung, sondern die Kompetenz seines gesamten sozialen Systems. Bei dem Übergang in die Schule sind demnach neben dem Kind als „aktiven Bewältiger“ zudem seine Eltern, Lehrer, Erzieher und wei- tere, dem Kind nachstehende Personen, beteiligt. Somit findet eine Partizipation aller am Übergang beteiligten Personen statt. Der Schuleintritt als „kritisches Lebensereig- nis“ (vgl. Filipp, 1995) fordert von den Familienmitgliedern und auch von der Gesamt- familie hohe Anpassungsleistungen innerhalb relativ kurzer Zeit.
Ihre Rolle und Aufgaben in dem Prozess des Übergangs sind jedoch verschieden: Das Kind muss den Übergang vom Kindergartenkind zum Schulkind und seine Eltern den Übergang von Eltern eines Kindergartenkindes zu Eltern eines Schulkindes aktiv be- wältigen (linke Seite, Abb. 2). Die ErzieherInnen, LehrerInnen und weiteren Fachkräfte hingegen vollziehen nicht die Transition selbst (denn sie erfahren keine Identitätsver- änderung), sondern können mithilfe ihrer fachlichen Kompetenzen „nur“ indirekt Ein- fluss auf die Prozesse nehmen (Abb. 2, rot markiert). Hier setzt auch das Projekt Brü- ckenjahr an, indem die ErzieherInnen und Lehrkräfte die Kinder (und Eltern) durch ver-schiedene Maßnahmen unterstützen sollen. Eltern und Kinder sind also neben den aktiven Gestaltern des Übergangs zudem Rezipienten unterstützender oder begleitender Schritte der Fachkräfte (daher werden sie auf beiden Seiten der Abb. 2 erwähnt). Das Kind entwickelt Vorläuferkompetenzen, um die Transition bewältigen zu können. Um jedoch die Rolle des aktiven Bewältigers einnehmen zu können, benötigen das Kind und seine Eltern genügend Selbst-vertrauen und die Überzeugung, den Veränderungen nicht machtlos ausge- setzt zu sein, welche durch entspre- chende Maßnahmen gestärkt werden sollen. Auf die Eltern hingegen kommt beim Schuleintritt ihres Kindes eine Doppelrolle zu: Zum einen sollen sie ihre Kinder unterstützen und den Übergang moderieren, zum anderen müssen sie selbst den Übergang bewältigen. Gera- de wenn sie selbst Übergangsprobleme haben, besitzen sie weniger Ressourcen für die Unterstützung ihrer Kinder. So- mit ist für die Bewältigung des Kindes auch die Übergangsbewältigung seiner Eltern bedeutend: Wenn es den Eltern
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2: Transition als ko-konstruktiver Prozess (Vergrößerung: Anhang 2)
gelingt, während des Übergangsprozesses Beziehungen zu den Erziehern und Lehr- kräften aufzubauen, habe dies zudem positiven Einfluss auf die Entwicklung des Kin- des, so Rimm-Kaufmann und Pianta (2000). Dies unterstreicht nochmals die Bedeu- tung der Unterstützung der pädagogischen Fachkräfte. So unterschiedlich die Aufga- benbereiche der Fachkräfte auch sind, im Übergangsprozess kreuzen sich diese teil- weise und „bedürfen somit des fachlichen Austausches“ (Griebel/ Niesel, 2004: 122). Auf die Individualität der Kinder sollte in der Transitionsbegleitung eingegangen wer- den, da nicht jedes Kind die gleiche Intensität und Art der Unterstützung benötigt.
Der Übergang bringt auf verschiedenen Ebenen Veränderungen und Anforderungen mit sich, die vom Kind zu bewältigen sind: auf der individuellen, interaktionalen und der kontextuellen Ebene. Die Diskontinuitäten, auch Entwicklungsaufgaben genannt, müs- sen verarbeitet werden und das Kind muss sich ihnen anpassen. Diskontinuitäten wer- den von Griebel und Niesel als Entwicklungsaufgaben bezeichnet, um den positiven, motivationalen, entwicklungsfördernden Charakter der Herausforderung zu betonen.
Auf der individuellen Ebene findet eine Veränderung der Identität statt, indem das Kind ein Schulkind und die Eltern Schulkind-Eltern werden. Das Kind und teilweise auch die Eltern müssen aufgrund neuer Anforderungen und Aufgaben Fähigkeiten wie Selbstständigkeit, soziale und kognitive Kompetenzen erwerben und vorhandene weiterentwickeln. Innerhalb dieser Entwicklung müssen jene starke Emotionen wie Freude, Stolz, aber auch Angst und Ungewissheit bewältigen. Grundsätzlich haben die Fachkräfte keine Möglichkeit der Einwirkung auf diese Entwicklungsaufgaben. Durch positive Gestaltung der Umwelt können sie jedoch indirekt Einfluss auf die Entwicklung auf individueller Ebene der Kinder nehmen. Durch Übernahme von Ritualen aus dem Kindergarten in die Schule oder durch frühzeitiges Kennenlernen des Klassenlehrers bzw. der -lehrerin können etwa Ängste genommen werden.
Auf interaktionaler Ebene finden Veränderungen in den bestehenden Bindungen der primären Bezugspersonen des Kindes statt. Die Beziehungen müssen neu entwickelt werden (Wandel in Eltern-Kind- Beziehung) und einige (mit Kindern aus dem Kinder- garten) müssen aufgegeben werden. Es kommt zur Aufnahme neuer Kontakte zu Schulkindern. Das Kind muss sich an seine neue Bezugsperson, der Lehrkraft, gewöh- nen. Im Gegensatz zum Kindergarten haben die Kinder in der Schule mit verschiede- nen Fachkräften zu tun, so dass der Bezug zur Lehrkraft eventuell nicht so intensiv wie zuvor zur Erzieherin sein wird. Neben der Knüpfung und den Verlusten von Beziehun- gen müssen das Kind und seine Eltern eine Veränderung und einen Zuwachs der Rol- lenerwartung bewältigen sowie eine positive Einstellung zur Schule und zum Lernen entwickeln. Auf interaktionaler Ebene ist bedeutend, dass frühzeitige Informationen über Personen, Erwartungen und Zeitpläne die Anpassung erleichtern können.
Die Anforderung auf kontextueller Ebene ist, mehrere Lebensbereiche zu vereinen. So müssen von dem Kind Rollen-Erwartungen aus der Schule mit denen aus der Fami- lie vereinbart werden. Die Eltern müssen Beruf, Familie und die Anforderungen als Eltern eines Schulkindes vereinen, etwa in Bezug auf die zeitliche Einteilung der Ver- pflichtungen. Zudem muss sich das Kind an neue Strukturen und Inhalte in der Institu- tion gewöhnen. Auf kontextueller Ebene wird die Bedeutung des Einbezugs der Eltern in die Übergangsaktivitäten und die Kooperation von Kindergarten und Grundschule sichtbar. Die kontextuelle Perspektive macht zudem darauf aufmerksam, dass institu- tionelle Systeme eine Verantwortung für den Übergang tragen (vgl. Griebel, 2006). Durch die Veränderungen auf den verschiedenen Ebenen werden noch einmal die große Leistung der Bewältigung und die mit dem Übergang einhergehenden vielschich- tigen Anforderungen betont und es wird deutlich, dass zum Schuleintritt neben Fähig- keiten für schulspezifische Anforderungen zudem Basiskompetenzen ausgebildet wer- den müssen, da diese für eine erfolgreiche Transition benötigt werden.
Positiv an diesem Theorieansatz ist hervorzuheben, dass ein ganzheitliches Bild des Übergangs geschaffen und die Rolle der Eltern betont und erweitert wird. Zudem ist der Transitionsansatz in dieser Arbeit bedeutend, da er den Übergang von Kindergar-ten in die Grundschule auf vielfältige Weise beleuchtet. Trotz des hohen Lobes in vie-len Forschungen und weiteren Veröffentlichungen, existieren auch kritische Meinungen zu jenem. Roßbach etwa kritisiert, der Transitionsansatz gehe von bestehenden Über- gängen aus und versuche die Bewältigungskompetenz der Beteiligten zu erhöhen (dies gilt auch für die integrierten Theorien): „Damit bleibt aber die strukturelle Frage offen, welche institutionellen Übergänge im Bildungssystem notwendig sind“ (Roßbach, 2006: 287). Er empfiehlt, andere Strukturen im Bildungssystem zu schaffen, wie etwa die alte oder neue Schuleingangsstufe, um so institutionelle Übergänge und ihre Probleme gar nicht erst aufkommen zu lassen. Letztere verbreitet sich aktuell in deutschen Grund- schulen. Zudem, so Roßbach, sei der Ansatz zu allgemein und unspezifisch in Bezug auf den Übergang in die Grundschule, so dass er nur begrenzt fähig sei, „auf die Be- sonderheiten der kumulativen Kompetenzentwicklungen der Kinder einzugehen und die entsprechenden didaktisch-methodischen Aspekte zu thematisieren“ (ebd.: 287). Auch Faust und Roßbach (2004) äußern, dass das Transitionskonzept auf verschiede- ne Übergänge übertragen werden könne und somit zu unspezifisch für die curricularen Vorgaben des Übergangs vom Kindergarten in die Grundschule sei. Zudem werde zu wenig Bezug auf kognitive und inhaltliche Bereiche genommen, was jedoch bedeutend für die konkrete Umsetzung in der Praxis sei. Kritische Lebensereignisse können von den betroffenen Personen unterschiedlich erlebt werden und somit ist es fraglich, ob das Transitionsmodell sich eignet, „gruppenbezogene Veränderungen anzunehmen und vorherzusagen“ (Faust 2008: 228), wenn sich lediglich im Einzelfall der Schulein- tritt als krisenhafter Übergang herausstellt.
3.1.6. Der Übergang in Anbetracht der Risiko- und Schutzfaktoren
Die Resilienzforschung beschäftigt sich u.a. mit der Frage, was Kinder im Übergang stärkt und somit, welche Möglichkeiten der Bewältigung bestehen. Resilienz kann als psychische Widerstandsfähigkeit gegenüber Entwicklungsrisiken verstanden werden (vgl. Wustmann, 2004; 2005). Das Kind besitzt Schutzfaktoren, aber auch Risikofakto- ren, die je nach Individuum unterschiedlich stark ausgeprägt sind. Die Schutzfaktoren können Risiko- und Stressfaktoren aus der Umgebung kompensieren. So kann das Kind bei kritischen Lebensphasen wie dem Schuleintritt auf personale und soziale Ressourcen zurückgreifen. Erstere sind zum Beispiel kindbezogene Faktoren wie hohe intellektuelle Fähigkeiten und psychosoziale Resilienzfaktoren in Form eines hohen Selbstwertgefühls, eines positiven Sozial- und aktiven Bewältigungsverhaltens, die sich aus der kontinuierlichen Interaktion des Kindes mit seiner sozialen Umwelt und aus der erfolgreichen Bewältigung bilden. Soziale Ressourcen sind einerseits in der Beziehung zur Familie (elterliche Liebe, Stabilität, familialer Zusammenhalt) zu finden, anderer- seits im sozialen, kontextuellen Umfeld (Unterstützung aus dem sozialen Netzwerk außerhalb der Familie wie Peerkontakte) und in den Bildungseinrichtungen. Diese Fak-toren wurden mithilfe von empirischen Untersuchungen von Werner (2000) identifiziert. Risikofaktoren hingegen sind ein schwieriges Temperament (primäre Vulnerabilität) oder eine familiäre Disharmonie (Risikofaktoren/Stressoren). Der Schuleintritt wird als Phase erhöhter sekundärer Vulnerabilität angesehen: Zum einen wird von dem Kind eine hohe Anpassungsfähigkeit erwartet, zum anderen wechseln die institutionellen Risiko- bzw. Schutzfaktoren von der Erzieherin zur Lehrkraft. Die Resilienzforschung schlägt aufgrund ihrer Erkenntnisse Förderungen auf individueller und der Bezie- hungsebene vor, welche besonders die Kinder, die auf wenig personale und soziale Ressourcen zurückgreifen können, stärken sollen. An den Förderungen sollen Eltern und die pädagogischen Fachkräfte beteiligt sein. In den Bildungsinstitutionen unterstüt- zen folgende Maßnahmen die erfolgreiche Bewältigung des Übergangs: transparente und konsistente Strukturen beider Einrichtungen, wertschätzende Atmosphäre, Förde- rung von Basiskompetenzen (Resilienzfaktoren) und die Zusammenarbeit mit den El- tern und anderen Einrichtungen (vgl. Wustmann, 2004: 116). Die Eltern sollten dane- ben zudem unterstützt und gefördert werden, indem sie durch Elterntrainings im Be- reich der Konfliktlösestrategien, des positiven Modellverhaltens und der konstruktiven Kommunikationstechniken gestärkt werden und indem auf Elternarbeit und -hilfe zent- rierte Fortbildungsprogramme für Fachkräfte beider Institutionsformen besucht werden. Außerdem werden Freundschaftbeziehungen als ein Unterstützungssystem angese- hen, so dass beide Einrichtungen die Bildung von Freundschaften mit sozial kompeten- ten Peers unterstützen sollten. „Resiliente Kinder haben positive Vorbilder, die ihnen zeigen, wie man Probleme lösen kann“ (Carle/Samuel, 2007: 31). Folglich könnten Paten den Kindergartenkindern während des Übergangsprozesses helfen. In der Resi- lienzforschung wird auch die Individualität einbezogen: Kinder reagieren verschieden auf unterstützende Maßnahmen. Jungen etwa profitieren in Bezug auf ihr Bewälti- gungsvermögen im Schuleintritt stärker als Mädchen von sozialer Unterstützung. Da- neben kommt es auf die Menge und Intensität der Unterstützung an: „Multiple stützen- de Bedingungen [...] können die Chance für eine gute Anpassung trotz schwieriger Lebensbedingungen erheblich verbessern (sie summieren und verstärken sich dann gegenseitig)“ (Wustmann, 2004: 47). Ähnlich äußert sich auch Franken: „Je mehr [Ein- blicke,] Informationen und Kenntnisse das Kind über die künftige Umgebung, die sozia- len Zusammenhänge und die Anforderungen oder Erwartungen hat, um so leichter fällt ihm der Übergang“ (Franken, 2004: 5). Demnach ist es im Brückenjahr vorteilhaft, wenn das Kind viele Informationen und Einblicke in den Schulalltag bekommt.
Schneider (2004) behauptet, der Schuleintritt sei ein gesellschaftlich gesetztes Ereig- nis, da sich die Individuen zum einen vorausschauend auf den Schulbeginn vorbereiten und eine Erwartungshaltung aufbauen, zum anderen rückblickend Erinnerungen und Gefühle an dieses Ereignis haben. In der Vorbereitungsphase sind bereits gemachte Erfahrungen in Bezug auf die Schule und Bilder, die dem Kind von Personen aus sei- nem Umfeld vermittelt werden, und die subjektive Bedeutung des Statuswechsels von Relevanz. Freude auf die Schule kann durch die Erwartung auf einen höheren Grad der Selbstbestimmung und durch den nahenden Aufbau von sozialen Kontakten maxi- miert werden. Schulangst hingegen entwickelt sich dann, wenn das Kind keine oder eine vage Vorstellung von der Schule hat, wenn es Versagensängste aufgrund eines negativen Selbstbildes hat und wenn es sich aufgrund einer starken Bindung an die Eltern nicht lösen kann. „Wenn Kinder Informationen und, wenn möglich, auch direkte Anschauungen über den zukünftigen Lebensbereich Schule erhalten, begünstigt das den Übergang“ (Schneider, 2004: 221). Zudem erleichtert es den Kindern die Über- gangsbewältigung, wenn sie in der ersten Zeit auf Vertrautes wie Rituale, etwa in Form von Liedern, treffen oder wenn sie bekannte Personen wiedersehen.
3.1.7. Zusammenfassung
Der wesentliche Berührungspunkt aller angeführten theoretischen Ansätze besteht in der Annahme, dass der Übergang zur Schule eine Störung in das Gleichgewicht vom Kind und seiner Umwelt bringt, welches durch aktive Anpassung an die neuen Gege- benheiten ausgeglichen werden kann. Hierbei sollten das Kind die ihm nahestehenden Personen unterstützen. Jedoch werden nur selten konkrete Unterstützungsformen vor- geschlagen. Einige dieser Unterstützungsmaßnahmen werden in den Projekten im Rahmen des Brückenjahres durchgeführt. Zu beachten ist jedoch, dass die positive Wirkung der meisten Maßnahmen zur Übergangsgestaltung zurzeit lediglich auf Plau- sibilitätsannahmen statt auf Forschungsergebnissen beruhen (vgl. Grotz, 2005).
Das Transitionskonzept versucht, alle Ansätze zu vereinen und hat den Charakter ei- ner Rundumbetrachtung. Auf die Eltern kommt bei Griebel und Niesel ein Doppelrolle zu. Aufgrund dessen sollten die Eltern im Brückenjahr (Kap. 4) in ihrer unterstützenden Rolle bestärkt werden und selbst durch eine Erziehungspartnerschaft einbezogen wer- den. Des Weiteren sollte ihnen durch Transparenz die Unsicherheit genommen wer- den. In der Befragung der Fachkräfte sollte daher konkret nach der Elternarbeit gefragt werden, um zu ermitteln, wie stark und in welcher Form die Eltern in die Projekte ein- bezogen werden und wie die Meinungen der Befragten zur Elternarbeit ausfallen.
Die theoretischen Ansätze beziehen sich auf die Übergangsbewältigung der Kinder (und teilweise der Eltern). Sie nennen die Kooperation aller Akteure als Mittel, die Kinder in der Übergangsbewältigung zu unterstützen. Somit muss sowohl die Kooperation beleuchtet werden als auch die Effektivität der übergangserleichternden Maßnahmen - und demnach in Bezug auf den Nutzen der Kinder.
3.1.8. Diskontinuität vs. Kontinuität
Das Ziel, eine Kontinuität im Übergangsprozess über beide Institutionen hinweg her- zustellen, ist die traditionelle Vorstellung zur Übergangsbewältigung, welche seit den achtziger Jahren besteht (vgl. Griebel/Niesel, 2003). Die Kontinuität soll durch Anglei- chungsmaßnahmen auf kontextueller Ebene in Bezug auf Tagesabläufe und Materia- lien, auf interaktionaler Ebene durch frühzeitiges Kennenlernen der Lehrkraft und Schule und Kooperation beider Einrichtungen und auf inhaltlicher Ebene durch Anglei- chung der Curricula erreicht werden. Für das Kind sollen nach dem Übergang mög- lichst alle Aspekte konstant bleiben. Unterstützer dieses Ziels sind unter anderem Neuman (2002) und Margetts, (2002) und auch im Konzept des Brückenjahres lässt sich das Ziel eines gleitenden Übergangs wiederfinden. Zudem steht in dem Erlass für die Arbeit an Grundschulen: „Um die Kontinuität der Bildungs- und Erziehungsarbeit sicher zu stellen, arbeitet die Grundschule mit dem Kindergarten zusammen“ (Nieder- sächsisches Kultusministerium, 2004: 3.5., nachträglich hervorgehoben). Jedoch gibt es auch eine dem entgegengesetzte Ansicht, welche bislang hauptsächlich in Deutsch- land Zustimmung findet (vgl. u.a. Filipp, 1995; Welzer, 1993, Schneider, 2004; Nickel, 1990 und Griebel/Niesel, 2004). Diese Autoren vertreten die Auffassung, dass Diskon- tinuitäten in gewissem Maße existieren müssen, damit durch Bewältigungs- und An- passungsprozesse Entwicklung stattfinden kann. Ferner stehen die Kinder im Laufe ihres Lebens häufiger vor Übergängen und Diskontinuitäten, so dass sie die Erfahrung des Umgangs und Bewältigung von diesem bereits früh lernen sollen (vgl. Fortune- Wood, 2002). Der Schulbeginn ist laut Schneider nicht „auf eine Kontinuität hin zu glät- ten, sondern sein diskontinuierlicher Charakter ist als Entwicklungspotenz bewusst zu nutzen“ (2004: 223). Jedoch ist der Übergang nur dann entwicklungsfördernd, wenn die Veränderungen individuell passgerecht an vorhandene Erfahrungen angeknüpft werden können und er herausfordernde neue Momente enthält. Daraus folgt, dass die Fachkräfte den Übergang in die Schule je nach Individualität des Kindes teils konti- nuierlicher gestalten, teils als natürlichen Bruch belassen müssen, so dass einerseits Entwicklung durch Anpassung stattfinden kann, andererseits Kinder mit Bewältigungs- problemen behutsamer durch diesen Prozess geführt werden.
„Der Transitionsansatz erfordert [...] eine pädagogische Konzeptualisierung sowohl von [geplanter] Kontinuität als auch von Diskontinuität“ (Griebel, 2003: 194).
3.2. Forschung zum Übergang in die Grundschule
Aufgrund von internationalen und nationalen Studien über die Schulleistung wird seit einigen Jahren der frühkindliche Bereich als eigene und bedeutende Bildungsphase thematisiert. Im Zuge dessen rückt auch der zeitlich unmittelbar angrenzende Über- gang zur Grundschule in den Vordergrund. Jedoch existieren trotz der hohen Aufmerk-samkeit des Schuleintritts relativ wenige Studien (vgl. Roßbach 2006), die im Überblick kurz aufgeführt werden. Es wird eine Einteilung der Studien bezüglich der Kooperation und der Übergangsbewältigung angelehnt an Hanke (2008) vorgenommen. Beide Forschungsfelder überschneiden sich in einigen Untersuchungen.
3.2.1. Überblick über die Forschung zum Übergangsprozess und -bewältigung
Tanja Grotz (2005) untersuchte im Rahmen ihrer Dissertation die kind-, familien- und institutionsbezogenen Schutz- und Risikofaktoren (Bezug zur Resilienzforschung Kap.3.1.6.), um zu ermitteln, wie diese zusammenwirken und welchen Einfluss sie vor und nach dem Übergang auf deren Bewältigung besitzen. Dieser Frage wird gemeinsam mit den am Übergang beteiligten Akteuren nachgegangen. Hierfür führte Grotz 2003/04 eine einjährige empirische Längsschnittstudie durch, in der sie 72 Kinder, deren Eltern, Erzieher/innen und Lehrer/innen mithilfe von Fragebögen quantitativ befragte und zu- dem 12 qualitative Einzelfallstudien durchführte, die auf eine detaillierte Darstellung der Bewältigungsverläufe von Risikokindern abzielten. So fand Grotz u.a. heraus, dass aus Sicht der Eltern und Erzieher etwa 10% der 72 Kinder zu Beginn des Übergangs Fehl- anpassung in Familie und Kindergarten zeigen. Kind-, familien- und institutionsbezoge- ne Schutz- bzw. Risikofaktoren treten beim Übergang weitestgehend kumulativ auf und sind für den Grad der Übergangsbewältigung entscheidend. Je mehr Risikofaktoren bestehen, desto höher ist das Risiko von Übergangsschwierigkeiten. Die Bewälti- gungskompetenz des Kindes hängt mit dem vom Kind subjektiv bewerteten Ausmaß an institutioneller und familiärer Unterstützung wechselseitig zusammen. Besonders Eltern sind fähig, Übergangsschwierigkeiten und Bewältigungskompetenzen ihrer Kin- der vorauszusagen. Folglich sollte ein intensiver Austausch von Fachkräften und Eltern stattfinden, um bereits vor dem Übergang Möglichkeiten der Unterstützung einzuleiten. Es soll laut Grotz nicht Ziel der Fachkräfte und Eltern sein, Kinder fortwährend zu un- terstützen, sondern lediglich wenn es zu Unstimmigkeiten zwischen Anforderungen und Lösungskompetenzen des Kindes kommt. Zudem muss die Ausbildung der Päda- gogen verbessert werden, damit diese Risikokinder identifizieren können. Daneben ist ihrer Ansicht nach eine gemeinsame universitäre Ausbildung der schulischen und vor- schulischen Fachkräfte erforderlich.
Beelmann (2000, 2006) geht von einem normativen kritischen Übergang nach Filipp (1995) aus und präsentiert ein als Langzeitstudie angelegtes Forschungsprojekt, das die Übergänge in Kindergarten, Grundschule und weiterführender Schule thematisiert und die Anpassungsverläufe der Kinder untersucht.
Im Jahre 1997 wurden zwei Untersuchungen jeweils drei Monate vor und nach der Einschulung durchgeführt. 59 der etwa 180 Kinder befanden sich im Übergang in die Grundschule. An dieser Stelle wird bewusst auf eine detaillierte Vergleichsanalyse der Kinder anderer Übergänge verzichtet und der Fokus auf die Ergebnisse jenes Über-gangs gelegt, da dieser in der Arbeit von Belang ist. Aus Perspektive der Eltern und Erzieher bzw. Lehrer wurde das Ausmaß von Verhaltensproblemen erfasst. Mithilfe der Untersuchung wird deutlich, dass innerhalb der Gruppe der Grundschulkin- der ein hoher Unterschied in Bezug auf die Übergangsbelastungen besteht: 42% der insgesamt 59 untersuchten Kinder zeigen aus Sicht der Eltern konstant geringe An- passungsstörungen - sie haben im Übergang demnach geringe Schwierigkeiten. 29% der Kinder leiden hingegen aus Sicht der Eltern an konstant hohen Anpassungsschwie- rigkeiten - bei ihnen verfestigen sich die vor dem tatsächlichen Schuleintritt bereits bestehenden Anpassungsprobleme. Der prozentuale Anteil an Kindern mit abnehmen- den und zunehmenden Anpassungsstörungen beläuft sich auf 15 % bzw. 14 %. Letzte- re schaffen es nicht, sich ohne Probleme an die neuen Lebensumstände anzupassen und die Veränderungen in ihrem Leben zu integrieren. Somit sind lediglich etwa ein Sechstel der Kinder als „Übergangsverlierer“ zu bezeichnen, was im Vergleich zu wei- teren Forschungsergebnissen und zu dem aktuellen Trend, alle Kinder in der Über- gangsbewältigung unterstützen zu wollen, ein äußerst geringer Anteil ist. Außerdem wird deutlich, dass die Kinder ungleiche Ausgangssituationen haben und zudem unter- schiedlich mit der Transition umgehen. Folglich sollte die pädagogische Arbeit darauf zielen, die Kinder individuell bei ihrem Übergang zu begleiten und zu stärken. Neben diesen Ergebnissen berichtet Beelmann u.a. von folgenden Resultaten: 27% der Eltern „bereiten ihr Kind mit Hilfe von themenrelevanten Bilderbüchern o.ä. vor“ (Beelmann, 2006: 126) und 20% fördern die kognitiven Kompetenzen ihres Kindes durch Lese- und Rechtschreibübungen. 70 - 80% der Kinder sind somit - geht man von einem positiven Effekt auf die kognitiven Leistungen aus - benachteiligt, wenn die Schulen und Kindergärten nicht gemeinsam zusätzliche soziale und kognitive Förderungsmaßnahmen anbieten.
Verhaltens- und Entwicklungsprobleme im Vorschulalter sind das beste Indiz für zukünftige Übergangsprobleme: Kinder, die vor der Übergangsphase Verhaltensprobleme haben, zeigen auch nach dem Schuleintritts zu 55% Anpassungsprobleme. Somit könnten gezielte Maßnahmen die bereits vor dem Schuleintritt diagnostizierten Verhaltensprobleme minimieren.
Bei den „Übergangsverlierern“ zeigen sich deutliche Charakterisierungen: Häufig sind es Jungen, die von ihren Familien nur wenig unterstützt werden und sich innerhalb der Erziehung ein widersprüchliches Disziplinierungsverhalten zeigt. Soziale Unterstützung wirkt sich positiv auf das Bewältigungsverhalten der Kin- der aus. Demzufolge sollten auch nach Beelmann Schule, Kindergarten und El- ternhaus zusammenarbeiten und gemeinsam das Kind unterstützen.
Bei Beelmann ist das Ergebnis seiner Studie, wie auch bei Grotz, dass beson-ders Eltern prädestiniert sind, Übergangsschwierigkeiten ihrer Kinder vorauszusagen (r=0.77). Folglich sollte ein intensiver Austausch von Fachkräften und Eltern stattfinden, um bereits vor dem Übergang Verhaltensprobleme zu diagnostizieren und Maßnahmen der Unterstützung einzuleiten.
Im Gegensatz zu Beelmann findet Kiening (2002) heraus, dass ca. 30% der unter- suchten 30 Kinder am Ende des ersten Schuljahres Probleme (physiologische, soziale, self-care ability) aufweisen. Aufgrund der geringen Teilnehmerzahl aller drei Studien (60, 72,30) ist jedoch zu hinterfragen, inwieweit die Ergebnisse repräsentativ sind.
Griebel und Niesel (2004, 2003, 1999) führten 1997-1999 eine umfangreichere Studie durch, in der die Sicht der Erzieher, Eltern und Kinder einbezogen wurden. Die Erzieher und Eltern wurden vor dem Schulbeginn mithilfe von Fragebögen (162 vollständige Fragenbögen, Rücklaufquote: 33%) befragt. Zudem konnten 27 Kinder und mehrere Eltern mithilfe von Interviews befragt werden, welche kurz vor dem Schulanfang, drei Monate danach und nach dem Halbjahreszeugnis stattfanden.
Etwa 25% der Kinder erlebten einen Besuch einer Lehrkraft im Kindergarten. An vielen Orten hat sich zudem der Schulbesuch der Kindergartenkinder etabliert (etwa 90% der Kindergartenkinder besuchten bereits mindestens einmal die Schule), mit dem Ziel die Kinder mit der Schule vertraut zu machen. Diese Maßnahme findet auch in vielen Kooperationsprojekten statt. Jedoch stellte sich in der Befragung heraus, dass die Kindergartenkinder sich kaum an diesen Besuch erinnern konnten und die Maßnahme ihnen wenig über das Schulleben vermitteln konnte, so dass die Autoren eine konkrete Untersuchung der Effektivität dieser Maßnahme fordern.
Bei der Befragung nach dem Schuleintritt gaben die Kinder häufig an, dass ihnen ihre Freundschaften zu älteren Schulkindern wichtig seien. Die älteren Kinder sind Vorbilder und Rollenmodelle und spenden Sicherheit bei möglichen Bedrohungen. Aufgrund dieses Ergebnisses könnte das Modell der Schulpaten die Kinder unterstützen: Bereits während der Kindergartenzeit sollte jedes Kind ein Schulkind als Paten zugeteilt bekommen, der ihm bei Eingewöhnungsproblemen unterstützen kann.
Die Eltern und Kinder äußerten, dass sie sich sicherer fühlen, wenn Freunde aus dem Kindergarten mit ihnen gemeinsam in dieselbe Klasse gehen, so dass einige Eltern aktiv versuchten, dies zu erreichen. Griebel und Niesel bezeichnen dies als Suche nach Kontinuität (2005a), was zudem zu Bronfenbrenners Theorie passt. Im Vergleich von Erzieher- und Elternfragebögen zeigt sich, dass schulvorbereitende Maßnahmen nicht nur in der Einrichtung, sondern größtenteils sogar zu Hause geleis- tet werden. Bei der Einschätzung übergangsrelevanter Kompetenzen wie sozialer und kognitiver Kompetenz, aktivem Problemlöseverhalten und Selbstkontrolle schätzen sowohl Eltern als auch die Erzieher die Mädchen stärker ein als die Jungen. Wenn Eltern die Kompetenzen ihres Kindes als weniger positiv einschätzten, dann beurteilten sie jenes zudem als unsicherer im Bezug auf den Schuleintritt.
Wenn angegeben wurde, dass im Prozess des Schuleintritts in der Familienentwick- lung weitere Übergänge stattgefunden haben wie die Geburt eines Geschwisterkindes oder die Trennung der Eltern, so wurden die Kompetenzen des Kindes von Eltern und Erziehern als weniger positiv eingeschätzt. Deshalb sollten die Kinder, die zu dem Schuleintritt zusätzlich weitere Übergänge erfahren, frühzeitig verstärkt unterstützt werden. Jedoch fehlte bei der Befragung häufig die Übereinstimmung bezüglich der Angaben über familiäre Ereignisse von beiden Akteuren. Giebel und Niesel fordern daher eine engere kommunikative Kooperation zwischen Eltern, Erziehern und Leh- rern, damit die Fachkräfte den Einfluss dieser bedeutenden Familienereignisse auf die Bewältigung des Überganges in die Schule einschätzen und demgemäß unterstützen können. Je enger der Kontakt zwischen Eltern und Erziehern ist, desto stärker gleicht sich ihre Einschätzung über das Kind und je höher die Übereinstimmung zwischen bei- den ist, desto positiver ist die Erwartung der Eltern im Hinblick auf den Schuleintritt.
Eltern, besonders Mütter, äußerten, dass die Schule sie zu wenig informiere. Aus die- sem Grund befragten sie ihre Kinder ausgiebig über den Schulalltag oder einige such- ten häufiger das Gespräch mit den Lehrkräften. Das Gefühl ausreichend informiert zu sein, vermittelt den Eltern Sicherheit, was positive Wirkungen auf das emotionale Wohlbefinden hat (vgl. Fabian, 2002). Fehlende Informationen aufgrund mangelnder Kooperation von Lehrern, Erziehern und Eltern während des Übergangprozesses kön- nen sich belastend auf die emotionale Ausgeglichenheit der Eltern und somit auch auf die Kinder auswirken (vgl. Fabian, 2002). Hier werden die Doppelrolle der Eltern und die Notwendigkeit der regelmäßigen Informierung der Eltern abermals verdeutlicht.
In dem Interview drei Monate nach der Einschulung beschrieben die Eltern den Einschulungsprozess als sehr gefühlsintensiv (wechselseitige Gefühle wie Freude und Verlustängste). Häufig wurde im Interview zudem das Sprichwort, dass mit der Schule "der Ernst des Lebens" beginne, geäußert. Zudem äußerten die Eltern teils hohe Erwartungen und setzten Druckmittel ein, wenn die Kinder diese nicht erfüllen. Lehrer und Erzieher sollen nach Griebel und Niesel deshalb den Eltern diese Illusion der Schule nehmen, damit diese nicht ihre Kinder mit solchen Floskeln beunruhigen, und zudem den Druck nehmen - Schwindet der Druck, unter dem die Eltern stehen, dann minimieren sie auch den Druck, den sie selbst ausüben.
Broström (2002, 2003) untersuchte dänische Kinder in Bezug auf ihre Übergangsbe- wältigung und kam zu dem Schluss, dass die Unsicherheit und ein allgemeiner „Kultur- schock“ beim Schuleintritt unter anderem aus den Unterschieden und Widersprüchen beider Einrichtungen bezüglich ihrer Ziele und Inhalte und aus der fehlenden Koopera-tion bzw. aus dem fehlenden kontinuierlichen, kommunikativen Austausch beider resultieren. 12% der untersuchten Kinder äußerten Unsicherheiten und Nervosität. Broström kommt zu dem Schluss, dass durch verstärkte Kooperationsmaßnahmen Kontinuität hergestellt werden soll. In Dänemark sind aufgrund dieser Erkenntnisse einige Maßnahmen zur Übergangserleichterung entwickelt worden, jedoch konnten trotz idealer Bedingungen die Anpassungen der Kinder nicht einschätzbar werden, so dass das Ziel, durch effektive übergangsunterstützende Maßnahmen den Kindern den Übergang tatsächlich zu erleichtern, noch nicht erreicht scheint.
Margetts (2002) weist in seiner Studie darauf hin, dass die übergangsunterstützenden Faktoren, die nachweislich positive Wirkungen haben, gefördert werden sollen: dies sind neben sozialen Fähigkeiten und Selbstvertrauen zudem Freundschaften in der Klasse. Daneben wirkt sich die Passung zwischen den Anforderungen und den Kom- petenzen der Kinder auf die Übergangsbewältigung aus. Die Kompetenzen wiederum hängen mit den Vorerfahrungen des Kindes in seiner Familie und im Kindergarten zu- sammen. Demnach ist es bedeutsam, dass Erzieher und Eltern die Kompetenzen durch positive Erfahrungen der Unterstützung und durch Vorerfahrung im Schulleben fördern und bei den Anforderungen die Heterogenität der Kinder beachten.
3.2.2. Überblick über die Forschung bezüglich Kooperation im Übergang
Neuere Evaluationsstudien in Schweden zeigen die Problematik der Kooperation bei- der Einrichtungen auf. Pramling Samuelsson (2004) fand in ihrer Befragung von Ele- mentarpädagogen (in Schweden bestehen drei verschieden Formen der Vorschule, die in das Schulsystem eingebunden sind) unter anderem heraus, dass aus Sicht jener kein Kontakt auf gleicher Augenhöhe stattfindet, da Grundschullehrkräfte weniger Achtung vor vorschulpädagogischer Arbeit haben und somit die Arbeit von ihnen weni- ger wertschätzen. Hinzu kommen die unterschiedlich hohen Löhne, welche diese Sichtweise und die Grenze zwischen beiden Einrichtungen weiter verstärken und somit einer erfolgreichen Kooperation im Wege stehen könnten. Positiv wird hingegen beur- teilt, dass „Mehrere Erwachsene [...] die Verantwortung für die Kinder [teilen], das för- dert Diskussionen und Herausforderungen“ (Pramling Samuelsson, 2004: 170).
Huppertz und Rumpf (1983) untersuchten, welche Gründe aus Sicht der Grundschul- lehrkräfte für die schleppende und teils problematische Kooperation von Kindergarten und Grundschule bestehen. In einer weiteren Studie wurden die Hindernisse aus Sicht der Erzieher untersucht (200 Erzieher/innen). Oft wurden organisatorische Probleme und Zeitmangel seitens der Lehrer genannt (obwohl sie über zwei zusätzliche Stunden verfügten). Neben diesem Grund gaben sie fehlendes Wissen über den Elementarbe- reich und über eine Kooperation an. Zudem äußerten sie Vermutungen über mangel-hafte Kompetenz und Interesse des Kooperationspartners und nahmen eine hohe Dif-ferenz in den Pädagogikrichtungen wahr. Auch die Erzieher schätzten die Lehrkräfte als wenig vorbereitet auf die Kooperation ein und nahmen hohe Unterschiede zwischen beiden Institutionen wahr. Eine Vielzahl vermutete, die Lehrkräfte nehmen sie nicht als gleichberechtigt wahr. Gemeinsame Elternarbeit wird von beiden Seiten nahezu gar nicht erwähnt, obgleich jene ein Kooperationsschwerpunkt darstellte. Ähnliche aktuelle Untersuchungen existieren derzeit nicht. Somit ist über den aktuellen Stand von Kooperationen von Kindergärten und Grundschulen in ganz Deutschland sowohl in der Fläche als auch zur wechselseitigen Wahrnehmung beider Kooperati- onspartner wenig bekannt (vgl. Faust, 2008).
3.2.3. Zusammenfassung
Festzuhalten ist, dass die Forschungen mehr oder weniger auf der Basis der Mehr- perspektivität bestehen. Neben dem Kind spielen zudem die Perspektiven der Eltern und Fachkräfte in der Bewältigung und zur Analyse der Bewältigungsprobleme eine Rolle. Kooperation zwischen Elternhaus, Kindergarten und Grundschule wird daher in allen Ansätzen als bedeutend für die Übergangsbewältigung angesehen. „Schulvorbe- reitung heißt [für den Kindergarten] Netzwerke bauen mit Eltern und der Grundschule, um mit Kindern die Zonen des Vertrauens und Verlässlichen, in denen Kinder und auch Erzieher sich sicher fühlen, auszubauen“ (Knauf, 2004: 318). Es werden oftmals Koo- perationsprobleme geäußert, die den Ausführungen in Kapitel 2.2.3. ähneln.
Trotz aller Unterschiede im Aufbau der internationalen Bildungssysteme, zeigen natio- nale und internationale Studien auf, dass der Schuleintritt des Kindes einen besonde- ren Übergang in Bezug auf seine Entwicklung darstellt. Der Schulbeginn ist stressreich- für einige Kinder mehr, für andere weniger. Genaue Daten der Anzahl der Kinder, welche erhebliche Übergangsprobleme aufweisen, so dass man von „Übergangsverlie- rern“ sprechen kann, sind unterschiedlich, mit 10% bei Grotz und 13% bei Beelmann jedoch häufig geringer als es aufgrund der öffentlichen Debatten und der Akzentuie- rung auf speziell diesen Übergang zu vermuten ist. Zudem zeigt sich, dass der Prob- lematik des Übergangs noch nicht erfolgreich entgegengewirkt werden konnte.
Dringender Forschungsbedarf besteht bei der Frage, inwiefern und mit welcher Effekti- vität einzelne Maßnahmen von Kooperation zwischen Kindergarten und Grundschule (wie Schulbesuch, Begleitung der Erzieherin in der Schulanfangsphase, Förderung bestimmter Kompetenzen etc.) in Bezug auf die Übergangsunterstützung wirkungsvoll sind. Zudem existieren seit der Studie in den achtziger Jahren wenig empirische eva- luative Befragungen, die Stärken und Schwächen der Zusammenarbeit beider Einrich- tungsformen thematisieren. Hier besteht aktuell ein hoher Forschungsbedarf. Aufgrund dessen werden in dieser Forschung zehn Erzieher/innen und Lehrkräfte unter anderem in Bezug auf die Grenzen und Schwächen der Kooperation und die anpassungsför-dernden Übergangsmaßnahmen befragt.
4. Modellprojekt „Das letzte Kindergartenjahr als Brückenjahr zur Grundschule“
4.1. Entwicklung/Aufbau
Broström sagt „A fundamental goal of a school-start transi- tion is to help young children feel suitable in school, that is, to have a feeling of well being and belonging“ (2002: 52). Dieses Ziel verfolgt auch das Modellprojekt „Brückenjahr“. Das Programm wurde entwickelt, um den Kindern in Nie- dersachsen im letzten Kindergartenjahr vor der Einschu-lung durch Kontinuität den Einstieg in die Schule zu erleichtern, indem die beiden Ein- richtungen Kindergarten und Grundschule eng miteinander kooperieren (vgl. Wolter, 2007). Das Projekt ist Teil des 100-Milionen-Programms „Familien mit Zukunft - Kinder bilden und betreuen“ und wird mit insgesamt 20 Millionen Euro gefördert. Der Träger ist das Regionale Bildungsmanagement, der Projektinitiator das Niedersächsische Kul- tusministerium (vgl. Brammer/Hiege/Reyhn, 2007). Im August 2007 und 2009 wurden jeweils 250 Modellprojekte für zwei Jahre gefördert. Ein Projekt besteht in der Regel aus einer Grundschule und bis zu drei Kindergärten, welche zusammenarbeiten. Die einzelnen Projekte erstrecken sich über ganz Niedersachsen, so dass flächendeckend eine Erprobung mit allgemeingültigem Charakter stattfinden kann. Um an dem Projekt teilnehmen zu können, mussten sich die Fachkräfte der Einrichtungen zunächst treffen, gemeinsam einen Schwerpunkt finden und ihr Konzept ausformulieren, mit welchen sich das Team beim Kultusministerium bewerben konnte. Jenes entschied anschlie- ßend, ob das Projekt unterstützt wird oder nicht.
In den zwei finanzierten Jahren soll gemeinsam ein Übergangskonzept nachhaltig aus- gearbeitet werden und in der nachfolgenden Zeit weiter geführt werden. Die Arbeit in den zwei Jahren soll also die Basis für die weitere Zusammenarbeit darstellen. Zudem fungiert das Projekte als Modellversuch: So soll durch Versuche und anschließenden Reflexionen herausgefunden werden, welche Maßnahmen in Bezug auf die Über- gangsgestaltung und Kooperation individuell effektiv sind und welche regionalen Ver- änderungen erfolgsversprechend sind. Damit diese Aufgaben geleistet werden können, werden Elementar- und Primarpädagogen gemeinsam fortgebildet und ihnen eine be- stimmte Anzahl an Arbeitsstunden bezahlt (vgl. Nds. Kultusministerium, 2007b).
[...]
1 Der Terminus „Kindergarten“ wird in dieser Arbeit als Synonym für alle vorschulischen Einrichtungen wie den Hort, Kindertagesstätten und andere Betreuungsstätten verwendet.
- Arbeit zitieren
- Anuschka Horstmann (Autor:in), 2010, Das “Brückenjahr“ als Übergangskonzept. Von der Elementar- in die Primarbildung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/319739
Kostenlos Autor werden





















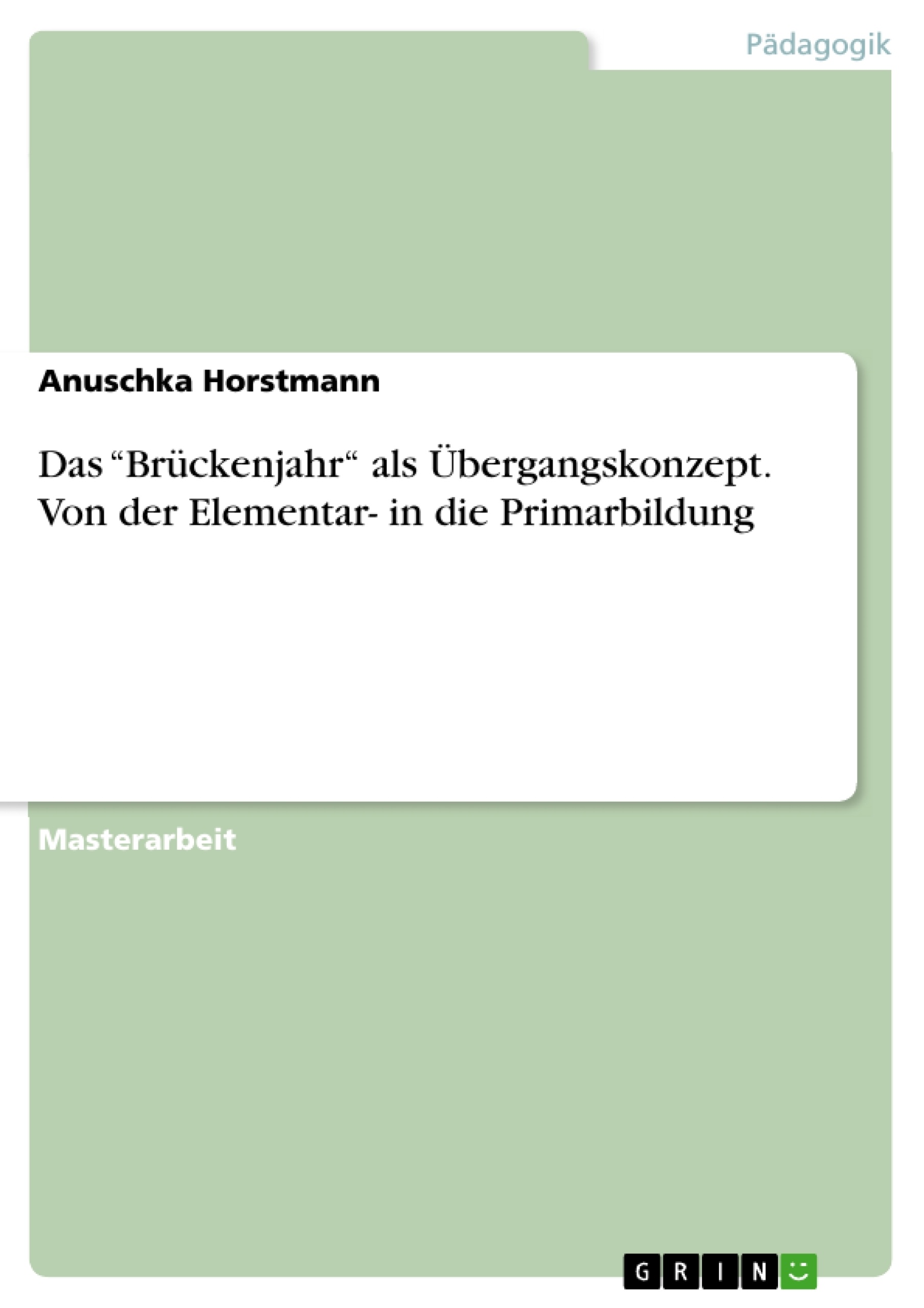

Kommentare