Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1.Einleitung
1.1 Ausgangssituation
1.2 Problemstellung
1.3 Forschungsfrage und Zielsetzung
1.4 Aufbau der Arbeit
2 Theoretische Grundlagen
2.1 Wissensmanagement
2.1.1 Begriffe und Definitionen
2.1.2 Arten und Dimensionen des Wissens
2.1.3 Gründe für Wissensmanagement
2.1.4 Modelle und Phasen des Wissensmanagements
2.1.5 Erfolgsfaktoren
2.1.6 Organisationales Lernen
2.2 Change Management
2.2.1 Gründe und Handlungsfelder für den Wandel
2.2.2 Konzepte des Vorgehens und ausgewählte Phasenmodelle
2.2.3 Erfolgsfaktoren im Change Management
2.2.4 Widerstände des Wandels
3 Wissensmanagement und Change Management
3.1 Operative Erfolgsfaktoren, statische Betrachtung
3.1.1 Übereinstimmungen und Ineinandergreifen der Erfolgsfaktoren
3.1.2 Stadien des Change Managements und jeweils zentrale Erfolgsfaktoren des Wissenmanagements
3.1.3 Zusammenspiel von Erfolgsfaktoren des Wissensmanagement und Widerständen im Change Management
3.2 Prozessuale Aspekte des Wissensmanagements
3.2.1 Bausteine des Wissensmanagements und die jeweils aktiven Erfolgsfaktoren des Change Managements
3.2.2 Die aktive Unterstützung der Change Management-Prozesse bei der Einführung des Wissensmanagements
3.2.3 Widerstände bei der Einführung eines Wissensmanagements
3.3 Situative Aspekte des Wissensmanagements und der Einfluss von Change Management
3.3.1 Unterschiedliche Gewichtung der Erfolgsfaktoren bei verschiedenen Wissensmanagement-Konstellationen
3.3.2 Situative Aspekte des Change Management Ablaufs
3.3.3 Besonderes Risiko für Widerstände bei unterschiedlichen Konstellationen
3.4 Change Management hin zur Lernenden Organisation
3.4.1 Voraussetzungen der Lernenden Organisation
3.4.2 Abläufe in Lernenden Organisationen
4 Zusammenfassung
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
1.Einleitung
1.1 Ausgangssituation
Die Themen Change Management und Wissensmanagement sind aus vielfältigen Gründen aktuell. Einer der Gründe ist eine schnelle Entwicklung der Technologie in allen Bereichen des Wirtschaftslebens, speziell der Informations- und Kommunikationstechnologie. Die Unternehmen sind gezwungen andere, innovativere Wege zu gehen als bisher: Kundenwünsche, Effektivität, Qualität, Konkurrenz, demografischer Wandel, Preis- und Leistungsdruck, Fusionen und Globalisierung sollen hier als Beispiele dafür genannt werden, dass Unternehmen in unterschiedlichen Bereichen auf einem konkurrenzfähigen Stand sein sollten, damit sie langfristig Ihre Existenz sichern können (vgl. Berner, 2015, S. 15ff.).
Die Güte der Anpassung an diese neuen Rahmenbedingungen entscheidet unter anderem über den Erfolg des Wirtschaftens. In diesem Zusammenhang sind speziell die Entwicklungen der Mikroelektronik, der Informatik und der Telekommunikationsmöglichkeiten relevant, die in immer schnelleren Zyklen zu einschneidenden Veränderungen im Alltag führen. Manche der neuen Kommunikationsmedien ersetzen auch Arbeitsplätze, welche früher zur Sammlung von Informationen und deren Auswertung und Weitergabe erforderlich waren. Durch die technologischen Entwicklungen werden zudem die Geschäftsprozesse beschleunigt, was für die bestehende Belegschaft zu einem erhöhten Leistungs- und Veränderungsdruck führt. Aktuelle Informationen sind jederzeit und überall verfügbar. Die Geschwindigkeit der Unternehmen bei der Umsetzung von Veränderungsprozessen wird zunehmend zu einem Erfolgsfaktor (vgl. Doppler, Lauterburg, 2008, S. 24ff.). Der gesellschaftliche Strukturwandel von der Industrie- zur Informations-, Dienstleistungs- und Wissensgesellschaft lässt Wissen in den Mittelpunkt zur Bewerkstelligung der komplexen Anforderungen in den globalen Märkten rücken. Das Wissen explodiert geradezu und gleichzeitig nimmt die Halbwertszeit ab (vgl. Binner, 2007, S. 15).
Auch die Einstellungen der Menschen und ihre Wertvorstellungen haben sich verändert. Zwar gehören Veränderungen zum Leben, dennoch neigen Menschen dazu Stabilität zu suchen. Ihr Handeln wird von dem Wunsch bestimmt, Dinge zu überblicken. Sicherheit und Ordnung wird angestrebt. Allein schon das Älterwerden an sich verändert die Menschen und ihren Erfahrungsschatz (vgl. Kraus et al., 2010, S. 12f.).
1.2 Problemstellung
Die Bedeutung vom effektiven Umgang mit Veränderungen und Wissen rückt mehr und mehr in den Mittelpunkt unternehmerischer Überlegungen. Die Ressource Wissen nimmt dabei eine zentrale Rolle innerhalb der Organisation ein. Große Mengen von Informationen müssen für Entscheidungen verarbeitet werden, gleichzeitig steigt die Komplexität der Aufgaben. Lange Entscheidungswege sorgen dafür, dass Unternehmen nicht mehr wettbewerbsfähig agieren können (vgl. Keuper, Neumann, 2009, o. S.).
Die notwendigen Veränderungen von Abläufen und Strukturen und die Verarbeitung von erforderlichem Wissen gilt es sinnvoll innerhalb der Unternehmen zu integrieren. Dies geschieht zum einen, um Kreativität zu fördern, und zum anderen, um langfristig erfolgreich und konkurrenzfähig zu bleiben. Bei der Umsetzung solcher Projekte und Prozesse müssen alle Abteilungen der Organisation berücksichtigt werden, da die Maßnahmen unterschiedliche Auswirkungen haben und sich gegenseitig beeinflussen können. Ein Change Management Konzept deckt ab, wie die jeweiligen Veränderungen angestoßen und bis zur Umsetzung begleitet werden. Dabei kommt es zu erwarteten und teilweise unerwarteten Reaktionen von Mitarbeitern oder Schwierigkeiten. Jedes Change Projekt ist individuell und schwer mit einem anderen zu vergleichen. Es herrscht ein anderes Umfeld, eine andere Kultur und andere Führungs- oder Kommunikationssysteme sind vorhanden (vgl. Berner, 2015, Vorwort). So sind auch Veränderungen im bzw. die Einführung eines Wissensmanagements stets in letzter Konsequenz individuell auszugestalten. Dennoch können grundlegende Problemfelder übergreifend behandelt werden.
1.3 Forschungsfrage und Zielsetzung
Da die Implementierung eines Wissensmanagements einen Veränderungsprozess im Sinne des Change Management darstellt bzw. die beiden Vorgänge Überschneidungen und Synergieeffekte in Aussicht stellen, versucht diese Arbeit folgende zentrale Forschungsfrage zu beantworten:
In welchen Bereichen können die Kenntnisse aus dem Change Management bei der Implementierung eines Wissensmanagements in einem Unternehmen hilfreich sein?
Dazu wird folgende Hypothese verfolgt:
Je strukturierter die Einführung eines Wissensmanagements auch in den Dimensionen von Change Management erfolgt und dabei die bekannten Problemfelder berücksichtigt, desto besser ist das Wissensmanagement später im Unternehmen integriert.
Die Arbeit hat das Ziel, die beiden Forschungsbereiche Change Management und Wissensmanagement hinsichtlich ihrer Ähnlichkeiten und ergänzenden Unterschiede näher zu beleuchten. Beide Forschungsbereiche beschäftigen sich intensiv mit dem Faktor Mensch im Unternehmenskontext. Es soll untersucht werden, in wie weit die Möglichkeiten und Kenntnisse aus dem Change Management hilfreich bei der Einführung eines Wissensmanagements in einer Organisation sind. Dabei soll außerdem ersichtlich werden, an welchen Stellen es Synergien gibt. Mit Hilfe der theoretischen Erkenntnisse soll der Leser verstehen können, was die Grundlagen der beiden behandelten Disziplinen sind und welche Ansätze und Modelle vorhanden sind. Es soll ein Verständnis für die Problematiken, aber auch für die Chancen von Veränderungsprozessen generiert werden. Ebenso soll der zunehmende Bedarf an Wissensmanagement dargelegt werden, um sowohl die Kreativität als auch die Wissensgenerierung innerhalb eines Unternehmens zu fördern und somit langfristig konkurrenzfähig und erfolgreich zu sein. Schließlich ist es ein Ziel der Arbeit, die theoretischen Erkenntnisse im praktischen Kontext anzuwenden und darzulegen, wie unterschiedliche Unternehmensumstände zu einer veränderten Ausrichtung des Fokus von Change Management beim Wissensmanagement führen können.
1.4 Aufbau der Arbeit
Die Arbeit gliedert sich in zwei Hauptteile. Nachdem in der Einleitung die Ausgangsituation dargestellt wurde sowie die Notwendigkeit erläutert wurde, sich in der heutigen Zeit zu verändern und mit Wissen bzw. Wissensmanagement auseinander zu setzen, wurden die Ziele formuliert.
Im folgenden Teil wird auf die theoretischen Grundlagen von Wissens- und Change Management eingegangen, um dem Leser einen Überblick über beide Forschungsdisziplinen zu verschaffen.
Dazu werden jeweils die wesentlichen Begriffe erläutert und definiert, damit eine Abgrenzung zu anderen Forschungsdisziplinen verständlich wird. Darauf aufbauend werden mögliche Gründe aufgeführt, welche das Forschungsinteresse und den Forschungsbedarf auf diesen Gebieten erklären. Es werden verschiedenen Ansätze und Modelle von ausgewählten Autoren vorgestellt, welche versuchen sowohl das Wissensmanagement wie auch das Change Management unter Berücksichtigung der aktuellen Forschungsergebnisse durch theoretische Konzepte zu erfassen. Sowohl beim Change Management wie auch beim Wissensmanagement stehen komplexe Sachverhalte im Mittelpunkt in unterschiedlichsten Kontexten, bei denen der Faktor Mensch im Mittelpunkt der Ausführungen steht. Aus diesem Grunde wird jeweils auf die aktuelle Erfolgsfaktorenforschung eingegangen, um die wesentlichen, bekannten Erfolgsfaktoren zu benennen.
Im zweiten Hauptteil werden die wesentlichen theoretisch erarbeiteten Faktoren aus den beiden Disziplinen zusammengeführt. Es wird versucht die Forschungsfrage und die aufgestellte Hypothese zu beantworten, indem die theoretischen Erkenntnisse aus verschiedenen Perspektiven betrachtet werden. Um Erkenntnisse abzuleiten, werden jeweils die statischen, die prozessualen und die situativen Gegebenheiten auf Übereinstimmungen, Unterschiede und Korrelationen durchleuchtet. Da die Ansätze des Change Managements in ihren Erklärungsmöglichkeiten unter Umständen nicht ausreichen wird das Theoriegebilde der lernenden Organisation als weiterer Erklärungsansatz vorgestellt.
Zum Abschluss dieser Arbeit folgt eine Zusammenfassung der erarbeiteten Ergebnisse in Bezug auf die Forschungsfrage und die aufgestellte Hypothese. Es wird versucht darzustellen, in wie fern diese beantwortet werden können und welche Bedeutung die Thematik für die Zukunft darstellt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Aufbau der Arbeit
Quelle: Eigene Darstellung.
2 Theoretische Grundlagen
Wissen wird heutzutage als vierter Produktionsfaktor neben Arbeit, Boden und Kapital angesehen. Es findet sich in allen Branchen und Unternehmensgrößen wieder; das Management dieses Wissens wird für alle Unternehmensüberlegungen immer wichtiger (vgl. Jaspers/Fischer, 2008, S. 1).
2.1 Wissensmanagement
Es gibt zahlreiche Forschungsansätze im Bereich Wissensmanagement. Die in der Fachliteratur am meisten diskutierten Ansätze stammen von Probst et al. (2006) sowie von Nonaka und Takeuchi (1997). Auf beide Ansätze wird unter anderem in 2.1.4 eingegangen, nachdem zuvor allgemeine Erkenntnisse zum Begriff (2.1.1), den Arten (2.1.2) und den Gründen (2.1.3) von Wissensmanagement erläutert werden. Am Ende von Kapitel 2.1 steht eine Herleitung von Erfolgsfaktoren (2.1.5).
2.1.1 Begriffe und Definitionen
Mit der Übersetzung der Managementtheorie von Henry Fayol (1949) ins Englische fand seine Definition von Management weltweite Anerkennung: "To manage is to forecast and to plan, to organise, to command, to co-ordinate and to control." Sein Ziel war weniger die Steigerung der Leistungsfähigkeit der Individuen, sondern die Verbesserung der Organisation als Ganzes. Management beinhaltet nach seiner Auffassung fünf Funktionen: planen, organisieren, befehlen, koordinieren und kontrollieren (vgl. Kirchler, 2011, S. 48).
Einen entscheidenden Einfluss auf die verhaltenswissenschaftlichen Bereiche des Managementbegriffes erzeugten die Hawthorne-Experimente 1927-1932 und deren Ergebnisse, die Mayo und Roethlisberger fanden. Im Fokus der Untersuchungen standen die Zusammenhänge zwischen Arbeitsbedingungen der Arbeitnehmer und deren Leistungen. Dabei zeigte sich, dass die Leistung eines Arbeiters nicht so stark von den betrachteten physischen Arbeitsbedingungen abhängt, sondern eher von seinem Verhältnis zu den Aufgaben, den Vorgesetzten und seinen Arbeitskollegen. Durch diese Erkenntnisse wurde die Berücksichtigung von Motivation und Delegation immer bedeutender (vgl. Bühner, 2001, S. 459).
Management wie auch Führung beinhalten jenseits des personalen Faktors übergeordnet sowohl operative als auch strategische Bereiche. Um diese planen zu können, muss das Management die wesentlichen äußeren und inneren Faktoren erfassen. Zu den inneren Faktoren gehören die eigene Leistungsfähigkeit und die Qualität der Arbeit des Unternehmens. Zu den äußeren Rahmenbedingungen zählen die Konkurrenzsituation, die Marktlücken sowie allgemeine Preisstruktur. Aufbauend auf den Rahmenbedingungen müssen verschiedene Ziele hinsichtlich des Ertrags oder der Marktposition definiert werden. Damit die gesteckten Ziele erreicht werden können, müssen die Mitarbeiter darüber informiert, dazu angeleitet und geschult werden. Um die Ergebnisse zu bewerten und den Stand der Zielerreichung zu eruieren werden Kontrollinstrumente nötig und eingesetzt (vgl. A. De, 2005, S. 198).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: Allgemeine Inhalte der Management- und Führungsaufgaben „Die Management-Brille“
Quelle: Dennis A. De, 2005, S. 198.
Bei der Festlegung konkreter Managementhandlungen steht am Anfang eine Aufgabe oder Anforderung. Es gilt zunächst die Kompetenzen festzulegen. Danach werden die erforderlichen Ziele definiert, welche erreicht werden sollen. Die Planung, wie die Ziele erreicht werden sollen und wie die Umsetzung erfolgen soll, sind weitere Aufgaben des Managements. Hier ist eine Steuerung einzusetzen, durch die Abweichungen bemerkt werden und erforderlichenfalls die Ziele neu definiert und anpasst werden können. Die Planung ist ein andauernder Lernprozess und muss immer wieder neu angepasst werden. Dieser Management Kreislauf bezieht sich auf alle Bereiche eines Unternehmens wie Einkauf, Entwicklung, Forschung und Verkauf (vgl. Deyhle et al., 2010, S. 22ff.).
Über den Begriff Wissen hat sich bislang kein einheitliches Verständnis gebildet. Je nach Kontext der wissenschaftlichen Betrachtung finden sich jedoch unterschiedliche Herangehensweisen und Betrachtungen des Begriffsinhalts. Gemeinsam liegt den Definitionen zu Grunde, dass Wissen eine subjektive Repräsentation von Wirklichkeit darstellt.
In der Organisations- und Managementlehre fehlt eine eindeutige Definition des Begriffs Wissen ebenso. Es sollte jedoch eine Abgrenzung insbesondere zum Verständnis von Humankapital und Human Ressourcen abgeleitet werden. Im wissenschaftlichen Diskurs haben sich in diesem Zusammenhang unter anderem der wissensbasierte Ansatz und der ressourcenbasierte Ansatz durchgesetzt. Der wissensbasierte Ansatz geht dabei gezielt der Frage nach, wie spezielles Organisationswissen Wettbewerbsvorteile erzielen kann und was für Auswirkungen diese sowohl in Theorie wie auch in der Praxis für das strategische Management haben kann.
Die Psychologie betrachtet das Wissen meist in Verbindung mit der Erforschung des menschlichen Denkens, Fühlens und Handelns. Hier wird das Wissen dreifach unterteilt. Eine Wissensgesellschaft ist nur dann stabil, wenn Wissen sowohl explizit, implizit wie auch bildlich dargestellt wird. Explizites Wissen ist bewusst vorhanden und kann katalogisiert werden. Es befindet sich beispielsweise in Nachschlagewerken und Büchern. Implizites Wissen ist Gewohnheitswissen, das man in unseren Handlungen und Entscheidungen erkennen kann. Das bildliche Wissen bedeutet hier das Anschauungs-, Erinnerungs- und Vorstellungswissen (vgl. Frey-Luxemburger, 2014, S. 13f.).
Soziologie und Pädagogik stellen den Wissenserwerb und die Wissensvermittlung in das Zentrum der Untersuchungen. Die Soziologie sucht zum Beispiel Antworten auf Fragen im Bereich von Änderungen der Gesellschaftsstruktur und ihre Auswirkungen. Je nach Disziplin wird ein anderes Verständnis von Wissen zu Grunde gelegt (vgl. Frey-Luxemburger, 2014, S. 13f.). Wissen entspricht der Gesamtheit der Möglichkeiten und Fähigkeiten, welche von Menschen eingesetzt werden, um Probleme zu bewältigen. Wissen bezieht sich immer auf Daten und Informationen und ist personengebunden. So ist es wichtig, dass Daten-, Informations- und Wissensmanagement immer ineinandergreifen (vgl. Probst et al., 2006, S. 23).
Wissen beschreibt in dieser Arbeit insbesondere im Bezugsrahmen zu Wissensmanagement eine vorhandene Ausgangssituation und damit Erwartungshaltung, welche Menschen in ihrem Umfeld oder im Zusammenhang mit dem Unternehmen einsetzen, um Wahrnehmungen bewusst oder unbewusst auszulegen und Maßnahmen zur Verbesserung ihrer Situation zu ergreifen. Objektives Wissen gibt es nach dieser Sichtweise nicht, sondern es besteht immer ein individueller Bezugsrahmen. Wissen ist an Menschen gebunden. Je komplexer ein Umfeld wie zum Beispiel das in einer Organisation ist, desto wichtiger wird es, sich die fortlaufend aufgebauten Erwartungshaltungen und somit das Wissen bewusst zu machen und auf organisatorische Ziele auszurichten (vgl. Pircher, 2010, S. 17f.).
Hinsichtlich der Einheiten, in denen Erkenntnisse auftreten, trennt man zwischen Daten, Informationen und Wissen. Das, was aus der fachlichen Betrachtung des Wissensmanagements als Wissen dargestellt wird, befindet sich ausschließlich im Kopf des Wissensträgers. Es ist das Ergebnis seines ganzen bisherigen Lebens und den Erfahrungen mit seiner Umwelt. Alles außerhalb seines Kopfes sind Daten, welche zu Informationen werde können, wenn die Daten beispielsweise von einem anderen Individuum wahrgenommen werden, um diese zu verwerten. Somit sind Daten alle Arten von Zeichen, welche für den Einzelnen bedeutsam sein können. Informationen können aus Daten entstehen, wenn sie von einem Empfänger bewusst wahrgenommen werden. Das Wissen existiert dann wiederum als Ergebnis im Kopf dieses Menschen, wenn die Informationen mit dem bereits vorhandenen Wissen verknüpft werden (vgl. Hasler Roumois, 2007, S. 7f.).
Wissen stellt eine wertvolle Ressource für Unternehmen dar. Wissen in Unternehmen muss geplant, organisiert und verwertet werden. In diesem Zusammenhang spricht man von Managementfunktionen. Somit ist Wissensmanagement ein methodischer Ansatz einer Managementfunktion (vgl. Bodendorf, 2006, S. 5). Wissensmanagement fasst alle Managementtätigkeiten zusammen, welche dafür gedacht sind, Wissen in Organisationen einzubringen und zu entwickeln. Das Ziel dahinter ist die bestmögliche Erreichung der Unternehmensziele (vgl. Gronau, 2009, S. 9).
Das Lernen von und in Organisationen ist eng mit dem Wissensmanagement verbunden. Wissensmanagement beinhaltet demnach die Verbesserung eines Unternehmens in allen Bereichen durch einen effektiveren Umgang mit der Ressource Wissen. Es dient als Interventionskonzept in einer Organisation zur Erreichung von Zielen und kann in Folge zu einer lernenden Organisation (s.2.3.1) werden (vgl. Keuper/Neumann, 2009, S. 21f.). Wissen ist sollte in einem dynamischen Umfeld betrachtet werden. Wissen betrifft immer wieder Lernen und die Weiterentwicklung von Wissen. Jede Weiterentwicklung des Wissens kann als Lernen betrachtet werden. Wissen nähert sich somit dem Lernen an, je mehr das Wissen in seiner Veränderung und Entwicklung betrachtet wird. Inzwischen ist diese Annäherung so weit fortgeschritten, dass die Wissensentwicklung und das Lernen in Organisationen gleichbedeutend betrachtet werden (vgl. Jones/Bouncken, 2008, S. 121).
Wissen auf der Basis von Daten zu generieren bedeutet die systematische Verbindung von Informationen und beinhaltet die Kenntnisse über Ursachen und Wirkungen. Mit Wissen hat man Zugriff auf Wahl- und Entscheidungsmöglichkeiten. Die Möglichkeiten, Wissen kreativ im Sinne von neuen Lösungsmöglichkeiten in einer Organisation zu finden oder es für Innovationen oder Verbesserungen bei der Wettbewerbssituation zu nutzen und zu speichern und auch weiter zu entwickeln, zeigt die starke Bedeutung für das Management heute und vor allem künftig (vgl. Lehner, 2012, S. 54f.).
Wissensmanagement beschäftigt sich allgemein mit den Fragen wie Wissen generiert, umgewandelt, gespeichert und verwendet werden kann. Die Aufgaben des Wissensmanagements lassen sich in den in Kapitel 2.1.4 dargestellten Modellen wiederfinden (vgl. Frey-Luxemburger, 2014, S. 52). Wissensmanagement zu betreiben bedeutet, dass dem Faktor Wissen im Management eines Unternehmens einen großen Stellenwert beigemessen wird und dass die Vielfalt der Möglichkeiten und Instrumente im Management bewusst integriert werden (vgl. Franken/Gadatsch, 2002, S. 4). Beim Wissensmanagement steht die Anwendungsorientierung im Vordergrund. Es ist ein komplexes Gebilde von Steuerungsaufgaben, welches alle Prozesse, Methoden und Strukturen einer Organisation umfasst, die sich mit Wissen beschäftigen. Das oberste Ziel des Wissensmanagements ist die effektive und geplante Bewirtschaftung des Produktionsfaktors Wissen in der ganzen Unternehmung (vgl. Brücher, 2004, S. 11f.).
Als Voraussetzung für eine lernende Organisation (s. 2.3.1) umfasst Wissensmanagement gemäß neuer Erkenntnisse grundsätzlich zwei Bereiche: zum einen die aktive Gestaltung des Arbeitsbereichs und der Arbeitsbedingungen zur Wissensarbeit und zum anderen das Verwalten der Daten und Informationen als Arbeitsgrundlage. Ziel muss es sein, die beiden Bereiche ideal zu koordinieren, was notwendig macht, dass man sich mit der Rolle des Menschen mit seinem Wissen sowohl in Hinblick auf die Kommunikation als auch das Lernen beschäftigt. Zudem muss ein Fokus auch auf die Struktur der Organisation mit ihren Prozessen und Informationssystemen gerichtet werden (vgl. Hasler Roumois, 2010, S. 26f.).
2.1.2 Arten und Dimensionen des Wissens
Wissen hat heutzutage zwei Bedeutungen: Zum einen besteht das Wissen als Objekt, also als festgehaltenen Erkenntnisse, auf die man zugreifen kann und das in irgendeiner Weise als Material wie zum Beispiel Bücher, Bilder oder Web-Einträge existiert. Zum anderen ist das Wissen als Prozess durch Erfahrungen und mit der Notwendigkeit des Kontaktes via face to face in Entstehung und dauernder Wandlung. Dieses Handlungswissen ist vom Wissensinhaber kaum trennbar (vgl. Reinmann-Rothmeier, 2001, S. 14). Wissen impliziert ein durch Erfahrungen gewachsenes Urteilsvermögen. Ebenso wird dadurch die Problemlösungskompetenz erhöht. Dieses Erfahrungswissen zeigt sich insbesondere in Bewältigungsfähigkeit von Krisensituationen (vgl. Erlach et al., 2013, S. 5).
Zum so genannten Fakten- oder Sachwissen zählen das Allgemeinwissen und das Regelwissen. Dieses Wissen wird durch Lernen erworben und kann wiedergegeben oder dargestellt werden (know-that). Wissen, das einem erzählt wurde oder das man durch Erlebnisse erworben hat wie Gerüchte-Wissen oder Ereigniswissen, kann man ebenfalls gut wiedergeben (know-about). Anwendungswissen, Erfahrungswissen oder besondere Fertigkeiten werden üblicherweise durch das Tun gelernt und sind meist schwierig wiederzugeben. Gelernt wird eher über Beobachtung und Kommunikation (know-how). Wissen, das durch Nachdenken über das Tun erworben wird, kommt zum Beispiel durch die Verständigung in einer Gruppe zustande. Man spricht von Meta- oder intellektuellem Wissen (know-why). Es ist kognitiv verfügbar und reproduzierbar. Strategisches-, Methoden-, und Expertenwissen (know-what-to-do) ist komplexeres Wissen und wird ständig durch das Zusammenspiel der verschiedenen Wissensarten erweitert. Diese Form ist kaum weiter zu geben (vgl. Haser Roumois, 2010, S. 53).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 3: Wissensarten
Quelle: Roumois, 2010, S. 54.
Dem Wissen über Produkte, Kunden und Partner der Organisation wird von Praktikern die höchste Bedeutung beigemessen. Ebenso wird das Fach- und Methodenwissen angesiedelt. Somit wird von den Unternehmen zunehmend nach Möglichkeiten gesucht, solche Wissenslücken zu schließen (vgl. Orth et al., 2008, S. 14).
Der Biologe und Wissenschaftstheoretiker Polanyi hat in den 1960er Jahren den Begriff tacit knowledge geprägt, der später mit implizitem Wissen in das Deutsche übersetzt wurde. Polanyi hat festgestellt, dass Menschen über wesentlich mehr Wissen verfügen, als sie benennen können. Teile davon können ergründet werden (vgl. Polanyi, 1983, S.4).
Implizites Wissen beinhaltet das gesamte Wissen eines Menschen, das er im Laufe seines Lebens aufgrund von Erfahrungen, Situationen oder Umständen in seinem Kopf gesammelt wurde. Die einzelnen Wissensteile haben jedoch unterschiedliche Merkmale hinsichtlich der Art ihrer Entstehung. Die Intuitionen haben zum Beispiel eine andere Qualität als auswendig gelerntes Fachwissen. Das implizite Wissen kann unbewusst, bewusst oder latent sein. Explizites Wissen ist dagegen bewusstes Wissen, das mitgeteilt werden kann. Wenn es mitgeteilt oder aufgeschrieben wurde, hat das Wissen jedoch einen anderen Zustand angenommen und sich durch den Kontext verändert. Dazu werden Codes wie die Sprache oder Zeichen benutzt. Das explizite Wissen kann nun einem anderem als Information dienen und könnte einen Beitrag zu seiner Wissensanreicherung darstellen (vgl. Hasler Roumois, 2010, S. 46ff.).
2.1.3 Gründe für Wissensmanagement
Es existieren drei grundlegende Gründe, warum Wissen als Schlüsselressource in der heutigen Wirtschaft geworden ist: Arbeit und Kapital werden von der Ressource Wissen durch den strukturellen Wandel von arbeitsintensiven Tätigkeiten hin zu wissen- und informationsintensiven Tätigkeiten. Dies führt zum einen zu Veränderungen innerhalb der Organisationen und zu einer anderen Ansicht von Führung und Mitarbeitern. Als zweiter Grund gelten die Globalisierung der Wirtschaft und die damit zusammenhängende Veränderung der internationalen Arbeitsteilung. Neue Mitbewerber treten in immer kürzeren Abständen auf den Markt. Als dritten Grund wird die Informations- und Kommunikationstechnologie angeführt. Sie sorgen für eine weltweite Informationstransparenz, schnellere Innovationszyklen, Preisverfall und kürzere Produktlebensphasen (vgl. North, 2011, S. 14f.). Die folgende Abbildung soll dies veranschaulichen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 4: Drei Triebkräfte steigern die Bedeutung der Ressource Wissen
Quelle: North, 2011, S. 15.
Die Gründe für die Notwendigkeit eines Wissensmanagements lassen sich in qualitative und quantitative unterscheiden. Qualitativ gesehen ist es bedeutsam, wenn sich durch das Wissensmanagement ein geringerer Aufwand für die Suche nach erforderlichen Daten, Informationen oder Dokumenten ergibt. Es würde eine Zeitersparnis mit sich bringen. Wird dieses bestimmte, organisierte Wissen im ganzen Unternehmen genutzt, so bringt es in allen Bereichen Zeit- und Aufwandvorteile. Ein weiterer Grund wäre, dass das Wissensmanagement die Kommunikation im Unternehmen verbessert. Auch Projekte können schneller durch gemeinsames Nutzen von Wissen abgewickelt und durch eine klare Dokumentation transparenter werden. Eine jederzeitige gezielte Zugriffsmöglichkeit erhöht die Effektivität für Folgeprojekte, indem zum Beispiel dokumentierte Fehler bei vergleichbaren zukünftigen Projekten vermieden werden können. Ein weiterer Grund für ein Wissensmanagement kann eine schnellere Eingliederung von neuen Mitarbeitern oder Projektteilnehmern sein (vgl. Keuper, Neumann, 2009, S. 123). Aufgrund der Größe vieler Organisationen kann eine Führung durch direkte Anweisungen und Kontrolle fast nicht mehr praktiziert werden. Mitarbeiter müssen in die Lage versetzt werden, sich selbst über einen Sachverhalt Gedanken zu machen und nach eigenen Überlegungen zu handeln. Damit dies funktionieren kann, müssen die Mitarbeiter auf eine entsprechende Wissensbasis zurückgreifen können (vgl. Gehle/Müller, 2001, S. 32).
Ein wesentlicher Einflussfaktor auf die Bedeutung von Wissensmanagement ist die Halbwertszeit des Wissens. Sie sagt aus, nach welcher Zeit erworbenes Wissen noch die Hälfte wert ist. Schulwissen besitzt eine Halbwertszeit von ca. 20 Jahren. IT-Wissen dagegen nur zwei Jahre. Unternehmen sind diesbezüglich häufiger gefordert, neues Wissen in die Organisation einzubringen und entsprechend die Mitarbeiter zu schulen (vgl. Jaspers/Fischer, 2008, S.1).
Die schnelle Integration von neuen Mitarbeitern in das Unternehmen sowie die Nutzung des bestehenden Wissens für neue Projekte und Dienstleistungen stehen an erster Stelle bei kleinen und mittelständigen Unternehmen, wenn es um Gründe für Wissensmanagement geht. Weitere Bereiche sind der Transfer von Wissen im Projekt und zwischen Projekten, die Nutzung von Wissen für Prozess- und Produktoptimierung, die Nutzung von Informationen von und über Kunden und Lieferanten, die Strukturierung und Vernetzung von Datenablagen, die Sicherung des Wissens von ausscheidenden Mitarbeitern, die Verbesserung des Wissenstransfers zwischen den Abteilungen sowie die Schaffung von Transparenz über die intern vorhandenen Kompetenzen (vgl. Orth et al., 2011, S. 7).
2.1.4 Modelle und Phasen des Wissensmanagements
Für die Implementierung eines Wissensmanagements empfiehlt sich die Anlehnung an folgende Projektvorgehensweise:
In der ersten Phase stehen die Initialisierung und die Strategie im Mittelpunkt. Danach wird der konkrete Wissensstand und -bedarf erhoben. Idealerweise werden hierzu im Rahmen von Workshops Personen und Entscheidungsträger aus den verschiedenen Bereichen involviert. In Phase drei werden die Ziele definiert und Lösungen dokumentiert. Anschließend erfolgt die Umsetzung, welche zu einem späteren Zeitpunkt kontrolliert und bewertet wird (vgl. Mertins/Seidel, 2009, S. 115ff.).
In der Literatur sind diverse Ansätze vorhanden, welche sich mit dem Wissenserwerb, der Wissensverteilung und der Speicherung von Wissen in Organisationen beschäftigen. Die im Folgenden beschriebenen Modelle gelten oft als Grundlagenmodelle: Das bekannteste ist die Wissensspirale von Nonaka und Takeucht aus dem Jahr 1997. Die Autoren legen den Schwerpunkt auf das Generieren von Wissen durch die Wandlung von implizitem zu explizitem Wissen. Probst et al. dagegen legen den Fokus auf sechs Bausteine als Hauptbestandteil eines Wissensmanagements von Bewertung und Zielen. Das Münchener Modell von Reinmann-Rotmeier zielt auf die Erweiterung der Lernfähigkeit und -bereitschaft der einzelnen beteiligten Mitglieder ab. Dieses Modell versucht in Anlehnung an die davor genannten, der psychologischen Seite mehr Geltung zu schenken. Technik, Organisation und Mensch werden miteinander verbunden und sollen so einen ganzheitlichen Ansatz darstellen. Durch die Darstellung auf der Ebene der Organisation und auch auf persönlicher Basis soll eine Verbindung zwischen Wissen und dem Lernprozess hergestellt werden (vgl. Karabag, 2015, S. 14f.)
2.1.4.1 Die Wissensspirale von Nonaka und Takeuchi
Das Modell von Nonaka und Takeuchi beschreibt im Wesentlichen die vier Formen der Wissensumwandlung. Vorab wird die Unterscheidung zwischen explizitem und implizitem Wissen (s. Kap. 2.1.2) dargestellt. Das explizite Wissen kann den Autoren zufolge ohne weiteres weitergegeben werden. Es ist Verstandeswissen das sich durch erzählen oder aufschreiben ausdrücken lässt. Das implizite Wissen kommt aus Erfahrungen, individuellen Überzeugungen und ist an persönliche Zusammenhänge gebunden. Dieses Wissen lässt sich nicht einfach mitteilen. Durch ein Zusammenspiel dieser beiden Wissensarten entsteht neues Wissen und das bestehende wird erweitert. Von implizitem zu explizitem Wissen kann durch ein Gespräch, durch Beobachtung oder Nachahmung stattfinden. Erst durch einen Code oder durch Dokumentation kann das implizite Wissen einem Unternehmen zur Verfügung stehen (vgl. Nonaka/Takeuche, 1997, S. 73).
Das Modell bezeichnet die Externalisierung als wichtigste Form der Wissensschaffung. Da externes Wissen jedoch nur schwierig zu benennen ist, erfolgt der Austausch durch Verwendung von Analogien, Hypothesen oder Metaphern. Internalisierung wird der Prozess von explizitem zu implizitem Wissen durch individuelles Tun und durch Meinungsbildung in diesem Modell bezeichnet. Die Kombination von bereits vorhandenem Wissen mit neuem, explizitem Wissen kann durch Dokumente, Kommunikationsmittel und Computer unterstützt werden (vgl. Lehner, 2012, S. 72ff.).
Die Wissensspirale durchschreitet fünf Phasen und beginnt mit dem Austausch von implizitem Wissen im Rahmen einer Sozialisierung. Das durch Erfahrung gesammelte implizite Wissen des einzelnen wird zum Beispiel in sich selbst organisierenden Gruppen mit unterschiedlichem Fachwissen ausgetauscht. Durch diesen Austausch entsteht in der zweiten Phase ein Konzept. Hier findet die Externalisierung statt und Konzepte entstehen unter dem Einfluss von verschiedenen Horizonten. In der nächsten Phase wird das Konzept dem Unternehmen oder anderen Gruppen erklärt. Es wird geklärt, ob das Konzept zu den Unternehmenszielen passt und weiterverfolgt werden soll. Besteht das Konzept die Erklärungsphase wird ein Prototyp oder ein Modell erarbeitet. Hier wird das Fachwissen von anderen Experten zur weiteren Entwicklung eingebracht. In der letzten Phase wird das Wissen übertragen. Die Wissensschaffung ist ein andauernder Prozess und findet in allen Bereichen der Unternehmung statt. Das konkretisierte Wissen kann sich nun innerhalb des Unternehmens und auch zwischen anderen Unternehmen ausdehnen (vgl. Nonaka/Takeuchi, 1997, S. 88ff.).
Im Grunde lässt sich nach den Autoren die Wissensschaffung in japanischen Unternehmen als die Umwandlung von implizitem zu explizitem Wissen beschreiben. Subjektive Einstellungen und Ideen der Einzelnen nützen dem Unternehmen nur dann, wenn dieses Wissen in explizites Wissen gewandelt und mit anderen geteilt werden kann. Dabei existieren drei Hauptmerkmale der Wissensschaffung (vgl. Nonaka/Takeuchi, 1997, 23ff.):
1) Japanische Manager äußern ihre Ahnungen und Einsichten in Bildern. Insbesondere Metaphern und Analogien ermöglichen Menschen, Erfahrungen und Eindrücke aus unterschiedlichen Erfahrungswelten ohne Analyse und Verallgemeinerung auf neue Art zusammen zu fassen.
2) Persönliches Wissen wird zu unternehmerischem Wissen. Wissen ist nur möglich durch die Initiative eines Einzelnen und die Interaktion in einer Gruppe. Wissen innerhalb der Gruppe kann sich durch Diskussion, Erfahrungsaustausch und Beobachtung verstärken. Innerhalb der Gruppe werden neue Standpunkte entwickelt und durch Meinungsverschiedenheiten und Konflikte können in Verbindung mit Erfahrungswerten neue Konzepte entstehen. Dieser Prozess ermöglicht die Übertragung von persönlichem Wissen zu Unternehmenswissen.
3) Verwirrung oder die Vieldeutigkeit führt zu Wissensschaffung. Durch unterschiedliche Ziele und Vorgaben für ein Problem werden verschiedenen Argumentationsketten zusammengeführt und das kann neues Wissen generieren. Durch das entstehende Chaos werden der Dialog und die Kommunikation gefördert.
Der dauernde Transfer vom individuellen Wissen zum Kollektiv und zurück wird mit Spirale des Wissens bezeichnet. Erforderlich sind dazu ein erhöhtes persönliches Engagement der Mitarbeiter und die Bereitschaft aller sich mit den Unternehmenszielen zu identifizieren. Durch die sich überschneidenden Prozesse und Verantwortungsbereiche können Mitarbeiter an dem impliziten Wissen anderer teilhaben. Ziel ist es, möglichst viele Mitglieder der Organisation Zugang zu einem breiten Wissen und Informationen haben. So ist es möglich auf unvorhergesehene Ereignisse schneller und kreativer zu reagieren. In diesem Modell sollen Kontexte geschaffen werden, welche die Entstehung und die Verarbeitung von Wissen unterstützen (vgl. North, 2011, S. 198 f).
Abbildung 5 stellt dar, wie die weiter unten beschriebenen Prozesse ineinandergreifen und somit die Theorie der Wissensschaffung in Unternehmen abbildet. Der Kern der Theorie liegt in der Beschreibung der Abläufe, welche zu einer derartigen Wissensspirale führen können. Durch das Zusammentreffen von implizitem und explizitem Wissen lassen sich vier Formen der Wissensumwandlung darstellen. Diese sind: Sozialisation, Externalisierung, Kombination und Internalisierung (vgl. Nonaka/Takeuchi, 1997, S. 69).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 5: Spirale der Wissensschaffung im Unternehmen
Quelle: Nonaka/Takeuchi, 1997, S. 87.
Den Grundstein dieser Erkenntnistheorie bildet die oben ausgeführte Unterscheidung zwischen explizitem und implizitem Wissen. Somit ist die Epistemologische Dimension also die Erkenntnistheorie die Basis der Annäherung an die Wissenstheorie bei Nonaka und Takeuchi. Diese Theorie weist eine eigene Ontologie auf, welche auf die Erzielung von Wissen auf den verschiedenen Ebenen abzielt. Diese sind Individuum, Gruppe, Unternehmen und die Interaktion zwischen Unternehmen (vgl. Nonaka/Takeuchi, 1997, S. 68). Der Wissensschaffungsprozess wird nach dieser Theorie nur möglich durch die Umwandlung und Mobilisierung von implizitem Wissen. Die Ebenen der Wissensschaffung innerhalb einer Organisation sind somit das Individuum, die Gruppen, das Unternehmen selbst sowie die Aktionen von dem Unternehmen mit anderen Unternehmen. Es werden vier Formen der Wissensschaffung unterschieden: Die Sozialisation, die Externalisierung, die Kombination und die Internalisierung bilden die Grundsteine dieses Modells:
Die erste Form der Wissensumwandlung wird mit Sozialisation bezeichnet. Hier findet ein Erfahrungsaustausch statt, bei dem implizites Wissen wie zum Beispiel gemeinsame Fähigkeiten oder mentale Modelle entsteht, das ohne Sprache erworben oder vermittelt werden kann. Beobachtungen, Nachahmung oder auch Praxiserfahrungen übertragen Wissen auf andere. Im Mittelpunkt steht hier die Erfahrung. Die Externalisierung stellt die zweite Form der Wissensumwandlung dar. Dabei wird implizites Wissen in explizite Konzepte übertragen. Das implizite Wissen wird in Metaphern, Analogien, Modellen oder Hypothesen dargestellt. In der dritten Form, der Kombination, werden in einem bestimmten Wissensbereich verschiedene Inhalte von explizitem Wissen miteinander verknüpft. Dieser Austausch findet unter Anwendung verschiedener Medien statt wie zum Beispiel in Besprechungen, Dokumenten oder Netzwerken. Durch das Sortieren, Katalogisieren und neu Zusammenstellen von explizitem Wissen kann neues Wissen generiert werden. Im der vierten Form der Wissensumwandlung wird explizites Wissen in implizites Wissen integriert. Diese Internalisierung kann durch Dokumente, Geschichten oder Handbüchern festgehalten werden. Falls solche Erfahrungen von mehreren Mitgliedern geteilt werden, wird das implizite Wissen Teil der Unternehmenskultur. Diese Verarbeitung von explizitem Wissen in implizites Wissen gleicht dem Prinzip von learning by doing (vgl. Nonaka/Takeuchi, 1997, S. 74ff.).
Eine Wissenserzeugung des Einzelnen durch Sozialisieren und Internalisieren in einem Unternehmen erfolgt erst durch die Kommunikation also durch das Externalisieren zum Beispiel in der Arbeitsgruppe oder der Abteilung. So wird der gleiche Prozess innerhalb der Sozialisation in der Gruppe angestoßen und kann so immer weiter innerhalb einer Organisation verbreitet werden. Damit kann das gesamte Verhalten eines Unternehmens durch Wissenserweiterung verändert werden (vgl. Hasler Roumois, 2010. S. 228f.).
Die Voraussetzungen für die Wissensschaffung auf Unternehmensebene sind Intention, Autonomie, Fluktuation und kreatives Chaos, Redundanz und notwendige Vielfalt (s. Abbildung 6). Sie schlagen sich oft in den Unternehmenszielen oder in einer Vision nieder.
Die Intention bietet dem Unternehmen die Grundlage zur Bewertung von wahrgenommenem oder geschaffenem Wissen.
Die Autonomie bietet den Mitgliedern auf jeder Unternehmensebene möglichst autonome Handlungsmöglichkeiten. Die Mitarbeiter sollen selbstständig agieren können damit das Unternehmen flexibler bei der Aneignung und Weitergabe von Wissen ist. Autonome Teams können so individuelle Perspektiven bündeln und diese auf eine höhere Ebene weitertragen.
Die Fluktuation führt dazu, dass Routinearbeiten und Gewohnheiten gestört werden. Grundanschauungen müssen immer wieder überdacht werden. Der Zwang zur sozialen Interaktion kann zu neuen Konzepten führen. Es sollte ein andauernder Prozess des Hinterfragens und neu Überdenkens fördert die Wissensschaffung im Unternehmen.
Mit Redundanz ist gemeint, dass die einzelnen Mitglieder über mehr bereichsübergreifende Informationen verfügen als für aktuelle operative Lösungen erforderlich wären. Der einzelne kann so seine Aufgaben und seinen Platz in der Organisation besser verstehen. Die Personalrotation stellt eine Möglichkeit dar den Horizont von Mitarbeitern zu erweitern.
Als letzte Voraussetzung ist die notwendige Vielfalt zu nennen. Die Mitglieder sollen aus verschiedenen Handlungsalternativen auswählen können. Das kann die Flexibilität der gesamten Organisation erhöhen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 6: Fünf-Phasen-Modell der Wissensbeschaffung im Unternehmen
Quelle: Nonaka/Takeuchi, 1997, S. 100.
2.1.4.2 Das Bausteine-Modell von Probst et al.
Dieses Modell von Probst et al. wird häufig in der Praxis für die Einführung und Gestaltung von Wissensmanagement verwendet. Die einzelnen Bausteine stellen jeweils einen Aspekt in den Mittelpunkt. Zusammengenommen kann dadurch ein umfassender Ansatz zur Bildung eines Wissensmanagements in einer Organisation entstehen. Das Modell folgt dem klassischen Managementkreislauf (s. 2.1.1) in seinen Phasen. Von den acht Phasen gibt es sechs, welche den operativen Teil erfüllen, und zwei übergeordnete, welche den strategischen Bereich des Wissensmanagements betreffen. (vgl. Lehner, 2012, S. 78).
Die Basis dieses Modells stellen die sogenannten Kernprozesse dar. Diese sind miteinander verbunden und zeigen Abhängigkeiten auf. Ein Eingreifen oder Optimieren in einen einzelnen Kernprozess, ohne die entstehenden Veränderungen bei den anderen Prozessen zu berücksichtigen, sollte vermieden werden.
Der erste Baustein der Kernprozesse ist die Wissensidentifikation. Darunter werden Maßnahmen zur Beschreibung und Analyse des Wissensumfeldes eines Unternehmens gefasst. Fehlt es einem Unternehmen an Transparenz bezüglich interner und externer Daten, Fähigkeiten und relevanten Informationen, so kann dies zu uneffektiven Entscheidungen führen. Ein wirkungsvolles Wissensmanagement soll die Mitarbeiter bei ihrer Daten- und Informationssuche unterstützen (vgl. Probst et al., 2006, S. 29). Die Wissensidentifikation dient der internen und externen Bestandsaufnahme des vorhandenen Wissens, um darauf den Bedarf an künftigem Wissen abzuleiten.
Den zweiten Baustein stellt der Wissenserwerb dar. Unternehmen gelangen auf vielfältige Weise zu internem und externem Wissen. Da können Kundenbeziehungen, Lieferantenkontakte oder auch die Konkurrenten mögliche Quellen sein. Mit Wissenserwerb ist eine gezielte Strategie gemeint, wie externes Wissen zum Beispiel von Mitbewerbern durch Neueinstellungen oder durch Stakeholder-Wissen erworben werden kann. Die Wissensentwicklung ist komplex, kann sich auf den Einzelnen oder auch Gruppen beziehen und soll neues Wissen innerhalb des Unternehmens generieren. Damit Wissen auch genutzt werden kann, muss es sinnvoll verteilt sein und zur Verfügung stehen. Die Nutzung fremden Wissens kann durch Barrieren behindert werden. Diese können psychologische oder strukturell bedingt sein und müssen erkannt und gezielt beseitigt werden. Das Wissensmanagement bringt wenig, wenn das festgestellte wichtige und spezifische Wissen nicht dauerhaft zur Verfügung gestellt wird. Es ist auszuwählen, zu speichern und nach einigen Abständen auf die Aktualität hin zu überprüfen (vgl. Al-Laham, 2003, S. 84f.). Die Möglichkeiten des Wissenserwerbes werden oft nicht ausgeschöpft. Eine Option stellt der externe Erwerb von Wissen von externen Experten dar.
Bei dem dritten Kernprozess des Wissensmanagements steht die Wissensentwicklung im Mittelpunkt. Hiermit sind alle Bestrebungen des Managements gemeint, welche darauf abzielen, intern oder extern noch nicht existierende Fähigkeiten zu entwickeln. Diese Wissensentwicklung kann in allen Bereichen der Organisation für den Unternehmenserfolg sinnvoll sein. Hierzu zählen auch die klassischen Bereiche wie Marktforschung und Forschung und Entwicklung (vgl. Probst et al., 2006, S. 29ff).
Sowohl das Teilen von Wissen wie auch die gezielte Verteilung von Wissen und relevanten Informationen innerhalb eines Unternehmens sind erforderlich, um einen Nutzen zu generieren. Dabei muss nicht jeder in einem Unternehmen auf alle Informationen zugreifen können: Es gilt eine sinnvolle Aufbereitung und Verteilung des Zugriffs von den einzelnen und von Gruppen zu finden. Der eigentliche Zweck des Wissensmanagements ist die produktive Nutzung und Umsetzung zum Vorteil des Unternehmens. Hierzu können – und müssen mitunter – Barrieren entstehen. Sehr wichtige Bereiche wie Patente oder Lizenzen gilt es zu sichern. Der letzte Baustein betrifft in diesem Sinne die Bewahrung von bestehendem Wissen. Relevantes Wissen ist in verschiedenen Bereichen im Unternehmen mit geeigneten Methoden regelmäßig zu sichern und in Abständen zu überprüfen, was noch gespeichert bleiben sollte. Zum Beispiel sind gemachte Erfahrungen, erworbene Fähigkeiten, wichtige Dokumente und Projektdokumentationen in unterschiedlichen Speichermedien für Wissen zu bewahren (vgl. Probst et al., 2006, S. 29ff).
[...]
- Arbeit zitieren
- Manfred Wagner (Autor:in), 2016, Implementierung eines Wissensmanagements im Unternehmen. Wie Kenntnisse aus dem Change Management helfen können, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/319033
Kostenlos Autor werden




















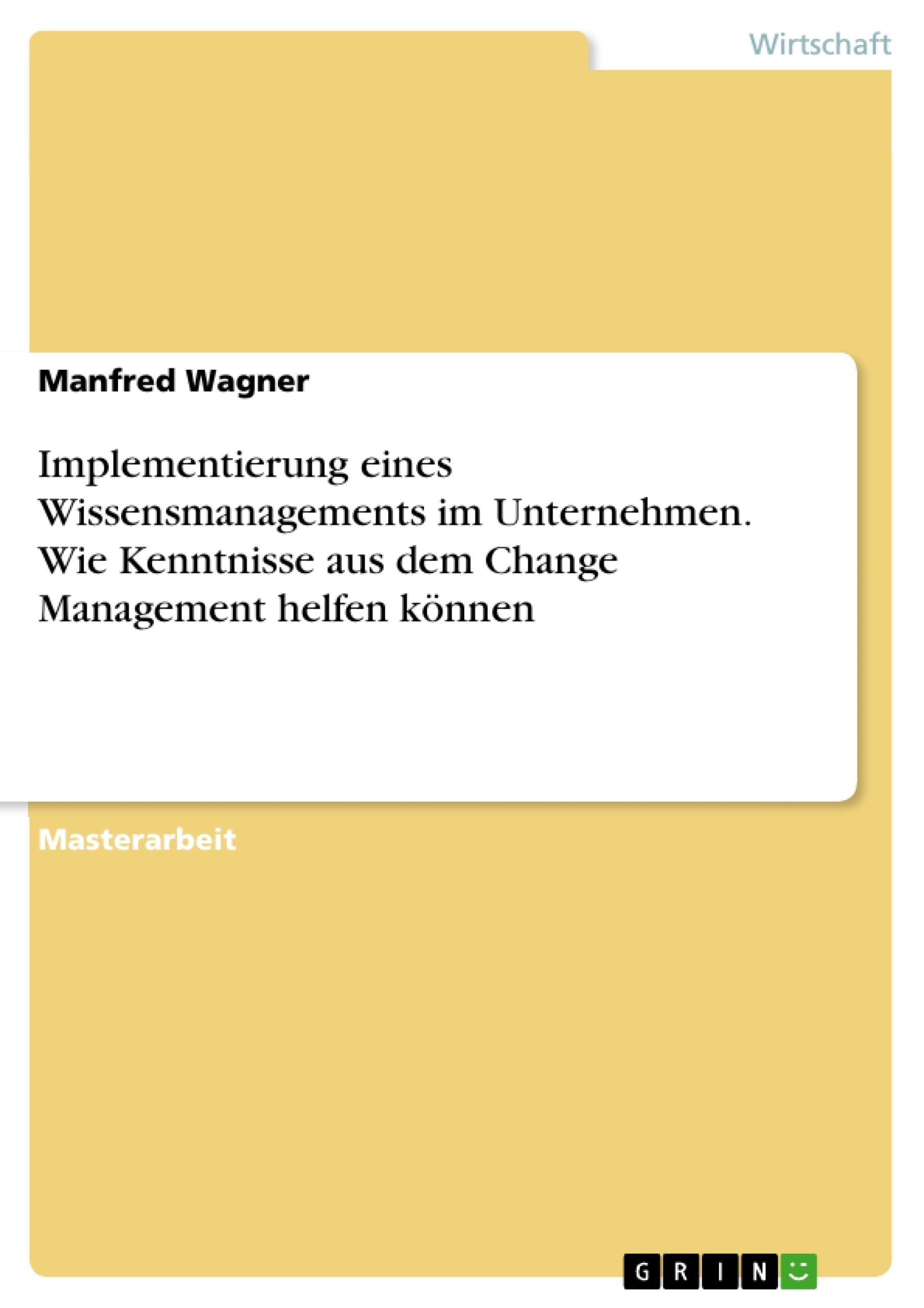

Kommentare