Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
1. EINFÜHRUNG
1.1 Thematischer Kontext und Zielsetzung der Arbeit
1.2 Methodenauswahl und Aufbau der Arbeit
2. KOMMUNIKATION, KOMPETENZ UND KOMMUNIKATIVE KOMPETENZ
2.1 Kommunikation
2.2 Der Kompetenzbegriff
2.3 Kommunikative Kompetenz
3. CARL ROGERS‘ PERSONENZENTRIERTER ANSATZ
3.1 Historische Entwicklung
3.2 Das Menschenbild der humanistischen Psychologie
3.3 Grundkompetenzen
3.3.1 Empathie oder einfühlendes Verstehen
3.3.2 Wertschätzung oder bedingungsloses Akzeptieren
3.3.3 Kongruenz oder Echtheit
3.4 Die Bedeutung der zwischenmenschlichen Beziehung
4. PÄDAGOGISCHE BERATUNG
4.1 Problematik der Institutionalisierung
4.2 Beratung im allgemeinen Verständnis
4.3 Beratung im pädagogischen Verständnis
4.4 Beratung in Abgrenzung zu Therapie und Erziehung
5. DIE BEDEUTUNG DER KOMMUNIKATIVEN GRUNDKOMPETENZEN IN DER PÄDAGOGISCHEN BERATUNG
5.1 Populärwissenschaftliche Literatur
5.1.1 Das pädagogische Gesprächstraining (PGT)
5.1.2 Weitere populärwissenschaftliche Literatur
5.2 Wissenschaftliche Literatur
6. SCHLUSSBETRACHTUNG
LITERATURVERZEICHNIS
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1. EINFÜHRUNG
1.1 Thematischer Kontext und Zielsetzung der Arbeit
Bedingt durch den permanenten und rasanten gesellschaftlichen Wandel verändern sich Alltag und Berufsleben jedes Individuums auf vielfache Weise. Sowohl die Kon- frontation mit neuen Bedingungen, die ein flexibles und offenes Einlassen vorausset- zen als auch mit einer unvorhersehbaren Zukunft, die eine ständige Reflexion der eigenen Lebenspläne voraussetzt und mit veränderten Normen, Werten und Traditi- onen, die alle Lebensbereiche unübersichtlicher und komplexer erscheinen lassen, stellen jeden Einzelnen vor eine komplexe Aufgabe. Aus diesem Grund unterliegt die eigenständige Bewältigung des Alltags dem Trend, nicht mehr als Selbstverständ- lichkeit an das Individuum herangetragen zu werden, was folglich die Ausbreitung des Phänomens Beratung mit sich bringt. Beratung als unterstützende zwischen- menschliche Kommunikation, die der Unübersichtlichkeit und Überforderung als Ori- entierungs- und Entscheidungshilfe entgegenwirken soll (vgl. Dewe/ Schwarz 2013, S.19-21). Ein weiterer Faktor, der Beratung als unabdingbare und allgegenwärtige Profession nach sich zieht, ist die Selbstverständlichkeit des lebenslangen Lernens. Der ständige soziale Wandel, welcher im Berufsleben Veränderungen wie beispiels- weise (bspw.) wissensbasiertere Arbeitsbedingungen und Aufgaben oder die Digitali- sierung, speziell die Computerisierung, und die damit verbundene elektronische Da- tenverarbeitung zur Folge hat, setzt voraus, dass sich Menschen aller Altersstufen mit den neuen technischen Errungenschaften auseinandersetzen, ihre Funktionswei- se erlernen und mittlerweile unzureichende Qualifikationen durch Weiterbildungs- maßnahmen erweitern müssen (vgl. Hof 2009, S.26f.). Ebenso bedingen Verände- rungen, die den Alltag betreffen wie zum Beispiel (z.B.) veränderte Formen des fami- liären Zusammenlebens und damit auch veränderte Wertvorstellungen eine höhere Lebenserwartung, die die Gestaltung des Alters erschwert oder etwa die Zunahme chronischer Erkrankungen und Behinderungen, dass sich jeder Einzelne in der Ori- entierungslosigkeit, hervorgerufen von übermäßig vielfältigen Möglichkeiten der Le- bensgestaltung, und der Komplexität zurechtfinden muss (vgl. Krause 2003, S.19; Sander/ Ziebertz 2010, S.19). Biologisch betrachtet zeigt sich lernen als lebenslang notwendiger (Lern-)Prozess bezüglich (bzgl.) der Auffassung Gehlens, dass der Mensch als Mängelwesen verstanden wird, der sich durch das Aneignen von Kennt- nissen und Fähigkeiten an die ständig veränderte Umwelt anpasst und somit sein Überleben sichert. In diesem Zusammenhang stimmt Lernen mit Leben überein (vgl.
Hof 2009, S.16). Pädagogische Beratung setzt an diesem Punkt an und zielt darauf, das schwierig, überkomplex oder sogar unerträglich gewordene Leben wieder bewäl- tigen zu lernen beziehungsweise (bzw.) leben zu lernen (vgl. Göhlich et al. 2007, S.8). Berater und Therapeuten treten den vielfältigen Problemen jedes Individuums mit einem ebenso breit gefächerten Repertoire an Kompetenzen und Fähigkeiten entgegen. Dies bedeutet nicht nur das eigens erworbene Fachwissen der vorliegen- den Problematik angepasst anzuwenden, sondern auch sein Augenmerk ständig auf weitere Hilfsangebote zu richten und diese in besonderen Fällen in Anspruch zu nehmen (vgl. Sander/ Ziebertz 2010, S.20). Genauer gesagt versuchen Berater als gleichberechtigte, einfühlsame und zuverlässige Kommunikationspartner den Klien- ten einerseits Informationen, Deutungen und Ratschläge zu vermitteln und ihre indi- viduellen Probleme zu verstehen. Anderseits besitzt neben dem fachlichen auch der zwischenmenschliche Aspekt, das heißt (d.h.) eine warme, echte Beziehung herzu- stellen, eine ebenso hohe Signifikanz, um eine Orientierungs- und Entscheidungsfin- dung beim Klienten hervorzurufen. (vgl. Dewe 2010, S.132; Sander/ Ziebertz 2010, S.24-26). Dieses Konzept findet sich gleichermaßen im personenzentrierten Ansatz Carl Ransom Rogers wieder, der einen erfolgreichen Therapieverlauf und somit auch Veränderungen innerhalb der Persönlichkeit des Klienten von der Beziehung zwi- schen Therapeut und Klient bzw. von der Einstellung des Therapeuten abhängig macht (vgl. Rogers 1987b, S.17/22). Dieser Haltung misst er die drei Grundkompe- tenzen Empathie, Akzeptanz und Kongruenz bei, welche einerseits bedeutender sind als erworbenes therapeutisches Wissen und Fähigkeiten und anderseits vom Thera- peuten auf eine Art und Weise vermittelt werden müssen - größtenteils nonverbal, d.h. in Worten, Mimik und Gestik - damit diese vom Klienten wahrgenommen wer- den, das Beziehungsangebot des Therapeuten angenommen und ein Therapiepro- zess in Gang gesetzt wird (vgl. Rogers 1987b, S.22f.; Sander/ Ziebertz 2010, S.85; Stumm/ Keil 2014a, S.27). Das dadurch erzeugte wachstumsfördernde Klima befä- higt den Klienten sich zu öffnen, sich seiner selbst, seinen eigenen Gefühlen und Einstellungen bewusst zu werden und diese zum Ausdruck zu bringen (vgl. Rogers 1987a, S.66f.; Rogers 1987b, S.18/163).
Weil Rogers vor allem (v.a.) der Einstellung des Therapeuten eine besonders große Bedeutung beimisst und zudem im Bereich der Psychologie und Psychotherapie an- zusiedeln ist, soll im Zuge der Arbeit der Frage nachgegangen werden, welche Rolle kommunikative Grundkompetenzen in der pädagogischen Beratung bzw. in pädago- gischen Beratungsansätzen spielen. Dahingehend soll die Analyse wissenschaftlicher Literatur und Ratgeberliteratur zeigen, ob sich neben psychologischen und psychotherapeutischen auch pädagogische Bereiche identifizieren lassen, in denen diese Grundkompetenzen als Voraussetzung für einen positiven, gelingenden Beratungsverlauf Eingang finden.
1.2 Methodenauswahl und Aufbau der Arbeit
Im Rahmen der Arbeit ÄKommunikative Grundkompetenzen pädagogischen Han- delns als zentrales Moment in der pädagogischen Praxis“ wird sowohl wissenschaft- liche als auch populärwissenschaftliche Literatur hinsichtlich kommunikativer Grund- kompetenzen analysiert, um deren Bedeutung für die pädagogische Beratung aufzu- zeigen. Dahingehend dient das hinführende Kapitel über Kommunikation, Kompetenz und kommunikative Kompetenz dazu, sich der Thematik definitorisch anzunähern und trägt allgemein zur besseren Verständlichkeit bei. Im Anschluss daran wird der personenzentrierte Ansatz Carl Rogers‘ näher beleuchtet, wobei lediglich grundle- gende Aspekte herausgegriffen werden, die einerseits die pädagogische Perspektive in seinem Konzept ersichtlich werden lassen und andererseits zur Beantwortung der Frage beitragen. Insgesamt wird der Fokus in diesem Kapitel auf den kommunikati- ven Grundkompetenzen Empathie, Akzeptanz und Kongruenz liegen. Darauf folgend wird das Feld der pädagogischen Beratung thematisiert. Eingangs wird die Proble- matik, in der Wissenschaftslandschaft Fuß zu fassen, erläutert und anschließend der Versuch, pädagogische Beratung in Abgrenzung zum allgemeinen Verständnis von Beratung zu definieren, unternommen. Des Weiteren soll durch die Gegenüberstel- lung von Beratung, Therapie und Erziehung die Durchlässigkeit der Grenzen zwi- schen selbigen aufgezeigt werden. Im darauffolgenden Kapitel findet die Durchfüh- rung der eigentlichen Analyse populärwissenschaftlicher und wissenschaftlicher Lite- ratur statt. Neben der kritischen Auseinandersetzung mit unterschiedlicher Literatur soll unter anderem (u.a.) der Versuch unternommen werden hinsichtlich der vielfälti- gen und nahezu unübersichtlichen Fülle an Literatur und deren nicht eindeutigen Grenze zwischen wissenschaftlich und populärwissenschaftlich für mehr Klarheit zu sorgen. Abgesehen vom Schriftgut ist es dem Umfang und Aufwand der Bachelorar- beit geschuldet, dass diese lediglich theorieorientiert ist und der Praxisbezug außen vor gelassen werden muss, sodass die Ergebnisse der Ausarbeitung lediglich auf der aufgelisteten Literatur basieren. In der Schlussbetrachtung werden wesentliche Er- gebnisse der Analyse dargelegt und zusammengefasst, inwiefern die kommunikati- ven Grundkompetenzen Rogers‘ in der pädagogischen Beratung Eingang finden.
Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird auf eine geschlechtsspezifische Diffe- renzierung verzichtet. Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, gelten diese im Sinne der Gleichbehandlung beider Geschlech- ter.
2. KOMMUNIKATION, KOMPETENZ UND KOMMUNIKATIVE KOMPETENZ
Die Auseinandersetzung mit der Forschungsfrage und Beantwortung derer betref- fend, dient die Ausführung dieses Kapitels der besseren Verständlichkeit. Hierbei stehen Definitionen, Bedeutung und die begriffliche Abgrenzung im Vordergrund. Folglich wird darauf verzichtet ein bestimmtes Kommunikationsmodell und diverse Kompetenzdefinitionen detailliert vorzustellen, da eine nähere Ausführung an dieser Stelle zu umfangreich wäre. Hinsichtlich der Definition des Kompetenzbegriffs wird lediglich eine für den pädagogisch-psychologischen Kontext gewichtige Begriffsbe- stimmung und der Bereich der sozial-kommunikativen Kompetenzen näher beleuch- tet.
2.1 Kommunikation
Sei es das Regulieren zwischenmenschlicher Beziehungen, die Möglichkeit sich arti- kulieren zu können, Informationen auszutauschen oder sein Verlagen nach Gemein- samkeit zu befriedigen (vgl. Fittkau et al. 1977, S.12; Retter 2002, S.11). Als omni- präsentes Element umfasst die Kommunikation sowohl im privaten als auch im öf- fentlichen Raum, in welchem Kommunikation ein unabdingbares Element wirtschaft- licher, politischer und sozialer Entscheidungsprozesse darstellt, vielerlei Aufgaben und Ziele. Diese allgegenwärtige und essenzielle Bedeutung spiegelt sich im ersten von fünf Axiomen, welches die Basis der Kommunikationstheorie Watzlawicks bilden, wider (vgl. Retter 2002, S.174f.). ÄMan kann nicht nicht kommunizieren“ (Watzlawick et al. 1990, S.53). Kommunikation ist unvermeidlich. Selbst wenn Menschen schwei- gen, sich teilnahmslos verhalten, den verbalen Austausch verweigern oder umgehen, indem sie nicht antworten, vermittelt dies seinem Gegenüber Desinteresse, womög- lich Langeweile oder Müdigkeit, was ebenso eine Art der Kommunikation darstellt (vgl. LeMar 1997, S.117f; Thomas 1991, S.54). Folglich kommunizieren Menschen permanent, in jeder Lebenslage, tagtäglich - mündlich oder schriftlich, unter vier Au- gen oder über größere Entfernungen, bewusst oder unbewusst, verbal oder nonver- bal durch Mimik, Gestik oder Körperhaltung (vgl. Retter 2002, S.13-15). Somit lässt sich schlussfolgern, dass Kommunikation die essenzielle Basis des alltäglichen Le- bens darstellt, ohne welches das menschliche Zusammensein unmöglich und un- denkbar wäre.
Versuche eine einheitliche Definition zu finden, gestalten sich schwierig. Denn je nachdem in welchem Bereich und unter welchem Aspekt der Begriff Verwendung findet, liegen diverse, unzählige Definitionsversuche vor. Greift man auf die etymolo- gische Bedeutung des Begriffs zurück, so lautet die Übersetzung für das lateinische Äcommunicatio“ Mitteilung, Teilhabe oder Gemeinschaft. Ebenso definiert sich das Verb Äcommunicare“ als teilen, mitteilen, teilnehmen lassen und Anteil nehmen (vgl. Stohwasser et al. 2006, S.100f.). Im englischen Sprachgebrauch besitzen die Worte Äcommunication“ und Äcommunicate“ hinsichtlich ihrer Definition lediglich mitteilenden Charakter, was auf die ursprüngliche Bedeutung von Kommunikation schließen lässt. Kommunikation meint demnach lediglich die Informationsvermittlung und versteht sich allgemein als (vgl. Ternes 2008, S.20) ÄAustausch jeglicher Mitteilungen zwi- schen Individuen“ (Thomas 1991, S. 55). Im Gegensatz dazu wird der Fokus im so- zialen Bereich auf den zwischenmenschlichen Aspekt gelegt, wonach sich Kommu- nikation als Äein wechselseitiger Prozess, eine Interaktion, in der sich Lebewesen Nachrichten (Wörter, Laute, Gestik) übermitteln“ (Kulbe 2009, S.84) definiert. Dies setzt mindestens zwei Personen voraus, die im gegenseitigen Austausch Nachrich- ten versenden und empfangen (vgl. Retter 2002, S.11). Dabei ist der übermittelnden Nachricht nicht nur ein inhaltlicher und sachlicher, sondern auch ein Beziehungsas- pekt immanent. Die wechselseitigen verbalen oder nonverbalen Aussagen inkludie- ren ebenso welche Intention und welche Einstellung hinter dem Geäußerten stecken. Dies kann sowohl positiv, d.h. Wertschätzung und Zuneigung vermittelnd als auch negativ, etwa neid- oder hasserfüllt sein und die Beziehung beider Gesprächspartner dementsprechend definieren (vgl. LeMar 1997, S.24f.).
2.2 Der Kompetenzbegriff
Ebenso wie sich Beratung durch die immer komplexer, dynamischer, vernetzter und unsicher werdende Lebens- und Arbeitswelt in den Vordergrund schiebt und zu ei- nem omnipräsenten Phänomen wurde ist der gesellschaftliche Wandel ausschlagge- bend für einen regelrechten Kompetenzboom. Orientierungslosigkeit und eine unge- wisse Zukunft verlangen dem Individuum bestimmte Kompetenzen ab, um im Hin- blick auf die Handlungsfähigkeit, selbstorganisiert handeln zu können, den Alltag zu meistern und je nach Profession anderen Individuen gegebenenfalls (ggf.) Hilfestel- lungen zu geben (vgl. Erpenbeck 2013, S.12). Egal ob im privaten Alltag oder im Be- rufsleben - eine nahezu unübersichtliche Menge an Kompetenzen werden vom Indi- viduum abverlangt und erfordern ständiges Weiterbilden und Lernen, um die Entfal- tung bereits vorhandener und das Entstehen neuer Kompetenzen zu gewährleisten (vgl. Erpenbeck/ Heyse 2007, S.157). Die enorme Vielfalt und Menge an Kompeten- zen und deren Allgegenwärtigkeit haben zur Folge, dass der Kompetenzbegriff häu- fig und oft fehlerhaft oder im falschen Zusammenhang verwendet wird und demnach unterschiedliche Definitionen nach sich zieht. Doch was versteht man nun unter Kompetenz und wie kann dies begrifflich präzisiert werden? Grundsätzlich umfasst der Begriff Kompetenz zwei Bedeutungen. Sowohl Zuständigkeit und Befugnis, deren weniger ein sozialer, sondern vielmehr ein politisch-juristischer Charakter anhaftet, als auch Fähigkeit bzw. Befähigung (vgl. Pfadenhauer 2010, S.150f.). Letztere drückt im engeren Sinn die ÄBefähigung zur Bewältigung unterschiedlicher Anforderungssi- tuationen“ (Pfadenhauer 2010, S.150; Herv.i.O.) aus. Weiter gefasst inkludiert der Begriff alles Wissen, alle Fähigkeiten und Denkmethoden, die der Mensch sich im Laufe seines Lebens aneignet und anwendet (vgl. Pfadenhauer 2010, S.150f.). Da der Fähigkeitsaspekt die soziale Dimension in den Fokus stellt, wird sich die weitere Ausführung auf jenen stützen.
Abgesehen von den unzähligen Definitionsversuchen lassen sich trotz scheinbar vorhandener Heterogenität viele Gemeinsamkeiten feststellen. Diese stimmen über- ein, dass Kompetenzen handlungsorientiert sind und darauf zielen künftige Hand- lungsmöglichkeiten zu erfassen und zu verbessern. Zudem stellen Kompetenzen jene Handlungsfähigkeiten dar, die das Individuum dazu befähigen, Probleme selbstorganisiert und kreativ zu bewältigen. Weiter sind sie ÄSelbstorganisationsdis- positionen geistigen und physischen Handelns, wenn man unter Dispositionen die Gesamtheit der bis zu einem bestimmten Handlungszeitpunkt entwickelten inneren Voraussetzungen zur psychischen Regulation der Tätigkeit versteht“ (Erpenbeck 2013, S.12). Demnach handelt es sich bei Kompetenzen nicht um Fähigkeiten, son- dern die Befähigung in für das Individuum bisher neuen, unsicheren Situationen, de- ren Ende offen und Handlungsbedingungen diffizil erscheinen, kreativ handeln zu können. Dies schließt folglich auch den Umstand ein, dass nicht jede problematische Situation kompetent bewältigt werden kann. Darüber hinaus beschränken sich die
Basiskompetenzen grundsätzlich auf personale, aktivitätsbezogene, fachliche, me- thodische und sozial-kommunikative Kompetenzen, wobei lediglich ihre Zuordnung variiert. Zentrum dieser Kompetenzen bilden die Äin Form eigener Emotionen und Motivationen handlungswirksam gewordene[n] Regeln, Werte1 und Normen“ (Erpen- beck 2013, S.13), die das selbstorganisierte Handeln des Individuums steuern (vgl. ebd., S.12f.). Breite Zustimmung findet u.a. der Umstand, dass Kompetenzen in der Regel mit diversen Methoden, etwa Äquantitativ (Tests), qualitativ (Kompetenzpässe, Kompetenzbiografien2 ), simulativ (z.B. im Flugsimulator) und situativ (Arbeitsproben)“ (Eprenbeck/ Heyße 2009, S.6) und unterschiedlicher Genauigkeit ermittelt werden können (vgl. Erpenbeck 2013, S.13). Um den Kompetenzbereich klar abzugrenzen, besteht obendrein Einklang darüber, dass diese nicht mit Fertigkeiten, Wissen und Qualifikation gleichzusetzen sind, da jene den unabdingbaren Ausganspunkt bilden, welcher den Kompetenzerwerb gewährleistet (vgl. ebd., S.13). Auch die Kompetenz- entwicklung betreffend stimmen die unterschiedlichen Definitionen überein, dass Kompetenzen generell nicht durch bloßes Wissen angeeignet werden können, son- dern die Wissensaneignung und das Aneignen von Werten, welche sich nur durch emotionale Labilisierung, d.h. über Widersprüche, Probleme und kognitive Dissonan- zen zu eigenen Emotionen und Motivationen verinnerlichen lassen, voraussetzt (vgl. Erpenbeck 2013, S.14; Erpenbeck 2008, S.29). Um die vorher ausgeführten unstritti- gen Kennzeichen der unterschiedlichen Kompetenzdefinitionen subsumierend auf den Punkt zu bringen, scheinen die zwei nachfolgenden Definitionen von Erpenbeck und Heyse an diesem Punkt am geeignetsten.
ÄKompetenzen schließen Fertigkeiten, Wissen und Qualifikationen ein, lassen sich aber nicht darauf reduzieren. Bei Kompetenzen kommt einfach etwas hinzu, das [sic!] die Handlungsfähigkeit in offenen, unsicheren, komplexen Situationen erst ermöglicht, beispiels- weise selbstverantwortete Regeln, Werte und Normen als »Ordner« des selbstorganisierten Handelns (Erpenbeck/ von Rosenstiehl 2007, S. XII)“. Generell werden sie Ävon Wissen fundiert, durch Werte konstituiert, als Fähigkeiten disponiert, durch Erfahrungen konsolidiert, auf Grund von Willen realisiert“ (Erpenbeck/ Heyse 2007, S.163; Herv.i.O.).
Eine klare Gegenposition ist bei Klieme et al. (2007b) erkennbar, welche Kompeten- zen im Rahmen einer Expertise zur technologiebasierten Kompetenzdiagnostik als „kontextspezifische kognitive Leistungsdisposition, die sich funktional auf Situation und Anforderungen in bestimmten Domänen beziehen“ (Klieme et al. 2007b, S.7; Herv.i.O.) definieren. Kognitive Merkmale verstehen sich in diesem Zusammenhang als fachbezogenes Gedächtnis, umfangreiches Wissen und automatisierte Fähigkei- ten (vgl. Klieme et al. 2007a, S.72). Leistungsdispositionen können ebenso als Kenntnisse, Fertigkeiten oder Routinen gekennzeichnet werden (vgl. Klieme et al. 2007b, S.6). Diese, auch den internationalen Schulleistungsstudien PSA, TIMSS, PIRL zugrunde liegende Definition, enthält zwei Einschränkungen von zentraler Be- deutung (vgl. Klieme et al. 2007b, S.7). Neben der Kontextspezifität, d.h. die Be- schränkung bestimmter Kompetenzen auf einen spezifischen Anforderungsbereich und somit auf einen bestimmten Kontext, wird die Bedeutung des Kompetenzbegriffs auf den kognitiven Bereich eingeschränkt und demnach motivational-affektive, wel- che ebenso eine Voraussetzung für erfolgreiches Handeln darstellen, ausdrücklich ausgeschlossen. (vgl. Klieme et al. 2007b, S.6f.; Stark 2009, S.7). Ein Kompetenz- begriff, der jedoch fundamentale, für die Kompetenzaneignung notwendige Prozes- se, d.h. emotional-motivationale Verinnerlichungsprozesse, ausschließt und Kompe- tenzen von spezifischen Kontexten abhängig macht, kann nicht als generalisierend gelten. Denn den Kern jeder Kompetenz bilden Wissen und Werte. Werte, die sich nur durch den Prozess der emotional-motivationalen Labilisierung verinnerlichen las- sen und folglich die Voraussetzung für das Erwerben von Kompetenzen darstellen. Zudem werden Kompetenzen nicht als kontextspezifisch, sondern als weiträumig betrachtet und sind demnach keine Äbeliebige[n] Handlungsfähigkeiten in allen nur denkbaren Lern- und Handlungsgebieten (Domänen) [...], sondern solche Fähigkeiten oder Dispositionen, die ein sinnvolles und fruchtbares Handeln in offenen, komplexen, manchmal auch chaotischen Situationen erlauben, die also ein selbstorganisiertes Handeln unter gedanklicher und gegenständlicher Unsicherheit ermöglichen“ (Erpenbeck/ Rosenstiel 2007, S.XI).
In dieser immer komplexer werdenden und Orientierungslosigkeit generierenden Welt bildet der Erwerb, das Erweitern und auch das Kombinieren unterschiedlicher Kompetenzen, welche Erfahrungen, Wissen, Fähigkeiten und Werte inkludieren, das Fundament für das Zurechtkommen in der neuen Welt und den Erfolg jedes menschlichen Handelns. Selbstorganisiert handeln zu können, d.h. seine komplexen, teilweise auch verborgenen Potenziale richtig zu nutzen stellt eine Notwendigkeit dar, die das gegenwärtige und zukünftige Leben steuert.
2.3 Kommunikative Kompetenz
Betrachtet man das Kompetenzkonstrukt so steht man einer Fülle von Kompetenzen gegenüber, die sich vier übergeordneten Bereichen - Metakompetenzen, Basiskom- petenzen, abgeleitete und übergreifende Kompetenzen - zuordnen lassen. Für die folgende Ausführung wird der Bereich der Basis- bzw. Grundkompetenzen näher in Betracht gezogen, da jener sich in diesem Zusammenhang als aufschlussreich er- weist. Basis- oder Grundkompetenzen, die anderweitig oftmals auch als Schlüssel- kompetenzen bezeichnet werden, untergliedern sich in personale, aktivitätsbezoge- ne, fachlich-methodische und sozial-kommunikative Kompetenzen. Diese stellen wohlgemerkt keine persönlichen Eigenschaften dar, sondern inkludieren je nach Ge- genstandsbereich verschiedene Fähigkeiten, welche sich im Allgemeinen auf das gegenständliche und kommunikative Handeln beziehen (vgl. Erpenbeck 2013, S.19f.). So umfassen sozial- kommunikative Kompetenzen die Fähigkeiten«
ÄKommunikations- und Kooperationsprozesse auf interpersonaler oder/ und interorganisationaler Ebene selbstorganisiert so zu optimieren, zu effektivieren und Konfliktpotenziale zu minimieren, dass sie zu höchstmöglicher Kreativität des individuellen und korporativen Handelns und zum Beschreiten neuer ÄPfade“ führen“ (Erpenbeck 2013, S.20).
Dieser Kompetenzbereich stellt sich als besonders wichtig für das zwischenmensch- liche Miteinander dar und umfasst folglich, die Fähigkeiten sich mit anderen Men- schen aus eigenem Antrieb auseinanderzusetzen, zu kooperieren und zu kommuni- zieren. Grundlage jedes effektiven kommunikativen Aktes bildet auf der einen Seite die Fähigkeit sich der Situation, den geltenden Normen und Werten und seinem Ge- genüber angepasst auszudrücken, was bedeutet bspw. unterschwellige Arroganz oder Unsicherheit zu vermeiden. Auf der anderen Seite ist es von enormer Wichtig- keit nicht nur verbale Signale seines Gesprächspartners, sondern auch Mimik, Gestik und Körperhaltung zu analysieren, um dessen Befinden und Anliegen ganzheitlich zu erschließen. Generell stellen kommunikative Kompetenzen für das alltägliche Leben die Voraussetzung dar, soziale Kontakte knüpfen zu können und ggf. partnerschaftli- che oder freundschaftliche Beziehungen aufzubauen und ebenso zu pflegen und an- derseits auch schwierige Situationen zu bewältigen und durch effiziente Verständi- gung Konflikte zu erkennen und zu lösen. Außerdem stellen sie die Grundlage, jegli- chen beruflichen Anforderungen gerecht zu werden, dar und mit anderen Menschen erfolgreich zu interagieren. Folglich sind sie der ausschlaggebende Punkt, welcher über Erfolg oder Misserfolg entscheidet - sowohl privat als auch beruflich (vgl. Röh- ner/ Schütz 2012, S.6).
Kommunikation stellt in allen Bereichen des Lebens die Grundlage jeder zwischen- menschlichen Interaktion dar. Ob jedoch ein beruflicher Aufstieg gelingt, eine Bezie- hung zustande kommt bzw. auch welche Qualität diese aufweist und Interaktionen erfolgreich sind, hängt von der sozial-kommunikativen Kompetenz des Individuums ab.
3. CARL ROGERS‘ PERSONENZENTRIERTER ANSATZ
Die folgende historische Entwicklung des personenzentrierten Ansatzes soll auch im Hinblick auf die Forschungsfrage, die auf die Rolle der kommunikativen Grundkom- petenzen in der pädagogischen Beratung zielt, die Entwicklung von einer reinen The- rapie- und Beratungsform im psychotherapeutischen Bereich hin zu einer personen- zentrierten Haltung, die in pädagogischen und gesellschaftlichen Bereichen Eingang findet, verdeutlichen. Des Weiteren wird das Menschenbild der humanistischen Psy- chologie, zu dessen Mitbegründern und Vertretern Rogers zählt und dessen Kernthesen größtenteils auf Rogers‘ Erfahrungen basieren, erläutert. Der Schwer- punkt dieses Kapitels liegt insbesondere auf den Grundkompetenzen Empathie, Ak- zeptanz und Kongruenz und der damit einhergehenden zwischenmenschlichen Be- ziehung zwischen Therapeut und Klient, da jene den zentralen Bestandteil der For- schungsfrage bilden und sowohl für ein besseres Verständnis als auch für die Be- antwortung derer unerlässlich sind.
3.1 Historische Entwicklung
ÄWirksame Beratung besteht aus einer eindeutigen strukturierten, gewährenden Beziehung, die es dem Klienten ermöglicht, zu einem Verständnis seiner selbst in einem Ausmaß zu gelangen, das ihn befähigt, aufgrund dieser neuen Orientierung positive Schritte zu unternehmen“ (Rogers 2014, S.28).
Mit dieser von Rogers aufgestellten Eingangsthese legte er im Jahr 1940 den Grund- stein für sein Theoriekonzept, welches sich zunächst in der Beratung und Psychothe- rapie etabliert (vgl. Rogers 1987b, S.18; Trein 2010, S.29; Weinberger 1990, S.27). Diese grundlegende These vermittelte in der ersten Entwicklungsphase des Ansat- zes, der zunächst als Beratungs- und Therapiemethode unter der Bezeichnung Änicht-direktiv“ Eingang fand, dass die Beziehung zwischen Klient und Therapeut und nicht primär die Behandlung von Symptomen ein unabdingbares Element der Bera- tungssituation ist (vgl. Rogers 1987b, S.18). Davon ausgehend postulierte er, dass die Realisierung der drei Grundhaltungen des Therapeuten - Empathie, Akzeptanz und Kongruenz - ausreichend aber auch fundamental sind, um ein förderliches Klima herzustellen, dass dem Klienten die Möglichkeit zur Selbstregulation, freien Entfal- tung und zum Wachstum eröffnet (vgl. Rogers 1987b, S.18; Trein 2010, S.27). Hier- bei ist zu beachten, dass sich der Therapeut nicht-direktiv verhält, was bedeutet den Entfaltungs- und Veränderungsprozess des Klienten nicht zu stören, indem er Be- wertungen über das Verhalten und Erleben des Klienten oder Interpretationen seiner nicht geäußerten Gefühle vermeidet und hinsichtlich seiner Lebensgestaltung keiner- lei Handlungsanweisungen oder Lösungsvorschläge gibt (vgl. Höger 2012a, S.23; Pallasch 2011, S.29).
ÄDie nicht-direktive Beratung basiert auf der Voraussetzung, daß der Klient das Recht hat, seine Lebensziele selbst zu wählen, selbst wenn diese im Gegensatz zu den Zielen stehen, die der Berater für ihn ausgewählt hätte. [...] Der nicht-direktive Standpunkt legt großen Wert auf das Recht jedes Individuums, psychisch unabhängig zu bleiben und seine psychische Integrität zu erhalten. Der direktive Standpunkt legt großen Wert auf soziale Übereinstimmung und das Recht des Fähigeren, den Unfähigeren zu lenken“ (Rogers 2014, S.119).
Diese Charakteristika spiegeln sich auch in der Tatsache, dass Rogers die Therapie oder Beratung aufsuchenden Menschen nicht als ÄPatienten“, sondern als ÄKlienten“ bezeichnet, wider, was seine Theorie weg von einem manipulativen psychologisch- klinischen Bereich in einen pädagogischen rückt. Er wollte damit betonen, dass der Mensch als eigenständiges, selbstverantwortliches Wesen, welches in einem vom Therapeuten hergestellten förderlichen Klima die Fähigkeit besitzt, selbstständig Ent- scheidungen zu treffen und eigene Erfahrungen zu sammeln, im Mittelpunkt steht und nicht als Behandlungsobjekt betrachtet wird (vgl. Rogers 1987b, S.18; Trein 2010, S.29). Eine weitere Entwicklung erfuhr der Ansatz als die Selbstexploration3 des Klienten in den Mittelpunkt gerückt und demgemäß die Bezeichnung Änicht- direktiv“ durch den Terminus Äklientenzentriert“ ersetzt wurde (vgl. Keil/ Stumm 2002, S.4, S.6). Die Änderung des Titels galt zudem einerseits der Tatsache, dass die ur- sprüngliche Bedeutung Änicht-direktiv“ das Missverständnis hervorrief, der Therapeut müsse eine passive bzw. laissez-faire Einstellung besitzen, das bedeutet nicht aktiv bzw. nur minimal am Beratungsgeschehen teilnehmen und dem Klienten primär zu- hören (vgl. Trein 2010, S.29; Weinberger 1990, S.28). Andererseits war auch der Umstand, dass der Therapeut eine Beeinflussung seinerseits nie vollkommen aus- schließen kann, für Rogers ausschlaggebend seinen Ansatz umzubenennen (vgl. Keil/ Stumm 2002, S.3f.). In dieser Phase entwickelt sich das zu Beginn der Therapie als Technik wirkende Widerspiegeln von Gefühlen zu einem tiefen, einfühlsamen
[...]
1 ÄWerte sind alle sprachlich gefassten oder sprachlich fassbaren Wertresultate die explizit Empfin- dungen, Gefühle, Wünsche, Vermutungen, Zweifel, Befürchtungen, Hoffnungen, Bedürfnisse, Interessen, Einstellungen, Meinungen, Haltungen, Ansichten, Überzeugungen, Vorurteile, Ablehnungen usw. enthalten“ (Erpenbeck 2009, S.22). Sie Äermöglichen ein Handeln unter der daraus resultierenden prinzipiellen kognitiven Unsicherheit. Sie “überbrücken“ oder ersetzen fehlende Kenntnisse, schließen die Lücke zwischen Kenntnissen einerseits und dem Handeln andererseits. Sie haben zuweilen den Charakter extrapolativen Scheinwissens, abergläubischen Gewissheit. Das reicht bis zum Glauben als bewertetem Nichtwissen“ (Erpenbeck 2009, S. 24).
3 Indem der Therapeut die drei Basisvariablen Empathie, Akzeptanz und Kongruenz im Therapiever- lauf realisiert, wird der Klient dazu befähigt sich seiner emotionalen Erlebnisse, Einstellungen, Ziele und Wünsche bewusst zu werden und diese zu verbalisieren (vgl. Weinberger 1990, S.56/76).
- Arbeit zitieren
- Kathrin Nährig (Autor:in), 2015, Kommunikative Grundkompetenzen pädagogischen Handelns. Das zentrale Moment in der pädagogischen Praxis?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/315847
Kostenlos Autor werden



















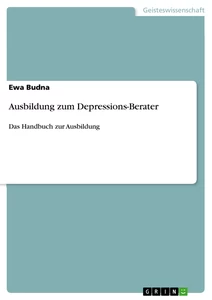


Kommentare