Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1. Einleitung
1.1 Hinführung zum Thema und Zielsetzung der Arbeit
1.2 Aufbau der Arbeit
2. Typologien Organisational Lernens
2.1 Typen organisationalen Lernens nach Shrivastava (1983)
2.2 Typen organisationalen Lernens nach Fiol und Lyles (1985)
2.3 Typen organisationalen Lernens nach Huber (1991) und Dixon (1992)
2.4 Typen organisationalen Lernens nach Klimecki und Thomae (1997)
2.5 Typen organisationalen Lernens nach Edmonson und Moingeon (1998)
2.6 Typen organisationalen Lernens nach Pawlowsky (2000)
2.7 Selektion relevanter Forschungsperspektiven
3. Diskussion der Begriffe Organisation, Lernen und Wissen
3.1 Gegenstandsbestimmung: Was ist eine „Organisation“?
3.1.1 Definitionen von „Organisation”
3.2 Gegenstandsbestimmung: Was bedeutet „Lernen“?
3.2.1 Die behavioristische Lerntheorie und das Stimulus-Response-Modell
3.2.1.1 Klassisches und operantes Konditionieren
3.2.2 Das kognitive Lernmodell
3.2.3 Lernen am Modell
3.3 Gegenstandsbestimmung: Was ist „Wissen“?
3.3.1 Der positivistische Wissensbegriff
3.3.2 Das sozialkonstruktivistische Wissensverständnis
3.3.3 Zum Verhältnis von Daten, Information und Wissen
3.3.4 Formen des Wissens
4. Perspektiven und Ansätze organisationalen Lernens
4.1 Die adaptive Perspektive nach Cyert/March (1963) und March/Olsen (1975)
4.1.1 Rahmenbedingungen organisationaler Entscheidungsfindung
4.1.2 Auslöser organisationalen Lernens
4.1.3 Organisationale Ziele
4.1.4 Organisation als begrenzt rationales System
4.1.5 Der Cycle of Choice nach March und Olsen (1975)
4.1.5.1 Die Unterbrechung des Lernzirkels
4.1.6 Kritische Würdigung und Zusammenfassung
4.2 Die interpretationsorientierte Perspektive nach Argyris und Schön (1978)
4.2.1 Die „espoused theory” der Organisation
4.2.2 Die organisationale „theory-in-use”
4.2.3 Organisationales „single-loop-learning”
4.2.4 Organisationales „double-loop- learning”
4.2.5 Organisationales „deutero-learning”
4.2.6 Defensive Routinen als Lernhindernisse
4.2.7 Zusammenfassung und kritische Würdigung
4.3 Die wissensorientierte Perspektive nach Duncan und Weiss (1979)
4.3.1 Das Organisationsverständnis
4.3.2 Das organisationale Lernverständnis und der Wissensbegriff
4.3.3 Auslöser organisationalen Lernens
4.3.4 Organisationale Lernprozesse
4.3.5 Ergebnisse organisationalen Lernens
4.3.6 Agenten des Lernens
4.3.7 Lernhindernisse
4.3.8. Rahmenbedingungen organisationalen Lernens
4.3.9 Zusammenfassung und kritische Würdigung
4.4 Die Informationsperspektive nach Daft/Huber (1987) und Huber (1991)
4.4.1 Das organisationale Lernverständnis
4.4.2 Prozesse organisationalen Lernens
4.4.3 Auslöser organisationalen Lernens
4.4.4 Ergebnisse organisationalen Lernens
4.4.5 Rahmenbedingungen organisationalen Lernens
4.4.6 Kritische Würdigung
4.5 Synopse und Zusammenfassung ausgewählter Ansätze organisationalen Lernens
4.6 Kollektives Lernen in Organisationen nach Wilkesmann (1999)
4.6.1 Einfaches kollektives Lernen und Problemlösungslernen
4.6.2 Problemlösungslernen als kommunikativer Akt
4.6.3 Routine- und Innovationsspiele
4.6.4 Zusammenfassung und kritische Würdigung
4.7 Exkurs: Der „community“- Ansatz
4.8 Die „Lernende Organisation“
4.9 Kognitive Organisationsstrukturen
4.9.1 „Cognitive maps“
4.9.2 Die organisationale Wissensbasis
4.9.2.1 Die organisationale Wissensbasis nach Pautzke (1989)
4.9.3 Organisationskultur
4.9.3.1 Organisationskultur nach Schein (1984)
5. Wissensmanagement
5.1 Der Ansatz von Nonaka und Takeuchi (1997)
5.1.1 Explizites und implizites Wissen
5.1.2 Die Transformation impliziten Wissens
5.1.3 Agenten des Lernens
5.1.4 Rahmenbedingung des Wissensmanagement
5.1.5 Kritische Würdigung
5.2 Bausteine des Wissensmanagement nach Probst et al. (1998)
5.2.1 Zum Verhältnis von organisationalem Lernen und Wissen
5.2.2 Prozesse des Wissensmanagement
5.2.3 Agenten des Lernens
5.2.4 Lernauslöser
5.2.5 Kritische Würdigung
5.3 Systemisches Wissensmanagement nach Willke (2001)
5.3.1 Organisationen als geschlossene Systeme
5.3.2 Agenten im Prozess des Wissensmanagement
5.3.3 Die Kognitiven Rahmenbedingungen systemischen Wissensmanagement
5.3.4 Strukturelle Voraussetzungen des Wissensmanagement
5.3.5 Wissensbegriff
5.3.6 Kollektives Wissen
5.3.7 Ziel des Wissensmanagement
5.3.8 Wissensmanagement als Geschäftsprozess
5.3.9 Kritische Würdigung und Zusammenfassung
5.4 Das Münchener Modell nach Reinmann-Rothmeier (2001)
5.4.1 Wissensmanagement und Wissen
5.4.2 Prozesse des Wissensmanagement
5.4.3 Agenten des Lernens
5.4.4 Kritische Würdigung
5.5 Zusammenfassung und kritische Würdigung der Ansätze des Wissensmanagement
6. Zum Verhältnis von organisationalem Lernen und Wissensmanagement
6.1 Schlussbetrachtung und Ausblick
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Die Matrix des organisationalen Lernens
Abbildung 2: Synopse der Typisierungen organisationalen Lernens
Abbildung 3: Hierarchie von Daten, Information und Wissen
Abbildung 4: The „complete cycle of choice“ und seine Unterbrechungen
Abbildung 5: Konstruktion der organisationalen “theory-In-use”
Abbildung 6: Single-loop-learning
Abbildung 7: Double-loop-learning
Abbildung 8: Wachstum und Veränderung der organisationalen Wissensbasis
Abbildung 9: Synopse ausgewählter Ansätze organisationalen Lernens
Abbildung 10: Kollektives Innovationslernen nach Wilkesmann
Abbildung 11: Das Schichtenmodell der organisatorischen Wissensbasis
Abbildung 12: Drei Ebenen der Organisationskultur
Abbildung 13: Die Wissensspirale auf epistemologischer Ebene
Abbildung 14: Spirale der Wissensschaffung im Unternehmen
Abbildung 15: Bausteine des Wissensmanagement
Abbildung 16: Wissensmanagement als Geschäftsprozess
Abbildung 17: Informationswissen vs. Handlungswissen
Abbildung 18: Prozesse des Wissensmanagement
Abbildung 19: Der individuelle Lernzyklus nach Senge et al.,1997
Abbildung 20: Der organisationale Lernzyklus nach Senge et al., 1997
Abbildung 21: Die Verbindung des organisationalen und des individuellen Lernzyklus nach Senge et. al., 1997
Abbildung 22: Synopse der Ansätze des Wissensmanagement
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1. Einleitung
1.1 Hinführung zum Thema und Zielsetzung der Arbeit
In immer mehr Berufen besteht die Hauptaufgabe darin, Wissen zu generieren. Organisationen werden durch eine globale Ökonomie in einen Wettbewerb gezwungen, der es notwendig macht, sich durch die effiziente Nutzung von Wissen einen Wettbewerbsvorteil zu sichern. Von daher ist Wissen als vierter Produktionsfaktor neben Boden, Kapital und Arbeit zu betrachten. Denn der Anteil des Produktionsfaktors Wissen an der Wertschöpfung steigt kontinuierlich[1] und überlagert zunehmend die klassischen Produktionsfaktoren[2]. Doch nicht nur Wirtschaftsunternehmen haben Wissen als Wettbewerbsfaktor erkannt. Zunehmend setzen auch andere Organisationstypen, wie öffentliche Verwaltungen, Hilfsorganisationen, Krankenhäuser und Kirchen, auf wissensbasierte Organisationsführung. Vor diesem Hintergrund setzen sich sowohl Theoretiker als auch Praktiker (Manager, Organisationsberater, etc.) mit dem Phänomen Wissen im organisationalen Kontext auseinander.
Wissensmanagement hat sich in der letzten Dekade zu einem der Top-Themen in Forschung und Praxis entwickelt. Die Anzahl der Veröffentlichungen zum Thema stieg seit der Erstveröffentlichung von „The Knowledge Creating Company“ (Nonaka/Takeuchi) im Jahre 1995[3] sprunghaft an. Thematisch setzt sich ein großer Teil dieser Ansätze mit der Frage auseinander, wie Wissen innerhalb von Organisationen generiert, verarbeitet und weitergegeben werden kann, um der Organisation als Ganzer einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.
Geflügelte Worte wie „Wissensgesellschaft“ (Willke, 2001), „Informationszeitalter“ (Klimecki, 1999) und „Globalisierung“ (Nonaka/Takeuchi, 1998) postulieren die unausweichliche Notwendigkeit einer organisationalen Steuerung von Wissen. Der Gedanke, mit organisationalem Wissen über eine Ressource zu verfügen, die durch Nutzung nicht verbraucht, sondern im Gegenteil optimiert wird (vgl. Pawlowsky, 1999), untermauert die Notwendigkeit eines Wissensmanagement auf organisationaler Ebene.
Zudem kann Wissen gleichzeitig an mehreren Orten eingesetzt werden, was nicht nur in den Unternehmungen den Wunsch nach einer Kontrolle organisational Wissens forciert. Dies beschert der Fachliteratur zum Thema Wissensmanagement einen erheblichen Auftrieb. Im Gegenzug sorgt die Fülle von Publikationen gleichzeitig für eine sehr intensive Wahrnehmung der Thematik.
Einige, zumeist praxisorientierte Beiträge zum Thema propagieren Wissensmanagement als grundlegendste Bedingung des organisationalen Überlebens. So umschreiben Probst et al. (1998) zu Beginn ihres viel zitierten Werks „Wissen Managen“ die Notwendigkeit eines organisationalen Wissensmanagements wie folgt:
Wissensmanagement ist eine Herausforderung für alle Unternehmen, welche in der Wissensgesellschaft überleben wollen. Während das Management klassischer Produktionsfaktoren ausgereizt zu sein scheint, hat das Management des Wissens seine Zukunft noch vor sich (Probst et al., 1998, S. 17).
Neu ist das Paradigma des organisationalen Umgangs mit Wissen jedoch keineswegs, sondern der theoretische Diskurs um das Wissen als organisational Ressource ist wesentlich älter.
Die Anfänge des so genannten „organisationalen Lernens“ liegen bereits in den 1960er Jahren[4]. In den 1980er Jahren folgte eine Phase der Expansion hinsichtlich der theoretisch-konzeptionellen Entwicklung (vgl. Antal/Dierkes, 2004). Mit der zunehmenden Popularität ging auch eine Diversifizierung des Themenfeldes einher. Organisational Lernen galt nicht nur in der sozialwissenschaftlichen Organsationsforschung als dominierendes Paradigma, sondern war Forschungsgegenstand unterschiedlicher Disziplinen. So stammen Konzepte zum Thema aus den Wirtschaftswissenschaften, den Politikwissenschaften, der Psychologie, der Soziologie und anderen Forschungsrichtungen. Verstärkt hat sich dieser Trend zur Diversifizierung durch eine zusätzliche Spaltung zwischen Theorie und Praxis[5], die sich in einer Dichotomie zwischen präskriptiven, aus der Praxis stammenden Ansätzen und theoretisch-konzeptionellen Arbeiten auf Seiten der Forschung äußert. Angesichts der Tatsache, dass mit dem „organisationalen Lernen“ bereits ein Konzept mit vergleichbaren Intentionen und Ansprüchen die Forschungs- und Praxislandschaft beherrschte, stellt sich die Frage, worin sich das Konzept des Wissensmanagement von dem des organisationalen Lernens unterscheidet. Häufig anzutreffende Aussagen, dass Wissensmanagement pragmatischer und anwendungsfreundlicher sei (vgl. Fried/Baitsch, 2002) oder es sich beim organisationalen Lernen lediglich um einen Teil des Wissensmanagement handele (vgl. Wilkesmann, 2005) besitzen nur wenig Aussagekraft, da sie sich lediglich auf den Anwendungsbezug beider Konzepte beschränken und auf ein theoriegeleitetes Vorgehen verzichten. Um das Verhältnis beider Forschungsfelder zueinander bestimmen zu können, bietet sich neben der Gegenüberstellung der praktischen Gestaltung vor allem ein Vergleich der jeweiligen theoretischen Basis beider Konzepte an. Letzteres ist die Zielsetzung der vorliegenden Arbeit. Die zu untersuchende Hypothese besagt, dass „Wissensmanagement“ auf den theoretischen Grundlagen des „organisationalen Lernens“ basiert. Das Erkenntnisinteresse liegt deshalb in der Analyse und dem Vergleich der theoretischkonzeptionellen Grundlagen populärer Modelle des „organisationalen Lernens“ und des „Wissensmanagement“. Dabei sollen vor allem Lernverständnisse, -auslöser und -prozesse aus Modellen beider Forschungsfelder zum Vergleich herangezogen werden. Das Ziel der vergleichenden Literaturanalyse ist es nicht nur zu bestimmen, ob „Wissensmanagement“ ein wissenschaftliches Novum darstellt, oder ob es theoretischkonzeptionell auf dem „organisationalen Lernen“ beruht. Der erweiterte Forschungsgegenstand dieser Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, ob Wissensmanagement als Fortführung einer bestimmten Perspektive organisationalen Lernens betrachtet werden kann.
1.2 Aufbau der Arbeit
Da sowohl „organisationales Lernen“ als auch das „Wissensmanagement“ äußerst heterogene Forschungsfelder beschreiben, ist neben einer Differenzierung und Definition der wichtigsten Begrifflichkeiten (Lernen, Wissen, Organisation), die in Kapitel drei durchgeführt wird, auch eine Selektion der zu untersuchenden Forschungsansätze unumgänglich. Mit der Auswahl geeigneter Beiträge organisationalen Lernens setzt sich Kapitel zwei auseinander. Weitgehend theoretische Schriften sollen hierbei im Mittelpunkt der Untersuchung stehen, wohingegen praktische Handlungsanleitungen und „Rezeptbücher“ keine Beachtung finden. Auf die Untersuchung Technik-zentrierter Beiträge, die häufig aus dem Umfeld der Informatik und den Informationswissenschaften kommen und sich unter dem Oberbegriff Wissensmanagement mit der Distribution und Verwaltung von Daten beschäftigen, geht diese Arbeit ebenfalls nicht näher ein. Um ein Verständnis sowohl für das Lernen von Organisationen als auch das Lernen in Organisationen herausarbeiten zu können, sollen die theoretischen Grundlagen prominenter Ansätze beider Richtungen erörtert werden. Die Untersuchung des Forschungsfeldes „organisationales Lernen“, welcher sich Kapitel vier widmet, basiert hauptsächlich auf Beiträgen von Cyert/March (1963), March/Olsen (1975), Argyris/Schön (1978), Duncan/Weiss (1979) und Huber (1991) und wird zusätzlich durch die Analyse des Ansatzes von Wilkesmann (1999) ergänzt. Des Weiteren beschäftigt sich Abschnitt 4.9 mit verschiedenen kognitiven Organisationsstrukturen, die in dieser Arbeit als Bindeglied zwischen organisationalem Lernen und Wissensmanagement verstanden werden. Die Analyse des Forschungsfeldes Wissensmanagement sowie die Gegenüberstellung der Ansätze organisationalen Lernens und des Wissensmanagement finden im fünften Kapitel statt, in dem neben den beiden wohl prominentesten und am häufigsten zitierten Wissensmanagementansätzen der „Wissensspirale“ von Nonaka/Takeuchi (1997) und dem „Bausteinmodell“ von Probst/Raub/Romhardt (1998) mit den Beiträgen von Helmut Willke (2001) und Gabi Reimann-Rothmeier (2001) auch zwei deutsche Beiträge zum Vergleich herangezogen werden sollen.
2. Typologien organisationalen Lernens
Organisationales Lernen zog vonjeher sowohl die Aufmerksamkeit von Theoretikern als auch von Praktikern auf sich (vgl. Büchel/Probst 2000, S. 3), was zu einer Spaltung zwischen Theorie und Praxis führte (vgl. Antal/ Dierkes, 2002, S. 7). Trotz der hohen Popularität wurde bis Dato keine allgemein gültige Theorie organisationalen Lernens entwickelt (vgl. Prange, 1999, S. 31). Der fehlende theoretische Bezugsrahmen und zu viele unterschiedliche Definitionen und Verständnisse organisationalen Lernens (vgl. Fiol/Lyles, 1985, S. 808) führen weiterhin zu einer sehr heterogenen Ausprägung des Feldes.
Major research [...] along with more modest efforts provide the basis for initial attempts to define, develop, and to differentiate organizational learning and its components. Each has approached the subject from different perspectives, leading to more divergence (Fiol/Lyles, 1985, S. 803).
Dieses von Fiol und Lyles (1985) genannte immer größer werdende inhaltliche Auseinanderdriften unterschiedliche Ansätze organisationalen Lernens ist einerseits auf die akademische Vielfältigkeit der beteiligten Forschungsrichtungen zurückzuführen. Andererseits sorgt die Tatsache, dass selbst intradisziplinär eine Vielzahl unterschiedlicher Perspektiven organisationalen Lernens existieren, dafür, dass der Begriff organisationales Lernen mehr „verschleiert [...] als er erklärt“ (Wittwer, 1995, S. 74). Jede weitere Publikation zum Thema erhöht die Komplexität des Forschungsfeldes, wodurch der Bedarf nach systematischen und perspektivischen Differenzierungen immer weiter steigt.
2,1 Typen organisationalen Lernens nach Shrivastava (1983)
Einer der frühen Versuche, unterschiedliche Ansätze organisationalen Lernens konzeptionell zu erfassen, stammt von dem Betriebswissenschaftler[6] Paul Shrivastava (1983). Generell differenziert Shrivastava die Literatur zum organisationalen Lernen in eine kulturelle, eine anpassungs- und eine wissensorientierte Schule. Mit Bezug auf die frühen Ansätze von Cyert und March (1963), Cangelosi und Dill (1965) sowie March und Olsen (1976) spricht er von organisationalem Lernen als Adaption (vgl. Shrivastava, 1983, S. 10f). Die zweite Kategorie Shrivastavas fasst organisationales Lernen als „assumption sharing“. Mit „assumption sharing“ umschreibt Shrivastava gemeinsame organisationale Interpretationsschemata, welche Annahmen (assumptions) bereitstellen, mit deren Hilfe die Organisationsmitglieder ihr Gebrauchs- und Handlungswissen zu gemeinsamen Alltagstheorien formen können.
Dieser Kategorie sind laut Shrivastava neben den Beiträgen von Mitroff und Emshoff (1979) und Mason und Mitroff (1981) vor allem die Arbeiten von Argyris und Schön (1978) zuzuordnen (vgl. Shrivastava, 1983, S. 11f). In der dritten Ausprägung begreift Shrivastava organisationales Lernen als Entwicklung einer organisationalen Wissensbasis und bezieht sich hierbei auf die Beiträge mit Beteiligung Robert Duncans (Duncan/Weiss 1979; Dutton/Duncan 1981).
Der chronologisch zweite Versuch, Literatur organisationalen Lernens zu typologisieren, geht auf Marlene Fiol und Marjorie A. Lyles (1985)[7] zurück. Fiol und Lyles untersuchen, was genau unter dem Terminus organisationales Lernen zu verstehen ist. Dabei unterscheiden sie zunächst zwischen individuellem und organisationalem Lernen (vgl. Fiol/Lyles, 1985, S. 804). Obwohl individuelles Lernen als notwendig zu betrachten ist, erfasst es nach Fiol und Lyles' Verständnis nicht den Kern organisationalen Lernens. Organisationales Lernen ist demnach mehr als die Summe individuellen Lernens und zeigt sich im organisationalen Verständnis und der organisationalen Interpretation der Umwelt (vgl. Fiol/Lyles, 1985, S. 804). Ergebnisse organisationalen Lernens sind demzufolge über-individuelle, kognitive Systeme, die sich Mitglieder einer Organisation teilen.
Eine weitere essenzielle Unterscheidung treffen Fiol und Lyles zwischen Literatur welche die Entwicklung von Verhalten (behavior development) und solcher welche die Entwicklung von Erkenntnis (cognition development) innerhalb von Organisationen thematisiert. Während erstere organisationales Lernen als reine Adaption abhandelt, wird tatsächliches Lernen erst in Werken, welche die organisationale Entwicklung von Erkenntnis untersuchen, thematisiert. Da dieser Lernbegriff in der Literatur häufig auf verschiedenen hierarchischen Ebenen Verwendung findet, differenzieren Fiol und Lyles zwei unterschiedliche Lernarten.
Während das von ihnen als „lower-level-learning“ bezeichnete Lernen[8] lediglich der Veränderung unterschiedlicher Parameter in einer starren Organisationsstruktur selbst dient, ist das so genannte „higher-level-learning“[9] in der Lage, Regeln, Normen, Werte und Weltanschauungen innerhalb einer Organisation grundlegend zu verändern (vgl. Fiol/Lyles, 1985, S. 805f).
Ein weiterer Typisierungsversuch aus der Betriebswirtschaftslehre stammt von George P. Huber[10] (1991). Huber unterscheidet zwischen Beiträgen, deren Fokus auf der Gewinnung (knowledge aquisition), Verteilung (information distribution), Interpretation (information interpretation) und Speicherung von Wissen (organizational memory) liegt (vgl. Huber, 1991, S. 90). Huber verwendet in seiner Arbeit die Termini Information und Wissen bewusst synonym (vgl. Huber, 1991 S. 89) und konzentriert sich in seiner Darstellung auf die Wissensgewinnung. Dabei widerspricht Huber der These, dass organisationales Lernen die Effektivität einer Organisation erhöhen muss (vgl. Huber, 1991 S. 89). Nach Huber mündet Lernen weder zwangsläufig in wahrheitsgetreuem Wissen noch in beobachtbaren Änderungen von Verhaltensweisen.
An Hubers Differenzierung knüpft Dixon (1992) nahezu nahtlos an. Auch sie differenziert in einer sequenziellen Reihenfolge nach „information acquisition“, „information distribution and interpretation“[11] und „organizational memory“. Erweitert wird Hubers Sequenz durch die Kategorien „Sinnstiftung“ (making meaning) und Wiederabrufen von Informationen (information retrieval), die in der Sequenz vor beziehungsweise nach der Informationsspeicherung angeordnet werden. Beiden Autoren ist gemein, dass sie organisationales Lernen eher auf der Systemebene als auf individueller Ebene ansiedeln (vgl. Dixon, 1992, S. 29). Ein Unterschied hingegen liegt darin, dass Dixon die Literatur explizit für die Nutzung und Anwendung durch Personalmanager (human resource professionals) aufbereitet hat, während Huber mit seinen Ausführungen eine bestimmte, seinem eigenen Ansatz organisationalen Lernens sehr nahe liegende Theorieperspektive weiterfuhren will (vgl. Klimecki/Thomae, 1997, S.1).
Eine der wenigen deutschsprachigen Bestandsaufnahmen führen Klimecki[12] und Thomae (1997) durch. Sie unterscheiden zwischen vier Forschungsperspektiven. Neben einem erfahrungsorientierten Ansatz existieren nach Klimecki/Thomae ein informationsorientierter, ein interpretationsorientierter sowie ein wissensorientierter Forschungsansatz organisationalen Lernens (Klimecki/Thomae, 1997, S. 2). Typisch für den erfahrungsorientierten Ansatz ist, dass Organisationen als „begrenzt rationale Entscheidungssysteme“ (Klimecki/Thomae, 1997, S. 3) betrachtet werden, welche ihre Entscheidungen auf der Grundlage vorausgegangener Erfahrungen treffen. Der Lernprozess selbst läuft zumeist, ohne nach bestimmten Phasen zu unterscheiden, in simplen Versuch-Irrtum-Schemen ab. Diesen erfahrungsorientierten Ansatz prägen im Wesentlichen die Arbeiten von Cyert und March (1963) und March/Olsen (1975). Der von Klimecki/Thomae als „interpretationsorientiert“ bezeichnete Ansatz steht in enger Beziehung zu den Werken von Chris Argyris und Donald Schön (1978). Lernen ist in diesen Ansätzen in zwei Ausprägungen zu finden: als „inkrementelles“ und „fundamentales“ Lernen (Klimecki/Thomae, 1997, S. 5). Der interpretationsorientierte Ansatz lässt sich laut Klimecki und Thomae keiner organisationstheoretischen Perspektive zuordnen (vgl. Klimecki/Thomae, 1997, S. 4). Anders sieht dies bei dem wissensorientierten Ansatz aus, der organisationstheoretisch dem „social systems approach“ zuzuordnen ist (vgl. Klimecki/Thomae, 1997, S. 6). Hierbei dominiert vor allem die Vorstellung, dass Organisationen nicht nur über individuelle Wissensbestände verfügen, sondern darüber hinaus auf Wissen zurückgreifen können, das nicht an bestimmte Mitglieder gebunden ist und durch den organisationalen Lernprozess optimiert werden soll. Der wissensorientierte Ansatz ist wesentlich durch den Beitrag von Duncan und Weiss (1979) geprägt. Beim informationsorientierten Ansatz handelt es sich um den jüngsten der vier Ansätze. Theoretisch mit der kybernetischen Organisationstheorie verwurzelt betrachtet man Organisationen als Systeme der Informationsverarbeitung (vgl. Klimecki/Thomae, 1997, S. 8). Referenzwerke dieses Ansatzes sind die Arbeiten von Daft/Huber (1987) und Huber (1991).
Edmondson und Moingeon[13] (1998) unterscheiden zunächst zwischen den Termini „Lernende Organisation" und organisational Lernen. Die Beiträge aus dem Forschungsfeld des organisationalen Lernens differenzieren sie auf zwei unterschiedlichen Analyseebenen. Zum einen unterscheiden sie zwischen verschiedenen Organisationsverständnissen. Auf der zweiten Analyseebene wird nach dem jeweiligen Erkenntnisobjekt (research goal) differenziert. Hier trennen Edmondson und Moingeon zwischen deskriptiven Forschungsansätzen (descriptive research) und prozessorientierten Forschungsansätzen (intervention research) sowie Mitwirkung (participation) und Verantwortlichkeit (accountability). Die Autoren verarbeiten diese vier Merkmale in einer Zwei-mal-zwei-Matrix.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Die Matrix des organisationalen Lernens.
Eigene Darstellung nach Edmondson und Moingeon, 1998, S. 7.
Insgesamt unterscheiden Edmondson und Moingeon demnach vier Ansätze:
1. Rückstände (residues): Hier wird ein deskriptiver Forschungsansatz mit einer organisational Analyseebene der Organisation kombiniert. Organisationen sind als Rückstände vorausgegangenen Lernens zu betrachten, da sie gesammelte Erfahrungen aus der Vergangenheit in Routinen „speichern“. Exemplarisch hierfür wird der frühe Ansatz von Cyert und March (1963) genannt.
2. Gemeinschaften (communities): Bei diesem deskriptiven Forschungsansatz betrachtet man Organisationen als Ansammlung lern- und entwicklungsfähiger Individuen.
3. Mitwirkung (participation): Dieser Ansatz untersucht die Prozesse und Taktiken, die Individuen zum organisationalen Handeln bewegen.
4. Verantwortlichkeit (accountability): Ansätze dieser Kategorie beschäftigen sich nach Edmondson und Moingeon vornehmlich mit der Frage, wie die Entwicklung „mentaler Modelle“ zum organisationalen Lernen beitragen kann. Edmondson und Moingeon nennen hier exemplarisch die Arbeiten von Argyris (1993) und Senge (1990).
2.6 Typen organisationalen Lernens nach Pawlowsky (2000)
Pawlowsky[14] (2000) hingegen untersucht unter anderem die vorangestellten Kategorisierungsversuche und stellt fest, dass sich trotz der verschiedenen theoretischen Perspektiven, Analysedimensionen, Forschungsfelder und -perspektiven dennoch fünf Gruppen von Theorien aus diesen Typologien extrahieren lassen (vgl. Pawlowsky, 2000, S. 9). Dabei handelt es sichjeweils um die Perspektive:
1. der organisationalen Entscheidungsfindung und Adaption
2. der Systemtheorie
3. der Erkenntnis und des Wissens
4. der Kultur
5. des „action-learning“.
Die erste Perspektive nimmt Bezug auf die Werke von Cyert und March (1963), die Lernen als Umweltadaption begreifen. Die Systemtheorie-Perspektive hingegen betrachtet nach Pawlowsky Organisationen als offene Systeme, die sich mit einer sich verändernden Umwelt auseinander setzen müssen. Hierbei ist zwischen den Vertretern des so genannten „open system approach“ und denen der „selbstreferenziellen Systeme“ zu differenzieren. Pawlowky führt unterschiedliche Autoren wie Probst (1987), Willke (1987), Senge (1990), Steinmann und Schreyögg (1993) als Vertreter dieser Systemtheorie-Perspektive an. Auch in der Erkenntnis- und Wissensperspektive unterscheidet Pawlowsky zwei Ausprägungen. Zum einen spricht er von Strukturansätzen, in denen sowohl organisationales Lernen als auch Entscheidungsfindung von der Struktur der Organisation abhängig sind (vgl. Pawlowsky, 2000, S. 15). Organisationales Lernen wird aus dieser Perspektive als Veränderung organisationaler Wissenssysteme betrachtet (vgl. Pawlowsky, 2000, S. 15). Als Vertreter dieses Strukturansatzes benennt Pawlowsky Autoren wie Huber (1991), Daft und Weick (1984), Weick und Bougon (1986) und Slocum (1996). Die zweite Ausprägung der Erkenntnis- und Wissensperspektive bilden Ansätze, die ihren Fokus auch auf den Prozess der organisationalen Wissensschaffung und -entwicklung richten. Beiträge hierzu stammen unter anderem von Pautzke (1989) und Nonaka (1988). Die Ansätze, welche Pawlowsky seiner, als Kulturperspektive bezeichneten, Kategorie zuordnet verstehen sich als eine Ergänzung der kognitiven Forschungsrichtung, da Lernen nicht nur auf dem individuellen sondern primär auf einem kollektiven Level untersucht wird. Neben den angeführten Werken von Argyris (1990) und Klimecki et al. (1991) sowie Cook und Yanow (1993) stammen die wohl bekanntesten Arbeiten zur Organisationskultur und organisationalem Lernen von Edgar Schein[15]. Lernen entsteht durch Handlungen. Dies ist der Leitgedanke der Ansätze der so genannten „action- learning“-Perspektive. Reflexionen der individuellen Erfahrungen stellen demnach die Grundlage für handlungsrelevantes Lernen dar (vgl. Pawlowsky, 2000, S. 21). Vertreter dieser Perspektive sind nach Pawlowsky (2000) neben Kolb (1976, 1984), Revans (1982) vor allem Argyris/Schön (1978) und Pedler (1997).
2.7 Selektion relevanter Forschungsperspektiven
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: Synopse der Typisierungen organisationalen Lernens. Eigene Darstellung.
Die Abbildung 2 soll partielle Übereinstimmungen zwischen verschiedenen Typisierungsversuchen verdeutlichen. Besonders das von Shrivastava (1983) als „adaptive learning“ bezeichnete adaptive Lernmodell, welches auf die Werke von Cyert/March (1963), March/Olsen (1975) und Cohen, March und Olsen (1972) zurückgreift findet sich inhaltlich in fünf der sieben Ansätze wieder. Dabei unterscheiden sich jedoch die benutzten Termini. Während Fiol/Lyles (1985) es „behavioral development“ nennen, sprechen die anderen Autoren von „Rückständen“ (Edmondson/Moingeon [1998]), von „erfahrungsorientiertem Lernen“ (Klimecki/ Thomae [1997]) oder von „Entscheidungsfindung und Adaption“ (Pawlowsky [2000]). Ein Grund für diesen Konsens liegt vermutlich darin, dass sich die Ansätze in ihrer Weiterentwicklung sehr nah an das von Cyert und March (1963) entwickelte Grundmodell halten und dessen Verständnis von organisationalem Lernen weitgehend übernehmen (vgl. Klimecki/Thomae, 1997, S. 3). Auch der interpretationsorientierte Ansatz organisationalen Lernens nach Klimecki/Thomae (1997) findet sich in ähnlicher Form sowohl bei Shrivastava, er spricht hier von „assumption sharing“ als auch bei Fiol/Lyles als „cognition development“ und Edmondson/Moingeon die es „Verantwortlichkeit“ nennen, wieder. Dieser eng mit den Arbeiten von Chris Argyris und Donald Schön verbundene Ansatz beschreibt nach Klimecki und Thomae das „dominierende Paradigma der OL-Forschung“ (Klimecki/Thomae, 1997, S. 4). Einen dritten Typus organisationalen Lernens stellt der von mehreren Autoren (Shrivastava, Klimecki/Thomae, Pawlowsky) identifizierte „wissensorientierte Ansatz“ dar. Dieser von Shrivastava als „development of knowledge base“ bezeichnete Ansatz ist zu großen Teilen auf die Arbeiten von Duncan und Weiss (1979) zurückzuführen.
Um ein möglichst weit gefächertes Verständnis organisationalen Lernens herausarbeiten zu können, bietet sich eine Übernahme dieser drei genannten Typen an, die sowohl im frühen Ansatz Shrivastavas (1983) als auch in vergleichbarer Form bei Klimecki/Thomae (1997) und mit Abstrichen bei Fiol/Lyles (1985) und Pawlowsky (2000) zu finden sind.
Die informationsorientierte Perspektive organisationalen Lernens (vgl. Klimecki/Thomae, 1997), die zu großen Teilen auf den Arbeiten von Huber (Daft/Huber [1987] und Huber [1991]) basiert und den neusten Forschungstyp des Themenfeldes darstellt, soll in dieser Arbeit ebenfalls untersucht werden. Des Weiteren ist zwischen „organisationalem Lernen“, das in einem Großteil der Ansätze als das Lernen von Organisationen als Entitäten verstanden wird[16] und dem „Lernen in Organisationen“[17] zu differenzieren. Aufgrund des häufig synonymen Gebrauchs der Termini ist unter anderem das Verhältnis zwischen dem Themenfeld des „organisationalen Lernens“ und dem aus der Betriebswirtschaftslehre stammenden Modell der „Lernenden Organisation“ zu untersuchen (vgl. auch Edmondson/Moingeon, 1998, S. 5).
Diese sehr unterschiedlichen Typologisierungsversuche organisationalen Lernens, die zudem auf unterschiedlichen analytischen Dimensionen argumentieren, lassen die heterogene Struktur des Forschungsfeldes organisationales Lernen bereits erahnen. Ziel des folgenden Kapitels soll es sein, unterschiedliche Ansätze organisationalen Lernens zu erörtern und auf diesem Weg zu einem möglichst breit gefächertes Verständnis des Forschungsfeldes zu gelangen. Gleichzeitig sollen auf diesem Weg theoretischkonzeptionelle Differenzen zwischen den Ansätzen herausgestellt werden.
Doch vor der Diskussion einzelner Ansätze organisationalen Lernens sind zunächst die grundlegensten Begriffe des Themengebietes zu erörtern. In einer Literaturanalyse, die sich mit organisationalem Lernen beschäftigt, darf eine Definition der Vokabeln „Organisation“ und „Lernen“ sowie eine Erörterung des Wissensbegriffs nicht fehlen.
3. Diskussion der Begriffe Organisation, Lernen und Wissen
3.1 Gegenstandsbestimmung: Was ist eine „Organisation“?
In ihrem Buch „Die Lernende Organisation“ (2002) fragen Argyris und Schön: „Was ist eine Organisation, dass sie lernen kann?“ (Argyris/Schön, 2002, S. 11).
In der Literatur existiert bislang keine interdisziplinär als allgemein gültig zu betrachtende Definition von Organisation. Das Organisationsverständnis von Betriebswirtschaftslehre, Soziologie und anderen das Phänomen Organisation untersuchenden Disziplinen kann sowohl interdisziplinär als auch innerhalb der einzelnen Disziplinen variieren. Die hier vorgestellten Definitionsansätze stammen allesamt aus dem Umfeld der (Organisations-) Soziologie.
Grundlegend ist der Terminus Organisation sowohl als Prozess als auch als Struktur anzusehen. Da diese Arbeit organisationales Lernen als gesamtorganisationales Phänomen untersucht, wird der Betrachtung von Organisationen als Strukturen der Vorzug gegeben.
3.1.1 Definitionen von „Organisation”
Die Organisation als Struktur ist unter anderem zu verstehen als:
a type of collectivity established to pursue specific aims or goals, characterizes by a formal structure of rules, authority relations, a division of labor, and limited membership or admission. (Jary/Jary, 1991, S. 345).
Die Zielgerichtetheit und Arbeitsteilung stellt bereits Fuchs (1978) heraus, indem er Organisation als „die Ordnung von arbeitsteilig und zielgerichtet miteinander arbeitenden Personen und Gruppen [welche] bewusst auf ein Ziel hinarbeiten, dabei geplant arbeitsteilig gegliedert sind und ihre Aktivität auf Dauer eingerichtet haben“ (Fuchs, 1978, S. 548) charakterisiert.
Mayntz (1969) unterscheidet ferner zwischen einem formellen und einem informellen Organisationstypus. Unter der formellen Organisation sind demnach die ziel- und zweckgerichteten Aspekte der Organisation wie die hierarchische Gliederung oder die Unterteilung in einzelne Abteilungen zu betrachten. Diese formellen Strukturen und Gliederungen können beispielsweise in Organigrammen festgelegt sein. Die Verhaltensweisen der Organisationsmitglieder beruhen demnach auf dem von der Organisationsleitung geschaffenen System von Strukturen und Regeln. In Kontrast dazu steht die informelle Organisation, die als „ungeplante soziale Erscheinungen [...] die zusätzlich zu oder in Abweichung von dem O.plan [Organisationsplan] auftreten“ (Mayntz 1969, S. 762) definiert wird. Mit dem Begriff informelle Organisation wird die Abweichung von den durch die Organisation vorgegebenen Strukturen durch Organisationsmitglieder umschrieben. Gemeint sind jene oft ungeplanten sozialen Abläufe, bei denen die Mitglieder die vorgegebenen Strukturen und Regeln der Organisation nicht beachten. Allerdings existieren beide Organisationstypen nicht unabhängig voneinander, sondern bilden im Zusammenspiel die „soziale Wirklichkeit des Betriebes oder seine soziale O. [Organisation]“ (Mayntz, 1969, S. 762).
Die genannten Definitionen zeigen zwei strukturelle Merkmale auf, durch welche sich Organisationen von anderen Kollektiven abgrenzen[18].
Erstens verfügen Organisationen über einen hohen Formalisierungsgrad, wobei die Kooperation der Organsationsmitglieder „bewusst“ geschieht. „Die Struktur der bestehenden Beziehungen wird explizit gemacht und [...] in dem Maße formalisiert, in dem die Regeln, die das Verhalten der Beteiligten steuern, präzise und explizit formuliert sind“ (Scott, 1986, S. 44).
Zweitens sind Organisationen stets zweckgerichtet, verfolgen also immer spezifische Ziele. Dabei koordinieren Organisationen die Interaktionen und Aktivitäten der Beteiligten überwiegend an zuvor definierten Zielen, welche gleichzeitig als Entscheidungsmaßstäbe dienen (vgl. Scott 1986, S. 44).
Eine Organisation ist folglich als „eine an der Verfolgung relativ spezifischer Ziele orientierte Kollektivität mit einer relativ stark formalisierten Sozialstruktur“ (Scott, 1986, S. 45) zu verstehen.
Da in der Forschung zum organisationalen Lernen und zum Wissensmanagement keine einheitliche Auffassung von Organisation existiert[19], bietet sich die Übernahme des von Argyris und Schön (1978) herausgearbeiteten Organisationsbegriffes an. Dieser birgt den Vorteil, dass er nicht nur ein sehr differenziertes Organisationsverständnis beinhaltet, sondern gleichzeitig den Organisationsbegriff an unterschiedliche Lernarten koppelt. Werden Organisationen als Gruppen gesehen, so findet Lernen zumeist in Interaktionen zwischen Individuen statt, die mit bestimmten Aufgaben betraut sind. Werden Organisationen als kollektive Akteure betrachtet, so lernen sie durch Erfahrungen, die sich in ihren Organisationsstrukturen und Regelwerken manifestieren. Begreift man Organisationen als Strukturen, so geht man zumeist von einem Lernen als Wandel aus, der sich in Anpassung an bestimmte Umweltbedingungen vollzieht. Organisationen als Systeme hingegen lernen durch bestimmte Mechanismen zur Fehlerbehebung. In der Auffassung von Organisationen als kulturelle Systeme wird Lernen als Prozess der Sozialisation und Transformation von Überzeugungen und Werten angesehen. In den Ansätzen, die Organisationen alspolitische Arenen begreifen, spielt sich Lernen häufig auf individueller Ebene ab. Besondere Aufmerksamkeit wird hier häufig mikropolitischen Bedingungen organisationalen Lernens geschenkt (vgl. Argyris/Schön, 1978, S. 321ff).
3.2 Gegenstandsbestimmung: Was bedeutet „Lernen“?
Diese Arbeit zielt darauf, sowohl das individuelle Lernen in Organisationen als auch das Lernen von Organisationen zu untersuchen. Sowohl in der Literatur zum individuellen Lernen in Organisationen als auch in der Literatur zum Lernen von Organisationen greift man auf Lernmodelle aus der Individualpsychologie zurück. Häufig lassen sich ganze Ansätze des organisationalen Lernens aus Modellen der Individualpsychologie herleiten. Bei dieser Transformation werden nachfolgend vorgestellte Ansätze, die der Untersuchung individuellen Lernens dienen auf höhere Aggregationsebenen wie Organisationen angewendet[20]. Die drei wichtigsten Lemformen sollen nebst zugehöriger Lemtheorie im folgenden kurz vorgestellt werden. Auf die Darstellung unterschiedlicher organisationaler Lerntypen wird an dieser Stelle verzichtet, da ihre Erörterung zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden soll.
3.2.1 Die behavioristische Lerntheorie und das Stimulus-Response-Modell
Nach der Stimulus-Response-Theorie lösen Umweltreize individuelles Handeln aus. Durch die (Umwelt-) Reaktion auf das individuelle Handeln wiederum wird dieses kontrolliert (vgl. Zimbardo, S. 39). Ziel des Stimulus-Response-Ansatzes ist „das Auffinden von gesetzmäßigen Verknüpfungen bestimmter Reize mit bestimmten Reaktionen“ (Fröhlich, 2002, S. 376). Der Behaviorismus strebt dabei eine „möglichst objektive Betrachtungsweise der beobachtbaren, offenen Reaktionen von Mensch und Tier “ ( Fröhlich, 2002, S.91)an.
Das individuelle Bewusstsein, besser die innerpsychischen Vorgänge zur Erklärung von Verhalten, sollen nach Ansicht der Behavioristen ausgeblendet werden. Die physiologischen Vorgänge innerhalb der Untersuchungsobjekte stoßen aus behavioristischer Sicht somit auf wenig Interesse (vgl. Fröhlich, 2002, S. 91). Das objektiv beobachtbare Verhalten und die Reaktion des Untersuchungsobjekts auf ebenfalls beobachtbare Reize bilden die Basis der behavioristischen Lerntheorie. Der Mensch wird nicht als einzigartig betrachtet, sondern er ist lediglich ein austauschbarer Informationsüberträger. Das Gehirn stellt folglich eine so genannte „blackbox“ dar, die unweigerlich mit einer Reaktion entgegnet, wenn ein Reiz auf sie einwirkt.
3.2.1.1 Klassisches und operantes Konditionieren
Der Mensch unterliegt demzufolge allgemeinen Gesetzmäßigkeiten und sein Verhalten ist vorhersehbar (vgl. Zimbardo, 1983, S. 42). Lernprozesse äußern sich als Resultat einer klassischen, beziehungsweise operanten Konditionierung. Die klassische Konditionierung geht auf Iwan Pawlow zurück, der im Jahre 1918 entdeckte, dass eine Reizsubstitution, bei der die Funktionen eines ursprünglichen unkonditionierten Reizes von einem neuen konditionierten Reiz übernommen wird, möglich ist. Prominentestes Beispiel hierfür sind die so genannten „Pawlowschen Hunde“. Bei diesen Versuchstieren kam es bei Darbietung eines Fleischpulvers zur automatischen ungelernten Reaktion der Speichelabsonderung. Nach einiger Zeit lösten auch weitere, zeitgleich auftretende Reize wie der bloße Anblick des Futters oder das Erklingen einer Glocke die Speichelabsonderung aus (vgl. Zimbardo, 1983, S. 176). Während sich bei der klassischen Konditionierung ein neuer Reiz einprägt, lernt ein Versuchstier bei der operanten Konditionierung eine freiwillige Reaktion auszuführen, die durch positive Verstärkung mit einem Reiz gekoppelt ist. Vorreiter dieser Disziplin ist Skinner. Die Experimente laufen nach einem einfachen Schema ab. Führt ein Versuchstier (zunächst zufällig) eine erwünschte Reaktion aus, erhält es mit einem so genannten positiven Verstärker (meistens Futter) eine Belohnung. Dieser Verstärker folgt unmittelbar auf die Reaktion und erhöht die Wahrscheinlichkeit der Verhaltenshäufigkeit für diese Reaktion. Der behavioristische Ansatz hat in der individuellen Lernpsychologie keine nennenswerte Bedeutung mehr (vgl. Klimecki, 1999, S. 7), wird jedoch häufig zitiert, um Lernprozesse in sozialen Systemen zu erklären. Während die Bedeutsamkeit des klassischen Konditionierens im organisationalen Kontext als eher gering zu bewerten ist, stellt das operante Konditionieren die wohl am häufigsten auftretende Form kollektiven Lernens dar (vgl. Wilkesmann, 2000, S. 2).
3.2.2 Das kognitive Lernmodell
Während sich behavioristische Lernmodelle mit den beobachtbaren äußeren Bedingungen des Lernens beschäftigen, blenden kognitive Lernmodelle die innerpsychischen Vorgänge bei der Untersuchung individuellen Verhaltens nicht aus, sondern betrachten das individuelle Bewusstsein als „zentrale Aktivität“ (vgl. Zimbardo, 1983, S. 41). Legen die Anhänger der behavioristischen Schule dem Verhalten einer Person beobachtbare „objektive“ Umweltreize zugrunde, so gehen Vertreter des Kognitivismus davon aus, dassjedes Individuum diese Reize subjektiv wahrnimmt. Das Erkenntnisinteresse der kognitiven Lernpsychologie besteht in der Untersuchung der individuellen, subjektiven Wahrnehmung von Umweltreizen sowie der Reaktionen auf diese. Der Fokus liegt hierbei insbesondere auf den dabei ablaufenden kognitiven Prozessen (vgl. Zimbardo, 1983, S. 41). Die kognitive Lempsychologie betrachtet den Menschen als einzigartig und nicht austauschbar.
3.2.3 Lernen am Modell
Von besonderer Bedeutung für die Untersuchung organisationaler Lernprozesse könnte sich die Theorie sozialen Lernens nach Bandura erweisen. Nach Bandura ist menschliches Verhalten nicht allein durch Reiz-Reaktion-Zusammenhänge zu erklären. Er geht davon aus, dass zwischen Reiz und Reaktion höhere Prozesse ablaufen müssen. Bandura beschäftigt sich gezielt mit der Frage, wie Verhaltensweisen speziell im sozialen Kontext erworben werden können. Seine zentrale Aussage dabei lautet, dass Individuen in erster Linie durch die Beobachtung anderer Individuen lernen (vgl. Zimbardo, 1983, S. 225ff). Das Betrachten eines so genannten Modells[21], regt ein Individuum dazu an, bestimmte Entscheidungs- und Verhaltensalternativen genauer zu reflektieren. Durch Beobachtung ist der Einzelne somit in der Lage, sein Verhalten anzupassen, ohne selbst handeln zu müssen. Gleichzeitig kann sich eine Person auf diese Weise auch komplexe soziale Handlungen aneignen.
3.3 Gegenstandsbestimmung: Was ist „Wissen“?
Um die Fragen nach Generierung und Management von Wissen untersuchen zu können, bedarf es einer adäquaten Interpretation des Begriffs. Die Schwierigkeit der Selektion und Entwicklung einer geeigneten Definition liegt vor allem darin, dass diese sich in verschiedensten Forschungsfeldern und Disziplinen in jeweils unterschiedlicher Ausprägung wiederfindet. Dabei bestimmt dasjeweilige disziplinäre Erkenntnisinteresse Substanz und Charakter des verwendeten Wissensbegriffs. Die wissenschaftliche Diskussion liefert bislangjedoch keine allseits anerkannte Definition von Wissen. Diese Tatsache führt dazu, dass die für das Forschungsfeld des Wissensmanagement relevanten Disziplinen[22] ihren Forschungen unterschiedliche Wissensbegriffe und -verständnisse zu Grunde legen.
3.3.1 Der positivistische Wissensbegriff
Grundsätzlich operiert die Wissenschaft mit der Unterscheidung zwischen „wahr“ und „falsch“ (vgl. Schreyögg 2002, S. 6). Schreyögg (2002) formuliert die notwendige Bedingung von Wissen als „begründete Aussagen, die ein bestimmtes Prüfverfahren durchlaufen haben“ (Schreyögg, 2002, S. 8).
Die Schule des Positivismus spricht ausschließlich dem wissenschaftlichen Wissen Gültigkeit zu. In Folge dessen akzeptiert sie auch nur wissenschaftliche Prüfverfahren für den Aufbau von Wissen[23] (vgl. Schreyögg, 2002, S. 7). Die positivistische Theorie ist der Auffassung, dass:
Wissen als Resultat der Erkenntnis eine prinzipiell unabhängige, selbständige und wirkliche äußere Welt repräsentiert und [...] als die Abbildung der ontologisch vorgegebenen Realität in einem erkennenden Subjekt [...] die Welt wahrheitsgetreu wiedergeben (Klimecki/Laßleben, 1995, S. 4)[soll].
Die Überprüfbarkeit stellt dennoch eine notwendige Bedingung des Wissens dar[24].
3.3.2 Das sozialkonstruktivistische Wissensverständnis
Die sozialkonstruktivistische Schule hingegen vertritt die Auffassung, dass Wissen in verschiedenen Funktionskreisen erzeugt werden kann (vgl. Schreyögg, 2002, S. 7). Wissen ist nicht an eine objektive, sondern an eine subjektive, individuell konstruierte Wirklichkeit gekoppelt, welche durch soziale Kontexte beeinflusst wird. Eine objektiv zu entdeckende Wirklichkeit existiert nach konstruktivistischer Auffassung nicht; vielmehr muss die Wirklichkeit immer wieder von jedem Individuum neu konstruiert werden.
In Abwandlung dazu sieht der radikale Konstruktivismus die Grundlage des Wissens in der Wahrnehmung. Der Mensch konstruiert sein Wissen auf Basis der Wahrnehmung seiner Sinnesorgane. Da Wahrnehmungen subjektiv sind, kann das daraus resultierende Wissen demnach auch nur subjektiv sein. Dieses subjektive konstruierte Wissen eines Menschen über seine räumliche Umgebung ist folglich von ihm selbst gefertigt und prinzipiell fehlerhaft (vgl. Klimecki/Laßleben, 1995, S. 5). Wissen beschreibt demzufolge nicht eine Kopie, sondern eine Konstruktion von Realität. Pawlowsky (1994) definiert Wissen als „Annahmen über die Realität“ (Pawlowsky, 1994, S. 184). Aus diesem konstruktivistischen Wissensverständnis sollen zwei Implikationen übernommen werden. Einerseits die Erkenntnis, dass Wissen auf Informationen[25] basiert und andererseits, dass Wissen immer personenabhängig sein muss. Die Erkenntnis, dass Wissen personengebunden ist, steht im absoluten Gegensatz zu dem Wissensbegriff der behavioristischen Lernpsychologie. Diese untersucht Wechselwirkungen zwischen Informations-Stimulus und Verhaltens-Response, wobei das Individuum als „blackbox“ wahrgenommen wird und intraindividuelle Prozesse vollständig ausgeblendet werden (vgl. Klimecki/Laßleben, 1995, S. 6). Wissen wäre demnach das „Abbild einer vom Beobachter unabhängigen Welt“ (Nassehi, 2000, S. 3). Erst die Einbeziehung der Wissensträger verleiht dem Wissensbegriff jedoch soziologische Züge (vgl. Böhme 1999). Wehner/Dick (2001) sehen Wissen als „die Integration von handelnd erworbener Erfahrung über Bedeutungs- und Sinngebung“ (Wehner/Dick, 2001, S. 23).
3.3.3 Zum Verhältnis von Daten, Information und Wissen
Wissen greift sowohl auf Informationen als auch auf persönliche Erfahrungskontexte zurück. Doch in welcher Beziehung stehen Wissen und Informationen? Spinner (1994) beispielsweise schlägt vor, Wissen und Information gleichzusetzen und die Termini synonym zu nutzen (vgl. Spinner, 1994, S. 26). Spätestens hier zeigt sich die Notwendigkeit einer Differenzierung, da „hne [sic.] eine klare Unterscheidung zwischen Daten, Informationen und Wissen [...] Wissensmanagement zum Scheitern verurteilt“ (Willke, 2001, S. 17) ist.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 3. Hierarchie von Daten, Information und Wissen. Eigene Darstellung nach Willke, 2001, S.13.
Bei einem Datum handelt es sich zunächst um ein nicht „per se“ interpretierbares Symbol. Als Beispiel sei die Zahl 5,34 Milliarden genannt. Erst wenn das Datum einen Kontextbezug erhält, wird es zu einer Information. Bringt man die Zahl 5,34 Milliarden in den Zusammenhang, dass es sich um die Jahresumsatzzahl der Firma Porsche in Euro handelt, so ergibt sich daraus die Information, dass der Jahresumsatz der Firma Porsche 5,34 Milliarden Euro beträgt. Nach Klatt et al. (1999) wird diese Information zu Wissen, wenn sie „in Erfahrungs- und Handlungshorizont[e] eingebunden wird“ (Klatt et al. 1999, S. 173).
Durch diese Einbindung in vorhandene individuelle Wissensstrukturen lässt sich einer Information Sinn zusprechen, wodurch sie verstanden werden kann. Beim Wissen handelt es sich demnach um „verstandene Information“ (Wilkesmann/Rascher, 2002, S. 3).
Zusammengefasst lassen sich folgende Eigenschaften von Wissen identifizieren:
Wissen ist sowohl personen- als auch kontextgebunden, es wird individuell konstruiert und stützt sich auf Informationen. Eine erste Arbeitsdefinition des Wissensbegriffs könnte demnach wie folgt lauten:
Wissen ist eine von Individuen konstruierte, personen- und kontextgebundene Struktur, welche sich auf Informationen stützt und sich weiterhin nach Wissensträgern und Wissensarten klassifizieren lässt.
Nach der Argumentation der bereits erwähnten Wissensverständnisse können ausschließlich Individuen über Wissen verfügen.
Ein Teil der Literatur spricht jedoch auch Gruppen oder gar ganzen Organisationen die Fähigkeit zu, als Wissensträger zu agieren.
3.3.4 Formen des Wissens
Wissen kann in unterschiedlichen Formen vorhanden sein, beispielsweise in kodifizierbarer Form als explizites oder als implizites, nicht kodifizierbares Wissen[26]. Eine weitere gebräuchliche Unterscheidung liegt zwischen dem als „knowing-how“ bezeichneten Können und dem als „knowing-about“ benannten Kennen. In eine ähnliche Richtung zielen auch die Differenzierungen zwischen prozedualem und deklarativem Wissen sowie zwischen Objektwissen[27] und Metawissen[28]. All diese Differenzierungen des Wissensbegriffs implizieren, dass der Wissensbegriff situationsabhängig zwischen den beiden extremen „Wissen als Objekt“ und „Wissen als Prozess“ einzuordnen ist (vgl. North, 1999, S. 47).
Wenn man davon ausgeht, dass der Wissensbegriff faktisch immer an Individuen gekoppelt ist, fällt es schwer, zwischen individuellem und kollektivem Wissen zu differenzieren. Hier steht der Überzeugung, dass ausschließlich Individuen in der Lage seien zu lernen (vgl. Arnold, 1995, S. 23) dem Argument, dass die Summe der Fähigkeiten individueller Mitglieder nicht ausreiche, um organisational Intelligenz zu erklären (vgl. Romhardt, 1998, S. 54), gegenüber. Der aristotelischen Erkenntnis folgend muss also das „Ganze mehr als die Summe der Teile sein“ (Romhardt, 1998, S. 54). Modelle, welche zu erklären versuchen, wie Organisationen als Kollektive lernen können, sollen im folgenden Kapitel erörtert werden.
4. Perspektiven und Ansätze organisationalen Lernens
4.1 Die adaptive Perspektive nach Cyert/March (1963) und March/Olsen (1975)
4.1.1 Rahmenbedingungen organisationaler Entscheidungsfindung
Die frühen Ansätze in der Forschung zum organisationalen Lernen orientierten sich am behavioristischen Lernmodell der Individualpsychologie. Die Grundlagen des ursprünglichen adaptiven Ansatzes basieren auf den vor über 60 Jahren angestellten Überlegungen Herbert Simons. Simon widerspricht dem damals vorherrschenden neoklassischen Paradigma, wonach organisational Entscheidungen immer auf rationalen Überlegungen[29] beruhen. Als Gegenentwurf hierzu schafft Simon das Modell einer begrenzten organisationalen Rationalität, dessen Kernaussage es ist, dass Entscheidungen immer aus einer unvollständigen Informationslage heraus getroffen werden(vgl. Simon, 1981, 116ff)[30].
Im Jahre 1958 vertreten Simon und March die Ansicht, dass die Prozesse der organisationalen Entscheidungsfindung und Problemlösung mit denen des menschlichen Organismus vergleichbar sind.
Die hohe Spezifität von Struktur und Koordination innerhalb von Organisationen [...] macht die einzelne Organisation zu einer soziologischen Einheit, die in ihrer Bedeutung dem Einzelorganismus in der Biologie vergleichbar ist (March/Simon, 1976, S. 4)[31].
Ihrer Meinung nach handelt es sich sowohl bei Organisationen als auch bei Organismen um komplexe Informationsverarbeitungssysteme. Das Verhalten eines Organismus innerhalb eines bestimmten Zeitraumes ist nach March und Simon (1976) abhängig von zwei Faktoren. Zum einen von seinem inneren Zustand zu Beginn des Zeitintervalls und zum zweiten von der Beschaffenheit der Umwelt zum selben Zeitpunkt. Der innere Zustand eines Organismus spiegelt die geronnenen Lebenserfahrungen wider. Diese Erfahrungen werden nach March und Simon im Gedächtnis gespeichert, das sich wiederum in drei Kategorien differenzieren lässt:
1. Werte und Ziele
2. das Verhältnis von Handlungen und deren Wirkungen
3. alternative Handlungsmöglichkeiten.
Individuen sind demnach in der Lage, ihre kognitiven Strukturen und Verhaltensweisen durch Erfahrung zu verändern; sie haben die Fähigkeit zu lernen[32]. Eben diese Lernfähigkeit sprechen die Autoren nicht nur Individuen, sondern auch ganzen Organisationen zu. Nach March und Simon sind Handlungen und Entscheidungen von Organisationen nicht nur durch ihren organisationalen Kontext vorherbestimmt, sondern sie sind auch abhängig von der Lernfähigkeit derjeweiligen Organisation.
Cyert und March (1963) übernehmen dieses Verständnis von Organisationen als lernfähigen Systemen. Ihrer Ansicht nach handelt es sich bei Organisationen um sehr komplexe, adaptive Systeme, welche die Fähigkeit haben, aus Erfahrung zu lernen; zudem bilden sich aus diesen Erfahrungen organisationale Regelsysteme heraus. Das Hauptaugenmerk von Cyert und March liegt auf der Untersuchung von Wechselwirkungen zwischen diesen Regelsystemen und den Umwelteinflüssen, welche auf Organisationen einwirken. Dabei gehen die Autoren davon aus, dass bestimmte Rückkopplungsschleifen zwischen Organisationen und ihren jeweiligen Umwelten existieren (vgl. Antal/Dierkes, 2002, S. 11), wobei das Regelsystem einer Organisation die Informationsaufnahme aus der Umwelt und deren Verarbeitung steuert.
4.1.2 Auslöser organisationalen Lernens
Die Irritation des Systems durch Umwelteinflüsse, wodurch die Organisation von ihrem eigenen Anspruchsniveau abweicht (vgl. Weick, 1991, S. 120), ist ein Lernauslöser organisationalen Lernens. Den zweiten Lernauslöser stellen organisationale Misserfolge dar. Angeregt durch diese Misserfolge wird die Suche der Organisation nach Alternativen zur Erfüllung der Organisationsziele intensiviert (vgl. Cyert/March, 1963, S. 113). Dies wiederum kann durch eine Änderung der organisationalen Regelsysteme in organisationalem Lernen münden. Nach Auffassung der Autoren entwickeln und verändern sich Regeln innerhalb einer Organisation sowohl durch „feedbacks“ der Umwelt, sowie durch Nachahmung. Eine weitere Möglichkeit, bestehende Regeln in einer Organisation zu ändern, bildet das Ersetzen ungültiger Regeln[33]. Durch Interaktion einzelner Organisationsmitglieder mit der Umwelt ändert sich deren Realitätswahrnehmung mit jeder Aufnahme neuer Informationen. Cyert und March fassen organisationales Lernen als Veränderung der „Suchregeln“, „Relevanzkriterien“ und „Level der Erwartungshaltungen“ auf. Lernsubjekt ist in Cyert und Marchs Modell die Organisation, diejedoch durch ihre Mitglieder lernt. Die Autoren formulieren es wie folgt: „organizational adaptation uses individual members of the organization as instruments” (Cyert/March, 1963, S. 123).
4.1.3 Organisational Ziele
Nach Cyert und March (1963) sind Organisationen Koalitionen verschiedener Interessenvertreter, die innerhalb der Organisation unterschiedliche Ziele verfolgen. Demnach besitzen Organisationen als Kollektive keine einheitlichen Ziele. Lediglich ihre Mitglieder und internen Koalitionen verfolgen Ziele, die jedoch durchaus im Widerspruch zueinander stehen können. Die Zielvorstellungen der Gesamtorganisation müssen deshalb immer wieder durch Verhandlungen angepasst werden. Basis hierfür bildet die Feststellung, dass Organisationen durch ihre begrenzten Kapazitäten nicht alle potenziellen Probleme gleichzeitig behandeln können. Hierdurch sind, unter Beachtung der Ansprüche der Organisationsmitglieder, unterschiedliche Schwerpunkte zu setzen. Ausgehend davon, dass kein Akteur innerhalb der Organisation stark genug ist, seine Ziele auch als Ziele der Organisation durchzusetzen, kommen Cyert und March zu dem Schluss, dass sich die organisationalen Ziele immer von den Zielen der organisationsinternen Akteure und Koalitionen unterscheiden. Dies führt nach Ansicht der Autoren dazu, dass sich die Organisation zum größten Teil mit kurzfristig auftretenden Problemen auseinandersetzen muss[34] und hierbei weitsichtiges agieren vernachlässigt. Aufgrund dieser ständig wechselnden Zielsetzung ist eine vollständige Auflösung von Konflikten nicht möglich. Für die sich stetig erneuernde Zielsetzung nennen die Autoren drei Gründe. Zum einen den dezentralisierten Entscheidungsfindungsprozess innerhalb der meisten Organisationen, eine permanente Reformulierung der Organisationsziele sowie die Anpassung von Überschussressourcen[35].
4.1.4 Die Organisation als begrenzt rationales System
Nach Cyert/March können organisationale Handlungen nicht vollständig auf rationalen Überlegungen beruhen, da organisationale Entscheidungen auf Informationen, Einschätzungen und Erwartungen basieren, die niemals der Realität entsprechen. Gründe dafür sind die Unvollständigkeit des Wissens, die Problematik der Bewertung zukünftiger Ereignisse sowie die begrenzte Auswahl an Entscheidungsalternativen. Den Akteuren innerhalb der Organisation steht aufgrund dieser unvollständigen Informationslage lediglich eine ebenfalls begrenzte Anzahl von Handlungsalternativen zur Verfügung[36]. Selbiges gilt auch für einzelne Organisationsmitglieder. Kein Organisationsmitglied kennt alle möglichen Handlungsalternativen mitsamt deren möglichen Konsequenzen[37]. Deshalb treffen Organisationsmitglieder ihre Entscheidungen auf Grundlage stark vereinfachter Weltbilder, unvollkommenen Wissens und unter Verwendung bestimmter Entscheidungsregeln. Die wohl wichtigste dieser Entscheidungsregeln ist des „satisfycing“[38], das besagt, dass Individuen in Entscheidungssituationen nicht optimale sondern befriedigende Lösungen anstreben. Welche Lösung als befriedigend betrachtet wird, hängt allerdings vom individuellen Anspruchsniveau ab.
Cyert und March (1963) betrachten Organisationen als Einrichtungen der Komplexitätsreduktion, die es erlauben, sowohl Entscheidungsfindungsprozesse als auch Handlungen großenteils auf Grundlage organisationaler Routinen[39] durchzuführen.
[...]
[1] Laut Güldenberg (2001) lag der Wissensanteil an der Wertschöpfung deutscher Unternehmen im Jahre 2001 bereits bei über 60 % (vgl. Güldenberg, 2001, S. 16).
[2] Wilkesmann (1999b) spricht von einer „Entmaterialisierung der Wertschöpfung“ (Wilkesmann, 1999b, S. 1).
[3] Die deutsche Ausgabe von „The Knowledge Creating Company“ erschien im Jahre 1997.
[4] Sofern man Cyert und Marches (1963) „A Behavioral Theory of the Firm“ als ersten Beitrag zum Thema betrachtet.
[5] Obwohl spätestens seit Lewin (1951) bekannt sein dürfte, dass es nichts Praktischeres gibt als eine gute Theorie (vgl. Lewin 1951, S. 169).
[6] Paul Shrivastava ist Professor ofManagement an der Bucknell University in Lewinsburg (USA).
[7] Marlene Fiol hat den Lehrstuhl für „Strategy and Health Administration“ an der University of Colorado (USA) inne. Marjorie A. Lyles ist Professorin für „ International Strategic Management“ an der Kelley School of Business der Indiana University.
[8] Fiol und Lyles nennen hier exemplarisch die Arbeiten von Cyert and March (1963).
[9] Die Autoren zeigen hier Parallelen zu den Werken von Argyris/Schön (1978) und Hedberg (1981) auf.
[10] Huber hat den „Charles and Elizabeth Prothro Regents Chair in Business Administration“ der Universität von Texas (USA) inne.
[11] Dixon fasst hier Hubers Kategorien der Verteilung und der Interpretation von Wissen zusammen.
[12] Klimecki ist Professor für Management an der Fakultät für Verwaltungswissenschaften der Universität Konstanz.
[13] Amy Edmondson ist Professor für „Business Administration“ an der Harvard Business School (USA), Bertrand Moingeon ist Professor für „Strategic Management and Associate Dean for Executive Education“ ander HECSchoolofManagementinParis.
[14] Pawlowsky ist Inhaber des Lehrstuhls „Personal und Führung“ an der TU Chemnitz.
[15] Siehe Schein (1984, 1993, 1996) und Kapitel 4 dieser Arbeit.
[16] Vgl. hierzu Dixon (1992). Ihrer Meinung nach handelt es sich bei organisationalem Lernen um „Learning at the system rather than individual level“ (Dixon 1992, S. 29).
[17] Das Erkenntnisinteresse des Lernens in Organisationen beruht auf der Analyse kollektiver Lernprozesse in Organisationen.
[18] Eine differenzierte Auseinandersetzung mit unterschiedliche Organisationsverständnissen und -theorien findet sich bei Gmür (1993).
[19] In neueren Beiträgen des Wissensmanagement wird der Organisationsbegriff auch auf „virtuelle Gemeinschaften“ (vgl. Rheingold, 1993; Kollock/Smith, 1996) und „Ba“ (vgl. Nonaka, 1998) erweitert.
[20] Auch Klimecki und Thomae (1995) wählen Termini aus der Individualpsychologie, indem sie zwischen einer „adaptiven“ und einer „kognitiven“ Schule organisationalen Lernens unterscheiden (vgl. Klimecki/Thomae, 1995, S. 3f).
[21] Dieses Modell kann sowohl direkt erfahren als auch bildlich dargestellt werden. Erstes wäre bei der Beobachtung einer konkreten Person der Fall, während letzteres beispielsweise ein Buch oder eine Person in einem Film beschreiben kann.
[22] Gemeint sind hier neben anderen vor allem die Soziologie, die (Sozial-)Psychologie und die W irtschaftswissenschaften.
[23] Wissenschaftliches Wissen muss sich somit an seinem Wahrheitswert messen lassen (vgl. Lyotard, 1999, S. 76 ff).
[24] An dieser Stelle sei angemerkt, dass die These von der zwangsläufigen Überprüfbarkeit von Wissen im Laufe dieser Arbeit mit der Untersuchung des „impliziten Wissens“ kritisch hinterfragt wird.
[25] Wissen stützt sich in diesem Fall auf die Informationen der Sinnesorgane.
[26] Diese Unterscheidung stammt von Michael Polanyi (1966) und wird im Verlauf dieser Arbeit eingehend untersucht.
[27] Objektwissen bezeichnet das auf konkrete Objekte bezogene Wissen.
[28] Metawissen bezeichnet das Wissen über Objektwissen.
[29] Die Theorie der rationalen Wahl geht davon aus, dass die so genannte Nutzenmaximierung die Grundlage für Entscheidungen bildet. Demnach handelt die entscheidende Persönlichkeit unbeeinflusst von persönlichen Werten und Gruppennormen und wählt stets die „beste“ Alternative (vgl. Scott, 1986, S. 93f).
[30] Die Erstauflage erschien 1945.
[31] Die Erstauflage erschien 1958.
[32] Lernprozesse folgen hierbei dem Reiz-Reaktionsschema.
[33] Dies würde einem Prozess des Verlernens im Sinne Hedbergs (1981) entsprechen.
[34] Wobei sie gleichzeitig immer neue kurzfristige Ziele kreiert.
[35] Cyert und March (1963) bezeichnen diese Überschussressourcen einer Organisation, die genutzt werden können um organisationale Lernprozesse anzuregen, als „organizational slack“.
[36] Diese unvollständige Informationslage und beschränkte Handlungsalternativen bilden den Kern von Simons (1945) Konzept der „bounded rationality“.
[37] Damit existieren immer auch Alternativen zu einer organisationalen Handlung. Systemtheoretiker würden in diesem Fall von „Kontingenz“ sprechen.
[38] Eines der bekanntesten Beispiele für das „satisfycing“ ist das Stecknadelspiel. Auf der Suche nach einer Stecknadel im Heuhaufen wird die Suche nach Auffinden der ersten ausreichend spitzen Nadel eingestellt (befriedigende Lösung) und nicht versucht, die spitzeste verfügbare Nadel (optimale Lösung) zu finden. Der Grund hierfür liegt in der individuellen Unkenntnis über die Existenz weiterer (spitzerer) Nadeln sowie des Ausmasses des weiteren Suchaufwands.
[39] Nach Cyert und March bilden sich Routinen dadurch, dass auf Handlungen, die mit Erfolgserlebnissen assoziiert werden, lieber zurückgegriffen wird als auf Handlungen, die sich in der Vergangenheit als Fehlentscheidungen herausstellten.
- Arbeit zitieren
- Patrik Liuni (Autor:in), 2006, Zum Verhältnis von „Organisationalem Lernen“ und „Wissensmanagement“, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/313334
Kostenlos Autor werden






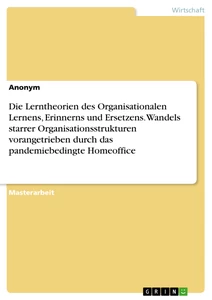













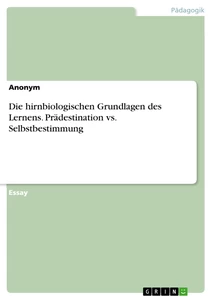
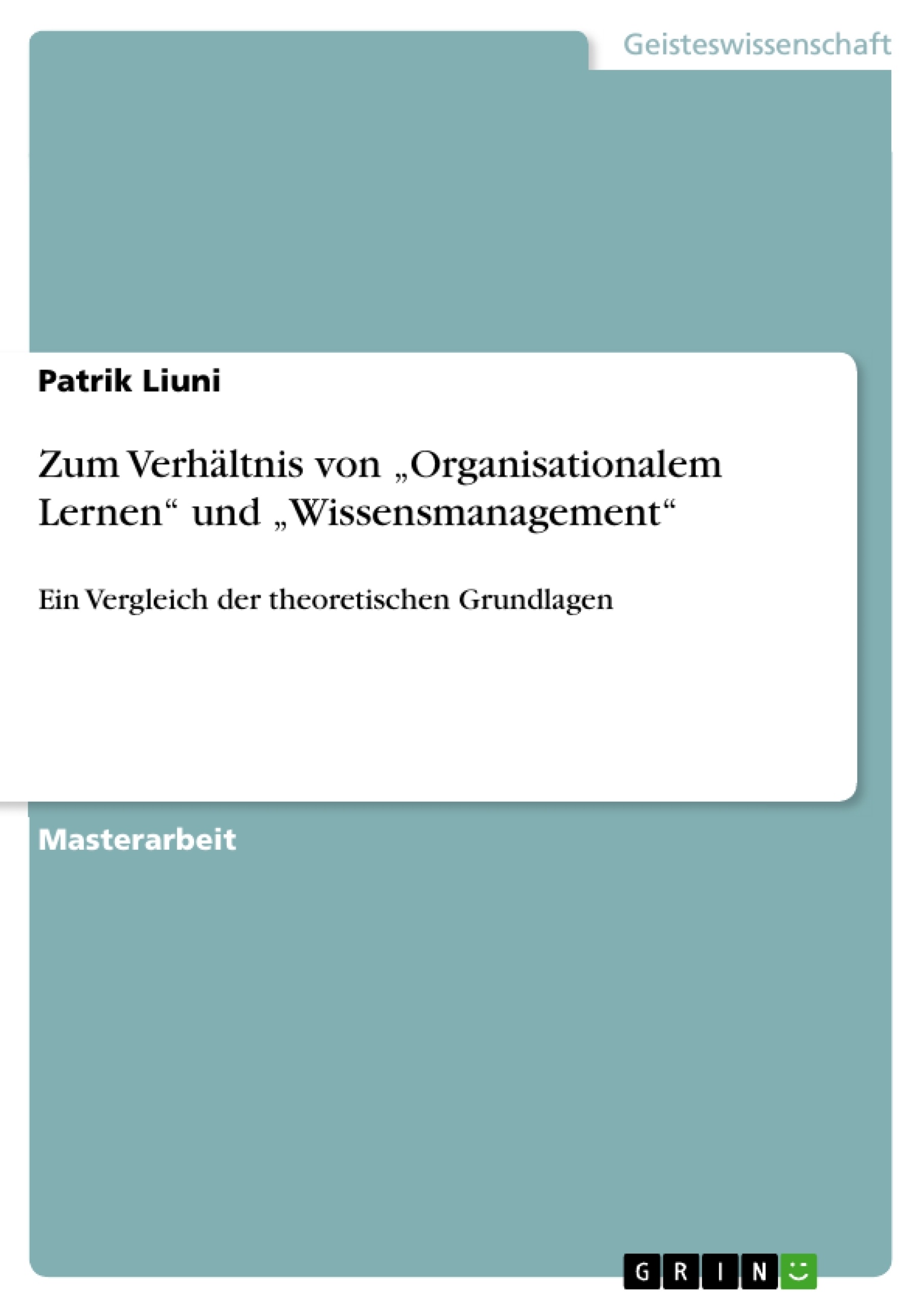

Kommentare