Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2.Erwerbsarbeit im Wandel: Vom Taylorismus zu postindustriellen Arbeitsformen
3.Subjektivierung von Arbeit
3.1 Ursachen
3.2 Merkmale
3.3 Der Arbeitskraftunternehmer
4. Personalauswahl
4.1. Eignungsdiagnostische Personalauswahl: Das Assessment Center
4.1.1 Übungen
4.1.2 Bewertungsmaßstäbe
4.1.3 Messkriterien
5 Forschungsstand Arbeitssubjektivierung
6. Methodische Vorüberlegungen
6.1 Ziel der Studie
6.2 Fragestellungen
6.3 Methodologische Positionierung
6.4 Untersuchungsmethode: Das Experteninterview
7.Durchführung der Studie
7.1 Sampling & Feldzugang
7.2 Konstruktion des Leitfadens
8. Auswertung des Materials
8.1 Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring
8.2 Das Kategoriensystem
8.3 Erläuterungen zur Erstellung derAuswertungstabelle
9.Darstellung und Diskussion der Ergebnisse
9.1 Vermarktlichung
9.2 Verbetrieblichung
9.3 Vom Unternehmen ausgehende Erwartungen
9.4 Vom Bewerber ausgehende Erwartungen
9.5 Das Assessment Center
10. Beantwortung der Forschungsfrage
10.1 Kritische Würdigung der Studie
11.Fazit & Ausblick
Literaturverzeichnis
Anhang
Anhang I: Interviewleitfaden
Anhang II: Transkriptionsregeln
Anhang III: Interviewtranskripte
Transkript 1
Transkript II
Transkript III
Anhang IV: Ablauf Modell der inhaltlichen Strukturierung
Anhang V: Auswertungstabelle
Tabellenverzeichnis
Tab. 1 DasAC im Zeitverlauf
Tab. 2 Aufwelche Dimensionen schauen Unternehmen in AC?
Tab. 3 Das Kategoriensystem
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1 Soziale Mechanismen im betrieblichen Kontext
Abb. 2 Richtung der Analyse
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1. Einleitung
„Werden Sie zur Marke- dann klappt’s auch im Job“ (Kallwitz 2015) titelt Die Welt im Februar 2015. Es sind Ratschläge wie diese, die Soziologen bestätigen wenn sie vom „Arbeitskraftunternehmer“ (Voß & Pongratz 1998) oder einem „unternehmerischen Selbst“ (Bröckling 2013) sprechen. Mit dem Zitat wird ein Individuum als Ganzes angesprochen, welches sich so formieren sollte, dass es optimal auf die Belange im Erwerbsleben ausgerichtet ist. Voß & Pongratz (1998) fassen diesen Trend zusammen und prophezeien eine „Ökonomisierung der eigenen Arbeitskraft, die immer mehr die ganze Person sowie das ganze Leben der Erwerbstätigen ergreift“ (142, Hervorhebung i. O.).
Das Verständnis von Arbeitskraft und damit auch das Verständnis von Arbeit im Allgemeinen unterlagen in den letzten Jahrzehnten einem dynamischen Wandel. Die fordistische Arbeitsorganisation zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde von den Leitbildern Frederick W. Taylors bestimmt, der nicht nur eine maximale Ausnutzung der Subjekte, sondern auch eine strikte Trennung von Person und Arbeitskraft postulierte. Dahingegen lassen sich in der postfordistischen1 Arbeitswelt konträre Trends beobachten, die mit Subjektivierungs- und Entgrenzungsprozessen zusammengefasst werden.
UnterArbeitssubjektivierung verstehtsich ein Vorgang, in dem subjektive Potenziale und Leistungen von Individuen an Bedeutung gewinnen (vgl. Moldaschl & Voß 2003: 16). Dabei offenbart Arbeitssubjektivierung einen doppelseitigen Charakter:
„Subjektivierung [bezeichnet] nicht nur dieses Bedürfnis von Menschen, über ihre fachspezifischen Kenntnisse hinaus auch ihre Persönlichkeit in den Arbeitsprozess einbringen zu können, sondern auch - und vermutlich in erster Linie die Erwartung von Unternehmen, dass diese Fähigkeiten tatsächlich eingebracht werden“ (Minssen 2012: 119.).
Unternehmen wollen also subjektivierte Potenziale im Arbeitsprozess implementieren. Was zeigt sich, wenn man einen Schritt zurückgeht und Verfahren der Personalauswahl betrachtet? Verändert sich unter dem Gesichtspunkt der Subjektivierung auch die Erwartungshaltung der Unternehmen gegenüber den Kompetenzen und Fähigkeiten der Bewerber2 ?
Klassischerweise werden im Auswahlprozess zunächst fachliche Aspekte begutachtet. Dazu werden Bewerbungsunterlagen überprüft und beispielsweise Referenzauskünfte eingeholt. Die Krux der Auswahl stellt jedoch vielmehr die überfachliche Passung dar (vgl. Jeserich 1981: 13; 21): Inwieweit passt der Bewerber zu Unternehmenskultur und informellen Strukturen? Im Zusammenhang mit dieser Frage gewann das eignungsdiagnostische3 Instrument des Assessment Centers (AC)4 vermehrte Aufmerksamkeit. Durch Fokussierung auf jenes mehrtägige Verfahren soll der Zusammenhang zwischen Personalauswahl und Arbeitssubjektivierung fokussiert werden. Dass ein solcher besteht, liegt durch die Zentralität sozialer Kompetenzen bereits auf der Hand. Der Einsatz von Tests zur Erfassung der Persönlichkeit hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen (vgl. Arbeitskreis AC 2012). Angesichts dessen kann die Fragestellung zugespitzt werden: Stellt das AC die Institutionalisierung der Arbeitssubjektivierung dar?
Aktuelle Studien verweisen auf die hohe Relevanz und Aktualität der Personalauswahl. Dem Recruiting Trend Report 20145 zufolge stellen die Themen .demografischer Wandel' und Fachkräftemangel die größten Herausforderungen der externen Personalbeschaffungen von Unternehmen dar (vgl. von Stetten et. al. 2014: 4). Analog zum steigenden Mangel an Fach- und Führungskräften schrumpft der Bewerberpool. So wächst der Druck auf Personalbeschaffer, Vakanzen passgenau zu besetzen um den Personalbestand zu sichern und Fluktuationen vorzubeugen.
Um die Herausforderungen zu bewältigen, nehmen Unternehmen zunehmend die Dienstleistung von externen Personalberatern an: Eine Studie vom Arbeitskreis für AC (2012) zeigt, dass 2001 38% der Unternehmen auf diese zurückgriffen, während es 2012 bereits 56% sind. Personalberater fungieren gewissermaßen als „Moderator“ (Hillebrecht & Peiniger: 6) zwischen Unternehmen und Bewerber. Da eine gelungene Besetzung die Reputation des Beraters sichert, muss er die beidseitigen Interessen synthetisieren. Insofern suggeriert die Personengruppe ideale Voraussetzungen um die Dichotomie der Arbeitssubjektivierung zu untersuchen. Personalberater werden von Unternehmen als Experten hinzugezogen. Die Entscheidung, Befragungen in Form von Experteninterviews durchzuführen, lag also nahe. Da die Dienstleistung der Beratung sehr kostenaufwendig ist, wird sie vordergründig in Bezug auf schwer zu besetzende und hochrangige Vakanzen in Anspruch genommen (vgl. Hillebrecht & Peiniger: 4). Daraus ergibt sich eine Fokussierung der Fragestellung im Hinblick auf hochqualifizierte Bewerber und Vakanzen, die oftmals mit Führungsverantwortung einhergehen. Das AC-Verfahren stellt einen Sammelbegriff für diverse Formen der Eignungsdiagnostik dar. Eine zentrale Unterscheidung kann zwischen internen und externen Auswahlverfahren getroffen werden. In dieser Arbeit wird sich auf AC fokussiert, in denen es um die Auswahl externer Bewerber geht6.
Bevor die empirische Studie vorgestellt wird, erfolgt im ersten Teil die theoretische Einbettung der Themen Arbeitssubjektivierung und Personalauswahl. Wird von .veränderten Erwartungen' gesprochen, impliziert das einen Wandel der Verhältnisse. Um diesen sichtbar zu machen, wird im zweiten Kapitel ein Blick auf fordistische Arbeitsmodelle geworfen. Hier wird vor allem der Frage nachgegangen, inwieweit sich Erwerbsarbeit im Laufe des 20.Jahrhunderts gewandelt hat.
Im dritten Kapitel rückt das Thema der Studie, die Subjektivierung von Arbeit, in den Fokus. Neben der Darstellung wesentlicher Merkmale geht es hier vor allem um die Herausstellung des ambivalenten Charakters. Mit der These des Arbeitskraftunternehmers (Voß & Pongratz 1998) wird ein Idealtypus der Subjektivierung vorgestellt.
Das vierte Kapitel stellt den theoretischen Rahmen der Personalauswahl dar. Um subjektivierte Potenziale im AC identifizieren zu können, bedarf es einer Beschreibung der einzelnen Übungen und Tests, die im Verfahren Anwendung finden. Um die empirische Relevanz nicht außer Acht zu lassen, zeigt Tabelle 1 wesentliche Fakten und Übungen im Zeitverlauf.
Zu Beginn des empirischen Teils wird in Kapitel fünf der Stand der Forschung dargelegt, der Defizite offenbart, an denen die Studie anschließen soll. In Kapitel 6 werden zunächst methodische Vorüberlegungen angestellt. Dabei werden grundlegende Fragen wie Erkenntnisinteresse und Forschungsfragen vorgestellt, bevor darauf aufbauend die Wahl der Untersuchungsmethode dargestellt und begründet wird.
In Kapitel sieben wird das empirische Vorgehen schließlich im Einzelnen dargelegt. Hier gehen die Auswahlkriterien der Befragungspersonen hervor, auch der Interviewleitfaden wird hier ausführlich erläutert.
Das achte Kapitel widmet sich sodann dem gewählten Auswertungsverfahren. Die Entscheidung für das Mayringsche Verfahren der qualitativen Inhaltsanalyse wird hier begründet, bevor der komplexe Ablauf schrittweise dargestellt wird.
In Rückgriff auf das in der Analyse entwickelte Kategoriensystem werden die Ergebnisse in Kapitel neun kontextuell dargelegt und erläutert.
In Kapitel zehn sollen die zu Beginn der Arbeit aufgeworfenen Forschungsfragen noch einmal aufgegriffen und explizit beantwortet werden. Inwiefern die Studie wissenschaftlichen Standards genügt, wird mithilfe spezifischer Gütekriterien geprüft. Zudem bietet sich an dieser Stelle eine allgemeine Reflektion der durchgeführten Forschung an.
Den Schlussteil stellt Kapitel elf dar, wo zentrale Erkenntnisse resümiert und in Synthese mit den Ausgangsfragen gestellt werden. Abgerundet wird der Schluss mit einem Ausblick nach Anschlussmöglichkeiten für weitere Untersuchungen.
2. Erwerbsarbeit: Vom Taylorismus zu postindustriellen Arbeitsformen
Bei der Durchsicht arbeits- und industriesoziologischer Schriften fällt die häufige Thematisierung von Wandlungsprozessen im Zuge der Erwerbsarbeit auf. Als zeitlicher Ausgangspunkt wird häufig das Zeitalter des Taylorismus festgelegt, was auch in dieserArbeit den zentralen Bezugspunkt darstellt.
Bei der Analyse von Erwerbsarbeit offenbart sich eine Transformationsproblematik: Damit ist die Transformation der Ressource Arbeitskraft in tatsächliche Arbeit gemeint. Im Gegensatz zu anderen Waren besteht der zentrale Unterschied in der Ware Arbeitskraft darin, dass diese nicht von der Person zu trennen ist. Insofern kann der Erwerbstätige also lediglich ,,künftige Arbeit verkaufen, d.h. die Verpflichtung übernehmen, eine bestimmte Arbeitsleistung zu bestimmter Zeit auszuführen. Damit aber verkauft er nicht Arbeit [...], sondern er stellt dem Kapitalisten [...] seine Arbeitskraft gegen eine bestimmte Zahlung zur Verfügung: Er vermietet resp. verkauft seine Arbeitskraft‘ (Marx 1972: 64, Hervorhebung i. O.). Dabei liegen bei beiden Parteien unterschiedliche Interessen zugrunde: Während der Arbeitgeber das Ziel einer möglichst großen Rentabilität verfolgt, ist der Arbeitnehmer an guten, stabilen Arbeitsbedingungen und hohen Lohnzahlungen interessiert. Um dieses Spannungsverhältnis zu bewältigen, verfügt das Management über Weisungsbefugnis gegenüber der Arbeitskraft (vgl. Hirsch-Kreinsen 2005: 62f). Die nachfolgende Skizzierung vom tayloristischen zum postfordistischen Zeitalter verdeutlicht unterschiedliche Handhabungen, um die Transformation sicherzustellen.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts begegnete Frederick W. Taylor dem Problem auf wissenschaftlicher Ebene und entwickelte, inspiriert von Methoden der Naturwissenschaften, ein Konzept der .wissenschaftlichen Betriebsführung' (.scientific management'). Taylors (1922) Leitidee stellt die „möglichst ökonomische Ausnutzung des Arbeiters und der Maschinen in den Vordergrund, d.h. Arbeiter und Maschinen müssen ihre höchste Ergiebigkeit, ihren höchsten Nutzeffekt erreicht haben“ (10) Um „Drückebergerei“ (ebd.: 22) der Angestellten zu vermeiden, soll eine individuelle, leistungsorientierte Entlohnung eingeführt werden, die die Motivation zur schnellstmöglichen Verrichtung der Tätigkeiten sicherstellt (vgl. ebd.: 21f). Um maximale Effizienz zu gewährleisten, soll eine strikte Trennung von Hand- und Kopfarbeit stattfinden und Arbeitsschritte in monoton-repetitiv kleine Einheiten zerlegt werden. Das größtmögliche Resultat, die „möglichst ökonomischen Ausnutzung“ (Taylor 1922: 10) der Mitarbeiter soll durch exakte Auslese und Anleitung gewährleistet werden (vgl. Minssen 2006: 28ff; Taylor 1922).
Insgesamt verfolgt das taylorische Produktionssystem die Logik der Rationalisierung, die sich über zentralisierten Arbeitsorganisation und Fremdkontrolle auch in dem Personalauswahlverfahren ausdrückt: „Bei der Auswahl der geeigneten Leuten braucht man nicht etwa nach besonderen Individualitäten zu fahnden, sondern nur [...] die paar herauszusuchen, die sich besonders für die betreffende Arbeit eignen“ (Taylor 1922: 65).
Das Konzept der wissenschaftlichen Betriebsführung diente eher als Leitbild, welches in der Realität kaum realisiert wurde. Dennoch inspirierte das Modell den Automobilhersteller Henry Ford zu ähnlichen Methoden und Prinzipien. Während Taylor jedoch die technischen Voraussetzungen der Produktionsprozesse außer Acht ließ, entwickelte Ford die Technologie der rationalen Produktion: Das Fließband. Hiermit legte er den Grundstein zu Massenproduktion und standardisierten Produktionsabläufen (vgl. ebd.: 26-30). Neben Kritik an den rigiden Prinzipien waren positive Effekte für Arbeitgeber und Arbeitnehmer zunächst unübersehbar: Dank Massenproduktion konnte der Endpreis für die Produkte gesenkt werden, was die Nachfrage auf dem Markt steigerte. Die Produktionskosten sanken, so profitierten Arbeitnehmer von steigenden Löhnen und einer Senkung der wöchentlichen Arbeitszeit (vgl. Taylor 1922: 101f; Hirsch-Kreinsen 2005: 74f). Nach dem Erfolg zu Beginn des 20. Jahrhunderts erschöpfte sich der Taylorismus im Laufe der 1970er Jahre jedoch zunehmend. Zentrales Problem stellt die starre und unflexible Massenproduktion dar, die in der Nachkriegszeit auf gesättigte Märkte, sinkende Abnehmerzahlen und zunehmenden Wettbewerb stieß (vgl. ebd.: 77f).
Diese Krisensituation war der Auftakt wissenschaftlicher Diskussionen um Organisationskonzepte von Erwerbsarbeit. Zentral ging es um die Bedeutung menschlicher Potenziale und Beziehungen im Arbeitsprozess, was hauptsächlich zwischen I960 und 1990 unter dem Titel der Humanisierung von Arbeit diskutiert wurde: Wie kann die Zufriedenheit der Arbeitskräfte gesteigert werden? Im Zuge dessen gewann das Stichwort der Autonomie besondere Aufmerksamkeit. So wurde von vielen Wissenschaftlern die Auffassung vertreten, dass Gestaltungsspielräume erhöht werden sollten, um die Sinngebung für den Einzelnen zu erhöhen (vgl. Mikl-Horke 2007: 158f; Minssen 2006: 28f).
Im Laufe der 1990er Jahre wurden zunehmend Forderungen laut, arbeitnehmerfreundlichere Strukturen im Sinne der Humanisierung von Arbeit organisatorisch zu implementieren. Ein Konzept, das Reorganisationsmaßnahmen beinhaltet, stellt das von Toyota entwickelte lean-management (deutsch: schlankes Management) dar. Das seit den 1990er Jahren auch in Deutschland populär gewordene Produktionskonzept ist ein Überbegriff für eine Vielzahl von Maßnahmen, die auf eine Ver- schlankung und somit effiziente Gestaltung der gesamten Wertschöpfungskette abzielen. Im Zuge dessen sollen sämtliche Ressourcenverschwendungen eliminiert werden. Der Fokus wird auf Kernbereiche des Unternehmens gerichtet, was häufig zur Ausgliederung von Teilbereichen führt: Das sogenannte Outsourcing wird populär. Zunehmende Dezentralisierung bedeutet die Verkürzung der Kommunikationswege, womit Hierarchieabbau und eine Erhöhung der Transparenz einhergeht. Im Gegenzug werden Verschlankungsmaßnahmen auch Personalabbau hervorrufen und die Aufstiegsmöglichkeiten der Mitarbeiter stark einschränken (vgl. Wüstner 2006: 64f). Insgesamt finden die Dezentralisierungsprozesse sowohl auf strategischer als auch auf operativer Ebene statt:
Bei der strategischen Dezentralisierung geht es um das Verlagern von Zuständigkeiten und Entscheidungskompetenzen auf niedrigere Ebenen. Um die dadurch steigende Komplexität zu bewältigen, werden neue Organisationsformen populär, bei der sich weitgehend autonome Geschäftsbereiche herausbilden7 (vgl. Minssen 2006: 112f; 132; Kühl 2004: 67).
Operationale Dezentralisierung soll die strikte Trennung zwischen Planung und Ausführung aufweichen. Es geht um das Bemühen, „operative Kontrolle, Kompetenzen, Verantwortlichkeiten aus der Hierarchie bzw. den indirekten Abteilungen und Stäben nach ,unten‘ zu den ausführend Beschäftigten bzw. in operative Einheiten zu verlagern“ (Faust et al. 1994: 23). Konkret bedeutet das die Zunahme von Gruppen- und Teamarbeiten mit der einhergehenden Abnahme von Einzelarbeiten (vgl. Kühl 2004: 68). In dem Zusammenhang wurden zunächst Qualitätszirkel populär. Mit dieser Idee nahm die Diskussion um die operationale Dezentralisierung aber nur ihren Anfang. Der langfristige Erfolg, der meist außerhalb der Arbeitszeit stattfindenden Treffen, bei denen ein spezifisches Problem fachbereichsübergreifend gelöst werden sollte, blieb aus. Gründe, die das Scheitern der Qualitätszirkel erklären, wurden vielfältig angeführt8.
Erfolgreicher stellten sich Projekt- und Gruppenarbeiten heraus, die „als typisches Element der Reorganisationswelle der neunziger Jahre gelten“ (Pongratz & Voß 2004: 33). Grund dafür ist, die zunehmende Abwendung von starren und automatisierten Produktionsweisen hin zu flexiblen Systemen (vgl. Pekruhl 2001: 81f). Während im Taylorismus kreative Potenziale von Angestellten nicht nur unberücksichtigt bleiben, sondern sogar vermieden werden sollen, kommt es zur Kehrtwende: In Team- und Gruppenarbeiten sollen diese „brachliegende[n] Potentiale“ (Minssen 2012: 82) bestmöglich abgeschöpft werden.
Im Gegensatz zu Qualitätszirkeln sind Projektgruppen vollständig in den täglichen Arbeitsprozess eingegliedert. Dabei liegt meist eine komplexe und innovative Zielvorgabe zugrunde, die mit begrenzten Ressourcen erreicht werden soll (vgl. Pekruhl 2001: 101).
Ebenso große Bedeutung kommt partizipativen Arbeitsstilen zugesprochen, die sich unter dem Label Gruppen- und Teamarbeit zusammenfassen lassen. Dabei zeichnen sich die verschiedenen Formen durch die Dauerhaftigkeit aus, wodurch sie als Form regulärerArbeitsorganisation gelten (vgl. Minssen 2006: 118f).
Insgesamt lässt sich festhalten, dass alle Formen partizipativer Arbeitsorganisation an der Grundidee eines vergrößerten Handlungsspielraumes orientiert sind. Das Management erhofft durch flexible Reaktionsmöglichkeiten und Anpassungsfähigkeit auf die organisationale Umwelt, die von Konkurrenz, Wettbewerbsschwankungen und konjunkturellen Entwicklungen geprägt ist. Dem Mitarbeiter werden herausfordernde Tätigkeiten, Weiterbildungsmöglichkeiten, Abwechslung, Sinnhaftigkeit und Autonomie versprochen (vgl. ebd.: 120). Durch Restrukturierungsmaßnahmen der Organisation und dem Abflachen der Hierarchien wächst die Aufgabenfülle der Beschäftigten. Wüstner (2006) pointiert die mit Arbeitsgruppen einhergehenden Forderungen nach Selbstkontrolle der Mitglieder. Je größer die Autonomie, desto mehr Aufwand wird ihnen bezüglich Planung, Organisation und Kontrolle von Aufgaben auferlegt. Die mit dem Wort ,Team‘ suggerierten Vorteile von Gemeinschaft und Kooperation erfordern einen hohen Preis: Die vollkommene Selbstregulation der Beschäftigten (vgl.: 65f).
Wie gelingt es dem Management, Aufgaben und Verantwortlichkeiten ,nach unten' zu verlagern, ohne dabei Aufruhr und Protesten zu begegnen? Boltanski & Chiapel- lo (2006) sind der Überzeugung, dass im postfordistischen Zeitalter ein neuer Geist des Kapitalismus geboren ist. Im Anschluss an Weber (1920), der die Entstehung des modernen Betriebskapitalismus durch die Geburt eines kapitalistischen Geistes begründet, einem Habitus, der sich geprägt von protestantischen Glaubensgrundsätzen asketisch-rational verhält, sprechen sie von der Entstehung eines neuen Geistes. Demnach gelingen die Verantwortungsverlagerungen, weil dem Handeln der Organisationsmitglieder eine Vision obliegt. So wird eine gemeinsame Zielvereinbarung, eine Vision kreiert, die dem Beschäftigten die Sinnhaftigkeit der Arbeit verdeutlicht: „Diese Vision hat dieselben Vorzüge wie der Geist des Kapitalismus, weil sie die Einsatzbereitschaft der Arbeiter ohne Gewalteinsatz gewährleistet [...] Dank dieses gemeinsamen Sinns, dem alle beipflichten, weiß jeder, was er zu tun hat, ohne dass man es ihm eigens sagen müsste“ (Boltaski & Chiapello 2006: 115).
Während die Antwort auf das Transformationsproblem im tayloristischen Produktionsmodell rigide Kontrolle, Fremdbestimmung und Standardisierung der Abläufe lautete, zeigt sich hier im Postfordismus ein konträres Bild: Zum einen ermöglichen die partizipativen Arbeitsformen eine flexible Anpassung der Organisation an ökonomische Verhältnisse und zum anderen werden Verantwortlichkeiten des Managements, Planung, Organisation und Kontrolle, zunehmend auf die Beschäftigten übertragen. Das Transformationsproblem wird also weniger gelöst als vielmehr verschoben: „die Rolle der Arbeitskräfte im Betrieb [wandelt sich] vom Objekt einer tay- loristisch orientierten Rationalisierung zum Subjekt, das Rationalisierung in Eigenregie betreibt“ (Hirsch-Kreinsen 2005: 79).
3. Subjektivierung von Arbeit
Die ,neue‘ Rolle der Beschäftigten im posttayloristischen, hochentwickelten, westlichen Arbeitssystem ist nach Baethge (1991) durch eine „normative Subjektivierung von Arbeit“ (6) gekennzeichnet. Davon muss der Begriff der ,Subjektivität‘ abgegrenzt werden: Während dieser eine „einseitige Relationierung, die [...] Verhältnisse der Person zu sich selbst und zu anderen in den Blick nimmt“, bezieht sich „‘Subjektivierung' auf Wechselverhältnisse zwischen Person und Betrieb“ (Kleemann, Matu- schek, Voß 1999: 2, Hervorhebungen i. O.). Während Subjektivierung9 im idealtypisch konstruierten Taylorismus als Störpotenzial identifiziert wurde, gilt es nun als wertvolle Ressource, auf die aktiv zurückgegriffen wird (vgl. Moldaschl & Sauer 2000: 216). Baethge (1991) definiert die normative Subjektivierung von Arbeit als Prozess, der sich insofern auf das Bewusstsein des Beschäftigten auswirkt, als dass diese veränderte Ansprüche an die Arbeit stellen (vgl.: 6f). Subjektivierung beschreibt ein verändertes Verhältnis zwischen Erwerbstätigem und Betrieb, beziehungsweise einen veränderten Stellenwert von menschlichen und individuellen Aspekten im Arbeitsprozess. Baethges Definition wurde im Laufe der Jahre von zahlreichen Autoren10 um einen elementaren Aspekt ergänzt, sodass von einer doppelten, wechselseitigen Subjektivierung gesprochen wird. So etwa Minssen (2012):
„Mittlerweile aber bezeichnet Subjektivierung nicht nur dieses Bedürfnis von Menschen, über ihre fachspezifischen Kenntnisse hinaus auch ihre Persönlichkeit in den Arbeitsprozess einbringen zu können, sondern auch - und vermutlich in erster Linie - die Erwartung von Unternehmen, dass diese Fähigkeiten tatsächlich eingebracht werden“ (119).
Die dichotome Subjektivierung zeichnet sich also dadurch aus, dass sie sowohl von Seite des Beschäftigten als auch von Seite des Betriebes ausgeht. Weder Ausgangspunkt noch Wirkungsrichtung gehen eindeutig hervor.
Um das komplexe, vielschichtige Phänomen der Subjektivierung zu strukturieren, unternehmen Kleemann, Matuschek & Voss (1999) den Versuch einer Konzeptuali- sierung. Dabei unterscheiden sie zwei Hauptkategorien, in die sie jeweils zwei Formen von Subjektivität einordnen. Während sich die erste Kategorie eher auf das praktische, reaktive Handeln der Beschäftigten bezieht, kann die zweite Kategorie eher auf diskursiver Ebene eingeordnet werden.
Innerhalb der ersten wird zwischen einer .kompensatorischen' und einer .strukturierenden' Subjektivität unterschieden (vgl. ebd. 1999: 32f) Mit kompensatorischer Subjektivität ist das reaktive Verhalten der Beschäftigten als Reaktion auf einen gegebenen, formalen Arbeitsprozess gemeint (vgl. Kleemann, Matuschek, Voß 2003: 89).
Strukturierende Subjektivität hingegen bezieht sich eher auf eine gegebene Struktur, einen Handlungsrahmen, mit dem sich der Beschäftigte, auch im Hinblick auf die alltägliche Lebensführung, revanchieren muss. Insofern geht es hier um die Aktivierung des Beschäftigten im Sinne einer selbstständig organisierten Arbeitsweise (vgl. ebd.: 89).
Die reklamierende Subjektivität setzt bei dem Beschäftigten an und betont - im Sinne Baethges (1991) - deren subjektive Ansprüche an Arbeit, verbunden mit der Erwartung, jene auch aktiv einbringen zu dürfen (vgl. ebd.: 90).
Die ideologisierende Subjektivität begründet sich darin, dass der Beschäftigten mit „diskursiv bzw. kulturell vermittelte[n] Sinn-Strukturen“ (ebd.: 91) in Bezug auf Arbeit konfrontiert ist, die er mittlerweile internalisiert hat. Vereinfacht lässt sich von normativen Anforderungen an Arbeit sprechen (vgl. ebd.: 91).
Die Kategorisierung zeigt den Doppelcharakter der Subjektivierung von Arbeit in differenzierter Form: Auf der einen Seite handelt der Beschäftigte reaktiv- folgt damit also den von Seiten des Betriebs ausgehenden funktionalen Vorgaben - den Erwartungen des Betriebs. Auf der anderen Seite ist der Beschäftigte aktiv an der Neustrukturierung beteiligt, indem er veränderte, höhere Ansprüche an die Arbeit stellt.
3.1 Ursachen
Die Gründe der zunehmenden Subjektivierung im Bereich von Arbeit scheinen in Anbetracht des Wandels auf der Hand zu liegen: Die gänzliche „Umkehrung der bisherigen Rationalisierungslogik“ (Moldaschl & Sauer 2000: 216, Hervorhebung i. O.) ist Ergebnis komplexer Restrukturierungs- und Dezentralisierungsprozesse, bei denen die menschliche Arbeitskraft als Ressource betrachtet wird, die es auszunutzen gilt. Rastetter (2008) spricht von einem „Disziplinierungsprozess [...], in dem Menschen zu brauchbaren Organisationsmitgliedern gemacht werden“ (107).
Baethge (1991) verweist auf weitere Wandlungsprozesse: Der Anstieg der Erwerbstätigkeit von Frauen und die „Ausdehnung vorberuflicher Sozialisation“ (12), die sich im Zuge der Wissensgesellschaft manifestierte, spielen ebenso eine Rolle wie die Erosion hochdifferenzierter Arbeitsteilung zugunsten komplexer Arbeitsschritte (vgl. ebd.: 12).
Spinnt man Baethges Gedanken weiter und sucht nach Gründen für die Subjektivierung von Arbeit außerhalb von Erwerbsphäre, stößt man auf soziokulturelle Wandlungsprozesse, wie etwa der Theorie des kulturellen Wandels von Inglehart (1989). In den 1970er Jahren hinterfragt der US-Amerikaner den Stellenwert von Arbeit, der bisher stets als fundamental hingenommen wurde (vgl. Mikl-Horke 2007: 378). In Rückgriff auf die Maslowsche Bedürfnispyramide11 unterteilt er materialistische und postmaterialistische Werte. Erstere umfassen fundamentale physiologische Bedürfnisse sowie Sicherheitsbedürfnisse. Mit postmaterialistischen Werten sind Soziale - Bedürfnisse, Ich-Bedürfnisse und das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung gemeint. Ingleharts (1989) These besagt, dass materialistische Werte durch Wohlstand und Sicherheit selbstverständlich geworden sind, wohingegen postmaterielle, individuelle Bedürfnisse wie „Gruppenzugehörigkeit, Selbstverwirklichung und Lebensqualität“ (ebd.: 90) in den Vordergrund getreten sind (vgl. ebd.: 90).
Subjektivierung von Arbeit könnte nun als logische Konsequenz der Werteverschiebung auf Ebene der Erwerbsarbeit interpretiert werden und damit eine Antwort auf die „Forderungen nach ‘Mündigkeit' der Bürger, nach Selbstbestimmung“ (Mikl- Horke 2007: 379) darstellen: Postmaterialistische Werte werden dank der Subjektivierung gewissermaßen in den Binnenkontext der Erwerbssphäre internalisiert (vgl. Boltanski & Chiapello 2006: 142f). Auch Voß & Pongratz (1998) unterstreichen, dass Arbeitnehmer, geprägt durch Wertewandel, neue Anforderungen an ihre Arbeit in Bezug aufSelbstbestimmung und Sinnhaftigkeit mit sich bringen (vgl.: 135).
Eine weitere Theorie, die den veränderten Stellenwert individueller Subjektivität hervorhebt, stellt die von Beck & Beck-Gernsheim (1994) ausgeführte Individualisierung der modernen Gesellschaft dar. Den Autoren zufolge ist unter Individualisierung ein Prozess zu verstehen, der sich durch Erosion vorgegebener Strukturen kennzeichnet dies, lässt sich in diversen Bereichen, wie Familienbildern, Geschlechterrollen oderauch einzelnen Biografien beobachten. Infolge dieser fragiler werdenden Struk- turen, fallen konkrete normative Handlungsanforderungen zunehmend weg. Das Individuum wird also aktiviert, da es nun selbstständig für die Herstellung von Strukturen verantwortlich ist (vgl.: 11f). Subjektivierung von Arbeit beschreibt genau diesen Prozess der Loslösung bürokratischer und standardisierter Vorgaben. Subjektivierung und Individualisierung gehen dementsprechend miteinander einher, wodurch sie auch ihren ambivalenten Charakter teilen. So wird auch hier betont, dass Individualisierungsprozesse eine „aktive Eigenleistung der Individuen nicht nur erlauben, sondern fordern“ (ebd.: 14).
3.2 Merkmale
Aus den skizzierten Ausführungen lässt sich eine Verschiebung der arbeitsbezogenen Handlungsräume und Verantwortlichkeiten festhalten.
Wie wirkt sich die Reorganisation von Arbeit auf den konkreten Arbeitsprozess aus? Im Raum stehen etliche Begriffe, die oftmals einen ambivalenten Charakter offenbaren:
Ein Merkmal, das die Arbeitssubjektivierung beschreibt ist (1) Autonomie. Frey et. al. (2010) sprechen von einer „Krise des Autonomiebegriffes“ (191), die sie insofern begründet sehen, als dass genau darauf reagiert, genau das umgesetzt wurde, was im Taylorismus vehement gefordert wurde: Dezentralisierung und Abflachung der Hierarchien. Die stark ausdifferenzierte Arbeitsteilung wich zugunsten größerer Handlungsspielräume, wodurch sich die Arbeit wissensintensiver, sinnhafter und personenbezogener gestaltet. Eingeführt wurden neue Formen der Arbeitsorganisation und dementsprechend angepasste Arbeitszeitmodelle, sodass sich von einer flexiblen Arbeitsstrukturierung sprechen lässt (vgl. ebd.: 191).
Und dennoch: „Die daran geknüpften positiven Erwartungen - wie z.B. der Abbau von Belastung und Restriktivität - sind [...] nur in sehr eingeschränktem Maße eingetreten“ (ebd.: 191). Vielmehr betonen Frey et. al. (2010), dass sich im Gegenteil eine neue Dimension prekärer Arbeitsbedingungen, verbunden mit zunehmenden Strapazen, herausgebildet hat (vgl. ebd.: 191f). Auf der einen Seite bringt Autonomie positiv konnotierte Auswirkungen wie einen vergrößerten Handlungsspielraum mit, sodass Selbst- statt Fremdbestimmung zunimmt. Auf der anderen Seite betonen Moldaschl & Sauer (2000) die damit einhergehende Bedeutung von Kontrolle und Herrschaft: Der stets bestehende Interessenskonflikt zwischen Organisation und Beschäftigten zwingt die Arbeitgeber, Bedingungen zu schaffen, die die Folgsamkeit und gewissermaßen Unterwerfung der Beschäftigten sicherstellt (vgl.: 213ff). Dies nutzt dem Arbeitgeber in doppelter Hinsicht: „Leidenschaft und Leis-tungsbereitschaft mobilisieren, teure Kontrollsysteme durch kostenlose und effektive Selbstkontrolle substituieren, Herrschaft durch Selbstbeherrschung virtualisieren und Planung durch Improvisation flexibilisieren. Kurz, sie [die Re-Subjektivierung] soll die Person mit der Arbeitskraft: vereinen“ (vgl. ebd.: 216, Hervorhebung i. O.).
Was bringt das strategische Vorgehen des Managements, die Vergrößerung der Autonomie mit sich? Auf der einen Seite birgt es positive Auswirkungen für den Beschäftigten: Wie Moldaschl & Sauer (2000) betonen, darf er nun ,,Leidenschaft‘ (216, Hervorhebung i. O.) in den Arbeitsprozess einbringen. Eigene Interessen, Ideen und Potenziale finden somit einen (Frei)-Raum, wodurch Mitarbeiter die Chance zur Selbstverwirklichung in der Sphäre der Arbeit bekommen (vgl. Kleemann, Matuschek, Voß 1999: 13).
Auf der anderen Seite, das geht aus dem oben genannten Zitat von Minssen (2012) hervor, darf der Mitarbeiter nicht nur eigene Interessen, Fähigkeiten einbringen, die neue Arbeitsgestaltung verlangt es von ihm- er muss es gewissermaßen. Kleemann, Matuschek & Voß (1999) bezeichnen die Ausnutzung subjektiver Potenziale als eine „.Ausbeutung' von Tiefenschichten der Person“ (13, Hervorhebung i. O.).
3.3 Der Arbeitskraftunternehmer
Inwiefern beeinflusst die Autonomiezunahme das Arbeitshandeln der Beschäftigten? Mit dem Begriff des .Arbeitskraftunternehmers' starten Voß & Pongratz (1998) eine Debatte um einen neuen Typus von Arbeitskraft, der den „verberuflichten Arbeitnehmer“ (131) ablösen sollte. Ihren Ansichten zufolge verändert sich die Beziehung von Arbeitskraft und Organisation insofern, als der Beschäftigte seine eigene Arbeitskraft wie ein Unternehmen zu verwalten hat (vgl.: 131). Um den Arbeitskraftunternehmer zu charakterisieren, führen die Autoren die Merkmale .Selbstkontrolle', .Selbstökonomisierung' und .Verbetrieblichung der Lebensführung' ein (vgl. ebd.: 131).
3.3.1 Selbstkontrolle
Die erweiterte Selbstkontrolle, die den Beschäftigten abverlangt wird, resultiert aus dem vergrößertem Gestaltungsspielraum und den damit verbundenen Selbststeue- rungs- und Selbstorganisationsaufgaben.
Voß & Pongratz (1998) unterschieden sechs Aspekte, die der Selbststrukturierungsaufgabezugrunde liegen (vgl. ebd.: 140f):
1) zeitliche Strukturierung: flexibilisierte Arbeitszeitmodelle erfordern die Eigenstrukturierungsleistung der Beschäftigten.
2) räumliche Strukturierung: zunehmende Mobilitäts- und Technologisierungspro- zesse weichen den einst kausalen Zusammenhang zwischen physischem Raum und Arbeit immer weiter auf.
3) wechselseitige Kontrolle der Beschäftigten: Mit projekt-und gruppenförmigem Arbeiten geht eine Dichte von Interaktionsprozessen einher, die die einstige Steuerungsaufgabe des Managements zunehmend übernimmt.
4) Flexibilität: Um den Flexibilitätsanforderungen des Unternehmens gerecht zu werden, sollen Beschäftigte in Bezug auf den Arbeitsort sowie auf den Einsatzbereich flexibel sein.
5) Eigenmotivation: Um die erweiterten Selbstorganisationsanforderungen zu erfüllen, obliegt die Fähigkeit der Sinngebung und der damit einhergehenden Triebkraft dem Beschäftigten.
6) technologische Erreichbarkeit: Durch technologische Durchdringung der Arbeitswelt wird die technische Ausstattung auch im Privatleben der Beschäftigten vorausgesetzt.
Insgesamt kann die Ablösung von Fremd- durch Selbstkontrolle in vielen Bereichen festgestellt werden. Diese bezieht sich auf Strukturierungsaufgaben an den Beschäftigten vor allem hinsichtlich Zeit, Ort, Gestaltung, Qualifikation, Motivation sowie Technologie. Die Kontrolle durch das Management erfolgt indirekt durch eine „deutliche [...] Erhöhung der quantitativen und qualitativen Leistungsanforderungen sowie einer Verschärfung der Arbeitsbedingungen (Zeitdruck, Ausdünnung der Personaldecke, Kürzung von Ressourcen, Reduzierung von Sozialleistungen und Einkommen u.v.a.m.)“ (ebd.: 139). Die Steuerung des Managements kann dementsprechend als Rahmen betrachtet werden, der nach dem Motto ,So wenig wie möglich, so viel wie nötig' konstruiert wurde.
3.3.2 Selbstökonomisierung & Selbstrationalisierung
Unter der ,Ökonomisierung von Arbeitskraft' wird die zunehmende Wahrnehmung und Verwertung der individuellen Arbeitskraft als Ressource, Kapital und .„Vermögen'“ (Voß & Pongratz 1998: 142, Hervorhebung i. O.) verstanden. Dabei beschränkt sich Ökonomisierung nicht allein auf die Sphäre der Arbeit, sondern umfasst zunehmend die „ganze Person der Erwerbstätigen“ (ebd.: 142). Dabei wird das Subjekt dazu aufgefordert, Arbeitsvermögen und Arbeitskraft aktiv zu vermarkten (vgl. ebd.: 142). Gewissermaßen als Folge dieser Selbstrationalisierung kann die „Verbetrieblichung der alltäglichen Lebensführung“ (ebd.: 131) beobachtet werden. Sofern die Beschäftigten sich als .ganze Person' ökonomisieren, führt dies zu einer „immer mehr [...] aktiv zweckgerichteten, letztlich alle Lebensbereiche umfassende sowie alle individuellen Ressourcen gezielt nutzende systematische Organisation des gesamten Lebenszusammenhangs“ (ebd.: 143, Hervorhebung i. O.).
Die einst mit der Arbeitsebene assoziierten Postulate Kontrolle, Ökonomisierung und Rationalisierung werden transformieren - Insofern, dass sie auf den Beschäftigten selber übertragen werden, wobei überspitzt von einer Selbstversklavung gesprochen werden kann und auch dort hingehend, dass sie über die ökonomische Sphäre hinaus sämtliche Bereiche der Lebensführung durchdringen. Das Ziel bleibt jedoch auf der ökonomischen Ebene verankert: Die optimale Vermarktung der eigenen Arbeitskraft12.
Wird der Lebensverlauf durchrationalisiert und so zum Betrieb gemacht, lässt sich auf eine Auflösung oder zumindest eine Verschwimmung der Grenze zwischen ökonomischer und privater Sphäre schließen. Diese „Entgrenzung“ (Minssen 2012: 59) von Arbeit und Leben wird durch den Einsatz digitaler Medien wie Mobiltelefon und Laptop ermöglicht und zunehmend forciert (vgl. ebd.: 110). Das Phänomen lässt sich als Folge subjektivierten Arbeitshandelns verstehen, da „handlungsstabilisierende Orientierungen“ (Kleemann, Matuschek, Voß 1999: 16) durch rigide Vorgaben hinsichtlich organisationaler, zeitlicher und räumlicher Strukturierungen wegfallen. Von dem Individuum werden also neuartige Aufgaben und Kompetenzen abverlangt und die Selbststeuerungsaufgaben, wie sie von Pongratz & Voß (2003) beschrieben werden, gewinnen an elementarer Bedeutung.
Nun gilt es nicht zu vergessen, dass es sich bei dem Arbeitskraftunternehmer um einen Idealtypus handelt, dessen empirische Überprüfung Pongratz & Voß (2003) erst einige Jahre später durchführten. Ein zentrales Ergebnis ist, dass mit dem Arbeitskraftunternehmer nicht von einer „neuen Grundform der Ware Arbeitskraft“ (Voß & Pongratz 1998: 131) im Sinne einer Ersetzung gesprochen werden kann. Stattdessen revidieren die Autoren ihre Aussage von 1998 und gehen nun von einer „Parallelität der Typen des verberuflichten Arbeitnehmers und des Arbeitskraftunternehmers aus, wobei sich noch erweisen muß [sic!], für welche Aufgaben und in welchen Erwerbsbereichen sich welcher Typus behauptet (Pongratz & Voß 2004a: 242, Hervorhebung i. O.). Bröckling (2013) ergänzt, dass sich die Charakteristika des Arbeitskraftunternehmer „insbesondere in zukunftsträchtigen Erwerbsfeldern wie der Informations- und Kommunikationstechnologiebranche, im Weiterbildungs- und Beratungssektor und den Unternehmen der New Economy nachweisen, während in anderen Segmenten [...] weiterhin der Typus des verberuflichten Arbeitnehmers vorherrscht“ (49).
4. Personalauswahl
Im 19. Jahrhundert stellten technologische Innovationen den Nährboden für betriebliche Wandlungsprozesse dar (siehe Kapitel zwei). Spätestens seit den 1980er Jahren lässt sich die zunehmende Relevanz eines weiteren Produktionsfaktors nicht leugnen: Des Humankapitals (vgl. Achouri 2007: 3): „Denn insbesondere in der Motivation eines Mitarbeiters lag nun der größte verbleibende Hebel zur Produktivitätssteigerung“ (ebd.: 2007: 3).
Angesichts des dargestellten Wandels von Arbeit liegt eine Veränderung der Personalauswahlverfahren auf der Hand: Während bei Taylor (1972) die Herausbildung eines leistungsfähigen Arbeiterstamms im Vordergrund stand, gewinnen im 21. Jahrhundert subjektive, individuelle Potenziale an Bedeutung. Klassische Auswahlverfahren, die nur aus Interviews und Vorgesetztenbeurteilung bestehen, sind nicht mehr zeitgemäß und müssen angepasstwerden (vgl. Jeserich 1981: 13).
Als ein Element des Personalmanagements hat die Personalauswahl die Funktion „aus dem Kreis der Bewerber jene herauszufinden, die für die zu besetzende Stelle am besten geeignet sind“ (Kossbiel 2002: 498). Nachdem auf der ersten Stufe eine Vorauswahl der Bewerber nach Begutachtung der Unterlagen stattfindet, warten auf der zweiten Stufe weitere Prüfungen auf den Bewerber, die zur Identifikation der passenden Kandidaten dienen sollen (vgl. ebd.: 498). Jeserich (1981) betont, dass das Problem bei derAuswahl nicht in der Einschätzung der fachlichen Eignung liegt. Die Herausforderung besteht vielmehr bei der Sicherstellung der überfachlichen Passung (vgl.: 21).
4.1. Eignungsdiagnostische Personalauswahl: Das Assessment Center
Ein Verfahren zur Feststellung der überfachlichen Fähigkeiten stellt das AC dar. Nach Sarges (2001) können AC als Prüfverfahren charakterisiert werden, die meist in Gruppen13 stattfinden. Dabei werden die in der Regel acht bis zehn Teilnehmer vor vielfältige Aufgaben gestellt, wobei sie von meist vier bis sechs Beobachtern bewertet werden (vgl.: VII). Die Besonderheit des Prozesses ist die Zentralisierung überfachlicher Kompetenzen. Diese spielen insbesondere bei hochqualifizierten Mitarbeitern und Führungskräften eine große Rolle (vgl. Obermann 2013: 1). Das Einsatzgebiet von AC ist vielfältig: Steht die Entwicklung der Kandidaten im Vordergrund und sollen deren Kompetenzen eingeschätzt werden, handelt es sich um ein „Entwicklungs-AC“ (vgl. Sarges 2001: VII). Demgegenüber steht das „Auswahl-AC“ (ebd.: VII), dass zur Auswahl passender Kandidaten dient und dafür die Einschätzung der Potenziale ermöglicht14 (vgl. ebd.: VII).
Insbesondere in psychologischen und betriebswirtschaftlichen Disziplinen spricht man vom AC als eignungsdiagnostisches Instrument, da sowohl die Funktion der „Einschätzung von derzeitigen Management - (bzw. Führungs-) Kompetenzen (= Diagnose)“ (ebd.: VII, Hervorhebung i.O.) als auch die Aufgabe der „Potenzialleinschätzung] (= Prognose) bei Problemen der Auswahl von Kandidaten“ (ebd.: VII) erfüllt wird.
Bei der Konzeption eines AC ist zunächst die Entwicklung eines Anforderungsprofils notwendig. Dieses hält zum einen fest, welche Anforderungen mit der Stelle verbunden sind (situativer Ansatz) und zum anderen werden Kompetenzen und Eigenschaften herausgearbeitet, die für die Erfüllung der Anforderungen idealerweise vorhanden sein sollten (personaler Ansatz). Während die Anforderungen die Basis für die Konzeption der Übungen darstellen, bilden die wünschenswerten Kompetenzen die Kriterien, nach denen die Beurteilung vollzogen wird (vgl. Obermann 2013: 54).
Die ersten deutschen Wurzeln der heutigen AC lassen sich bis in die Weimarer Republik 1926/1927 zurückverfolgen. Damals suchten Vertreter der Reichswehr in Zusammenarbeit mit der Universität Berlin nach einer Methode, die die Auswahl der Offiziere nach einer ganzheitlichen Prüfung ermöglichte. Bei einer Gegenüberstellung der AC aus dem Jahre 1930 mit denen aus den 2000ern zeigen sich beachtliche Übereinstimmungen in der Konzeption der Übungen und der Grundidee. Das Kernstück ist also die letzten Jahrzehnte hindurch relativ stabil geblieben (vgl. Obermann 2013: 23-26).
Im Jahre 1969 schließlich hielten AC Einzug in der deutschen Wirtschaft15. Nachdem das erste AC bei dem Unternehmen ,ITB‘ durchgeführt wurde, stieg die Popularität kontinuierlich (vgl. Arbeitskreis AC 2008).
Wie kommt es, dass sich die eignungsdiagnostischen Instrumente ausgerechnet Ende der 60er Jahre etablierten? Dieser Frage verfolgt Jeserich (1988), indem er gesellschaftlichen und sozialen Rahmenbedingungen auf den Grund geht. Er stellte fest, dass die Selektionsfunktion damals häufig Institutionen oblag. So waren zum Beispiel Studentenverbindungen, Universitäten oder Wehrdienst entscheidend bei der Auswahl bestimmter Personen. Im Zuge der Diskussion um die Leistungsgesellschaft ging diese institutionelle Vorauswahlfunktion zunehmend zurück, sodass insbesondere ältere Führungskräfte nach institutionseigenen Auswahlverfahren verlangten (vgl.: 16f). Dazu kommt die Tatsache, dass der wirtschaftliche Aufschwung Mitte der 1970er Jahren stagnierte, womit das Ende der Vollbeschäftigung eingeläutet wurde. Angesichts der kritischen wirtschaftlichen Situation, die durch neue Gesetze wie Mutter- oder Kündigungsschutzgesetz noch verstärkt wurde, standen Unternehmen mehr denn je vor der Aufgabe, kostspielige Fehlbesetzungen zu verhindern (vgl. ebd.: 17f).
Der Arbeitskreis AC hat in den letzten Jahren Studien zu AC durchgeführt. Tabelle 1 zeigt ausgewählte Ergebnisse aus den Jahren 2001, 2008 und 2012 im Überblick (vgl. Arbeitskreis AC 2001; 2008: 12)16:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 1: Das AC im Zeitverlauf (eigene Darstellung nach Arbeitskreis AC 2012: 9f)
Tabelle 1 zeigt die zunehmende Popularität von AC seit Beginn des 21. Jahrhunderts und stellt wichtige Eckdaten vor.. Bevor jedoch näher auf Verbreitung und Charakteristika eingegangen wird, sollen zunächst die Inhalte der Verfahren beleuchtet werden.
4.1.1 Übungen
Wie aus Tabelle 1 hervorgeht, sind die beliebtesten Übungen in AC Präsentationen, Interviews, Fallstudien, Gruppendiskussionen, Persönlichkeitstests und Postkorbübungen.
Bei Präsentationen werden die Teilnehmer dazu aufgefordert, ein vorgegebenes Thema zunächst vorzubereiten und schließlich vor der Gruppe zu präsentieren. Mögliche Themen sind hier beispielsweise die Vorstellung des Lebenslaufs oder die Analyse eines Verkaufsgespräches (vgl. Obermann 2013: 120).17
Bereits Jeserich (1981) betont die elementare Bedeutung von Interviews (bekannter als Vorstellungsgespräche) (vgl.: 23). Sie stehen meist am Anfang des Auswahlprozesses und thematisieren unter anderem die Lebensläufe der Bewerber und die Vorstellung des Unternehmens sowie des vakanten Stellenprofils (vgl. Achouri 2007: 15f)
Fallstudien fordern Bewerber dazu auf, vorgegebene Problemstellungen eigenständig zu bearbeiten. So erfordern die Aufgaben zum Beispiel Reorganisations,- oder Optimierungsmaßnahmen. Durch die selbstständige Bearbeitung wird jedoch nur die letztendliche Lösung kommuniziert, was Rückschlüsse auf Lösungswege unberücksichtigt lässt - insbesondere bei unbefriedigenden Ergebnissen gehen hier wichtige Informationen über die Schwierigkeiten oder Probleme des Kandidaten verloren (vgl. Obermann 2013: 126f). Dennoch zeigt Tabelle 1, dass Fallstudien im Verlauf der Jahre an Beliebtheit dazugewonnen haben (2001: 64%; 2012: 73%).
„Gruppendiskussionen bilden traditionell den Kern des AC, sie zeigen das wichtige Vorgehen des Einzelnen in Teamarbeitssituationen, seine Fähigkeit, sich in eine Gruppe zu integrieren, und gleichzeitig seinen Willen, eigene Impulse [...] zu setzen“ (ebd.: 108f, Hervorhebung A.S.). Gruppendiskussionen gehören zwar nach wie vorzu den klassischen Bestandteilen in AC, verlieren jedoch deutlich an Bedeutung: Während sie 2001 noch in 95% eingesetzt wurden, sind es 2012 nur noch 61% (siehe Tabelle 1) Diese Zahlen lassen auf die rege methodische Diskussion schließen: Obermann (2013) betont, dass die wesentlichen Vorzüge in der einfachen und günstigen Konzeption der Instruktionstexte sowie im möglichen Direktvergleich der Kandidaten liegen. Kritisch zu bewerten ist allerdings die geringe Validität, die auf die Kopplung der individuellen Leistungen an die allgemeine Zusammensetzung der Gruppe zurückzuführen ist (vgl.: 110).
Die Postkorbübung stellt die Teilnehmer vor die Aufgabe, diverse Schriftstücke aus einem Posteingang zu bearbeiten. Oftmals geht es dabei um Analyse oder Koordinationsaufgaben. Dabei werden Drucksituationen (oft zeitlicher Art) geschaffen, die zur Erschwerung der Situation beitragen (vgl. ebd.: 131f).
Ein weiteres populäres Element klassischer AC-Verfahren sind psychologische Verfahren. Darunter fallen Intelligenz-, Leistungs- und Persönlichkeitstests, dabei genießen Letztere besondere Beliebtheit: Der Einsatz hat sich von 16% in 2001 auf 43% im Jahre 2012 erhöht (siehe Tabelle 1) (vgl. Obermann 2013: 149). Die Tests zur Messung typischer Verhaltensweisen werden vorwiegend mithilfe von Fragebögen durchgeführt, in denen der Kandidat zur Selbsteinschätzung aufgerufen wird (vgl. Hossiep 2001: 56). Dabei wird sich bei der Konzeption der Fragebögen meist an dem Big Five der Persönlichkeit18 orientiert (vgl. Obermann 2013: 159). Die Messung der individuellen, typischen Eigenschaften einer Person fasst Obermann (2013) folgendermaßen zusammen: „Im AC sehen wir, was jemand in bestimmten Situationen tut. Mit dem Persönlichkeitstest sehen wir, warum jemand dies tut“ (152, Hervorhebung A.S.).
Dass dieser Prozess, des ,gläsern-machen‘ der Bewerber viel diskutiert ist, liegt auf der Hand: Die Nutzen der Verfahren liegen hauptsächlich in der guten Vergleichbarkeit bei derAuswertung. Diese ergibt sich dadurch, dass vorher festgelegte Kriterien unmittelbar eingesetzt werden und somit frei von subjektiven Einflüssen sind (vgl. ebd.: 152). Es bleibt die Frage, inwiefern die Fragebögen das Ergebnis sozialer Er- wünschtheit abbilden. Obermann (2013) vertritt hier die Auffassung: „Jeder schummelt bei einzelnen Antworten [...], niemand kann jedoch ein Profil - also die relativen Unterschiede zwischen einzelnen Dimensionen - gezielt manipulieren (152).
4.1.2 Bewertungsmaßstäbe
Auch wenn sich die Bewertungsdimensionen je nach Anforderungsprofil unterscheiden, lassen sich einige gemeinsame Kriterien festhalten. Der Arbeitskreis für AC (2012) geht in seiner Studie der Frage nach, auf welche Dimensionen im AC Wert gelegt wird. Die Ergebnisse für die Jahre 2001, 2008 und 2012 fasst Tabelle 2 zusammen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 2: Auf welche Dimensionen schauen Unternehmen in AC? (eigene Darstellung nach Arbeitskreis AC 2012)
Tabelle 2 zeigt, inwiefern soziale Kompetenzen, häufig als ,Soft Skills' bezeichnet, bei der Beurteilung der Kandidaten eine Rolle spielen. Die am häufigsten genannten Kriterien wie Kommunikationsfähigkeit, Durchsetzungs- und Überzeugungskraft sowie Analysefähigkeit weisen im Zeitverlauf eine große Konstanz auf. Bei der Betrachtung der anderen Dimensionen zeigt sich, dass diese 2001 oftmals den höchsten Wert erreichen: Von den 23 Dimensionen ist bei 20 ein tendenzieller Rückgang der Relevanz von 2001 bis 2012 zu beobachten. Lediglich Kommunikations- und Delegationsfähigkeit sowie Fachwissen gewinnen im Laufe der Zeit leicht an Bedeutung. Die deutlichsten Abnahmen der Werte von 2001 bis 2012 zeigen die Kriterien Kooperationsfähigkeit (von 85% auf 68%), Entscheidungsfreude (von 62% auf 53%), systematisches Denken (von 65% auf 48%), Organisationstalent (45% auf 29%), Kreativität (46% auf 27%) und Offenheit (38% auf 17%).
4.1.3 Messkriterien
Die Beobachtung und Bewertung der Teilnehmer in dem eignungsdiagnostischen Verfahren des AC orientiert sich an den Kriterien der klassischen Testtheorie (vgl. Sichler 2001: 22). Lienert (1961) zufolge zeichnet sich ein guter Test durch die Gütekriterien Rentabilität, Objektivität und Validität und aus. Die Nebenkriterien, die für das AC gelten, sind vor Allem Ökonomie und Nützlichkeit (vgl.: 12; Sichler 2001: 22).
Rentabilität meint die Zuverlässigkeit des Verfahrens, also die Messgenauigkeit: „Ein Test ist dann zuverlässig, wenn er dasjenige Persönlichkeitsmerkmal, das er mißt [sic!], eindeutig mißt [sic!], d.h. wenn er bei einer Wiederholung unter gleichen Bedingungen zu dem gleichen Ergebnis führt‘ (Lienert 1961: 13, Hervorhebung i. O.).
Angesichts der Bedingung der Wiederholbarkeit lässt sich hier bereits auf das zweite Kriterium der Objektivität schließen. Lienert (1961) erklärt, dass darunter die Eindeutigkeit des Messens verstanden wird, die unabhängig von der Beobachterperson sein muss (vgl. 13).
Das dritte Kriterium Validität kann auch mit Gültigkeit übersetzt werden. Die Prognosegüte der Validität gibt an, inwiefern tatsächlich das gemessen wurde, was gemessen werden sollte (vgl. ebd.: 14f). „Validität gibt an, wie gut ein Instrument das misst, was es zu messen vorgibt“ (Achouri 2007: 79). Im Falle von AC wird hier also die Frage aufgeworfen, inwiefern spätere Berufserfolge auf die Ergebnisse im AC zurückzuverfolgen sind19 (vgl. Lienert 1961.: 24).
Die Bedeutung von Ökonomie bezeichnet Obermann (2013) als letztendlich entscheidendes Kriterium (vgl.: 341). Vor betriebswirtschaftlichem Hintergrund ist das Verhältnis von Kosten und Nutzen dann zufriedenstellend, wenn der Test möglichst ressourcenarm, schnell und einfach durchzuführen ist (vgl. Lienert 1961: 16). Obermann (2013) betont die Kosten von Fehlbesetzungen und spricht somit von einer langfristig sinnvollen Investition (vgl.: 341f).
Das letzte Kriterium der Nützlichkeit stellt die Frage nach der Austauschbarkeit. Sofern keine andere Möglichkeit zur Messung bestimmter Eigenschaften besteht, gilt der Test als nützlich (vgl. Lienert 1961: 17).
5. Forschungsstand Arbeitssubjektivierung
Um einen Überblick über die bisherige Forschung zum Thema der Arbeitssubjektivierung zu erhalten, werden im Folgenden die wichtigsten Meilensteine der Forschung chronologisch skizziert:
Den Grundstein der arbeitssoziologischen Diskussion legt Baetghe (1991), indem er im Gegensatz zur fordistischen Einstellung zur Arbeit neuartige Ansprüche der Subjekte an Erwerbsarbeit pointiert. Als eine spezifische Form der Subjektivierung stellen Voß & Pongratz (1998) den Idealtypus des Arbeitskraftunternehmers vor. Im Zusammenhang damit wird die These aufgestellt, dass Arbeitende nicht mehr latentes Arbeitsvermögen verkaufen, sondern eher als Auftragnehmer für bestimmte Leistungen agieren (vgl.: 139). Der Typus des Arbeitskraftunternehmers wurde sowohl von den Autoren selber als auch von anderen Kritikern des Öfteren untersucht, revidiert und teilweise bestätigt (vgl. Pongratz & Voß 2004a; 2004b; Köhler et. al. 2014).
Große Aufmerksamkeit erfuhr laut Kleemann (2012) ein im Jahre 1999 veröffentlichtes Paper des Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, in dem Kleemann, Matuschek & Voß (1999) zwar auch normative Erwartungen der Beschäftigten erkennen, darüber hinaus aber eher die gezielte betriebliche Nutzung subjektiver Potenziale betonen. Anknüpfend wurde von Moldaschl & Voß (2002, in ergänzender Auflage 2003) ein Sammelband herausgegeben, der dank verschiedener Perspektiven und Diagnosen als Standardwerk zum Thema Arbeitssubjektivierung bezeichnet werden kann (vgl. Kleemann 2012: 8).
Im weiteren Diskursverlauf wurde Subjektivierung mit anderen arbeitssoziologischen Begriffen wie Flexibilisierung oder Entgrenzung (Minssen 2006) sowie Individualisierung und Wertewandel in Verbindung gebracht (vgl. Kleemann 2012).
Anknüpfend an den Arbeitskraftunternehmer entwarf Bröckling (2013) den Typus des .unternehmerischen Selbst', der sich dem ökonomischen Prinzip in allen Bereichen unterwirft. Damit geht Bröckling über den Arbeitsprozess hinaus und beschreibt die Unterwanderung ökonomischer Imperative in sämtlichen Lebensbereichen.
Kleemann (2012) unterscheidet vier Analyseperspektiven, aus denen das Phänomen der Arbeitssubjektivierung betrachtet wurde. Auf der ersten steht das Subjekt als Arbeitskraft im Fokus: Die Verwertung subjektiver Potenziale zu ökonomischen Zwecken. Die zweite Perspektive befasst sich mit den positiven Ansprüchen der Arbeitnehmer, die aufgrund von Subjektivierung verwirklicht werden können. Der Bezugspunkt der dritten Perspektive ist das wechselseitige Verhältnis zwischen betrieblichen und individuellen Ansprüchen. Hier steht die Frage im Fokus, ob und unter welchen Umständen die Vereinbarkeit der beiden Parteien gewährleistet ist. Die vierte Perspektive erfolgt aus makrosoziologischem Blickwinkel und fragt nach gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die die Fügung der Subjekte erklären (vgl.: 9).
Die vorliegende Studie, die im Rahmen der Ausarbeitung realisiert wird, lässt sich in die dritte Analyseperspektive einordnen. Die doppelseitige Subjektivierung und damit das Wechselverhältnis zwischen Unternehmen und Beschäftigtem stehen im Fokus. Kleemann (2012) pointiert, dass der umfangreiche Untersuchungsfundus die Existenz des subjektivierten Arbeitsverhältnisses in allen Einzelheiten und in kontex- tueller Einbettung dargelegt hat (vgl.: 9). Mangelhaft wurde seiner Ansicht nach die Frage verfolgt, „in welchen Formen und mit welcher Reichweite“ (ebd.: 11) Arbeitssubjektivierung evident ist.
Die hier vorliegende Studie soll einen Beitrag zur Füllung dieser Forschungslücke leisten. Nachgegangen wird der Frage der Reichweite, indem Subjektivierung nicht wie typisch im Arbeitsprozess direkt untersucht werden soll, sondern im vorausgehenden Personalauswahlprozess. Bei der Durchsicht arbeitssoziologischer Literatur, ist eine Studie von besonderer Relevanz, die den Zusammenhang von Subjektivierung und Personalauswahl beleuchtet. Im Artikel ,Der Support des Bauches' verweist Voswinkel (2012) auf ein von ihm durchgeführtes Forschungsprojekt, welches er 2005 unter dem Titel: Persönlichkeit in der Bewerbung' ins Leben rief20. Mit der Befragung von Recruitern und Bewerbern rückt auch Voswinkel (2006) die doppelseitige Subjektivierung in den Vordergrund. Im entscheidenden Unterschied zur hier vorgestellten Studie wird hier der vollständige Personalauswahlprozess in den Blick genommen. In der aktuellen Studie hingegen wird die fachliche Eignungsüberprüfung nicht berücksichtigt. Stattdessen wird der Fokus in dieser Studie auf das AC gelenkt, in dem überfachliche Kompetenzen und Fähigkeiten gemessen werden.
6. Methodische Vorüberlegungen
Nachdem die theoretische Einordnung der Phänomene erfolgte, wird nun die empirische Studie Schritt für Schritt dargestellt.
6.1 Ziel der Studie
Die umfangreichen Ausführungen im theoretischen Teil haben gezeigt, dass das Thema der Arbeitssubjektivierung bereits von vielen Arbeitssoziologen behandelt und in empirischen Sozialforschungen nachvollzogen wurde. Insofern existieren einige renommierte Studien, mithilfe derer Arbeitssubjektivierung bereits systematisiert und kategorisiert werden kann. Die vorliegende Ausarbeitung verfolgt nicht das Ziel, eine wiederholte Untersuchung des Phänomens durchzuführen, sondern die bisherigen Ergebnisse aufzugreifen und in einem neuen Forschungsfeld anzuwenden.
Subjektivierung von Arbeit meint einen veränderten Stellenwert menschlicher und individueller Aspekte im Arbeitsprozess (vgl. Baethge 1991: 6f). Dieser zeigt sich im Kern durch die gezielte Nutzung individueller Persönlichkeitseigenschaften zu ökonomischen Zwecken. Wenn Subjektivierung eine wichtige Rolle im Arbeitsprozess spielt, wird dementsprechend auch bei der Auswahl von Personal genau auf diese Eigenschaften der Bewerber Wert gelegt? Kann das zur Messung überfachlicher Fähigkeiten konstruierte AC gewissermaßen als Konsequenz auf die veränderten Anforderungen der Unternehmen betrachtet werden?
Bisher wurde Subjektivierung im unmittelbaren Arbeitsprozess untersucht. Die vorliegende Studie geht einen Schritt zurück und verfolgt die Frage, ob subjektivierte Anteile auch schon im Personalauswahlprozess eine Rolle spielen.
Ist von Subjektivierung die Rede, wird stets der doppelseitige Charakter des Phänomens herausgestellt. Es wird also von einem reziproken Prozess gesprochen, der sowohl von Arbeitnehmer- als auch von Arbeitgeberseite stimuliert wird. Eine gewissermaßen Bindegliedfunktion nehmen Berater ein, die Unternehmen bei der Auswahl geeigneter Bewerber zur Seite stehen. Damit ihre Dienstleistung von Kunden langfristig in Anspruch genommen wird, sind passgenaue Besetzungen elementar. Belange, Wünsche und Erwartungen sowohl von Seite der Unternehmen als auch seitens der Bewerber sind als jene erfolgskritischen Punkte anzunehmen, die die Reputation der Berater sicherstellen. Erhofft wird sich durch die Befragung der Personalberater mehr Klarheit sowohl über die Reichweite von Subjektivierung im gesamten Personalmanagementprozess sowie über die dichotome Eigenheit des Phänomens.
Kleemann (2012) unterscheidet zwischen enger und weiter Fokussierung der Sub- jektivierung (vgl.: 9). Während unter Subjektivierung im engeren Sinne das unmittelbare Arbeitshandeln verstanden wird, umfasst die weite Fokussierung „den Prozess der Verlagerung unterschiedlicher, direkt oder indirekt auf die Erwerbsarbeit bezogener gesellschaftlicher Funktionsanforderungen auf die Subjekte“ (ebd.: 12). Da die Studie nicht den Arbeitsprozess an sich, sondern den vorausgehenden Auswahlprozess in den Blick nimmt, liegt die weite Auslegung des Subjektivierungsbe- griffs auf der Hand.
6.2 Fragestellungen
Bei genauerem Hinsehen zeigt sich, dass bereits der Titel der Ausarbeitung eine Hypothese beinhaltet: Veränderte Erwartungen an Bewerber im Zuge der Arbeits- subjektivierung' setzt einen Wandel der Erwartungen voraus. Dem liegt die theoriegeleitete Überlegung zugrunde, dass posttayloristische und netzwerkartige Strukturen neue Bedingungen schaffen und Beschäftigte vor neue Aufgaben stellen. Daraus wurde, in theoretischer Übereinstimmung, die Behauptung von veränderten Anforderungen oder zumindest Erwartungen gestellt. Aus dem Forschungsinteresse leiten sich zwei zentrale Forschungsfragen ab:
1) Lassen sich Aspekte von Subjektivierung im Personalauswahlprozess erkennen?
2) Inwiefern zeigt sich der doppelseitige Charakter der Subjektivierung im eignungsdiagnostischen Prozess der Personalauswahl?
Um der ersten Frage gerecht zu werden, soll Subjektivierung nicht isoliert, sondern im Kontext seines Charakters analysiert werden. Es soll also berücksichtigt werden, dass Arbeitssoziologen das Phänomen stets im Zusammenhang mit einer zeitlichen Komponente definieren: So spricht etwa Minssen (2012) von „neuen Grenzen im Sinne einer (Selbst-) Verpflichtung der Arbeitenden“ (118), Baethge (1991) meint, dass es „im Zuge fortschreitender gesellschaftlicher Modernisierung zu einer zunehmenden normativen Subjektivierung des unmittelbaren Arbeitsprozesses“ (6, Hervorhebung i. O.) kommt.
Subjektivierung wird also als ein neuartiger Prozess beschrieben, sodass es angemessen scheint, die zeitliche Entwicklung im Zuge der Untersuchungen zu berücksichtigen. Um Aussagen über Veränderungen treffen zu können, ist eine genauere zeitliche Einordnung unerlässlich. Die Ausarbeitung greift dabei auf das von Volpert (1975) entwickelte und von Moldaschl (2003) weiterentwickelte Stufenmodell der Arbeitswissenschaften zurück (vgl.: 33-61; 27-30). Das Modell skizziert die Entwicklung der Arbeitswissenschaften21. Der Taylorismus lässt sich in die individualwissenschaftliche Stufe einordnen, die sich durch Standardisierung und Massenproduktion auszeichnet. Das hier fokussierte Phänomen der Subjektivierung hingegen, kann in die subjektwissenschaftliche Stufe verortet werden, die spätestens Anfang der 1990er Jahre zu Tage trat und die Individualität der Beschäftigten in den Fokus rückt (vgl. ebd.: 30).
Auch die zweite Leitfrage setzt die Berücksichtigung der zeitlichen Komponente voraus: Bevor Erwartungen von Bewerber- oder Unternehmensseite auf subjekti- vierte Anteile untersucht werden, muss geklärt werden, ob sich diese in den letzten Jahren verändert haben22. Wird der Prozess der Subjektivierung maßgeblich durch veränderte Strukturen der Unternehmen forciert oder sind es die Bewerber, die möglicherweise geprägt durch postmaterialistische Werte neue Forderungen an ihre zukünftigen Arbeitsplätze stellen? Um dieser Frage gerecht zu werden sind Differenzierungen notwendig: Lässt sich von dem Personalauswahlverfahren sprechen oder inwieweit sind Unterscheidungen evident? Insbesondere steht hier die Frage im Mittelpunkt, ob sich je nach Branche oder organisationaler Fachabteilung, also zum Beispiel Marketing oder Forschung und Entwicklung Unterschiede manifestieren. Auch Divergenzen, die auf Hierarchieebenen der Zielposition zurückzuführen sind, sollen nicht unberücksichtigt bleiben. Da jedoch davon ausgegangen wird, dass der Einsatz externer Berater mit hohen finanziellen Aufwendungen und somit eher mit der Besetzung hochrangiger Stellen verbunden ist, wird diese Frage nur sehr eingeschränkt behandelt.
6.3 Methodologische Positionierung
Welches Forschungsfeld eignet sich zur Beantwortung der Forschungsfragen? Diese Frage nach der Wahl des interpretativen Zugangs muss zu Beginn jedes Forschungsinteresses beantwortet werden. Mit dem Interesse am Ausmaß subjektivier- ter Anteile in Personalauswahlverfahren liegt das Forschungsfeld bereits auf der Hand: Im Fokus steht das typische Auswahlverfahren in Form von AC. Tabelle 1
zeigt die zunehmende Verbreitung des eignungsdiagnostischen Vorgehens, insbesondere im Hinblick auf die Auswahl externer Bewerber in Gruppenauswahlverfahren23. Auf jenes Feld beschränkt sich die vorliegende Studie.
Eine weitere Frage, die sich zu Beginn jeder Sozialforschung stellt, ist die methodische Positionierung: Quantitativ oder qualitativ? Während es sich bei der der quantitativen Sozialforschung um ein standardisiertes Vorgehen handelt, wo die erhobenen Daten im Hinblick auf Häufigkeitsverteilungen und statistische Kennziffern untersucht werden, zielt das qualitative Verfahren auf die Herausarbeitung kollektiver Orientierungsmuster und sozialer Sinnstrukturen (vgl. Kruse 2015: 44ff). Hier muss das zentrale Erkenntnisinteresse in Erinnerung gerufen werden: Im ersten Schritt geht es um die Identifikation subjektivierter Elemente im Personalauswahlprozess, und zwar um dessen Ausmaß. Hier scheint ein quantitatives Vorgehen zunächst plausibel. Lamnek (1989) zufolge liegt die Verwendung quantitativer Methoden auf der Hand, sofern sich das Interesse auf die Ermittlung von Wissen beschränkt (vgl.: 38). Tatsächlich sollen in den Untersuchungen Informationen über den konkreten Ablauf von Personalauswahlprozessen gewonnen werden. Das übergeordnete Ziel besteht jedoch darin, Subjektivierung originär zu erfassen, um mehr Klarheit in die Wirkungsrichtung der doppeldeutigen Subjektivierung zu bringen. Zudem muss das komplexe Phänomen kontextuell erfasst werden, eine Quantifizierung lässt das kaum zu. Insofern ist ein qualitatives Vorgehen notwendig, dass durch NichtStandardisierung die Abrufung von Erfahrungswissen der Befragten ermöglicht und gleichzeitig Einblicke in Handlungsabläufe gewährt.
6.4 Untersuchungsmethode: Das Experteninterview
Nachdem Forschungsfeld und Methodologie bestimmt sind, geht es nun um die Wahl eines geeigneten Erhebungsverfahrens. Neben einer Vielzahl qualitativer Interviewformen können beispielsweise Gruppendiskussionen, biografische Methoden oder teilnehmende Beobachtungen durchgeführt werden (vgl. z.B. Lamnek 1989: 1). Da es bei der Studie um Generierung spezifischen Wissens unter Berücksichtigung der individuellen Erfahrungshintergründe geht, erweisen sich Gruppendiskussionen und Biografieforschungen schnell als untauglich. Zudem besteht hier, genau wie bei der teilnehmenden Beobachtung die Schwierigkeit des Zugangs. Bei AC handelt es sich um vertrauliche, von Unternehmen unter hohem Ressourcenaufwand entwickelte Verfahren (vgl. Hillebrecht & Peiniger 2015: 144).
[...]
1 Um eine Abgrenzung zum Fordismus zu schaffen, wird im Verlaufe der Ausarbeitung von Postfordismus gesprochen. Die Bezeichnung findet sich beispielweise bei Aglietta (1987) wieder: The class struggles in production today bear the germ of a major new transformation of the labour process- Neo-Fordism“ (122)
2 Aus Gründen der Lesbarkeit wurde bei der sprachlichen Gestaltung der Arbeit auf die Verwendung geschlechterdifferenzierter Begriffe verzichtet.
3 Der Sammelbegriff der Eignungsdiagnostik geht auf psychologische Konzepte zurück und beschreibt dort in Bezug auf Personalauswahl die Prognose von zukünftigem Verhalten (vgl. Obermann 2013: 276).
4 Im weiteren Verlauf der Arbeit mit AC abgekürzt.
5 Befragung derdeutschen Top-1000 Unternehmen. Rücklaufquote: 12,8%
6 Wird im Verlauf derArbeit von AC gesprochen, ist damit immer jenes Verfahren gemeint, welches sich auf die Auswahl externer Kandidaten beschränkt.
7 Minssen (2006) hebt in diesem Zusammenhang besonders die Matrix-Organisation und das Profit-Center hervor (vgl.: 132)
8. Einige Autoren sprechen von hohen Erwartungen seitens des Managements, die später nicht eintrafen und Frustration erzeugte. Im Endeffekt bleiben die meisten Ergebnisse unberücksichtigt (vgl. Pekruhl 2001: 77f; Faust et al. 1994: 48).
9 Bereits aus der Bedeutung geht hervor, dass eigentlich nicht von ,der‘ Subjektivierung gesprochen werden kann. Welche subjektiven Eigenschaften in den Arbeitsprozess eingebracht werden, hängt vom dem Individuum ab. Wird von ,der‘ Arbeitssubjektivierung gesprochen, ist dies also konzeptionell gemeint.
10 Siehe etwa: Holtgrewe 2005: 344; Kleemann 2012: 7; Moldaschl 2003: 16
11 Die Maslowsche Bedürfnispyramide stellt menschliche Bedürfnisse und Motivationen in einer fünfstufigen Hierarchie dar. Als grundlegend identifiziert er zunächst physiologische Bedürfnisse und Sicherheitsbedürfnis, dann Soziale Bedürfnisse, Individualbedürfnisse und an der Spitze das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung (vgl. Maslow 1978: 74-95)
12 Bröckling (2013) knüpft an Voß & Pongratz an und führt den Terminus des .unternehmerischen Selbst' ein. Der Idealtypus des Arbeitskraftunternehmers zeigt, wie die gesamte Lebensführung von Rationalisierungsprozessen mit einem Ziel durchdrungen wird, das auf ökonomischer Sphäre verankert bleibt: Die optimale Vermarktung der eigenen Arbeitskraft. Bröckling (2013) hingegen stellt dar, wie sich die Charakteristika des Arbeitskraftunternehmer im Binnenkontext anderer Sphären internalisieren. Der Zweck findet sich nicht in der Erwerbsarbeit, vielmehr bleibt das Ziel den jeweiligen Bereichen behaftet. Die Ausprägungen beziehungsweise Folgeerscheinungen sind leicht zu finden: So titelte beispielsweise DER SPIEGEL am 13.02.2015 „Ökonomisierung der Bildung: .Wer einfach mal abhängt macht sich verdächtig'“ (Freisinger 2015). Ein weiteres Beispiel, wie sich die einst vorbehaltenen, Imperative der ökonomische Sphäre auf anderen Ebenen zeigen, stellt die Plattform .airbnb' dar. Hier bekommen Privatpersonen die Möglichkeit ihren Wohnraum oder einzelne Zimmer an Gäste zu vermieten (vgl. Airbnb Inc.). Akteure können hier, pointiert gesagt, ihre Privatsphäre ökonomisieren (vgl. Detek- tor.fm 2010)
13 Nicht zu vernachlässigen ist, dass auch Einzel-Assessment Center (EAC) durchgeführt werden. Durch einen hohen Ressourcenaufwand und mangelnde empirische Absicherung ist das EACjedoch weit wenigerverbreitetals das klassischeAC (vgl. Obermann 2013: 361f).
14 Im Rahmen der Arbeit wird sich im Folgenden auf das Auswahl-AC konzentriert. Ist also die Rede von AC, ist damit immer das Auswahlverfahren gemeint, an dem externe Kandidaten teilnehmen.
15 Als Vorreiter im Einsatz von AC in der Wirtschaft gelten die USA, dort erreichten sie den Durchbruch bereits 1958 (vgl. Obermann 2013: 33).
16 Die Tabelle wurde anhand der vorläufigen deskriptiven Erlebnisberichte aus den Studien des Arbeitskreises AC e.V. erstellt. Der Fragenbogenumfang lag 2001 bei 281,2008 bei 233 und 2012 bei 125. Bei den beiden aktuelleren Studien wurde eine Vollerhebung der DAX 100 Unternehmen realisiert (vgl. Arbeitskreis AC: 2001; 2008; 2012). Durch die verschiedenen n-Werte kann hier also kein direkter Vergleich stattfinden, es geht lediglich um das Aufzeigen von Tendenzen. Außerdem muss beachtet werden, dass die Stichprobengrößeje nach Fragestellung variiert und teils Mehrfachantworten möglich waren. Die Werte sind auf ganze Zahlen gerundet.
17 Frage wurde nicht berücksichtigt.
18 Das Fünf-Faktoren-Modell der Persönlichkeit umfasst die Dimensionen: Neurotizismus, Extraversion, Offenheit, Soziabilität und Gewissenhaftigkeit (vgl. Obermann 2013: 62).
19 Achouri (2007) gibt die Prognosegüte vom AC mit 58% an. Zeugnisnoten wird 4% zugeschrieben, Interviews 6% und Persönlichkeitstests 16% (vgl.: 24).
20 Die Studie ist nicht veröffentlicht. Versuche einen Zugang zu erhalten, bleiben leider ohne Erfolg. Ein Resümee dieser findet sich jedoch auf der Webseite des Instituts für Sozialforschung an derJohann Wolfgang Goethe-Universität: http://www.ifs.uni- frankfurt.de/forschung/abgeschlossene-projekte/personlichkeit-in-der-bewerbung- performative-regeln-im-verkauf-der-arbeitskraft/, Abruf: 27.07.2015
21 Während Volpert (1975) drei Stufen identifizierte: eine individualwissenschaftliche, gruppenwissenschaftliche und aktionswissenschaftliche, erweiterte Moldaschl (2003) das Modell um die vierte der subjektwissenschaftlichen Stufe (vgl.: 29; 33-61).
22 Zwar begann die Diskussion um Subjektivierung von Arbeit schon 1991 (Baethge), jedoch wird im Allgemeinen von einem Verlauf gesprochen, der im Laufe der Jahre zunimmt und an Bedeutung gewinnt (z.B. Baethge 1991 ; Minssen 2012)
23 Personalauswahl: 2008: 37% / 2012: 81%; Personalentwicklung: 2008: 24% / 2012: 16%, vgl. Arbeitskreis AC 2012: 9f)
- Arbeit zitieren
- Alena Stock (Autor:in), 2015, Veränderte Anforderungen an Bewerber im Zuge der Arbeitssubjektivierung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/312187
Kostenlos Autor werden

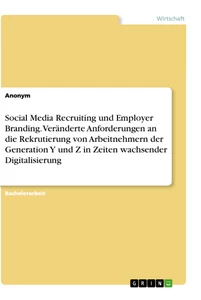




















Kommentare