Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Vorwort
Einleitung
1. Hundegestützte Pädagogik und Therapie im Diskurs
1.1 Die Abenteuer- und Erlebnispädagogik bietet Chancen für tiergestützte Interventionen
1.2 Vom Nutzen der Hunde in der pädagogischen Arbeit
1.3 Hunde im Therapieeinsatz
1.4 Suchtmittelkonsumentwöhnung beim Menschen mithilfe des Einsatzes von Hunden
1.5 Zusammenfassung
2. Die Einrichtung: Der Kompass e.V. Elsholz
3. FORSCHUNG: Methodisches Vorgehen
4. SAMPLING: Auswahl der Klientel
4.1 Kriterien des episodischen Interviews
4.2 Implementierung der Interviews
4.3 Erstellung der Transkription mit MAXQDA
5. AUSWERTUNG: Informationen zur inhaltsanalytischen Auswertung nach Mayring
6. Zur Wirksamkeit des Umgangs von Jugendlichen mit Schlittenhunden im Rahmen eines Entzugs - Ergebnisse einer empirischen Studie
6.1 Gründe für den Drogenkonsum
6.2 Interventionen von Außenstehenden, Pädagogen und Therapeuten
6.3 Die Bedeutung der Schlittenhunde während der Therapie
6.4 Erfahrungs- und Bewegungslernen durch abenteuerliche Erlebnisse mit Schlittenhunden
7. Analyse der Ergebnisse im Vergleich mit den Aussagen von Referenzautoren
8. Ausblick
9. Literatur
10. Anhangsverzeichnis
Anhang 1 Überblick inhaltliche Qualifikation
Anhang 2 Menschliche Bedürfniskomplexe
Anhang 3 Gruppentherapieraum des Kompass e.V
Anhang 4 Wirkmechanismen des tiereschen Co-Pädagogen
Anhang 5 Regelwerk ABC des Kompass e.V
Anhang 6 Wissensformen episodisches Interview
Anhang 7 Episodisches Interview
Anhang 8 Transkriptionsregeln
Anhang 9 Überblick der Kategorien (tabellarisch)
Anhang 10 Überblick der Hypothesen
Abkürzungsverzeichnis:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Vorwort
Wie kann man drogenabhängigen Jugendlichen helfen, ihre Abhängigkeit zu überwinden, ihr Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl wiederzufinden und sie dazu motivieren, wieder vertrauensvoll in die Zukunft blicken zu können? Fragen an eine moderne Gesellschaft, die ihre Verlierer zunächst in Eigenregie generiert, sie dann aber, um Schlimmeres zu verhindern, wieder auffangen und rückintegrieren muss, Fragen von hoher Priorität, die auf Antworten warten.
Das Konsumieren von Rauschmitteln im Jugendalter impliziert schwerwiegende Folgen für die psychische und körperliche Gesundheit der Betroffenen. Es bedarf vielfältiger Maßnahmen, wenn hier effektiv abgeholfen werden soll. Eine vielversprechende Möglichkeit scheint der Einsatz von Schlittenhunden im Rahmen eines abenteuer- und erlebnispädagogischen Ansatzes darzustellen. Doch ist das wirklich so?
Valide Daten und empirische Untersuchungen hierzu gibt es kaum. Theoretisch scheint dieser pragmatische Ansatz aber durchaus plausibel begründbar zu sein. Es handelt sich um eine von vielen vorgeschlagenen Methoden, den Jugendlichen Wege aus der Sucht aufzuzeigen und sie auf ihrem Weg zu einem Leben ohne Rauschmittel zu begleiten. Das Repertoire wird für die Zeit des Entzuges durch neue Ideen stetig erweitert, doch fehlt es bisher massiv auch an Nachsorgemaßnahmen. Hier scheint es noch viel zu tun zu geben.
Der geneigte Leser sei an dieser Stelle im Vorfeld dazu aufgefordert, selbst einmal über die mögliche Rolle und Funktion von Hunden während des Drogenentzugs bei einem Jugendlichen nachzudenken. Unter Berücksichtigung von möglichen zu bestehenden Abenteuern und Erlebnissen im Zusammenhang mit dem Einsatz von Schlittenhunden, sind vielfältige geeignete Szenarien sicherlich vorstellbar.
Die Thesis der Arbeit beginnt mit der Redewendung „Auf den Hund gekommen “. Die Ambiguität der Bedeutung liegt bezogen auf den Einsatz von Hunden bei therapeutischen Maßnahmen mit drogenabhängigen Jugendlichen auf der Hand.
Eine ursprüngliche Bedeutung der Redewendung stammt aus dem Mittelalter. Die Menschen bewahrten in jener Zeit ihre „Notgroschen“ häufig in Geldtruhen auf, deren Böden durch das Bild oder die Schnitzerei eines Hundes verziert waren. Zum einen symbolisierte der Hund den Wächter und Beschützer der letzten Habe, zum anderen sollte die Symbolik den Besitzer der Truhe an eine maßvolle Bescheidenheit im Umgang mit dem letzten Besitz erinnern.
Ein anderer ursprünglicher Bedeutungsinhalt geht auf sehr arme Menschen in vergangenen Zeiten zurück, die in Ermangelung von Ochsen, Eseln oder anderen Zugtieren Hunde zum Transport schwerer Lasten vor ihre Karren spannen mussten. „Auf den Hund gekommen“ kennzeichnet in diesem Zusammenhang widrige Lebensbedingungen, ein Leben in Bedürftigkeit.
Im virtuellen Buch für Sprichwörter und Redewendungen ist die folgende Bedeutung nachzulesen: „ Auf den Hund gekommen – gesundheitlich oder wirtschaftlich ruiniert sein, sozial oder moralisch abgestiegen, in schlechte Verhältnisse geraten zu sein“
(www.sprichwoerter-redewendungen.de/redewendungen/auf-den-hund-gekommen/, letzter Zugriff: 15.03.2014).
Die Redewendung erfährt in der heutigen Zeit auch einen gegenteiligen Sinn und ist bei Hundeliebhaberinnen und Hundeliebhabern ein Ausdruck der Freude, einen Hund als treuen Begleiter ihr Eigen nennen zu können.
„Auf den Hund gekommen“ steht in den Ausführungen dieser Arbeit auf der einen Seite für die misslichen Lebenslagen von Jugendlichen, die als Ursache für ihren Drogenkonsum anzusehen sind, auf der anderen Seite aber auch für die sich bietenden Chancen, mithilfe des Einsatzes von Hunden die Sucht überwinden zu können und eine erneute Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen.
Aus der Vernetzung fachlicher Disziplinen wie Sozialer Arbeit mit Abenteuer- und Erlebnispädagogik ergeben sich innovative Möglichkeiten für die Drogenentwöhnung und Reintegration im Zusammenhang mit dem Einsatz von Schlittenhunden. Der entscheidende Wirkfaktor der Symbiose zwischen Fachpersonal und den Klienten liegt hier im Unterschied zu herkömmlichen Ansätzen auf dem konfrontativen Umgang mit den im Dreh-und Angelpunkt stehenden Hunden. Berufsgruppen aus unterschiedlichen Bereichen kooperieren miteinander. Die wissenschaftlichen Bereiche Soziale Arbeit, Psychologie, Medizin und die Tiertherapie können als vier Grundpfeiler hierfür angesehen werden. Eine enge Zusammenarbeit des Fachpersonals dieser Bereiche mit den Klienten in Verbindung mit dem Einsatz von Hunden weist das Potenzial auf, einen erfolgreichen Drogenentzug in Aussicht stellen zu können, da der Einsatz der Hunde andere emotionale Zugänge zu den Betroffenen bewirken kann.
„Woran sollte man sich von der endlosen Verstellung, Falschheit und Heimtücke der Menschen erholen, wenn die Hunde nicht wären, in deren ehrliches Gesicht man ohne Misstrauen schauen kann?“
(Arthur Schopenhauer)
Einleitung
Die Ausführungen in dieser Arbeit sollen in dem eher vernachlässigten Diskurs um tiergestützte Maßnahmen im Bereich des Drogenentzugs bei Jugendlichen neben der Bereitstellung theoretischer Forschungsergebnisse auch dazu beitragen, empirische Befunde bei Jugendlichen während des Entzugs zu erheben. Es liegt in der Natur der Sache, dass dies nur mit wenigen Probanden möglich sein wird und die Ergebnisse daher nur einen kleinen Ausschnitt abbilden können, der keinen Anspruch auf Verallgemeinerung erhebt. Die Autorin möchte ihrer Hoffnung Ausdruck verleihen, mit dieser Arbeit tiergestützten Maßnahmen, die dem Bereich der sozialen Fürsorge zuzurechnen sind, eine etwas größere Aufmerksamkeit im Rahmen empirischer Forschungen in den Bezugswissenschaften teilwerden zu lassen.
Die historischen Entwicklungslinien im Bereich der tiergestützten Interventionen werden stark gerafft aufgezeigt. Es folgen Darlegungen zur abenteuerpädagogischen Landschaft im Bereich der tiergestützten Pädagogik, die maßgeblich durch das „Abenteuermodell“ von Becker und den Ansatz von „Krise und Routine“ nach Oevermann gestützt werden (vgl. Oevermann, 2008).
Ein Überblickswissen soll durch die Ansprache von Zusammenhängen unterschiedlicher Themengebiete der Abenteuer- und Erlebnispädagogik erzeugt werden. Der tiergestützten Pädagogik kommt hier eine besondere Bedeutung zu, weil gerade im Rahmen des sich ergebenen abenteuerlichen Erlebens unter Mitwirkung von Tieren eigenständige Entscheidungen und die Übernahme von Verantwortung für die hilfsbedürftigen Jugendlichen angebahnt werden können.
In einer Literaturrecherche werden aus einer Auswahl von Büchern und Fachartikeln zunächst wichtige Thesen elaboriert, in denen effektive Grundprinzipien des Einsatzes tiergestützter Pädagogik zum Ausdruck gebracht werden. Die in der praktischen Arbeit mit therapiebedürftigen Jugendlichen zum Einsatz kommenden abenteuer- und erlebnispädagogischen Grundprinzipen, die im Rahmen der Schlittenhund gestützten Betreuung beim Kompass e.V. identifiziert werden können, dienen für einen Vergleich mit den Thesen aus der Referenzliteratur.
Im Kern der Arbeit geht es auch darum, die Praxistauglichkeit der elaborierten Thesen aus der Referenzliteratur zu testen. Hierfür werden episodische Interviews mit zwei im Kompass e.V. betreuten Jugendlichen durchgeführt und mit Blick auf die Referenzthesen der Literatur auf Übereinstimmung hin untersucht. Mit den Thesen, die auf diese Weise einer empirischen Falsifikation unterliegen, soll eine Ursachenanalyse durchgeführt werden. Die Thesen, die eine empirische Stützung erfahren, werden besonders herausgestellt.
Somit könnte mit dieser Arbeit ein Beitrag geleistet werden, valide Thesen, die Bestandteile einer Theorie werden könnten, empirisch zu begründen.
1. Hundegestützte Pädagogik und Therapie im Diskurs
Das Wirkungsfeld der Sozialen Arbeit in dem Bereich der tiergestützten Pädagogik und Therapie stellt ein neues, innovatives Betätigungsfeld dar. Die wissenschaftlichen historischen Entwicklungslinien im Bereich der tiergestützten Maßnahmen lassen sich bis zu ihren ersten vorsichtigen Anfängen in den 1970er Jahren zurückverfolgen, als die „Delta Society“ in Oregon in den Vereinigten Staaten von Amerika erste grundlegende Erkenntnisse über Mensch-Tier-Beziehungen gewann und behutsam diesbezügliche Forschungen etabliert wurden. Auf dem Gebiet der Sozialen Arbeit und im Bereich des Gesundheitswesens haben sich mittlerweile grundlegende Ziele manifestiert, die auch dokumentarisch festgehalten worden sind. Die ersten Erkenntnisse aus diesem Bereich wurden 1996 veröffentlicht (vgl. Kirchpfening, 2012, S. 10).
Zurzeit gelten die Qualitätsstandards der Delta Society ESAAT (European Society for Animal Assisted Therapie) und der internationalen Organisation ISAAT (International Society for Animal Assisted Therapie) (vgl. Röger-Lakenbrink, 2010, S. 17).
An dieser Stelle sei zum besseren Verständnis auf zwei verschiedene Bereiche hingewiesen, die erst seit 2011 einer Vereinheitlichung unterzogen worden sind. Auf der einen Seite stehen tiergestützte Aktivitäten (AAA: Animal-Assisted Activities), die von jedermann, ob Fachperson in einem speziellen Bereich oder nicht, praktiziert werden können. Sie zielen auf einen allgemeinen Wohlfühlaspekt und eine mögliche Verbesserung der Lebenssituationen betroffener Menschen ab. Auf der anderen Seite steht die tiergestützte Therapie (AAT: Animal-Assisted Therapy), die ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt wird, klare Zielvorgaben beinhaltet und deren Fortschritte schriftlich protokolliert und dokumentiert werden (vgl. Kirchpfening, 2012, S. 11).
Mit einer internationalen Vereinigung von Fachleuten sollte eigentlich ein Forum für den Informationsaustauch und die Veröffentlichung wissenschaftlich erworbener Erkenntnisse in diesem Bereich geschaffen worden sein, in dessen Rahmen Richtlinien nach gesetzlichen Vorgaben formuliert werden können. Die bisher aufgeführten Standards lassen jedoch einen breiten Korridor für länderspezifische Interpretationen offen. In Deutschland gibt es beispielsweise keine Regelungen darüber, welche Berufsgruppen autorisiert sind, Hunde in der täglichen Arbeit beim Drogenentzug einzusetzen. Bezüglich der Eignungsqualifikationen der Betreuer selbst klaffen ebenfalls große Lücken. Kirchpfening zieht das Fazit des Vorhandenseins einer im Wesentlichen Rahmenrichtlinien freien Zone, die keinerlei Qualifikationen von Personen einfordert, die Angebote im Sozial- und Gesundheitswesen offerieren (vgl. Kirchpfening, 2012, S. 14).
Weder wird der tiergestützten Therapie trotz mittlerweile in einigen Bereichen vorhandener positiver Rückmeldungen eine Präferenz von behördlicher Seite her eingeräumt, noch erfährt sie eine ausreichende Unterstützung. Im Gegenteil dienen restriktive Vorschriften bezüglich Hygiene und Sicherheit eher ihrer Verhinderung. Die therapeutischen Institutionen und sozialen Vereine entscheiden daher autark über den Einsatz tiergestützter Maßnahmen. Da die tiergestützte Therapie aber zusätzlich kostenintensiv ist, bleibt sie im Bereich der Sozialen Arbeit wohl eher die Ausnahme.
Exemplarisch sei auf den Einsatz von Hunden in der Schullandschaft verwiesen. Ein von der Klassenlehrerin mitgebrachter Hund begleitet bei diesem Ansatz die Kinder und Jugendlichen in ihrem Schulalltag, dient ihnen als Spielkamerad, vertrauensvoller Freund und stellt zudem Anforderungen an ihre Fürsorgepflichten. Trotz seines hohen berichteten pädagogischen Potenzials verhindern Hygienevorschriften oder generelle Tierverbote an Schulen seine Etablierung innerhalb der Institution weitgehend (Kirchpfening, 2012, S. 19).
Der Bereich der tiergestützten Sozialen Arbeit (siehe Anhang A1 S. 82) befindet sich noch im Aufbau. Bezüglich eines geeigneten Qualitätsmanagements sind noch viele Fragen offen. Offizielle Qualitätsstandards, die festlegen, wie die Therapien in ihren Bezügen zur Pädagogik einzusetzen sind, existieren noch nicht. Der Zusammenschluss von Verbänden unter einem Dachverband könnte hier hilfreich sein, das Fachpersonal aus den multiplen Berufsgruppen zu vernetzen und dadurch ein Forum für den gegenseitigen Austausch von länderinternem Fachwissen bereitzustellen (vgl. Otterstedt, 2007, S. 459).
Es stellen sich an dieser Stelle auch Fragen, die bezogen auf forschungsimmanente Aspekte von großer Bedeutung sind. Damit im Rahmen der tiergestützten Interventionen mehr Aufklärungsarbeit geleistet werden kann, ist es unverzichtbar, dieses Gebiet noch intensiv zu beforschen. Es gibt bereits vereinzelte Studien, in denen erste Erkenntnisse in einer Sammlung von Kriterien münden. Auch werden zaghaft Vergleiche zwischen den Studien gezogen und erste Projekte und Testverfahren entwickelt. In den Fachhochschulen und Universitäten in Deutschland wird das Thema der tiergestützten Begleitung in den verschiedenen Fachbereichen allmählich aktueller. Durch geförderte Promotionsmöglichkeiten wird das Themengebiet unterstützt. Auch im Bereich der Printmedien werden vereinzelt Artikel, Zeitschriftenbände und Bücher herausgebracht, die neue Zusammenhänge offerieren (vgl. Otterstedt, 2007, S. 459).
„Wissenschaftliches Arbeiten im Bereich Mensch-Tier-Begegnung wird in Deutschland leider bisher kaum gefördert. () Es gilt, die wissenschaftliche Arbeit im Team mit anderen Fakultäten zu verbessern. Eine interdisziplinäre Forschung entspricht dem realen Leben mehr als eine fachspezifische Forschung. Sie verlangt allerdings auch die Entwicklung themengerechter Methoden und viel Mut von den Wissenschaftlern, die derzeit mit diesem Thema noch zu wenig Aufmerksamkeit erhalten. Es gilt auch Doktoranten mit entsprechenden Themen zu fördern, damit sie in Zukunft die wissenschaftliche Entwicklung mitbestimmen können“ (Otterstedt, 2007, S. 534).
Um die Bedeutung relevanter Wirkzusammenhänge im emotionalen, affektiven Bereichen der Mensch-Hund Begegnung besser verstehen zu können, lohnt es sich einen Blick in die gemeinsame Vergangenheit der beiden Spezies zu werfen.
Die These „Ohne bestimmte Tiere wären die Menschen nicht so (menschlich) geworden, wie sie sind“ (Otterstedt, 2009, S.11) von Paul Shepard (einem amerikanischen Umweltschützer und Buchautor, 1925-1996) steht im Fokus der Aufmerksamkeit und wird eingehend diskutiert.
Um die kulturelle Stammesgeschichte des modernen Menschen (Homo sapiens sapiens, ca. 150.000 vor Chr.) in Bezug zu der von Tieren (insbesondere Hunden) setzen zu können, muss der Frage nach ihrem gegenseitigen Bedingungsgefüge nachgegangen werden. Welche Anlässe in der kulturellen Evolution des Menschen verbindet diese in außergewöhnlicher Weise mit den Tieren, insbesondere den Hunden? (vgl. Otterstedt, 2009, S. 14).
Tiere dienten dem Menschen schon seit jeher als Nahrungsmittel. Mit sich entwickelnden Werkzeugen verbesserten sich auch die Jagdmethoden. Tiere wurden gezielt erlegt und ihr Fleisch als wichtige Proteinquelle genutzt. Auch die Felle der erbeuteten Tiere, lernte der Mensch zu wertvoller Kleidung zu verarbeiten. Die kulturelle Evolution zum heutigen Menschen hin vollzog sich in atemberaubender Geschwindigkeit. Dass sich die Menschen dabei Tiere in jeglicher Form zu Nutzen machten, stellt ein kulturübergreifendes Phänomen dar (vgl. Otterstedt, 2009, S. 15).
Der Hund nimmt in seinen Bezügen zur kulturellen Evolution des Menschen eine Sonderstellung ein. Schon vor ca. sechzigtausend Jahren wurden Wölfe von sesshaft werdenden Menschen gezähmt und in vielfältigen Funktionen genutzt. Vor diesem Hintergrund entwickelten sich durch Züchtungen die verschiedenen Rassen, die wir heutzutage kennen (Putsch, 2013, S. 13).
Die Symbiose von Mensch und Hund erweist sich als ausgesprochen nutzbringend für beide Symbionten. Sie basiert auf ähnlichen Verhaltensweisen der beiden Spezies. Mensch und Hund sind sich in ihrem Bestreben nach Eingliederung und Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft sehr ähnlich (Anhang A2, S.83). Der Mensch pflegt Zeit seines Lebens den Kontakt zu anderen Menschen innerhalb von Gemeinschaften und auch bei Hunden (insbesondere Huskies) ist ein ursprüngliches Rudelverhalten auch heute noch dominant (Putsch, 2013, S. 13).
„Bei keinem anderen domestizierten Tier kam es zu einer dermaßen starken Sonderung der Funktionen wie beim Hund“ (Otterstedt, 2009, S. 20).
Die Beziehung zwischen Mensch und Hund besitzt daher seit Jahrtausenden eine große Bedeutung im Hinblick auf okkulte, zivilisatorische und ökonomische Belange (vgl. Frömming, 2006, S. 4).
Die erste schriftliche Erwähnung von Hunden als Zugtiere geht auf das Jahr 250 v. Chr. zurück. Hunde sind vermutlich die ältesten Zugtiere, die der Mensch in dieser Funktion nutzte. Zeichnungen aus dem Neolithikum im Übergang zur Bronzezeit in Skandinavien belegen bereits den Gebrauch von Schlittenhunden (vgl. www.ssv-ev.de/lg_bws_og_ortenau.de, letzter Zugriff 25.01.2014). Es ist zu vermuten, dass sich über diese Funktion hinaus in der rauen Natur starke sozio-emotionale Beziehungen zwischen Mensch und Hund ausbilden konnten.
Die tiergestützte Soziale Arbeit eröffnet durch den Einsatz des Hundes ein Betätigungsfeld, devianten, drogenabhängigen und anscheinend erziehungsresistenten Jugendlichen zu einem autonomen Lebensrhythmus zu verhelfen.
„Über die Tiere kann der Mensch zu einem kleinen Teil wieder zu der Natur zurückfinden, die er sich selber verschlossen und verdorben hat. [] Gemeinschaft mit Tieren ist in sich nicht nur pädagogisch wie therapeutisch effektiv, sondern sie ist in sich selbst sinnvoll. Tiere helfen unserer schwerbeschädigten Zivilisation zur Besinnung auf Gegenkräfte“ (Greiffenhagen, 1991, S. 33).
Innerhalb des Bereiches der tiergestützten Pädagogik und der tiergestützten Therapie bilden sich Kriterien heraus, die im Folgenden erläutert werden.
Der Begriff der tiergestützten Pädagogik umfasst allgemein Maßnahmen, mit denen unter Anwendung von einem oder mehreren Tieren Lernprozesse bei devianten Personen eingeleitet werden können. Strikte Zielvorgaben müssen eingehalten werden, wenn man die Betroffenen letztlich erreichen möchte. Dies beträfe zum Beispiel das tägliche Training mit den Schlittenhunden, um am Ende des Jahres eine erfolgreiche Exkursion in Aussicht stellen zu können. Eine tiergestützte Pädagogik ist somit eine längerfristige Auseinandersetzung zwischen Klienten, Tieren und dem Fachpersonal, die sich über eine Zeitspanne erstreckt, in der verlässliche, soziale und emotionale Beziehungen zwischen allen Beteiligten aufgebaut werden (Kirchpfening, 2012, S. 13).
Tiergestützte Interventionen dieser Art treten zum ersten Mal Ende des 20. Jahrhunderts auf. Verschiedene Tierarten, wie Katzen, Hunde, Delphine und Pferde werden mit therapeutischen Intentionen eingesetzt. Die Potenziale der Tiere werden mit Bezug auf ihre emotionalen Wirkungen auf Menschen in unterschiedlichen Einsatzgebieten genutzt. Exemplarisch seien an dieser Stelle nur der Tierbesuchsdienst, Therapiehunde in den Bereichen der Ergo-, Physio- und Psychotherapie oder Blindenbegleithunde erwähnt (vgl. Otterstedt, 2001, S. 21).
Die Arbeit mit Hunden setzt klare Zielvorgaben voraus. Der bewusste Einsatz von Hunden mit speziellen Fähigkeiten bei verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen zielt auf eine Modifikation ihres individuellen Habitus und Handelns innerhalb der Gesellschaft ab (vgl. Kirchpfening, 2012, S. 99).
Die hundegestützte Pädagogik ist eine spezielle Verbindung von verschiedenen Subdisziplinen, die sich aus den Erziehungswissenschaften herausgebildet haben. Auch Inhalte anderer geisteswissenschaftlicher Bereiche lassen sich finden, wie z.B. lernpsychologische-, soziologische- oder philosophische- Modelle, die dazu beitragen, das Agieren zwischen Mensch und Hund besser verstehen und analysieren zu können. Diverse Verständigungs- und Wahrnehmungstechniken kommen zum Einsatz und tragen einem weitgehenden Verständnis der Empathie, die sich zwischen Hund und Mensch ausbilden kann, Rechnung. Auch aus dem Bereich der biographischen Spurensuche lassen sich Elemente integrieren (vgl. Frömming, 2006, S. 3).
Das „Life Model“ der Autoren Germain und Gittermann, das aus der Praxis der Sozialen Arbeit heraus abgeleitet wurde, findet in der tiergestützten Arbeit seine Berechtigung. Dieses Modell erläutert den Zusammenhang zwischen den Interventionsmöglichkeiten der pädagogischen Arbeit mit den Umweltfaktoren (vgl. Kirchpfening, 2012, S. 17).
„Zentraler Aspekt dieses Ansatzes ist der Begriff der „Ökologie“. In dem ursprünglichen Sinne wird dieser als die Lehre der Beziehungen von Organismen untereinander und mit ihrer Umwelt verstanden. Das Erklärungsmodell nach Germain und Gittermann, welches erstmals 1983 veröffentlicht wurde, unterscheidet sich von anderen Modellen der Sozialen Arbeit durch die Erweiterung des Erklärungsansatzes um einen systemischen Umweltaspekt“ (Kirchpfening, 2012, S. 17).
Anders gesagt handelt es sich bei diesem Modell um einen systemischen Ansatz, der ein Fehlverhalten von Menschen durch die positiven Einflüsse der Hunde, die auf verschiedene Teilbereiche des menschlichen Bewusstseins einwirken, verändern soll. Die betreuenden Pädagoginnen und Pädagogen sind dafür verantwortlich, diesen Prozess durch Ermutigung und Anspornung der Klienten nachhaltig anzubahnen (vgl. Kirchpfening, 2012, S. 18).
Hunde, die in einem pädagogischen Setting eingesetzt werden, bezeichnet die Wissenschaft als Sozialhunde. Diese Hunde benötigen keine spezielle kostspielige Hundeausbildung.
„Als Sozialhunde sind diejenigen (mehr oder weniger) trainierten Hunde zu bezeichnen, die zeitweilig für die Begegnung mit Menschen eingesetzt werden, um deren Wohlbefinden zu erhöhen oder bei der Entwicklung von Kompetenzen als hilfreiches Medium fungieren. Sie werden vornehmlich eingesetzt bei (), Kindern und Jugendlichen mit auffälligem und/oder deliquentem Verhalten. Die Tiere werden nicht für spezifische Dienstleistungen ausgebildet“ (Kirchpfening, 2012, S. 23).
Aus dem Bereich der tiergestützten Therapie stammen Ansätze, die der Psychologie entlehnt sind. Lebensart und Denkweise der Menschen sind in Abhängigkeit von gesellschaftlichen Formen des Zusammenlebens häufig starken Fluktuationen unterworfen. Ein Wissen über eigene Denk- und Handlungsoptionen impliziert ein sich verselbstständigendes Autonomiebewusstsein bei den Betroffenen. Hier sind nicht nur Pädagoginnen und Pädagogen in einer Betreuerfunktion, sondern unter anderem auch ausgebildete Psychologinnen und Psychologen, die in Einzel- und Gruppensitzungen in Zusammenarbeit mit den Tieren Unterstützung anbieten und leisten.
Exemplarisch sei auf den Kompass e.V. Elsholz (ausführliche Beschreibung in Kapitel 2) in diesem Zusammenhang verwiesen. Der Gruppentherapieraum der Einrichtung wurde exklusiv so gestaltet, dass sich ein Hundethema in einem Mosaik auf dem Boden des Raumes befindet. Durch die eindrucksvolle Darstellung am Boden erfolgt gleich beim Betreten des Raumes eine psychologische Einflussnahme auf die Jugendlichen, die Hunde in den Mittelpunkt rückt (siehe Anhang, A3, S. 84).
In vielen Geschichten im Zusammenhang mit Therapiehunden werden offenbar nur schwierig zu verstehende Phänomene beschrieben, die in der Fachliteratur mit einer „heilenden Wirkung von Tieren“ erklärt werden (Pohlheim, 2006, S. 70). Durch die Berührung eines Hundes kann sich nachgewiesenermaßen der Blutdruck eines Menschen senken lassen und sich in Folge hiervon die Herzfrequenz verringern (vgl. Pohlheim, 2006, S. 70). Ähnliche Effekte lassen sich auch mit anderen Tieren erzielen, allerdings eignen sich Hunde hierfür ausgesprochen gut.
„() aufgrund ihres vielfältigen Verhaltensrepertoires entsprechen Hunde den grundlegenden psychischen Bedürfnissen des Menschen: Dem Wunsch: geliebt zu werden und sich für andere und für sich selbst wertvoll zu fühlen. Hunde besitzen die Fähigkeit, Liebe und beruhigende Berührungen zu schenken, ohne dabei herablassend, kritisch oder verletzend zu wirken und ein Gefühl der Dankesschuld zu erzeugen“ (Calabró, 1999, S. 70 f).
1.1 Die Abenteuer- und Erlebnispädagogik bietet Chancen für tiergestützte Interventionen
Die Abenteuer- und Erlebnispädagogik unterscheidet sich in einigen Aspekten von herkömmlichen pädagogischen Anwendungsfeldern. Ein wesentlicher Unterschied zu anderen pädagogischen Konzepten liegt im ganzheitlichen Erlernen von lebenspraktischen Aspekten mit allgegenwärtigem Bezug zur Realität (vgl. Berthold, 2002, S. 17).
Der Begründer der Erlebnispädagogik, Kurt Hahn, beschreibt die Bedeutung folgendermaßen:
„Durch das Bewältigen von körperlich anstrengenden Ereignissen sollte die eigene Kompetenz gesteigert werden, um so für den Notfall gerüstet zu sein und das Leben eigenverantwortlich steuern zu können “ (Heckmair, 1995, S. 301).
Die Tiefenpsychologie weist Theorien über menschlichen Triebe, Strebungen und Leidenschaften aus . Fragen nach den Gründen für einen vorhandenen Drang nach Abenteuern und waghalsigen Erlebnissen im Menschen werden aufgeworfen. Die Psychologen vermuten die Ursprünge der menschlichen Triebe in ihrer evolutiven Vorgeschichte, aus der auch die Sozio-Biologie merkwürdigerweise Gründe für einen Drogenmissbrauch ableiten kann (siehe Anhang A4, S. 84). Auch Paläontologen und Ethnologen haben viele Anstrengungen unternommen, Erklärungsansätze für den Abenteuerdrang der Menschen zu finden.
Eine Frage, mit der sich die Erziehungswissenschaft eingehend beschäftigen, ist, ob „Erleben auch erziehen kann?“ (Heckmair, 1995, S. 113). Eindrückliche Erlebnisse hinterlassen immer Spuren im Bewusstsein des Menschen und soweit sich ein Bezug zur Lebensbiographie herstellen lässt, erziehen diese sicherlich auch. Erlebnis ist dabei nicht nur schmückendes Beiwerk einer eindrucksvollen Aktion oder Handlung, sondern die „stärkste pädagogische Kraft“ überhaupt (vgl. Heckmair, 1995, S. 113). Sobald das Erleben pädagogisiert und damit zu einem steuerbaren Prozess avanciert, werden Ziele vorgegeben und angestrebt. Es geht nicht mehr um das zufällige ungeplante und spontane Erlebnis, sondern darum, Defizite abzumildern oder Erziehungslücken geplant zu füllen. Erlebnispädagogik bietet folglich alternative Möglichkeit der Erziehung, bei der Gefährdungspotenziale vermieden bzw. kontrolliert werden. Hieraus resultiert eine funktionierende Pädagogik, die keine „subversive Kraft“ aufweist (Heckmair, 1995, S. 117).
Ein übergeordnetes pädagogisches Erziehungsziel für Jugendhilfemaßnahmen stellt die Schulung der Erlebnisfähigkeit dar, mit der eine Heranbildung selbstverantwortlicher, reifer Persönlichkeiten angestrebt wird. Das Erlebnis spiegelt sich in der Schulung der Sinne wider, Eigeninitiative führt zu individuellen Erfahrungen. Bei den Prozessen, die die Erlebnispädagogik bieten kann, spielt die Grundstimmung, die Freude des Jugendlichen, eine ganz wesentliche Rolle (vgl. Becker, 2007, S. 263).
„Diese mit der Erlebnisorientierung assoziierte positive Grundstimmung, wohl auch die semantische Nähe zum Leben und zur Lebendigkeit macht das Erlebnis zweifellos attraktiv. Allerdings bleibt meistens ungeklärt, was die Kategorie Erlebnis ausmacht und was sie im pädagogischen Kontext zu tragen vermag“ (Becker, 2007, S. 263).
Die Handlungs- und Erlebnisfähigkeit in der erlebnisorientierten Jugendhilfe beschreibt die längerfristige aktiv handelnde Auseinandersetzung mit dem Leben, nicht jedoch die spektakuläre und aktionsreiche Seite des schnellen Erlebnisses. Es wird dabei nicht auf Abenteuer, Aktion, Erlebnis und Handlung verzichtet. Eindeutiges Ziel ist aber die Schulung ganzheitlicher menschlicher Erlebnisfähigkeit (vgl. Bauer, 2001, S. 22). Wissenschaftlich belegt ist ein Zusammenhang zwischen Primär- und Sekundärerfahrungen. Das eigene aktive Erleben lässt sich kaum vom passiven Erleben durch bloßes Zuschauen trennen (vgl. Bauer, 2001, S. 72).
Der Ansatz der Abenteuer- und Erlebnispädagogik basiert auf einem handlungsorientierten Lernen, das alle Sinne anspricht. Er stellt die „learning by doing“ Methode (Michl, 2009, S. 31) in den Mittelpunkt, nimmt die Gruppe ernst, unterstützt die Selbststeuerung, schafft Ernstsituationen, sucht nach den Stärken und Ressourcen der Lernenden, um sie gegebenenfalls reaktivieren zu können.
Aus dem weitgefächertem Gebiet der Abenteuer- und Erlebnispädagogik lassen sich verschiedene Handlungsmuster ableiten, die für den Fachbereich der Sozialen Arbeit, gerade für heutige Jugendliche, eine bedeutende Rolle spielen können. Die Vernetzung von Abenteuerpädagogik mit verschiedenen Therapieformen (zum Beispiel der Erlebnistherapie, Wildnistherapie oder abenteuerbasierte Therapie) liefert neue Optionen für die Klienten (vgl. Gilsdorf, 2004, S. 38). Durch handlungspraktische und lebensnahe Methoden wird ein Bildungsprozess bei ihnen angebahnt (vgl. Gilsdorf, 2004, S. 62). In den Bereichen, die die Abenteuerpädagogik abdeckt, befinden sich Aspekte, die den Jugendlichen einen Zugang zum Fremden vermitteln, die das Erfahrungslernen geradezu anregen.
„Natur wird als Herausforderung angesehen und angenommen, mit der man sich vor allem aktiv bewältigend auseinandersetzt. Man könnte diese Auseinandersetzung als ein ins aktiv gekehrtes Erbe der Ästhetik des Erhabenen bezeichnen“ (Becker, 2001, S. 3).
Das Abenteuer- Modell von Becker dient als Grundlage zur Darlegung des Strukturmodells des Abenteuers. Danach liegt jedem Abenteuer ein Aufbruch ins Ungewisse zugrunde. Das Abenteuer wird als ein Aufbruch ins Ungewisse mit klarem Anfang und Ende einer Reise bezeichnet. Der Hauptgrund für das abenteuerliche Unterwegssein ist eine Unzufriedenheit mit momentanen Lebenssituationen. Die derzeitige Lebenslage wird als mangelhaft befunden und ein Ausweg aus diesem Zustand gesucht. Die eigentliche Lebenskrise lässt sich nicht am Detail festmachen, festzuhalten ist aber, dass sie die Ursache für den Aufbruch ins Ungewisse darstellt. Ein Aufbruch aus gegenwärtigen Lebensverhältnissen ist auch immer ein Aufbruch in eine nicht bekannte und damit fremde Welt. In neuen Situationen werden alte vorher angeeignete Routinen neu überdacht, führen zu neuen Erkenntnissen, die bei der Bewältigung von Krisen nützlich sein können.
Der Krise und Routine -Ansatz von Oevermann unterstützt durch eine Hinwendung zu einem strukturellen Optimismus die Ausführungen von Becker maßgeblich. Der strukturelle Optimismus, ist ein Ansatz, der davon ausgeht, dass nicht in gewohnten, also routinierten Handlungen Neues entstehen kann, sondern erst in der Bewältigung von krisenhaften Situationen Neues beim Individuum etabliert werden kann. Oevermann weist exemplarisch den Satz: „Im Zweifelsfall wird es gut gehen“ (vgl. Becker, 2001, S. 11 und Oevermann, 2008, S. 5) hierfür aus. Die Begegnung mit dem Fremden und der Fremde dient als bildungsimmanentes Moment, in dem sich das Individuum mit seiner gesamten Körperlichkeit selbst als zentrales Steuerungsinstrument der Situationsbewältigung bewusst wird.
„Man muss der Zone der Vertrautheit fremd geworden sein, um sie wieder sehen zu können () wir nehmen nur das Unvertraute wirklich wahr. Um es anschauen zu können, ist Distanz nötig. () Nur das Unverständliche sucht man zu verstehen ()“ (Plessner, 2003, S. 92).
Jede Krise verlangt nach Entscheidungen, die getroffen werden müssen, selbst wenn man sich für nichts entscheidet, hat man sich damit dennoch für etwas entschieden. Durch die Entscheidungen, die getroffen werden, erlebt man ein Mehr an Selbsterfahrung, sie können zur Förderung eines Autonomiebewusstsein beitragen. Durch leibliche Erfahrung wird eindrucksvoll erkennbar, dass die Entscheidungen, die man getroffen hat, auch getragen werden müssen. Bei einer Fehlentscheidung beispielsweise, muss auch ein Scheitern in Kauf genommen werden. „Handeln wird riskant, und Zukunft wird bedeutsam“ (Becker, 1994, S. 205). Gerade die Bewältigung der Jugendphase im Übergang zur Adoleszenz kann mit einem abenteuerpädagogischen Ansatz folgenreich gestützt werden. In den Handlungskrisen, die im Jugendalter auftreten können, bietet das abenteuerliche Unterwegssein Möglichkeiten an, die einen lebensweltorientierten Ansatz verfolgen und die Individuen durch die Eigenschaften des Abenteuers altersgerecht ansprechen. Das Abenteuer darf dabei aber in keinem Falle in dem Sinne pädagogisiert werden, dass simulierte Krisensituationen die Folge wären. Durch eine gewisse Vorstrukturierung des Unterwegsseins, werden die Rahmenbedingungen gesetzt, eine Feinplanung bis ins kleinste Detail unterbleibt. Hauptaugenmerk muss immer die Zielgruppe sein, für die eine Unternehmung gedacht ist. Jedes Klientel benötigt dabei eine individuelle Berücksichtigung des sportpädagogischen Spektrums. Beispielsweise würde man mit einer Gruppe adipöser Jugendlicher nicht Klettern gehen, sondern eher eine angemessene Wanderung anstreben.
Ein Abenteuer stellt die Individualisierung des Lebens heraus und bietet durch das unmittelbare Erleben einen direkten Verweis auf die eigene Existenz. Es stellt einen Bezug zu dem jeweiligen „Selbst“ des Abenteurers her (vgl. Thiersch 1993, S. 40). Kanu fahren, Segeln, Klettern, Seekajak fahren, Schlittenhundetouren durch die Wildnis Lapplands oder Wanderungen durch unwegsames Gelände, sind Anlässe, den gewohnten Alltag zu verlassen, sich unbekannten Situationen auszusetzen und diesen adäquat zu begegnen: „ Sicherheit und Gleichförmigkeit werden gegen Ungewissheit und nicht planbaren Wechsel der Situation eingetauscht.“ (Becker, 2001, S. 12).
Die exemplarisch angeführten Unternehmungen verdeutlichen noch einmal die Distanz, die zwischen dem vertrauten Leben und dem eigenen „Ich“ geschaffen werden muss, damit festgesetzte Denk- und Handlungsmuster aufgebrochen werden und neue entstehen können. Durch die Auseinandersetzung mit den sich ergebenen Situationen und den ihnen innewohnenden Widerständen werden beim Individuum zwangsläufig neue Verhaltensmodifikationen angebahnt (vgl. Becker, 2001, S. 12).
Das Abenteuer-Modell ist wie maßgeschneidert für die Phase des Jugendalters, weil das Abenteuer Situationen entstehen lässt, die für Jugendliche spannend, authentisch und real sind. Die komplette Aufmerksamkeit wird auf die Bewältigung einer Krisensituation gelenkt, in der Entscheidungen getroffen werden müssen, für die im Hier und Jetzt und vor allem auch im Nachhinein eingestanden werden muss. Für den Bildungsprozess der Beteiligten gilt, dass Abenteuer nicht enden, nur weil
„() die Gletscher gequert und der Gipfel erklommen, der sichere Hafen endlich angelaufen oder alle Wehre und Walzen eines Bachs befahren wurden. Da im Abenteuer viel passiert, kann auch viel erzählt werden. Dynamik und Dramatik der im Abenteuer durchlebten Krisen und ihre erfolgreiche oder weniger erfolgreiche Bewältigung, die Komplikationen und Hindernisse, die auftreten, die Gefühle der Anspannung, der überwundenen Angst, des Glücks einer gelungenen oder die Ohnmacht einer gescheiterten Bewährung sowie der überschaubare Rahmen mit klarem Anfang und Ende ergeben Anlässe für Erzählungen“ (Becker, 2001, S. 12.).
Als Plätze für Zusammenkünfte bieten sich beispielsweise Lagerfeuerstellen für die Gruppen an. Aber auch im Nachhinein dienen die durchlebten Abenteuer als Erzählungen für Freunde, Bekannte oder sonstige GesprächspartnerInnen. Durch das Erzählen setzen sich die Individuen noch einmal mit dem abenteuerlichen Unterwegssein auseinander und reflektieren ihre Handlungen und Denkweisen in den Situationen, in denen es sich zu bewähren galt. Die Ausführungen machen deutlich, wie sich die abenteuerlichen Unternehmungen auch auf die Selbstbildung des Subjekts auswirken können. Durch das Durchleben und Durchstehen der Situation kann der Grundstein für einen autonom denkenden und handelnden Menschen gelegt werden (vgl. Bietz, 2005, S. 246). Neues an sich selbst kennenzulernen, auszutesten und selbst zu entscheiden, welchen Aspekten ein Stellenwert in der eigenen Identität zukommt, sind mit dem Bestehen von Abenteuern verbunden. Durch integrative Methoden wird der Umgang mit anderen Menschen in Form von Gruppenerlebnissen gepflegt. Hier geht es weitestgehend darum, das Empathieverständnis der Akteure zu schulen und sie miteinander in Diskurs treten zu lassen (vgl. Gilsdorf, 2004, S. 344).
Die pädagogische Arbeit in abenteuerlichen Situationen vermittelt auch das Erleben von Grenzerfahrungen, die dem Klienten dazu verhelfen sollen, noch nie zuvor erlebte Situationen zu bewältigen (vgl. Gilsdorf, 2004, S. 402).
„Ein solcher Erfahrungsprozess an der Grenze ist in der Regel geprägt von intensiven Gefühlen. Grenzerfahrung kann als verdichteter Prozess verstanden werden, in dem vieles, was in anderen Erfahrungen eher im Hintergrund mitschwingt, ins Zentrum des Bewusstseins und der Aufmerksamkeit kommt“ (Gilsdorf, 2004, S. 401).
Auch die an den abenteuerlichen Unternehmungen beteiligten Pädagoginnen und Pädagogen müssen ihre Rolle als Begleiter unkenntlich machen und sich in ihre wichtige Position einfügen. Im abenteuerlichen Unterwegssein ergeben sich andere pädagogische Handlungsmuster, die für den Erfolg der Unternehmung von großer Bedeutung sind.
„Grade diese Verbindung von Indirektheit und Verbindlichkeit, von Nötigung durch die Situation und Zurückhaltung im unmittelbar steuernden, vorgegebenen Handeln bestimmt die spezifische Form des pädagogischen Umgangs und die Kompetenz des Pädagogen “
(Thiersch, 1993, S. 46).
Nach den aufgeführten Argumenten könnte man die Abenteuer- und Erlebnispädagogik nun als eine Form der Pädagogik ansehen, die an sich schon eine geeignete theoretische Grundlage bietet, den Jugendlichen in schwierigen Lebenslagen einen Weg aufzuzeigen, mit sich selbst und ihrem Leben umzugehen. Durch eine Erweiterung in Form der Einbindung von Tieren (in diesem Fall Schlittenhunden) erlangt der Ansatz der Abenteuer- und Erlebnispädagogik nach der Auffassung der Autorin eine zusätzliche Aufwertung. Es handelt sich bildhaft gesprochen um einen Weg mit großem Potenzial, der begehbar ist, der allerdings zurzeit auf den theoretischen Landkarten der Abenteuer-und Erlebnispädagogik noch nicht umfassend genug verzeichnet worden ist. Diese Arbeit stellt den Versuch dar, einen Beitrag zur Vernetzung der beiden Themenfelder zu liefern und theoretische Ansätze für die Bezugswissenschaft zu initiieren.
Die Jugendlichen auf Entzug beschäftigen sich in ihrem Alltag in der therapeutischen Wohngemeinschaft des Kompass e.V. (siehe Kapitel 2) jeden Tag mit nordischen Hunderassen, die als Schlittenhunde zum Einsatz kommen. Einzelne Hunde dienen den Jugendlichen der Einrichtung als Bezugshund in allen auftretenden Situationen und als Sportbegleiter beim Training. Die Jugendlichen erlernen schnell, dass sie Verantwortung übernehmen müssen. Die Hunde halten die Jugendlichen im wahrsten Sinne der Bedeutung „auf Trab“.
Im Diskurs innerhalb der Bewegungspädagogik stellt das in Aktiontreten im Sinne einer körperlichen Ertüchtigung ein „konstitutives Grundprinzip von Bildung“ dar (Bietz, 2010, S. 3). Dass Bewegung und Bildung sich gegenseitig bedingen, gilt im Rahmen der bildungstheoretischen Debatte als gesichert. Es ist ein handlungsorientiertes und persönlichkeitsbildendes Unterfangen, sich als Betroffener auf eine hundegestützte Maßnahme einzulassen. Die Jugendlichen in Therapie bereiten sich auf das Bestehen von Abenteuern mit Schlittenhunden vor. Nach ihrem Bestehen kehren sie mit individuellen Eindrücken und Erfahrungen auf sportpädagogischen und sozio-emotionalen Gebieten zurück. In jedem Fall weist das neue Trendmedium „Schlittenhunde“ alle abenteuer- und erlebnispädagogischen Überlegungen im Zusammenhang mit den Grundgedanken zum Erlebnis- und Abenteuerbegriff auf.
Der wissenschaftliche Zugang im Bereich der tiergestützten Pädagogik ist, wie die bisherigen Ausführungen auch mit Bezügen zu kulturell evolutiven Wurzeln gezeigt haben dabei, derzeit zu einer eigenständigen Disziplin heranzureifen. Auf dem Gebiet der tier-gestützten Interventionen durchdringen sich die pädagogischen und therapeutischen Zugänge mit zunehmender Tendenz. Dem Bereich wird eine verstärkte Aufmerksamkeit der Bezugswissenschaften zuteil. Der Erweiterungsaspekt, suchtmittelerkrankten Jugendlichen mithilfe des Einsatzes von Hunden einen Weg aus der Drogensucht aufzuzeigen, gewinnt ebenfalls an Bedeutung (vgl. Achenbach, www.das-husky-projekt.de letzter Zugriff: 25.04.2014 und www.walden-net.de, letzter Zugriff: 25.04.2014). Die diesbezüglichen Aspekte von Pädagogik, Therapie und Entwöhnung werden in den folgenden Kapiteln genauer analysiert. Dabei wird versucht, die Erkenntnisse mittels bereits ermittelter empirischer Daten zu stützen. Es werden Thesen aus der Referenzliteratur ermittelt, die als effektive Grundprinzipien einem vorsichtigen Versuch, einer theoretischen Ergänzung der Grundlagen dienen könnten.
1.2 Vom Nutzen der Hunde in der pädagogischen Arbeit
Die Bedeutsamkeit der Einbindung von Tieren in der Sozialen Arbeit weist in Bezug auf Theorie und Praxis ein gewisses Ungleichgewicht auf. In der praktischen Anwendung lassen sich einige Institutionen mit pädagogischem Fachpersonal finden, die in diesem Zusammenhang mit den unterschiedlichen Tieren an den Problemlagen der Klienten arbeiten. In der diesbezüglichen Fachliteratur werden unterschiedliche Ansätze und Methoden beschrieben. Das Literaturangebot ist hier reichhaltig, vielfältige Ideen für Maßnahmen werden veröffentlicht.
Im Fachbereich der Pädagogik (Abenteuer- und Erlebnispädagogik) wird das Themengebiet dagegen streckenweise bezogen auf seine theoretischen Aspekte und Begründungen noch stark ausgeblendet (vgl. Buchner - Fuchs, 2012, S. 9). Daher werden die in der Praxis vorkommenden Ansätze durch die Pädagogik kaum theoretisch unterstützt und basieren mehr auf plausiblen Überlegungen.
Neben Tieren, die speziell für Dienstleistungen ausgebildet werden, wie beispielsweise Blindenbegleithunde, spielen auch Nutztiere wie Hühner, Ziegen und Esel, die man auf pädagogisch betreuten Aktivspielplätzen oder auf Jugendfarmen antrifft, sowie Hunde, Pferde, Katzen, Fische, Vögel und Nagetiere, die in stationären Einrichtungen gehalten werden, eine Rolle. Vereinzelt lassen sich auch Schulbegleithunde verzeichnen. Die Tiere werden je nach pädagogischem Setting eingebunden. In einigen Institutionen bildet der Einsatz von Tieren die eigentliche Basis für ein Gelingen, in anderen sind sie eher nur ein Begleitmedium (vgl. Buchner – Fuchs, 2012, S. 10).
Auch wenn man Themen über Tiere in den theoretischen Diskursen der Sozialen Arbeit schon hier und da vorfindet, besteht das Kernproblem bisher darin, dass sich bis heute hier kein diesbezüglicher Fachunterbereich ausbilden konnte. Die Ansätze, die im Zusammenhang mit Tieren und Pädagogik zu finden sind, sind ausgeborgte Ansätze aus anderen Fachgruppen wie der Biologie, Psychologie, Medizin und der Heil- und Sonderpädagogik (vgl. Rose, 2006, S. 211).
Trotzdem lassen sich nach Kirchpfening Verknüpfungen zur Sozialen Arbeit ableiten. Zusammengefasst stellt sie heraus: Die Soziale Arbeit mit Tieren bewirkt Änderungsvorgänge bei den betroffenen Jugendlichen und Verbesserungen bei der Bewahrung und Entstehung uneigennütziger Fähigkeiten (Kirchpfening, 2012, S. 16).
Rose merkt kritisch zu diesem Thema an, die Berichte über wundersame Therapieerfolge beim Einsatz von Tieren enthielten häufig mystisch anmutende Tendenzen (vgl. Rose, 2006, S. 208 ff).
Einem wissenschaftlichen Anspruch, der sich an ein Verstehen der Wirkzusammenhänge zwischen Mensch und Tier richtet, sind Geschichten über wundersame Heilungen abträglich. Tiere werden so zu einem Medium hochstilisiert, das den betroffenen Menschen aus anscheinend unerklärlichen Gründen Genesung zuteilwerden lässt.
Kusztrich stellt in diesem Zusammenhang die These auf: „Im gewissem Sinn sind Tiere sogar bessere Therapeuten als Menschen“ (Kusztrich, 1990, S. 393).
Es wird versucht, durch derartige Aussagen der Tiertherapie eine wundersame Wirkung und Kraft zuzuschreiben. Unwissenschaftliche Mystifizierungen schaden der Sache aber eher, als dass sie ihr nützen. In diesem Sinne ist auch die folgende Aussage einzuordnen: „Tiere sind >> Wunderheiler<<, die Menschen von ihrem Elend befreien können. Die Beziehung zu ihnen macht gesund und gut“ (Rose, 2006, S. 213).
Solche und ähnliche Aussagen können auch in der heutigen Zeit noch eine gewisse Anziehungskraft auf bestimmte wundergläubige Leserkreise ausüben. Es handelt sich dabei aber wohl kaum um wissenschaftliche Hypothesen. Über ihre Berechtigung lässt sich wissenschaftlich nichts aussagen, da sie nicht überprüfbar sind. Sie weisen keine Ansatzpunkte für eine Falsifikation auf und gehören daher in den spirituellen Bereich. Es gilt, eine solide wissenschaftliche Grundlagenforschung einzufordern. Populistische Einzelfallgeschichten bedienen eher den Boulevard Markt und bieten keine empirischen Ansätze der Überprüfbarkeit.
„In Kanada wurde () gefunden, dass ältere Menschen, die ein Haustier haben, zwar genauso häufig in ein Krankenhaus müssen, wie Menschen ohne Haustier. Aber die Tierbesitzer und -besitzerinnen blieben im Schnitt etwa acht Tage im Krankenhaus, während die Menschen ohne Tier über 13 Tage im Krankenhaus verweilten“ (Olbrich, 2000, S. 14).
Welche wissenschaftlichen Schlüsse lassen sich aus derartigen Untersuchungen ziehen? Die Antwort ist klar: Keine! Wissenschaftliche Beobachtungsdokumentationen auch in diesem Fachbereich müssen so gestaltet sein, dass Überprüfungen theoriebasierter Aussagen empirisch möglich werden.
So stellen die Autoren Vernooij und Schneider die Hypothese auf, tiergestützte Maßnahmen wirken sich auf die Körpermotorik und den Wahrnehmungsapparat des Menschen positiv aus, da durch den Umgang mit den Tieren auch immer Bewegung implementiert sei. Durch den Kontakt zum Tier würden auch emotionale Verbindungen zwischen den beiden Akteuren angebahnt (vgl. Vernooij, 2010).
Im Gegensatz zu den Aussagen mit spirituellem, mystischem Inhalt, ist es hier möglich, Beobachtungen so zu planen, dass auswertbares, valides Datenmaterial erzeugt und adäquate Testverfahren für die Hypothesen entwickelt werden können.
Gerade im sozialpädagogischen Bereich stehen Hunde im Fokus der therapeutischen Ansätze. Feddersen-Petersen erläutert anhand der Eigenschaften, die Hunden zugeschrieben werden, die große Beliebtheit dieser Tierart im Bereich der Sozialen Arbeit. Er behauptet, die Art und Weise wie sich ein Hund verständlich machen könne, werde vom Menschen in einer speziellen Form verstanden. Eine dem Hund eigene Kompetenz durchbreche arttypische Hürden zugunsten der Verständigung mit dem menschlichen Subjekt (vgl. Feddersen-Petersen, 2004).
Auf dem Gebiet der hundegestützten Arbeit speziell mit Schlittenhunden existieren derzeit keinerlei Erkenntnisse. Wenn auch die hier eingesetzte Hunderasse (Huskies) sich durch gewisse Eigenarten von anderen Hunderassen unterscheidet, so ist dennoch die Vermutung legitim, dass sie sich in den Diskurs um die tiergestützten Therapien problemlos eingliedern lassen. Die geplanten episodischen Interviews mit zwei betroffenen Jugendlichen könnten hier weitere Erkenntnisse liefern.
Es gibt in der tiergestützten Sozialen Arbeit bereits einen Katalog von Zielen auf der Grundlage des Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches (KJHG).
„Vermittlung von sozialer Kompetenz, Verbesserung von Anpassungsleistungen im sozialen Kontext, soziale Integration und Inklusion, z.B. durch Freizeitgestaltung und Erlebnispädagogik: Persönlichkeitsbildung, Beteiligung; Prävention im Bereich Gesundheit: Ernährung, Bewegung, Umweltbildung; Gemeinwesenarbeit“ (Kirchpfening, 2012, S. 24).
Diesen Zielkatalog können Einrichtungen, in denen tiergestützt gearbeitet wird, weitgehend zur Begründung eines pädagogischen Handelns nutzen.
Der Einsatz von Hunden in der pädagogischen Arbeit bildet eine spezifische Methode ab: Tiere dienen dazu, Vorgänge anzustoßen, Selbstbildungsprozesse herzuleiten oder als Ansporn zur Implementierung neuer Antriebskraft bei den Jugendlichen (vgl. Kirch-pfening, 2012, S. 24).
Erwin Breitenbach untersucht im Rahmen von fünfundzwanzig wissenschaftlichen Erhebungen die Auswirkungen von Tieren auf den Menschen. Sieben Studien beziehen sich auf den Einsatz von Pferden, vier auf den von Hunden, dreizehn Studien befassen sich mit Delfinen und in einer Untersuchung tauchen unterschiedliche Tierarten auf. Die hier elaborierten Materialien beziehen sich ausschließlich auf Menschen mit einer körperlichen Beeinträchtigung. Breitenbach stellt deutlich heraus, dass im Bereich Kommunikation und Interaktion ein großes Feld geboten wird, in dem die Betroffenen den Tieren begegnen können (vgl. Breitenbach, 2006, S. 3). Durch diese Interaktionsfläche eröffne sich ein im Aufbau befindendes Selbstwertgefühl, das durch eine Handlung zum Vorschein käme, indem ein Wagnis eingegangen werde. Dem Tier werde ein Vorschussvertrauen zuteil, was auf der Klientenseite einen Zuwachs an Überwindung zufolge habe. Der Autor stellt die Vermutung auf: „Kinder () wirken mutiger. Sie probieren vermehrt Neues aus und trauen sich mehr zu“ (Breitenbach, 2006, S. 4). Corson begründet die These Breitenbachs durch ein wachsendes Selbstwertgefühl bei Menschen, die mit Hunden in Kontakt kamen (vgl. Corson, 1975, S. 277 ff).
Eine Beeinflussung des Autonomiebewusstseins stellen die Untersuchungen von Duncan und Allen heraus (vgl. Duncan / Allen, 2000, S. 303 – 323). Ein festzustellender Zuwachs an eigenständigen Denkansätzen und Handlungsoptionen der Heranwachsenden könne als eine Optimierung ihrer Fähigkeiten gedeutet werden. Die Klienten müssen in multiplen Problemlagen eigene Strategien entwickeln, um mit der Situation umgehen zu können. Sie haben hier wie bei dem Abenteuermodell von Becker die Chance altbewährte Routinen mit neuen Verhaltensmustern zu versehen, die sie innerhalb der sich ergebenen Umstände entwickeln. Wie sich der Kontakt mit dem Tier herstellen lässt, liegt teils auch in der Verantwortung der Klienten. Durch die Auseinandersetzung mit dem Tier kann ein meditativer Zustand hervorgerufen werden, der eine innere Befriedigung und ein Wohlbehagen der eigenen Befindlichkeit zur Folge hat. Breitenbach behauptet: „Die Menschen werden im Zusammensein mit Tieren selbstzufriedener und zeigen vermehrt positive Emotionen, wie zum Beispiel Freude“ (Breitenbach, 2006, S. 4).
Das Fachkrankenhaus Vielbach (in der Nähe von Frankfurt am Main) ist spezialisiert im Bereich Alkohol- und Medikamentenabhängigkeit und arbeitet seit vierzig Jahren im Bereich der tiergestützten Arbeit. Das Fachkrankenhaus stellt die positive Wirkung von Tieren auf Suchtmittelabhängige Menschen ebenfalls fest.
„Die Ausschüttung von „Glückshormonen“ wie Oxytozin und Serotonin, die Menschen beim Streicheln eines Tieres erleben, ist grade für Suchtkranke von besonderer Bedeutung. Diese haben entsprechende Gefühlszustände bisher vorrangig durch den Konsum psychotroper Substanzen versucht zu erlangen“ (http://www.fachkrankenhaus-vielbach.de/index.php?option=com_content&view=article&id=158&Itemid=154, letzter Zugriff: 30.03.2014).
Auch der Bewegungsaspekt, der im Zusammenspiel von pädagogischen Interaktionen zwischen Mensch und Tier Einzug erhält, gilt als gesundheitsfördernd (vgl. ebd.).
Bei all diesen dargelegten Effekten handelt es sich um intuitive Aussagen, die auf beobachteten Phänomenen basieren. Es fehlen wissenschaftsbezogene empirische Überprüfungen, ohne die sie nicht in einschlägigen Theorien manifestiert werden können. Erziehung und praktizierte Pädagogik ist auf eine längerfristige allumfassende, zeitlich nicht unterbrochene Zeit ausgelegt. Greiffenhagen, eine anerkannte Autorin auf dem Fachgebiet der tiergestützten Interventionen, listet die Bandbreite der Einflüsse von Tieren auf den Menschen auf:
„Sie senken >>den Blutdruck des menschlichen Partners und stabilisieren – empirisch hundertfach glasklar bewiesen- seinen Kreislauf; sie bringen Zärtlichkeit und Sinnlichkeit in den Alltag, dienen als >>soziales Gleitmittel bei der Kontaktsuche zu anderen Menschen<< (), lehren Empathie und nonverbale Kommunikationsfähigkeit, reizen zum Lächeln und Lachen und sorgen auf diese Weise bei Tierhaltern mehrfach am Tag für die Ausschüttung körpereigener Glückshormone<<“ (Greiffenhagen, 2003, S.23).
Eine empirische Studie aus dem Jahr 2005 hat ergeben, dass sich die Zahl an Haustieren im Jahr 2004 in deutschen Haushalten auf ca. 23,1 Millionen Tiere belief (Hunde, Katzen, Kleintiere) (Rose, 2006, S. 208). In einer Untersuchung aus dem Bereich der Kinder und Jugendhilfe wurde festgestellt, dass 90 % der befragten Kinder und 79% der befragten Jugendlichen ihre Haustiere als wichtig bis sehr wichtig für ihren Lebensweg einstuften. Die Studie belegt ein Anthropomorphisieren der Tiere. Den Tieren werden menschliche Eigenschaften zugesprochen, sie werden vermenschlicht. Rose stellt an der Fachhochschule Frankfurt am Main bei angehenden Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen eine zunehmende Tendenz fest, einen Hund mit in die Vorlesung zu bringen. Viele ihrer Studierenden geben an, später gern „>> was mit Tieren<< machen zu wollen“, einige können bereits schon jetzt von ersten Arbeitserlebnisse aus dem Bereich der tiergestützten Interventionen berichten (ebd.).
Der Arbeitsbereich der Sozialen Arbeit wird durch den Kontakt mit Tieren verändert und kann in zwei unterschiedliche Dimensionen unterteilt werden, zum einen in die Dimension „Tiere als Gefährten des Alltags“ und zum Anderen in die der „Tiere als Helfer“ (ebd., S. 208 – 210). Es wird herausgestellt, dass das Klientel, mit dem sich die Soziale Arbeit beschäftigt, häufig Tiere besitzt, die nicht in die jeweiligen Einrichtungen (Drogenentzugsanstalt, Obdachlosenhilfe, Psychiatrischen Einrichtungen oder Heimen) mitgenommen werden können. Wie geht die Soziale Arbeit mit diesen Umständen um? Sie sind sicherlich einer positiven Beeinflussung der Klientel abträglich.
„Dies verweist einmal mehr auf die grundsätzliche Notwendigkeit der Sozialen Profession, sich der Mensch-Tier-Beziehung zu widmen: Wenn Tiere existentiell bedeutsame Beziehungsobjekte der AdressatInnen Sozialer Arbeit sind, müssen Fachkräfte und Institutionen diese Realität verstehen und mit ihr fachlich adäquat und integrationsfördernd umgehen.“ (ebd., S. 209)
Die sozialen Effekte, die ein Tier bei dem Menschen ausüben kann, werden von Otterstedt herausgestellt. Menschen, die sich mit Tieren beschäftigen, seien in erster Linie nicht allein und erführen durch das Tier auch keine Abkapselung. Tiere böten dann auch in der menschlichen Kommunikation einen Anlass, sich mit seinem Gegenüber auszutauschen.
Die Anwesenheit eines Tieres beschleunigt den Kontakt zu Gesprächspartnern und kann als erster „Eisbrecher“ (Hartmann, 2010, S. 82) genutzt werden. Die Verbundenheit zum Tier schweißt in allen Lebenslagen zusammen und trägt zur Angliederung in der Gesellschaft bei. Beim Auftreten von Konflikten kann das Tier als vermittelnder Faktor ebenfalls zur Klärung beitragen. Als Beispiel wird hier der Aspekt des Erhebens der Stimme genannt, der durch die Rücksichtnahme auf das Tier abgemildert werden kann. So können Streitgespräche in einem Lautstärkepegel entstehen, der eventuell zur Konfliktbewältigung beitragen kann (vgl. ebd.).
Im Bereich der Bildungswissenschaften existieren unterschiedliche Ansichten über optimale Entwicklungsoptionen und effektive Lernstrategien des Menschen (vgl. Schäfer, 1995, S. 18). Verantwortliche Faktoren für die Entwicklung neuer Handlungsmuster bei Kindern und Jugendlichen hängen eng mit der intrinsischen Motivation der betroffenen Individuen zusammen. Der für den Umgang im Kindes- und Jugendalter so wichtige Selbstbildungsprozess kann durch das Training mit Schlittenhunden insbesondere bei der angesprochenen Problemgruppe angestoßen, positiv beeinflusst und gestaltet werden. Durch das aktive Handeln und das stete Kooperieren mit den Hunden wird ein resilientes Verhalten gefördert. In der fachlichen Literatur wird Resilienz als physische Widerstandskraft betitelt, die es Kindern oder Erwachsenen ermöglicht, trotz biologischer, psychologischer oder sozialer Entwicklungsrisiken bei schlechten Lebensbedingungen eine gesunde Entwicklung zu vollziehen. Bevorstehende Risiken werden von diesen Personen ohne abweichendes Verhalten bewältigt (vgl. Zander, 2008, S. 18). Entscheidend für den Begriff der Resilienz ist aber nicht nur das positive Entwicklungsergebnis, sondern auch noch zwei weitere wichtige Faktoren, wie Wustmann betont (vgl. Wustmann, 2004,). Zum einen muss die Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen signifikant in Bedrohung sein, zum anderen muss eine Bewältigung dieser belastenden Lebensumstände erfolgen (vgl. Zander, 2008, S. 18).
Resilientes Verhalten zeigt sich dann, wenn ein Jugendlicher eine Situation erfolgreich bewältigt hat, die als risikoerhöhende Gefährdung für seine Entwicklung angesehen werden konnte, wie beispielsweise die Scheidung der Eltern, Tod einer Bezugsperson, Aufwachsen in Armut und viele weitere belastende Ereignisse (vgl. Fröhlich-Gildhoff/ Rönnau-Böse, 2009, S.10). Resilienz ist keine angeborene Fähigkeit, sondern ein Resultat aus der Interaktion zwischen Individuum und Umwelt. Dies bedeutet, dass jedes Individuum regulierend Einfluss auf seine Umwelt nimmt, Resilienz ist also eine dynamische Größe, die abhängig von unseren Erfahrungen und bewältigten Erlebnissen größer oder kleiner sein kann. Eine Person kann somit in einer Situation resilient sein und im nächsten Moment jedoch Schwierigkeiten haben, eine Risikosituation zu bewältigen. Resilienz ist demnach kein Garant für immerwährende Unverwundbarkeit (vgl. ebd., S. 10).
Resilienz ist keine auf Ressourcen des Individuums beschränkte Fähigkeit, sondern auch soziale „Schutzfaktoren“ haben eine wichtige Bedeutung in der gesunden Entwicklung. Das Fehlen von Resilienz soll daher nicht als individuelles Charakterdefizit interpretiert werden, sondern betonen, sowohl Erziehung, Bildung, Familie und soziale Netzwerke stellen ein entscheidendes Faktum in der Entwicklung dar (vgl. ebd., S. 11). Das Individuum selbst tritt in Erscheinung und muss reagieren. Ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen defizitärem Verhalten, wie es bei von Suchtmitteln abhängigen Jugendlichen auftritt und einer unzureichend entwickelten Resilienz gegenüber belastenden Situationen ist evident.
Die innige Verbundenheit mit Schlittenhunden in anspruchsvollen Situationen ist der Entwicklung von Strategien für zu erwerbende Resilienz absolut zuträglich. Die so entwickelten Handlungsstrategien können in zukünftigen Stresssituationen dazu beitragen, späteren erneuten Drogenkonsum zu verhindern. Durch den engen Kontakt zu den Hunden entwickelt sich eine mit nichts vergleichbare Dynamik zwischen Mensch und Tier. Beide Akteure können und müssen sich aufeinander verlassen können. Wenn die Rede von Selbstbildungsprozessen ist, so korrespondieren die unterschiedlichen Faktoren Bewegen, Handeln und Erfahren miteinander.
Um die Mensch-Tier-Beziehung aus bindungstheoretischer Sicht zu interpretieren, kommt ein von Bowlby (1968) und Answorth (1969) entwickelter Ansatz zur Anwendung. Nach diesem Ansatz ist das Vorhandensein oder Fehlen von Beziehungen in der frühen Kindheit maßgeblich für die soziale und emotionale Kompetenz des Heranwachsenden verantwortlich. Daraus lassen sich vier unterschiedliche Desiderata von Bindungstypen mit ihren speziellen Eigenschaften ableiten: Bindungsunsicherheit, Bindungsvermeidung, Bindungsambivalenz und Bindungsdesorientierung (vgl. Beetz, 2006, S. 27 ff). Diese Bindungsdefizite können laut Möhrke (Begründerin der Canepädagogik, Praxis Dortmund) durch Einsatz von Hunden abgemildert werden.
Jugendliche werden über den „ Aufbau eines positiven Selbstkonzeptes“ befähigt, „mit sich, ihren Mitmenschen und Situationen angemessen umzugehen“ (Vernooij / Schneider, 2008, S. 165).
Tiere können im Kinder- und Jugendbereich schnell zu „Sozialpartnern“ avancieren (Pohlheim, 2006, S. 16). Die Bewegungsfreude der Schlittenhunde kommt dem Bewegungsdrang der Jugendlichen entgegen.
„Tiere lehren ein Paradoxon. Sie machen Jugendlichen klar, dass sie Hunger nach Liebe, Aufmerksamkeit und Fürsorglichkeit ein Stück weit stillen lässt, wenn es gelingt, selbst fürsorglich zu sein.“ (Pohlheim, 2006, S. 17)
Vertrauen wird geschaffen, Körperbeherrschung und Motivation der Jugendlichen wieder etabliert. In Kombination mit dem Spüren und Erleben von erfolgreichen Handlungen lernen sie eine neue Erlebnisfähigkeit kennen. Die Arbeit mit den Hunden löst sowohl positive als auch negative Emotionen aus. Ein handlungsnaher Umgang mit dem eigenen Verhalten wird durch die Arbeit mit ihnen verdeutlicht und spürbar. Die Wahrnehmungsfähigkeit wird gefördert, indem die Jugendlichen in ihrer Zusammenarbeit mit den Hunden die Bedürfnisse des Hundes erkennen. Dadurch wird ihr Einfühlungsvermögen geschult. Ein neuer Alltag wird in Einklang mit den Hunden eingeübt und erhält durch die Fütterungszeiten des Hundes auch geregelte Vorgaben. Durch Sozialpädagogen, Therapeuten und Schlittenhundeexperten wird den Jugendlichen alles rund um den Schlittenhundesport beigebracht. Der Ansatz mit Schlittenhunden ist ein handlungsorientiertes Feld, auf dem auch ein abenteuer- und erlebnispädagogischer Charakter bestens ersichtlich wird (vgl. www.kompass-elsholz.de, letzter Zugriff: 25.01.2014).
Bisher wurden die Aspekte der Jugendlichen in den Fokus genommen. Wie steht es aber mit Hunden, die maximal alle drei Jahre ihre Bezugsperson wechseln.
Es ist zu beobachten, dass die Hunde im Anschluss eine gewisse „Trauerzeit“ benötigen, um mit dem Verlust fertig zu werden. Sie verweigern teilweise eine Zeitlang die Nahrungsaufnahme. Da aber zu jedem Zeitpunkt auch intensive Kontakte zu den Tierpflegern und anderem Personal unterhalten werden, scheint ihre psychische Situation stabil zu bleiben. In Ausnahmefällen benötigen einige Hunde eine längere Zeit. Aggressive Verhaltensweisen neuen Bezugspersonen gegenüber sind nicht bekannt, zumal es sich um Hunde handelt, die in einem artgerechten Rudel leben.
1.3 Hunde im Therapieeinsatz
Der Begriff der Tiertherapie (Pet Therapie) hat seine Ursprünge in der Nutzung von Lebewesen im praktizierenden Bereich der Psychologie (vgl. Frömming, 2006, S.28). Im Jahre 1969 entdeckte der Psychologe Boris Levinson seinen Hund als Medium für seine Klienten.
„Es war der reine Zufall, dass Levinson seinen Hund Jingles mit in die Praxis nahm, als er von einem verhaltensgestörten Jungen mit seinen Eltern schon vor der verabredeten Zeit aufgesucht wurde.“ (Frömming, 2006, S.28).
Über den direkten Kontakt des Jungen mit dem Tier gelang der Einstieg in eine Therapie ohne Hindernisse.
Das Tier wird in den Ausführungen von Greiffenhagen nicht als Therapie, Therapeut oder Kotherapeut verstanden (Greiffenhagen, 2007, S. 197). Es wird als Medium beschrieben, das durch seine Anwesenheit den Genesungsprozess der Klienten unterstützt (vgl. ebd., S. 172). Die Hunde, die zur Unterstützung des Therapieverlaufs in entsprechenden Einrichtungen eingesetzt werden, üben nach Greiffenhagen auch positive Einflüsse auf jene Jugendlichen aus, die sich bisher jeglichen Erziehungsversuchen gegenüber resistent zeigten (vgl. ebd., S. 196).
In der schweren Zeit der Drogenentwöhnung treten häufig physische und psychische Konflikte auf, die durch den Hund entschärft werden. Durch ihn wird die Interaktion zwischen Pädagogen, Therapeuten und Klienten unterstützt.
„Einerseits übertragen die jungen Leute den Hass auf ihre bisherige Umwelt auf diese neuen Autoritäten; andererseits idealisieren sie ihre Lehrer und werben um ihre Liebe. Ständig warten sie auf Signale, die ihnen zeigen sollen, was die Erwachsenen von ihnen halten. Tiere wissen nichts von dieser prekären Situation und können, insbesondere in der ersten Phase des Resozialisierungsprozess, deshalb besonders hilfreich sein.“ (ebd., S. 196)
Die Mensch-Tier-Beziehung ist von großer Wichtigkeit für die Gesundheit und das Wohlbefinden (vgl. ebd., S. 30).
- „Der körperliche Kontakt mit dem Tier löst Verhärtungen; angstfreie Zärtlichkeit öffnet den Weg zu psychischer Stabilität.“ (ebd., S. 196)
- „Tiere vermitteln Verantwortungsgefühl gegenüber schwächeren Wesen.“ (ebd.)
- „Tiere vermitteln Erfolgserlebnisse (des Könnens, des Gefolgsschaftsfindens, des Beneidentswerdens).“ (ebd.)
- „Das Tier ist geduldig und erzieht zur Geduld“ (ebd.)
- „Das Tier sendet keine Signale der Ablehnung aus. ()“ (ebd.)
Die Erlebnistherapie bezieht psychoanalytische Ansätze direkt mit ein. Dies lässt sich auch auf dem Gebiet der Suchtmittelentwöhnung wiederfinden (vgl. Gilsdorf, 2004, S. 17).
Im Laufe der Zeit hat sich der Mensch in unseren Regionen immer weiter von der Natur entfernt und gelernt, in die Natur aktiv einzugreifen (z.B. mit Gentechnologie). Die Krise des 21. Jahrhunderts besteht weitestgehend darin, dass der Kontakt zwischen der ursprünglichen Natur und den Menschen unterbrochen ist (vgl. Frömming, 2006, S. 4). Der Kontakt zwischen den Lebewesen (Mensch und Tier) wird in der Wissenschaft als Biophilie betitelt. Soziologen und Ethnologen stellten eine seit der frühen Menschheitsgeschichte existentielle Verbundenheit zwischen unterschiedlichen Lebensformen fest. Die Mensch-Tier-Beziehung ist in den unterschiedlichen Bereichen miteinander verknüpft. Beispielsweise sei auf die frühzeitlichen überlebenssichernden Funktionen, die nonverbale Kommunikation im Interagieren mit anderen Lebensformen oder aber auch auf die sozial- und psychologischen Strategien im gegenseitigen Umgang hingewiesen (vgl. Otterstedt, 2009, S. 113).
„Begegnung als zentrales Thema therapeutischer Arbeit ist nicht notwendigerweise eingeschränkt auf zwischenmenschliche Begegnungen. Der Kontakt zwischen Mensch und Tier hat eine eigene Qualität. Durch den Wegfall sprachlicher Verständigung und sozialer Normen können Hemmungen genommen, intensiver körperlicher Kontakt erlebt und die Wahrnehmung für die subtilen Zeichen analoger Kommunikation geschärft werden. Der Umgang mit Tieren hat in anderen Zusammenhängen schon länger Einzug in therapeutische Kontexte erhalten. Denkbar ist in diesem Sinne, dass bewährte Methoden, wie etwa therapeutisches Reiten, in einen erlebnistherapeutischen Kontext integriert werden und darüber hinaus, dass der Umgang mit Tieren im spezifischen abenteuerlichen Zusammenhang stattfindet, wie etwa bei einer Expedition mit Schlittenhunden.“ (Gilsdorf, 2004, S. 157)
Es gibt Tiere, die beim Menschen negative Gefühle erzeugen, wie etwa Schlangen oder Spinnen. Die Begegnung mit diesen Tieren löst in der Regel eine evolutionsbedingte archaische Flucht mit dem Ziel aus, der Begegnung zu entrinnen. Von anderen Begegnungen mit Tieren gehen dagegen positive Effekte aus, etwa von der Begegnung mit Hunden oder Pferden, die einen Aufforderungscharakter aufweisen und sich den menschlichen Bedürfnissen eher zuwenden. Wenn von der Biophilie die Rede ist, dann spielt auch immer gegenseitige Empathie eine große Rolle. Dann zeigt sich,
„() dass Wirbeltiere und insbesondere Säugetiere eine Reihe von >>social tools<< besitzen, die unter anderem in den neurologischen Substraten von Emotionen nachgewiesen werden können; sie lassen sich im sozial-sexuellen Verhalten erkennen und werden im sozialen Bindungsverhalten ebenso wie in bestimmten Prozessen des Umgehens mit Stress erkennbar“ (Otterstedt, 2009, S. 114).
Durch den Kontakt zum Tier werden zahlreiche psychosoziale Wirkungen hervorgerufen. Das Erlernen des Umgangs mit dem Tier bietet auch einer geistigen Aktivierung in unterschiedlichen Hirnarealen einen neuen Anstoß. Somit kann ein Lernzuwachs erfolgen. Eine Affektregulierung und ein Gefühl des Wohlfühlens können durch die unterschiedlichen Zugänge erschlossen werden. Kompetenzen im Bereich der Steigerung des Selbstwertgefühls sind zu verbuchen. Vertrauen, Kooperationsvermögen und Projektionsflächen werden geschaffen (vgl. Hartmann, 2010, S. 81).
Die Wissenschaft spricht in diesem Bereich von der sogenannten Du-Evidenz. Im Jahre 1931 formulierte der Soziologe Theodor Geiger im Rahmen von Mensch-Tier Interaktion den Begriff. Du-Evidenz ist die Fertigkeit der Schaffung einer gegenseitigen Akzeptanz und die Befähigung ein Lebewesen als ein gegenüberliegendes Subjekt anzuerkennen (vgl. ebd. S. 92). Damit Du-Evidenz überhaupt entstehen kann, ist es erforderlich, subjektive Emotionen entwickeln und sich empathisch in andere Lebensformen hineinversetzen zu können: „Menschen gehen bevorzugt Du-Beziehungen mit sozial lebenden Tieren wie Pferden und Hunden ein“ (Vernooij / Schneider, 2008, S. 8)
Hieraus lässt sich ableiten, dass sich Menschen mit Hunden anfreunden und mit ihnen in einer Symbiose zusammen leben können. „Hierin liegt beträchtliches therapeutisches Potential“ (Vernooij / Schneider, 2008, S. 8). Einer sozial-emotionalen Entwicklung steht kein Hindernis im Weg. Natürlich muss auf beiden Seiten ein gegenseitiges Interesse aneinander vorhanden sein. Ein Aufeinandertreffen von Mensch und Tier kann in unterschiedlichen Facetten in Erscheinung treten. Entscheidend ist aber, dass der Mensch das Tier als etwas Wertvolles und damit etwas Unverwechselbares anerkennt. Schon allein die Tatsache, dass sich Menschen für Ihre vierbeinigen Gefährten Namen überlegen, stimmt in den Kanon der Individualisierung ein (vgl. ebd. S. 92). Dass die Du-Evidenz eine bedeutende Rolle spielt, veranschaulicht das folgende Zitat des Zoologen Konrad Lorenz:
„Ein Mensch, der ein höheres Säugetier, etwa einen Hund oder einen Affen, wirklich genau kennt und nicht davon überzeugt wird, dass dieses Wesen ähnliches erlebt wie er selbst, ist psychisch abnorm und gehört in die psychiatrische Klinik, da eine Schwäche der Du-Evidenz ihn zu einem gemeingefährlichen Monstrum macht“ (Otterstedt, 2009, S. 33; zitiert nach Sambraus, 1995, S. 37).
Damit den therapeutischen Bemühungen in diesem Fall ein Mehrwert zugeschrieben werden kann, müssen sich die Akteure intensiv miteinander beschäftigen. Innerhalb der Interaktion zwischen Mensch und Tier entstehen handlungsleitende Prozesse auf allen Ebenen. Die Du-Evidenz ist die Voraussetzung für den pädagogischen und therapeutischen Einsatz von Tieren“ (ebd., S. 93), der in der Praxis Anwendung findet.
Die Züchtung bestimmter Hunderassen für definierte Aufgaben, ist allgegenwärtig. Häufig werden Hunde nur als Statussymbol gehalten oder werden kommerziell genutzt. Dennoch gelten sie vielen Menschen auch heute noch als treue, verlässliche Begleiter, die dem Aufbau sozialer Beziehungen dienlich sein können. Auch deshalb hebt sich der Hund als ein sinnvoller Begleiter für einen Suchtmittelentzug heraus.
[...]
- Arbeit zitieren
- Viktoria Wloka (Autor:in), 2014, „Auf den Hund gekommen“. Tiergestützte Abenteuer- und Erlebnispädagogik mit Schlittenhunden, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/308213
Kostenlos Autor werden
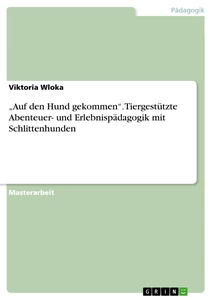










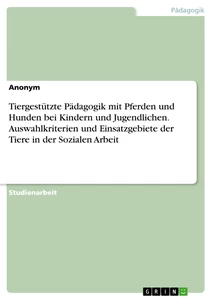








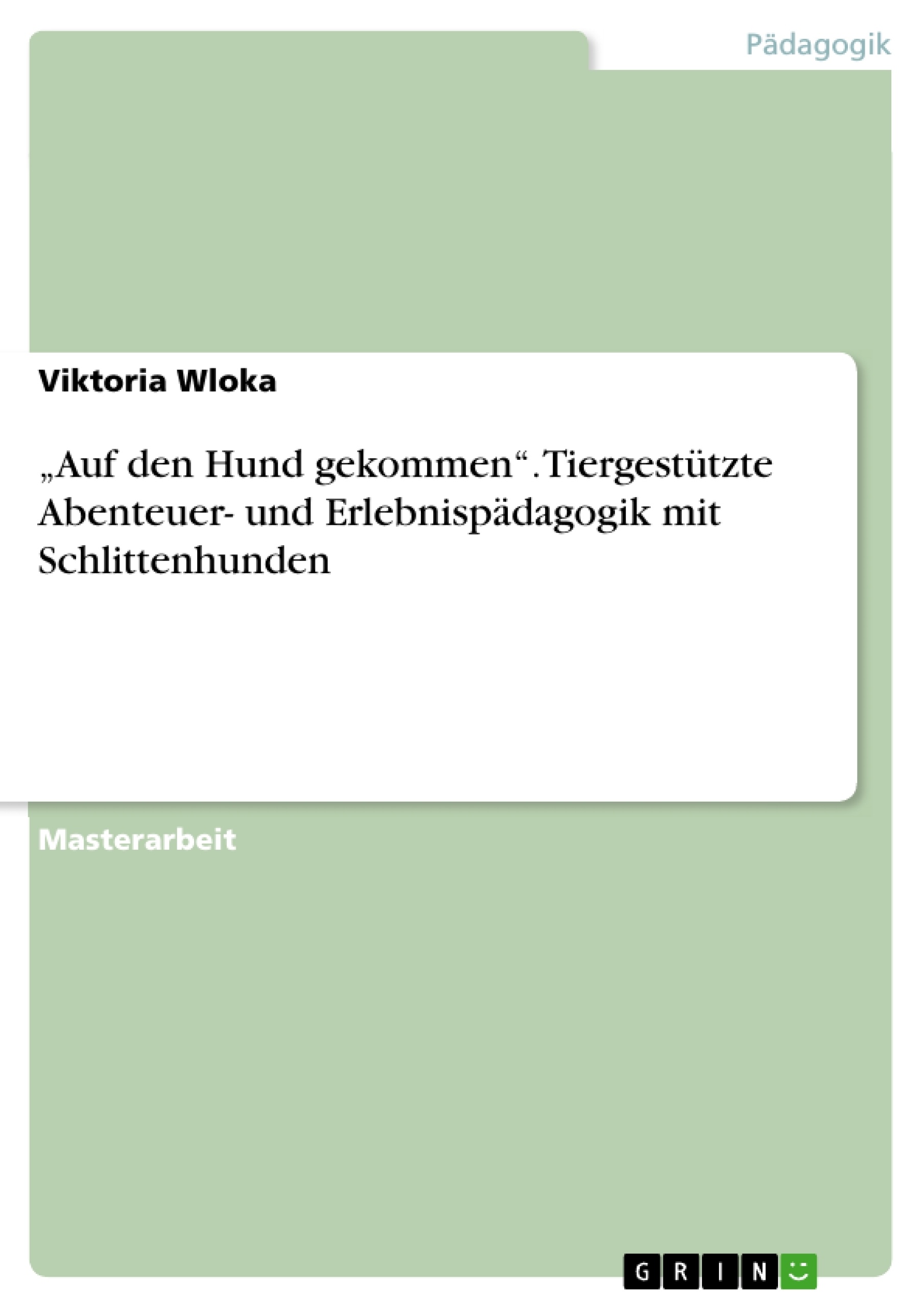

Kommentare