Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Musik und Jugend
2.1 Musik
2.1.1 Geschichte der Musik
2.1.2 Musiknutzung in der heutigen Zeit
2.2 Jugend
2.2.1 Geschichte der Jugend
2.2.2 Jugend in der modernen Gesellschaft
2.3 Bedeutung von Musik im Jugendalter
3. Musikalische Selbstsozialisation
3.1 Die Theorien Bourdieus
3.1.1 Der Habitus
3.1.2 Kapital und Klasse
3.1.3 Geschmack als Mittel zur Distinktion
3.2 Musikalische Sozialisation
3.3 Das Konzept der Selbstsozialisation
3.3.1 Das Modell des produktiv Realität verarbeitenden Subjekts
3.3.2 Selbstsozialisation
3.4 Das Konzept musikalischer Selbstsozialisation
3.4.1 Kritik am Konzept
4. Unsichtbare Bildungsprogramme in Jugendszenen
4.1 Jugendkultur(en), Subkultur und Szene
4.2 Der Kompetenz-Leitfaden
5. Heavy Metal
5.1 Die Szene und ihre Musik
5.2 Der Metal-Stil
5.3 Szenetreffpunkte und –Events
6. Das unsichtbare Bildungsprogramm der Heavy Metal-Szene
6.1 Basale szeneintern relevante Kompetenzen
6.2 Szeneintern relevante Kompetenzen zur Ressourcenschöpfung
6.3 Allgemein alltagspraktisch relevante Kompetenzen
6.4 Nicht-zertifizierte berufspraktisch relevante Kompetenzen
6.5 Quasi-zertifizierte berufspraktisch relevante Kompetenzen
6.6 Formal-zertifizierte berufspraktisch relevante Kompetenzen
7. Fazit
Literaturverzeichnis
1. Einleitung
„Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum.“ (Friedrich Nietzsche)
„Musikalische Selbstsozialisation Jugendlicher im Heavy Metal[1] “ – Was ist darunter zu verstehen? Wie kann der Umgang mit einer grundsätzlich negativ belasteten, Musikrichtung förderlich für die Sozialisation von Jugendlichen sein? Müsste sich die Beschäftigung damit nicht eher nachteilig auf deren Entwicklung auswirken?
Fakt ist, dass sich laut einer Studie aus dem Jahr 2013 etwa drei Viertel der 15 bis 29 jährigen Deutschen einer Jugendszene zugehörig fühlen (tfactory 2013). Die Heavy Metal-Szene zählt dabei zu den zahlenmäßig am stärksten vertretenen Szenen. Wäre eine so hohe Beteiligung daran überhaupt möglich, wenn Szenen schädlich für deren „Mitglieder“[2] wären?
Jugendszenen fallen häufig negativ auf. Besonders die Heavy Metal-Szene kann auf den ersten Blick wie ein Haufen betrunkener und pöbelnder Langhaariger erscheinen. Bei genauerer Beschäftigung mit der Szene stellen sich diese Vorurteile jedoch oft als unbegründet heraus.
Jugendszenen scheinen eine immer größere Rolle im Leben Jugendlicher einzunehmen, weshalb es wichtig erscheint, zu untersuchen, wie sich diese auf die Heranwachsenden auswirken.
Das Ziel dieser Arbeit ist es, die Bedeutung von Musik und musikalischen Jugendszenen, sowie deren Einfluss auf die Entwicklung und Sozialisation Jugendlicher darzustellen. Es soll außerdem gezeigt werden, dass das schlechte Bild, das viele Menschen von Heavy Metal und Fans des Genres haben, nicht ganz der Wahrheit entspricht.
Aus pädagogischer Sicht ist die Behandlung dieses Themas als relevant anzusehen, da besonders in der Jugendarbeit das Wissen darüber, wie Jugendliche Musik verwenden und wie Musik dazu verwendet werden kann, Jugendliche zu erreichen, von Vorteil ist.
In Form einer theoretischen Abhandlung sollen die genannten Ziele erreicht werden.
In der modernen Jugendforschung hat vor allem Ronald Hitzler den Szene-Begriff geprägt. Sein gemeinsam mit Arne Niederbacher verfasstes Buch „Leben in Szenen“ (Hitzler/Niederbacher 2010) soll als Grundlage für das Verständnis von Jugendszenen in dieser Arbeit dienen. Speziell für die Heavy Metal-Szene ist diesbezüglich Bettina Roccors Doktorarbeit über die Szene (Roccor 1998) als deutsches Standardwerk zu betrachten.
Die vorliegende Arbeit gliedert sich in Sieben Kapitel, wobei das 1.Kapitel in Form dieser Einleitung an das Thema heranführen und die Zielsetzung der Arbeit darstellen soll.
Das 2.Kapitel gibt einen Überblick über die geschichtliche Entwicklung von Musik und Jugend in der Gesellschaft. Des Weiteren wird geklärt, wie und vor allem, warum Menschen Musik hören und welche besondere Rolle die Musik in der Jugendzeit einnimmt.
Im 3. Kapitel wird nach einer Darstellung der Debatte um den Selbstsozialisationsbegriff das von Renate Müller entwickelte Konzept musikalischer Selbstsozialisation vorgestellt.
Zuvor soll jedoch in die Theorien Pierre Bourdieus eingeführt werden, da diese für ein besseres Verständnis der musikalischen Selbstsozialisation unabdingbar sind.
Als weitere Grundlage werden die Begriffe „Sozialisation“ und „musikalische Sozialisation“ geklärt.
Das 4. Kapitel hat Ronald Hitzlers und Michaela Pfadenhauers Konzept der unsichtbaren Bildungsprogramme in Jugendszenen zum Thema, welches als Erweiterung der Theorie musikalischer Selbstsozialisation betrachtet werden soll. Der „Kompetenz-Leitfaden“ zur Aufdeckung unsichtbarer Bildungsprogramme wird ebenfalls ausführlich behandelt, da er im sechsten Kapitel auf die Heavy Metal Szene angewandt wird. Neben dem Konzept selbst, sollen Formen jugendlicher Vergemeinschaftungen vorgestellt werden, mit Konzentration auf den Szene-Begriff.
Das 5. Kapitel porträtiert die Heavy Metal-Szene, sowohl im Hinblick auf die Musik, als auch die Menschen, die sich darin bewegen. Die Geschichte des Heavy Metal, der typische Metal-Stil, sowie Events und Treffpunkte der Szene werden in diesem Abschnitt dargestellt.
In einem letzten Schritt soll im 6.Kapitel das unsichtbare Bildungsprogramm der Heavy Metal-Szene sichtbar gemacht werden. Es wird mithilfe des „Kompetenz-Leitfadens“ untersucht, ob in einer unterschätzten musikalischen Jugendszene wie der Heavy Metal-Szene Prozesse ablaufen, in denen sich die Individuen selbst sozialisieren, indem sie sich eigenständig Kompetenzen aneignen, die innerhalb und außerhalb der Szene, sowie im späteren Berufsleben von Nutzen sein können.
Das 7.Kapitel stellt eine Zusammenfassung mit Fazit der vorliegenden Arbeit dar.
2. Musik und Jugend
2.1 Musik
Physikalisch betrachtet ist Musik nichts anderes als Schallwellen, die vom Außenohr aufgenommen und von dort aus zu den Sinneszellen im Cortischen Organ, dem eigentlichen Hörorgan, weitergeleitet werden (vgl. Fassbender 1993, S. 613). Wie unterscheidet sich Musik denn nun von anderen akustischen Reizen, wie zum Beispiel einem vorbeifahrenden Auto? Dazu ein kurzer Einblick in die Evolutionsgeschichte des Menschen. Unser Hörsinn hat primär die Funktion eines „Bewegungsmelders“ inne, der zu jeder Zeit Aktivitäten in der Umwelt registriert. Ob der Schall, der auf unser Ohr trifft, nun als bedrohlich oder beruhigend wahrgenommen wird, hängt unter anderem von der Intensität und der Frequenz des Geräusches ab. Je näher beispielsweise ein Gewitter kommt, desto lauter und hochfrequenter wird es, was für uns eine akute Gefahr signalisiert, vor der wir uns in Sicherheit bringen sollten. Das gleichmäßige Plätschern eines Baches hingegen wird nicht als Gefahr interpretiert und löst somit auch keine umgehende Handlung aus (vgl. Hellbrück 2008, S. 17f.).
Übertragen auf die Musikrezeption würde dies überspitzt bedeuten, dass überall nur Meditationsmusik gehört werden müsste, da laute schnelle Musik eine Gefahr signalisiert und somit einen Fluchtreflex auslöst. Dass dem nicht so ist, liegt daran, dass Musik nicht nur instinktiv gehört wird, sondern eine Reihe anderer wichtiger Komponenten beim Musikhören eine Rolle spielen, auf die im weiteren Verlauf der Arbeit eingegangen wird.
2.1.1 Geschichte der Musik
Tatsächlich ist es so, dass es in der Geschichte der Menschheit keine Gesellschaft ohne Musik gegeben hat (vgl. Jakoby 1981, S.3). Funde von Instrumenten und bildlichen Darstellungen aus der Steinzeit belegen, dass auch schon unsere Vorfahren vor etwa 50.000 Jahren musiziert haben (vgl. ebd. S. 6). Die Frage, warum Menschen angefangen haben, Musik zu machen, also nach dem Ursprung der Musik ist umstritten. Huron beispielsweise betrachtet den Ursprung der Musik aus einer evolutionsbiologischen Perspektive. Er fragt nicht nach dem Grund, der Menschen dazu veranlasst hat, Musik zu machen, sondern danach, welchen Vorteil das musizierende gegenüber dem nicht-musizierenden Individuum hatte (vgl. Huron 2003, S. 43).
Neben der Theorie, dass Musik bei der Wahl der Geschlechtspartner[3] eine Rolle gespielt haben könnte, nennt er auch die Stärkung des sozialen Zusammenhalts durch Musik:
„Music might create or maintain social cohesion. It may contribute to group solidarity, promote altruism, and so increase the effectiveness of collective actions such as defending against a predator or attacking a rival clan“ (Huron 2003, S. 47). Diese soziale, gemeinschaftsstiftende Komponente von Musik wird in späteren Kapiteln dieser Arbeit eine große Rolle spielen.
Bis in die Renaissance war die Auffassung von Musik geprägt vom Gedankengut der antiken Hochkulturen. Beruhend auf Pythagoras‘ Lehre von Konsonanz und den Intervallen, aus dem 6. Jahrhundert v. Chr., wurde die Musik in „musica mundana“, „musica humana“ und „musica instrumentalis“ eingeteilt.
Hierarchisch stand die musica mundana an erster Stelle. Gemeint ist damit die „Musik des Weltalls“, die Harmonie der Planeten, des ganzen Kosmos.
Entsprechend beschrieb die musica humana, die menschliche Musik, die harmonische Einheit der Seelenteile und die Einheit von Körper und Seele.
Unter der musica instrumentalis verstand man die hörbare Musik, die durch die Instrumente erzeugt wird. Gleichgesetzt wurde das Musizieren mit rein körperlicher Arbeit (vgl. Hoffmann-Axthelm 1991, S.219f.).
Die musica instrumentalis stand in der Rangfolge weit unter den beiden anderen Disziplinen. „Das Wissen um die Gesetzmäßigkeiten der Musik, das Denken von und über Musik war im Bildungs- und Erziehungssystem dem praktischen Musizieren übergeordnet“ (Jakoby 1981, S. 9). Vielmehr wurde Musik gleichgestellt mit Astronomie, Geometrie und Arithmetik. Zusammen mit den Disziplinen Grammatik, Dialektik und Rhetorik bildeten sie die „septem artes liberales“, die sieben freien Künste, die vor allem im Mittelalter den Gegenstand von Forschung und Lehre darstellten (vgl. ebd., S. 9).
Ab dem 12./13. Jahrhundert ist eine Hinwendung zur musikalischen Praxis feststellbar. Immer mehr spielte die Beachtung von sinnlichem Wohlklang und der Einfluss von Musik auf die das Gefühlsleben des Menschen eine Rolle (vgl. ebd., S. 21). Lange Zeit wurde Musik nur komponiert, um einen Zweck zu erfüllen, wie zum Beispiel der Lobpreisung Gottes oder der Legitimation eines weltlichen Herrschers. Die Komponisten selbst blieben dabei meist anonym und erhielten wenig Anerkennung.
Die Rolle des Musikschaffenden änderte sich im Laufe der Zeit zunehmend vom beauftragten Anonymen zum anerkannten Experten (vgl. Blaukopf 1982, S. 231ff.).
Im 18. Jahrhundert entwickelte sich allmählich eine bürgerliche Musikkultur. Davor war Musik und Musikerziehung ein Auftragsprivileg des Adels (vgl. Dahlhaus 1985, S. 32ff.). Nun gab es auch Zusammenschlüsse von Menschen bürgerlicher Herkunft, die für eine Gruppe von Zuhörern, oft gegen Entgelt, musizierten. Die Tatsache, dass Menschen nun zusammenkamen, nur um Musik zu hören, kann als ein entscheidender Schritt in der Entwicklung zur heutigen Auffassung von Musik betrachtet werden. Musik wird heute nicht mehr nur verstanden als eine Wissenschaft, die auf rein rationaler Ebene zu behandeln ist, sondern in erster Linie als ästhetisches Objekt, dem man sich genussvoll hinwenden und das auf Basis subjektiver Empfindungen bewertet werden kann (vgl. Gebesmair 2001, S. 26).
2.1.2 Musiknutzung in der heutigen Zeit
Heutzutage ist Musik in ihren verschiedensten Formen allgegenwärtig. Musik begegnet uns als „Lautsprechermusik“ (Rösing 1993) in Wartesälen, beim Einkaufen, am Arbeitsplatz, in Gaststätten und sogar in öffentlichen Toiletten. Wir hören Musik unterwegs, im Auto, über Kopfhörer in der Bahn und natürlich Zuhause (vgl. ebd., S.116). Dazu kommen die Live Darbietung von Musik und Musik als Ergebnis eigenen Musizierens.
Es fällt auf, „daß das Hören von Musik im Alltag nur zu einem Teil eigenbestimmt ist. Sehr oft werden wir mit Musik beschallt, die wir uns weder gewünscht, noch ausgesucht haben“ (ebd. S. 117).
Trotz dieser „Dauerbeschallung“ zählt das Musikhören zu den beliebtesten Freizeitbeschäftigungen. Laut einer Studie der ARD-Werbung Sales & Services GmbH aus dem Jahre 2010 nutzen die Deutschen ab 14 Jahren durchschnittlich 35 Minuten täglich die Musikmedien CD/LP/MC/MP3 und 187 Minuten den Hörfunk. Auffällig ist, dass das Radio nur zu 38 Minuten in der Freizeit und 150 Minuten außerhalb der Freizeit genutzt wird (vgl. ARD-Werbung Sales & Services GmbH 2013, S. 66f.). Dies lässt vermuten, dass auch das eigenbestimmte Musikhören zu einem großen Teil nebenbei geschieht. Vor allem ältere Generationen kritisieren, dass Musik immer mehr an Wert verliere (vgl. North/Hargreaves/Hargreaves 2004, S. 42), da in Zeiten von Streaming-Diensten[4] wie Spotify und Co, jede beliebige Musik immer und überall abrufbar ist.
Eine im Jahr 2004 von North, Hargreaves und Hargreaves durchgeführte Studie (North/Hargreaves/Hargreaves 2004) zur Musiknutzung im Alltag lieferte ähnliche Ergebnisse. Ziel der Studie war es, herauszufinden, wann, mit wem und welche Musik am Tag gehört wird. Dazu versendeten sie 14 Tage lang Textnachrichten an die Mobiltelefone der 346 Teilnehmer zwischen 13 und 78 Jahren, die diese dazu aufforderten, einen Fragebogen auszufüllen. Der Fragebogen enthielt Fragen zur Musik, die die Teilnehmer zum Zeitpunkt des Erhalts der Textnachricht hörten, wenn dies der Fall war.
38,6% der Teilnehmer hörten zu besagtem Zeitpunkt Musik, woraus auf ein hohes Maß an täglichem Musikkonsum zu schließen ist. 49,9% gaben an, Musik außerhalb von Zuhause gehört zu haben. In nur etwa 26,3% der Fälle wurde Musik alleine gehört, meist wurde Musik zusammen mit Freunden, Partnern oder in der Familie rezipiert. Dies kann als ein weiteres Indiz für die zuvor erwähnte gesellschaftsstiftende Komponente von Musik gesehen werden. Der Verdacht, dass Musik immer häufiger nur als Beiwerk für andere Tätigkeiten genutzt wird, bestätigt sich mit folgenden Zahlen. Nur 26,4% der Teilnehmer gaben an, dass Musikhören zum Zeitpunkt der Befragung ihre Haupttätigkeit war. Das bewusste Musikhören, beispielsweise Zuhause oder im Rahmen eines Konzerts, wurde lediglich von 11,9% angegeben.
Eine weitere wichtige Frage, die aufkommt, wenn über den heutigen Umgang mit Musik nachgedacht wird, ist die nach den Gründen für die Musikrezeption. Welche Motivation haben Menschen, Musik zu hören? Oder anders gefragt, welche Funktion hat Musik?
Auch hier können Ergebnisse aus der Studie von North, Hargreaves und Hargreaves herangezogen werden.
In den Fällen, in denen die Teilnehmer in der Lage waren, die gehörte Musik selbst zu wählen, gab ein Großteil derer an, Musik zu hören, da sie es genossen (56,4%), um die Zeit zu vertreiben (40,06%) oder um die richtige Atmosphäre zu schaffen (30,5%). Auch der Antrieb aus Gewohnheit war ein häufig genannter Grund (30,06%). Nur wenige konsumierten Musik, um mehr über Musik zu lernen (2,8%) oder um bestimmte Erinnerungen hervorzurufen (10,1%). Auffällig ist dabei wieder, dass die meisten Teilnehmer Funktionen nannten, die keine aktive Beschäftigung mit der Musik voraussetzten. Die Autoren schließen daraus: „The data suggest […] that on most of those occasions when participants chose to listen to music, they did so with little thought, and seemed to opt deliberately to be subjected to a form of “sonic wallpaper” that formed the undemanding backdrop to some other task” (North/Hargreaves/Hargreaves 2004, S. 72).
Helmut Rösing unterscheidet hinsichtlich der Funktionen der Musik zwischen zwei Bereichen, dem gesellschaftlich-kommunikativen und dem individuell-psychischen Funktionsbereich (vgl. Rösing 1992, S. 315f.). Zum gesellschaftlich-kommunikativen Bereich zählt er unter anderem Repräsentationsfunktionen (Musik als Statussymbol), gemeinschaftsbindende, gruppenstabilisierende Funktionen (Musik bestimmter Gruppen die sich durch ihre Musik identifizieren, z. B. musikalische Jugendszenen), Kontaktfunktionen (Musik als nichtsprachliches Medium der Kontaktaufnahme), und Funktionen der Selbstverwirklichung (Besonders beim selbst Musizieren, aber auch beim eigenbestimmten Musikhören). Die Funktionen des gesellschaftlich-kommunikativen Bereichs sieht Rösing als „hochgradig abhängig vom jeweiligen situativen Kontext, also von der spezifischen musikalischen Aufführungs- bzw. Darbietungssituation“ an. „Sie beruhen […] auf Aneignungs- und Vergegenständlichungsstrategien von Musik durch Objektivierung im Sinne vorgegebener gesellschaftlicher Normen“ (Rösing 1992, S. 316).
Die Funktionen im individuell-psychischen Bereich dagegen sind personenorientierter und weniger kontextabhängig. Ihre Aneignung „erfolgt vornehmlich durch Subjektivierung, also z.B. durch Assoziation und Imaginationen im Hinblick auf die eigene psychische Bedürfnislage“ (ebd.). Der individuell-psychische Bereich umfasst unter anderem Konfliktbewältigungsfunktionen (z.B. Musik als Drogenersatz), Entspannungs- und Aktivierungsfunktionen und Unterhaltungsfunktionen (vgl. ebd.).
Holger Schramm hebt vor allem die Stimmungsregulation, in der musikpsychologischen Forschung „Mood Management“ genannt, als zentrales Motiv der Musikrezeption hervor. Darunter versteht er „das Verstärken, Abschwächen, Kompensieren oder Aufrechterhalten von Stimmungslagen, die – je nach Person oder Situation – als angenehm/positiv oder unangenehm/negativ empfunden werden“ (Schramm 2005, S.67).
Bei den hier genannten Funktionen von Musik handelt es sich selbstverständlich nicht um alle möglichen Motive, Musik zu hören. Diese umfänglich darzustellen, ist unmöglich, da jeder Mensch, aufgrund individueller Motivationen Musik rezipiert. Besonders im Jugendalter nimmt Musik eine Sonderstellung ein. Warum Musik eine so große Rolle bei den Jugendlichen spielt und was eigentlich mit „Jugend“ gemeint ist, auf diese Fragen wird im nächsten Kapitel eingegangen.
2.2 Jugend
„Die Jugend gibt es […] nicht, allenfalls Jugend im Plural, Jugenden, wenn man nicht sogar schon von einem Ende der Jugend sprechen muss“ (Horn 1998, S. 1). Um diese Aussage verstehen zu können, soll an dieser Stelle zunächst auf die „Entdeckung“ der Jugend und die Entwicklung des Jugendbegriffs eingegangen werden.
2.2.1 Geschichte der Jugend
In den Gesellschaften der vorindustriellen Zeit war es noch nicht üblich, Menschen aufgrund ihres (jungen) Alters anders zu behandeln, als Erwachsene.
„Die Dauer der Kindheit war auf das zarteste Kindesalter beschränkt, d.h. auf die Periode, wo das kleine Wesen nicht ohne fremde Hilfe auskommen kann; das Kind wurde also, kaum daß es sich physisch zurechtfinden konnte, übergangslos zu den Erwachsenen gezählt, es teilte ihre Arbeit und ihre Spiele. Vom sehr kleinen Kind wurde es sofort zum jungen Menschen ohne die Etappen der Jugend zu durchlaufen“ (Aries 1996, S. 45f.).
Eine einheitliche Lebensphase, die als Jugend bezeichnen werden könnte, gab es also lange Zeit nicht. Erst mit dem Übergang zur industriegesellschaftlichen Moderne traten Änderungen auf. Immer weniger Menschen lebten und arbeiteten auf dem Land und im Zuge der Industrialisierung wurde die Schulpflicht durchgesetzt und die Kinderarbeit verboten. Die räumliche und soziale Trennung von Familie und Berufstätigkeit ging einher mit einer neuen Betrachtungsweise von Kindheit und Jugend. Junge Menschen wurden nun nicht mehr ausschließlich als billige Arbeitskraft gesehen, wie es vor allem in den Arbeiterschichten der Fall war. Dafür wurde die Erziehung der Kinder und Jugendlichen immer mehr zum zentralen Element des Familienlebens (vgl. Scherr 2009, S. 92).
Mit der Entstehung der bürgerlichen Familie und der Pädagogisierung des Kindheits- und Jugendalters verstärkte sich auch die intensivierte Beschäftigung mit Jugend.
Der Philosoph und Schriftsteller Jean-Jaques Rousseau wird oft als „Erfinder“ der Jugend bezeichnet. In seinem Werk „Emil oder Über die Erziehung“ misst er der Jugend einen solch großen Stellenwert bei, dass er sie als „zweite Geburt“ bezeichnet (Rousseau 1762/2010, S. 383). Er beschreibt den Übergang in die Jugendphase als „unter Stürmen vor sich gehender Umschwung“ (ebd., S. 382), eine Metapher für die einsetzende Pubertät. Rousseau sieht, entgegen der Ansicht jener Zeit, die Jugend als eine Lebensphase, die besonderer pädagogischer Aufmerksamkeit bedarf: „Diese Epoche, in welcher für gewöhnlich die Erziehung ein Ende zu nehmen pflegt, ist gerade diejenige, in welcher die unsrige erst recht ihren Anfang nehmen soll“ (ebd., S. 383).
Des Weiteren möchte Rousseau, dass Kindheit und Jugend als ein Schonraum betrachtet wird, in dem Kinder und Jugendliche sich auf ein Leben in der Gesellschaft vorbereiten können (vgl. Scherr 2009, S. 94). Dazu äußert er sich folgendermaßen: „stellt ihm nicht gleich zuerst den Prunk der Höfe, die Pracht der Paläste, den fesselnden Reiz der Theater vor Augen; […] zeigt ihm die Außenseite der großen Gesellschaft nicht eher, bis ihr ihn befähigt habt, sie nach ihrem wahren Wert zu schätzen“ (Rousseau 1762/2010, S. 405).
Im deutschsprachigen Raum des 19. Jahrhunderts war das Wort „Jüngling“ für einen jungen Mann, der kein Kind mehr, aber auch noch nicht erwachsen war, vorherrschend. Bezeichnet wurden mit dem Begriff Jüngling allerdings überwiegend junge gebildete Männer aus dem Bürgerstand (vgl. Baacke 2004, S. 228). Roth nennt als Beispiele die „Leipziger Jünglinge“, die „Göttinger Jünglinge des Hainbundes“ und die „Jünglinge des Sturm und Drang“, zu denen auch der junge Goethe zu zählen ist (vgl. Roth 1983, S. 16ff.). Allesamt Gruppen und Zusammenschlüsse, die sich „parasitär über und an den Universitäten bildeten“ (Baacke 2004, S. 228).
Etwa Anfang des 20. Jahrhunderts wurde das Konzept des Jünglings aufgegeben, da es mittlerweile nur noch ein Erziehungsideal darstellte. Es vermittelte das Bild eines „rechtschaffenen“, „christlichen“, „deutsch-nationalen und gehorsamen“ jungen Mannes (ebd., S. 229). Da damit nur ein sehr kleiner Teil der bürgerlichen Bevölkerung beschrieben wurde, trat im Laufe der Zeit „der Jugendliche“ in den Fokus der Gesellschaft. Anfangs war der Begriff eher negativ besetzt. Bezeichnet wurde damit eine „kriminelle oder verwahrloste Person jugendlichen Alters“ (Roth 1983, S. 114), die meist aus der Arbeiterschicht entstammte. Vor allem in der psychiatrischen und der juristischen Literatur wurde „der Jugendliche“ oft als Problem dargestellt (vgl. Baacke 2004, S. 229).
Während zu Beginn der Jugend-Begriff nur auf die Proletarierjugend angewandt wurde, weitete sich dieser im Laufe der Zeit auf „jeden jungen Menschen zwischen 14 und 18 (21) Jahren“ (Roth 1983, S. 140) aus. Maßgeblich dazu bei trug der „Imagewechsel“ des Jugendlichen, der zwischen 1911 und 1914 stattfand (vgl. ebd., S. 122): „Vor dem ersten Weltkrieg wandelte sich das negativ-repressive Konzept vom Jugendlichen in das des „jungen Staatsbürgers“, in die ins Positive gewendete Konzeption vom jungen Menschen, den es für Staat und Gesellschaft zu gewinnen gilt“ (ebd. S. 137).
2.2.2 Jugend in der modernen Gesellschaft
Heute sind die Begriffe Jugend und Jugendliche nicht mehr aus unserem alltäglichen Sprachgebrauch wegzudenken. Auch wenn immer noch dieselben Begriffe wie damals verwendet werden, hat sich jedoch einiges, in Hinsicht auf die Lebensweise dieser Altersgruppe, geändert. Primär ist darauf hinzuweisen, dass die Lebensphase Jugend zeitlich viel ausgedehnter strukturiert ist. Die durchschnittliche Lebenserwartung lag zu Beginn des 20. Jahrhunderts bei 65 Jahren, heute liegt sie bei etwa 80 Jahren. Die veränderten demografischen Bedingungen haben auch Einfluss auf die verschiedenen Lebensphasen. Während die Phase Kindheit und Erwachsenenalter seit 1900 bezüglich ihrer Länge abnahm, ist eine Zunahme der Dauer der Jugendphase festzustellen, welche sich zukünftig, aufgrund höherer Lebenserwartung, vermutlich noch weiter ausdehnen wird (vgl. Hurrelmann/Quenzel 2013, S. 15ff.). Verantwortlich dafür sind zum Teil auch das Schul- und Hochschulwesen und die Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt. „Neben der längeren Schulverweildauer ist das Finden geeigneter Berufe und Berufschancen immer schwieriger […], so daß auch diese entscheidende Status-Einmündung […] oft um Jahre aufgeschoben wird“ (Baacke 2004, S. 233). Diese Altersphase der 20 bis 30 Jährigen wurde lange Zeit als junges Erwachsenenalter bezeichnet. Heute wird sie oft zur Jugend dazugezählt, oder als Postadoleszens bezeichnet (vgl. ebd.).
Wenn über veränderte Lebensbedingungen von Jugendlichen gesprochen wird, fällt häufig der Begriff „Individualisierung“. Der Terminus beschreibt in erster Linie den Umstand, dass die Klassen- und Schichtorientierung in modernisierten Gesellschaften immer mehr an Bedeutung verliert. Als weitere Indikatoren nennt Hitzler unter anderem „erhöhte biographische Mobilität (mehr soziale Auf- und Abstiege, geographische ‚Wanderungen‘)“, „Flexibilisierung der Orientierung im Beruf (häufiger Arbeitsplatzwechsel, ‚Umschulungen‘)“ und „verändertes Freizeit- und Konsumverhalten (Sinnverlagerungen aus der beruflichen in die Privatsphäre, wechselnde Orientierung an mannigfaltigen Angeboten)“ (Hitzler 1994, S. 75f.). Das Individuum in der Gesellschaft ist demnach mehr als je zuvor „seines Glückes Schmied“, indem es seinen Lebensverlauf, unabhängig von seiner Herkunft, selbst bestimmen kann. „Der einzelne Mensch wird aus den überlieferten Bindungen herausgelöst, die noch vor vier oder fünf Generationen die Lebensgestaltung nach Alter, Herkunft, Religion und Geschlecht festlegten“ (Hurrelmann/Quenzel 2013, S. 17). Allerdings ergeben sich daraus nicht nur Chancen für das Leben der Jugendlichen.
Der neu gewonnene Freiraum stellt diese vor neue Herausforderungen, mit denen die Jugend vor 100 Jahren noch nicht in dieser Weise konfrontiert war.
Der Lebensverlauf eines solchen Jugendlichen war größtenteils klassengebunden und somit vorgegeben. Die damit einhergehende Sicherheit und Verlässlichkeit, zu erkennen, wie das eigene Leben verlaufen wird, haben junge Menschen in der heutigen Zeit nicht mehr in diesem Maße. Stattdessen sehen sie sich einer Fülle von Möglichkeiten gegenübergestellt, aus denen sie wählen „müssen“. „Individualisierung ist ein Zwang, ein paradoxer Zwang allerdings, zur Herstellung, Selbstgestaltung, Selbstinszenierung [...] der eigenen Biographie“ (Beck/Beck-Gernsheim 1994, S. 14). Dieser Zwang ist immer auch mit dem Risiko des Scheiterns verbunden. Um nicht zu scheitern, müssen die Individuen „langfristig planen und den Umständen sich anpassen können, müssen organisieren und improvisieren, Ziele entwerfen, Hindernisse erkennen, Niederlagen einstecken und neue Anfänge versuchen“ (ebd. S. 15).
Studien zufolge gelingt den meisten Jugendlichen dieser Akt und viele profitieren sogar von dieser Freiheit. Eine Minderheit allerdings ist mit den hohen Erwartungen und Ansprüchen überfordert und reagiert darauf mit Belastungssymptomen wie Aggression und gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Einige von ihnen versuchen, ihre Probleme mit Drogenkonsum zu „lösen“, bzw. zu vergessen (vgl. Hurrelmann/Quenzel 2013, S.66).
An dieser Stelle soll nun noch einmal auf das Zitat zu Beginn des Kapitels 2.2 zurückgekommen werden: „Die Jugend gibt es […] nicht, allenfalls Jugend im Plural, Jugenden, wenn man nicht sogar schon von einem Ende der Jugend sprechen muss“ (Horn 1998, S. 1).
Spricht man von „der Jugend“ wird man der Vielfalt der jugendlichen Lebensweisen nicht gerecht. Oft wird auch von der „Pluralisierung der Lebensstile“ oder der „Entstandardisierung von Lebensläufen“ gesprochen, beides Kennzeichen moderner Gesellschaften (vgl. Müller-Bachmann 2002, S. 23). Die Jugend ist keine homogene Phase, deren Ablauf von vorneherein klar ist, keine Jugend verläuft so wie die andere.
Trotz dieser Heterogenität gibt es selbstverständlich auch Merkmale, die für die Lebensphase Jugend typisch sind und anhand derer sie von Kindheit und Erwachsenenalter abgegrenzt werden können, auch wenn diese Grenzen immer mehr verschwimmen.
Auf körperlicher Ebene stellt die Pubertät, also das Eintreten der Geschlechtsreife, ein entscheidendes und leicht feststellbares Abgrenzungsmerkmal dar. Aufgrund der günstigen Lebensbedingungen in hoch entwickelten Gesellschaften, verschiebt sich der Zeitpunkt des Pubertätseintritts immer weiter nach vorne, was zu einer Verkürzung der Phase der Kindheit führt.
Während im Jahr 1840 die Pubertät erst mit etwa 17 Jahren eintrat, ist die weibliche Menarche heute schon bei 12 bis 13 Jährigen festzustellen (vgl. Oerter/Dreher 2008, S.294). Die Pubertät bringt bekanntermaßen nicht nur körperliche Veränderungen mit sich. der Eintritt ins Jugendalter stellt die Betroffenen auch vor psychische, soziale und kulturelle Herausforderungen, die sie im Laufe ihrer Jugend bewältigen müssen. Das bekannteste theoretische Konzept, das diese Aspekte miteinander vereint, ist das der Entwicklungsaufgaben, das 1948 von Robert J. Havighurst entwickelt wurde.
„Eine ‚Entwicklungsaufgabe‘ ist eine Aufgabe, die in oder zumindest ungefähr zu einem bestimmten Lebensabschnitt des Individuums entsteht, deren erfolgreiche Bewältigung zu dessen Glück und Erfolg bei späteren Aufgaben führt, während ein Mißlingen zu Unglücklichsein, zu Mißbilligung durch die Gesellschaft und zu Schwierigkeiten mit späteren Aufgaben führt … Die Entwicklungsaufgaben einer bestimmten Gruppe haben ihren Ursprung in drei Quellen: (1) körperliche Entwicklung, (2) kultureller Druck (Die Erwartungen der Gesellschaft), und (3) individuelle Wünsche und Werte“ (Havighurst 1956, S. 215, aus der Übersetzung von Dreher/Dreher, 1985, S. 30).
Die Entwicklungsaufgaben sind demnach zum Teil universell („körperliche Entwicklung“), teilweise abhängig von der Gesellschaft („kultureller Druck“), aber auch teilweise abhängig vom Individuum selbst („Individuelle Wünsche und Werte“).
Nach Dreher und Dreher kann zwischen den folgenden zehn Entwicklungsaufgaben im Jugendalter unterschieden werden:
Tabelle 1: Entwicklungsaufgaben (vgl. Dreher/Dreher 1985, S. 36)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Anzumerken ist, dass die genannten Entwicklungsaufgaben nicht isoliert von den angrenzenden Lebensphasen Kindheit und frühes Erwachsenenalter zu sehen sind. „Einige stellen eine Weiterführung von Aufgaben der Kindheit dar, andere beginnen zwar in der Adoleszenz, setzen sich aber im frühen Erwachsenenalter fort“ (Oerter/Dreher 2008, S. 280). Folglich bauen Entwicklungsaufgaben aufeinander auf. Die Entwicklungsaufgaben des frühen Erwachsenenalters „Auswahl eines Partners“, „Mit dem Partner leben“ und „Gründung einer Familie“ knüpfen beispielsweise an die Entwicklungsaufgabe EA 7: Partner/Familie an, die Aufgabe „Verantwortung als Staatsbürger ausüben“ knüpft an, an die Aneignung von Werten (EA 9) (ebd., S. 281). Die erfolgreiche Bewältigung der Entwicklungsaufgaben in der Jugend kann somit als eine Voraussetzung für den Eintritt in das Erwachsenenalter betrachtet werden.
Trotz alledem lässt sich kein allgemein gültiger Zeitpunkt für das Ende der Jugend feststellen. Hurrelmann bezeichnet dies als „schleichenden“ Übergang in das Erwachsenenalter: „er stellt sich in kleinen, kaum merklichen Schritten ein und ist den Jugendlichen selbst oft unbewusst und geschieht ungewollt“ (Hurrelmann 2013, S.32).
Dieser Übergang vollzieht sich meist zwischen dem 18. Und 21. Lebensjahr, doch aufgrund der längeren Schulverweildauer wird er oft lange Zeit hinausgezögert.
2.3 Bedeutung von Musik im Jugendalter
In Kapitel 2.1.2 wurde die Frage nach den Funktionen der Musik gestellt. In diesem Abschnitt soll die Frage etwas eingegrenzt werden: Welche Funktion hat Musik in der Jugendzeit?
Warum spielt gerade in der Phase der Jugend die Musik solch eine große Rolle? Stellt Musik dabei womöglich nur eine Form des Zeitvertreibs dar? Jeder der an seine Jugendzeit zurückdenkt, wird diese Frage höchstwahrscheinlich verneinen können. Bilder und Emotionen, die dabei aufkommen können, lassen darauf schließen, dass Musik eine weitaus größere Bedeutung als die einer simplen Freizeitbeschäftigung hat.
Ob über Schallplatte, Musikkassette, CD, Smartphone oder YouTube, auch wenn sich die Rezeptionsweise von Musik geändert hat, rangiert das Musikhören immer noch auf den ersten Plätzen der Freizeitcharts (vgl. Leven/Quenzel/Hurrelmann 2010, S. 96).
Nirgends innerhalb des Lebenszyklus ist die quantitative Beschäftigung mit Musik so groß, wie im Jugendalter (Berufsmusiker ausgenommen). Dollase beschreibt dies folgendermaßen: „Bezogen auf die Quantität des Musikkonsums gibt es eine Anstiegsphase von etwa 10-13, die in eine Plateauphase bis etwa 20 mündet und jenseits der 25 wieder deutlich abnimmt (Abschwungphase)“ (Dollase 1998, S. 356).
Baacke fasst die Funktionen der (Pop)Musik im Jugendalter in fünf Dimensionen zusammen (vgl. Baacke 1998, S. 35).
- Psycho-physiologische Intensität und die Bedeutung des Körpergefühls: Damit ist gemeint, dass Jugendliche beim Musikhören ihre eigene Körperlichkeit erleben, zum Beispiel durch Tanzen oder rhythmische Bewegungen zum Takt.
- Affektive Komponente wie Begeisterung, Freude, Kompensation: Jugendliche hören Musik, um Stimmungen und Emotionen zu erzeugen oder zu unterdrücken, zur Kontrolle ihres „Emotionalen Haushalts“ (Mood Management).
- die sozial-psychologische Funktion der Identitätsbildung in der Frage nach Authentizität: Jugendliche hören oft eine bestimmte Musik bzw. ein bestimmtes Musikgenre, um sich von anderen Personen und Gruppen abzugrenzen oder um sich bestimmten Personen und Gruppen zugehörig zu fühlen. Durch Abgrenzung (Distinktion) und Zugehörigkeit kann Identität gebildet werden.
- die ästhetisch-synästhetische Wahrnehmung der Popkulturen: Damit ist unter anderem gemeint, dass Jugendliche beim Hören von Musik musikästhetische Erfahrungen machen und Musik oft auch nur „der Musik wegen“ hören.
- Die Sinn-Dimension, die Ebene der Deutung: Die Songtexte in der Popmusik handeln oft von Themen, die besonders für Jugendliche relevant sind. Die intensive Beschäftigung mit den Texten kann ihnen bei der Findung einer eigenen Persönlichkeit helfen.
Verschiedene Autoren erkennen die Bedeutung der Musik und ihrer Funktionen für die Bewältigung von Entwicklungsaufgaben im Jugendalter (vgl. Hoffmann 2008; Müller-Bachmann 2002, S. 204f.; Münch 2002).
Hinter der Musik, die Jugendliche tagtäglich hören, stehen immer auch Interpreten, die häufig als „Stars“ vermarket werden. Oftmals ist für sie das Auftreten eines solchen Künstlers wichtiger als die Musik selbst, weshalb dessen Erfolg nicht nur abhängig ist von der Qualität der Musik. Andere Faktoren wie Schönheit, Reichtum, Coolness, Klugheit, Humor oder auch Skandale, wie zum Beispiel Drogenexzesse, spielen dabei eine Rolle (vgl. Hoffmann 2008, S.164). Dieses Gesamtpaket, das eine Berühmtheit darstellt, kann Entwürfe anbieten, „in Bezug auf Selbstpräsentation, in Bezug auf sexuelle und geschlechtliche Orientierungen“ (ebd., S. 164f.). „Stars“ stellen Vorbilder dar, an denen sich Jugendliche orientieren und zu denen sie hochschauen können. Besonders sind es junge Mädchen, die Personen oder Gruppen aus dem Bereich Musik als Vorbild haben (vgl. Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest 2004, S.8). Sie schminken und kleiden sich wie ihre Vorbilder, versuchen so zu singen wie sie oder verehren sie geradezu.
Das Schwärmen für Stars kann als eine Vorbereitung auf das „Verliebtsein“ angesehen werden. Mädchen, aber auch Jungs können auf diese Weise unverbindlich erste Erfahrungen mit dem anderen Geschlecht machen.
Dieser parasoziale Kontakt zu den Berühmtheiten kann somit hilfreich sein bei der Entwicklung eines Körperkonzepts und bei der sexuellen Orientierung und Geschlechterrolle. In der oben stehenden Tabelle 1 entspricht dies den Entwicklungsaufgaben EA 2 und EA 3.
Musik kann aber auch Jugendliche unterstützen, reale soziale Kontakte zu knüpfen und Beziehungen zu Gleichaltrigen aufzubauen (Entwicklungsaufgabe EA 1). Der Musikgeschmack stellt oft ein Vergemeinschaftungsmerkmal dar, auf das Freundschaften unter Jugendliche aufbauen. Besonders in musikgeprägten Jugendkulturen wie der Heavy Metal- oder Gothic-Szene wird der Musikgeschmack als Grundlage für die Mitgliedschaft in solch einer Gruppe aufgefasst. Dieser Aspekt wird später noch einmal ausführlicher behandelt, weshalb an dieser Stelle nicht näher darauf eingegangen werden soll.
Neben den genannten, gibt es noch weitere Entwicklungsaufgaben, die mithilfe von Musik bearbeitet werden können. Die Ablösung von den Eltern (EA 5) beispielsweise kann unterstützt werden, indem Jugendliche sich einem bestimmten Musikstil zuwenden, dem die Eltern negativ gegenüber eingestellt sind, sozusagen als eine Form der Rebellion.
Darüber hinaus stellen Songtexte oft eine Quelle für Jugendliche dar, aus denen sie bestimmte Werte und Meinungen herausschöpfen können. Dadurch kann die Bewältigung der Entwicklungsaufgabe EA 9: „Eine eigene Weltanschauung entwickeln“ begünstigt werden.
[...]
[1] Die Bezeichnung „Heavy Metal“ wird in der vorliegenden Arbeit als Überbegriff für die verschiedenen Spielarten des Genres verwendet.
[2] Der Begriff wird in Anführungszeichen gesetzt, da es keine förmlichen Mitgliedschaften in Szenen gibt.
[3] Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird auf eine geschlechtsspezifische Differenzierung verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung für beide Geschlechter.
[4] Streaming-Dienste wie Spotify, Deezer, Simfy oder Napster erlauben es dem Nutzer, kostenlos oder gegen geringe Gebühren, Musik von fast allen bekannten Künstlern, auf dem PC, Tablet oder Smartphone zu hören.
- Arbeit zitieren
- Jan Zintel (Autor:in), 2015, Musikalische Selbstsozialisation Jugendlicher im Heavy Metal, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/307950
Kostenlos Autor werden




















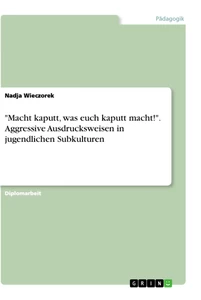


Kommentare