Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung – Hegels »Ästhetik« im Aufriß
2. Begrenzung des Untersuchungsgegenstandes – Ziele dieser Arbeit
3. Philosophiegeschichtliche Voraussetzungen
3.1. Platon stellt die zentrale Frage: Was ist das Schöne an sich?
3.2. Warum ist Platon bemüht, die Vielgestaltigkeit und Vielheit der Dinge in abstrakter Einheit zusammenzufassen?
3.3. Das Dilemma der Metaphysik: Die Ideen existieren losgelöst von dem, wovon sie Ideen sind
3.4. Die ‚Lösung’ der Frage, wie sich das Einzelne zur Idee verhält
3.5. Die besondere Stellung der Idee des Schönen – sie schlägt eine Brücke zwischen der Ideenwelt und dem Erfahr- und sinnlich Wahrnehmbaren
3.6. Widersprüchlichkeiten lassen erkennen, daß es zum Sein des Schönen gehört, sich als Schein zu zeigen
3.7. Platons Verständnis vom Wesen der Kunst – sie verharrt im bloßen Schein und kann deshalb nicht Organon der Wahrheit sein
3.8. Die Unzulänglichkeiten der sinnlichen Wahrnehmung als Grund, weshalb es die Kunst vermag, mit Trugbildern zu täuschen
3.9. Von der Dichtung geht eine psychologische Wirkung aus, die wider Vernunft und Sitte gerichtet ist
3.10. Platons Erbe für die spätere philosophische Ästhetik
4. Kunst im Systemzusammenhang bei Hegel – als Antwort auf die Frage, wie der menschliche Geist zu einem Erkennen seiner selbst gelangt
4.1. Der Begriff des Geistes bei Hegel
4.1.1. Die Idee als Einheit von Begriff und Realität
4.1.2. Der Begriff wird zur Idee, wenn er die in abstrakter Einheit ihm innewohnenden Besonderungen in die Realität stellt
4.1.3. Was menschlicher Geist seinem Begriffe nach ist, bildet der Mensch im Kunstwerk für sich und sein Bewußtsein aus
4.1.4. Die Kunst – nach Religion und Philosophie als eine Möglichkeit, wie der Mensch in den Hervorbringungen seiner selbst zur Erkenntnis gelangt
4.2. Das Ideal und der verwirklichte Begriff der Schönheit – die der Idee angemessene Verwirklichung in Form und Gestalt
4.2.1. Die Kunstformen als die besonderen Momente der Idee
4.2.2. Die symbolische Kunstform
4.2.3. Die klassische Kunstform
4.2.4. Die romantische Kunstform – mit der christlichen Offenbarung geht das Ende der Kunst einher
5. Literaturverzeichnis
6. Abbildungsverzeichnis
7. Anhang
Das Ende der Kunst bei Hegel
Ein Versuch, Hegels zentrale Positionen zur Kunst auf der Grundlage der »Ästhetik« darzustellen.
1. Einleitung – Hegels »Ästhetik« im Aufriß
Hegels Vorlesungen über die Ästhetik, zumindest so, wie sie durch Hothos Mitschriften und Bearbeitungen überliefert wurden, liegt eingangs die Fragestellung zugrunde, „[...] was das Schöne überhaupt ist und wie es sich im Vorhandenen, in Kunstwerken [...]“1 gezeigt hat. Als Antwort auf diese Frage begründet Hegel im Entfaltungsgang seiner systematischen Theorie, warum die Kunst neben der Religion und der Philosophie zu jenen Formen zu zählen sei, die es dem Geist des Menschen ermöglichten, zu einem Erkennen und Bewußtsein seiner selbst zu gelangen. Denn, um Hegels Auffassung vom Wesen der Kunst und ihre Deduktion aus dem Begriff des Geistes mit den Worten Hans-Georg Gadamers in nuce zusammenzufassen, in „[...] der Kunst begegnet sich der Mensch selbst, Geist dem Geiste“2. In der Entäußerung des Geistes zum sinnlich Konkreten, zum Kunstwerk hin, wird sich der Geist nämlich nicht etwa selber untreu, so Hegel sinngemäß, sondern der Geist geht vollkommen in den entgegengesetzten Zustand seiner selbst, in das Kunstwerk, über und wird in und an ihm für sich selber gegenständlich. Er kann sich demnach in der von ihm geschaffenen Entgegensetzung seiner selbst betrachten und sich dergestalt auch in der Entäußerung zur Empfindung und Sinnlichkeit hin (wieder-)erkennen und begreifen3, wodurch er schließlich eine neue und mithin höhere Stufe seines Bewußtseins erlangt. Insofern manifestiert sich für Hegel im Kunstwerk „[...] nichts bloß Sinnliches, sondern der Geist als im Sinnlichen erscheinend“4. Und die Kunst hat deshalb keine geringere Aufgabe, als die Idee, das heißt, den abstrakten Begriff des Geistes in ungeschiedener Einheit mit seinen Besonderungen als verwirklicht und in die Realität hineingestellt, für die unmittelbare Anschauung in sinnlich konkreter und der Idee gemäßer Gestalt darzustellen.5
Durch diese aus dem Begriff des Geistes hergeleitete Auffassung vom Wesen der Kunst und des Schönen ist es Hegel in seiner »Ästhetik« gelungen, den Wahrheitsanspruch der Kunst grundsätzlich zu legitimieren. Und im Gegensatz zu Kant, beispielsweise, der das Gefühl des Schönen als „interessenloses Wohlgefallen“6 definiert und den Gegenstand eines solchen Interesses schön heißt, ohne daß etwas von ihm erkannt wird, ist die Kunst für Hegel ein Medium, in dem sich menschliche Selbsterkenntnis vollzieht.
Mit der zuvor skizzierten Auffassung hat Hegel gleichsam die Kunst geadelt und sie in den Stand einer Erkenntnisweise erhoben, die unabhängig von der Philosophie und anderen Erkenntnisweisen einen alternativen Zugang und ein alternatives, wenngleich geschichtlich gebundenes Erkennen von Welt ermöglicht7. Der Zusammenhang zwischen Kunst und Erkennen, insbesondere der Zusammenhang zwischen Kunst und reflexiver Selbstdurchdringung des menschlichen Geistes, läßt sich in der Nachfolge Hegels nicht mehr länger negieren – zumindest scheint es so.
Durch den philosophischen Nachweis Hegels, daß ein gewisser Nexus zwischen Kunst und Erkennen besteht, scheint sich Hegels »Ästhetik« all jenen als freudig willkommene Rechtfertigungstheorie anzubieten, die sich selber mit Kunst beschäftigen, wobei es keinen Unterschied macht, ob sie sich nun analytisch-rezeptiv oder praktisch-produktiv mit ihr befassen. Sie alle scheinen darauf hoffen zu dürfen, ihr Handeln mit Hilfe der »Ästhetik« rechtfertigen zu können. Denn wenn die Kunst von Hegel philosophisch als eine Weise und Möglichkeit begründet wird, wie der menschliche Geist zu einem Bewußtsein seiner selbst gelangt, wäre damit auch gleichzeitig die wie auch immer geartete Beschäftigung mit Kunst selber und mithin das Handeln all derer gerechtfertigt, die mit Kunst zu tun haben. Sie alle würden sich ja schließlich mit einer Erkenntnisweise beschäftigen, die, so Hegel, „[...] die tiefsten Interessen des Menschen, die umfassendsten Wahrheiten des Geistes zum Bewußtsein [...]“8 bringt. Doch schon zu Beginn der Vorlesungen über die Ästhetik bereitet Hegel jenen, die sich mit der zuvor skizzierten Hoffnung an ihn gewandt haben, durch seine These vom Vergangenheitscharakter der Kunst eine herbe Enttäuschung. Schließlich wird schon eingangs der »Ästhetik« klar, daß sich die eigentliche Funktion und Stellung der Kunst, die ihr aufgrund ihres Beitrags im Zuge des menschlichen Bestrebens nach Weiter- und Höherentwicklung und damit im Gesamtzusammenhang von Kultur zukommt, lediglich aus der historischen Rückschau ergibt. Für uns, das heißt, in der heutigen Zeit, stellt die Kunst hingegen keine adäquate Möglichkeit mehr dar für das Erkennen dessen, was des Menschen Geist ist und was ihn ausmacht.
Sucht man nach Gründen, weshalb die Kunst ihr erkenntnistheoretisch bedeutsames Potential verloren hat, so sind dies in erster Linie Gründe, die sich aus dem Systemzusammenhang ergeben, in dem Kunst bei Hegel eingebettet ist. Und zwar ist Kunst, um ihr Wesen und dessen fundamentale Bedeutung im umfassenden Sinne zu verstehen, bei Hegel immer an die Entwicklungsgeschichte des menschlichen Geistes gekoppelt. Denn was menschlicher Geist abstrakt ist, darüber lassen sich unabhängig von dessen Manifestationsformen keine Prädikationen machen. Ein Erkennen dessen, was der menschliche Geist ist, kann sich bei Hegel immer erst im nachhinein, nachdem er sich in der Besonderung zum Konkreten hin gezeigt hat, vollziehen. Denn die „[...] Idee des Geistes erfordert, daß er sich [...] gegenständlich macht [...]“9. Und wenn „[...] die Gegenstände subjektiver Art, d.h. nur im Geiste und nicht als äußerliche Objekte vorhanden sind, so wissen wir, im Geiste sei nur, was er durch seine Tätigkeit hervorgebracht hat“10. Insofern ist ein Erkennen dessen, was der menschliche Geist ist, immer nur ein nachträgliches Erkennen, das stets von den Hervorbringungen desselben auszugehen hat. Dadurch, daß „[...] der Geist wesentlich diese Tätigkeit des Sichhervorbringens ist, [...] ergeben sich daraus [aber zumindest] Stufen seines Bewußtseins; aber er ist sich immer nur bewußt gemäß dieser Station“11.
Da die Kunst wiederum zu jenen Formen gehört, in denen sich der menschliche Geist niederschlägt und der menschliche Geist sich in ihr ein Bewußtsein seiner selbst gibt, versucht Hegel auf Grundlage einer Analyse der Kunst letzten Endes auch zu Aussagen über den Geist des Menschen zu gelangen. Er denkt also die Entwicklungsgeschichte der Kunst demnach auch immer ein Stück weit als Entwicklungsgeschichte des menschlichen Geistes. In diesem Zusammenhang sind auch die verschiedenen Kunstformen, die symbolische, klassische und romantische, zu denen sich die Kunst im Laufe ihrer Geschichte hin entwickelt, eingebettet. Denn in den verschiedenen Kunstformen und den ihnen zugeordneten Künsten spiegeln sich der jeweilige Begriff und der jeweilige Grad an reflexiver Selbsterkenntnis des menschlichen Geistes wider.12 Geistesgeschichte ist daher bei Hegel also auch immer Kunstgeschichte, wobei dies umgekehrt in noch weitaus stärkerem Maße gilt. Schließlich ist Kunst bei Hegel als Resultat geistig-produktiven Schaffens immer ein Kind13 des sich tätig hervorbringenden14 Geistes.
Im Zuge seiner kontinuierlichen Entwicklung hat der menschliche Geist im Verlauf seiner Geschichte aber ein gesteigertes Maß an reflexiver Selbstdurchdringung erreicht, das es der Kunst am Ende unmöglich macht, diesen immer weiter ins Abstrakte sich treibenden geistigen Gehalt und Bewußtseinsinhalt im Modus des sinnlich- konkret Anschaulichen auszudrücken. Die Kunst verliert damit ihre ursprüngliche Bedeutung – ohne daß sie deshalb sofort die Grenzen der Kunst übersteigt. Aber ab einem gewissen Punkt ist sie nicht mehr in der Lage, dem Geist des Menschen als sinnlich anschauliches Ausdrucksmedium zu dienen. Die Kunst hat sich deshalb, um den neuen und im hohen Grade abstrakten Gehalt, der im wesentlichen mit der christlichen Religion zusammenfällt, überhaupt noch ausdrücken zu können, um neue Erscheinungs- und Gestaltungsweisen zu bemühen.
In Abhängigkeit davon, wie sich der menschliche Geist als Ausdruck seiner Entwicklung (auch) in der Kunst ein immer höheres und sich immer weiter ins Abstrakte steigerndes Bewußtsein seiner selbst gibt und damit die Kunst sukzessive an den äußersten Rand dessen drängt, was sie in der Lage ist, sinnlich-konkret auszudrücken, verschieben sich daher auch die Gewichtungen in dem für die Kunst und deren Werke konstitutiven Verhältnis von sinnlicher Gestalt und geistigem Gehalt, von Form und Inhalt. Denn schließlich vollzieht die Kunst nicht nur inhaltlich, sondern auch in bezug auf ihre äußerliche Erscheinungs- und formale Gestaltungsweise einen Entwicklungsprozeß, der an den des Geistes gekoppelt ist. Und als Ergebnis dieses Prozesses zieht sich der Geist, da es ihn beständig drängt, sich in einem sinnlichen Material einzuwohnen, das ihm und seiner Entwicklungsstufe als adäquater Ausdruck seiner selbst gemäß ist, im Verlaufe seiner Entwicklung Schritt für Schritt aus der Sinnlichkeit zurück.15 Er löst damit das wechselseitige Aufeinanderangewiesensein von Form und Inhalt, die „gediegene“16 „Ineinsbildung“17 von Gehalt und Gestalt, wie sie die klassische Kunstform für Hegel als Ideal der Schönheit verkörperte, schließlich auf. Erforderte in der klassischen Kunst ein bestimmter geistiger Gehalt eine bestimmte, von ihm vollständig durchdrungene sinnliche Gestalt, so geht dieses gegenseitige Abhängigkeitsverhältnis in der romantischen Kunst schließlich weitestgehend verloren.
Der sukzessive Rückzug des Geistes aus der Sinnlichkeit hat für die Kunst und ihre äußere Erscheinungsweise weitreichende Folgen: Zum einen, wie bereits zuvor angedeutet, befreien sich beide Seiten des Kunstwerks, Form und Inhalt, in der romantischen Kunstform zunächst aus ihrer gegenseitigen Abhängigkeit, und sie können sich fortan (auch) unabhängig voneinander und autonom (im Sinne der Modernen Kunst) entwickeln. Hierdurch wird es schließlich möglich, daß sich ein beliebiger Inhalt einer beliebigen Form bemächtigt. Darüber hinaus wird die Kunst im Laufe ihrer Entwicklung durch den voranschreitenden Rückzug des Geistes aus der sinnlichen Materie, aber auch hinsichtlich ihrer Inhalte, die sie fortan ergreifen kann, frei. Schließlich unterliegt sie im Gegensatz zur klassischen Kunstform nicht mehr den Beschränkungen, die insofern mächtig wirkten, als der geistige Gehalt, den die klassische Kunst auszudrücken fähig war, auch begrenzt wurde durch die festgelegten Möglichkeiten der sinnlich-konkreten Gestaltung und der hierzu verwandten starren, dem Ausdruck des Geistes nur bedingt angemessenen sinnlichen Materialen18. Denn mit den nun unstofflichen, weitaus flexibleren und formbareren Mitteln, den sozusagen geistigen Formen – zu ihnen zählt Hegel unter anderem die Vorstellung und die geistige Veranschaulichung19 –, die sich dem Geist und seinen Bedürfnissen gegenüber als willfähriger und gefügiger erweisen, weil sie ihm nun eine Ausdehnung in jeder Hinsicht ermöglichen, gewinnt die romantische Kunstform im Unterschied zur klassischen nicht nur eine neue, wenngleich weniger sinnliche und in die innere Vorstellung des Menschen verlagerte Gestalt, sondern sie gewinnt dadurch auch die Befähigung zum Ausdruck eines neuen, tieferen und nahezu allumfassenden Gehalts.
Insgesamt betrachtet ist das Ende der klassischen Kunst bei Hegel zunächst einmal das nahende Ende jeder sinnlichen und an die Sinnlichkeit gebundenen Kunst-Form, da sich der Geist im Zuge seiner Fort- und Höherentwicklung kontinuierlich aus der sinnlichen Materie herauswindet20, bis er sie schließlich sublimiert und am Ende über sie triumphiert, um so in der romantischen Kunstform zu einem Ausdrucksmittel zu gelangen, das ihm als einziges adäquat ist. Das einzige dem Geiste aber adäquate und entsprechend sinnlichkeitslose, aber deshalb auch formbarste Material, das ihn auf der höchsten Stufe der romantischen Kunstform nahezu mit sich selbst versöhnt, sind das sprachliche Element und die dramatische Rede21 in der Poesie und in letzter Konsequenz der abstrakte Begriff in der Philosophie. Hat der menschliche Geist in der Kunst im Laufe seiner Entwicklung das Joch der Sinnlichkeit und die daraus resultierenden Beschränkungen hinsichtlich der Gestalt und die damit direkt verbundenen des Gehalts gleichsam abgeschüttelt, um so in der Kunst „[...] die tiefsten Interessen des Menschen, die umfassendsten Wahrheiten des Geistes zum Bewußtsein [...]“22 bringen zu können, so ist mit dieser neuen inhaltlichen Freiheit wiederum das endgültige Ende der Kunst verbunden. Denn am Ende, wenn die Kunst das Geistige nicht mehr versinnlichen kann, sondern es statt dessen ‚nur noch’ auf den Begriff bringt, um es so, mit dem genuinen Medium des Geistes nahezu versöhnt, dem abstrakten Denken zugänglich zu machen, geht die Kunst nach Hegel unweigerlich und unvermerkt in den Bereich der Philosophie über. Damit löste sich im Übergang zur romantischen Kunstform nicht nur die schöne, die klassische Kunstform auf, die stets des sinnlichen Momentes bedurfte, sondern ein ähnliches Schicksal widerfährt auch später der romantischen Kunstform, obgleich sie sich auf der höchsten Stufe ihrer Entwicklung, und zwar in der Poesie, des sinnlichkeitslosesten und geistigsten Materials bedient23, das die Bedürfnisse des Geistes am ehesten zu befriedigen vermag24. Da es aber im Begriff des Geistes begründet ist, daß er nicht eher ruht, bis er vollständig versöhnt und befriedigt im Anderen seiner selbst zu sich zurückkehrt25, übersteigt er am Ende inhaltlich, aber auch hinsichtlich der verwandten Gestaltungsmittel die Möglichkeiten der Kunst; und er läßt sie hinter sich zurück, um sich in der Philosophie in dem ihm genuinen Medium, dem abstrakten Begriff, das höchste, aber deshalb auch sinnlichkeitsloseste Bewußtsein seiner selbst zu geben.
2. Begrenzung des Untersuchungsgegenstandes – Ziele dieser Arbeit
Nach dem gerafften Überblick über den Verlauf und einige inhaltliche Aspekte der Ästhetik sollen nun im weiteren Fortgang dieser Arbeit folgende Gesichtspunkte Gegenstand einer vertieften Analyse werde:
Zunächst einmal fragt es sich, was Hegel unter dem Terminus der Idee verstanden wissen will, wenn er formuliert, es sei Aufgabe der Kunst, „[...] die Idee für die unmittelbare Anschauung in sinnlicher Gestalt [...] darzustellen [...]“26. Schließlich stellt die grundlegende Klärung der Frage, wie sich die Idee des Schönen in der Kunst gezeigt hat, sowohl den inhaltlichen Gegenstandsbereich als auch den Ausgangspunkt für die philosophische Ästhetik Hegels dar. Deshalb scheint es wichtig und legitim zu sein, die philosophiegeschichtlichen Implikationen, die dem Begriff des Schönen an sich, respektive der Idee des Schönen, zugrunde liegen, näher herauszustellen. Dies scheint auch insofern notwendig, als sich Hegel in diesem Zusammenhang des öfteren auf Platon bezieht, um sich dann in der Auseinandersetzung mit dem platonischen ‚Terminus’ der Idee von ihm kritisch absetzen zu können. Dergestalt wird dann vielleicht nachvollziehbar, warum Hegels systematischer Ansatz mitunter auch als „ästhetischer Platonismus“27 bezeichnet wird. Es werden also im ersten Abschnitt dieser Arbeit bestimmte Voraussetzungen in Hinblick auf die Idee des Schönen nachgetragen und aufgedeckt, die Hegel implizit als bekannt vorauszusetzen scheint.
Im Zuge der Beschäftigung mit Platon wird auch darzustellen sein, welche Rolle und welchen Stellenwert er der Kunst zuerkannte und warum sie, begründet durch seine Auffassung vom Wesen der Kunst, bei ihm im Gegensatz zu Hegel nicht den Anspruch erheben durfte, Organon der Wahrheit zu sein.
Nach der Analyse dessen, was Platon unter der Idee des Schönen verstand, soll gezeigt werden, wie dieses Vorstellungskonzept schließlich bei Hegel im Begriff des Geistes und somit in seiner Philosophie des absoluten Geistes aufgeht und woraus Hegel den erkenntnistheoretischen Stellenwert, den er der Kunst in seinem System zuweist, im einzelnen ableitet. Um aber verstehen zu können, wieso die Kunst in der Vergangenheit ihr erkenntnistheoretisch bedeutsames Potential schließlich wieder verloren hat, soll fernerhin gezeigt werden, wie und warum sich die Idee des Schönen seinem Begriff nach in höchster Vollendung nur vorübergehend im Ideal der klassischen Kunstform realisieren konnte und welche Gründe und weltanschaulichen Positionen es waren, die den Übergang zur romantischen Kunstform bewirkten, bis auch sie sich schließlich wiederum auflöst.
Die Arbeit möchte dergestalt die notwendigen Voraussetzungen schaffen, um letzten Endes nachvollziehen zu können, was Hegel mit der »These vom Ende der Kunst« zum Ausdruck bringen wollte. Insofern ist die Fragestellung wenig innovativ, aber sie ist in sich selber Anspruch genug und möchte, nachdem herausgestellt worden ist, was Hegel mit jener These bezeichnet, das Fundament dafür schaffen, um zukünftig die Konsequenzen, die sich aus »dem Ende der Kunst« ergeben, analysieren zu können. Aus der Grundanlage dieser Arbeit erklärt es sich fernerhin, daß es in ihr nicht darum geht, sich in ein kritisches Verhältnis zu Hegel zu setzen, sondern vor aller möglichen Kritik hat im Sinne eines weitestgehend hermeneutisch geprägten Verfahrens zunächst einmal das Bemühen zu stehen, Hegels Positionen in der »Ästhetik« zu rekonstruieren. Daß sich aus der »Ästhetik«, insbesondere aus Hegels Bestimmung des Ideals, auch grundlegende formalästhetische Kriterien ableiten lassen, die nach wie vor eine Rolle spielen, zumindest in der Literaturwissenschaft, ist hierbei gleichsam ein nützlicher, aber dennoch nur nebensächlicher Umstand. Schließlich bemüht sich die Philosophie der Kunst nicht „[...] um Vorschriften für die Künstler, sondern sie hat auszumachen, was das Schöne überhaupt ist[,] und wie es sich [...] in Kunstwerken gezeigt hat, ohne dergleichen Regeln geben zu wollen“28.
Aus dem dreibändigen Umfang der »Ästhetik« erklärt es sich von selbst, daß sich diese Arbeit nur als geringe Teildarstellung verstanden wissen will und daß in ihr wesentliche Aspekte seiner Philosophie der schönen Kunst im notwendigen Bemühen um Selbstbegrenzung ausgespart werden müssen. Es ist in Anbetracht des Umfangs der »Ästhetik« um so mehr geboten, das Unmögliche erst gar nicht versuchen zu wollen. Aber es wäre auch schon ein Gewinn, wenn es gelingen sollte, sich mit dieser Arbeit auch nur ein Stück weit der inkommensurablen Größe des Hegelschen Werks zu nähern.
3. Philosophiegeschichtliche Voraussetzungen
3.1. Platon stellt die zentrale Frage: Was ist das Schöne an sich?
Seit je hat die Frage, was das Schöne ist, das philosophische Denken beschäftigt und herausgefordert. Belege dafür, daß diese Frage bereits im Altertum Gegenstand differenzierter Reflexionen war, findet man vornehmlich bei Platon (*Athen 427, † ebd. 347). Er dürfte wohl zu denjenigen gehören, die mit als erste versucht haben, das Phänomen des Schönen und dessen Faszination zu ergründen. In dem Dialog »Hippias maior«29 beispielsweise läßt Platon den Sophisten Hippias den Versuch unternehmen, zu bestimmen, was das Schöne an sich ist30. Gefragt wird nicht nach der „sichtbaren Mannigfaltigkeit von Schönheiten“31, also nicht nach dem, was im konkreten Einzelfall schön zu sein scheint. Sondern Platon ist in Hinblick auf das Schöne in diesem wie auch in den übrigen Dialogen bemüht, jenes „intelligible“32 unveränderliche Eine, „das Ansichschöne“33, das der Vielzahl der vergänglichen Einzelphänomene gemeinsam ist und durch dessen Teilhabe an ihm die Dinge überhaupt erst schön werden und scheinen, durch abstrahierendes Denken im Geiste als ein Allgemeines zu bestimmen.34 Es wird bei Platon demnach immer das „Wesen“35, die „Idee“36 des Schönen gesucht, jener transzendente und letzte Grund, der den Dingen in ihrem konkreten Dasein das Schönsein verleiht.
3.2. Warum ist Platon bemüht, die Vielgestaltigkeit und Vielheit der Dinge in abstrakter Einheit zusammenzufassen?
Platons generelles Bestreben, im Denken ausschließlich dasjenige als abstrakte Einheit festhalten zu wollen, was den in Veränderung und im ständigen Vergehen begriffenen Dingen gemeinsam ist, mag auf die Natur des menschlichen Geistes zurückzuführen sein. Infolge der unendlichen Vielheit und Vielgestaltigkeit der Dinge, die den Menschen umgeben und die er wahrnimmt, scheint der Geist um Ordnung und Strukturierung der zunächst chaotisch auf ihn einstürmenden sinnlichen Eindrücke bemüht zu sein. Um dieses Chaos an Eindrücken, hervorgerufen durch jene Vielheit und Vielgestaltigkeit der Dinge, im Denken bewältigen und es auflösen zu können, ist er stets bemüht, sie in einem abstrakten Objekt37, oder anders gesagt, in ‚Form’ der intelligiblen Wesens-‚Gestalt’ zusammenzufassen. Diese ‚Gestalt’ stellt umgekehrt ihrerseits wiederum sicher, daß es dem Menschen überhaupt möglich ist, die Dinge trotz ihrer Verschiedenheit und Vielgestaltigkeit wiederzuerkennen – und zwar an jenen, im Geiste abstrakt zusammengefaßten individuellen Merkmalen, am Wesenhaften.
Bliebe dem menschlichen Geist, so begründet Platon die Art und Weise seines Denkens selber, die Fähigkeit versagt, jene abstrakten Objekte im Geist bilden und festhalten zu können, fehlten ihm auch die Gegenstände, auf die er sein Denken richten könnte. Dem Vermögen, so Platon weiter, die Dinge einer wissenschaftlichen Untersuchung unterziehen zu können, wäre damit die notwendige Grundlage entzogen.38 Der menschliche Geist scheint jener abstrakten Objekte also auch zu bedürfen, um an ihnen, wenn man sie gegenständlich deuten will, das konkret Einzelne überhaupt messen und es damit vergleichen zu können. Nur so gelangt er zu einer hinreichend gesicherten Grundlage, um Aussagen über die Erfahrungswirklichkeit machen zu können.39
3.3. Das Dilemma der Metaphysik: Die Ideen existieren losgelöst von dem, wovon sie Ideen sind
Ein grundlegendes Dilemma des platonischen Denkens und der Metaphysik im allgemeinen offenbart sich aber, wenn diese Art des Philosophierens auf das Phänomen des Schönen selber angewandt wird. Denn das nur durch die Sinne wahrnehmbare Schöne habe – und darin besteht der zu lösende Widerspruch – Grund und Ursache in einer wahrnehmungstranszendenten Sphäre; und zwar in dem ausschließlich „durch die Vernunft erkennbaren Reiche und Gebiete“40, und nur dort, gesondert von der sinnfälligen Existenz des Schönen, sei es an sich in seinem wahren, respektive in seinem unveränderlichen und eigentlichen Sein. Wie die übrigen Ideen könne die Idee des Schönen folglich auch nur im Bereich der Vernunfterkenntnis erkannt und begriffen werden. In letzter Konsequenz existiert die Idee (des Schönen) bei Platon gleichsam „als gesonderte an und für sich seiende Wesenheit“41 unabhängig und losgelöst von dem, was uns im konkreten Dasein (als schön) erscheint.
Da die Idee des Schönen ausschließlich „[..] mit dem Auge des Geistes [...]“, mit der Vernunft „[...] geschaut [...]“42 werden kann und alles andere in der Erfahrungswirklichkeit nur infolge der Teilnahme an der Idee des Schönen selber schön scheint, stellt sich umgekehrt die Frage – das Problem der Methexis –, wie das Einzelne der Idee des Schönen teilhaftig wird. Diese Frage drängt sich um so mehr auf, als ja die Idee (des Schönen), wie soeben dargelegt, bei Platon unabhängig vom konkreten Dasein (des Schönen) existiert.
3.4. Die ‚Lösung’ der Frage, wie sich das Einzelne zur Idee verhält
Lösen, wenngleich wenig überzeugend lösen läßt sich jene Frage im Rückgriff auf das Höhlengleichnis43. Obgleich Platons Sprachgebrauch im Hinblick auf das, was bei ihm unter »Idee« verstanden wird, wenig konsistent zu sein scheint – man kann bei ihm eigentlich noch gar nicht von einem genau festgelegten Terminus »Idee« sprechen44 –, legen bestimmte und wiederholt auftretende Formulierungen, deren er sich bedient, wenn er implizit vom Verhältnis des Einzelnen zur Idee (des Schönen) spricht, zumindest nahe, daß es statthaft ist, die Frage der Methexis45 auch aus dem Höhlengleichnis zu erschließen. Als Ergebnis eines derartigen Analogieschlusses verhält sich das Einzelne zur Idee (des Schönen) wie das Ab- und Schattenbild zum Urbild (desselben). Im »Parmenides« findet sich jene Passage, in der er dieses Verhältnis auch selber so beschreibt, indem er ausführt:
„[...] diese Ideen stehen [...] als die Musterbilder im Bereiche des [... ewigen Seins] da, alles andere aber [in der sinnlich-sichtbaren Welt] ist ihnen ähnlich und als ihre Abbilder anzusehen, und jene Teilnahme desselben an den Ideen ist keine andere als eben die, daß sie ihnen nachgebildet sind.“46
Das zuvor Zitierte läßt überdies den Eindruck entstehen, Platon betrachte das konkret-sinnfällige Dasein der Dinge als etwas Sekundäres. Schließlich sind die Dinge der jeweiligen Idee nur nachgebildet und ihr deshalb lediglich im Sinne eines wesenlosen Abbildes ähnlich. Wird das sinnlich-empirisch Wirkliche bei Platon dergestalt prinzipiell als das Unwesentliche erachtet, wird es folglich auch unmöglich, beide Reiche, und zwar das der Vernunft als Sitz der Ideen, mit dem des sinnfälligen Daseins der Dinge im Denken wiederzuvereinen und auszusöhnen – Wahres im Sinne der Idee und Scheinbares im Bereich des „sinnlich Sichtbaren“47 lassen sich daher bei Platon im Denken nicht miteinander verbinden.
Platons namhaftester Schüler, Aristoteles, mochte jene Trennung von Idee und Einzelnem nicht hinnehmen, und er widersprach nachhaltig und vehement Platons Vorstellungskonzept von den Ideen als gesondert existierenden Wesenheiten. Denn Aristoteles schien es undenkbar, „[...] daß das Wesen gesondert von dem existiert, wovon es Wesen ist“48. „Wie können [...]“, so fragt er, um dergestalt Platon zu widerlegen, „[...] die Ideen, die ja die Wesen der Dinge darstellen, gesondert von ihnen existieren?“49 Auch ist es für ihn erwiesen, „[...] daß nichts Allgemeines neben den einzelnen Dingen getrennt vorhanden ist“50. Ganz im Gegensatz zu Platon und mit ähnlichen Argumenten wie denen des Aristoteles versucht Hegel später, nachzuweisen, daß die Idee im Sinne des Wahren das Ergebnis eines prozessualen Aufeinanderbeziehens von Allgemeinem und Realem, von Abstraktem und Konkretem ist, so daß schließlich das Wahre im Sinne der Hegelschen Idee stets mit dem Scheinbaren zusammengedacht werden muß.
Für Platon jedoch, und dies gilt es festzuhalten, existieren die Idee und das Wahre vorerst noch allein als nur dem Denken Zugängliches, losgelöst und unabhängig von dem Gebiet des sinnlich-empirisch Wirklichen. Und obgleich die Dinge hier nach einem jeweiligen Ur- und Musterbild geformt wurden, liegen für ihn die eigentlichen Erkenntniswerte nicht in diesem Gebiet, sondern in obersten Zielpunkten des geistigen Schauens, Denkens und Strebens nach jenen Ur- und Musterbildern des Wirklichen, den Ideen.51
3.5. Die besondere Stellung der Idee des Schönen – sie schlägt eine Brücke zwischen der Ideenwelt und dem Erfahr- und sinnlich Wahrnehmbaren
Unter den Ideen selber nimmt die Idee des Schönen bei Platon allerdings eine herausragende Stellung ein. Zum einen, weil ihr Platon auch eine ethisch-moralische Dimension zuschreibt, oder besser gesagt, zumindest bei ihr anklingen läßt, indem er in »Hippias maior«, beispielsweise, „das Schöne als das Ursächliche des Guten“52 ansieht. Demgemäß steht über der Idee des Guten und Wahren die Idee des Schönen als der Kulminationspunkt, in dem die anderen Ideen sich zusammenschließen.53 Darüber hinaus, und dies mag verwundern, wenn man bedenkt, daß Platon das sinnlich Wahrnehmbare gegenüber dem Reich der Vernunfterkenntnis stets als das vermeintlich Nachrangige erachtet, gesteht er den schönen Dingen indirekt zu, daß ihnen in gewissem Maße dennoch eine erkenntnisdienliche Funktion innewohne. Denn als Abbilder des Schönen an sich seien sie immerhin in der Lage, dasjenige, wovon sie Abbilder sind, vermittels ihres schönen Scheins (andeutungsweise und im Sinne der Evokation) transparenter werden und auf die Sinneswahrnehmung des Menschen wirken zu lassen. Die Idee des Schönen schlägt somit durch ihren „lichten Glanz“54, durch die sinnlich wahrnehmbaren Qualitäten ihrer Abbilder und deren Wirkung auf die Sinneswahrnehmung als einzige der Ideen gleichsam eine Brücke zwischen der transzendenten Sphäre der Vernunfterkenntnis, in der die Ideen verankert sind, und dem Gebiet des konkret Erfahr- und sinnlich Wahrnehmbaren. Ein Erkennen des Schönen an sich sei dennoch mit den Sinnen ausgeschlossen; es sei letztendlich nur mit den „Geistesaugen“55, anders formuliert, nur mit den Mitteln des Verstandes zu erreichen – wenn überhaupt. Denn, so läßt er Sokrates im »Phaidros« ausführen, was
„[...] die Schönheit betrifft, so stand sie [...] unter jenen befindlichen [Ideen] in lichtem Glanze; und auch hierher gekommen [in das Reich der tatsächlichen Erscheinungen], fassen wir sie mit dem hellsten unserer Sinne auf, als am hellsten schimmernd. Das Auge nämlich kommt uns als der schärfste der Sinne des Körpers zu; doch wird [...] Weisheit [respektive Wahrheit] damit nicht erblickt.“56
Hingegen erwecke aber auch Eros, ausgehend von der (erotischen) Begeisterung, die das sinnfällig Schöne im Menschen auslöse, den Drang und das Bestreben des Menschen, Schönheit nicht nur mit den Augen in Form des menschlichen Körpers besehen, sondern sie in immer mehr umschließenderen und allgemeineren Formen erkennen zu wollen, bis der Mensch die Schönheit schließlich in ihrer höchsten Gestalt, der Idee des Schönen selbst, „geschaut“ hat. Eros, verstanden als die Begeisterung und Liebe des Menschen für das Schöne in seinem sinnfälligen Dasein und als des Menschen Drang nach Einsicht, wird somit im »Symposion« zum Führer eines sich stufenweise vollziehenden Erkenntnisprozesses, der von der Begeisterung für die Schönheit des menschlichen Körpers sukzessive zur Schau des Schönen an sich und damit zur Ideenwelt leitet.57 Und zur Erkenntnis besonders geeignet sind die schönen Dinge wiederum insofern, als sie, wie zuvor ausgeführt wurde, das, wovon sie Abbilder sind, im Gegensatz zu anderen Dingen vermittels ihres schönen Scheins transparenter werden und auf die sinnliche Wahrnehmung wirken lassen.
3.6. Widersprüchlichkeiten lassen erkennen, daß es zum Sein des Schönen gehört, sich als Schein zu zeigen
Einerseits, so bleibt festzuhalten, sei es nur mit den Mitteln des Verstandes denkbar, sich der Idee des Schönen zu nähern. Hingegen existiere wiederum auch die Möglichkeit, geführt von Eros, in dem sich letztendlich die Liebe zum wahrnehmbaren Schönen mit dem genuin menschlichen Drang nach Erkenntnis verbindet, jenen zuvor beschriebenen Prozeß zu durchlaufen, der die sinnliche Wahrnehmung offenbar zur Voraussetzung hat und von ihr aus zu einem allmählichen Aufschwung von der Sinnen- zur Ideenwelt leitet und so schließlich zu wahrer Erkenntnis führt. Betrachtet man diese beiden theoretischen Möglichkeiten zusammen, kann man bei Platon durchaus einen Widerspruch erkennen, und zwar einen Widerspruch hinsichtlich der Frage, wie man sich den Weg zu denken habe, der es einem theoretisch ermöglicht, zu den Ideen vorzudringen. – Sollte man zu ihnen etwa auch gelangen können, wenn man dabei, zumindest im Anfangsstadium jenes Prozesses, von der sinnlichen Wahrnehmung ausgeht? Es scheint so. Unter diesem Blickwinkel betrachtet, kann man Platon im Gegensatz zu der Feststellung von vorhin nicht vorhalten, er habe das Sinnliche stets abgelehnt und es lediglich als das Nachrangige gegenüber dem Reich der Idee erachtet. Vielmehr drängt sich nun der Eindruck auf, als habe es bei ihm schon erste Ansätze gegeben, die von jenen dankbar aufgenommen und weiterentwickelt wurden, die später das Wesen des Schönen in einer wechselseitigen Durchdringung von Sein und Schein erkannten, und zwar dergestalt, daß es zum Sein des Schönen gehöre, sich als Schein zu zeigen.58 Platons Vorstellung, daß die Idee des Schönen durch die sinnlich wahrnehmbaren Qualitäten ihrer Abbilder und deren Wirkung auf die Sinneswahrnehmung als einzige der Ideen gleichsam eine Brücke zwischen dem Reich der Vernunfterkenntnis, dem ewigen und eigentlichen Sein, und dem Gebiet des sinnlichen Scheins herzustellen vermag und daß hinwiederum die sinnliche Wahrnehmung die Eingangsform für den beschriebenen Aufschwung zur Ideenwelt darstellt, hat vielleicht das ihrige zum späteren Verständnis vom Wesen des Schönen mit beigetragen.
3.7. Platons Verständnis vom Wesen der Kunst – sie verharrt im bloßen Schein und kann deshalb nicht Organon der Wahrheit sein
Obwohl Platon den schönen Dingen als Abbildern des Schönen zugesteht, ihnen komme, wenn auch nur durch den Schein dessen, wovon sie Abbilder sind, eine erkenntnisdienliche Funktion zu, so darf die Kunst dennoch keineswegs den Anspruch erheben, Organon der Wahrheit und Erkenntnis zu sein. Ganz im Gegenteil! Was den Wahrheitsanspruch der Kunst anbelangt, so fällt Platon ein vernichtendes Urteil über sie. Sucht man nach Gründen für dieses Urteil, so wird man sie jedoch nicht in Platons Konzept vom Wesen des Schönen selber finden. Statt dessen resultiert jenes Urteil vielmehr aus einer bestimmten Kunstauffassung. Nicht aus Gründen also, die mit der Idee des Schönen selber unmittelbar zusammenhängen, sondern aus Gründen, die sich aus Platons Auffassung vom Wesen der Kunst ergeben, negiert er den Wahrheitsanspruch derselben.
Platon geht davon aus, Kunst sei stets Nachbildung und Nachahmung (mímesis) von bereits Bestehendem. Diese für ihn grundlegende Auffassung gewinnt er an Hand eines kontrastiven Vergleichs. Und zwar vergleicht er im zehnten Buch der Politeia den Handwerker – der bei ihm auch als Künstler gilt, weil er es durch Kunstfertigkeit (téchne) und besonderes Geschick versteht, einen Gegenstand zum praktischen Gebrauch zu fertigen – mit dem Künstler, genauer gesagt mit dem Maler. Ausgangspunkt für den Vergleich zwischen dem Handwerker, dem Bildner der Dinge, und dem Maler, den Platon Nachahmer heißt, ist folgende Hypothese: Gott, oder eine wie auch immer zu bezeichnende Kraft produktiver Natur, sei als Schöpfer aller Wesenheiten anzunehmen. Auf diese Kraft seien letzten Endes die Ideen in ihrem Ursprung zurückzuführen. Da man von allem und auch von jedem Gegenstand eine Idee anzunehmen habe, muß es, so illustriert Platon sein Denken, beispielsweise auch einen ideell existierenden Stuhl geben, also jenes unikale und intelligible Musterbild eines Stuhls, das die konkret-individuellen Besonderheiten eines jeden Stuhls, um es hier einmal in Anlehnung an Hegel auszudrücken, im Sinne des Begriffs in abstrakter Einheit in sich zusammenfaßt und in sich beschlossen hält. Der Handwerker, genauer gesagt der Tischler, sei nun derjenige, um auf den eigentlichen Vergleich zurückzukommen, der gemäß Platon bestrebt ist, einen Stuhl nach möglichst getreuer Maßgabe jenes ideell existierenden Stuhles zu fertigen, ihn zumindest in dem Maße getreu der Idee des Stuhls zu fertigen, wie es ihm gelungen ist, zu dieser Idee vorzudringen. Der Maler aber würde im Gegensatz zum Tischler nicht versuchen, sich jenem intelligiblen Ideal- und Musterbild des Stuhls zu nähern, sondern er würde sich statt dessen damit begnügen, den Stuhl so zu malen, wie er ihm als Produkt des Tischlers erscheine. Verglichen mit jener gottähnlichen Kraft, auf die jenes Muster- und Urbild des Stuhls zurückgehe, und dem Tischler, der den konkreten Stuhl insoweit nach Maßgabe der Idee des Stuhls fertige, wie es ihm gelungen ist, zu dieser Idee vorzudringen, fabriziere der Maler lediglich ein Abbild des bereits Bestehenden, so wie es sich ihm dem Schein, respektive dem Anschein nach darstellt. Und schon deshalb ist für Platon bewiesen, daß sich der Maler „[...] mit einem im dritten Grade von der Wahrheit entfernten Objekte [...]“59 beschäftige.
Daß der Maler die Dinge einerseits lediglich so abbilde, wie sie ihm zu sein scheinen, und es ihm deshalb niemals gelinge, sie in ihrem wirklichen (Da-)Sein so zu malen, wie sie sind, der Maler aber wiederum andererseits den Schein und bloßen Anschein der Dinge bewußt für seine Wirkungsabsichten einzusetzen verstehe, wird überdies deutlich an Hand dessen, was wir seit ihrer Entdeckung und Entwicklung in der Renaissance unter der Perspektivgebundenheit der Malerei verstehen. Platon bezieht sich in diesem Zusammenhang und aus Gründen der Anschaulichkeit erneut auf das Beispiel des Stuhls:60
Der Stuhl, so wie ihn der Betrachter wahrnehme, erscheine in Abhängigkeit vom jeweiligen Blickwinkel in einer Gestalt, die sich von derjenigen, die unter einer anderen Perspektive gewonnen wird, erheblich unterscheide. Das Auge nehme also Verschiedenheiten des Objektes wahr, obgleich das betrachtete Objekt selber unverändert geblieben ist. Die wahrgenommenen und letzten Endes lediglich perspektivbedingten Verschiedenheiten des Objektes bestünden also nur dem Scheine nach, so Platon. Der Maler, der bei der Auffassung des Bestehenden nur zu leicht Gefahr laufe, selber ein Opfer dieser Sinnestäuschung zu werden, sei nun wiederum bestrebt, Bestehendes, so wie es ihm durch andere hervorgebracht erscheint, mit den Mitteln des Scheins zu reproduzieren. Auf diese Art und Weise, um indirekt auf das Beispiel des Stuhls zurückzukommen, vermag der Maler nicht nur Verschiedenheiten dem Scheine nach darzustellen, wo in Wirklichkeit keine vorhanden sind, sondern er könne mit dem trügerischen Mittel des Scheins alles Erdenkliche nachahmen.
Aber es sei eben nicht die Nachahmung des Wesenhaften wie es nur im Sinne der Ideen wahrhaft wirklich ist, sondern lediglich (mit den Mitteln des Scheins) die Nachahmung des Bestehenden, wie es sich dem Schein nach darstellt, was die Malerei zu leisten vermag. Deshalb könne man ihr auf keinen Fall eine erkenntnisdienliche oder sogar eine erkenntnisleitende Funktion zusprechen. Schließlich, um pointiert formuliert zusammenzufassen, dringe die Malerei niemals zum eigentlich Sein, den Ideen, vor, sondern sie begnüge sich vielmehr mit dem bloßen Schein.
Nun könnte sich der Eindruck aufdrängen, Platon sei lediglich ein Gegner der Malerei gewesen und seine hier referierte Auffassung vom Wesen der Kunst würde sich nur auf diese spezielle Gattung der bildenden Kunst beschränken. Dem ist nicht so – leider, möchte man beinahe hinzufügen. Denn die Ansichten, die Platon hier in der Auseinandersetzung mit der Malerei gewinnt, wendet er auf alle Bereiche der Kunst, insbesondere aber auch auf die Dichtung an. Es läßt sich demnach auf die Kunst insgesamt dasjenige übertragen, was bereits zuvor für die Malerei im besonderen galt: Kunst, verstanden als Nachbildung von Bestehendem, strebe nicht zu den Ideen, zur Wahrheit und zum eigentlichen Sein der Dinge, sondern sie beschäftige sich lediglich mit dem bloßen Schein. Und statt Wahres darzustellen, stelle sie nur Scheinbares, nur Trug- und Schattenbilder dar.
3.8. Die Unzulänglichkeiten der sinnlichen Wahrnehmung als Grund, weshalb es die Kunst vermag, mit Trugbildern zu täuschen
Daß es der Kunst gelinge, den Rezipienten zu täuschen, und sie ihn beispielsweise Qualitäten und Eigenschaften eines Objektes wahrnehmen lasse, die dieses Objekt realiter gar nicht besitzt, führt Platon auf die Besonderheiten und die generellen Unzulänglichkeiten des sinnlichen Wahrnehmungsvermögens zurück, auf die Kunst abziele. Das menschliche Wahrnehmungsvermögen, so ist Platon bemüht, es veranschaulichend darzustellen, lasse beispielsweise einen Gegenstand aus der Ferne betrachtet klein, aus der Nähe besehen groß erscheinen. Die (distanz- und perspektivabhängigen) Aussagen und Ergebnisse hinsichtlich der wahrgenommenen Größe des Gegenstandes seien aber unzuverlässig, da es beispielsweise nicht angehen könne, daß der Gegenstand beides gleichzeitig sei, nämlich groß und zugleich klein. Um nun Aufschluß über die wahre Größe des Gegenstandes zu bekommen, bedürfe es eines Vermögens, das imstande sei, jene sinnliche Erscheinung objektiv zu berechnen und zu messen. Nun könne aber der Fall eintreten, daß dieses objektive Verstandes- und Vernunftvermögen zu Ergebnissen gelangt, die im Widerspruch zu dem Eindruck von Größe stehen, der durch die sinnliche Wahrnehmung gewonnen wurde. Damit sei bewiesen, so Platon, daß das ohne den Maßstab logischer Prüfung vorstellunggewinnende Seelenvermögen nicht mit dem Vermögen identisch sei, das mit dem logischen Maßstab solche Vorstellungen gewinnt.61 Mit anderen Worten: Das Wahrnehmungsvermögen unterscheidet sich von dem Vermögen, das mit (natur-)wissenschaftlich objektiven Methoden – zu ihnen zählt Platon beispielsweise das Rechnen, Messen und Wiegen – zu Vernunfturteilen gelangt. Da aber das rechnende Verstandes- und Vernunftvermögen zweifelsfrei als das edlere anzusehen sei, folge daraus, so Platons Quintessenz, daß das Wahrnehmungsvermögen als das niedere und vom Geist weiter entfernte Vermögen anzusehen sei. Und dies war es, was er
[...]
1 Hegel, G.W.F.: Werke. Auf der Grundlage der Werke von 1832 bis 1845 neu ed. Ausg. Red. E. Moldenhauer u. K. M. Michel. Hier Werke 13: Vorlesungen über die Ästhetik. Bd. I. Frankfurt a. M.: Suhrkamp. S. 35. Der Einfachheit halber unter Angabe des jeweiligen Bandes nachfolgend zitiert als »Hegel, G.W.F.: Ästhetik«.
2 Gadamer, Hans-Georg: Gesammelte Werke, Bd. I. Hermeneutik I: Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik. 6. Auflage. Tübingen J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) 1990, S. 65.
3 Hegel, G.W.F.: Ästhetik. Bd. I. S. 27–28.: „In dieser Beziehung liegt die Kunst dem Geiste und seinem Denken schon näher als die nur äußere geistlose Natur; er hat es in den Kunstprodukten nur mit dem Seinigen zu tun. Und wenn auch die Kunstwerke nicht Gedanken und Begriff, sondern [...] eine Entfremdung [des Geistes] zum Sinnlichen hin sind, so liegt die Macht des denkenden Geistes darin, nicht etwa nur sich selbst in seiner eigentümlichen Form als Denken zu fassen, sondern ebensosehr sich in seiner Entäußerung zur Empfindung und Sinnlichkeit wiederzuerkennen, sich in seinem Anderen zu begreifen, indem er das Entfremdete zu Gedanken verwandelt und so zu sich zurückführt. Und der [...] Geist wird sich in dieser Beschäftigung mit dem Anderen seiner selbst nicht etwa untreu, [...] sondern er begreift sich und sein Gegenteil.“
4 Hegel, G.W.F.: Ästhetik. Bd. II. S. 255.
5 Vgl. Hegel, G.W.F.: Ästhetik. Bd. I. S. 103.
6 Vgl. Kant, Immanuel: Kritik der Urteilskraft. Mit einer Einl. u. Bibliogr. hrsg. v. Heiner F. Klemme. Mit Sachanm. v. Piero Giordanetti. Hamburg: Meiner 2001. § 6, S. 58.
7 Vgl. hierzu Fußnote 74.
8 Hegel, G.W.F.: Ästhetik. Bd. I. S. 21.
9 Hegel, G.W.F.: Ästhetik. Bd. II. S. 25/16.
10 Hegel, G.W.F.: Ästhetik. Bd. I. S. 41.
11 Hegel, G.W.F.: Werke. Auf der Grundlage der Werke von 1832 bis 1845 neu ed. Ausg. Red. E. Moldenhauer u. K. M. Michel. Hier Werke 16: Vorlesungen über die Philosophie der Religion. Teil I, S. 78 – 80.
12 Vgl. Hegel, G.W.F.: Ästhetik. Bd. I. S. 103: „Denn der Geist, ehe er zum wahren Begriffe seines absoluten Wesens gelangt, hat einen in diesem Begriffe selbst begründeten Verlauf von Stufen durchzugehen, und diesem Verlaufe des Inhalts, den er sich gibt, entspricht ein unmittelbar damit zusammenhängender Verlauf von Gestaltungen der Kunst, in deren Form der Geist als künstlerischer sich das Bewußtsein von sich selber gibt.“
13 Vgl. Geulen, Eva: Das Ende der Kunst. Lesarten eines Gerüchts nach Hegel. Frankfurt a. Main: Suhrkamp 2002. S. 37: „Kunst ist des Geistes Kind.“
14 Vgl. hierzu Hegel, G.W.F.: Ästhetik. Bd. I. S. 49–50.
15 Vgl. Hegel, G.W.F.: Ästhetik. Bd. I. S. 142.: „In dieser Weise besteht das Nach der Kunst darin, daß dem Geist das Bedürfnis einwohnt, sich nur in seinem eigenen Inneren als der wahren Form für die Wahrheit zu befriedigen.“
16 Vgl. Hegel, G.W.F.: Ästhetik. Bd. I. S. 119.
17 Hegel, G.W.F.: Ästhetik. Bd. I. S. 111.
18 Vgl. Hegel, G.W.F.: Ästhetik. Bd. III. S. 232: „Bei der Wichtigkeit nämlich, welche die sinnliche Seite in den bildenden Künsten und der Musik erhält, entspricht nun, der spezifischen Bestimmtheit dieses Materials wegen auch nur ein begrenzter Kreis von Darstellungen vollständig dem besonderen, realen Dasein in Stein, Farbe oder Ton, so daß dadurch der Inhalt und die künstlerische Auffassungsweise der bisher betrachteten Künste in gewisse Schranken eingehegt wird.“
19 Vgl. Hegel, G.W.F.: Ästhetik. Bd. I. S. 123.
20 Vgl. Hegel, G.W.F.: Ästhetik. Bd. II. S. 211.: „Der Geist hat sich aus der Äußerlichkeit der Erscheinungen in sich zurückgezogen [...].“
21 Vgl. Hegel, G.W.F.: Ästhetik. Bd. III. S. 229: „Bei dieser Zurückziehung des geistigen Inhalts aus dem sinnlichen Material fragt es sich nun sogleich, was denn jetzt in der Poesie, wenn es nicht der Ton sein soll, die eigentliche Äußerlichkeit und Objektivität ausmachen werde. [...] Die Sache, der Inhalt soll zwar auch in der Poesie zur Gegenständlichkeit für den Geist gelangen; die Objektivität jedoch vertauscht ihre bisherige Realität mit der inneren und erhält ein Dasein nur im Bewußtsein selbst, als etwas bloß geistig Vorgestelltes und Angeschautes. Der Geist wird so auf seinem eigenen Boden sich gegenständlich und hat das sprachliche Element nur als Mittel, teils der Mitteilung, teils der unmittelbaren Äußerlichkeit, aus welcher er als aus einem bloßen Zeichen von Hause aus in sich zurückgegangen ist.“ Vgl. hierzu ferner: ebd. S. 474: „Denn den sonstigen sinnlichen Stoffen, dem Stein, Holz, der Farbe, dem Ton gegenüber, ist die Rede allein das der Exposition des Geistes würdigste Element [...].“
22 Hegel, G.W.F.: Ästhetik. Bd. I. S. 21.
23 Hegel, G.W.F.: Ästhetik. Bd. I. S. 123: „Die Dichtkunst ist die allgemeine Kunst des in sich freigewordenen, nicht in das äußerlich sinnliche Material zur Realisation gebundenen Geistes, der nur im inneren Raume und der inneren Zeit der Vorstellungen und Empfindungen sich ergeht. Doch gerade auf dieser höchsten Stufe steigt nun die Kunst auch über sich selbst hinaus, indem sie das Element versöhnter Versinnlichung des Geistes verläßt und aus der Poesie der Vorstellung in die Prosa des Denkens hinübertritt.“
24 Vgl. Hegel, G.W.F.: Ästhetik. Bd. III. S. 272.: „Denn wie sehr in den anderen Künsten auch das Innere aus seiner leiblichen Form herausscheinen muß und wirklich herausscheint, so ist doch das Wort das verständlichste und dem Geiste gemäßeste Mitteilungsmittel, das alles zu fassen und kundzutun vermag, was sich irgend durch die Höhen und Tiefen des Bewußtseins hindurchbewegt und innerlich präsent wird.“
25 Vgl. Hegel, G.W.F.: Ästhetik. Bd. II. S. 155.
26 Vgl. Hegel, G.W.F.: Ästhetik. Bd. I. S. 103.
27 Gethmann-Siefert, Annemarie: Einführung in die Ästhetik. München: Fink, 1995, S. 12.
28 Vgl. Hegel, G.W.F.: Ästhetik. Bd. I. S. 35.
29 Anmerkung: Schon Schleiermacher bezweifelte die Authentizität dieses Dialoges, und er gehört zu jenen, die man nur mit großem Vorbehalt der Autorschaft Platons zuordnet. Dennoch wird dieser Dialog an dieser Stelle erwähnt, weil er, bezogen auf die Idee des Schönen, eine zentrale Fragestellung Platons exemplarisch herausstellt und sie verdeutlicht.
30 Vgl. Platon. Sämtliche Werke. Berliner Ausgabe. Hrsg. von Erich Loewenthal. Heidelberg: Lambert Schneider 2001. Der Einfachheit halber unter Angabe des jeweiligen Bandes und Dialoges nachfolgend zitiert als »Platon: SW«. Hier Bd. I: »Hippias maior«. 287B – 287E [S. 628]: „Und doch […] merke […] auf: denn er fragt nicht, was schön ist, sondern was das Schöne ist.“
31 Vgl. Platon: SW. Hier Bd. II: Politeia. VI. 493E – 494C [S. 221].
32 Vgl. Platon: SW. Hier Bd. II: Politeia. VI. 510D – 511D [S. 247].
33 Platon: SW. Hier Bd. I: »Symposion«. 211C – 212B [S. 711].
34 Vgl. Platon: SW. Hier Bd. I: »Hippias maior«. 292C – 293A [S. 636]: „‚Wieso?’ wird er sagen, ‚bist du nicht imstande dich zu erinnern, daß ich nach dem Schönen an sich fragte, das allem, mit dem es sich verbindet, die Eigenschaft verleiht, schön zu sein, sowohl dem Stein und Holz, als dem Menschen und dem Gott, wie auch jeder Handlung und Kenntnis? Denn nach der Schönheit an sich [...] frage ich dich [...], was sie sei [...].’“
35 Vgl. Platon: SW. Hier Bd. II: Politeia. VI. 506E – 507C [S. 241]: „Ich will zuvor nur, sprach ich, ein paar Worte vorausschicken und euch die Gedanken ins Gedächtnis zurückrufen, die vorhin schon und schon anderwärts oftmals ausgesprochen worden sind.
Welche denn? fragte er.
Daß es eine Vielheit von Schönem, sagte ich, eine Vielheit von Gutem und so überhaupt von jedem gebe, räumen wir ein und bezeichnen es auch näher sprachlich.
Ja.
Auch bekanntlich ein Schönes an sich, ein Gutes an sich, und so überhaupt in bezug auf alles: was wir erst als eine individuelle Vielheit von jedem hinstellen, das stellen wir dann wiederum in einem einzigen begrifflichen Gedankenbild hin, als wenn die Vielheit eine Einheit wäre, und nennen es das Wesen von jedem.
Es ist so.
Und von jener Vielheit räumen wir ein, daß sie sichtbar und nicht denkbar, sowie andererseits von den Gedankenbildern, daß sie nur denkbar und nicht sichtbar sind.“
36 Vgl. Platon: SW. Hier Bd. II: »Parmenides«. 132A – 132C [S. 494]: „Und ferner die Idee wird eben dies sein, was so vom Gedanken als Eins erkannt wird, indem es immer dasselbe in allen jenen Dingen ist. Nicht wahr?
Das scheint wiederum notwendig.“
Vgl. hierzu ferner Platon: SW. Hier Bd. II: »Phaidros«. 249B – 250A [S. 440]: „Denn der Mensch muß sie [die Wahrheit] begreifen in der Form der Idee, wie man es ausdrückt, die, aus einer Vielheit sinnlicher Wahrnehmungen sich ergebend, durch logisches Denken zur Einheit zusammengefaßt wird.“
37 Vgl. hierzu auch Humboldt, W. von: Einleitung zum Kawi-Werk. Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluß auf die geistige Entwicklung des Menschengeschlechts. Hier zitiert nach Humboldt, W. v.: Schriften zur Sprache. Hrsg. v. M. Böhler. Reclam jun.: Stuttgart 1973. S. 46: Ähnlich wie beim abstrakten Denken, so ist der Sprachlaut „[...] dem Verstande bei der Auffassung der Gegenstände unentbehrlich. Sowohl die Dinge in der äußeren Natur, als die innerlich angeregte Tätigkeit dringen auf den Menschen mit einer Menge von Merkmalen zugleich ein. Er [der menschliche Verstand] aber strebt nach Vergleichung, Trennung und Verbindung und in seinen höheren Zwecken nach Bildung immer mehr umschließender Einheit. Er verlangt also auch, die Gegenstände in bestimmter Einheit aufzufassen [...].“ Aus dem Kapitel „Natur und Beschaffenheit der Sprache überhaupt“.
38 Vgl. Platon: SW. Hier Bd. II: »Parmenides«. 134E – 135C [S. 499]: „Aber dennoch, habe Parmenides fortgefahren, wenn man anderseits wiederum keine Ideen der Dinge zulassen will [...] und nicht für jede besondere Klasse der Dinge auch eine besondere Idee festsetzen will, so wird man keinen Gegenstand mehr haben, auf den man sein Nachdenken richten kann, indem man ja damit für eine jede Klasse der Dinge ihre gemeinsame, sich immer gleichbleibende Gestaltung aufhebt. Und so wird man denn auf diese Weise alles Vermögen zu wissenschaftlicher Untersuchung vollständig zerstören.“
39 Vgl. Brigitte Scheer: Einführung in die philosophische Ästhetik. Darmstadt: Primus Verlag 1997, S. 8.
40 Vgl. Platon: SW. Hier Bd. II: Politeia. VI. 509C – 510A [S. 245].
41 Vgl. Platon: SW. Hier Bd. II: »Parmenides«. 129D – 130B [S. 490]: „Hast du selbst jene Sonderung gemacht, die du eben aussprachst, indem du als ein Gesondertes jenes etwas hinstellst, was du an sich seiende Ideen nennst, und wiederum als ein Gesondertes die Dinge, welche an ihnen bloß Anteil haben, und scheint dir wirklich die Ähnlichkeit an sich etwas zu sein gesondert von derjenigen Ähnlichkeit, welche wir an uns tragen, und ebenso die Einheit und Vielheit und alles, was du sonst von Zenon hörtest?
Allerdings, habe Sokrates erwidert.“
42 Vgl. Platon: SW. Hier Bd. II: Politeia VI. 510D – 511B [S. 247].
43 Vgl. Platon: SW. Hier Bd. II: Politeia VII. 514A – 518A [S. 249 – 253].
44 Vgl. hierzu Historisches Wörterbuch der Philosophie. Hrsg. v. Joachim Ritter und Karlfried Gründer. Völlig neubearb. Ausg. d. »Wörterbuchs der philosophischen Begriffe« von Rudolf Eisler. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Hier Bd. 4, S. 55: „Der ausgeprägte philosophische Terminus »Idee« verbindet sich heute an erster Stelle und untrennbar mit dem Namen Platon. Eine philologisch genaue Überprüfung der platonische Originaltexte freilich bringt das Ergebnis, daß Platon einen ausgezeichneten Terminus idéa noch nicht kennt. Was wir heute mit »platonischer Idee« meinen, umschreibt Platon selbst mit einer Vielzahl von Vokabeln und Redewendungen. [...] Cicero dürfte in erster Linie verantwortlich sein für die endgültige Terminologisierung des Wortes »Idee« und seine Fixierung auf Platon und dessen Wirkungsgeschichte.“
45 Vgl. Hegel, G.W.F.: Werke. Auf der Grundlage der Werke von 1832 bis 1845 neu ed. Ausg. Red. E. Moldenhauer u. K. M. Michel. Hier Werke 18: Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie. Bd. 1. Frankfurt a. M.: Suhrkamp. S. 241: „Aristoteles schreibt den Ausdruck Teilnahme (methexis) dem Platon zu, der damit den pythagoreischen Ausdruck »Nachahmung« vertauscht habe. Nachahmung ist ein bildlicher, kindlicher, ungebildeter Ausdruck für das Verhältnis; Teilnahme ist allerdings schon bestimmter. Aber Aristoteles sagt mit Recht, daß beides ungenügend sei: Platon habe hier auch nicht weiter entwickelt, sondern nur einen anderen Namen substituiert; es sei ein leeres Gerede. Nachahmung und Teilnahme sind nichts weiter als andere Namen für Beziehung; Namen geben ist leicht, ein anderes aber ist das Begreifen. Vgl. hierzu auch: Aristoteles: Metaphysik. I. Buch (A), 991a [S. 45]: „Auch die Behauptung, es handle sich bei ihnen um Urbilder und die anderen Dinge hätten an ihnen Anteil, bedeutet nichts weiter als leeres Gerede und heißt nur dichterische Vergleiche vorbringen. Denn was ist das, das werkt und zu den Ideen blickt? Es ist doch möglich, daß etwas ähnlich ist oder wird, ohne diesem nachgebildet zu sein, so daß es, ob es nun einen Sokrates tatsächlich gibt oder nicht, doch einen Mann geben könnte wie Sokrates; und die Sache wäre offenbar dieselbe, wenn es einen ewigen Sokrates gäbe. Weiter müßte es mehrere Urbilder ein und desselben Dinges geben, also auch mehrere Formen, beispielsweise vom Menschen »das Lebewesen« und »das Zweifüßige« und zugleich »den Menschen an sich«. Ferner müßten dann die Formen nicht nur die Urbilder der Sinnesdinge sein, sondern auch ihrer selbst, wie etwa die Gattung als Gattung der Formen, so daß Urbild und Abbild dasselbe sein müßten.“
46 Vgl. Platon: SW. Hier Bd. II. »Parmenides«. 132C – 133A [S. 495].
47 Platon: SW. Hier Bd. II: Politeia X. 509C – 510A [S. 245].
48 Aristoteles: Metaphysik. I. Buch (A), 991a| 991b [S. 46].
49 Aristoteles: Metaphysik. I. Buch (A), 991a| 991b [S. 46].
50 Aristoteles: Metaphysik. VII. Buch (Z), 1040b| 1041a [S. 203].
51 Vgl. hierzu [Eisler: Philosophenlexikon, S. 1412. Digitale Bibliothek Band 3: Geschichte der Philosophie, S. 18344 (vgl. Eisler-Phil., S. 552)].
52 Vgl. Platon: SW. Hier Bd. I: »Hippias maior«. 297A – 297C [S. 643]: „Wenn also das Schöne das Ursächliche des Guten ist, so möchte wohl das Gute aus dem Schönen werden.“ Vgl. hierzu auch Platon: SW. Hier Bd. II: »Symposion«. 197A – 197D [S. 691]: „[...] seitdem dagegen dieser Gott [Eros] geboren war, da erwuchs aus der Liebe zum Schönen alles Gute für Götter und Menschen.“
53 Vgl. Gethmann-Siefert, Annemarie: Einführung in die Ästhetik. München: Fink 1995, S. 12.
54 Platon: SW. Hier Bd. II: »Phaidros«. 250A – 250E [S. 441].
55 Platon: SW. Hier Bd. I: »Der Sophist«. 254A – 254D [ S. 718].
56 Platon: SW. Hier Bd. II: »Phaidros«. 250A – 250E [S. 441].
57 Vgl. Platon: SW. Hier Bd. I »Symposion«. 210A – 212B [S. 709-711]: „Es muß nämlich [...] der, welcher auf dem richtigen Wege auf dies Ziel hinstrebt, in seiner Jugend sich allerdings den schönen Körpern zuwenden, und zwar zuerst, wenn sein Führer ihn richtig leitet, einen solchen schönen Körper lieben und an diesem sich fruchtbar in schönen Reden erweisen; dann aber muß er innewerden, daß die Schönheit an jedem einzelnen Körper der an jedem anderen Körper verschwistert ist; und wenn er doch überhaupt der Schönheit der Gestalt nachgehen soll, so wäre es ja großer Unverstand, wenn er nicht endlich die Schönheit an allen Körpern für eine und dieselbe erkennen würde. Wenn er aber zu dieser Einsicht gelangt ist, dann muß er sich als Liebhaber aller schönen Körper darstellen und von seiner gewaltigen Glut für einen einzigen nachlassen, vielmehr sie gering schätzen und verachten. Hiernach aber muß er die geistige Schönheit für weit schätzbarer achten lernen als die des Körpers, so daß, wenn jemand nur eine liebenswürdige Seele besitzt, mag auch dabei sein körperlicher Reiz nur gering sein, dies ihm genügt und er sie liebt und ihrer pflegt und Reden gebiert und aufzufinden sucht, so wie sie geeignet sind, veredelnd auf Jünglinge zu wirken. Diese Stufe führt ihn aber wiederum nur dazu, daß er gezwungen wird, das Schöne in den Bestrebungen, Sitten und Gesetzen zu beachten, und einzusehen, daß dies alles mit einander verwandt ist, und so das körperliche Schöne für ganz geringfügig achten zu lernen. Von den Bestrebungen aber muß man ihn zu den Wissenschaften führen, damit er wiederum die Schönheit der Wissenschaften erkenne [...]. [...] bis er [...] alles in eine einzige Erkenntnis [...] zusammenfaßt, die auf ein Schönes gerichtet ist, wie ich es jetzt dir beschreiben will. [...] Auf diesem Höhepunkt des Lebens [...], auf welchem er das Ansichschöne betrachtet, hat das Leben des Menschen, wenn irgendwo, einen wahrhaften Wert.“
58 Vgl. Brigitte Scheer: Einführung in die philosophische Ästhetik. Darmstadt: Primus Verlag 1997, S. 9: „Die ontologisch-metaphysisch orientierte Suche nach dem Schönen selbst muß [...] auf dem selbständigen Sein des Schönen bestehen, wenn dieses Schöne überhaupt etwas und nicht bloße Täuschung sein soll. Daß das Wesen des Schönen womöglich in einer Verschränkung von Sein und Schein liegen könnte, derart, daß es zum Sein des Schönen gehörte, sich als Schein zu zeigen, muß dem platonischen Sokrates etwas vollkommen Undenkbares bleiben.“
59 Platon: SW. Hier Bd. II: Politeia X. 602A – 602C [S. 378].
60 Vgl. Platon: SW. Hier Bd. II: Politeia X. 597E – 598B [S. 371]: „Ein Stuhl z.B., wenn du ihn von der Seite oder von vorn oder wie immer ansiehst, hat er da nicht jedesmal eine von der vorigen verschiedene Gestalt, oder ist eigentlich kein Unterschied vorhanden, sondern nur der Schein einer Verschiedenheit, und so hinsichtlich aller Dinge überhaupt? Ich meine letzteres, sagte er: es ist nur ein Schein von Unterschied vorhanden, aber kein eigentlicher. Diesen Punkt nun halte fest im Auge! Für welchen der beiden Zwecke hinsichtlich jeden Dinges ist die Malerei vorhanden: für das Nachahmen des Wesenhaften, wie es wirklich ist, oder für das des Seienden, wie es sich dem Scheine gibt, d.h. ist sie eine Nachahmung von Schein oder von wesenhafter Wahrheit? Vom Scheine, antwortete er. Weit also von der wesenhaften Wahrheit ist offenbar die Nachahmung entfernt; deswegen macht sie auch alles mögliche nach, weil sie sich nur mit dem Oberflächlichsten [dem Schein] eines jeden Dinges befaßt, und dazu noch mit einem Schattenbilde davon. So wird der Maler in unserem Beispiele einen Schuhmachermeister, einen Zimmermeister und überhaupt alle übrigen Meister malen, ohne das geringste von allen diesen Handwerken zu verstehen, dessenungeachtet aber wird er, wenn er ein guter Maler ist, dadurch das Bild eines Zimmermanns und durch die Hinstellung desselben aus der Ferne Kinder sowie unvernünftige Menschen zur Verblendung führen, als wäre es ein Zimmermann, wie er leibt und lebt. Ohne Zweifel. Aber, mein Freund, dies gilt, denke ich, nicht von dem Maler allein [...].“
61 Platon: SW. Hier Bd. II: Politeia X. 602C – 603A [S. 379]: „Das ohne den Maßstab logischer Prüfung Vorstellungen gewinnende Seelenvermögen ist also nicht identisch mit dem, das mit dem logischen Maßstabe solche Vorstellungen gewinnt.“
- Arbeit zitieren
- Malte Oetjen (Autor:in), 2003, Das Ende der Kunst bei Hegel, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/30768
Kostenlos Autor werden











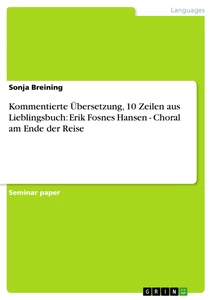
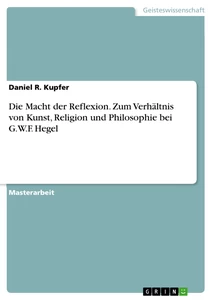
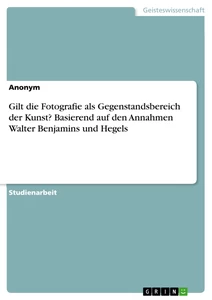



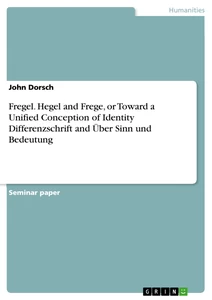




Kommentare