Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Anmerkungen zur Terminologie
1. Einleitung
1.1 Fragestellung
1.2 Zielsetzung
1.3 Methodische Herangehensweise
2. Das Künstlersubjekt zwischen Celebrity-Kultur und Postmoderne
2.1 Das Subjekt und die „Selbsttechnologien“
2.2 Das Diktum vom Tod des Autors
2.3 Der Diskurs um das Künstlersubjekt
2.3.1 Der „Celebrity-Artist“
2.3.2 Das weibliche Künstlersubjekt
2.4 Die Bedeutung des Neuen im Kunstsystem
3. Konstruktion des Selbst in der künstlerischen Arbeit Tracey Emins
3.1 Bildtheoretische Analyse der Arbeit „Everyone I have ever slept with 1963-1995“
3.2 Kontextualisierung: britische Kunst in den 1990er Jahren
3.3 Biografie als Gegenstand der künstlerischen Arbeit
3.3.1 Biografischer Hintergrund
3.3.2 Künstlerische Arbeit zwischen Biografie, Rollenmustern und Vorbildern
3.4 Medien als Raum der Inszenierung und Selbstbefragung
3.4.1 Mediale Inszenierung der Biografie
3.4.2 Öffentliche Inszenierung als integraler Bestandteil der künstlerischen Arbeit
3.5 Emin und Andy Warhol als Celebrities - ein Vergleich
4. Tracey Emin als Objekt der Medien
4.1 Die Erzeugung öffentlicher Aufmerksamkeit
4.2 Inhaltliche Dimension der Berichterstattung
4.2.1 Exemplarische Rezeptionsanalyse von „Everyone I have ever slept with 1963-1995“
4.2.2 Emin als Objekt der Kunstkritik und Lifestyle-Presse
4.3 Emin als Celebrity?
5. Fazit und Ausblick: Kunst als Selbstbefragung?
Literaturverzeichnis
Abbildungen
Anmerkungen zur Terminologie
Mit „Kunst“ ist, wenn nicht explizit anders ausgewiesen, der Sonderfall der bildenden Künste gemeint. Wenn dieser Terminus als Kollektivsingular zwar die Gefahr in sich birgt, nicht der Vielfalt künstlerischer Praktiken Ausdruck zu verleihen, soll sich dieses trotzdem im Sinne einer theoretischen Abstraktion bedient werden, weil er für die Klärung thematisierter Zusammenhänge notwendig scheint.
Wenn von „der Künstler“ die Rede ist, ist immer auch die weibliche Form gemeint. Dass diese nicht explizit genannt wird, folgt allein praktischen Erwägungen.
„Kunstsystem“ soll hier synonym zu dem Begriff „Kunstfeld“, wobei dessen Grenzen schwer auszumachen sind, sowohl kunstschaffenden Akteure als auch Akteure des Kunstmarktes von Teilnehmern am kunstwissenschaftlichen Diskurs über Kunstkritiker, Händler usw. bezeichnen.
1. Einleitung
1.1 Fragestellung
„I mean fuck, who wants to be the same as anyone else? Er, to be an individual, to fight for your own fucking individuality in this world is a really difficult thing to do“ (Emin 1999: 38). Die Künstlerin Tracey Emin befasst sich mit sich selbst. In Interviews, in ihrer Kunst - alles scheint um sie zu kreisen. Dabei wirkt, was sie von sich gibt, wenn nicht ordinär, dann doch sehr unmittelbar. Die Qualität ihrer Arbeiten wird häufig als „direkt“ und ungeschliffen umschrieben - zum Beispiel die der Arbeit „My Bed“, die aus einem ungemachten Bett besteht, das von Tampons, Kondomen, Kippen, leeren Alkoholflaschen und allerlei anderen Utensilien, die von dem desolaten Zustand der Besitzerin erzählen, umgeben ist. In ihrem Werk sowie in der Öffentlichkeit exponiert Emin ohne Rücksicht auf eigene Schamgrenzen intime Details und psychische Leiden. Ihrer Medienpräsenz, die sich über die Kunstfachpresse hinaus bis hin zu Zeitungen und Lifestyle-Magazinen erstreckt, hat sie zu einer der bekanntesten britischen Künstlerinnen gemacht. Eine breite Medienöffentlichkeit erfährt vom Weglaufen ihrer Katze, sieht sie in aufreizender Pose im Spitzen-BH und als Model für Vievienne Westwood, liest über ihre Abtreibungen, Selbstmordversuche, Alkoholexzesse. In ihren Installationen, Näharbeiten, Videos, Drucken und Zeichnungen rekonstruiert sie ihre Lebensgeschichte, gibt scheinbar alles von sich preis und macht sich so zur Zielscheibe der Kritik: Emin greife mit bohemienhafter Attitüde stereotype Rollenmuster auf, übe eine Praxis der Markt- und Machtstrategie aus, es mangele ihr an Reflexionsfähigkeit und Intellektualität und ihre ständige Selbstthematisierung sei Ausdruck ihres Egozentrismus.1 Warum auch, so könnte man fragen, sollte man den Seelenbekenntnisse einer Künstlerin mehr Aufmerksamkeit als denen einer Amy Winehouse schenken?
Es gibt Kritiker, die sich dafür aussprechen, Emin nicht auf die Figur eines „Celebrities“ zu reduzieren. Sie sehen die Qualität ihrer künstlerischen Arbeit - so der Tenor der Kritik - in der Unmittelbarkeit und Direktheit, in der sie sich mit den Betrachtern verbinde.2 Gerade durch die Thematisierung von Alltäglichem seien Emins Reflexionen über ihre eigene Person hinaus von Belang.
Zwei Positionen, die jeweils ein unterschiedliches Bild von Emin zeichnen, werden besonders laut:
- Zum einen entwirft die Kritik sie als kalkulierte Strategin, die alles von sich preisgibt nicht aus inhaltlichen Erwägungen, sondern weil sie auf die Erzeugung von Öffentlichkeit und kommerziellen Erfolg zielt. Sie greife bewusst auf eine tradierte Vorstellung vom Künstlersubjekt als „Modell eines besseren, authentischeren Lebens“ (Gamm 2006: 49) zurück, weil diese sich geschickt vermarkten lasse.
- Die gegenteilige Position innerhalb der Kritik wertet Emins Arbeit als gerade nicht kalkuliert und reflektiert. Innerhalb dieser Position loben manche Kritiker die „Unmittelbarkeit“ und „Wahrhaftigkeit“3 ihrer Arbeiten, während andere Emin ein
Anknüpfen an die Vorstellung vom Künstler als originärem Schöpfer vorwerfen, worin sich ihre vereinfachte und nicht mehr tragfähige Vorstellung vom Künstlertum entlarve. Aufgrund der spontanen und unmittelbaren Wirkungsqualität der Arbeiten argumentieren sie, dass Emin für diese in Anspruch nehme, sie seien aus einem originalen künstlerischen Empfinden heraus entstanden - und das in einer Zeit, in der von dem „Anspruch auf Ursprünglichkeit [...] nur noch eine Rhetorik übrig geblieben“ (Schmidt-Wulffen 1993: 343) sei. Schmidt-Wulffen soll hier nur stellvertretend genannt werden für die im kunstwissenschaftlichen Diskurs prominente Annahme, dass sich der Künstler nicht mehr glaubwürdig als besonders authentisches Kreativsubjekt positionieren könne. Die Künstlichkeit des „Mythos des Ursprünglichen“ sei längst entdeckt worden (ebenda); das postmoderne, dekonstruktivistische Denken entwirft das Subjekt als abhängiges - die Vorstellung von Authentizität und Ursprünglichkeit jenseits gesellschaftlicher Zusammenhänge wird hinfällig. So bemüht die Kritik, wenn auch Uneinigkeit über die Komplexität der Arbeit und zugrundeliegende Strategien besteht, im Zusammenhang mit Emin den Diskurs um Authentizität, als wäre es die „wahrhaftige“ und unverstellte Emin, die Gegenstand der Arbeiten sei.
Auch aus dem kunstwissenschaftlichen Diskurs gehen wenige Erkenntnisse über mögliche Gründe der breiten Rezeption Emins hervor: „[B]ecause of her notoriety, she has attracted more press gossip than serious critical analysis“ (Leighton/Groom 2008: 7).4 Dieser Befund soll zum einen Anlass sein, Emins Arbeit einer solchen kritischen Analyse zu unterziehen, zum anderen soll er in dem Sinne zum Inhalt der Arbeit gemacht werden, als er die Vorwürfe der Kritik zu untermauern scheint, dass Emins kommerzieller Erfolg schlicht in dem Bedienen des voyeuristischen Interesses einer breiten Medienöffentlichkeit begründet ist.
Wenn man den Diskurs um Authentizität verlässt und die Arbeiten als konstruiert und inszeniert begreift, kann man den Blick für eine neue Lesart der Arbeiten öffnen. Diese Arbeit möchte sich einer solchen zuwenden und richtet den Blick besonders darauf, mit welchem Konzept vom Subjekt operiert wird: Lässt sich Emins Arbeit auch als eine Befragung des Selbst und als Subjektivierungspraxis im Foucaultschen Sinne5 begreifen? Und lassen sich daraus der kommerzielle Erfolg und die Medienwirksamkeit erklären oder sind sie darin zu suchen, dass sie nur mythische Topoi vom Künstler weiterschreibt und sich damit zum „Celebrity“6 stilisiert?
Die Arbeit schlägt eine Lesart von Emins Arbeiten als konstruierte und als Befragung des Selbst und des eigenen Subjektstatus vor, die darin vermutet wird, dass Emin sich in einer ambivalenten, nicht eindeutigen, sondern mitunter widersprüchlichen Weise weibliche Rollenmuster und Klischees vom Künstlertum zu eigen macht. Das Subjekt wird als ein zerbrechliches, unzulängliches gezeichnet und die künstlerische Arbeit scheint sich als ein Ort der Auseinandersetzung mit Fragen der eigenen Identität und der Versicherung seiner selbst zu erweisen. Die Vermutung, dass Emin über das künstlerische Feld hinaus auch den medialen Raum als Ort der Inszenierung und Selbstbefragung nutzt - und sich somit die künstlerische Arbeit und öffentliche Inszenierung nur schwerlich trennen lassen -, soll überprüft werden.
Ihr kommerzieller Erfolg wird in der Ähnlichkeit ihrer medialen Inszenierung zu der des Celebrities vermutet. Eine Einschätzung dessen, inwieweit diese Parallele Ergebnis strategischer Überlegungen und persönlichen Geltungsdranges sein könnte, kann nicht geübt werden, weil im Rahmen dieser Arbeit nicht die Suche nach einer transzendentalen Größe und der „authentischen Emin“ geleistet werden soll, sondern die nach einer schlüssigen Lesart ihrer Arbeit.7
1.2 Zielsetzung
Die Arbeit zielt darauf, Emins Werk und dessen Verortung vor dem Hintergrund des Diskurses um das Künstlersubjekt einer kritischen Analyse zu unterziehen und die von der Kunstkritik vorgenommenen Positionierungen Emins gegebenenfalls zu revidieren. Dabei muss neben der künstlerischen Arbeit auch der mediale Raum in das Blickfeld rücken, weil das Phänomen Emin nicht ohne die mediale Inszenierung und öffentliche Aufmerksamkeit zu erfassen zu sein scheint.
Zudem hofft die Arbeit darauf, Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie sich Künstlersubjekte heute in dem Gefüge von kunstwissenschaftlichem Diskurs und medialer Rezeption konstituieren. Die Arbeit kann nicht den Anspruch auf eine erschöpfende Analyse dieser Mechanismen erheben, weil die Komplexität und das Ineinandergreifen verschiedener Faktoren eine solche im Rahmen einer hermeneutisch- theoretischen Analyse nicht erlaubt. Auch Emins Werk kann keiner umfassenden Analyse auf inhaltliche Aspekte unterzogen werden; die Fragestellung und Überprüfung der vorgeschlagenen Lesart verlangen eher danach, folgende Fragen in den Blick zu nehmen: Wie entwirft sich Emin in ihren Arbeiten? Wie inszeniert sie sich medial? Und wie entwerfen die Medien sie?
Diese exemplarische Analyse der Arbeit Emins erhofft sich zudem, Schlussfolgerungen über das Künstlertum heute zwischen tradierten Rollen vom Künstler als Kreativsubjekt oder Schöpfer und neuen Autorenrollen ziehen zu können. Emin ist prädestiniert für eine solche Analye, scheint sie doch das „authentische Künstlersubjekt“ par excellence zu sein und das Genre der Selbstdarstellung auf die Spitze zu treiben. Deshalb ist diese Analyse in zweifacher Hinsicht relevant: Zum einen hält Emins Arbeit, wenn man sich dieser aus einem neuen Blickwinkel zuwendet, vielleicht mehr bereit als einen reinen Unterhaltungswert, zum anderen sind Fragen nach den Möglichkeiten einer Kunst als Selbstdarstellung und -werdung nach der postmodernen Dekonstruktion des Subjekts für die künstlerische Praxis von Interesse.
1.3 Methodische Herangehensweise
Eine hermeneutische, beobachtende Quellenanalyse soll erlauben, Aufschluss über Emins Arbeit und das öffentliche Interesse an ihr zu gewinnen. Der analytische Teil folgt theoretischen Betrachtungen:
Ein erster Teil soll ein Verständnis für heutige Positionen im Diskurs um das Künstlersubjekt herstellen, die auch die Kritik an Emin verständlich machen. Michel Foucaults und Judith Butlers Subjektbegriffe, die das Subjekt nicht als ein historisch konstantes, sondern als ein veränderbares, von Machtverhältnissen abhängiges verstehen, werden vorgestellt. Die Foucaultschen Begriffe der „Subjektivierungspraxis“ oder der „Selbsttechnologien“ sollen erklärt werden, weil sie später als Verstehensmodell für Emins Arbeit vorgeschlagen werden. In einem zweiten Schritt werden einige - hier relevante - kultur- und kunsttheoretische Positionen im Diskurs um das Künstlersubjekt dargestellt. Josef Früchtl leitet historisch her, warum die Idee des Künstlers als „exemplarischer Statthalter moderne[r] Subjektivität“ (Früchtl 2006: ) brüchig geworden ist und Gerhard Gamm schildert aus philosophischer Perspektive, warum die Kunst vermehrt ihre medialen Voraussetzungen befragt. Das Phänomen des „Celebrity Artist“ (Graw 2008) und der Diskurs um das „weibliche Künstlersubjekt“ werden thematisiert, weil sie für das Verständnis von Emins Arbeit und Rezeption unerlässlich scheinen. Niklas Luhmann und Boris Groys liefern Gründe dafür, dass das Neue noch immer entscheidender Richtwert im Kunstfeld ist, trotzdem das Neue und die Kreativität radikal infragegestellt wurde.
Der darauffolgende Abschnitt soll sich mit der künstlerischen Arbeit Emins auseinandersetzen und überprüfen, welche Parallelen zwischen der Arbeit und der Inszenierung ihrer Selbst in den Medien bestehen. Dabei sollen die 1990er Jahre den Rahmen der Untersuchung bilden. Wesentlich soll eine exemplarische Analyse der Arbeit „Everyone I have ever slept with 1963-1995“, die sich Techniken der Bildtheorie bedient, eine mögliche Lesart von Emins Arbeit aufzeigen. Biografischer Hintergrund und die spezifische Situation der britischen Kunst in den 1990er Jahren werden skizziert, um eine Kontextualisierung Emins selbst als auch der Kritik vorzunehmen. Es wird herauszustellen versucht, in welcher Weise Biografie zum Gegenstand der Arbeit gemacht wird. Die mediale Inszenierung wird untersucht, um zu überprüfen, inwieweit sich Muster in der Arbeit mit denen in der öffentlichen Inszenierung decken.
Andy Warhols Entwurf seiner selbst in seiner Arbeit und dem öffentlichem Raum wird für eine vergleichende Analyse herangezogen, weil auch er sein Privatleben medial inszeniert hat. Sicherlich werden sich Differenzen auftun, die die Spezifik von Emins Arbeit verdeutlichen.
Im nächsten Teil wird untersucht, wie die Medien Emin entwerfen, wofür eine Analyse von Presseartikeln notwendig ist. Es soll überprüft werden, wie sich die Kunstkritik im Gefüge verschiedener Akteure, zum Beispiel Sammlern und Mäzenen, verhält. Die getrennte Behandlung der künstlerischen und medialen Konstruktion des Selbst ist zwar insofern schwierig, als beides ineinandergreift und voneinander abhängig ist, muss aber aus praktischen Erwägungen erfolgen. Um zu verstehen, weshalb kunstkritische Texte die angesprochenen Rollenzuweisungen vornehmen, soll ein Blick darauf geworfen werden, in welchem Kontext Emin rezipiert wird, wofür wiederum skizziert werden muss, wie Emin zu Bekannheit gelang. Diese Mechanismen zu verstehen ist eine Motivation dieser Arbeit, kann aber nicht den Anspruch von Vollständigkeit haben.
2. Das Künstlersubjekt zwischen Celebrity-Kultur und Postmoderne
„Vom Anspruch auf Ursprünglichkeit ist in den Augen jüngerer Künstler und Theoretiker nur noch die Rhetorik übrig geblieben, die sich gegen das zeitgemäße Denken sperrt“ (Schmidt-Wulffen 1993: 343). Schmidt-Wulffen setzt sich entschieden dagegen zur Wehr, Unmittelbarkeit weiterhin als Kriterium für die Unterscheidung von Kunst und Nicht-Kunst heranzuziehen. Er spricht damit Tendenzen in der künstlerischen Praxis sowie Positionen im kunsttheoretischen Diskurs an, die fordern, dass Künstler nicht länger in Anspruch nehmen, ihre künstlerische Arbeit resultiere aus einem „ursprünglichen“ Empfinden jenseits gesellschaftlicher Zusammenhänge. In Diskurs und künstlerischer Praxis macht sich ein „Misstrauen gegenüber dem Status des Subjekts als transzendentalem Grund des Schöpferischen“ (Berg 2009: 214) breit - der Künstler könne sich nicht weiter als „Verkörperung eines ,höheren‘ Wissens“ (Schmidt- Wulffen 1993: 345) begreifen. Viele Künstler beziehen sich demnach in der künstlerischen Arbeit auf die eigene „Autorenschaft“8 und den eigenen Subjektstatus.
Um dieses Spannungsfeld klarer zu umreißen und das Verständnis für die verschiedenen Positionen in der heutigen künstlerischen Praxis und Kunstkritik zu schärfen, soll der Diskurs um das Künstlersubjekt als originärer Schöpfer umrissen werden. Dazu werden die Subjektbegriffe Butlers und Foucaults als Verstehensgrundlage für die dekonstruktivistische, im Diskurs um das Subjekt verbreitete, Kritik an der Vorstellung eines Subjekts, das eine abgeschlossene Entität bildet, vorgestellt. Von dekonstruktivistischer Seite wird angenommen, dass das Subjekt von Normen abhängig ist, ihm wird aber auch Handlungsspielraum beigemessen. Bei Foucault geschieht das in Form der „Technologien des Selbst“9, einer bestimmten, identitätsstiftenden Praxis der Auseinandersetzung mit dem Selbst. Diese soll skizziert werden, weil die künstlerische Arbeit als eine solche Praxis der Selbstversicherung denkbar zu sein scheint. Dieses veränderte Verständnis vom Subjekt und der „Subjektwerdung“ macht auch die Idee vom Künstler als Schöpfer und Kreativsubjekt brüchig, die lange Zeit vorherrschte, und die Autorenschaft fragwürdig.
2.1 Das Subjekt und die „Selbsttechnologien“
Das „Subjekt“ ist Forschungsgegenstand vieler Disziplinen und hat als solcher eine lange Tradition, die hier nicht nachvollzogen werden kann. Im Diskurs um das Subjekt setzen sich Positionen durch, die nicht mehr von einem dem Subjekt immanenten Wesen, sondern von einer Subjektwerdung ausgehen: Identität wird als ständig changierendes Resultat von Inszenierungsstrategien und Selbst-Erfindungen begriffen (Becker 2000: 18). In den Subjekttheorien Michel Foucaults und Judith Butlers wird vor allem diese Konstitution des Subjekts - die Subjektivierung - ins Auge gefasst, die hier von besonderem Interesse ist.
Foucaults Subjektbegriff ist von der Abwendung von einem historisch konstanten Subjekt und von dem cartesianischen Grundpostulat des Schöpfersubjekts bestimmt.10 Wendete er sich in seinem frühen Werk gegen das Subjekt an sich, weil er als ein abhängiges entwarf, konzipiert er im Zusammenhang mit seiner „Ethik des Selbst“ das Subjekt als eines, das mithilfe von „Selbsttechnologien“ (Foucault 1989: 18) auf sich und andere einzuwirken vermag. Foucault bezweifelt also nicht die Existenz des Subjekts, sondern dessen autonomen Willen. Die Herleitung der Foucaultschen Begriffe der „Subjektivierungspraxis“ und der „Technologien des Selbst“ bedarf der Darstellung seines den Machtverhältnissen unterworfenen Subjekts:
Foucaults Ablehnung des Glaubens an eine endgültige Form des Menschen und somit an ein transzendentales Subjekt liegt darin begründet, dass er historisch veränderbare Wissens- und Machtssysteme als dem Menschen vorgängig begreift (Foucault 2005: 888). Er erkennt dem Subjekt seine Urheberfunktion bei der Konstitution gesellschaftlicher Ordnung ab und macht es zu deren Wirkung. Foucaults Anliegen ist es demnach, nicht nach einem Wesen des Menschen, sondern nach dem Prozess der Subjektwerdung zu fragen. Das geschieht, indem er die „Formen der Subjektivierung des Menschen in unserer Kultur“ (Foucault 2005: 269) und die „vielfältige[n] Unterwerfungen, die innerhalb eines Gesellschaftskörpers stattfinden und funktionieren“ (Foucault 2003: 235) historisch rekonstruiert. Er untersucht die Beziehung des Subjekts zur Wahrheit, Macht und Moral (Foucault 2005: 759). Wissen und Macht ergäben einen Komplex, dessen Effekte „das erkennende Subjekt, das zu erkennende Objekt und die Erkenntnisweisen“ (Foucault 2006: 198) bilden. Das Subjekt ist also, so Butler über Foucault, dadurch bestimmt, dass ein „Wahrheitsregime [...] von Anfang an entscheidet, was eine anerkennbare Form des Seins ist und was nicht“ (Butler 2003: 31).11
Das Individuum wird durch Subjektivierungsweisen, die Produkt diskursiver und nicht- diskursiver, trotzdem Machtverhältnissen unterworfener, Praktiken sind, zum Subjekt. Als eine unter vielen Subjektivierungsweisen nennt Foucault die „Technologien des Selbst“, mit denen er dem Subjekt autonome Selbstbestimmung einräumt, wobei diese keine Loslösung von Strukturzwängen impliziert. Die „Technologien des Selbst“ seien es, „die es dem Einzelnen ermöglichen, aus eigener Kraft oder mit Hilfe anderer eine Reihe von Operationen an seinem Körper oder seiner Seele, seinem Denken, seinem Verhalten und seiner Existenzweise vorzunehmen, mit dem Ziel, sich so zu verändern, dass er einen gewissen Zustand des Glücks, der Reinheit, der Weisheit, der Vollkommenheit oder der Unsterblichkeit erlangt“ (Foucault 1993: 26).
Wie andere Subjektivierungsweisen ändern sich die Selbsttechnologien, in dessen Zentrum die Selbsterkenntnis und Versicherung über die eigene Souveränität steht, in geschichtlicher Dimension: Sie sind kulturell vorgegebene Schemata (Foucault 2005: 889). Er vollzieht in „Hermeneutik des Selbst“ abendländische „Technologien des Selbst“ nach und umfasst den Begriff in diesem Zusammenhang etwas klarer:
Darunter sind gewusste und gewollte Praktiken zu verstehen, mit denen sich die Menschen nicht nur die Regeln ihres Verhaltens festlegen, sondern sich selber zu transformieren, sich in ihrem besonderen Sein zu modifizieren und aus ihrem Leben ein Werk zu machen suchen, das gewisse ästhetische Werte trägt und gewissen Stilkriterien entspricht (Foucault 1989: 18f).
Nur über bestimmte Selbstpraktiken kann sich das Subjekt also selbst erkennen und sich als bewusstes und bewusst handelndes erkennen (Foucault 2004: 544). In „Schrift des Selbst“ geht Foucault auf antike Schreibpraktiken ein, die als Selbsttechnologien bzw. -praktiken fungieren (Foucault: 1983). Er nennt als eine Selbsttechnologie das Verfassen von Notizbüchern als Sammlung für Aussagen, denen vom Schreibenden Bedeutung beigemessen wird. Dabei gehe es nicht um Seelenforschung und nicht um eine Überwindung des Selbst, sondern „im Gegenteil darum, das schon Gesagte zu sammeln, das zusammenzufassen, was einer hören oder lesen konnte, und das zu keinem geringeren Zweck als der Selbstkonstitution“ (ebenda: 419). Das Schreiben stellt hier also ein positives Konzept der Selbstschöpfung dar. Foucault geht allerdings nicht explizit darauf ein, welche Subjektivierungsweisen das Subjekt der heutigen Zeit konstituieren und welche Selbsttechnologien vorherrschen; seine Ausführungen lassen aber einer Übertragung auf vorherrschende „Technologien des Selbst“ zu, die zum Beispiel die Kulturphilosophin und -soziologin Barbara Becker vornimmt. Sie nennt in einer Untersuchung der Konstruktion von virtuellen Identitäten als Selbsttechnologie eine Reihe von Ausprägungen, die der Exploration des Subjekt- Seins dienen: Sie reichten von Tagebüchern, Literatur, Briefen, der Beichte, Rollen- und Theaterspiel bis zur öffentlichen Rede (Becker 2000: 19).
„Wie sowohl Adorno als auch Foucault verdeutlichen, muss man nicht souverän sein, um moralisch zu handeln; vielmehr muss man seine Souveränität einbüßen, um menschlich zu werden“ (Butler 2003: 11). Die Philosophin und Philologin Judith Butler schließt in dem Sinne an Foucault an, als sie die Handlungsfreiheit des Subjekts, obwohl es nicht souverän ist, nicht infragestellt. Die Handlungsfreiheit sieht sie gerade darin begründet, dass „die Selbsterkenntnis nie vollständig sein kann [...], dass die Hinnahme der Begrenzungen, die das Menschliche definieren, Teil jeder Erklärung moralischer Verantwortlichkeit sein muss“ (ebenda).
Trotz dieser Übereinstimmung mit Foucault entwickelt Butler einen Subjektbegriff, der sich von seinem abgrenzt. Ihr Interesse ist zunächst auf geschlechtliche Subjektivierungsweisen gerichtet, davon ausgehend entwickelt sie aber eine Subjekttheorie. Das Hauptaugenmerk soll hier ihrem Entwurf des Subjekts und des Prozesses der „Subjektwerdung“ gelten.
Butlers Subjekttheorie, die zum einen politisch motiviert12 war und zum anderen einem philosophisch-theoretischen Erkenntnisinteresse folgte, bricht wie Foucault mit der modernen Vorstellung des autonomen Subjekts als ontologische Entität.13 Zunächst richtet sich ihr Augenmerk darauf, wie das Subjekt produziert wird, denn es existiere nicht an sich (Butler 1991: 20ff). So konstruiere etwa der Feminismus, den Butler als produktiven Diskurs14 begreift, sein Subjekt selbst und beteilige sich an dem Prozess der „Subjektivation“, der auch bei ihr einer der Unterwerfung unter bestehende Verhältnisse ist (Butler 2001: 8), allerdings wird nach Butler das Subjekt allein diskursiv erzeugt (ebenda: 83). Sie führt weiter aus, dass das Subjekt nie ein „abstraktes“ ist, sondern immer ein „konkretes Jemand“, zu dem es von a priori bestehenden Identitätskategorien, Bezeichnungen etc. gemacht wird (ebenda). Butler trifft eine Unterscheidung zwischen dem Begriff des „Subjekts“ und dem des „Individuums“:
Das Subjekt ist die sprachliche Gelegenheit des Individuums, Verständlichkeit zu gewinnen und zu reproduzieren, also die sprachliche Bedingung seiner Existenz und Handlungsfähigkeit. Kein Individuum wird Subjekt, ohne zuvor unterworfen/ subjektiviert zu werden oder einen Prozess der ,Subjektivation‘ [...] zu durchlaufen (Butler 2001: 15f).
In Anlehnung an Foucault wendet sich Butler im Rahmen ihrer „genealogischen Kritik“ (Butler 1991: 9) von der Suche nach ontologischen Wahrheiten von Kategorien wie der des Subjekts ab15 und befasst sich mit den Mechanismen der Produktion einer bestimmten Idee des Subjekts, die wiederum manifest werde (Butler 1993b: 130). Sich einer „antifundamentalistischen Methode“ (Butler 1991: 36) bedienend, die sich gegen Kategorisierungen und fixe Definitionen zur Wehr setzt, will Butler die Möglichkeiten dessen, was ein Subjekt ist, erweitern und merkt an, dass das Subjekt „niemals vollständig konstituiert [ist], sondern [...] immer wieder neu entworfen (subjected) und produziert“ (Butler 1993c:45) wird.16
Trotz dieser Dekonstruktion der Autonomie des Subjekts, das sich durch vor allem sprachliche Praktiken formiert, räumt sie diesem als „postsouveränem Subjekt“ Handlungsfähigkeit ein: „[A]n solchen Schnittpunkten, wo der Diskurs sich erneuert“ (Butler 1993b: 125) und in der Anerkennung der eigenen Abhängigkeit von diskursiven Strukturen entstünden für das Subjekt kritische Handlungsfähigkeit und somit Freiheitsgrade. Das Bewusstwerden der diskursiven Abhängigkeit der Begriffe eröffne insofern Freiräume, als diese in diskursiven Auseinandersetzungen diskutiert und neu gedeutet werden könnten (ebenda: 125ff).
Butler entwirft das Subjekt also als ein diskursiv abhängiges, das gerade im Erkennen dieser Abhängigkeit Handlungsfreiheit gewinnt. Um diskursiv hervorgebrachte Begriffe zu diskutieren, muss es zunächst anerkennen, dass diese keine transzendentale Größe, sondern gesellschaftlich erzeugt sind. Das Subjekt konstituiert seine Identität in der Aushandlung der Normen und kulturellen Muster, „weil das „Ich“ gar keine Geschichte von sich selbst, die nicht zugleich Geschichte seiner Beziehung - oder seiner Beziehungen - zu bestimmten Normen ist“ (Butler 2003: 20), hat.
Foucault weitet die Abhängigkeit des Subjekts auf nicht-diskursive Praktiken aus und räumt dem Subjekt durch die „Technologien des Selbst“, die der produktiven Selbsterkenntnis dienen, Handlungsspielraum ein. Kunst kann, wenn man Foucault als Verstehensmodell für die Subjektivierung heranzieht, eine identittätsstiftende Praktik sein, wenn sie sich der Auseinandersetzung mit dem Selbst verschreibt - also eine Praxis ist, die der Vermittlung des Selbst zu sich dient. Diese Auseinandersetzung muss sich nach Butler als eine mit den eigenen „gesellschaftlichen Entstehungs- bedingungen“ (ebenda) vollziehen.
2.2 Das Diktum vom Tod des Autors
Mit der Abkehr von dem bis in die 1960er Jahre vorherrschenden Subjektbegriff wird die Vorstellung eines aus sich selbst schöpfenden Subjekts hinfällig; auch die Zurechnung von einem Werk zu einem Autor wird damit fraglich. Ende der 1960er Jahren tritt eine Wende im Diskurs um die Autorenschaft ein, die auch den um das Künstlersubjekt nicht unberührt lässt. Roland Barthes und Michel Foucault relativieren in ihren Texten „Der Tod des Autors“ (Barthes 2000) bzw. „Was ist ein Autor?“ (Foucault 2000) die Rolle des Künstlers im Prozess der ästhetischen Sinngebung, woraufhin sich der Diskurs stark ausdifferenziert.17 Hier soll vor allem der Wirkungsverlauf der genannten Texte im Vordergrund stehen und ein kurzer Blick auf deren Einflussnahme auf die künstlerische Praxis geworfen werden.
Barthes „Der Tod des Autors“, 1967 erstmals veröffentlicht, bezog sich ursprünglich auf den literarischen Autor, lässt aber eine Übertragung auf die Figur des Künstlers zu. Mit der von Barthes proklamierten Unmöglichkeit des Ausdrucks eines „inneren Gefühls“ - der Schriftsteller könne „nichts als eine immer schon geschehene, niemals originelle Geste nachahmen“ (Barthes 2000: 190) - wird auch jede Authentizität und Originalität unmöglich. Barthes richtet sich insbesondere dagegen, dass „[d]ie Erklärung eines Werkes [...] stets bei seinem Urheber gesucht [wird]“ (Barthes 2000: 186). Vielmehr müsse, so die Schlussfolgerung des Textes, dem Leser die Rolle der sinnkonstituierenden Instanz zugeschrieben werden (Barthes 2000: 192-193). Das andere einflussreiche Plädoyer für die Verabschiedung des Autors, das 1969 Barthes Diktum des „Tod des Autors“ aufgreift18, stammt von Foucault, wenngleich sein Anliegen darin bestand, „den durch das Verschwinden oder Tod des Autors frei gewordenen Raum“ ausfindig zu machen und die „Autorfunktion“ zu konzeptualisieren (Foucault 2000: 199).19
In Hinblick auf die Wirkungsgeschichte der Texte bemerkt Giaco Schiesser, Professor für Medien- und Kulturtheorie, ihre wohl wirksamste Folge sei „die Verwendung der wiederkehrenden Formel vom Tode des Autors als Spielmarke, als Klischee oder Platzhalter für eine nicht wirklich geführte Diskussion“ (Schiesser 2008: 28), weil der Autor weitgehend der zentrale Referenzpunkt geblieben sei. Wenn auch nicht alle künstlerischen Auseinandersetzungen mit Autorenschaft auf die Texte zurückgeführt werden können, blieb das Diktum vom Tod des Autors nicht ohne Auswirkungen auf die künstlerische Praxis:
Es sei, so merkt Schiesser an, im Rahmen der künstlerischen Ausbildung häufig die Befähigung zur vielfältigen Autorenschaft Programm (Schiesser 2008: 30). Insgesamt zeige sich eine „einmalige Pluralisierung und Koexistenz von Autorenfunktionen bzw. - konfigurationen“. Seit Marcel Duchamp und Andy Warhol werde immer selbstverständlicher mit Materialität und Medialität vorliegenden Materials gespielt, der Künstler werde zum „,Meta-Autor‘ als Operator der Kopien (statt der Originale), Zitate (statt Aussagen), Simulationen (statt Darstellungen) und Pluralitäten (statt Individualitäten)“ (Wetzel 2001: 541).
Es zeichneten sich zwei gegenläufige Tendenzen ab: Es schwinde zwar der „Schöpfungsmythos vom Individuum“ allmählich, gleichzeitig erfinde aber „die zweite Bewegung [...] im Zeitalter der Reproduzierbarkeit immer wieder aufs Neue - als Gegenbild und kontrafaktische Größe - den Autor als individuellen, als singulären Schöpfer seines Werkes“ (Schneider 2006, zit. nach Schiesser 2008: 32). Sich zur Autorenschaft zu bekennen, so leitet Boris Groys in seinem Essay „Politik der Autorenschaft“ (Groys 2001) her, bedeute heute meist, die Verantwortung für das Schaffen - auch in dem Wissen darum, dass man nicht originärer Ursprung ist - zu übernehmen (ebenda: 14). So hat ein Reflexivwerden des Problems der Autorenschaft in den Bereich der künstlerischen Praxis Eingang gefunden, das vonseiten vieler Diskursteilnehmer gefordert wird, wenngleich noch immer auch Schöpfertum behauptet werde.
2.3 Der Diskurs um das Künstlersubjekt
Zentriert sich der Diskurs um die Autorenschaft in erster Linie darum, wem im Prozess der ästhetischen Sinngebung die Urheberrolle zugeschrieben wird, steht die jeder Kunstform und Zeit eigene Definition des Künstlerbegriffs und damit das sich durch die Geschichte hinweg ändernde Verhältnis von Subjekt und künstlerischer Arbeit im Mittelpunkt der Debatte um das Künstlersubjekt. Ein Schnittpunkt scheint darin gegeben, dass jedem Künstlerbegriff auch ein Konzept von Autorenschaft immanent ist.
Josef Früchtl, Professor der Philosophie in Münster, leitet in seinem Essay „Die Unverschämtheit, Ich zu sagen - ein künstlerisches Projekt der Moderne“ (Früchtl 2006) historisch her, weshalb das künstlerische Subjekt im ausgehenden 20. Jahrhundert seine Stellung als „exemplarischer Statthalter moderner Subjektivität“ (ebenda: 38) verliert, was Anlass sein soll, seine Argumentation hier nachzuvollziehen.
Er stellt zwei Thesen auf, von denen hier besonders die zweite von Relevanz ist: Das 18. Jahrhundert sei die Epoche der, „subjektivitätstheoretisch gesehen, ambivalenten Kreativitätsfindung“ und im 19. und 20. Jahrhundert habe sich „das künstlerische Subjekt als Statthalter moderner Subjektivität“ etabliert, diesen Status aber Ende des 20.
[...]
1 Vgl. beispielsweise Stallabrass 1999: 47, Archer 1994: 59ff, Mahoney 1999: 10
2 Vgl. bspw. Leighton/Groom 2008: 7
3 Vgl. bspw. Barber 2001
4 Es gibt nur zwei Publikationen, die sich umfassend mit Emins Arbeit befassen: eine kunstwissenschaftliche Essaysammlung (Merck/Townsend: 2002) und eine Analyse von Emins Werk ebenfalls aus kunstwissenschaftlicher Perspektive (Krause-Wahl: 2006). Die Essaysammlung ist in Bezug auf inhaltliche Aspekte aufschlussreich, zielt aber nicht auf ein Verständnis von Emins Subjektentwurf. In der anderen Publikation analysiert Antje Krause-Wahl, wie Emin und die Künstler Renée Green und Rirkrit Tiravanija Identitäten konstruieren, sieht dabei aber von einer Einordnung Emins vor dem Diskurs um das Künstlersubjekt ab und reduziert das sich in Emins Selbstentwurf zeigende Muster auf die Figur des Stars. Wo es sinnvoll scheint, soll hier an die Publikationen angeknüpft werden.
5 Der Foucaultsche Begriff der „Subjektivierungspraxis“ wird in „2.1 Das Subjekt und die ,Selbsttechnologien‘ ‘‘ hergeleitet; er bezeichnet Praktiken, die der Versicherung des Selbst dienen und die identitätsstiftend sind.
6 Der Begriff wird im Folgenden ohne Anführungszeichen verwendet; das Phänomen des Celebrities wird in „2.3.1 Der ,Celebrity-Artist‘ ‘‘ behandelt.
7 Die Arbeit schließt sich einem Verständnis des Subjekts als ständig changierendes Resultat von Inszenierungsstrategien und Selbst-Erfindungen (Becker 2000: 18) an. Wenn man Realität als „eine immer schon (medial) vermittelte, immer schon beobachtete“ (Berg/Landkammer 2006: 150) begreift, wird eine Suche nach Authentizität hinfällig.
8 Autorenschaft wird in „2.2 Das Diktum vom Tod des Autors“ behandelt und hier im Folgenden ohne Anführungszeichen verwendet.
9 Der Begriff der „Selbsttechnologien“ wird nachfolgend in 2.1 behandelt.
10 Zu Descartes Subjektbegriff vgl. z.B. Geyer 2007: 46ff
11 Diskursive und nicht-diskursive Praktiken4 üben disziplinarisch Macht über den Körper aus5 ; das Machtkonzept greift aber nicht nur auf der Ebene des vereinzelten Subjekts, sondern auch auf der gesellschaftlichen. Dafür verwendet Foucault den Begriff der Gouvernementalität, der unterschiedliche Machtverhältnisse bezeichnet, die der Steuerung von Menschen dienen. Zu diskursiven und nichtdiskursive Praktiken schreibt Foucault: „Ich möchte klären und beschreiben, welche Beziehungen zwischen diesen Ereignissen, die man als Diskursereignisse bezeichnen kann, und anderen Ereignissen bestehen, die zum ökonomischen System, zum politischen Bereich oder zu den Institutionen gehören. So gesehen ist der Diskurs nur ein Ereignis unter vielen, auch wenn Diskursereignisse im Vergleich zu anderen natürlich ihre eigene Funktion besitzen. Ein weiteres Problem besteht darin, die spezifischen Funktionen des Diskurses zu klären, und verschiedene Diskurstypen voneinander zu unterscheiden“ (Foucault 2003: 597). Isabelle Lorey macht Foucaults Unterscheidung von diskursiven und nicht-diskursiven Praktiken deutlich und von Sprache abhängig: „Der über den Diskurs hinausgehende Begriff des Dispositivs bedeutet, dass Macht sich nicht allein in Diskursen, d.h. in Sprache manifestiert. Da Foucault Diskurs eng mit Sprache verknüpft, diskursive Praktiken also sprachliche Praktiken sind, ist Macht mehr als diese. Es gibt somit Praktiken „außerhalb“ des Diskurses, aber nicht außerhalb von Machtverhältnissen“ (Lorey 1999: 94).
12 Butler richtet sich gegen feministische Praktiken, die „Identity Politics“, d.h. politische Praxis qua Identität, in den USA der 1980er und 1990er Jahre. Die politische Konstruktion des weiblichen Subjekts sei mit Legitimations- und Ausschlusszielen verbunden - gerade im Bilden der Kategorie „Frau“ als Subjekt des Feminismus liege also eine Einschränkung, obwohl eine Emanzipation erreicht werden solle (Butler 1991: 17).
13 Butlers Kritik richtet sich also nur gegen den modernen Subjektbegriff, der ein autonomes, dem Diskurs vorgelagertes Subjekt bezeichnet, und gegen ein „Trugbild der Souveränität“ (Butler 1998: 29); sie geht nicht auf andere bestehende Konzepte vom Subjekt ein.
14 Butler lehnt ihren Diskursbegriff an den Foucaults an; er bezeichnet für eine Epoche oder einen Zeitrahmen konstituive sprachlich-begriffliche Vorstellungen und Sprechweisen, also eine Menge von Aussagen, die dem gleichen Formationssystem angehören. Diskurse beziehen sich auf ein Objekt und haben insofern wirklichkeitserzeugende Wirkung, als sie nur bestimmte Begrifflichkeiten in Bezug auf das Objekt hervorbringen. Nach Butler umfasst die diskursive Praxis auch Performativität, die in Anklang an Austin als Sprechakte, die das, was sie äußern, durch die Tätigung der Äußerung auch erzeugen, verstanden werden. Sie sind realitätserzeugend, aber die performative Wirkung muss nicht dem entsprechen, was zuvor benannt wurde, sondern hängt von einer Vielzahl von Faktoren ab.
15 Im Foucaultschen Sinne setzt die Genealogie voraus, dass alle Dinge „ohne Wesen sind oder ihr Wesen ein Stückwerk aus ihren fremden Bedeutungen“ sei (Foucault 1974: 86).
16 Eine wesentliche Praktik ist die Anrufung, die mittels Identitätskategorien operiert19 und ausschließt, als was man nicht bezeichnet wird. Butler schreibt: „[D]ie Anrede ruft das Subjekt ins Leben“ (Butler 1998: 43) und weist auf die „zeitweilige Totalisierung“ hin, weil im Moment der Anrufung mit einer Identitätskategorie man nichts außer dieser einen Identität sei. Die Ausschließung dessen, als das man nicht bezeichnet wird, nennt Butler auch „Sperre“ und sie versteht diese als Auswirkung diskursiver Machtstrukturen, die identitätsstiftend wirken. Die individuelle, psychische Dimension der „Sperre“ und somit des Identitätsbildungsprozesses - denn eine Person kann eine Anrufung annehmen oder ablehnen - bezeichnet Butler in Anlehnung an Louis Althusser, Hegel und Nietzsche als „Umwendung“. Diese ist Möglichkeit der Selbst-Wahrnehmung, denn „erst durch Rückwendung gegen sich selbst erlangt das Ich überhaupt den Status eines Wahrnehmungs- objekts“ (Butler 2001: 158), wie auch ein Vorgang der „Selbstverknechtung“ (ebenda 157), da die spezifische Existenz dieses einen Selbstentwurfes alle anderen möglichen ausschließe. Der Verlust aller anderer Existenzen geschieht unbewusst - man weiß nicht, wer man hätte bekommen können - und ist von bestehenden Machtverhältnissen abhängig. Wer sich nicht der Ordnung dieser Machtverhältnisse unterwirft, gilt als „Figur der Verwerflichkeit“ (Butler 1995: 156). Gleichzeitig ist der Verlust konstituiv dafür, was man ist, und somit Daseinsbedingung des Ichs (ebenda).
17 Es kann nur ein sehr verkürzter Überblick über die Texte gegeben werden, weil hier vor allem der veränderte Umgang mit Autorenschaft innerhalb der künstlerischen Praxis von Interesse ist.
18 Nach Foucault implizieren Barthes Begrifflichkeiten „Werk“ und „Schreiben“ ein Festhalten an der Figur des Autors: Im Beibehalten des Begriffs des (einheitlichen) „Werkes“ liegt ein logischer Fehlschluss, so der Abschied von der Figur des Autors auch den Zusammenschluss aller Arbeiten eines Schreibers zu einem „Werk“ ausschließt (Foucault 2000: 205-206), der Begriff des „Schreibens“ übertrage nur „die empirischen Charakterzüge des Autors in eine transzendentale Anonymität“ (Foucault 2000: 206).
19 Die Funktionsweise des Autornamens wird in „Was ist ein Autor?“ unter drei Gesichtspunkt analysiert - der Autorenname als besondere Funktionsweise des Eigennamens, der „Autorenfunktion“, die einige Diskurse haben und andere nicht und dem Autor als „Diskursivitätsbegründer“25 (Schiesser 2008: 26-27). Haben Diskurse die Funktion Autor, sind sie durch vier Merkmale charakterisiert: Erstens haben die Autoren eine, auch rechtlich fixierte, Eigentumsbeziehung zu ihren Texten, zweitens gilt die Funktion Autor nur für manche Diskurse, drittens bildet sich die Funktion Autor „nicht so spontan, wie man einen Diskurs einem Autor zuschreibt“ (Foucault 2000: 213), sondern resultiert aus einer komplizierten Konstruktion, und viertens zeigen Diskurse mit der Funktion Autor eine Zersplitterung der Sprecher-Ichs und haben somit eine „Ego-Pluralität“ (Foucault 2000: 217), vgl. Foucault 2000: 211-217
- Arbeit zitieren
- Anonym, 2010, Kunst als Selbstbefragung. Künstlerische und mediale Konstruktion des Selbst bei Tracey Emin, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/306993
Kostenlos Autor werden





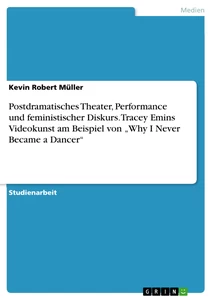














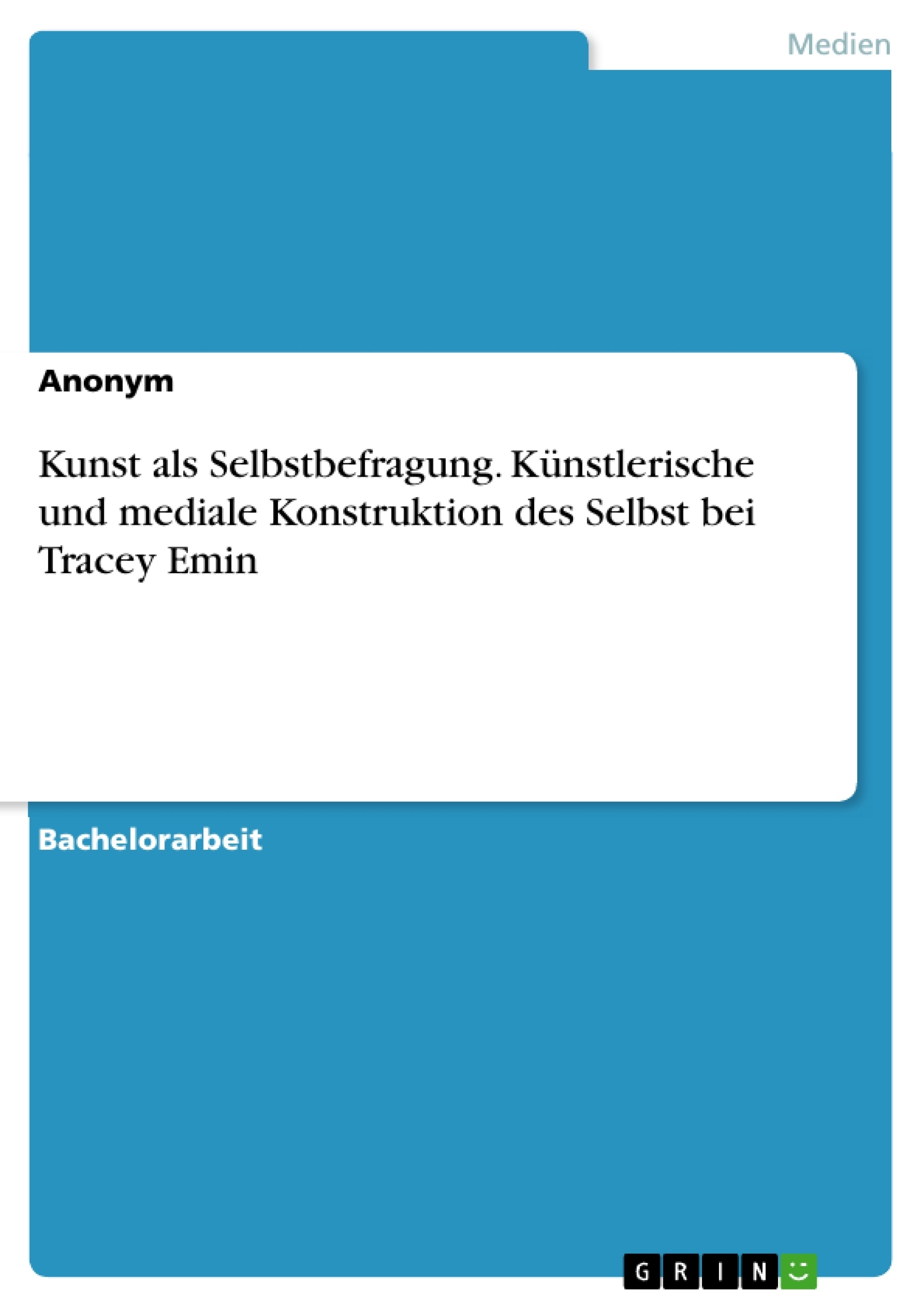

Kommentare