Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1 (Computer-)Spiele
1.1 Was ist ein Spiel?
1.2 Was ist ein Computerspiel?
1.3 Gesellschaft und virtuelle Welten
1.3.1 Strukturebenen virtueller Welten
2 Fallbeispiel Star Wars: The Old Republic
2.1 Entwicklung
2.1.1 Vier Säulen erfolgreicher Computerspiele
2.2 Geschichte
2.3 Abonnements
2.4 Avatare
2.4.1 Gesinnungen und Fraktionen
2.4.2 Aussehen und Hintergründe
2.4.3 Stimmen, Welten und Identität(en)
2.4.4 BegleiterInnen
3 Identitätsarbeit, Subjekte und Rollen
3.1 Thesen zum Thema
3.1.1 Pearce: Rollenspiele und Gruppen(-Identitäten)
3.1.2 Mortensen: „Das Fremde in mir“ und vermeintlicher Realitätsverlust
3.1.3 Geschlechterwahl und Identität(en)
3.1.4 Bilden: Das heterogene Selbst
4 Forschungsarbeit
4.1 Themenwahl und gesellschaftliche Relevanz
4.2 Forschungsfragen
4.2.1 Interviewfragen
4.3 Methoden und Vorgehensweisen: Definitionen
4.3.1 Teilnehmende Beobachtung
4.3.2 Qualitative, leitfadengestützte Interviews
4.3.3 Selbstbeobachtung
5 Auswertung und Vergleich der Forschungsergebnisse
5.1 ForschungsteilnehmerInnen und Interviews
5.1.1 Laien
5.1.2 Experten
5.2 Selbstbeobachtung
6 Auswertung und Beantwortung der Forschungsfragen
6.1 Charaktererstellung
6.1.1 Optik
6.1.2 Sex und Gender
6.1.3 Persönlichkeit
6.2 Beziehungen
6.3 Leben abseits des Monitors ↔ virtuelle Welt
6.3.1 Gefühle während und nach dem Spielen
7 Kurzzusammenfassung der Ergebnisse und Resümee
Quellenverzeichnis
Anhang: Interviews (Laien)
Anhang: Interviews (Experten)
Interview: Krasha
Einleitung
Verschiedenste Medien sind in unserem heutigen Alltag omnipräsent. Fernsehen, Radio oder Internet prägen unser Leben und sind wichtige Komponenten unserer modernen Gesellschaft. Besonders das Internet erfuhr in den letzten Jahrzehnten einen regelrechten Schub an UsernInnen, denn es wurde immer beliebter: Während es in Europa ab den 80er Jahren für gewisse Institutionen erstmals möglich war online zu gehen, besitzen heute acht von zehn österreichischen Haushalten einen Internetzugang. Dies entspricht 81% aller Haushalte im Land. 64% dieser Haushalte sind mit einer festen Breitbandverbindung ausgestattet, 48% mit einer mobilen Breitbandverbindung über Mobilnetze. (vgl. Statistik Austria 2014)
Die Welt ist vernetzt und auch wir Menschen selbst agieren heute als GrenzwandlerInnen zwischen dem Leben vor dem Bildschirm und der virtuellen Realität. Dabei von einer „einzig wahren Realität“ und einer gegenüberstehenden „Nicht-Realität im Computer“ zu sprechen, wäre nicht mit unseren neuen Lebensstilen und der Bedeutung der digitalen Lebensräume konform. Beispiele für die Existenz mehrerer Realitäten und die fortschreitende Technisierung wären die starke Nutzung von Social Networks, Smartphone-Apps oder (anderen) intelligenten Systemen wie Haushaltsrobotern oder ähnlichem. Der Alltag und die Kommunikation spielen sich, anders als noch in den letzten Jahrzehnten, immer stärker in unserer digitalen „Parallelwelt“ ab. Das Leben vor dem Monitor verschwimmt immer mehr mit dem auf dem Bildschirm und dieser Trend nimmt nicht ab, im Gegenteil: Mobilität und Flexibilität auf vielen Ebenen ist heute gefragter denn je und dies nicht nur in der Freizeit; darum spielt Vernetztheit auch im Berufsleben eine essentielle Rolle.
Ein nicht unmaßgebliches Gebiet der digitalen Welten, das in dieser schriftlichen Arbeit von Wichtigkeit sein wird, machen die Computerspiele aus (und dies nicht nur im Alltag von Kindern und Jugendlichen). Immer mehr Erwachsene verbringen ihre Zeit heutzutage mit dem Computerspielen on- und offline. Laut der Entertainment Software Association beläuft sich das durchschnittliche Alter des Gamers auf 31 Jahre. 71% der Gamer sind älter als 18 Jahre und 48% der SpielerInnen sind weiblich (vgl. ESA 2014). Das Klischee einer ausschließlich männlich dominierten Computerspielszene wurde damit also widerlegt. Auch sind Personen, die regelmäßig „zocken“ keine sozial zurückgezogenen, introvertierten oder eigenbrötlerischen EinzelgängerInnen. So zu denken, wäre altmodisch und entspräche nicht den Fakten über den technischen (Spiele-)Fortschritt und -Boom der letzten Jahre. Gamer sitzen nicht nur alleine zu Hause vor ihrem Computer, sondern spielen auch unterwegs auf Smartphones, Tablets oder bei (und mit) Freunden auf Konsolen. LAN-Parties stellen in diesem Zuge eine weitere, soziale Komponente der geselligen VideospielerInnen dar. Sie sind Treffen von SzenemitgliedernInnen, bei denen die eigenen PCs mitgebracht werden. Über LAN spielen diese Personen dann miteinander. Im Gegenzug zum Multiplayer-Spielen online, bei dem man seine FreundeInnen oder Fremde in einer virtuellen Welt trifft, befindet man sich bei LAN-Parties auch physisch in einem gemeinsamen Raum in der Welt vor dem Monitor.
Eine weitere Art von Treffen der AnhängerInnen der Computerspielszene sind, nach den bereits genannten Varianten, die sogenannten Game-Conventions. Dies sind Messen, auf denen Publisher und EntwicklerInnen ihre neuesten und populärsten Games vorstellen. Diese Videospiele kann man vor Ort anspielen, also „ausprobieren“ und testen. Conventions erfreuen sich hoher Beliebtheit und deren Besucherzahlen sprechen für sich: Die größte Game-Convention Europas, die Gamescom, findet jährlich in Köln statt. Neben 700 AusstellernInnen aus 47 Ländern besuchten 2014 rund 335,000 Interessierte aus 88 Ländern dieses Event, das fünf Tage dauert (vgl. Kölnmesse 2014: 1). Auch in Österreich gibt es eine Gaming-Convention namens Game City. Unter dem Motto „Gaming findet Stadt“ findet dieses Event jährlich und an drei Tagen im Wiener Rathaus statt. 69,000 BesucherInnen spielten hier im letzten Jahr die neuesten Titel der bekanntesten HerausgeberInnen und Entwicklerstudios (vgl. Game City 2014: o.S.). Und dies teils zivil gekleidet, teils als ihre liebsten Charaktere aus diversen Videospielen verkleidet. Diesen Kostümtrend, der ursprünglich aus Japan stammt und auch in Europas Gamingszene immer populärer wird, nennt man Cosplay.
Neben den vielsagenden Statistiken über die Gamerkultur spricht auch der Verkaufstrend der Videospiele für die starke Präsenz und Wichtigkeit der Games in der modernen Gesellschaft: Durch den Entfaltungsdrang auf kreativer Seite der EntwicklerInnen und den rasanten, technischen Fortschritt entstand mit der Gamingbranche eine Industrie, die den MartforschernInnen von DFC zufolge einen weltweiten Jahresumsatz von 100 Milliarden Dollar übersteigen wird. Und dies bis zum Jahre 2018. Bereits heute spielen Videogames mehr Geld ein als die weltweiten Kinofilme und Musikverkäufe zusammen (vgl. Zsolt 2014: o.S.). Activision Blizzard investierte 500 Millionen Dollar in Bungie's Spiele-Blockbuster „Destiny“, ein first-person action Game, das im Jahre 2014 veröffentlicht wurde (vgl. Pitcher 2014: o.S.). In Gegenüberstellung kostete der teuerste Film, der jemals gedreht wurde – Disney's „Fluch der Karibik: Am Ende der Welt“, der 2007 in die Kinos kam – 341,8 Millionen Dollar. (vgl. Toro 2014: o.S.).
Der Trend, dass Videospiele mehr einbringen, als Kino-Blockbuster, ist keine neue Tatsache. Bereits Ende Oktober 1982 verkündete das Magazin „Newsweek“:
„Die boomende Videospielindustrie ist fast so groß wie das Filmgeschäft, die Steckkarten eines gut gehenden Heimvideospieltitels könnten schon bald mehr Geld bringen als ein Blockbuster aus Hollywood.“ (vgl. Lischka 2002: 51)
Warum man annahm, dass Computerspiele zu dieser Zeit so viel Geld einbringen würden, ist unklar. Was aber einem/r jeden Interessierten bewusst war, ist, dass es in der Gamingindustrie einen schnellen, technischen Fortschritt gab. Bereits 1977 zeigte sich, dass ständige, technische Innovation ein grundlegendes Gesetz dieses Bereiches war (vgl. Lischka 2002: 51). Und dies ist es noch heute. Die Prognosen von vor einigen Jahrzehnten haben sich also bewahrheitet. Digitale Spiele waren auf dem Vormarsch und sind bis heute zu einem wichtigen, allgegenwärtigen Medium geworden, das stets weiterentwickelt wird und an Bedeutung gewinnt.
Heute besitzen 76% der Haushalte eine stationäre Konsole wie die „Playstation“ oder die „Xbox“. 59% sind mit einer tragbaren Spielkonsole, wie dem „Nintendo DS“ oder der „Playstation Vita“ ausgestattet. (vgl. JIM-Studie 2013: 6).
Doch was macht Videospiele eigentlich so populär und beliebt? Was fasziniert am digitalen Spiel und warum werden so viele Gamer von den virtuellen Welten am Monitor angezogen? Das manchmal so sehr, dass sie neben dem Spielen auch Cosplay-Kostüme anfertigen, um ihr/e LieblingsheldIn aus der virtuellen Welt im Alltag vor dem Bildschirm verkörpern zu können?
Die vorliegende Masterarbeit soll sich unter anderem mit genau diesen Fragen beschäftigen. Es soll erklärt werden wo hier die Gelegenheiten zur Identitätsentwicklung und -formung liegen, welche Identitäten kreiert werden und inwiefern Videospiele Menschen beeinflussen und unterhalten können. Es stellt sich die Frage, wie viele Aspekte aus dem Leben vor dem Bildschirm in das virtuelle Leben mit einfließen und vice versa. Ein Hauptaugenmerk wird auf all die Wechselwirkungen zwischen Spiel und Alltag gelegt. Vorteile des Spielens werden beleuchtet werden, sowie auch mögliche Risiken und Gefahren. Einen nicht unwichtigen Punkt werden zudem die Thematiken „Gender und Sex“ sein, die direkt mit den wichtigen Spielavataren der einzelnen SpielerInnen zu tun haben. Welche Aspekte fließen in die Erstellung eben dieser noch ein? Wie stehen sie mit der Person vor dem Computer in Verbindung und wie steht es um Beziehungen zwischen diesen beiden und anderen SpielernInnen online oder computergesteuerten Charakteren?
Am Anfang dieser Studienarbeit werden wichtige Begriffe näher beleuchtet. Der weite Bereich der Computerspiele wird genau erklärt und ein Überblick über deren historische Entwicklung wird gegeben. Auch auf das Spiel außerhalb der virtuellen Welt und dessen Funktionen in der Identitätsbildung wird eingegangen werden. Darauf folgen Erläuterungen einiger, wichtiger Theorien über Identitätsarbeit und Subjektbildung namhafter WissenschaftlerInnen. Das Fallbeispiel dieser Arbeit, das Spiel Star Wars: The Old Republic (kurz: SW:TOR), wird vorgestellt und schließlich wird auf die Forschungsarbeit eingegangen: Sieben Personen wurden zur Beantwortung der Forschungsfrage beim Spielen von dem behandelten Game beobachtet und interviewt. Auch folgen Auswertungen und Vergleiche mit bestehender Literatur und zwei Experteninterviews. Eine Selbstbeobachtung wird die neuen Erkenntnisse und Thesen dieser Studienarbeit noch weiter untermauern. Nach der Auswertung, einem Abgleich mit wissenschaftlicher Literatur und dem Resümee schließen Quellenangaben, das Abbildungsverzeichnis und ein Anhang diese Masterarbeit.
1 (Computer-)Spiele
1.1 Was ist ein Spiel?
Glaubt man einem Brief Friedrich Schillers aus dem Jahre 1795, so ist ein Mensch nur dann ein Mensch, wenn er spielt. Spielt man nicht, so sei man unmenschlich. Über die ästhetische Erziehung des Menschen schrieb der Autor folgende Worte:
„Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Worts Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.“ (Schiller 1795: 15. Brief)
Doch dies so stehen zu lassen, wäre im Zuge einer Forschungsarbeit wie dieser unzureichend. Man stellt sich, nach diesem Brief Schillers, nämlich nach wie vor die Frage was das Spiel wirklich sei und welche Rolle es für jede/n Einzelne/n einnimmt. Warum spielt man? Wer spielt? Inwiefern und wo wird gespielt?
Schon Stuber schrieb, dass es auf die Frage „Was ist Spiel?“ keine einfache Antwort gäbe. Denn jegliche theoretische und praktische Beschäftigung mit dem Gebiet des Spielens geschähe mit dem Hintergrundgedanken anthropologischer Grundannahmen. Verschiedenste Deutungen - oder der Versuch derselbigen - menschlichen Daseins führen zu unterschiedlichsten Einschätzungen der Bedeutung und Beschreibung des hier behandelten Themas: des Spielens. (vgl. Stuber 1998: 7) Dabei glaubt man, dass ein Begriff wie das Spielen so leicht zu deuten und zu definieren sei. Denn jeder Mensch spielt vom Kindesalter an. Es wirkt daher dermaßen verständlich und klar. Doch das ist es nicht. Denn das Spielen ist ein komplexes Thema mit vielerlei Facetten, Gründen und Möglichkeiten zur Identitätsarbeit und der Subjektwerdung. Es fällt also tatsächlich schwer die Vielfalt von Erscheinungen des Spielens unter eine gemeingültige oder gemeinsame Definition zu fassen. Anzumerken ist hierbei, dass die englische Sprache zwischen „Play“ und „Game“ unterscheidet. Der Begriff des Games wird in unserer Gesellschaft als Anglizismus und für Spiele generell verwendet; er ist auch sehr vielen Personen im Alltag bekannt. Doch an und für sich ist „Game“, anders als „Play“, dem Regelspiel vorenthalten (vgl. Oerter o.J.: 1).
Auch der Wissenschaftler Jan Huizinga beschäftigte sich in seiner fundierten, schriftlichen Arbeit „Homo ludens“ mit dem Terminus des Spielens. Er definiert es gut zusammengefasst als „eine freiwillige Handlung oder Beschäftigung, die innerhalb gewisser festgesetzter Grenzen von Zeit und Raum nach freiwillig angenommenen, aber unbedingt bindenden Regeln verrichtet, ihr Ziel in sich selber hat und begleitet wird von einem Gefühl der Spannung und Freude und einem Bewusstsein des Andersseins als das gewöhnliche Leben.“ (Huizinga 1987: 37)
Im deutschsprachigen Duden findet man zu dem Thema des Spielens nicht nur eine, sondern mehrere Definitionen. Diese lauten wie folgt:
- Das Spiel ist eine Tätigkeit, die ohne bewussten Zweck zum Vergnügen, zur Entspannung, aus Freude an ihr selbst und an ihrem Resultat ausgeübt wird.
- Es gibt ein Spiel, das nach festgelegten Regeln durchgeführt wird: das Gesellschaftsspiel.
- Ein Spiel, bei dem der Erfolg vorwiegend vom Zufall abhängt und bei dem um Geld gespielt wird, ist das Glücksspiel.
- Auch ein sportlicher Wettkampf, bei dem zwei Parteien um den Sieg kämpfen – und dies nach bestimmten Regeln – ist ein Spiel.
- Eine künstlerische Darstellung, die Gestaltung einer Rolle durch eine/n SchauspielerIn, eine Darbietung, ein Bühnenstück oder Interpretation eines Musikstückes, ist ein Spiel.
- Spielen ist eine Handlungsweise, die etwas, das Ernst erfordert, leichtnimmt.
(vgl. Duden)
Nach Stampfl Nora ist das Spiel so alt wie die Menschheitsgeschichte: Es ist eine Quelle für Kreativität und ein essentieller Ausgangspunkt für die Entwicklung und Findung des Selbst. Also ein Anstoß für die Identitätsarbeit und Subjektbildung. Das Spiel wird auch im Zuge der Fähigkeit zu Lachen genannt; Spielen ist gleichgestellt mit einem lebenswertem Leben und trägt zu einer guten, gesundheitlichen Verfassung bei. Es ist eine Freizeitbeschäftigung, die man genießen kann und soll. Spielen ist demnach untrennbar mit dem Leben verbunden. Der Mensch ist von Natur aus ein spielendes Wesen. Es gibt darum kaum ein besseres Motivationsmittel als das Spiel, denn es bewegt zum Mitmachen und besitzt eine starke Kraft, die man nicht unterschätzen sollte (vgl. Stampfl 2012: 46).
Warum spielen wir also? Stampfl bezeichnet den Menschen als „geborenen Spieler“, der ohne das Spiel nicht sein könnte. Das Spiel ist schließlich unabdingbar für neurologisches Wachstum und nervliche Entwicklung: Es unterstützt die Lern- und Gedächtnisleistung, trägt zur Stressbewältigung bei, fördert das Wohlbefinden und ist somit mehr als bloße Beschäftigung und simpler Zeitvertreib. Gewandtheit, Reaktionsfähigkeit, Sozialkompetenz und Reflexion sind nur einige der Kompetenzen, die durch das spielende Handeln ausgeprägt werden. Dies jedoch nur, wenn ein Mensch gesund und lebhaft ist. Bei Krankheit, Stress oder Hunger wird das Spiel über Bord geworfen (vgl. Stampfl 2012: 47). Spiel wird also als Handlung beschrieben, die Spaß bedeutet. Spaß entsteht wiederum durch die Beherrschung des Spieles. SpielerInnen suchen nach kognitiven Herausforderungen und sobald ein Spiel diese nicht mehr bietet, wird den involvierten Personen sehr schnell langweilig. Kommt es auf der anderen Seite aber zu einer Überforderung durch das Spielen, so kann es zu Stress und Frustration führen. Des Weiteren stellt ein Spiel nur dann ein Spiel dar, wenn sich der/die SpielerIn freiwillig darauf einlässt, so Stampfl. Ist dies nicht der Fall, so muss von Arbeit gesprochen werden (vgl. Stampfl 2012: 49f).
Um das Spiel genauer zu definieren und ganz eindeutig von anderweitigen Tätigkeiten (wie der angesprochenen Arbeit, des Studiums und so weiter) abzugrenzen, stellte Oerter vier Merkmale des Spielens auf. Diese beschreiben die Regeln des Spiels und geben an wann man von Spielen sprechen kann und wann nicht. Die vier besagten Merkmale sind:
- Der Selbstzweck des Spiels (Handlung um der Handlung willen)
Nach Oerter geht man voll und ganz in der Tätigkeit des Spielens auf. Es besteht eine Motivation, die tätigkeitszentriert ist; man ist also auf das Spiel fokussiert. Das Handeln nach dem Paratelic Model von Apter ist hierbei genauso wichtig wie das Fluss- oder „Flow“-Erleben nach Csikszentmihalyi: Die Erfahrung, die man während des Spielens erlebt, ist eine besondere. Man passt sich an, denn man fühlt sich optimal beansprucht und der Ablauf der Handlungen und Tätigkeiten im Spiel erscheinen als flüssig und gehen glatt vonstatten. Es ist also nicht schwer sich zu konzentrieren und man geht vollkommen und begeistert in der besonderen Situation auf. Das Zeitgefühl des/der Spielenden wird wie selbstverständlich abgeschaltet (Rheinberg, 1991: 2f, zit. n. Oerter o.J: 2). Man wird anders ausgedrückt „Eins mit dem Spiel“. Dies geht hin und wieder so weit, dass gewisse körperliche Grundbedürfnisse abgeschaltet werden. Ein Beispiel dafür wäre das tatsächliche Vergessen der Nahrungsaufnahme oder das Bedürfnis auf die Toilette zu gehen. Stefan Zweig schrieb in seinem Werk „Schachnovelle“ über das Flowerlebnis während des Schachspielens:
„Jede Unterbrechung wurde mir zur Störung; selbst die Viertelstunde, da der Wärter die Gefängniszelle aufräumte, die zwei Minuten, da er mir das Essen brachte, quälten meine fiebrige Ungeduld; manchmal stand der Napf mit der Mahlzeit noch unberührt, ich hatte über dem Spiel vergessen zu essen.“ (Zweig 1974: 84)
Der Protagonist in dem genannten Buch Zweigs ist vom Spiel also dermaßen eingenommen, dass er alles um sich herum zu vergessen scheint. Er beschreibt gar eine Ungeduld, die den Spielenden beherrscht, da er wissen möchte, wie sein Spiel weitergeht.
- Der Wechsel des Realitätsbezuges
Für das Spielen gelten andere Regeln als für den Alltag, der neben dem Spiel existiert. Es bestehen gegebenenfalls andere oder abgewandelte Regeln, Werte, Normen oder Ansichten. Auch werden zumeist gewisse Rollenbilder angenommen oder definiert. Die bestehenden, ausgehandelten Regeln und Werte bezeichnen folglich neue Handlungsrahmen und Grenzen für das Handeln im Spiel. Als SpielerIn bewegt man sich auf einer Ebene, die manchmal sogar nur in der Fantasie der TeilnehmerInnen existiert. Beispiele für letzteres wären die sogenannten Pen and Paper-Spiele, in denen eine Gruppe von SpielernInnen Fantasiefiguren spielt. Man sitzt dabei an einem Tisch zusammen und erzählt einander, wie die jeweilige Figur, die als imaginärer Avatar agiert, handelt. Ein „Gamemaster“ führt diese Spielergruppe zumeist durch eine zuvor ausgedachte Spielwelt, die auf vorgegebenen Regeln gewisser Pen and Paper-Systeme basiert. Kurzum könnte man sagen, dass die Betroffenen zusammen eine Geschichte erzählen; jede/r von ihnen trägt seinen/ihren Teil zu diesem Geschehen, das in den Köpfen der SpielerInnen abläuft, bei.
Das Spiel ist also eine weitere Realität und bildet einen Handlungsrahmen, innerhalb dessen Gegenstände, Handlungen und Personen etwas anderes bedeuten können als in der Realität außerhalb des Spiels. Im sozialen Spiel sind die Rahmenbedingungen ebenso vereinbart und reichen bis in die Phylogenese des Menschen an sich zurück. Sie sind bereits im tierischen Spielverhalten präsent; zum Beispiel im kämpferischen Spielen und Rangeln von jungen Tieren. Es versteht sich von selbst, dass sich Menschen – egal welchen Alters – sprachlich oder nonverbal auf die Spielregeln einigen. Das heißt: Sie machen sich die eingebildete Situation bewusst aus (vgl. Oerter o.J.: 2).
Ein weiteres Beispiel für solche Spielsituationen wären Live Action RolePlays (kurz: LARPs). Diese sind Spiele, die LaienschauspielerInnen jeglichen Alters involvieren. In ihren Schauspielereien verkörpern sie Fantasiefiguren in erfundenen Settings. Sie handeln sich vor dem LARP Regeln und Rahmen aus, die jede/r Beteiligte beachten muss, um mitspielen zu dürfen. Zu diesen Rahmenbedigungen zählen beispielsweise die Spielwelt, das Handeln in besonderen Situationen, die Optik der dargestellten Charaktere und vieles mehr. Am Ende spielen die LARPer Theater; dies oft über mehrere Tage hinweg und ohne ZuschauerInnen. So wie man es auch von Kindern kennt, die Spiele wie Vater-Mutter-Kind spielen. Das größte LARP Europas, das jährlich im deutschen Brokeloh stattfindet, zählt im Schnitt 7500 BesucherInnen, die über 100 Hektar Land in eine Fantasiewelt verwandeln (vgl. Live-adventure 2014: o.S.).
Den Wechsel des Realitätsbezuges kann man also damit beschreiben, dass hier tatsächlich die Realität, in der man sich befindet, gewechselt wird.
- Die Wiederholung und das Ritual
Egal, um welche Spielhandlung oder -gattung es geht, sie alle haben etwas miteinander gemeinsam: In allen Spielen werden gewisse Handlungen wiederholt, die in ihrer Form meist exzessiv sind und zudem einen Ritualcharakter besitzen. Das heißt, dass sie Spielhandlungen in ihren Rahmen einen festgelegten und ausgehandelten Ablauf haben und dass sie in ihrer Gestalt stärker profiliert sind als normale Handlungen im Leben neben dem Spiel (vgl. Oerter o.J.: 2). Im Zuge dessen könnte man die Theatralik nennen. Sie stellt eine überzogene Darstellung einer Handlung dar, die man im außerspielischen Alltag nicht in ihrer Form vollziehen würde. Natürlich stellt man auch in Letzterem dar, doch in den meisten Fällen nicht so gezielt und mit der Absicht „SchauspielerIn“ zu sein.
- Der Gegenstandsbezug
Spielt man, so bezieht man sich nahezu immer auf Gegenstände. Zu diesen Gegenständen zählen Spielsachen, Gesellschaftsspiele, Körperteile bei Bewegungsspielen, Kostüme, Sportgeräte oder sonstige Requisiten. Ein solitärer und sozialer Umgang mit Dingen ist ein wesentliches Merkmal des Spiels; sowie die fantasievolle Umdeutung und -gestaltung der betroffenen Gegenstände (vgl. Oerter o.J.: 2). Als Beispiel kann man hierbei Kinder sehen, die Ritter spielen. Oftmals verwenden sie zum spielerischen Kämpfen Stöcke, die in ihren ausgehandelten Fanstasierahmen Schwerter darstellen sollen. Denkt man wieder an die LARP-Szene, so wird einfache Pyrotechnik dazu verwendet, um Feuermagie darzustellen; Mehl wird zu magischem Nebel und Schaumstoffstäbchen werden zu tödlichen Projektilen.
Im Gegenzug zu Handlungen in der Arbeitswelt oder dem Leben außerhalb des Spieles, die auch auf Gegenstände mit festen Funktionen und Bedeutungen gerichtet sind, deutet das Spiel Objekte nahezu beliebig um. Während Dinge in ersterem Fall unverrückbare Bedeutungen besitzen (zum Beispiel wird Mehl immer ein Pulver aus Getreidekörnern sein), so vermag man Gegenständen im Zuge des Spieles völlig neue Realitäten und Funktionen zuzuweisen (zum Beispiel wird Mehl im fantasievollen Spielrahmen zu Eisnebel). (vgl. Oerter o.J.: 2)
Dingen, denen man Bedeutung zumessen kann, bestimmen Spiele also mit. Ohne sie gäbe es manche Spiele oftmals nicht, denn wenn man an den Sport denkt, so sind Sportgeräte für das Spiel unabdingbar: Ohne den Tennisschläger gebe es kein Tennisspiel oder ohne das Fußballtor kein Fußballspiel.
Um die Merkmale des Spiels nach Oerter noch einmal prägnant zusammenzufassen, kann man sagen, dass das Spiel ein ungezwungenes Tun ist, das freiwillig vonstatten geht und den/die Spielende/n völlig vereinnahmt. Im Spiel gibt es kein Zeitgefühl und Flowerlebnisse treten auf; dies heißt, dass das Spiel vollkommen flüssig abläuft und man sich zurecht findet, ohne dass Komplikationen auftreten. Gewisse, körperliche Bedürfnisse manch einer Person werden im Zuge dessen nahezu „vergessen“ oder abgeschaltet: man isst nicht oder geht nicht auf die Toilette.
Diese Charakteristiken treten nicht nur beim Spiel unter Kindern auf, sondern auch im spielerischen Handeln von Erwachsenen. Sie deuten in ihren Spielrealitäten Gegenstände um und schreiben Objekten manchmal völlig neue Eigenschaften zu; diese fantasievollen Normen und Werte existieren dabei in den Köpfen aller Beteiligten. Denn die Regeln des Spiels werden von allen TeilnehmernInnen ausgehandelt; es besteht ein Übereinkommen über den eingebildeten Rahmen. Ob beim Spielen von Brettspielen, LARP-Geschichten oder im Sport, es gelten stets die selben, oben genannten, Merkmale, die diese Spielarten definieren. Sie machen das Spiel erst zu dem, was es ist: Eine weitere Realität, in der man sich unbeschwert entfalten und austesten kann.
Geht man nun etwas weiter, so kann man diese Merkmale nach Oerter auch durchaus auf heutige Computerspiele anwenden, die in den nächsten Kapiteln näher beleuchtet werden sollen. Doch können digitale Spiele nicht unabhängig von dem klassischen Spielen abseits des Monitors gesehen werden.
1.2 Was ist ein Computerspiel?
In den 70er Jahren gewannen Videospielkonsolen, in den 80er Jahren Personalcomputer, stark an Beliebtheit und hielten Einzug in die heimischen Wohn- und Kinderzimmer. Es entstand ein Phänomen, bei dem sich eine ganze Generation Wissen und spezifische Fähigkeiten aneignete, von welchen deren Eltern weniger Ahnung hatten als die SpielerInnen selbst. Videospiele prägten sowohl die Kinder selbst als auch deren Kindheit. Im Laufe der Zeit kam es zu extremen Entwicklungen im Feld der Technologie, in welchem Videospiele auch einen wichtigen Bestandteil darstellten. Während Videospiele früher als reine Ablenkung und Unterhaltung betrachtet wurden, stellen sie heute einen festen Bestandteil des täglichen Lebens dar. Die „Generation Gaming“ fühlt sich in ihrer virtuellen Welt wohl, sieht sie als eine Art Zuhause und verbringt dort erheblich viel Zeit. Videospiele dienen dieser Generation unter anderem dazu Probleme zu lösen, sich mit anderen UsernInnen zu verbinden und die eigene Identität zu entdecken (vgl. Stampfl 2012: 50f).
Doch wie kam es überhaupt dazu, dass Video- bzw. Computerspiele so populär wurden? Und worin besteht der Unterschied zwischen beiden Termini? Aufschluss darüber sollen die folgenden Seiten geben.
- Die historische Entwicklung der digitalen Spiele
Als einen Vater der digitalen Spiele kann man wohl Nolan Bushnell betiteln. Als Student, der sein Einkommen etwas aufbessern wollte, arbeitete er 1963 in einem Freizeitpark. Dort überredete er die BesucherInnen Geld für das Spielen an seinem Stand auszugeben: Einen viertel Dollar kostete es einen Baseball auf leere Milchflaschen zu werfen. Während seiner Arbeit an dem Schießstand bemerkte er bereits ein wichtiges Motiv, das Menschen dazu bringt überhaupt zu spielen: Leute, die spielen wollen, wollen keine Enzyklopädien und lange Einleitungen zu einem Spiel lesen. Daher muss diese Beschäftigung so einfach sein, dass sie auch ein/e Betrunkene/r versteht. Auch entging Bushnell die Begeisterung seiner MitstudentenInnen bezüglich des Automatenspieles „Spacewar!“ nicht und es fiel ihm auf, wie beliebt der Flipperautomat neben seiner Schießbude war. Als Programmierer, der selbst kleine Videospiele schrieb (unter anderem „Tic Tac Toe“ für den Großrechner seiner Universität), erkannte Bushnell schnell das Problem, das die Kommerzialisierung der digitalen Spiele verhinderte: Computer waren viel zu teuer.
Bushnell machte es sich zum Ziel mit Computerspielen Geld zu verdienen und arbeitete an einem eigenen Videospielautomaten, der sich später nicht durchsetzen sollte, da seine Bedienung zu komplex und die neue Technik für Menschen abschreckend war. Nichts desto trotz arbeitete Bushnell fortan für die Spielefirma Ampex und gründete im Jahre 1972 mit einem Arbeitskollegen ein Unternehmen, das zum am schnellsten wachsenden der Wirtschaftsgeschichte werden sollte: Atari. Diese Firma machte anfänglich ausschließlich mit Flipperautomaten Umsatz; doch dies änderte sich mit dem, heute noch bekannten, Computerspiel „Pong“. Hierbei handelt es sich um ein einfaches Ping-Pong-Konzept: Es gibt zwei simple Schläger, einen Ball und zwei Punkteanzeigen. Ziel ist es den Ball an dem Schläger des/r jeweils anderen SpielersIn vorbeizuschießen. Das Besondere an diesem Spiel war 1972, dass dafür eine eigene Physik entwickelt wurde; drei Monate lange dauerte es, bis der erste Prototyp von „Pong“ spielbereit war. Der erste „Pong“-Spielautomat erwies sich schnell als sehr beliebt und spielte mehr als dreimal so viel Geld ein, wie die sehr guten Flippertische in Gasthäusern oder auf Jahrmärkten. Spätestens an diesem Punkt angelangt war Bushnell klar, dass er ein Massenprodukt erschaffen hatte.
Atari baute und verkaufte in den folgenden zwei Jahren 8.000 „Pong“-Automaten für Cafés und Kneipen und verdiente damit 3,8 Millionen Dollar. Zehn Jahre später setzte das Unternehmen mit Videospielautomaten, und auch mit Heimkonsolen, 2 Milliarden Dollar um. (vgl. Lischka 2002: 41-44)
Im Jahr 1976 verkaufte Bushnell Atari schließlich an den Warner-Konzern. Warner investierte in den folgenden Jahren gut 100 Millionen Dollar in Atari, doch bevor neue ästhetische und spielerische Konzepte auf Konsolen erprobt wurden (und somit auch die Ära der Heimgeräte eingeläutet wurde), fand die Innovation der Firma an einem anderen, gewohnten Ort statt: der Spielhalle. (vgl. Lischka 2002: 46)
Während die Preise für das Spielen an Automaten in Spielhallen gering waren und sich umgerechnet auf wenige Cent beschränkten, waren Konsolen sehr teuer: Mehr als 100 Dollar kostete eines dieser Geräte; 40 mehr musste man für jedes Spiel ausgeben, das man darauf spielen wollte. Die erste Heimkonsole Ataris kam 1977 auf den Markt. Unter dem Namen VCS (kurz für: Video Computer System) mutete diese mit ihrer Holzfront wie ein Einrichtungsgegenstand an. Der Zweck dahinter war, dass man der Gesellschaft die Scheu vor der Technologie nehmen wollte. Das Holzimitat am vorderen Teil des VCS vermittelte, dass die Konsole nicht High-Tech war, sondern, ohne sich abzuheben, zu dem restlichen Inventar gehörte. Und tatsächlich war das VCS nicht wirklich „High-Tech“: Ja, es war verwunderlich, dass die Programmierer Wagner und Whitehead es überhaupt vollbracht hatten, ein Schachspiel für dieses Gerät zu schreiben. Denn es musste mit gerade einmal vier Kilobytes Daten- und mit 138 Bytes Arbeitsspeicher auskommen. Wenn das VCS mit seinen 1,19 Megahertz Taktfrequenz also einen Schachzug berechnete, so flackerte der Monitor bis zu einer halben Stunde lang in vielen Farben.
Daneben muss man wohl nicht hervorheben, dass die wesentlichen Fortschritte hinsichtlich der digitale Spiele weiterhin bei großen Automaten für Spielhallen gemacht wurden. Neue Maßstäbe hinsichtlich der Gestaltung und des Klanges setzte hierbei das, von Taito lizensierte, Computerspiel „Space Invaders“. 1978 wurde dieses in Japan veröffentlicht.
Das Ziel dieses Spieles ist es so viele Außerirdische abzuschießen wie möglich. Diese sogenannten „Space Invaders“, bestehend aus vielen Pixeln, wandern während des Spieldurchlaufs von einer Seite des Bildschirmes zum anderen. Sind sie dort angekommen, rücken sie eine Reihe weiter nach unten, auf den/die SpielerIn zu. Diese/r SpielerIn ist RepräsentantIn der Menschheit, mit einem Laser bewaffnet muss er/sie die Welt gegen die Außerirdischen verteidigen. Schafft er/sie dies nicht und kommen die feindlichen Pixelwesen am untersten Rand des Monitors an, ist das Spiel vorbei. Das Interessante an diesem Computerspiel ist nun das Konzept, das den/die SpielerIn niemals gewinnen lässt. Denn es ist immer erst dann zu Ende, wenn der Avatar des/der Spielenden stirbt oder wenn aufgegeben wird. Belohnung für ein langes Durchhalten ist hierbei lediglich ein hoher Punktestand.
„Space Invaders“ war in Japan dermaßen erfolgreich, dass man sagt, dass die Produktion der 100-Yen-Münze Ende 1978 verdreifacht werden musste. Ob dies stimmt oder nicht, ist nicht klar. Doch Taito war mit dem besagten Spiel und dem Game „Gunfight“ auch in den USA so erfolgreich, dass das Unternehmen beschloss auch gezielt am amerikanischen Markt tätig zu werden. (vgl. Lischka 2002: 47ff)
Ebenfalls im Jahre 1978 wurde in den USA Cinematronic's Spiel „Space Wars“ veröffentlicht. Dieses digitale Spiel war eine Adaption von „Spacewar!“ und nutzte erstmals Vektorgrafiken. Die Bildverarbeitung geschah damit schneller als bei anderen Spielen. Doch nicht nur wegen dieser grafischen Neuerung wurde dieses Computerspiel bekannt. Einen erheblichen Teil zu dessen Popularität trug der erste Teil der Filmreihe zu „Star Wars“, der zu dieser Zeit in den Kinos anlief, bei.
Es folgten immer bessere Spielautomaten mit mehr Farben und Spiele mit neuen Klangeffekten. 1980 bot Taito's „Stratovox“ die erste digitalisierte Sprachausgabe.
Der Sinneseindruck wurde hinsichtlich der Computerspiele immer wichtiger. Dies zeigte 1983 das Laserdisc-Spiel „Dragon's Lair“: Mit Hilfe der Kapazität der neuen Laserdiscs war es möglich Spiele zu schaffen, die filmische Bildqualitäten und einen gewissen Grad an Interaktion vereinten. Das Animationsstudio des Disney-Zeichners Don Bluth (Er arbeitete zum Beispiel an dem Film „Feivel der Mauswanderer“) zeichnete Filmsequenzen für „Dragon's Lair“. Hier ging es darum den Spielhelden mittels der Betätigung eines Joysticks vor dem Tod zu bewahren. Schaffte man dies, so rettete dieser Protagonist eine Prinzessin aus der Höhle eines gefährlichen Drachen. Lief es nicht gut und versagte man, so bekam man eine Todessequenz zu sehen. Die spielenden Menschen liebten das besagte Game und so brachte ein Automat mit „Dragon's Lair“ pro Woche bis zu 1.400 Dollar ein. Noch heute gibt es im Internet eine große Fangemeinde zu diesem Spiel. (vgl. Lischka 2002: 49f)
Nach einem großen Fortschritt im Sektor der Spielautomaten wurde wieder an neuen Heimkonsolen gearbeitet. Auch Heimcomputer wurden nun entwickelt und produziert. Ein Beispiel dafür wäre der erste Apple-Heimcomputer von Steve Jobs, der 1976 für 666,66 Dollar reißenden Absatz fand. Computer kamen nicht mehr mit einem simplen Fernseher-Charme in die Haushalte, sondern als programmierbare Geräte, die dadurch ein neues, großes technisches Potenzial besaßen. Tramiel erkannte:
„We need to build computer for the masses, not the classes.“ (vgl. Lischka 2002: 52)
Eines der ersten dieser Massenprodukte war Commodore's PET (kurz für: Personal Electronic Transactor), der ab 1977 für 800 Dollar verkauft wurde. Die Ära der Heimcomputer war eingeläutet worden; immer mehr dieser Geräte verschiedener Hersteller fanden ihre Wege in die heimischen vier Wände. Der Computermarkt wurde lange dominiert von Apple und IBM, der Spielemarkt von Nintendo. (vgl. Lischka 2002: 53)
Ein namhaftes Videospiel ist „Pacman“. Die Figur, eine gelbe Scheibe mit einem dreieckig ausgeschnittenen Mund, die in einem Labyrinth unaufhaltsam Punkte und Früchte essen muss und von Geistern gejagt wird, machte die Menschen 1981 nahezu verrückt. Vom Unternehmen Namco ins Leben gerufen wurde „Pacman“ bis 2002 schätzungsweise 60 Milliarden Mal gespielt. 1981 wurde das Spiel zum Kult und es gab erstmals Merchandise (also Fanartikel) zu diesem Spiel: In den Vereinigten Staaten gab es Pacman-Musikalben, -Cornflakes und sogar eine Fernsehserie, die von 1982-1984 jeden Samstagmorgen bei ABC lief. Auch ein Weihnachtsfilm war 1982 am Weihnachtsabend zu sehen; er hieß „Christmas comes to Pac-Land“.
Während Atari's Erfolg nachließ, hatten japanische Videospielfirmen offenbar das Geheimnis des erfolgreichen Spiels entdeckt. Als die amerikanische Videospielbranche zusammenbrach, eroberten die japanischen Unternehmen Nintendo, Namco und Sega mit neuen Spielkonzepten den Markt für Heimkonsolen und Spielautomaten. (vgl Lischka 2002: 55)
Shigeru Miyamoto, ein Programmierer Nintendos, verstand sich bereits in den Anfängen seiner Arbeit als Künstler. Für ihn machte die Erzählung des Computerspiels nicht die Kunst des Games aus. Für ihn waren Gameplay und Struktur wichtig. Er stellte zuerst Regeln für ein Spiel auf, dann entwarf er die besten Charaktere für das jeweilige Spielsystem. Anschaulich wird das bei seinem ersten Spiel, das er für Nintendo entwerfen durfte: „Donkey Kong“. Hierbei galt es in der Entwicklung zunächst, dass eine Spielfigur mithilfe mehrerer Sprünge ein hohes Gerüst und Plattformen erklimmen muss. Der Handlungsort sollte eine Baustelle sein, da es auf solch einer viele Gerüste zum Hüpfen gäbe. Neben Gerüsten und Plattformen wurde ein Lagerhaus eingefügt, damit der/die SpielerIn über Fässer springen muss, die daraus herabrollen. Konsequenterweise hieß der Protagonist dieses Spieles, er sollte von Beruf Schreiner sein, „Jumpman“. Dieser Charakter besitzt einen großen Affen, der sich gedemütigt fühlt. Als großer Affe, so Miyamoto, fühle man sich nämlich schlecht, wenn man einem kleinen Schreiner gehört. So entführt der Affe die Freundin des Schreiners, die wiederum befreit werden muss. Jumpman muss also Gerüste und Plattformen erklimmen und rollenden Fässern ausweichen, um zu dem Affen zu gelangen, der seine Freundin gefangen hält.
Seinen neuen, heute verbreiteten, Namen bekam Jumpan dann zufällig durch eine amerikanische Nintendo-Tochtergesellschaft: Diese benannte den Helden nach dem Vermieter der Nintendo-Lagerhallen: Mario. Damit war Super Mario, wie man ihn heute kennt, geboren.
„Donkey Kong“ verkaufte sich gut, denn es besitzt eine gute Balance. In Miyamoto's Design verhindert der Schwierigkeitsgrad des Spieles Frustration ebenso wie allzu schnelle Erfolge. (vgl. Lischka 2002: 58f)
Die erste Heimkonsole Nintendo's war 1985 das NES (kurz für: Nintendo Entertainment System). Zielgruppe hierfür waren jüngere Menschen, weswegen Nintendo's Spiele bis heute stets kindlich angehaucht sind: Pilze schießen aus dem Boden, die virtuelle Welt ist bunt, man kann große Münzen einsammeln und zur kindlichen Ästhetik tragen auch heute noch die großen Augen der Spielcharaktere bei. Miyamoto sagte einst, dass es schwieriger wäre Menschen zum Lachen als zum Weinen zu bringen und dass er die Herausforderung darin sähe Spielinhalte mit bestimmten Gefühlen zu beschreiben anstatt auf Gewalt zurückzugreifen. Die Geschichten der Spiele sollten dabei auch nicht allzu komplex sein, was auch wieder für ein junges Zielpublikum spricht.
Dieses Publikum brachte Nintendo auch genug Geld ein: Mit dem dritten Teil von „Super Mario Bros.“ wurden in Japan und den USA bis 2002 440 Millionen Euro umgesetzt. (vgl. Lischka 2002: 59)
Neben dem NES Nintendos kam Sega's Master System auf den Markt. Durch die schnell wechselnden und besser werdenden technischen Standards wurden diese Konsolen, die man an den Fernseher anschließen konnte, bald von ihren neuen Generationen abgelöst: vom Nintendo's „Super NES“ und Sega's „Mega Drive“.
Die Geräte für Zuhause verfügten über immer mehr Speicherkapazität und als Datenträger wurden bald CD-ROMs verwendet. Sony wagte den Markteinstieg hier mit seiner „Playstation“, die ab 1995 verkauft wurde. Nebenher existierte noch Sega's „Saturn-Konsole“. Nintendo zog dieses Mal nach und veröffentlichte seine neue, leistungsstarke Konsole erst ein Jahr später: Der „Nintendo 64“ wurde zum beliebten Heimgerät vieler Menschen. Anders als die Playstation und die Saturn-Konsole nutzte der Nintendo 64 für seine Spielsoftware noch Steckkarten anstatt der neuen CD-ROMs, verfügte aber über mehr Speicherplatz. Dennoch schaffte Nintendo es nicht die populäre Playstation als Marktführer zu verdrängen. Ob deren Erfolg brachte Sony im Jahre 2000 ein Nachfolgemodell auf den Markt: Die „Playstation 2“. (vgl. Fromme/Meder/Vollmer 2000: 7f)
Natürlich blieb die Entwicklung der Spielkonsolen nicht stehen und betrachtet man den heutigen Gaming-Markt, so finden sich viele leistungsstarke Konsolen in den Regalen der Händler. Nach der „Playstation 3“, die 2007 in Europa erschien, kam 2013 die „Playstation 4“ auf den Markt und wurde damit zum Konkurrenten von Microsoft's „Xbox One“, die ein direkter Nachfolger der „Xbox 360“ ist. Auch Nintendo veröffentlichte nach dem Nintendo 64 weitere, technisch fortschrittliche Heimkonsolen: Den „Gamecube“ (2001), die „Wii“ (2006) und die „Wii U“ (2012). Die drei erfolgreichsten dieser Konsolen sind bis dato die drei Playstations (345,28 Mio. verkaufte Exemplare), die Nintendo Wii (101,05 Mio.), die Xbox 360 und das NES (61,91 Mio.). (vgl. Statista 2014: o.S.)
Neben den Konsolen feierten auch Personalcomputer einen erheblichen Fortschritt; sie sind in der heutigen Zeit kaum mehr aus modernen Haushalten wegzudenken. Die Unternehmen, die diese oder einzelne Hardware verkaufen, sind unzählig. Die erfolgreichsten Firmen (nach Marktanteilen) sind zur Zeit Lenovo, Hewlett-Packard, Dell, Acer und Asus. (vgl. Statista 2014: o.S.).
Ein Bereich, den man im Zuge der Geschichte der Videospiele noch beleuchten muss, ist der der Handspielcomputer. Im Jahr 1990 brachte Nintendo den ersten dieser Handheld-Computer auf den Markt: Den „Gameboy“. Dieses Gerät sieht auf den ersten Blick aus wie ein dicker, etwas größerer Taschenrechner mit vier Knöpfen (A, B, Start und Select) und einem Steuerkreuz. Am hinteren, oberen Ende befindet sich ein Steckschlitz für Software-Steckkarten. Hier können die Spielmodule eingesteckt und nach dem Einschalten des Gerätes gespielt werden. Der Gameboy verfügt über einen schwarz-weiß-LCD-Bildschirm (vgl. Lindner/ Wink 2002: 27) und eine Audioausgabe; er wurde 1990 zusammen mit dem monochromen Spiel „Tetris“ herausgegeben. In diesem Paradebeispiel für Computerspiele, das bereits 1984 von Alexei Palischnow entwickelt wurde, muss der/die SpielerIn verschiedene, blockartige Formen so stapeln, dass sie einen durchgehenden Block bilden und sich somit wieder auflösen. Die Blöcke fallen vom oberen Bildschirmrand herab und dies im Spielverlauf immer schneller. Schafft man es nicht die Formen nahtlos ineinander zu fügen, bleiben sie stehen und stapeln sich immer höher. Berühren sie den oberen Bildschirmrand, so hat man das Spiel verloren.
Über ein so genanntes Dialogkabel kann man zwei Gameboys miteinander verbinden und Spiele wie Tetris zusammen oder gegeneinander spielen. (vgl. Lindner/ Wink 2002: 27)
Der Nachfolger des Gameboys war der „Gameboy Color“, der 1998 auf den Markt kam. Sein Name lässt bereits vermuten, dass diese Handheld-Konsole die erste war, auf der man Spiele in Farbe spielen konnte. Kein Handspielcomputer anderer Unternehmen (zum Beispiel Sega's „Game Gear“)
konnte es mit dem Gameboy Color aufnehmen. Auch hier kam der technische Fortschritt wieder zum Ausdruck. Im Vergleich zu den Vorgängergeräten der genannten Handheld-Konsolen, den Card-Games, die Anfang der 80er Jahre verkauft wurden, war die Entwicklung zu den Geräten mit Steckplätzen ein großer Sprung. Bei Card-Games handelte sich nämlich um Geräte, in deren Mechanik die Spiele integriert werden. Sie konnten also nicht ausgewechselt werden. Card-Games besaßen, wie die neueren Handheld-Geräte, ebenfalls LCD-Bildschirme in schwarz-weiß und wurden mit Batterien betrieben. Sie waren ein guter und günstiger Einstieg in die Computerspielewelt. (vgl. Dittler 1997: 19)
Neben den aktuellen Heimkonsolen stellen heute auch Handheld-Geräte noch wichtige Medien dar. Dabei zu nennen sind der Gameboy-Nachfolger „Nintendo DS“ (Ein aufklappbares Gerät mit zwei Bildschirmen, Touchscreen, drahtlosem Empfänger für WLAN oder eine lokale Verbindung und einem Farbbildschirm.), der „Nintendo 3DS“ (Der Nintendo DS mit 3D-Funktion. Man kann also Spiele in 3D spielen.) und deren Konkurrenten Sonys namens „Playstation Portable“ und die neue „Playstation Vita“, die den technisch hoch entwickelten Handspielkonsolen Nintendos in nichts nach stehen.
Zudem kommen hier nun auch Smartphones und Tablets ins Spiel. Auch auf ihnen wird heutzutage viel „gezockt“; unter anderem gibt es für sie alte Spieleklassiker zum Download. Spielte man das monochrome Tetris vor 30 Jahren auf dem Gameboy, so finden sich heute unzählige, bunte und kreative Varianten dieses Games. Und das nicht nur kostenpflichtig für Handheld-Geräte, Konsolen, PCs oder Mobilgeräte. Auch andere alte Computerspiele sind zuweilen als gratis Apps verfügbar. Gibt man in der Google Bildersuche beispielsweise „Atari Breakout“ ein, so wird das Ergebnis der Suche zu verschieden, farbigen Blöcken zusammen gesetzt und man kann Breakout direkt im Browser, auf der Google-Bildersuchseite, spielen. Das Spielprinzip dieses Games ist ähnlich dem von „Pong“: Man muss mithilfe eines Schlägers einen Ball über das Spielfeld bewegen und bute Blöcke kaputt schießen. Ein Spielklassiker und eine damalige Innovation im Bereich der Videospiele wurde damit zu einem unterhaltsamen Gag des Google-Konzerns.
Rückblickend auf die geschichtliche Entwicklung der Computerspiele kann man zusammenfassend sagen: Spiele hatten Startschwierigkeiten, denn Computer waren teuer und die neue Technik in ihren Anfängen abschreckend. Es war nicht natürlich, dass man in Haushalten technische Geräte fand und so wurden erste Konsolen so designed, dass sie aussahen wie Einrichtungsgegenstände. Spielautomaten in Spielhallen erfreuten sich zunächst größerer Beliebtheit, denn sie waren billiger. Erst später wurde der Personalcomputer als Massenmedium auf den Markt gebracht und zusammen mit Handheld- und stationären Konsolen löste er die Spielautomaten ab. Die technische Entwicklung und der ständige Fortschritt in der Computerspielentwicklung trugen dazu bei, dass aus monochromen, verpixelten und einfachen Games komplexe, grafisch nahezu fotorealistische Videospiele mit packenden Geschichten wurden, die auch wegen ihrer Audioqualität an Filme erinnern. Aus simplen Geräten wurden Maschinen mit enorm hohen Speicherkapazitäten und Leistungsstärken. Moderne Gaming-PCs der gehobenen Preisklasse verfügen über etwa 16 Gigabyte Arbeitsspeicher und bis zu über einen Terrabyte Datenspeicher. Mit Taktfrequenzen von etwa 4,2 Gigahertz (vgl. Hightech-gamer 2014: o.S.) wirken sie gegen die, zu Anfang beschriebene Konsole, Atari's VCS mit vier Kilobytes Daten- und mit 138 Bytes Arbeitsspeicher und 1,19 Megahertz Taktfrequenz, wie protzige Technik-Giganten. Doch heute sind sie dies nicht. Denn neueste High-Tech ist für viele Menschen Norm im heimischen Wohn- und Arbeitszimmer:
Nahezu jeder Haushalt ist heute mit einem Computer, oder zumindest einem Laptop oder Netbook, ausgestattet. 76% der Haushalte besitzen eine feste, 59% eine tragbare Spielkonsole. (vgl. JIM-Studie 2013: 6).
1.3 Gesellschaft und virtuelle Welten
Als soziales und kommunikatives Wesen schloss sich der Mensch schon seit jeher gerne mit Gruppen oder mindestens einer anderen Person zusammen. Dies erkannte schon Aristoteles, als er den Menschen als „zoon politikon“ bezeichnete.
„Niemand führt alleine Kriege oder zettelt einsam Revolutionen an, und Kinder werden nicht von einer einzelnen Person gezeugt.“ (Schmitz 2007: 11)
Videospiele sind hinsichtlich dessen keine Ausnahme. Und darum scharten sich schon in den 70er Jahren Menschentrauben um Leute, die alleine vor Spielautomaten standen und Pong spielten. Nacheinander lieferten sie sich Pong-Duelle und den ZuschauernInnen ein spannendes Spektakel. 1978 realisierte dies auch der britische Student Roy Trubshaw und fragte sich im Zuge dessen, wie es wohl wäre, wenn sich hunderte SpielerInnen zusammen schlossen, um gemeinsam zu spielen. Der Mann kam in Kontakt mit „Zork“ und „ADVENT“, zwei textbasierten Spielen, und erkannte, dass man über einen Kniff viele Menschen gleichzeitig auf Datenbanken seiner Universität zugreifen lassen kann. Die allererste Idee für Games mit Mehrspielermodus war geboren und sollte bald noch weiter ausgereift sein. Zusammen mit einem Mitstudent arbeitete Trubshaw bald an einem kompletten Mehrspieler-Adventure namens „Multi-User-Dungeon“ (kurz: MUD1). Trubshaw programmierte hierbei nahezu ausschließlich und kümmerte sich um die Technik, während sich sein Kollege Bartle der Geschichte hinter dem Spiel widmete. Er war „Dungeons & Dragons“-Kenner und gab MUD1 eine prägende Fantasy-Ausrichtung, die an Herr der Ringe erinnert. In dem besagten Urvater der Online-Rollenspiele lenkte man eine Figur durch eine Fantasiewelt und dies rein textbasiert. Das heißt: Es gab keine Grafiken, sondern nur Text, mit dem man interagieren konnte. Von heutigen Computerspielen ist man es gewohnt etwa auf eine Wasserflasche zu klicken, damit der Avatar, den man steuert, daraus trinkt. Damals, im MUD1, war dafür eine Texteingabe wie „drink water“ nötig.
Das Spielprinzip und die Geschichte von MUD1 waren einfach: Man musste böse Monster töten, Gegenstände sammeln und man war der glorreiche Held des Spieles.
MUD1 wurrde zunächst nur über Universitätsnetzwerke gespielt, denn das Internet, wie man es heute kennt, existierte noch nicht. Trotz dieses Unterschiedes fällt es auf, wie viele Gemeinsamkeiten die Multi-User-Dungeons mit den heutigen, populären Online-Rollenspielen aufweisen. Wie in den modernen Games musste man nämlich 1980 schon in Gruppen in fantasievollen Weiten oder Höhlen umherziehen, um miteinander zu kämpfen und sogenannte Quests (Aufgaben) abzuschließen. Auch wurde zwischen Mehrspieler und Einzelspieler unterschieden: man konnte sich aussuchen, ob man die Geschichte alleine oder mit anderen Personen zusammen erleben möchte. Wobei anzumerken ist, dass es Missionen gab, die man alleine nur schwer oder gar nicht schaffen konnte. Diese waren darauf ausgelegt, dass man sie in einer Gruppe spielte. Auch gehörte das Sammeln von Erfahrungspunkten (das sogenannte „Leveln“) zu den MUDs dazu. Wie auch heute war dies nötig, um seinen anfänglich schwachen Charakter zu verbessern und ihn mit neuen Fähigkeiten auszustatten.
Neben dem Spielen in Gruppen bildeten sich damals schon Gilden. Solche Gilden (oder auch: Clans) fungieren wie Familienzusammenschlüsse in den virtuellen Welten. Sie haben festgelegte Hierarchien und Rollenverteilungen: Es gibt zumeist ein Oberhaupt, StellvertreterInnen und normale MitgliederInnen. Neben dieser Aufgabenverteilung, die den Ausbau eines Charakters unterstützte, kam es auch vor, dass eine Gilde auch die Ausrichtung und Gesinnung einer Spielfigur mitbestimmte. Diese Möglichkeit begegnet einem heute noch nahezu standardmäßig, wenn man an (Online-)Rollenspiele denkt, nämlich als Klassenwahl und ähnliches. (vgl. Schmitz 2007: 11f)
Die Entwicklung der Computerspiele wurde stets vorangetrieben. Die Grafiken wurden beispielsweise besser und dies auch im Bezug auf die MUDs, die im Laufe der Jahre weltweit viele Nachahmer gefunden hatten. Einen ersten Meilenstein in der Verbesserung der Optik der Multiplayer-Spiele setzte 1984 „Island of Kesmai“, das die virtuelle Umgebung via ASCII-Grafik umsetzte und das man über CompuServe, einen Kommunikationsnetzwerkdienst, spielen konnte. Und es waren nicht nur die Bilder, die dieses Game besonders machten, denn Island of Kesmai war das erste Multiplayer-Spiel, für das man Gebühren zahlen musste: wer über ein langsames 300-Baud-Modem spielte, zahlte 6 Dollar die Stunde. SpielerInnen mit einem schnellen 1200-Baud-Modem 12 Dollar. Unglaublich hohe Preise, wenn man an den heutigen Onlinespielemarkt denkt. Für ein Abonnement bei „Star Wars: The old Republic“ zahlt man heutzutage und je nach Abo-Variante zwischen 10,99 und 12,99 Euro im Monat (vgl. SWTOR Markt 2014: o.S.).
Ein weiterer Sprung geschah 1988 mit dem Game „Habitat“. Es bediente sich anstatt der ASCII-Grafik einer Art Bildergrafik und konnte über den Netzwerkanbieter Q-Link gespielt werden. Das Besondere hierbei war, dass SpielerInnen über Q-Link und ihren Commodore 64 miteinander verbunden wurden und somit über einen Zentralserver, der Daten speicherte, zusammen spielen konnten. Trotz der neuen, herausragenden optischen Präsentation passierte das Spielgeschehen aber nach wie vor zumeist über Text. Ein sehr wichtiger Punkt bei Habitat war nun erstmalig, dass man seine gesteuerte Figur, den Avatar, nicht nur gestalten und lenken konnte, sondern dass man ihn auch am Bildschirm sah. Dies machte nicht nur die Interaktion mit anderen leichter sondern erleichterte auch das Handeln in der virtuellen Welt.
Vollendet wurde die Entwicklung zum grafischen Onlinespiel mit dem Titel „Neverwinter Nights“. Dieses Spiel erschien 1991 bei AOL und im Gegensatz zu seinen Vorgängern war das Spielgeschehen rein grafischer Natur.
Nach Neverwinter Nights kamen noch einige andere Mehrspieler-Online-Rollenspiele auf den Markt. Was jedoch noch immer bestand waren wie horrenden Stundenpreise als Nutzungsgebühr. Dies änderte sich im Laufe der Jahre nicht; erst mit der Ausbreitung des freien Internets konnten SpieleentwicklerInnen ihre Games für die Allgemeinheit schreiben und nicht nur für spezifische Nutzergruppen von Netzwerkanbietern. Ein wichtiger Grundstein für den kommenden Boom der Onlinerollenspiele war damit gelegt worden. 1996 erschien der erste große Titel für Internet-Onlinespiele: „Meridian 59“. Meridian 59 führte nun viele Neuerungen ein, die man bis heute von Onlinegames kennt: Monatliche Kosten statt Stundengebühr und eine ungewohnt realistische 3D-Grafik. Hiermit war die Ära der MMORPGs (kurz für: Massive Multiplayer Online RolePlayGame) eingeläutet worden.
Weitere Neuerungen im Gebiet der Onlinerollenspiele für die Massen bot Origin's und Electronic Arts' Titel „Ultima Online“. Mitte 1997 meldete man dabei bereits 100.000 AbeonnentenInnen und in guten Zeiten erreichte das Spiel gar 250.000 SpielerInnen gleichzeitig. Neuartige Impulse waren nun das Prinzip sich ingame Häuser kaufen und bauen zu können (was eine große soziale Komponente darstellte), ein Crafting-System, mit dem man Rohstoffe zu diversen Gegenständen verarbeiten konnte und ein Einkaufs- und Verkaufssystem, das einem realen Wirtschaftssystem glich. Nach dem Prinzip des Angebots und der Nachfrage konnten SpielerInnen Gegenstände im Spiel verkaufen oder einkaufen. Dies stellte, neben der Möglichkeit zu Leveln, ein großes Motivationsfeld dar. Auch war es in Ultima Online eine Herausforderung gegen andere UserInnen zu kämpfen oder sich zu verteidigen, wenn man von einem/r anderen SpielerIn angegriffen wurde.(vgl. Schmitz 2007: 13f)
Wie Ultima Online war auch Verant Interactive's „EverQuest“, das 1999 am westlichen Markt erschien, ein großer Erfolg. Dieses Spiel besaß ebenso eine 3D-Grafik, Spielinteraktion und eine persistente Spielewelt. Zudem konnte man sich auch wieder in Gruppen zusammenschließen, um Quests zu erledigen. Dies konnte in kleineren Teams von bis zu sechs Avataren oder auch in großen Armeen von bis zu 72 SpielernInnen geschehen. Mit Zweiterem waren die „Raids“ geboren: Anspruchsvolle Missionen, die nur mit hoher Spieleranzahl zu schaffen sind und in denen sich der Kampfschwerpunkt auf Taktik verlagert. Diese Taktiken waren anfänglich nicht immer die besten und die SpielerInnen mussten die Schwachstellen der Endgegner erst herausfinden, was dazu führte, dass man manche Raids ab und an auch öfter als einmal spielen musste, um sie zu bewältigen. Wie bei Ultima Online spielte auch bei EverQuest das Craften eine große Rolle: UserInnen konnten aus gesammelten Gegenständen neue Items herstellen und verkaufen. Dieser Verkauf beschränkte sich mit der Zeit nicht nur auf den ingame-Verkauf (also den Verkauf im Spiel und mit Spielwährung als Zahlungsmittel), sondern viele UserInnen verkauften Spielgegenstände gegen echtes Geld. Es entstand der Trend Items, und sogar Charaktere oder Accounts, über Auktionshäuser wie eBay zu verkaufen. Der Enwickler des Games forderte eBay dazu auf sämtliche dieser Auktionen zu löschen, doch dies tat dem Handel keinen Abbruch. Noch heute verkaufen SpielerInnen Spielinhalte gegen echtes Geld.
Was mit EverQuest auch zum ersten Mal aufkam war die Onlinespielsucht. In Anlehnung an eine Droge bekam das Game den Spitznamen „EverCrack“ und bisweilen zerbrachen sogar Ehen an diesem MMORPG. An die Spitze trieb ein 21-Jähriger seine Sucht: Er wählte, nachdem ihm im Spiel Geld gestohlen worden war, den Freitod. (vgl. Schmitz 2007: 16f)
Die öffentliche Aufmerksamkeit rund um die MMORPGs und der Erfolg von Ultima Online und EverQuest zeigten, dass sich das neue Genre der Onlinegames auf dem besten Wege befand und tatsächlich erfreuen sich diese Spiele auch heute noch reger Beliebtheit. Drei der bekanntesten MMORPGs mit mehreren Millionen SpielernInnen in ihren virtuellen Welten sind „World of Warcraft“, „Guild Wars 2“ und „Star Wars: The old Republic“.
1.3.1 Strukturebenen virtueller Welten
Thomas Fuchs nannte im Zug mit den virtuellen Welten einen Begriff: „Disbodiment“, also die Entkörperung der Erfahrungen. Die These der Entkörperung besagt, dass unmittelbare Erfahrungen durch vermittelte ersetzt werden. Das heißt, dass intermodale, also durch mehrere Sinne gebildete Wahrnehmungen oder Empfindungen, reduziert werden. Ebenso verringert wird die interaktive Auseinandersetzung mit der Realität. Die Wahrnehmung und Bewegung als Basis der Realitätserfahrung reduziert sich auf ein Minimum; Im Fall der digitalen Umgebungen auf Knopfdrücke oder Mausklicks. Die Entdeckung der Welt, so Fuchs, geschähe heute über das Internet; Leibliche Erfahrungen werden ersetzt von Telepräsenz. Er sagt:
„Im virtuellen Raum sind wir nicht länger Gefangene unseres Körpers, müssen wir nicht mehr den Ort verlassen, um woanders zu sein.“ (Fuchs 2010: 64)
Er bezeichnet virtuelle Welten als mediale Vorspielungen unmittelbarer Realität und schreibt Medien die Rolle von „Mittlern“ zwischen EmpfängerIn und einer entfernten Wirklichkeit zu. Gleichauf kann man zwischen dieser und Abbild oder Fiktion kaum mehr unterscheiden; Es entsteht ein Zwischending zwischen Schein und Sein, das in der virtuellen Realität und im Cyberspace um eine weitere Illusion gesteigert wird: Um die der Wechselwirkung. Diese Wirkung beschreibt die unmittelbare, leibliche Verbindung mit dem elektronisch produzierten Bild. Der Mensch ist damit nicht mehr nur bloßer Zuschauer (wie etwa jemand, der fernsieht), sondern ein/e AnwenderIn, der/die symbiotisch mit der Illusion verbunden ist. Dies produziert eine nahezu magische Wirkung des eigenen Tuns. Das Medium zieht den/die UserIn in eine neue, virtuelle Realität. Und die betroffene Person, so Fuchs, würde dadurch so weit „infantilisiert“, dass sie das Bild am Monitor als unmittelbare Wirklichkeit erlebe. (vgl. Fuchs 2010: 63ff)
Ein sehr kritischer Standpunkt, den nicht jeder in dieser Form mit ihm teilt. Benjamin Jörissen, zum Beispiel, erkennt in den virtuellen Welten keine Umgebungen, die den/die SpielerIn infantilisiert, sondern zeigt Entwicklungsmöglichkeiten auf: Für ihn steht die Frage im Raum ob und inwiefern Strukturelemente virtueller Welten Potenziale für Prozesse der Identitätsfindung und -transformation, für den Aufbau von Orientierungswissen, mithin für das Reflexivwerden des eigenen Welt- und Selbstbildes bieten. Denn virtuelle Welten sind in sich hoch komplexe Gebilde und weit mehr als bloße Spielereien. Vom sozialen Standpunkt her sind sie absolut wichtig, denn in ihnen treffen sich unzählige und unterschiedlichste TeilnehmerInnen sozialer, ethischer und kultureller Kontexte. Manche MMORPGs werden global bespielt und so könnten soziale Begegnungen in ihnen nicht vielfältiger sein. In Form von Avataren (Spielfiguren) geben sich Menschen hier eine (oder auch mehrere) Identität(en), lernen einander kennen, schließen Freundschaften (die manchmal sogar jahrelang bestehen), bilden Gruppen und Gilden, kommunizieren auf unterschiedlichste Weise, spielen zusammen, kooperieren miteinander und machen im Zuge dessen oft neue persönliche und soziale Erfahrungen. Diese Erfahrungen prägen den Menschen und bringen ihn dazu zu reflektieren.
Betrachtet man virtuelle Welten nun, so fällt auf, dass sie besondere Arten von Onlinecommunities sind. In soziografischer Hinsicht sind sie soziale Gefüge, die sich aus Öffentlichkeit und privaten Räumen zusammensetzen und zur Kommunikation und Interaktion genutzt werden. Nur sind virtuelle Welten dermaßen komplex, dass man sie nicht nur mit einfachen Merkmalen klassischer Onlinecommunities beschreiben kann. Denn damit würde man sie reduzieren.
Um virtuelle Welten also besser verstehen und kategorisieren zu können, hat Jörissen sie in drei Strukturebenen beschrieben:
- Die virtuelle Umgebung
- Die Avatar-Technologie
- Die Community-Umgebung und -Funktionalität
Diese Ebenen sollen auf den folgenden Seiten näher beleuchtet werden. Anzumerken ist hierbei noch, dass man Avatare, die sich in den besagten Welten aufhalten, analytisch von ihrer digitalen „Heimat“ zu trennen sind. Denn Avatare findet man nicht nur in etwa Onlinespielen und ähnlichem, sondern auch außerhalb virtueller Welten (zum Beispiel in Web-Browsern oder Nachrichtendiensten). (vgl. Jörissen 2009: 120ff)
- Strukturebene 1: Die virtuelle Umgebung
Diese Ebene fasst alles zusammen, was mit dem, vom/von der SpielerIn gesteuerten, Avatar in Verbindung steht. Also den gesamten, optischen, programmierten Inhalt der virtuellen Welt. Dazu zählen beispielsweise Räume, Gegenstände, Objektaktionen, die Gestaltung der Welt und so weiter. Die Strukturebene 1 beschreibt auch den Grad des lebendigen Geschehens in einem Spielsetting: Je glaubwürdiger und intensiver eine digitale Umgebung ein lebendiges Geschehen darstellt, desto größer ist die Möglichkeit der sozialen Perspektivenübernahme und des persönlichen Involvements. Denn der Mensch kann dies nur empfinden, wenn sich die Umgebung online tatsächlich „echt“ anfühlt. Mit diesen Faktoren hängt des weiteren und unter anderem auch das soziale Lernen zusammen.
Zur virtuellen Umgebung gehören Aspekte wie die soziale Bühne, auf der das Online-Geschehen stattfindet, die situative Rahmung der Welt, die Perspektiven der NutzerInnen, Regeln, Werte, Normen oder die einzelnen Charaktere der jeweiligen Welt. Auch die grafische Umsetzung ist hier ein essentieller Punkt. Es ist anzumerken, dass diese dazu beiträgt, wie sich ein/e SpielerIn mit seiner/ihrer Spielfigur identifiziert. Wird in 2D gespielt, so schauen die UserInnen auf einen isometrischen Raum oder eine Fläche; diese Perspektive erinnert an Puppenstuben. Die SpielerInnen bewegen sich hier nicht mit den Avataren und werden damit von ihnen dissoziiert. Dies ist bei 3D-Welten etwas anders: Hier kann man oft zwischen der „Third-Person“-Ansicht (einer Ansicht, bei der man seiner Spielfigur über die Schulter sieht oder es so anmutet, als fliege man ihr hinterher) und einer „First-Person“-Ansicht (Die Ego-Perspektive aus der Sicht des Avatars) wählen oder wechseln. Die Third-Person-Perspektive erzeugt eine gewisse Distanz zum Avatar, denn man hat diese Figur bei jeder Spielaktion, die man tätigt, im Blickfeld. Dies entweder zum Teil oder ganz. Gleichzeitig ermöglicht die genannte Sicht eine stärkere Identifikation mit den Aktionen, die man setzt, denn diese sind schließlich vom/von der UserIn initiiert.
Im Großen und Ganzen gibt es nun also verschiedene Arten von grafischer Gestaltung virtueller Welten. Kategorisiert man sie knapp in zwei Arten, dann gibt es folgende: Comicähnliche Gestaltungen oder eine naturalistische Ästhetik. Die digitalen Umgebungen haben verschiedene Dimensionen, Schatten- und Lichtverhältnisse, Farbgebungen, Atmosphären, Designs, Perspektiven und so weiter. Ihre Darstellungscharaktere sind sehr wichtig dafür, wie man sie und ihre Inhalte erfährt.
Auch Interface-Elemente zählen zu den virtuellen Umgebungen und sind für diese und die Koordination im Spiel unabdingbar. Sie sind Schnittstellen mit körperlichen Aktionen des/der SpielersIn; also der Anschluss des Leibes an die digitale Sphäre. (vgl. Jörissen 2009: 122-126)
- Strukturebene 2: Avatare
Einleitend zu der Thematik der Spielfiguren ist zu erwähnen, dass Menschen Identitäten heutzutage konstruieren, anstatt sie zu suchen oder zu erringen. In der modernen Gesellschaft, in der permanente Flexibilität und Erreichbarkeit eine große Rolle spielen, fällt dies schließlich leichter. Der globalisierte Kapitalismus erschwert somit vielen die Ausbildung der traditionellen innengeleiteten Identität und Autonomie. Als Resultat dessen tritt an die Stelle der Konstanz klassischer, bürgerlicher Existenzen der „flexible Charakter“, wie ihn Richard Sennet bereits 1998 beschrieben hat. Zu den konstruierten Identitäten gehören nun, wie bereits erwähnt, Avatare. In der hinduistischen Mythologie waren Avatare eine Bezeichnung für verkörperte Gottwesen. Diese Götter stiegen in Tiergestalten auf die Erde herab. Heute sind Avatare nicht mehr Repräsentanten von Göttern sondern Stellvertreter des Selbst auf dem Bildschirm und in virtuellen Welten. Sie sind Darstellungen der eigenen Identität(en) und daneben auch Masken, die, je nach Kontext, angelegt werden können. Das ohne Risiko, dahinter erkannt zu werden. (vgl. Fuchs 2010: 68f)
a) Präsentationsstruktur
Die Präsentationsstruktur beschreibt die visuellen Erscheinungsformen der Avatare der UserInnen. Hier geht es um die Optik der Spielfigur, unabhängig derer Bewegungen oder Handlungen. Zu unterscheiden ist, nach Jörissen, nun zwischen folgenden Begriffen, die im Bezug auf das Aussehen eines Charakters eine Rolle spielen:
- Grundformen: Diese sind frei wählbare, grundlegende Formen. Wie etwa die Beschränkung auf menschliche, humanoide oder tierische Avatare. Es gibt Games, bei denen man nur in menschlicher Form spielen kann. Das MMORPG Star Wars: The old Republic bietet im Gegenzug dazu, und neben den Menschen, auch außerirdische Spezies.
- Gestaltungsparameter: Zu diesen Parametern gehören Augenform, Frisur, Geschlecht, Altersmerkmale, Kleidung, Gesichtsformen und so weiter. In vielen Spielen ist es möglich den Avatar zu Anfang des Games mithilfe dieser Optionen zu gestalten. Manchmal ist es jedoch auch üblich, dass man zwischen vorgefertigten Avataren, die man nicht weiter oder nur begrenzt anpassen kann, entscheiden muss.
- Freiheitsgrade der Gestaltung: Damit ist die Feinanpassung eines Charakters gemeint. Oftmals kann man mittels Schieberegler die Breite des Gesichtes, die Tiefe von Gesichtsfalten, die Größe der Nase oder die Haarfarbe einstellen. Weitere Optionen hierbei sind unzählig und variieren von Spiel zu Spiel. Sie ermöglichen es aber in allen Fällen die Optik des Avatars noch genauer und nach eigenen Wünschen anzupassen. Eines der Paradebeispiele für eine enorme Freiheit bei der Anpassung des Avatars ist das Spiel „Dragon Age: Inquisition“: Hier ist es über unglaublich viele Optionen möglich einen Charakter nahezu so aussehen zu lassen, als wäre er der Zwilling des/der SpielersIn, der/die ihn lenkt.
Bei der Charaktererstellung besteht weiters (und zumeist) eine zweigeschlechtliche Norm; man kann zwischen „männlich“ und „weiblich“ wählen, nicht aber zwischen weiteren Geschlechtern oder geschlechtslosen Spielfiguren. (vgl. Jörissen 2009: 126-129)
Zusammenfassend kann man nun sagen: In den meisten Online- wie Offline-Videospielen ist es zu den Anfängen der Spielgeschichte möglich einen Avatar nach eigenen Vorstellungen zu erstellen (Manchmal besteht die Option dazu auch während dem Spielverlauf. Wie etwa in „Dragon Age 2“ durch eine kostenpflichtige Erweiterung). Die Möglichkeiten dazu variieren, je nach Spiel, stark: In manchen Games kann man lediglich zwischen wenigen vorgefertigten Charakteren wählen und in anderen ist es wiederum möglich bis zu der Höhe der Stirn oder dem Abstand der Augen jede optische Kleinigkeit des Spielcharakters festzulegen. In manchen Games werden durch eine kostenpflichtige Mitgliedschaft weitere Anpassungsoptionen bereitgestellt; man muss also zahlen, um einen Avatar detailreicher und genauer bearbeiten zu können. Diese Gestaltungsmöglichkeiten ermöglichen unter anderem Ausdrücke kultureller, sozialer, ethischer oder politischer Zugehörigkeiten. Accessoires, die einer Subkultur zuordenbar sind, sind oft ebenso vorhanden wie die Möglichkeiten Generationszugehörigkeiten oder die Zugehörigkeit zu einer Fanszene darzustellen. Auch ist es möglich einen Avatar bewusst unattraktiv zu gestalten und dass Männer Frauen spielen oder vice versa ist nicht unüblich. Doch dazu folgt etwas später mehr.
b) Interaktionsstruktur
„Statt mit Personen und konkreten Situationen interagieren wir immer häufiger mit Bildern und Symbolen. Wir werden von automatischen Ansagern bedient, von unserem Computer begrüßt, und Apparate ersetzen die leibliche Begegnung. Ebenso nutzen wir selbst immer öfter die Gelegenheit, hinter Doubles zu verschwinden.“ (Fuchs 2010: 66)
Bei der Interaktionsstruktur geht es um die Effekte, die Aktionen des/der BenutzersIn in der Interaktion mit Objekten der digitalen Umgebung haben. Das heißt: Dass die Handlungen des/der SpielersIn mit den interaktiven Algorithmen programmierter, digitaler Dinge (zum Beispiel mit den Körperteilen des Avatars und so weiter) interagieren. Neben diesem gezielten Handeln und Interagieren durch den/die NutzerIn, gibt es auch automatische Aktionen, die komplex programmierte Avatare und Objekte ausführen können. Man kann, da beides der Fall ist und die Algorithmen nie vollständig vom/von der SpielerIn oder dem Spiel selbst gesteuert werden, vom hybriden Akteur sprechen. Diese Aspekte sind dabei zu unterscheiden, so Jörissen:
- Handlungsinitiation und -kontrolle: Es wird unterschieden, ob Handlungen vom/von der SpielerIn kontrolliert (also manuell und durch einen Tastaturbefehl gesteuert), hybrid gesteuert (halbautomatisch oder indirekt induziert) oder algorithmeninduziert (vollautomatisch) passieren.
- Verbale Interaktionsoptionen: Bei Onlinespielen ist es üblich, dass die Kommunikation durch Sprachausgabe oder Text-Chat funktioniert. Auch sind heute oftmals Voice-Chats vorhanden. Beim Voice-Chat ist zu unterscheiden, ob die Kommunikation über den Avatar geschieht (zum Beispiel mittels Sprechblase oder entsprechenden Sprechbewegungen des Avatars) oder ob charakterunabhängig über das (Spiel-)Interface gesprochen wird (zum Beispiel via Skype, Teamspeak oder angebundene Chatfenster). Der verbale Interaktionsaspekt ist für die Präsenzstruktur natürlich von Bedeutung.
- Nonverbale Interaktionsoptionen: Hierzu zählen explizite Gesten des Avatars (zum Beispiel Körperhaltungen, Mimik, Blicke, Gestik und so weiter), Bewegungen (wie Tanzen, Hüpfen, Schwimmen, Fliegen etc.) und räumliche Bewegungsmöglichkeiten (durch etwaige Veränderung der Avatarposition im digitalen Bildraum. Zum Beispiel gibt es hierbei die Teilnahme des Charakters an szenischen Arrangements wie Ingame-Hochzeiten, Gruppentänzen und dergleichen). Zu beachten ist auch, ob es im Spiel möglich ist mit anderen Avataren oder Objekten zu kollidieren oder ob dies in der Programmierung nicht vorhergesehen ist.
Noch einmal hervorzuheben ist: Kommunikation, Gesten und Bewegungen aller Art spielen für den Avatar in der virtuellen Umgebung eine sehr wichtige Rolle. Sie stehen für die Art der kultivierten Sozialität im Spiel. (vgl. Jörissen 2009: 129-132)
c) Präsenz und Kopräsenz
Die Präsenz beschreibt inwiefern man sich in einer virtuellen Umgebung präsent fühlt. Relevant dafür sind die visuelle Gestaltung, die Perspektive, die Art des Interfaces und die Qualität der Dichte der Handlungsoptionen. Die Kopräsenz steht wiederum dafür, wie sehr sich die Erfahrung einstellt, dass man zusammen mit anderen Personen an einem Ort ist. Dies hängt von Interaktivität und persönlichem Involvement ab; sowie von der nonverbalen Kommunikation und gewissen Eingebundenheitsgefühlen.
Es geht hier um appräsente Körpererfahrungen und Entgrenzungserfahrungen; Um transformierte Präsenz hinsichtlich Raum und Zeit, sowie um Erfahrungen sozialer Präsenz im Umgang mit anderen SpielernInnen. Es geht in einem gewissen Sinn um eine experimentelle Neuentdeckung des eigenen Körpers. Man kann im Zuge dessen und aufgrund des komplexen Charakters von Avataren nicht von einem Subjekt-Objekt-Schematismus sprechen, wenn man das Verhältnis zwischen SpielerIn und Avatar betrachtet. Diese Annahme gleiche zu sehr dem Modell eines Marionettenspielers. Und dies ist ein UserIn beim Spielen in virtuellen Welten nicht. Es geht vielmehr um eine hybride Subjektivität. Der Avatar verkörpert in verschiedenster Art und Weise und auch Ausprägung den/die SpielerIn, der/die ihn lenkt; Er ist somit eine Verlängerung des eigenen Körpers und nicht ein davon abgesondertes Objekt.
Folgendes ist im Bezug auf die Präsenz nun deutlich: Je höher die Avatar-Technologie ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass neue Selbsterfahrungsräume eröffnet werden. Die Präsenz korrespondiert in MMORPGs mit einer sozialen Kopräsenz, also der Möglichkeit des Erfahrens eines artikulierten Anderen. Durch dieses werden Gesten und ähnliches in einem virtuellen Raum erst wirksam. (vgl. Jörissen 2009: 133-136)
- Strukturebene 3: Communityfunktionen
Jörissen bezieht sich in der dritten Ebene auf Marotzki (2003) und unterteilt die Communityfunktionen virtueller Welten in sieben online-ethnografische Strukturmerkmale:
- Leitmetapher: Die Kommunikation in Onlinecommunities folgte schon früher gewissen Leitmetaphern, die Navigationsstruktur, Interaktions- und Kommunikationsmöglichkeiten versinnbildlicht darstellten (zum Beispiel „Cybercafe“ für einen Chatraum). In virtuellen Welten kann dieser Punkt angemessen behandelt werden, obwohl Leitmetaphern sonst nur mehr selten Einsatz finden: Die Rahmungsfunktion, die in der Strukturebene 1 erwähnt wurde, findet in diesem Sinn Einsatz.
- Soziografische Struktur: Diese Struktur umfasst Zugangsbedingungen und -prozeduren (Die Anmeldung und die Bedingungen dafür), Regelwerke, Statussysteme (zahlende MitgliederInnen, nicht Zahlende und so weiter), Gratifikationen und Sanktionen, Freundschaftslisten, Blacklist-Systeme oder Gruppen. Diese Merkmale bestimmen soziale Beziehungen, unter anderem in virtuellen Umgebungen, mit und sind wichtig für die Identifikation. Nimmt man als Beispiel etwa eine Community mit anonymen Zugang her, so wird diese nicht so „ernst“ genommen wie eine, bei der man sich verbindlich anmelden muss.
- Partizipationsstruktur: Onlineumgebungen sind vom Mitwirken der MitgliederInnen abhängig. Ohne sie könnten sie nicht existieren. Verschiedene Grade an Verpflichtung und Eingebundenheit gehen mit diesen Strukturen einher und sind in jeder Community anders. Neulinge haben zum Beispiel weniger Mitbestimmungsrecht als langjährige MigliederInnen oder AdministratorenInnen einer digitalen Umgebung.
- Kommunikationsstruktur: Diese Struktur beinhaltet die Kommunikationsdienste einer Community. Diese können „one-to-one“ (also unter zwei KommunikationspartnernInnen) oder „many-to-many“ (zum Beispiel in Form von Foren, Chats, Mailinglisten etc.) sein. Denkt man an virtuelle Welten, so ist die Kommunikation stark über den Avatar oder das Spielinterface organisiert. Zudem gibt es zu Spielen des Öfteren eigene Webseiten mit Foren, Mailinglisten oder Chatsystemen.
- Informationsstruktur: Newsletter, Datenbanken, Info-Mails, thematische Linksammlungen und ähnliche Medieninhalte gehören zu dieser Struktur. In einer Community befinden sich zumeist MitgliederInnen mit selben Interessen, die relevante Informationen zu einem gewissen Thema bekommen (sollen). Für virtuelle Welten ist dies wichtig, denn es werden unter anderem gewisse Online-Veranstaltungen ausgeschrieben und Events geplant. Für eine hohe Partizipation an selbigen ist es wichtig, dass die Informationen darüber möglichst viele UserInnen erreichen. Auch Tutorial-Videos und Wikis gehören zu der Informationsstruktur. Besonders Neulinge greifen auf diese zurück, um einen Einstieg in ein Spiel und etwas Orientierung zu finden.
- Präsentationsstruktur: Hierbei geht es um Identitätsmanagement und die Präsentation nach außen. Die Möglichkeiten für MitgliederInnen sich selbst zu präsentieren gehören zu dieser Struktur. Sie können für jeden einzeln verfügbar, aber auch für Gruppen, die sich als eben diese repräsentieren wollen, wichtig sein. In virtuellen Welten ist die Spielfigur das vermeintlich wichtigste Werkzeug für Präsentation und Sinnbild der Identität des/der betroffenen SpielersIn.
- Verhältnis Online-Offline: Es ist heutzutage üblich, dass sich MitgliederInnen einer Community auch offline treffen. Dies geschieht in Form von Usertreffen oder Treffen weniger einzelner MitgliederInnen. Für SpielerInnen, die sich in virtuellen Welten bewegen, sind Offline-Treffen eher ein untergeordnetes Thema, da man sich ohnehin in repräsentierter Form online treffen kann. Ausnahmen sind Warenlieferungen von Onlineshops, die als Pakete, die von der Post geliefert werden, realweltlich werden. Ein Sonderfall ist die hybride Ökonomie, in der man für den Avatar online Accessoires oder Gegenstände für das virtuelle Haus kaufen kann. Hier greift „offline“ in „online“ über und umgekehrt. (vgl. Jörissen 2009: 137-136-139)
Trotz dieser genau artikulierten Strukturebenen, Merkmale und Kategorien können virtuelle Welten nicht pauschal betrachtet werden. Jede ist für sich komplex und bietet andere/verschiedene Möglichkeiten zur Kommunikation, Weltbezugserweiterung oder zur Identitätsarbeit. Auf Letztere soll bald eingegangen werden, denn sie ist ein zentraler Punkt dieser Masterarbeit. Doch zunächst zu dem Videospiel, das hierfür als Fallbeispiel dienen soll:
2 Fallbeispiel Star Wars: The Old Republic
2.1 Entwicklung
Der, in der Gamer-Szene durchaus bekannte, Spieletitel „Baldur's Gate“, der 1999 von dem kanadischen Unternehmen BioWare auf den Markt gebracht wurde, beeindruckte LucasArts (die Abteilung für Videospiele von Lucasfilm). Baldur's Gate stach damals durch nonlineare Narration, computergesteuerte BegleiterInnen und einen Handlungsverlauf, der von Entscheidungen des/der SpielersIn abhängt, heraus. Die flexible Spielmechanik und Charakterentwicklung dieses Games inspirierte LucasArts und so nahm das Unternehmen Kontakt mit BioWare auf. Man wollte das Gameplay des beschriebenen BioWare-Titels in Spiele des großen Star Wars-Universums übernehmen.
BioWare hatte bis dato stets an Rollenspielen gearbeitet, die dem Fantasy-Genre zuzuordnen waren. Es waren Games, die an Hintergrundgeschichten von Filmen wie etwa „Herr der Ringe“ erinnerten und mittelalterlich anmuteten. Der Science Fiction-Bereich war also unbetretenes Neuland für die EntwicklerInnen. Doch es war eine Schiene, auf die sie aufspringen wollten. Und so arbeiteten LucasArts und BioWare schließlich zusammen: Erstere schrieben Dialoge, lieferten Originalmusik und Soundeffekte aus den Star Wars-Filmen, zweitere kümmerten sich um die Spielentwicklung an sich. Damit BioWare dabei (also bei dem Erschaffen eines neuen Settings für das Star Wars-Franchise), nicht an bereits bestehende Geschichtsverläufe stieß, wurde das zu entwickelnde Game in der „Alten Republik“ angesetzt: Einer Ära, viertausend Jahre vor den populären Filmen über Luke Skywalker und Darth Vader. Dies war ein Plan, der von LucasArts zunächst etwas kritisch betrachtet wurde, denn man war sich keineswegs sicher, wie die Star Wars-Fangemeinde einen völlig neuen geschichtlichen Rahmen aufnehmen würde. Denn eventuell wollten die SpielerInnen gar keinen eigenen Charakter erschaffen, vielleicht wollte man als Luke Skywalker oder Han Solo spielen. Vielleicht wollte man Darth Vader oder anderen bekannten Antagonisten in dem Game begegnen können. Doch diese Befürchtungen waren, so zeigte sich nach der Veröffentlichung des ersten, von BioWare entwickelten, Star Wars-Spieles im Jahr 2003, unberechtigt. „Star Wars: Knights of the Old Republic“ (kurz: KotOR), das sich nicht an bereits bestehenden Rahmen des Science Fiction-Universums bediente, sondern lediglich Archetypen und Themen daraus in eine neue Zeit importierte, war ein sehr großer Erfolg.
Nach dem Release von KoTOR arbeitete BioWare an weiteren Games, die den Bereich der digitalen Rollenspiele völlig ausloten und austesten sollten: „Jade Empire“ (2005), „Mass Effect“ (2007) und „Dragon Age: Origins“ (2009). (vgl. Erickson/ Parisi 2011: 16)
Nach dem Erfolg von KotOR, und den darauf folgenden Games von BioWare, stand eine neue Idee im Raum: Das ehrgeizige Unternehmen wollte ein MMORPG erschaffen. Die Wahl der Thematik dieses Spieles fiel den EntwicklernInnen nicht schwer:
„Knights of the Old Republic was very popular. People look fondly upon it. If you were to ask BioWare fans, 'Hey BioWare is about to do an MMO, what MMO do you want them to do?' Most of our fans would say, 'Knights of the Old Republic MMO.'“ (Ohlen, zit. n. Erickson/ Parisi: 23)
Auch LucasArts wollte sich weiter in den MMORPG-Bereich bewegen und aufgrund ihrer gemeinsamen Erfolge mit KotOR, arbeiteten LucasArts und BioWare ab 2006 wieder zusammen, um ihren nächsten großen Titel zu entwickeln: Ein Rollenspiel, dessen Geschichte wieder in der Ära der Alten Republik spielen sollte: „Star Wars: The Old Republic“. Die Narration dieses neuen Games sollte wieder BioWare-typische Nuancen aufweisen: Eine komplexe Charakterentwicklung und einen Geschichtsverlauf, der flexibel und abhängig von Entscheidungen der SpielerInnen ist. (vgl. Erickson/ Parisi 2011: 23)
Wie bei dem vorangegangenen Titel KotOR lieferte LucasArts nun erneut das Audio-Design für das, nun auch völlig vertonte, MMORPG. Die ingame-Gespräche mit Charakteren und anderen InteraktionspartnerInnen sollten nicht mehr bloß textbasiert sein, sondern über eine Sprachausgabe geschehen. Mehr als 300.000 Dialoge wurden folglich aufgenommen und editiert und acht KomponistenInnen arbeiteten an dem Soundtrack für das neue Videospiel, der heute über sechs Stunden originale Star Wars Musik beinhaltet.
BioWare war derweil verantwortlich für alle weiteren Bereiche der Spielentwicklung: das Skript, Charakter- und Umgebungs-Design des Games, Animation, Programmierung und das Erschaffen des technischen Systems rund um das Spiel. Auch Electronic Arts (kurz: EA), das Mutterunternehmen BioWares, kam nun ins Spiel: Es übernahm das Marketing und agierte als Publisher für The Old Republic.
Das wichtigste, oft erwähnte, Team rund um die Entwicklung des neuen MMORPGs war währenddessen die Gruppe der Spiel-AutorenInnen. Tausende KandidatenInnen wurden für diese Posten gecastet und diejenigen, die es schafften, passende nonlineare Dialoge und Geschichten zu schreiben, wurden in die Entwicklung integriert (vgl. Erickson/ Parisi 2011: 25):
„When you're writing interactive fiction, the work is game design as much as story-telling. What this means is that many of the normal rules of writing go out of the window. First, there is no protagonist. The player could be playing as a man or a woman and see themselves as smart, funny or mean. […]. At BioWare, it was important that the writing team come together as quickly as possible. Because The Old Republic was to be voice acted and translated into multiple languages, the team would need a huge lead time to develop what would be enormous scripts. Plus, with BioWare's story-driven tradition, the locations, the characters – in short, everything waits for the writers.“ (Erickson/ Parisi 2011: 25)
Eine Hürde, die BioWare und LucasArts nehmen mussten, war nicht nur das Programmieren eines hoch komplexen, narrativen Spielsystems, sondern man sollte das MMORPG am Ende 24 Stunden und sieben Tage die Woche für SpielerInnen erreichbar machen. Anders als bei Offline-Spielen galt es in Zukunft einen Server zu warten, der stabil sein sollte, um das Spielerlebnis der UserInnen nicht zu unterbrechen. Ein eigener Spezialist hinsichtlich Serverprogrammierung wurde zu Rate gezogen, denn das Star Wars-MMORPG sollte immer online sein, SpielerInnen sollten, wenn sie sich nach einer Spielpause wieder einloggen, nahtlos und mit zuvor gespeicherten Erfolgen weiterspielen können; das Game sollte als virtuelle Welt einfach immer ohne Komplikationen erreichbar sein. (vgl. Erickson/ Parisi 2011: 27)
Als MMORPG stellte The Old Republic die weitere Aufgabe an die EntwicklerInnen alle Konzepte, die in vorangegangenen Singleplayer-Spielen funktioniert hatten, mit auf die Multiplayer-Ebene zu nehmen: Die Möglichkeit frei zu handeln und eigene Entscheidungen zu treffen, die den Spielverlauf beeinflussen, Konsequenzen für das Handeln zu erfahren, filmisch anmutende Zwischensequenzen, actiongeladene Kämpfe, Emotion, computergesteuerte BegleiterInnen und so weiter. Es galt eine Geschichte, wie sie noch nie für ein MMORPG verwendet wurde, in eines zu implementieren.
Zumeist ist es in MMORPGs so, dass die Quest-Reihe im Spiel einem Ein-Aus-Prinzip folgt und stets eine öffentliche Angelegenheit darstellt. Bekommt man zum Beispiel die Aufgabe zehn Gegenstände zu sammeln, so zieht man, wie viele andere SpielerInnen parallel, los, um diese Gegenstände zu suchen. Hat man dies geschafft, wird die Aufgabe als beendet abgehakt. Raum für Überraschungen oder unvorhergesehene Wendungen der Geschichte gibt es kaum oder gar nicht. Somit besteht auch keine große Möglichkeit zur individuellen, geschichtlichen Charakterentwicklung. Erickson und Parisi beschrieben dies weiter und sagten dabei, es gäbe in MMORPGs „events but no story“ (Erickson/ Parisi 2011: 143). In The Old Republic wollte man dies vermeiden und kreierte daher sogenannte „World Arcs“ (Etwa zehn Aufgaben, die sich über die Handlung eines Planeten/einer Gegend spannen), die, je nach digitaler Umgebung, zwischen zehn und 20 Stunden Spielinhalt bieten. Dies zu bespielen gleicht nun weniger einem klassischen MMORPG als einem Film, in dem man mit seinem Avatar als SchauspielerIn mitspielt: Die vielen Planeten sind Bühnen und die World Arcs ihre Drehbücher. Diese Geschichten spielt man zudem nicht nur im öffentlichen Raum, denn es gibt sogenannte „Instanzen“ oder „Flashpoints“: Von außen abgeschottete Bereiche, die man alleine oder zusammen mit bis zu drei FreundenInnen betreten und, unter Beachtung gewisser Aufgaben, meistern kann. Sie erinnern stark an „Raids“ aus anderen Onlinerollenspielen; sie machen das Spielerlebnis für Spielgruppen (oder EinzelspielerInnen) „privat“ und daher intensiver oder besonderer. Kooperatives Zusammenspiel ist hier unter anderem nötig, um die, teils schwierigen, Instanzen zu bestehen:
„Flashpoints not only offer visceral cinematic thrills, but also provide players with highly scripted, character-changing decision points. Players get to make huge choices that change the entire plot and resonate across the galaxy. They have the chance to destroy capital ships, invade space stations, and experience complex storylines that rival the best of singleplayer games.“ (Erickson/ Parisi 2011: 143)
„That's hard to do in a public space, so you put that into a instance zone. You can have […] all the cool stuff that really seems like you're playing a movie.“ (Prince, zit. n. Erickson/ Parisi 2011: 143)
Das erwähnte, soziale Gruppenzusammenspiel ist in The Old Republic ein sehr interessanter Punkt. Man kann nicht nur Instanzen in Gruppen lösen, sondern auch all die verbleibenden Questreihen des Spieles. Man kann einander also stets helfen und/oder zusammen mit computergesteuerten Charakteren und anderen „realen“ Avataren auf Erkundung gehen. In Teams von bis zu vier Personen kann man die virtuelle Welt bespielen; und auch in Gesprächen mit computergesteuerten Charakteren spielt es eine Rolle, wenn man in der Gruppe spielt. Tut man dies nämlich, sprechen alle GruppenmitgliederInnen mit einem betroffenen Nebencharakter. Es wird nach der Dialograd-Auswahl (Antworten oder Handlungen eines/r Jeden; gewählt über ein Menü in Form eines Dialogrades) vom Game ausgewürfelt, wer als nächstes antworten/sprechen darf und so ergibt sich ein flüssiges, für alle Beteiligten spannendes Gesprächserlebnis in Film-Ästhetik. Werden hierbei nun Entscheidungen getroffen, die die sogenannten „hellen/dunklen“ (also „guten“ oder „bösen“) Gesinnungspunkte (auf die später noch eingegangen wird) oder Spielverläufe der Avatare beeinflussen, so wird beachtet wie jede/r Spieler einzeln gehandelt hätte. Das heißt, dass eine Entscheidung, die ein/e einzelne/r SpielerIn in der Gruppe trifft, nie für die gesamte Gruppe gilt. Ein Beispiel hierzu: Vier Spieler sind in einer Gruppe unterwegs und stehen vor der Entscheidung ein Dorf zu vernichten. Drei der Spieler stimmen dagegen, doch einer dafür. Der Computer würfelt nun aus und der Spieler, der für die Vernichtung gestimmt hat, gewinnt. Das Dorf wird vernichtet. Doch nur der, der dafür gestimmt hat, bekommt auch „dunkle“ Punkte. All die anderen Gruppenmitglieder bekommen „helle“ Punkte gutgeschrieben, denn sie stimmten ja gegen die Auslöschung des Dorfes.
2.1.1 Vier Säulen erfolgreicher Computerspiele
James Ohlen sagte über erfolgreiche, digitale Rollenspiele, dass sie über vier bestimmte Säulen verfügen müssen, um spannend bleiben und den/die SpielerIn motivieren zu können. Diese Säulen seien die Möglichkeit zu entdecken, ein ausgeklügeltes Kampfsystem, die Entwicklung/Anpassung des Charakters und die durchdachte Geschichte des Games selbst.
Das Entdecken war mit der Star Wars-Welt gegeben. Schließlich verfügt diese über ein riesengroßes Universum, viele verschiedene Planeten, unzählige Alienrassen und über eine lange Geschichte (diese wird später noch näher beleuchtet).
BioWare und LucasArts stimmten mit Ohlen's erster Säule überein: Die wichtigsten Punkte eines erfolgreichen Kampfsystems seien Immersion und Schnelligkeit; so wie man beides auch aus Actionspielen kennt. Gleichauf sollte die Kampfweise im Spiel mit dem bekannten Stil aus den Star Wars-Filmen oder bereits bestehenden -Videospielen übereinstimmen. Am Ende sollte die Kampfmechanik einer der komplexesten Teile des MMORPGs werden. Dies zusammen mit der Charakteranpassung, die, je nach gewählter Klasse, über verschiedene ingame-BegleiterInnen, Raumschiffe, Fähigkeiten und Ausrüstungsgegenstände verfügen sollte. Klassenspezifische, anpassbare Rüstungen oder Waffen sollten hier zahlreicher vorhanden sein als in anderen Videospielen.
Die vierte Säule, die Spielgeschichte, war essentiell für den Erfolg des neuen Star Wars MMORPGs. Andere Onlinespiele verfügten zwar über die ersten drei Säulen nach Ohlen, doch an den Geschichten scheiterten sie, während der Entwicklung von The Old Republic, oft. Ein MMORPG um eine umfangreiche, tiefe Geschichte zu bauen, war also relativ neu in dem Gebiet des Spieldesigns. Es ging hierbei von Anfang an darum klassisches Storytelling einzusetzen:
„Using classic storytelling techniques meant telling a story over time, introducing interesting characters, giving players a chance to bond with them, then giving players choices about how to interact with those characters, which would then change the path of the story forever.“ (Erickson/ Parisi 2011: 37)
BioWare und LucasArts machten es sich zudem zur Aufgabe The Old Republic für UserInnen mit verschiedensten Hintergründen und Gaming-Erfahrungen interessant zu machen, was das Anspruchslevel der Spielentwicklung anhob.
In MMORPGs geht es SpielernInnen darum Fortschritte zu machen. Dies geschieht durch gewonnene Kämpfe, Gruppenzusammenspiel, das Abschließen von Quests (Aufgaben) und das eigenständige Erstellen neuer ingame-Gegenstände. All diese Vorhaben und Zielsetzungen fangen UserInnen in einem Kreis des ständigen Besiegens oder Tötens von GegnernInnen und dem Sammeln von Gegenständen/Objekten, um den eigenen Charakter zu verbessern und zu leveln. Setzt man in einem Spiel nun jedoch eine tiefe Hintergrundgeschichte ein, kann diese die Gamer langsam an all die vorhandenen Spielmechaniken und die verbleibenden drei Säulen des Games heranführen (vgl. Erickson/ Parisi 2011: 37). Dies in einem äußerst verständlichen Kontext. Jede/r SpielerIn verfolgt Aufgaben in der virtuellen Welt lieber, wenn er/sie vom Game erklärt bekommt wie und warum er/sie diese Aufgaben zu erledigen hat. Immersion und der Sinn hinter dem, was man tut, sind nicht nur für den Spielspaß essentiell, sondern auch für das Flow-Erlebnis.
„No other MMO has really explored having a meaningful story to support why you're going on quests, why you're fighting a different faction, why you even want to level up. With The Old Republic, story actually gets you more immersed and gives you a purpose for doing every activity in the game.“ (Cowles, zit. n. Erickson/ Parisi 2011: 37)
Auf diese besprochene, besondere Geschichte soll nun näher eingegangen werden:
2.2 Geschichte
Die Spielgeschichte von The Old Republic dreht sich um den ewigen Krieg zwischen der sogenannten dunklen Seite (dem „Imperium“) und der hellen Seite (der “Republik“). Schon während der Entwicklung des MMORPGs stand fest: Die Galaxie sollte in einem Konflikt stehen, der unzählige Planeten und Rassen betrifft. Ein Krieg, den jeder Star Wars-Fan versteht, ist der bereits angesprochene, zwischen der hellen und der dunklen Seite; zwischen den sogenannten Jedi und Sith. Der ständig bestehende Kriegszustand im Game gibt dem/der SpielerIn die Möglichkeit sich an eine dieser beiden Fronten zu stellen. Der/die UserIn sollte jedoch nicht direkt in diese Kämpfe und einen tobenden Krieg geworfen werden, sondern in einer Umgebung starten können, die noch relativ ruhig ist:
„Starting players right before the Old Republic equivalent of the World War II invasion of Iwo Jima would cause confusion and chaos. What the game needed was an equivalent to the days just following Pearl Harbor, when two sides were looking at the inevitable but had not yet seriously chlashed.“ (Erickson/ Parisi 2011: 47)
Die Geschichte rund um The Old Republic greift weit und ist lange. Doch die wichtigsten Gesichtspunkte des hier bestehenden Konflikts zwischen Hell und Dunkel sind im Prinzip einfach zusammenzufassen. Die Informationen, die jede/r SpielerIn vermittelt bekommt, bevor er/sie die Spielwelt betritt, sind folgende:
Die galaktische Republik existiert, als fortschrittliche Zivilisation, seit mehr als 21.000 Jahren. Vom sogenannten Jedi-Orden beschützt und mithilfe dessen steter Unterstützung konnte die Republik bisher all ihre Feinde besiegen. Darunter auch das dunkle Sith-Imperium. Doch unter der Führung des Imperators erhoben sich die Sith neu und forderten Vergeltung. Der neu entfachte Krieg zwischen der hellen Seite (Republik) und der dunklen Seite (Imperium) tobte, bis ein Friedensvertrag („Vertrag von Coruscant“) eine erneute Ruhepause brachte. Doch trotz dieses Vertrages bestehen Spannungen zwischen den beiden Großmächten, die in ihren Grundsätzen unterschiedlicher nicht sein könnten. Ein weiterer Krieg scheint daher unausweichlich und das Verstecken unter einem Deckmantel der Neutralität als sinnlos. (vgl. SWTOR Fraktionen 2014: o.S.)
Da eine neutrale Charaktergesinnung also als nicht sinnvoll deklariert oder belohnt wird, muss sich der/die UserIn zwischen einer der beiden Mächte entscheiden. Dies geschieht im Zuge der Charaktererstellung zum Anfang des Games; und auch während des Spielens.
[...]
- Arbeit zitieren
- Sabrina Auer (Autor:in), 2015, Videospiele und Identität(en). Identitätsarbeit in und über digitale Bildschirmspiele, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/305425
Kostenlos Autor werden
















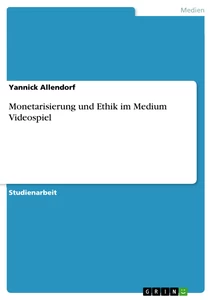





Kommentare