Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
I Einleitung
II Bedeutung der Antike in der Renaissance
1. Die Wiedergeburt der Antike durch den Humanismus
1.1 In der Literatur
1.2 In Kunst und Architektur
1.3 Patriotische Bestrebungen versus Antikes Erbe
2. Römische Geschichte als Exemplum
2.1 Römische Wertvorstellungen als civil guidance
2.2 Militärische Taktiken als Lehrbuch britischer Herrscher
2.3 Römische Machthaber und das Wheel of Fortune
III Elisabethanische Historiographie
1. Wahrheitsempfinden der Elisabethanischen Historiographen
1.1 Die Chronisten der Tudors
1.2 Legitimation Englands als Erbe Roms
2. Shakespeares Quellen
2.1 Shakespeares Bildung
2.2 Shakespeares Zugang zu antiken Stoffen
2.3 Shakespeare und Plutarch
2.3.1 Parallelen und Änderungen bei Julius Caesar
2.3.2 Parallelen und Änderungen bei Antony and Cleopatra
IV Shakespeares politisch-historische Doppelperspektive
1. Vergangenheitsbezogene Dimension
1.1 Das Ende der römischen Republik – Suche nach der idealen Staatsform
1.1.1 Verfall römischer Tugenden
1.1.2 Das Scheitern der Demokratie
1.2 Der Anfang des Römischen Imperiums – Suche nach Stabilität
1.2.1 Flucht aus dem öffentlichen Leben
1.2.2 Ziele und Chancen des Individuums in der Monarchie
1.2.3 Vergleich Rom und Ägypten
1.3 Einfluss der römischen Wertvorstellungen
1.3.1 Römische „virtus“ versus „ambitio“
1.3.2 Römische Freundschaft
1.3.3 Römische Vorstellungen von Ehe und Liebe
1.3.3.1 Caesar und Calpurnia
1.3.3.2 Brutus und Portia
1.3.3.3 Antony und Octavia
1.3.3.4 Antony und Cleopatra
1.3.4 Römischer Suizid und Jenseitsvorstellungen
1.4 Repräsentanten unterschiedlicher römischer Lebensvorstellungen
1.4.1 Julius Caesar – der gottgleiche Imperator
1.4.2 Brutus – der Idealist?
1.4.3 Cassius – der Revolutionär
1.4.4 Antonius – der gescheiterte Feldherr und Liebhaber
1.4.5 Octavian – Caesars Erbe
1.5 Stellung der Frau in der antiken Welt
1.5.1 Portia
1.5.2 Calpurnia
1.5.3 Octavia
1.5.4 Cleopatra
2. Gegenwartsbezogene Dimension
2.1 Anachronismen
2.2 Parallelen römischer und elisabethanischer Lebenssituationen
2.2.1 Monarchie als ideale Staatsform
2.2.2 Ethische Kontroversen und Religionskonflikte
2.2.3 Einfluss der Bevölkerung
2.2.4 Machtkämpfe am Hof – Rebellion oder Anpassung?
2.2.5 Der Status der Frau
2.2.6 Antikes Ägypten und Elizabethan Theatre
2.3 Das Goldene Zeitalter Großbritanniens
2.3.1 Blüte der Literatur – Ein Scheinfrieden?
2.3.2 James I. als Personifikation des Augustus?
V Bedeutung der Werke für den Literaten Shakespeare
1. Stellung der beiden Stücke in seinem Lebenswerk
2. Lenkung der Rezeption des Publikums
3. Verwendung von Zeit
3.1 zeitliche Raffungen in den Dramen
3.2 Manipulation des Zeitbegriffs
3.3 Festhalten der Zeit - Kampf gegen die Vergessenheit?
VI Schlussfolgerung
VII Bibliographie
I Einleitung
Ivdicio Pylium, genio Socratem, arte Maronem,
Terra tegit, Populus Maeret, Olympus habet.
(Einen Nestor im Urteil, einen Sokrates im Genie, einen Vergil in der Kunst,
begräbt die Erde, beweint das Volk, besitzt der Olymp)
Diese epischen Zeilen zieren ein Denkmal, das posthum zu Ehren William Shakespeares (1564-1616) in der Holy Trinity Church in Stratford-upon-Avon, seiner Tauf- und Grabesstätte, ca. 1620-1623 errichtet wurde. In der Wahl der Sprache und der genannten Personen klingen schon die immense Bedeutung des Lateinischen und die mit antiken Begrifflichkeiten verbundene Ehrerbietung mit an. Es handelt sich hierbei nicht um irgendeine Auswahl berühmter Männer der Geschichte, sondern: um Nestor, der aufgrund seiner Herrschaft in Pylus auch unter dem Namen Pylius (der aus Pylos stammende) bekannt war, der als Mitglied der Argonauten zu einem homerischen Helden wurde und für seine Eloquenz und Weisheit gerühmt wurde; um Sokrates, der wohl meist gefeierte Philosoph Griechenlands und moralische Wegbereiter der westlichen Zivilisation und um Vergil, dessen Beiname Maro war, der berühmt wurde durch seine Aeneis, dem Gründungsepos Roms. Kurz gesagt, gleich mit allen dreien verglichen zu werden, dürfte wohl die höchste Auszeichnung für einen Dichter sein und ihn wohl in den „Olympus“ der Dichter erheben. Selbst sein Konkurrent Ben Johnson bezeichnet seinen „beloved friend“ als Apollo, Gott der Poesie, als Merkur, Gott der Eloquenz und „Sweet Swan of Avon“, eine Anspielung auf Orpheus, einen Repräsentanten der musischen Künste und des Dramas (vgl. Dawkins, S.xix ff.).
Allen diesen Auszeichnungen ist gemein, dass sie auf berühmte antike Persönlichkeiten und Gottheiten anspielen, deren wirklicher Stellenwert nur einem Eingeweihten, einem sogenannten „homo doctus“, verständlich sind. Mag ein Besucher des oben erwähnten Denkmals heutzutage die Namen Pylos und Maro in einem Wörterbuch nachschlagen, Shakespeares Zeitgenossen wussten diese Vergleiche sicherlich zu deuten. Hieraus ergibt sich jedoch die Frage, weshalb elisabethanische Gelehrte und Schriftsteller fast 1500 Jahre nach der Blütezeit der römischen Kultur wieder begannen, sich mit antiker Philosophie zu befassen und das Wissen um die Antike wieder zu einem „common knowledge“ zu machen. Welches Wissen konnte jedoch eine untergegangene Kultur liefern, deren letzte Zeugnisse als Ruinen zeitweilig zum Bau von neuen, „modernen“ Bauten genutzt wurden?
Auch William Shakespeare wuchs mit einer humanistischen Bildung auf, die verstärkt das literarische und philosophische Erbe der Antike lehrte. Diese Strömung seiner Zeit beeinflusste unweigerlich auch sein Lebenswerk. Neben Anspielungen auf antike Begrifflichkeiten und Personen in zahlreichen seiner Werke befasste sich Shakespeare vor allem in mehreren Tragödien explizit mit diesem Thema. Zu diesem Repertoire gehören Troilus and Cressida (1602), Timon of Athens (1605), Cymbeline (1610) und die sogenannten „Roman Plays“: Titus Andronicus (1592), Julius Caesar (1599), Antony and Cleopatra (1606) und Coriolanus (1608) (vgl. Erlebach, S.269 f.). Von diesen vieren wird Titus Andronicus, das von dem Kampf mit den Goten handelt und die gewalttätige römische Vergangenheit zeigt , eher vernachlässigt (vgl. Spencer bei MacCallum, S.xiv; Humphreys, S.5). Deshalb werden unter dem Titel „Roman Plays“ meist die Stücke Julius Caesar, Antony and Cleopatra und Coriolanus verstanden. Diesen drei Stücken ist gemeinsam, dass sie in Rom spielen, jedoch zu unterschiedlichen Epochen. Coriolanus spielt in der jungen römischen Republik, kurz nach der Vertreibung des letzten Tarquinierkönigs, Julius Caesar handelt von dem Umbruch zwischen Republik und Monarchie und Antony and Cleopatra schließt darauf mit der Darstellung der Anfänge der Monarchie an (vgl. Cantor, S.10-13).
Die folgende Darstellung wird sich aufgrund der chronologischen Nähe der Geschehnisse und der starken politischen und sozialen Kontraste auf die Tragödien Julius Caesar und Antony Cleo patra konzentrieren, jedoch wird der Schwerpunkt nicht auf einer reinen Sachanalyse der Werke liegen. Vielmehr wird das von Shakespeare entworfene Bild der Antike zur Zeit des Umbruchs von der Römischen Republik zur Monarchie von zentraler Bedeutung sein. Hierbei ist vor allem die Sorgfalt und Faktentreue Shakespeares zu betrachten. Um den Vorwurf bewerten und diskutieren zu können, Shakespeares römische Figuren seien lediglich „Elizabethans in disguise“ (Cantor, S.7), ist zunächst ein Vergleich mit den üblichen Maßstäben der elisabethanischen Historiographie und den vorhandenen historischen Quellen notwendig. Desweiteren ist zu klären, welchen Einfluss nun die eigene Wirklichkeit Shakespeares auf die Darstellung der Figuren und Ereignisse in den beiden Roman Plays hatte. Aber auch, welche Parallelen in der römischen und elisabethanischen Wirklichkeit in Bezug auf politische, soziale und religiöse Sachverhalte zu finden sind. Auch die Person Shakespeares wird von Bedeutung sein, um zu erörtern, inwiefern die Behandlung antiker Themen dazu beitrug, dass sich ein „Normalsterblicher“ aus der Mittelschicht eine Stellung in der eigenen Kultur seiner Zeit erarbeitete, in der er den ehrwürdigen Vergleich durch seine Zeitzeugen mit antiken Größen wie Sokrates nicht scheuen musste.
II. Bedeutung der Antike in der Renaissance
1. Die Wiedergeburt der Antike durch den Humanismus
Antikes Gedankengut verdankt seine Wiederauferstehung vor allem einer kulturellen Strömung des 14. und 15. Jahrhunderts, nämlich dem Humanismus. Wie schon der Name Humanismus (aus dem Lateinischen abgeleitet von humanitas = Menschlichkeit) aussagt, befasst sich diese Lehre mit dem Wesen des Menschen. Dieser Ansatz war gegen die alleinige Autorität des Papstes gerichtet und betonte die Würde und den Wert des Individuums. Diese zunächst rein philosophische Haltung hatte in Italien durch Schriftsteller wie Giovanni Boccaccio ihren Ursprung und fand bald Anhänger in ganz Westeuropa. Eine Antwort auf die aufkommenden Fragen nach dem Wesen des Menschen versprach man sich, in den Werken antiker Schriftsteller zu finden. Künstlerische und architektonische Erzeugnisse, die den klassischen Stil nachzuahmen versuchten, waren ebenfalls Ausdruck dieser neuen Selbstdarstellung. Der steigende Einfluss des Humanismus auf die europäischen Kulturen wirkte sich schließlich in der Reformation und somit der Abspaltung der anglikanischen Kirche von der katholischen Glaubenslehre zu Anfang des 16. Jahrhunderts aus (vgl. Eintrag „Humanismus“, S.538 f.). Auch Shakespeare setzt sich in seinen Werken Julius Caesar und Antony and Cleopatra mit humanistischem Gedankengut und philosophischen Lebensvorstellungen auseinander, auf diese Einflüsse wird im späteren Verlauf hingewiesen werden.
1.1 In Literatur und Bildung
Grund für die Verbreitung klassischer Literatur waren nicht nur die Thesen des Humanismus selbst sondern zunächst einmal die Entdeckung längst vergessener antiker und literarischer Zeugnisse durch archäologische Ausgrabungen. Aber auch die Erfindung des Buchdrucks trug ihr Übriges dazu bei, dass die lesende und vermögende Bevölkerung Europas in den Kontakt mit diesen Werken kam. Das wachsende Interesse an lateinischer Literatur führte schließlich auch dazu, dass vermehrt muttersprachliche Übersetzungen auf dem Markt erschienen (vgl. Rose, S.21), durch welche wiederum auch der lateinischen Sprache Unkundige in den Genuss antiken philosophischen Gedankenguts kamen.
Die wachsende Bedeutung der lateinischen Sprache machte auch nicht vor der Erziehung des Einzelnen halt. In sogenannten „grammar schools“ wurde den jungen Schülern schon von Anfang an die Grundzüge des Latein gelehrt mit steter Erinnerung an die literarische Oberhoheit antiker Autoren. Autoren wie Vergil, Ovid, Caesar und Cicero gehörten somit zum literarischen Kanon des elisabethanischen Unterrichts (vgl. Suerbaum, S.350). Auch an den Universitäten galt die Regel: „Nothing was studied (...) that was not Latin“ (Thomson, S.10). Gebildet zu sein war in der elisabethanischen Gesellschaft gleichzusetzen mit der Beherrschung der lateinischen Sprache (vgl. Thomson, S.10). Darüber hinaus waren lateinische Sprachkenntnisse essentiell für den Status eines gentleman, dessen Benehmen von jedem Sprössling aus gutem Hause erwartet wurde (vgl. Thomson, S.15).
Diese Entwicklung führte jedoch zu folgender Verfahrensweise: „in their adoration of antiquity the scholars were prepared to throw away nearly the whole of medieval literature as childish or worthless or inartistic” (Thomson, S.10). Neben der Verleugnung des kulturellen Erbes des Mittelalters, das durchaus bemerkenswerte Werke wie Chaucers Canterbury Tales hervorbrachte, ließ die Bevorzugung der lateinischen Sprache Erzeugnisse in der eigenen Muttersprache relativ unbedeutend aussehen. Die lateinische Sprache als lingua franca wurde sowohl von Akademikern als auch von Diplomaten, Historikern, Philosophen, Theologen und sogar Wissenschaftlern als alleinige Autorität angesehen. Sowohl auf nationaler Ebene als auch international hatte die englische Sprache aus diesem Grund kein allzu hohes Prestige; sie galt sogar im Ausland als ein „semi-barbarous dialect“ (Thomson, S.11). Alle bekannten englischen Logiker und Theologen des Mittelalters, wie zum Beispiel Sir Thomas Moore, die international großes Ansehen erlangt hatten, konnten diesen Erfolg nur erreichen, weil sie ihre Werke in lateinischer Sprache publizierten. Bei Shakespeares Zeitgenossen war diese Bevorzugung der lateinischen Sprache lange Zeit nicht anders. Das europäische Bild der englischen Literatur zu Beginn des elisabethanischen Zeitalters wurde deshalb nur von Werken in lateinischer Sprache, wie Francis Bacons Instauratio Magna, geprägt (vgl. Thomson, S.11; Lindsay, S.1 ff.).
1.2 In Kunst und Architektur
Nicht allein die mittelalterliche Literatur wurde von antiken Werken abgelöst; die antike Strömung beeinflusste auch andere kulturelle Bereiche des alltäglichen Lebens, wie zum Beispiel die elisabethanische Kunst und Architektur. Obwohl sich die Kunst der Renaissance meist auf Süd- und Mitteleuropa beschränkte, beeinflussten deren Ausläufer auch den elisabethanischen Stil. Jedoch beschränkte sich diese, was die Malerei betrifft, meist auf italienische und spanische Maler, da die englische Malerei nahezu in Vergessenheit geraten war (vgl. Thomson, S.38). Neben architektonischen Zeitzeugen aus antiker Zeit, wie öffentlichen Gebäuden und Kirchen, erlebte der antike Lebensstil in elisabethanischen Wohnhäusern ebenfalls eine Renaissance. Auf Fresken, Tapeten und „painted cloths“(Thomson, S.38) bildete man mythologische und historische Ereignisse der römischen Zeit ab. Auch in Schnitzereien und bemaltem Fensterglas fand man Szenen wie zum Beispiel den Tod des Priamos, des Königs von Troja. Diese bildliche Darstellung der römischen Geschichte ermöglichte außerdem auch Menschen ohne Lateinkenntnisse und sogar Analphabeten den Zugang zu antiken Glaubensvorstellungen (vgl. Thomson, S.38f).
1.3 Patriotische Bestrebungen versus antikes Erbe
Im Hinblick auf das erstarkende Selbstbewusstsein Englands nach dem Sieg über die spanische Armada im Jahr 1588 (vgl. Erlebach (u.a.), S.271) scheint es zunächst befremdlich, dass immer noch nicht die englische sondern die lateinische Sprache und die römische Geschichte so großes Interesse bei den Monarchen und der Bevölkerung fand. Jedoch ist trotz allen europäischen Spottes eine Tendenz zu erkennen, dass die englische Sprache mit der Zeit ihren Platz in der Literaturgeschichte fand. Im Laufe der Elisabethanischen Zeit wurden deshalb eine Vielzahl römischer Historien in englischer Sprache verfasst, was gleichwohl als revolutionär und provokativ angesehen wurde. Im Gegensatz zu den romanischen Sprachen konnte das Englische nicht stolz auf lateinische Sprachwurzeln zurückblicken. Erschwerend kam hinzu, dass Julius Caesar versucht hatte, die britische Insel zu erobern und demnach eher ein feindliches Rom verkörperte als eine Kultur, die noch 1500 Jahre später von englischer Seite zu preisen wäre. Diese Eroberung würde eher die Schwäche als die Stärke der Vorfahren betonen (vgl. Thomson, S.12).
Verständlich wird die ungetrübte Begeisterung der Engländer für die Kultur der ehemaligen Besatzer erst, wenn man die Eroberungen Caesars aus einem anderen Blickwinkel betrachtet: Man kann die römischen Feldzüge nach Britannien auch derart interpretieren, dass die Schwierigkeiten, die die englische Bevölkerung Caesar durch ihren Widerstand bereitete, als positiv für diese Vorfahren gewertet werden könnte. So lange Widerstand gegen das viel mächtigere römische Weltreich geleistet zu haben, könnte das englische Volk mit Stolz erfüllt haben (vgl. Rose, S.24). Dieser Strategie der Betonung des eigenen Selbstbewusstseins bedienten sich auch die elisabethanischen Übersetzer: Anstatt lateinische Werke ehrfürchtig rein literarisch Wort für Wort zu übersetzen, zwangen die Übersetzer den Werken ihren eigenen englischen Stil auf und veränderten nach ihrem Belieben und Verständnis die Meinungen der Autoren (vgl. Thomson, S.12). Dies führte zu einer sogenannten „Kontemporaneisierung“ der Originaltexte (vgl. Breuer, S.233). So geschah es auch bei Norths Übersetzung der Werke des Plutarch, die Shakespeare hauptsächlich für seine römischen Stücke zu Rate zog. North übersetzte nicht direkt aus der griechischen Quelle, sondern griff auf eine französische Übersetzung von Jacques Amyot zurück. Obwohl sich der französische Übersetzer gut mit dem prosaischen Stil auskannte und getreu dem Original übersetzte, veränderte und erweiterte North dieses Vorbild soweit, bis es zu einem „masterpiece of English literature“ wurde mit einem „independent life of its own“ (Thomson, S.12).
2. Römische Geschichte als Exemplum
Das Elisabethanische Publikum wollte jedoch nicht nur unterhalten werden, sondern von den antiken Werken oder Stücken, die es las und sah, für die eigene Lebensführung profitieren: „Few Elizabethans, especially among the middle-class, would have sympathized with a creed of ‘knowledge for its own sake’ (...) They were as practical as they were curious, and their avocations were expected to contribute instructions as well as delight” (Rose, S.40). Das imperiale Rom fand im elisabethanischen England besonderes Interesse. Es gab im Europa des 16. Jahrhunderts noch sehr wenige Republiken jedoch umso mehr Herrscher, die den römischen Imperatoren nachzueifern versuchten. Spencer begründet diese Entwicklung wie folgt: „It was therefore from the history of the growth of monarchical rule in Rome (...) that the most useful and relevant lessons could be learnt” (Spencer, S.9).
Die Historien über die Karriere Caesars zum Beispiel wurden sowohl im Original in den „grammar schools“ unterrichtet als auch in zahlreichen englischen Übersetzungen privat gelesen. Viele Publikationen beschäftigten sich mit dem Aufstieg und Fall dieses berühmten Feldherrn. Sein Leben und das seiner Zeitgenossen waren Stoff zahlreicher Bühnenstücke (vgl. Rose, S.37). Historien wurden jedoch nicht nur unter dem zeitgeschichtlichen Aspekt gelesen sondern auch als moralische und politische Anleitung für einen besseren Lebensstil, getreu dem Motto: die Erfolge der Vorgänger nachahmen und aus den Fehlern anderer lernen. (vgl. Rose, S.42).
2.1 Römische Wertvorstellungen als civil guidance
Die Erzählungen über den Aufstieg und Fall großer Personen und Nationen, zu denen auch das römische Imperium gehörte, hatten das Ziel, dem Einzelnen nicht nur eine Lebenshilfe zu geben, sondern auch seine moralischen und religiösen Pflichten aufzuzeigen: „The righteous man would discover in the lives of the ancients not only the fortitude to face his present difficulties in the light of others’ past misfortunes, but also evidence of God’s Providence as the ruling force in human affairs” (Rose, S.48). Entgegen der Befürchtung, dass „viewing God as first and final cause negated the importance of detailing the human causes of events in history“ (Rose, S.50) stand die Ansicht, dass die Darstellung der richtigen Verhaltensweisen dem Menschen ermöglichen kann, seine Lebensziele „within God’s providential plan“ (Rose, S.50) trotzdem erreichen können. Da der Monarch als gottgesandte Macht und Exekutive Gottes auf Erden galt, musste der Untertan diesem jedoch gehorchen, wie willkürlich dessen Herrschaft auch war, wenn er nicht in Gottes Ungnade fallen wollte. Dies zeigte das Beispiel Caesars, der sich über die Götter erhob oder das, der Verschwörer Brutus und Cassius, die ein klägliches Ende auf der Flucht fanden. Rebellion war unter allen Umständen untersagt, denn dies würde einer Auflehnung gegen Gott gleichkommen.
2.2 Militärische Taktiken als Lehrbuch britischer Herrscher
Nicht nur auf die englischen Untertanen war das römische Beispiel anwendbar, auch ihre Könige und Königinnen wurden in römischer Politik und Lebensführung unterrichtet. Anwärter auf den Thron waren besonders gefährdet, leichtfertig durch ihre Unerfahrenheit den falschen Weg einzuschlagen, denn die Gratwanderung zwischen „fame“ und „disgrace“(Rose, S.46) war für einen Monarchen sehr schmal und die Konsequenzen verheerend, sowohl für den Regenten selbst als auch für das Land. Das berühmte Sprichwort „Probieren geht über studieren“ war in ihrem Fall also schwer denkbar. So stellt auch Haward das Lernen über die Selbsterfahrung (Rose, S.47). Deshalb boten Historien „the perfect, pleasant, and easy mode of instructions (...) (to) show princes the truth concerning the inevitable results of whatever courses they propose to follow” (Rose, S.45). Auf diese Weise wurden den potentiellen Erben des Throns in einer Art Vorhersage die Konsequenzen ihrer Taten vorgeführt, bevor sie überhaupt getan wurden.
Schon seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts verzeichnete man ein gesteigertes Interesse an „military affairs“ (Rose, S.35). Sowohl die Bedrohung der Spanier als auch General Leicesters Erkundungen in die Niederlande und der große Seesieg gegen Spanien in 1588 legitimierten diesen Fokus (vgl. Rose, S.35). Caesar wiederum war aufgrund seiner „purity of style“ und „authority in military matters“ (Rose, S.37) besonders unter Hoflehrern angesehen. Obwohl seine Commentarii in den „grammar schools“ meist unter stilistischen Aspekten gelesen wurden, waren diese Berichte umso wertvoller als Zeugnis römischer militärischer Disziplin.
2.3 Römische Machthaber und das Wheel of Fortune
Die Personifizierung des Schicksals als mächtige Entität („Fortune“, Rose, S.199) war besonders prägend im Mittelalter und der Renaissance. Deshalb spielte bei elisabethanischen Zuschauern und Lesern dieser Aspekt auch stets eine große Rolle, wenn der Aufstieg und Niedergang großer Nationen und Machthaber szenisch dargestellt wurde. Das Schicksal stellte man sich bildlich als großes Rad des Lebens vor, das durch die Göttin Fortuna in rascher Bewegung gedreht wird, so dass „the proud are tumbled and the humble raised“ (Dawkins, S.68). Die Griechen nannten sie „Hecate“, die Zerstörerin, die alles Schlechte zerstörte, damit das Gute aufsteigen konnte. Sie ist auch der dunkle Teil der Artemis, der Göttin des Schicksals, und gilt als äußerst wechselhaft. In Darstellungen der Renaissance wird sie deswegen des Öfteren auch in unsicherem Stand auf einer Erdkugel dargestellt, auf der sie durch die Winde Gottes bald hierhin und bald dorthin geweht wird (s. Abb. 1). Mit dieser allegorischen Darstellung versuchte man zu erklären, warum das Schicksal manchmal Unglück und Ungerechtigkeiten im Leben zuließ. Man stellte sich nämlich vor, dass die Göttin durch die Winde gelegentlich ihr Gleichgewicht verlieren konnte. Sie steht deshalb auch für die unstete und wechselhafte Seele des Menschen und der Gesellschaft, die oft ihren eigenen verworrenen Regeln zu gehorchen scheint. Selbst Shakespeare verarbeitete diese Vorstellung in seinen Gedichten, indem er das Schicksal als „dark mistress“ beschrieb, die ihn lähmte („So I was made lame by Fortune’s dearest spite“) und die er „as black as hell, as dark as night“ charakterisierte (vgl. Dawkins, S.68 f.).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1: „Fortune and the Globe“ aus George Wither: Collection of Emblems, Ancient and Modern, 1635.
Das „Fortune“ Konzept wurde von Boccaccio als einem der Ersten in seinem Werk De Casibus Virorum Illustrorum (1363/4) definiert, welches in moralischen Exempeln davor warnt, vom Schicksal allzu abhängig zu werden. Denn das personifizierte Schicksal galt als willkürlich und unbeständig. (vgl. Rose, S.199f). Nur das Leben nach dem Tod konnte deshalb in einer solchen „incomprehensible, imperfect world“ (Rose, S.202) gewünscht werden und die Flucht „into a devinely ordered and therefore perfect one“ (Rose, S.202). Das Leben in dieser „göttlichen“ Welt hing jedoch nach christlichem Glauben davon ab, wie man selbst zuvor in der Welt der Lebenden mit seinem Schicksal verfahren hat. Nicht nur der Fall ganzer Nationen sondern vielmehr der Mensch selbst, der zuvor nur eine sekundäre Rolle im Lauf der Welt gespielt hatte, trat nun in den Fokus. Die Schicksale großer Herrscher wurden deshalb herangezogen, um zu analysieren, warum diese letztendlich scheiterten, um daraus Lehren für das eigene christliche Leben zu ziehen (vgl. Rose, S.202).
Im englischen Sprachraum wurde ab 1559 The Mirror for Magistrates regelmäßig veröffentlicht, der die Elisabethanische Leserschaft durch Erzählungen von Geistern verstorbener und gescheiterter Größen der englischen Geschichte den „proper way to behave“ (Rose, S.203) lehrte. Selbst Caesar kam in der Ausgabe von 1587 zu Wort. Diese Editionen waren als Fortsetzung von Boccacios De casibus gedacht und umspannten zu Shakespeares Zeiten einen Zeitraum von König Albanactus, dem Gründer von Albanien (ca. 1085 v. Chr.), bis zu Königin Elizabeth I selbst (vgl. Ward (u.a.), S.192). In seiner Einleitung beschreibt Herausgeber Baldwin die Absicht des Mirror for Magistrates wie folgt: „A mirour for al men as well nobles as others to shewe the slipery deceiptes of the wavering lady (i.e. Fortune), and the due rewarde of all kinde of vices“ (Baldwin bei Ward (u.a.), S.192). Zumeist wurde das Scheitern der verschiedenen Machthaber durch ein und denselben fatalen Fehler eingeleitet, nämlich durch ihre „ambition“ (Rose, S.203), dem Verlangen, immer mehr zu erreichen. Fahrnham konkretisiert das zugrundeliegende Konzept wie folgt: „The idea that tragedy is the natural portion of any man in high place, simply because he has climbed upon Fortune’s wheel and must meet the downward turn eventually“ (Farnham, S. 291). Der Gedanke des Wheel of Fortune wird deshalb in einer weiteren Beurteilung der zentralen Figuren Julius Caesar, Brutus und Cassius noch eine Rolle spielen.
III Elisabethanische Historiographie
1. Wahrheitsempfinden der Elisabethanischen Historiographen
Im Gegensatz zu der heutigen Sensibilität für historische Ereignisse, d.h. der geforderten objektiven Distanz zu der Vergangenheit, tendierten elisabethanische Historiographen dazu, Geschichte umzudeuten und an die eigene Zeit anzupassen (vgl. Breuer, S.228). Der heutzutage angewandte „New Historicism“ baut auf der These auf, dass vor allem die eigene Persönlichkeit und die gemachten Erfahrungen das eigene Geschichtsbild beeinflussen und prägen (vgl. Derrick, S.5). Deshalb kann Geschichtsschreibung nie gänzlich ohne subjektive Wertung geschehen, wenn sie wie in elisabethanischer Zeit rein auf Zeitzeugenberichten und mündlicher Tradition basiert. Dies hat zur Folge, dass „trotz liebevoller Beschäftigung mit alten Chroniken und nationaler Vergangenheit, trotz ‚antiquarischer’, historisierender Bemühungen um das zeitlich Ferne (...) die Trennlinie zwischen Vergangenheit und Gegenwart unscharf“ bleibt (Breuer, S.228).
Heutige moderne Standards der verlässlichen Dokumentation und der unbeeinflussten Berichterstattung waren damaligen Historikern fremd. Nach Goy-Blanquet kann Historiographie nur als modern gelten, wenn diese folgende vier Kriterien erfüllt: erstens, Säkularisation, das bedeutet die Unabhängigkeit von theologischem Gedankengut und dessen Vorstellungen; zweitens, experimentelle Forschung, die dokumentierte Beweise und Vergleichsstudien gegenüber alten Zeugnissen bevorzugt; drittens, ein Gespür für historische Entwicklung, das die traditionelle Analogiebildung, d.h. die unvoreingenommene Übereinstimmung zwischen Vergangenheit und Gegenwart außer Kraft setzt und viertens, die Abgrenzung dieses Forschungsbereichs von der Philosophie und der Poesie, welche diesen Bereich von dem Zwang loslöst, unterhaltend oder überzeugend zu sein (vgl. Goy-Blanquet, S.65).
Der Hauptgrund, weshalb die Zeugnisse der elisabethanischen Historiker oft keiner dieser Kategorien gerecht werden konnten, waren die andersartigen Prioritäten der damaligen Zeit. Bei der Abfassung einer Historie ging es ihnen nicht allein um die Information der Leser sondern um ihre moralische Instruktion, wie bereits im vorherigen Kapitel ausgeführt wurde, und deren Unterhaltung. Um die Leser nicht zu langweilen, wurden gerne Anekdoten, Gerüchte und Schauergeschichten in die Geschichten eingewoben, dies jedoch ohne von der Behauptung abzuweichen, die unbedingte Wahrheit der Ereignisse darstellen zu wollen. Auch propagandistische Zwecke und die Glorifizierung und Fälschung ganzer Ahnenlinien post mortem lagen den Historikern nicht fern (vgl. Derrick, S.47). Im Gegenteil, oft waren sie auf die Gunst ihrer wohlhabenden Gönner angewiesen und mussten sich deren Anweisungen fügen (vgl. Suerbaum, S.358). Deshalb ist es bei einer Untersuchung der Erzeugnisse elisabethanischer Historiker und Chronisten stets schwierig zu entscheiden, welchen Wert diese auf Fakten und welchen auf Interpretation legen.
1.1 Die Chronisten der Tudors
Ein eindrucksvolles Beispiel dieser Wahrheitsvorstellung in der Geschichtsschreibung liefern die Chronisten, die sich zur Zeit der Tudors fleißig bemühten, ihre königlichen Auftraggeber zufriedenzustellen. Zu elisabethanischer Zeit war der Gedanke weitverbreitet, dass Geschichte sich wiederholt. Deshalb galt folgender Grundsatz: „The past could be used as a mirror to project critical reflections on present realities, ‘and tax the vices of those that are yet living, in their persons that are long since dead’“ (Goy-Blanquet und Raleigh 1829, S.61). Heinrich VII gilt in diesem Genre als Urvater der tudorianischen Historiographie, der Geschichtsschreibung dazu missbrauchte, seinen Anspruch auf den Thron zu legitimieren (vgl. Goy-Blanquet, S.62). Um nicht als Rebell zu gelten, der widerrechtlich den englischen Thron von Richard III usurpiert hatte, musste er diesen in den Historien in einem besonders schlechten Licht, genauer gesagt als Tyrannen darstellen. Denn auch Heinrich VII, wie auch seine Nachfolger, verurteilte selbst jegliche Rebellion gegen einen legitimen Thronanwärter, denn dies galt zu seiner Zeit als Landesverrat. Heutige Historiker sind nahezu davon überzeugt, dass das schlechte Bild, das von Richard III überliefert wurde, ganz allein auf die verfälschte Darstellung seiner Person in elisabethanischen Chroniken zurückzuführen ist. Laut dieser Quellen galt Richard III demnach als missgestalteter Tyrann auf dem englischen Thron, der nicht davor zurückschreckte, um der Erhaltung der Macht willen die eigenen Neffen zu töten. Selbst Shakespeare übernimmt dieses Bild und lässt Richards Figur zu Beginn des ersten Akts noch als Lord of Gloster mit folgenden Worten auftreten:
GLOSTER: I, that am curtail’d of this fair proportion
Cheated of feature by dissembling nature,
Deform’d, unfinish’d, sent before my time
Into this breathing world scarce half made up,
(...)
And therefore, – since I cannot prove a lover,
To entertain these fair well-spoken days, –
I am determined to prove a villian,
And hate the idle pleasures of these days.
(Shakespeare: Richard III, I.i.18-21, 28-31)
Nicht anders praktizierte es Königin Elizabeth I., die Enkelin von König Heinrich VII. Die Analogie zwischen Vergangenheit und Gegenwart war zu ihrer Zeit und besonders am Hofe besonders verbreitet. Aufgrund der eigenen Selbstwahrnehmung sah sie sich als eine Erbin der Ahnenlinie Richards II, was sie mit folgendem Zitat vehement bekräftigte: „But I am Richard II. Know ye not that?“. Als Konsequenz aus diesem Anspruch ließ sie alle schriftlichen Zeugnisse, die dem Bild Richards II schaden könnten, rigoros zerstören. Diese Maßnahmen trafen auch Schriftsteller wie John Hayward, der für sein Werk über Henry IV mit dem Titel The First Part of the Life and Raigne of King Henrie IIII (1599), weil es auch den Fall Richards II behandelte, ins Gefängnis musste. Er wurde bezichtigt, in die Verschwörung von Lord Essex verwickelt zu sein und alle Kopien seiner Werke wurden verbrannt (vgl. Goy-Blanquet, S.61). Sein entscheidender Fehler war es nämlich, sein Buch dem Earl of Essex zu widmen und ihn mit dem Usurpator Henry Bolingbroke zu vergleichen, der Richard II vom Thron stürzte. Da seine Formulierungen Essex dazu zu ermutigen schienen, Bolingbroke als Vorbild zu nehmen, ist die Empörung Elisabeths nicht ganz unbegründet. (vgl. Dawkins, S.3) Nach diesem Vorfall wurde durch das Privy Council angeordnet, dass keine Historie über die Geschichte Englands ohne vorherige Autorisierung veröffentlicht werden durfte. Etwaige Parallelen, die ohne ausdrücklichen Wunsch der Herrschenden verstorbenen oder noch lebenden Monarchen zugeordnet werden konnten, waren demnach strengstens zu vermeiden (vgl. Goy-Blanquet, S.61).
Aus den zahlreichen Beispielen elisabethanischer Historiographie ist zu erkennen, dass der Begriff der „Wahrheit“ nicht viel mit Faktentreue und freier Meinungsäußerung gemein hatte: „What counts as knowledge is simply a way of speaking tied to the viewpoint of the powerful“ (Wilson, S.7). Dieses gelenkte „Wissen“, welches an spätere Generationen weitergegeben wurde, hing demnach allein von den Persönlichkeiten der Herrschenden ab, da eine Trennung zwischen Wahrheit und Macht immer unmöglicher wurde (vgl. Wilson, S.7).
1.2 Legitimation Englands als Erbe Roms
„The Tudor thirst for respectability turned the quest of origins into a national pastime“ (Goy-Blanquet, S.61). Sowohl Herrscher als auch Privatpersonen und Institutionen versuchten in der Tudorzeit, „Ahnenforschung” zu betreiben. Englands Könige sahen die eigene Zivilisation nur allzu gerne beeinflusst durch große und mächtige Reiche, die versucht hatten Britannien zu erobern und deren Kultur nach Rückzug oder Verfall mit in die englische einfloss. Sie legten sehr viel Wert auf eine „cultural marriage“ (Derrick, S.45) Englands mit Rom. Diese Beschäftigung konnte recht merkwürdige Blüten tragen, indem versucht wurde, die eigenen Wurzeln auf römischen und sogar trojanischen Ursprung zurückzuführen, die Kultur der Gründungsväter Roms (vgl. Parry, S.8 f.).
Um dieses kulturelle Erbe Roms zu legitimieren, ließen sich die elisabethanischen Historiker eine sagenumwobene Geschichte über den Gründer des britischen Commonwealth einfallen. Diese Legendenbildung fand bereits im zwölften Jahrhundert mit Geoffrey of Monmouths History of the British Kingdom (Historia Regum Britanniae) ihren Anfang. Edmund Spenser ergänzte sie in Elisabethanischer Zeit im Exil. Diese Geschichte handelt von einem gewissen „Brut the Trojan“, der in Rom aufgrund eines Irrtums den eigenen Vater, interessanterweise der Urgroßvater des großen Gründungsvaters Aeneas, tötete. Dieser Brut soll nun auf der Flucht nach England gekommen sein und den Geist des trojanischen Helden Aeneas mit in die Hauptstadt der englischen Vorväter, nämlich London, gebracht und es zu einem neuen Troja gemacht haben. Aus der Linie der Könige, die Brut folgten, entstammte niemand Geringeres als König Artus selbst, eine Gestalt aus der mythischen englischen Vergangenheit. Dieser machte aufgrund seiner allgemeinen Akzeptanz und Bewunderung die Gründungswurzeln bis nach Rom glaubhaft. Selbst Königin Elizabeth I stimmte in diese Legende mit ein, da die Tudors ihre Ahnenlinie auf das walisische Haus des Artus zurückführten. Dieser Gründungsmythos war Stoff zahlreicher Balladensänger, Poeten und Geschichtenerzähler. Auch Shakespeare stellt mit seinen Roman Plays einen Teil dieser Erzähltradition dar (vgl. Derrick, S.46).
2. Shakespeares Quellen
Wie in der vorherigen Darstellung bereits anklang, handelt es sich bei Shakespeares Roman Plays thematisch nicht etwa um singuläre Ereignisse sondern um eine kulturelle Bewegung seiner Zeit mit der Antike zum Vorbild. Aufgrund dieser Allgegenwart antiker Stoffe im elisabethanischen Alltag musste Shakespeare nicht lange suchen, um Inspirationen für die Handlung und die Figuren seiner Stücke zu finden. Interessant ist in dieser Hinsicht, welche Quellen Shakespeare in seiner Recherche für die Roman Plays herangezogen hat und mit welcher Sorgfalt er dabei vorging.
2.1 Shakespeares Bildung
Obwohl über den Bildungsweg William Shakespeares nicht viel bekannt ist und meist nur Vermutungen angestellt werden, so nimmt man zumindest an, dass er die Stratford Grammar School besucht haben könnte. Diese besuchte er jedoch mit der Einschränkung, dass sein Vater ihn zu einem unbekannten Zeitpunkt wieder von der Schule nehmen musste, da er seine Mithilfe zu Hause benötigte. Aufgrund dieses frühen Abbruchs wird Shakespeare zwar Latein gelernt haben und in Kontakt mit ein paar Originalen Stücken gekommen sein, wie zum Beispiel mit Vergils Eklogen oder Priscians Institutiones Grammaticae, jedoch nur auf ganz rudimentärer Ebene, zumeist aus grammatikalischen Hintergründen. Zudem konnte man von einem elisabethanischen Schüler, der sogar die „grammar school“ vollständig absolviert hatte, nicht behaupten, dass er Werke eines Autors wie Vergil wirklich „las“, sondern vielmehr, dass er sich mit Hilfe seines Lehrers mit viel Mühe durch ein Buch der Aeneis gearbeitet hatte (vgl. Thomson, S.17f.).
2.2 Shakespeares Zugang zu antiken Stoffen
Aufgrund seiner vermutlich unzulänglichen Kenntnisse in der lateinischen Sprache musste Shakespeare sein Wissen über die antike Geschichte demnach aus anderen Quellen als den lateinischen Originalen schöpfen. Zunächst war Shakespeare, wie schon erläutert wurde, im Alltag durch zahlreiche antike Zeugnisse umgeben; dies konnte zum einen durch die Kunst und die Architektur (zum Beispiel Fresken, Wandmalereien, Statuen etc.) aber auch zum anderen durch literarische Übersetzungen antiker Texte oder die Adaption antiker Mythen in zeitgenössischen Werken geschehen (vgl. Thomson, S.38 ff.). Letzteres brachte jedoch unwillkürlich einen Verlust an Authentizität aufgrund der Übersetzungen mit sich, die meist 1500 Jahre nach Erstellung des Originals und durch Angehörige einer anderen Kultur verfasst wurden. Wie bei jedem editorialen Verfahren bringt der Übersetzer oder Herausgeber stets auch ein Stück eigene Interpretation mit in die neue Fassung ein, von den normalen sprachlichen Verlusten bei einer Übersetzung aufgrund der interkulturellen Barrieren ganz zu schweigen. So leiden diese Übersetzungen nicht nur unter chronologischen sondern auch unter interkulturellen Unterschieden zu dem Original.
[...]
- Arbeit zitieren
- Anne-Mareike Franz (Autor:in), 2008, Die Darstellung der Antike in William Shakespeares "Julius Caesar" und "Antony and Cleopatra", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/304569
Kostenlos Autor werden
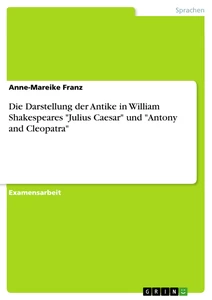
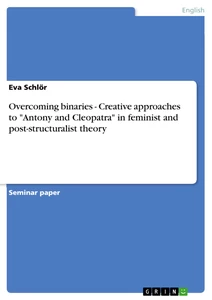
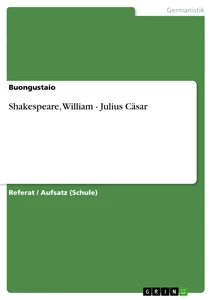
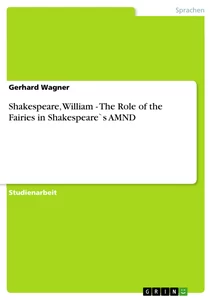
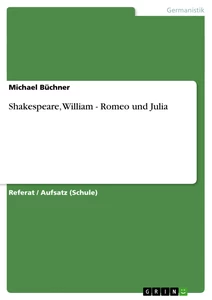

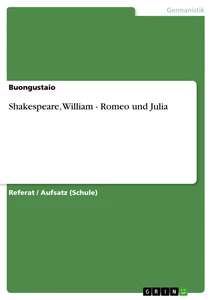

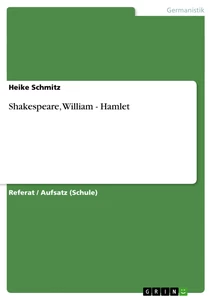


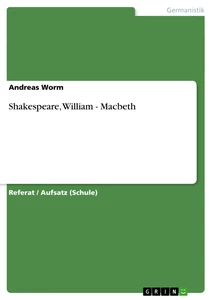


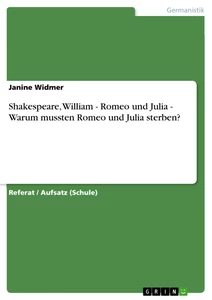
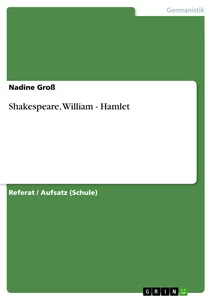
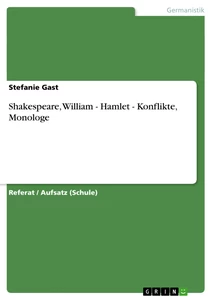

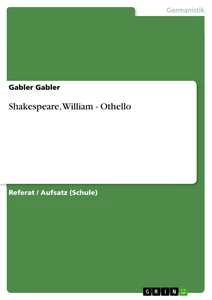
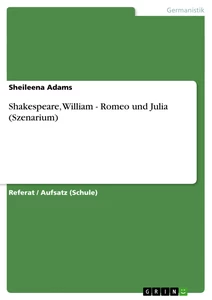
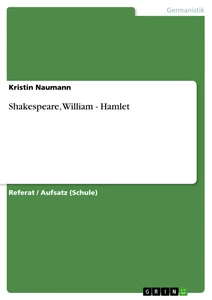
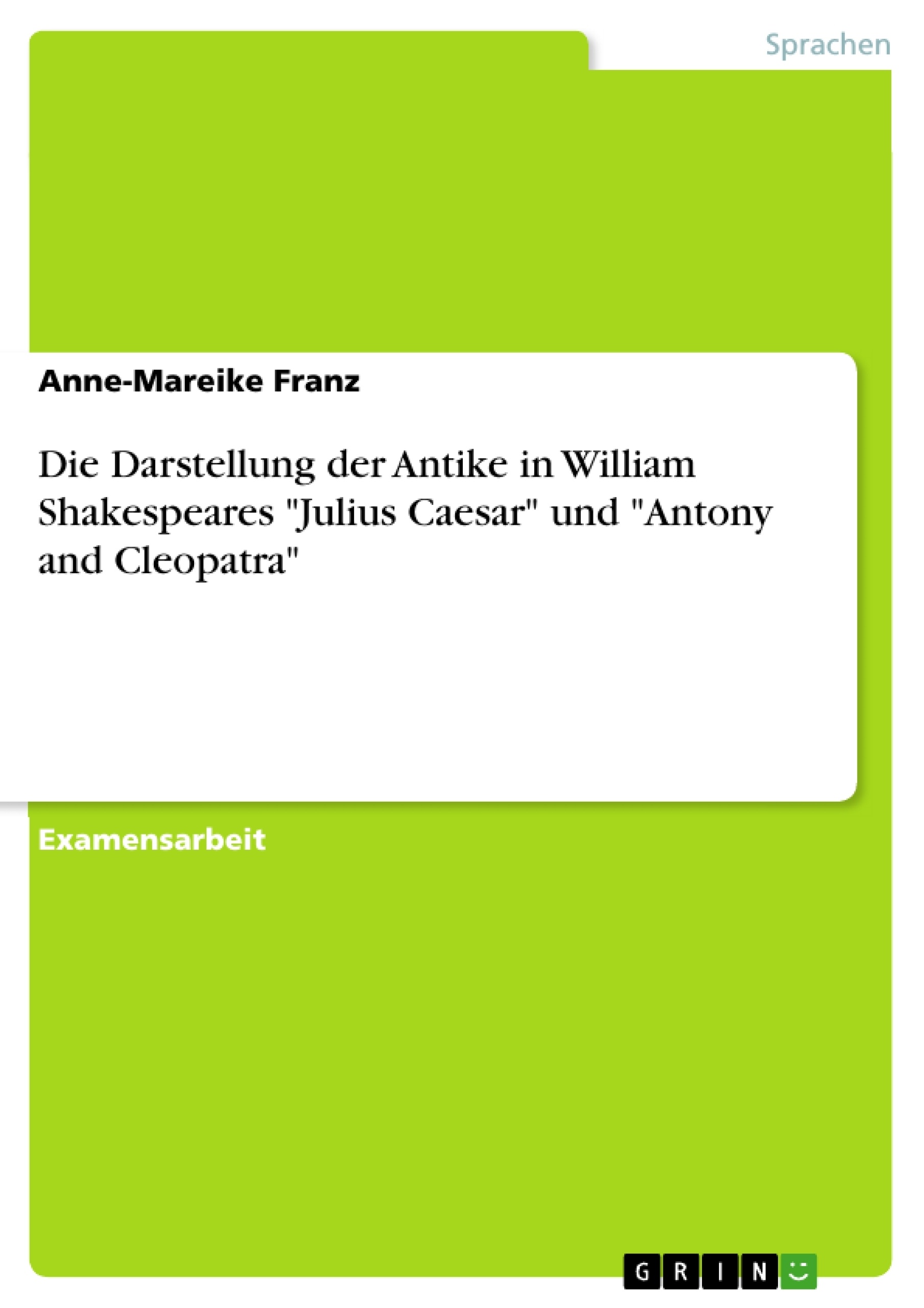

Kommentare