Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1 Hinführung
2 Sartre über das Bewusstsein
2.1 Thetisches und Nicht-thetisches Bewusstsein
2.2 Bewusstsein als Negation
3 Freiheit, Angst und Unaufrichtigkeit
4 Ich und der Andere
4.1 Das Sein Für-Andere
4.2 Das Für-Andere als Entfremdung
5 Eine soziologische Perspektive auf die Selbsterkenntnis
5.1 Mead und der Sozialbehaviorismus
5.2 Selbstbewusstsein bei Mead
5.2.1 Play und Game
5.2.2 I und Me
5.3 Die Frage nach der Möglichkeit zur Selbsterkenntnis
5.4 Die Internalisierung des Blickes
6 Eine soziologische Perspektive auf die Objektseite
6.1 Der Goffmensch in der Interaktion
6.2 Wahre oder unwahre Darstellungen
6.3 Die existentialistische Objektseite
7 Fazit
8 Literaturverzeichnis
1 Hinführung
Nicht Folter, nicht Fegefeuer, sondern „Die Hölle, das sind die Anderen.“1 So konkludiert Jean-Paul Sartre sein Werk „Geschlossene Gesellschaft“ (1944). Es handelt sich dabei um eines der wohl bekanntesten Zitate Sartres in einem Theaterstück, das vor allem den dritten Teil seines Hauptwerkes „Das Sein und das Nichts - Versuch einer phänomenologischen Ontologie“ (1943) illustriert. In dem Spiel werden die drei Hauptcharaktere Estelle, Garcin und Inés nach ihrem Tod in einen Raum gebracht, in dem sie die Höllenqualen erwarten. Im Verlauf des Gesprächs, und am Ende des Stückes in dem genannten Zitat Garcins auf den Punkt gebracht, stellen sie fest, dass sie selbst es sind, die sich gegenseitig foltern. Die Qual für einen jeden liegt im urteilenden Blick des Anderen2, der ihnen nie das Bild zeich- net, das sie gerne von sich selber hätten. Sartre unterstreicht damit die Aussagen aus dem vierten Kapitel „Der Blick“ im dritten Teil von „Das Sein und das Nichts“, dessen zentrale Frage die nach der Rolle des Anderen ist. Wie lässt sich meine ursprüngliche Erfahrung des Anderen beschreiben und welche Bedeutung hat der Andere dabei für die Konstitution meiner Selbstwahrnehmung?
Was Sartre hier als philosophische Fragestellung im Rahmen einer ontologischen Untersu- chung des Bewusstseins aufwirft, ist ein Thema, welches auch in der Soziologie auftaucht.
Hegels Herr-und-Knecht-Motiv, das Sartre in seiner Philosophie durch die Rezeption der Begriffe Für-sich und An-sich aufgreift und weiterdenkt, findet sich auch in mikrosoziolo- gischen Ansätzen wieder. Genauso wie Sartre ist auch George Herbert Mead durch die Philosophie Hegels beeinflusst und teilt somit Grundgedanken einer Theorie, in der die spezifische Gegenüberstellung des Ichs mit dem Anderen thematisiert wird. Hegel be- schrieb bereits in der „Phänomenologie des Geistes“ (1808) die „Selbstanschauung des einen im Anderen“3. Die wechselseitige Verständigung über Bedeutungen und die Annah- me, dass Individuen auf Grundlage dieses Prozesses des sich gemeinsamen Anzeigens handeln, ist, wie ich im Laufe der Arbeit erläutern werde, eine Grundprämisse des Symbo- lischen Interaktionismus. George Herbert Mead, der in seinem Werk „Geist, Identität und Gesellschaft“ (1934) dafür die Grundsteine gelegt hat, veranschaulicht, dass in der Interak- tion nicht nur gegenüber Gesten, Gesprächsinhalten und Gegenständen eine bestimmte Haltung eingenommen wird, sondern die Individuen selbst zum Objekt der Interaktion werden können. Damit ist auch die Bedeutung des Ichs, auf das Bezug genommen wird, ein Ergebnis der Interaktion. Insofern behaupte ich, dass es hier in der Betrachtung eines mir durch den Anderen vermittelten Selbstbewusstseins einen Schnittpunkt zwischen Sart- re und Mead gibt. Sartres Existentialismus, der oft als negativ und zutiefst pessimistisch bewertet wurde, hat eine Idee inne, die in der Soziologie auf eine Weise behandelt wurde, die trotz ihrer Ähnlichkeit zu Sartre eine andere Konnotation bekommt.
Eine andere soziologische Theorie, die hier ebenfalls genutzt werden soll, greift wiederum Grundideen Meads auf. Erving Goffman macht sich ganz bestimmte Prinzipien Meads zunutze. Sein Individuum in „Wir alle spielen Theater“ (1959) befindet sich in einer Posi- tion, in der es sich sowohl bewusst darstellt als auch durch den Anderen beschränkt wird. Goffman wurde häufig für diese Beschreibung des Ichs als zynischen Akteur, der immer irgendeine Rolle spielt, kritisiert. Dem Grunde nach handelt es sich hier um eine soziologi- sche Darstellung des Seins Für-Andere bei Sartre. Daher sehe ich die Möglichkeit für eine differenziertere Auseinandersetzung, da auch der Akteur bei Goffman einen existentialisti- schen Moment erlebt, indem die eigene Rolle eine Darstellungsleistung ist, die auch von der Akzeptanz und Bestätigung anderer abhängt.
Insofern möchte ich mit Hilfe von Mead und Goffman unterschiedliche Aspekte in der Frage nach Bewusstsein und dessen Konfrontation mit dem Anderen beleuchten und somit eine mögliche Leerstelle in der Theorie Sartres aufzeigen. Ich werde dazu in dieser Arbeit zunächst den Bewusstseinsbegriff und die Rolle des Anderen im Existentialismus von Jean-Paul Sartre betrachten, so wie er sie insbesondere in „Das Sein und das Nichts“ be- schreibt. Auf dieser Grundlage möchte ich mich dann im zweiten Teil der Arbeit mit den Ideen des Sozialbehaviorismus von George Herbert Mead in „Geist, Identität und Gesell- schaft“ und mit der Theorie Erving Goffmans über Selbstdarstellung im Alltag auseinan- dersetzen. Dadurch soll gezeigt werden, dass die Auseinandersetzung über Bewusstsein und die Rolle des Anderen auf Grundlage von sehr ähnlichen Konzepten geschieht. Lässt sich anhand dessen eine soziologische Perspektive auf Sartre entwickeln?
Die thematische Nähe dieser soziologischen Ansätze mit der Philosophie Sartres findet in der Literatur nur begrenzten Widerhall. Eine ausführliche Auseinandersetzung mit den Vergleichspunkten zwischen Sartre und Mead wurde vor allem von Mitchell Aboulafia vorgenommen. Wesentliche Bezugsquellen zum Vergleich zwischen Sartre und Goffman sind Aufsätze von Peter Ashworth und Ronald Hitzler. In der vorliegenden Arbeit wird es zu einer Gegenüberstellung von Sartre und Mead zum einen und Sartre und Goffman zum anderen kommen, wobei ich ausgewählte Ideen der Philosophie Sartres diskutieren und dabei die Nähe und Unterschiedlichkeit in der Thematisierung von Bewusstsein und Selbsterkenntnis aufzeigen möchte. Obwohl sich diese Arbeit an Vergleichspunkten zwi- schen Sartre, Mead und Goffman bedienen wird, soll es aber eher darum gehen, mit Hilfe von Mead und Goffman einen Blick auf Sartre zu entwickeln, der die Probleme Sartres stärker herausstellt und ihnen einen anderen, weil sozialwissenschaftlichen, Fokus verleiht. Es soll weder darum gehen, nachzuweisen, dass Mead oder Goffman bessere Ansätze ha- ben als Sartre noch dass der eine den anderen beeinflusst hat. Vielmehr möchte ich zeigen, dass es einen philosophischen Ansatz gibt, der Fragen aufwirft, die auch der Soziologie gehören und die in der Diskussion mit Mead und Goffman einen anderen Aspekt verliehen bekommen.
2 Sartre über das Bewusstsein
Bevor ich danach frage, welche Rolle der Andere für mein Bewusstsein spielt, muss ge- klärt werden, was Bewusstsein im Sinne Sartres überhaupt sein soll. Dabei ist es für den Verlauf der Argumentation besonders relevant, den Bewusstseinsbegriff vom Begriff der Selbstreflexion zu unterscheiden. Denn eine der zentralen Aussagen Sartres über das Be- wusstsein ist, dass ich nicht nur dann Bewusstsein von mir habe, wenn ich mich in meinem Sein, in meinen Taten und Gedanken erkenne, sondern auch schon vorher. Im Folgenden soll es zunächst um die Beschreibung jenes Bewusstseins gehen, das schon vor der Refle- xion vorhanden ist.
In Sartres Argumentation taucht eine Kritik an Descartes auf, die dazu beiträgt, einen ganz wesentlichen Aspekt in der Herleitung und Definition des Bewusstseins herauszustellen. Wenn Descartes sagt „Ich denke, also bin ich.“(Cogito ergo sum.) und dies als einzige gesicherte Wahrheit annimmt, wird dabei nach Sartre folgendes Problem sichtbar: Er macht sein Sein - oder zumindest die Gewissheit darüber - von der Erkenntnis über dieses Sein abhängig.4 Das würde bedeuten, dass es ein Sein gibt, das erst in der Reflexion weiß, dass es existiert. Dabei beachtet Descartes aber nicht, dass es einen Unterschied gibt zwi- schen jenem Sein, das er vor der Erkenntnis ist und jenem, das er in der Reflexion an- schaut. Die Gewissheit über das Ich, das Descartes erkennt, ist ein Resultat von Reflexion und er ignoriert damit, dass es sich eben nur um eine Gewissheit über das Ich in der Selbst- anschauung handelt. Es gibt ein Ding und das denkt. In einem nächsten Schritt erkenne ich, dass ich dieses Ding bin, das denkt. Der Gegenstand, über den ich reflektiere, bin ich selbst. Das denkende Ich wird in der Reflexion zum Objekt meines Denkens. Aus der Er- kenntnis, dass ich denke, folgt daraufhin die Erkenntnis, dass ich wohl existiere, da es ein Objekt geben muss, das das Denken vollzieht. Das heißt aber, dass das Bewusstsein über mich wie eine Eigenschaft zum Objekt hinzukommt und ich aufgrund dieser Eigenschaft dann den Schluss ziehe, dass das Objekt existiert. Descartes hat damit keine Gewissheit über das Ich, das vor der Reflexion existiert hat, sondern seine Wahrheit über das Ich ist eine Wahrheit über den Moment der Selbstanschauung allein.5 Sartres Kritik an Descartes bezieht sich auf die Tatsache, dass Descartes in der Reflexion ein Objekt erkennt, dessen Existenz er mit eben dieser Reflexion zur Wahrheit macht, dessen Wahrheit damit aber nicht im zeitlichen Verlauf besteht. Das Sein des Objektes ist somit auf das reduziert, wo- rüber wir Erkenntnis erlangen und ohne diese Erkenntnis würde das Objekt sein Sein ver- lieren.6 Descartes macht demzufolge die Erkenntnis zum Ausgangspunkt für jegliche Wahrheit über das Sein. Sartre hingegen verteidigt einen Standpunkt, nach dem das Sein des Bewusstseins, nicht die Reflexion, Ausgangspunkt und Grundvoraussetzung aller Er- kenntnis ist.
2.1 Thetisches und Nicht-thetisches Bewusstsein
Ob Sartre mit der Kritik an Descartes tatsächlich dessen Kerngedanken berührt oder nicht, sei an dieser Stelle dahin gestellt. Ausschlaggebend ist, dass Descartes cogito tatsächlich schon existierte, bevor es sich in der Reflexion erkannt hat. Die Erkenntnis, das Ich zu sein, das zweifelt, setzt nach Sartre bereits voraus, dass es vor der Reflexion ein Bewusstsein gegeben hat, das sich des Zweifelns bewusst war. Genau dies ist nun Ausgangspunkt von Sartres Überlegungen.
Das cogito ist bei Sartre lediglich die „Manifestation des Bewusstseins.“7 Ich habe es nicht, sondern ich bin mein Bewusstsein. Es ist nicht so, dass es das Subjekt gibt und es als eine Eigenschaft unter vielen auch Bewusstsein hat, sondern das Subjekt ist immer schon Bewusstsein - genau das ist seine „Seinsdimension“.8 Damit richtet sich Sartre gegen eine Auffassung von Bewusstsein, nach der dieses wie ein leeres Gefäß mit Objekten gefüllt wird. Bewusstsein darf nicht als etwas verstanden werden, das die Objekte der Welt in sich trägt, die dann als Inhalt meines Bewusstseins von mir entdeckt werden müssen. Sondern das Bewusstsein ist ein Sein, das entweder bei sich ist oder bei einem Objekt, das in der Welt verbleibt.9 Das bedeutet, es ist entweder nicht-thetisch, das heißt nicht Objekt- setzend, sondern reines Erleben, oder es ist thetisch, das heißt Gegenstand-setzend.10
Zur Erklärung dessen wählt Sartre folgendes Beispiel: Man stelle sich vor, ich lese ein Buch und bin ganz in mein Lesen vertieft. In diesem unreflektierten Dasein, in dem ich nur das Buch lese, ohne mich dabei zu erkennen, bin ich ganz meine Tat. Dieses Ich bezeichnet Sartre als das präreflexive cogito. Das präreflexive cogito ist ein Bewusstsein, das kein Ich als Gegenstand der Reflexion hervorbringt, sondern darin besteht, in seinem Erleben auf- zugehen.11 Das Bewusstsein ist hier nicht-thetisch. Weder das Buch noch das lesende Ich werden von meinem Bewusstsein als Objekte erkannt, sondern das Bewusstsein ist ganz bei sich. Es ist eins mit seiner Tat. Das ist damit gemeint, wenn Sartre sagt, dass ich mein Bewusstsein bin. Es hat in dem Moment des Lesens eine ganz bestimmte Form. Die Mani- festation ist das Lesen des Buches.
Wenn mich dann aber jemand fragt, was ich tue, dann kann ich sofort antworten: „Ich lese.“ Darum muss das präreflexive cogito Voraussetzung für die reflexive Erkenntnis sein.
In diesem Moment löse ich mich von dem Ich, das ganz in seiner Tat aufgegangen ist. Man würde doch aber sagen, dass ich schon weiß, dass ich existiere, noch bevor mich jemand fragt und ich mich selbst als Objekt der Erkenntnis setzte. Bevor ich Distanz zu dem auf- baue, was ich tue, indem ich sage „Ich lese.“, vollziehe ich eine Handlung, in der ich ganz bei mir bin. Ich war mein Lesen, ohne zu sehen, dass ich das lesende Ich bin. Die Feststel- lung, die ich in der Reflexion mache, lässt sich nach Sartre aber nur dadurch erklären, dass ich in meiner Präreflexivität bereits ein Bewusstsein davon hatte, das lesende Bewusstsein zu sein. Die Reflexion bringt lediglich ein Ich als Objekt hervor, das das Lesen vorge- nommen hat. Die unmittelbare Wahrnehmung meines Bewusstseins ist jedoch konstitutiv dafür, dass es das reflexive Bewusstsein überhaupt gibt.12 Denn um zu verbalisieren, dass ich beispielsweise traurig bin, muss ich doch aus einem Bewusstsein von Traurigkeit her- austreten. Ich muss schon vorher Bewusstsein von Traurigkeit gewesen sein, um dieses in der Reflexion anzuschauen. Nur bin ich vorher in meinem Erleben aufgegangen und war deshalb zu dicht an meinem Bewusstsein von Traurigkeit, als dass ich ein Ich hätte setzen können.
2.2 Bewusstsein als Negation
Die Betrachtung dieser Grundstruktur des Bewusstseins bringt Sartre zu der Unterschei- dung zweier Seins-Formen, dem An-sich-Sein und dem Für-sich-Sein, die die Charakteris- tika des Bewusstseins verdeutlichen werden. Dabei widmet er der Beschreibung des Seins An-sich verhältnismäßig wenig Worte. Es gibt nicht mehr über es zu sagen, als dass es ist, was es ist und dass es in seinem Sein von nichts anderem abhängt als von sich selbst.13 Das Sein An-sich ist gleichzusetzen mit dem Ding-Sein. Das Sein des Steins ist, dass es ein Stein ist. Ein Stein ist genau das, was er ist. Sein Sein ist durch absolute Identität mit sich selbst gekennzeichnet. Er kann weder bei sich sein noch in Distanz zu sich treten noch sich irgendwie zu sich selbst verhalten.
Mensch-Sein hingegen bedeutet, die Fähigkeit zu haben, sich von anderem zu unterschei- den. Genau das ist es, was Sartre Bewusstsein nennt.14 Für diese Seinsform, die das Be- wusstsein ist, benutzt Sartre den Begriff des Für-sich-Seins. Während das An-sich völlige Identität ist, ist das Für-sich Nicht-Identität, was Sartre zusammenfasst durch: „Der Exis- tierende ist das, was er nicht ist, und ist nicht das, was er ist.“15 Wie ist dieser für die Philo- sophie Sartres so essentielle Satz zu verstehen? Wenn ich einen Gegenstand ansehe, dann nehme ich dabei eine innere Negation vor, in der ich mich vom Objekt der Wahrnehmung unterscheide. Mein Bewusstsein, das einen Baum anschaut, geht mit der Feststellung ein- 7! her, selbst nicht dieser Baum zu sein. Bewusstsein, das Sein Für-sich, ist also Negativität. Es nichtet sich, da es immer in dem Prozess besteht, sich von den Dingen zu unterschei- den.16 Ich bin nicht das Buch, nicht der Stein, ich weiß, dass ich mich von dem Tisch un- terscheide. Dies alles sind Dinge in der Welt, außerhalb von mir. Darum ist das Bewusst- sein das, was es nicht es.
Gleichzeitig unterscheidet sich das Bewusstsein auch von sich selbst, da es immer intenti- onal ist. Diese Charakteristik des Für-sichs wird im sogenannten ontologischen Beweis Sartres deutlich: „Das Bewußtsein ist Bewußtsein von etwas: das bedeutet, daß die Trans- zendenz konstitutive Struktur des Bewußtseins ist; das heißt, das Bewußtsein entsteht als auf ein Sein gerichtet, das nicht es selbst ist.“17 Das Für-sich hängt von etwas anderem als sich selbst ab, da es grundsätzlich in einem Modus ist, Bewusstsein von etwas zu sein. Ein Bewusstsein, das nicht Bewusstsein von irgendetwas ist, gibt es nach Sartre nicht. Da nie- mand nur bewusst ist, sondern es immer etwas gibt, dessen man sich bewusst ist, ist man selbst notwendigerweise das, wovon das Bewusstsein nicht handelt.18 Dadurch ist das Be- wusstsein ebenfalls etwas, das nicht gleich mit sich selbst ist, da es als Bewusstsein von etwas immer schon eine Distinktion mit sich bringt. Denn als nicht-thetisches Bewusstsein von Traurigkeit ist es nicht das, was es ist, weil es Traurigkeit ist, indem es Bewusstsein von Traurigkeit ist und sich somit schon von ihr unterscheidet. Es ist nicht das, was es ist, weil es nicht wie der Stein immer ein Stein ist, sondern immer als Bewusstsein von etwas existiert.19 Also bin ich meine Traurigkeit in der Form, dass ich sie nicht bin, weil das Be- wusstsein bereits die Negation enthält. Ich bin meine Traurigkeit, indem ich Bewusstsein von Traurigkeit bin, aber ich bin nicht meine Traurigkeit im Sinne von völliger Identität. Ich bin nicht die Traurigkeit in Form einer Koinzidenz. Also ist das Bewusstsein nicht das, was es ist.
Sowohl das thetische als auch das nicht-thetische Bewusstsein sind intentional. Ersteres ist Bewusstsein von einem Objekt in der Welt. Letzteres ist Bewusstsein, das zwar keinen Gegenstand hervorbringt, aber dennoch Bewusstsein von etwas sein muss, weil auch ein nicht-thetisches Bewusstsein von Traurigkeit, Bewusstsein davon sein muss. Denn es gibt keine Traurigkeit als ein Ding in der Welt, zu der dann Bewusstsein als Eigenschaft hinzu- käme, sondern Traurigkeit das gleiche wie Bewusstsein von Traurigkeit.20 Traurigkeit ist kein Objekt außerhalb meiner selbst, sondern Traurigkeit existiert als Art und Weise des 8! Bewusstseins. Es gibt keine Traurigkeit, ohne denjenigen, der sie empfindet.
3 Freiheit, Angst und Unaufrichtigkeit
Es wurde erläutert, dass der Mensch kein Sein An-sich, sondern ein Sein Für-sich ist, weil er die Fähigkeit besitzt, sich von den Dingen der Wahrnehmung zu unterscheiden. Dies hat Sartre Bewusstsein genannt. Da Bewusstsein immer Bewusstsein von etwas ist, ist es getrennt von dem Objekt des Bewusstseins. Das Sein des Bewusstseins besteht somit in einer permanenten Nicht-Identität, indem es immer eine Negation vornimmt. Diese Tatsache führt zu einem Erleben, das nach Sartre sowohl durch Freiheit als auch durch Angst charakterisiert ist, welches in diesem Kapitel näher beschrieben werden soll.
Das Bewusstsein, dessen Sein in der Negation besteht, führt zu folgendem Problem: Wenn ich mir die Frage stelle, wer ich denn eigentlich bin, dann kann ich versuchen, mich über meine Vergangenheit zu definieren und werde daraufhin feststellen, dass ich im Bewusst- sein von ihr nicht mit ihr identisch bin. Ich bin jetzt und bin nicht mehr der, der ich war.
Gleichzeitig bin ich aber auch nicht meine Zukunft. Ich bin noch nicht der, der ich sein werde. Paradoxerweise muss ich mich aber doch auf meine Zukunft hin entwerfen, sonst hätte ich keinerlei Interesse daran, was mit mir morgen oder in fünf Jahren passiert. Versu- che ich die Frage, was ich bin, mit Attributen der Gegenwart zu beantworten, werde ich auch an dieser Stelle feststellen, dass mir eine bloße Aufzählung von Eigenschaften keine zufriedenstellende Antwort auf die Frage „Wer bin ich?“ liefern kann, weil ich nicht iden- tisch mit ihnen bin. Sartre beschreibt diesen Umstand in der Erzählung „Die Kindheit eines Chefs“ (1938), in der die Hauptfigur Lucien Fleurier sich eben diese Frage stellt. Lucien beginnt mit einer Aneinanderreihung von Eigenschaften über sich selbst, um dann zu er- kennen, dass er sich mit keiner dieser Attribute hinreichend gleichsetzen kann. Er kann in keiner dieser Eigenschaften völlig aufgehen, nirgends findet er absolute Identität. „Die Kategorien Haben, Machen und Sein sind gleichsam Schleppnetz, in dem er sich einfangen will.“21, aber keine dieser Kategorien liefert ihm eine befriedigende Antwort auf seine Fra- ge. Er scheitert und verzweifelt bei der Suche nach einer Absolutheit, die er aufgrund der Konstitution des Bewusstseins in sich nicht finden kann. Lucien sucht nach einer Essenz, nach etwas, das ihn nicht nur beschreibt, sondern das er ist und darin liegt seine Verzweif- lung begründet.
Die Frage danach, was man ist, ist der Versuch, Distanz zu sich zu bekommen und sich 9! selbst als Objekt zu sehen. Lucien, der sich fragt, was er denn sei, war und sein wird, möchte seine Essenz finden und stellt fest, sich durch nichts absolut beschreiben zu kön- nen. Tatsächlich versucht er, sich als ein Ding zu betrachten, das irgendeine essentielle Eigenschaft in sich trägt, das ist, was es ist. Da er aber ein Für-sich ist, kann er diese Abso- lutheit nicht finden, sondern ist permanent damit konfrontiert, das zu sein, was er nicht ist. Nach Sartre ist diese Erfahrung beunruhigend. Wenn der Mensch auf nichts determiniert ist, sich notwendigerweise auf eine Zukunft hin entwerfen muss, diese aber nicht vorge- schrieben ist, sondern in der Freiheit seiner Möglichkeiten liegt, dann ist nach Sartre genau dies die Angst. Angst zu haben bedeutet, sich seiner Freiheit und Indeterminiertheit be- wusst zu sein, indem man sich als Negation erfährt.22 Nach Sartre ist der Mensch also durch die Tatsache, ein Sein Für-sich zu sein, zur Freiheit verurteilt.23
Die Angst als Bewusstsein von Freiheit wird ebenso mehrfach in „Geschlossene Gesell- schaft“ illustriert. Dort gibt es beispielsweise Garcin, der erschossen wurde, als er versuch- te, vor dem Krieg zu fliehen. Nun da er tot ist, möchte er insbesondere von der etwas zyni- schen Inés die Bestätigung bekommen, kein Feigling zu sein. Garcin behauptet dazu fort- während, dass er gar nicht anders hätte handeln können, woraufhin ihm Inés entgegnet: „Du bist nichts anderes als sein Leben.“24 Garcin versucht daraufhin zu erklären, er wäre einfach zu früh gestorben und hätte nicht mehr die Zeit gehabt, zu verwirklichen, was er eigentlich wollte. Seine Hölle liegt darin begründet, nicht das sein zu können, was er möchte und nun nach dem Tod sein Sein, als Freiheit, sich zu ändern, verloren hat. Solange er noch gelebt hat, war er frei, zu tun und zu sein, was er wollte. Nun ist er tot und ist ge- nau das Leben, das hinter ihm liegt. Jetzt versucht er zu sagen, dass die Handlungen un- ausweichlich gewesen sind, tatsächlich gibt es aber nach Sartre keine Mentalität des Feig- lings, sondern nur die Handlungen eines Feiglings. Um zu sagen, dass dieses und jenes zu dieser Handlung und nicht einer anderen geführt hat, müssen die Vorkommnisse der Ver- gangenheit erst einmal als konstituierend für die Zukunft gewählt werden. Ein Grund muss immer erst als Grund für eine Entscheidung in der Gegenwart anerkannt werden.25 Die Vergangenheit ist nicht notwendigerweise Motiv für meine Handlungen, sondern ich kann sie als Motiv wählen. Aus dem gleichen Grunde beängstigt mich der Blick in die Zukunft, da das Bewusstwerden meiner Freiheit mir aufzeigt, dass es keine hinreichende Begrün- dung dafür gibt, dass ich diese und nicht jene Verhaltensweise durchhalte.26
Vor diesem theoretischen Hintergrund wird auch noch einmal deutlicher, warum Sartre die Hölle als Schauplatz gewählt hat. Die Hölle, als Ort nach dem Tod, lässt keine Definition durch Vergangenheit oder Zukunft mehr zu. Alle Beteiligten sind für immer in der Gegen- wart gefangen. Die Möglichkeit der Existenz als Entwurf von sich selbst entzieht sich ihnen. Sie sind nun damit konfrontiert, genau das zu sein, was sie zu Lebzeiten waren - ohne die Freiheit zu wählen oder Taten verändern zu können. Dadurch sind sie damit kon- frontiert, das zu sein, was sie nicht sein wollen. Gleichzeitig wird auch gezeigt, wie Garcin aus Angst vor der Verantwortung für seine Taten versucht, sich zu rechtfertigen, indem er seine Handlungen als determiniert darstellt. Tatsächlich versucht er sich zum Ding zu ma- chen, dessen Sein so und nicht anders hätte sein können. Nach Sartre flieht der Mensch, der sich mit seiner Freiheit und seinen Möglichkeiten konfrontiert sieht, aus Angst vor Verantwortung für sein Tun, in eine Art Selbstlüge. Mit einer Aussage wie Garcin sie macht, täuscht er sich selbst, indem er behauptet, in Wahrheit nicht frei, sondern lediglich Opfer seiner Umstände gewesen zu sein. Das gleiche geschieht auch mit Lucien Fleurier aus „Die Kindheit eines Chefs“, der versucht, sich über diese und jene Eigenschaften zu definieren. In der Erfahrung, das zu sein, was er nicht ist und nicht das zu sein, was er ist, sieht er sich mit seiner Freiheit konfrontiert und möchte sich aus Angst vor der damit ein- hergehenden Verantwortung auf ein Ding-Sein festlegen, damit er sich eine grundlegende Essenz geben kann.
Das reflexive cogito, das hier auftaucht, produziert ein Objekt, das sich vom präreflexiven Sein unterscheidet. Das Sein, das das reflexive cogito zu sehen bekommt, ist eines, das wie ein An-sich aussieht. Insofern ist dieser Versuch, sich selbst zu sehen, fehlgeleitet und führt in einen Zustand, den Sartre die Unaufrichtigkeit nennt, also in den Glauben mit die- sem Objekt, das ich sehe, gleich zu sein.27 Denn was ich in meinem Sein Für-sich erfahre, ist Nicht-Identität. Indem ich das bin, was ich nicht bin und mein Bewusstsein immer Ne- gation ist, erfahre ich mich selbst als das, was nie mit etwas identisch ist. Der Prozess der Selbstreflektion versucht hingegen, das Für-sich auf etwas zu reduzieren, das die Charakte- ristika des An-sich trägt.28 Die Geschichte von Lucien Fleurier zeigt, dass das Sein Für- sich ein Sein ist, das sich selbst nicht einfangen kann. Die grundsätzliche Erfahrung des Bewusstseins ist es darum, keine Essenz zu haben. Es ist nicht wie der Stein immer essen- tiell ein Stein, sondern existiert als Negation. Darum ist der Mensch in seinem Sein weder determiniert noch hat er eine Natur oder eine Mentalität, auf die er festgeschrieben wäre. Alles, was er ist, ist er als Bewusstsein von etwas. Die konsequente Ablehnung des Deter- minismus ist es, für die sich der Existentialismus im Allgemeinen und Sartres Philosophie im Besonderen eingesetzt hat.
Auch im Hinblick auf diesen Aspekt muss noch einmal Sartres Problem mit Descartes be- trachtet werden. Wenn die Erkenntnis über sich selbst der Gewissheit über die Existenz voraus ginge, dann hieße das, dass man sich selbst nur des Dinges mit Essenz gewiss ist. Ich bin der, der da denkt. Tatsächlich muss Sartre gegen diesen Gedanken sein, denn einer der Grundpfeiler seiner Philosophie besteht in der Aussage, dass die Existenz der Essenz vorausgeht.29 Dies ist gleichbedeutend mit der Annahme, dass das präreflexive Bewusst- sein dem reflexiven Bewusstsein vorausgeht. Descartes hingegen scheint sich mit einem cogito zu begnügen, das nur in der Momentaufnahme seiner Erkenntnis existiert und darin besteht, einmal gewesen zu sein, ohne zu realisieren, dass das Ich, dessen man sich be- wusst wird, nicht mehr das Ich ist, dass sich jetzt gerade Gedanken macht. Für Sartre kommt die Existenz zuerst und bildet die Grundlage jeder Erkenntnis. Da der Mensch aber einerseits seine Taten und Gefühle ist, sich durch nichts anderes beschreiben lässt, aber gleichzeitig nicht genau das - im Sinne von Identität - ist, besteht die Essenz, die er sich geben möchte, nur als Schatten oder Entwurf von sich selbst.
4 Ich und der Andere
In den vorangegangenen Abschnitten wurde erläutert, dass es eine wesentliche Eigenschaft des Bewusstseins ist, sich von anderem zu unterscheiden. Genauso wie ich weiß, nicht die- ser Baum zu sein, weiß ich auch, nicht der Andere zu sein. Kommt mir eine Person auf der Straße entgegen, nehme ich sie zunächst einmal als von mir verschiedenes Objekt wahr. Woher kann ich nun wissen, dass der Andere als Person überhaupt existiert, wenn er mir doch als ein Objekt erscheint? Man würde wohl dem Gedanken zustimmen, dass die Per- son auf der Straße mit großer Wahrscheinlichkeit genauso ein Innenleben hat wie ich - dass es hinter der Objekt-Außenseite auch ein Subjekt gibt. In meiner Beobachtung bleibt dies aber reine Wahrscheinlichkeit. Ich beobachte etwas, das genauso gut eine perfekt kon- struierte Maschine sein könnte und nehme dann die Einschätzung vor, dass es sich hierbei um einen Menschen handelt. Das Urteil, dass es sich dabei aber tatsächlich um ein Subjekt handelt, kann auch falsch sein, denn beobachten lässt sich dies nicht.30 Wie kann nun aus dieser Wahrscheinlichkeit, dass der Andere auch Subjekt ist, Gewissheit werden? Was ist meine ursprüngliche Erfahrung des Anderen?
Subjekt-sein heißt auch, Zentrum einer Objektwelt zu sein.31 Ich sehe mich im Mittelpunkt einer Welt von Objekten, die mich umgeben und von denen ich weiß, dass ich mich von ihnen unterscheide. So taucht auch der Andere zunächst als eines der Objekte um mich herum auf und dennoch habe ich die Annahme, dass er auch Bewusstsein ist und ich somit nicht das einzige Ich in der Welt bin. Sartre beschreibt dieses Problem in dem Kapitel „Der Blick“ in „Das Sein und das Nichts“, indem er eine Situation konstruiert, in der jemand durch ein Schlüsselloch schaut.32
Ich blicke durch ein Schlüsselloch und beobachte die Personen auf der anderen Seite der Tür. Ich nehme sie als Objekte wahr. Ich gehe ganz auf in meinem Durchs-Schlüsselloch- Schauen - ohne Distanz zu mir selbst. Ich bin meine Tat, ohne dass diese Gegenstand mei- ner Reflexion ist, sondern „mein Bewusstsein klebt an meinen Handlungen.“33 Solange ich nur durch das Schlüsselloch schaue, gibt es kein Ich als Objekt meiner Gedanken, nichts über das man urteilen könnte. Ich bin meine Tat. Ich bin meine Neugier, meine Eifersucht, aber ich sehe sie nicht. Ich existiere in dieser Tat, wie in den vorangegangenen Abschnitten beschrieben, präreflexiv. Auch bin ich nicht in der Tat determiniert. Das, was hinter der Tür, durch deren Schlüsselloch ich schaue, geschieht, zwingt mich nicht dazu, durch eben dieses Schlüsselloch zu schauen.
[...]
1 Sartre, 1944. S.59.
2 Zur Bezeichnung einer im Umfeld des Ichs auftauchenden Person wird in dieser Arbeit häufig der Begriff des „Anderen“ benutzt werden. Sämtliche personenbezogenen Bezeichnungen beziehen sich jedoch aus- drücklich auf alle Geschlechter. Ich entscheide mich für diese nicht genderneutrale Bezeichnung - zum einen aufgrund des Bestrebens möglichst dicht an der begrifflichen Konzeption Sartres zu bleiben, zum anderen aus Gründen der Lesbarkeit. Ich möchte behaupten, dass Sartre mit „dem Anderen“ eine so abstrakte Idee bezeichnet, dass die Frage nach dem Geschlecht gar nicht auftaucht. Da ich mir aber bewusst bin, dass eine Untersuchung des Androzentrismus in der Philosophie der vergangenen Jahrhunderte sicherlich den Wert eines eigenen Untersuchungsgegenstandes hat, sehe ich auch die damit verbundene Schwierigkeit, den „An- deren“ als tatsächlich genderneutral zu begreifen.
3 Hegel, 1808. §31, S.119.
4 Vgl. Sartre, 1947. S.6.
5 Vgl. Sartre, 1943. S.181.
6 Vgl. Sartre, 1947. S.6.
7 ebd.
8 ebd.
9 Vgl. Sartre, 1943. S.19.
10 Vgl. Sartre, 1947. S.7f.
11 Vgl. Sartre, 1943. S.17ff.
12 Vgl. ebd. S.21.
13 Vgl. Sartre, 1943, S.37ff.
14 Vgl. Sartre, 1947. S.7.
15 ebd.
16 Vgl. Sartre, 1943. S.80.
17 ebd. S.35.
18 Vgl. Danto, 1975. S.51.
19 Vgl. Sartre, 1947. S.43f.
20 Vgl. ebd. S.37.
21 Suhr, 1987. S.26.
22 Vgl. Sartre, 1943. S.99.
23 Vgl. ebd. S.253.
24 Sartre, 1944. S.57.
25 Vgl. Suhr, 1987. S.52f.
26 Vgl. ebd. S.52.
27 Vgl. Sartre, 1943. S.119ff.
28 Vgl. ebd. S.307.
29 Vgl. ebd. S.36.
30 Vgl. Danto, 1975. S.113.
31 Vgl. Suhr, 1987. S.66.
32 Vgl. Sartre, 1943. S.467.
33 ebd. S.468.
- Arbeit zitieren
- Julia Eickhoff (Autor:in), 2014, Ich und der Andere. Eine soziologische Perspektive auf Bewusstsein und Selbsterkenntnis im Existentialismus von Jean-Paul Sartre, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/304101
Kostenlos Autor werden





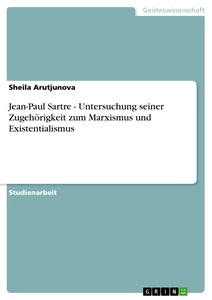


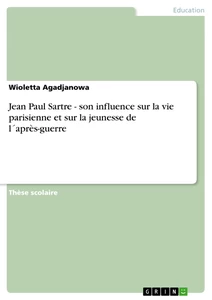

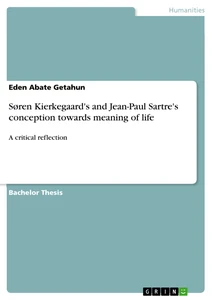

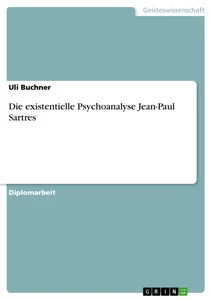







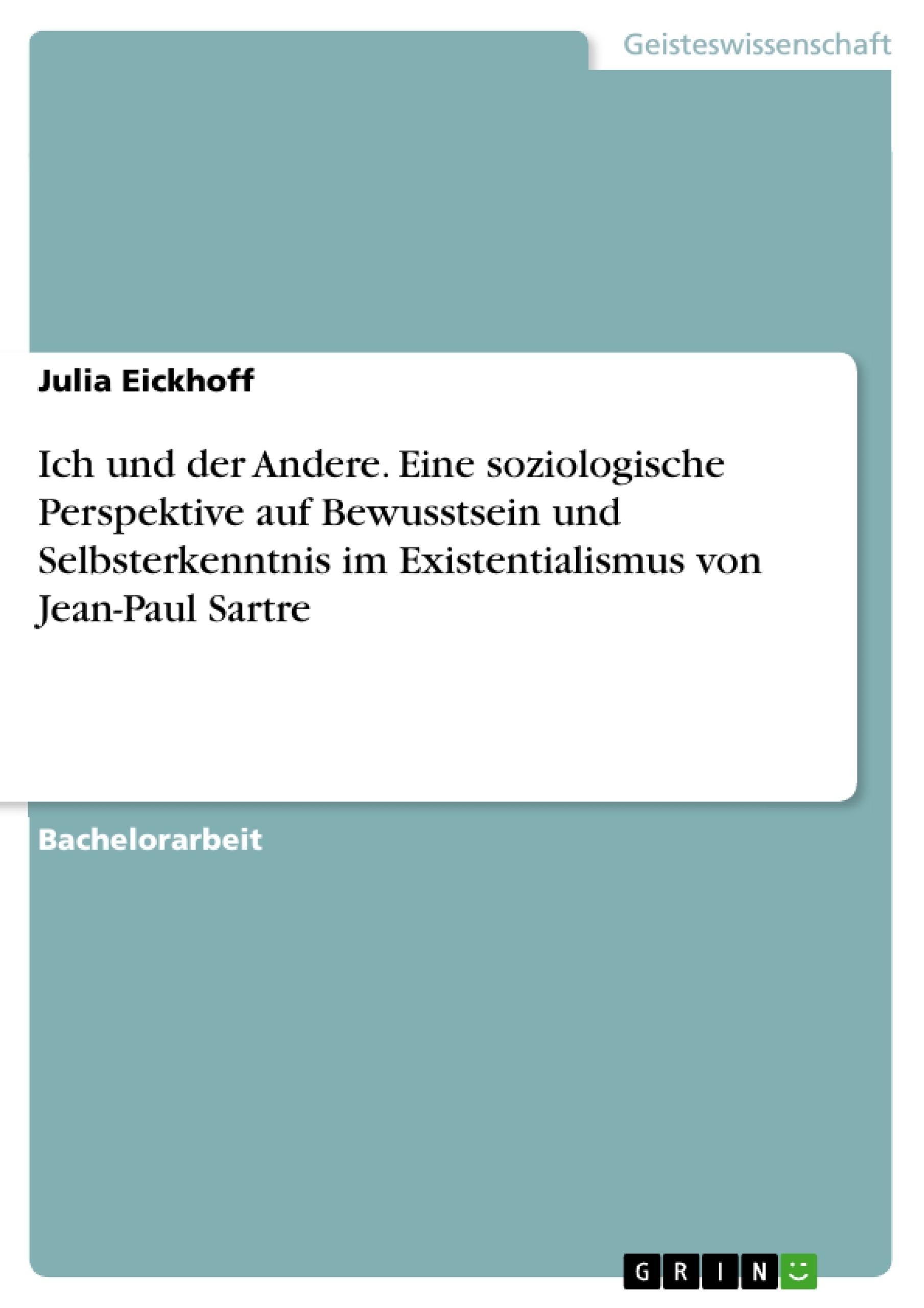

Kommentare