Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Nachhaltigkeit in der Entwicklungszusammenarbeit
2.1. Vorbemerkungen und Begriffserklärungen
2.2. Phasen der Entwicklungsarbeit
2.3. Das Umdenken zur Nachhaltigkeit
2.4. Die Rolle nichtstaatlicher Entwicklungszusammenarbeit
3. Nachhaltigkeitsevaluation in der Entwicklungszusammenarbeit
3.1. Vorbemerkungen zur Evaluierungsproblematik
3.2. Der Evaluierungskatalog des BMZ
3.3. Kritische Würdigung und Ergänzungen
4. Vorstellung und Evaluation der Projekte
4.1. Vorbemerkungen zur Auswahl der Projekte
4.2. Cidades sem Fome (Städte ohne Hunger)
4.2.1. Vorstellung des Projekts
4.2.2. Evaluation der Nachhaltigkeit
4.3. Engineers Without Borders
4.3.1. Vorstellung des Projekts
4.3.2. Evaluation der Nachhaltigkeit
4.4. Das Gonzalinho-Kinderprojekt
4.4.1. Vorstellung des Projekts
4.4.2. Evaluation der Nachhaltigkeit
5. Ergebnisse der Evaluationen
5.1. Ergebnis der Übertragung des BMZ-Katalogs
5.2. Ergebnis der Nachhaltigkeitsevaluation
6. Fazit und Ausblick in die Zukunft
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Anhang
1. Einleitung
Heute, im Jahr 2015, stehen die Menschen in einer nicht friedlicher werdenden Welt, nach Finanz- und Wirtschaftskrisen und sich verschärfenden globalen Ressourcen- und Umweltproblemen, an der Schwelle zu einem Umbruch. In den kommenden Jahren und Jahrzehnten muss die Menschheit es schaffen, große Veränderungen zu vollbringen; ein „weiter wie bisher“ scheint immer weniger möglich. Es muss, noch viel stärker als bereits geschehen, ein Umdenken einsetzen, wie das Leben auf dieser Welt auch in Zukunft möglich und lebenswert bleibt.
Dieser Prozess aber ist nicht von einem Land oder einer Region zu vollbringen, sondern muss weltweit getragen werden. Die heutigen Industrienationen haben einen großen Teil der Verantwortung für den gegenwärtigen Gesamtzustand der Welt, aber der Beitrag der sogenannten Schwellen- und Entwicklungsländer nimmt stetig zu. Die Erde würde es nicht verkraften, wenn alle Menschen ein Leben nach dem amerikanischen oder europäischen Standard lebten. Darum sind natürlich in erster Linie die reichen Industrienationen gefordert, an ihrem Überverbrauch an Ressourcen und natürlichem Kapital und ihrer Politik etwas zu ändern, aber es hat auch Implikationen auf die Länder, die noch einen weiten Weg der Entwicklung hin zu größerem und gerechter verteiltem Wohlstand vor sich haben.
Sollen nun wohlhabendere Länder die ärmeren bei diesem Weg unterstützen? Immer wieder tauchen in den Medien Begriffe wie „gescheiterte Entwicklungshilfe“ (Gerhardt, 2009) oder „Hilfe, die arm macht“ (Endres, 2012) auf und es werden nicht nur aus den Geberländern, sondern zunehmend aus den Nehmerländern Forderungen laut, wie die des kenianischen Ökonomen James Shikwati, der einen sofortigen Stopp aller Entwicklungszusammenarbeit fordert, da die Bilanz sogar stets negativ sei, Entwicklungszusammenarbeit also den Empfängerstaaten schade (vgl. Shikwati, 2006, S. 6-15).
Dessen ungeachtet scheint es auf der anderen Seite neben politischen Interessen doch eine humanitäre und ethische Pflicht der Industrienationen zu geben, andere Länder bei einer sinnvollen Entwicklung zu unterstützen, mit dem Ziel im Sinne der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 eine Welt zu schaffen, in der die Menschen frei von Furcht und Not leben können (vgl. Nuscheler, 2004, S. 248). Entscheidend ist nur, auf welche Art und Weise die Hilfe stattfindet. Vor dem Hintergrund dieser übergeordneten Fragestellung soll die vorliegende Arbeit stehen.
In den letzten Jahren hat sich nun die schon fast zum inflationär verwendeten Modewort verkommene Eigenschaft Nachhaltigkeit, beziehungswiese der englische Begriff „sustainable development“, etabliert, um so ziemlich jede wünschenswerte Entwicklung in welchem Bereich auch immer zu charakterisieren. Trotzdem möchte ich mit dieser Arbeit zeigen, wie wichtig Nachhaltigkeit bei jeder Art von Entwicklungszusammenarbeit ist, besonders, da Entwicklungszusammenarbeit wiederum ein immer wichtigeres Element in nationalen Nachhaltigkeitsstrategien wird, wie am Beispiel der Nachhaltigkeitsstrategie der deutschen Bundesregierung ersichtlich ist. (vgl. Caspari, 2004, S. 49-52).
„Jede Definition von Entwicklung“, betont der deutsche Politikwissenschaftler Franz Nuscheler in seinem Standardwerk zur Entwicklungspolitik, ist „ohne die Bedingung von ökologischer Nachhaltigkeit [...] unvollständig“ (2004, S. 246). Doch eben nicht nur aus ökologischen, sondern, wie im Eingangszitat vom ehemaligen deutschen Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit Klaus Töpfer erwähnt, auch aus politischen, gesellschaftlichen und sozialen Beweggründen. Dies betrifft nicht nur das staatliche, sondern auch immer stärker das nichtstaatliche Engagement, dessen globale Bedeutung kontinuierlich wächst. Deshalb ist es für alle Seiten entscheidend, die Eigenschaft Nachhaltigkeit zu identifizieren, um umfassend Aussagen machen zu können, welche Art von Entwicklungszusammenarbeit nachhaltig ist und welche nicht.
Um einen Beitrag dazu zu leisten, möchte ich im Rahmen dieser Arbeit, nach einigen grundsätzlichen Gedanken zur Nachhaltigkeit in der Entwicklungszusammenarbeit, die ursprünglich für die staatliche bilaterale Entwicklungszusammenarbeit entworfenen Evaluierungskriterien des deutschen Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (im Folgenden kurz: BMZ) vorstellen, deren Anwendungsgebiet auf Entwicklungszusammenarbeit im Allgemeinen erweitern und versuchen, sie auf nichtstaatliche Entwicklungszusammenarbeit zu übertragen. Dazu beleuchte ich beispielhaft drei private Entwicklungsprojekte unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit, bringe eigene Ergänzungen ein und reflektiere am Ende die Möglichkeiten, aus den Evaluierungskriterien einen allgemeingültigen Ansatz zu formulieren.
2. Nachhaltigkeit in der Entwicklungszusammenarbeit
2.1 Vorbemerkungen und Begriffserklärungen
Das Thema Nachhaltigkeit in der Entwicklungszusammenarbeit ist weder selbstverständlich noch selbstredend. Um sich diesem zu nähern, ist es unumgänglich einige Erklärungen und Definitionen der Begriffe vorzunehmen. Was ist Entwicklungszusammenarbeit? Was ist Entwicklungspolitik? Was ist Nachhaltigkeit? Und was ist eine nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit? Die Entwicklungszusammenarbeit an sich kann man noch relativ einfach definieren als Gesamtheit aller materiellen sowie immateriellen Beiträge, die von den entwickelten Ländern an die weniger entwickelten geleistet werden mit dem Ziel, den Lebensstandard dort zu verbessern. Aber schon die Definition von Entwicklung selbst zeigt die Schwierigkeit der Thematik, weil es eben kein vorgegebener wertneutraler, sondern ein höchst normativer, von Wertvorstellungen geprägter Begriff ist, dessen Bedeutung und Rezeption sich verändert.
Unbestritten ist eine gesellschaftliche und kulturelle Entwicklung der Menschheit und fast alle Gesellschaften sind heute weiter entwickelt als vor 100 Jahren. Aber war im 19. und bis weit ins 20. Jahrhundert hinein gesellschaftliche Entwicklung charakterisiert durch Rationalisierungsideale im menschlichen Verhalten wie bei Max Weber (vgl. Weber, 1922, S. 12-13) und gleichbedeutend mit Fortschritt und mehr Wohlstand ein rein positives Faktum, so erkennen die Menschen heute zunehmend, dass daraus resultierende Umweltzerstörungen sowie Kriege und Ungleichheiten die positiven Effekte überwiegen können, und andere, weichere Definitionen, zum Beispiel Entwicklung als Handlungsfähigkeit einer Gesellschaft zu verstehen (vgl. Morris, 2011, S. 33), werden populär.
Die Bedeutung aller zentralen Begriffe des Arbeitsfelds wird also erst als Teil einer oftmals langen Evolution verständlich, weshalb hier zusammengefasst der geschichtliche Kontext der Entwicklungszusammenarbeit von den Anfängen bis heute und die Veränderungen im Verständnis der Begriffe vorangestellt werden soll.
Die Anfänge von Entwicklungspolitik liegen in der Zeit des Spätkolonialismus, als die Kolonialmächte nicht mehr nur Ressourcen und Sklaven aus ihren Kolonien gewinnen wollten, sondern es auch immer mehr als ihre Pflicht sahen, den Entwicklungsstand dort zu verbessern und die Kolonien aufzubauen (vgl. Büschel, 2010, S. 3) und es entstand infolgedessen ein „Entwicklungskolonialismus“ (Osterhammel, 1995, S. 45). Dies rührte vorwiegend aus zwei Gründen: Zum einen zur Sicherung des Machterhalt, indem man so Rebellionen und Aufstände vermied und zum anderen auch aus dem chauvinistischen Gedanken heraus, die „Wilden“ bekehren und kulturell zivilisieren zu müssen. Bereits im Friedensvertrag von Versailles von 1919 war festgehalten, dass die „Vormundschaft über die unterentwickelten Völker mit der heiligen Aufgabe der Zivilisation“ und mit der Verantwortung für das „Wohlergehen und die Entwicklung dieser Völker“ (Versailler Friedensvertrag, Art. 22, Abs. 1, 1919, zitiert nach: Osterhammel, 1995, S. 41) einhergehen soll. Bald entwarfen Frankreich und Großbritannien eine Entwicklungspolitik für ihre Kolonien, so beschloss das Londoner Parlament 1929 ein Gesetz, nach welchem jedes Jahr eine Million Pfund für Ausbildung, medizinische Versorgung und Infrastruktur in den Kolonien zur Verfügung zu stellen sind (vgl. Büschel, 2010, S. 4).
Der Beginn dessen allerdings, was heute unter Entwicklungszusammenarbeit verstanden wird, beginnt erst nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Als Meilenstein gilt das Point-IV-Programm des amerikanischen Präsidenten Harry S. Truman aus seiner Amtsantrittsrede 1949. Das als Teil der Eindämmungsstrategie gegen einen expandierenden sowjetischen Einflussbereich zu verstehende, nicht auf eine Region begrenzte Programm, also eine Art globaler Marshallplan für alle nicht-revolutionären und nicht-kommunistischen Länder, sollte weltweit den wirtschaftlichen Aufbau nach dem Krieg in Gang bringen und viele entwicklungspolitische Abkommen resultierten aus dieser Idee (vgl. Stockmann et al., 2010, S. 23-24; Büschel, 2010, S. 3). Truman erklärte: „Künftig müssten die entwickelten Industrienationen den unterentwickelten Ländern helfen, sich selbst zu helfen“ (Truman, Inauguration Speech 20th January 1949, in: Department of State Bulletin January 30, 1949, Washington D.C. 1949, S. 123, zitiert nach: Büschel, 2010, S. 3).
Hieraus bildeten sich in den folgenden Jahrzehnten die verschiedensten Formen der Entwicklungszusammenarbeit heraus.
2.2 Phasen der Entwicklungsarbeit
Der Kulturhistoriker Hubertus Büschel teilt, nach einer „Vorstufe der Entwicklungspolitik“ (Büschel, 2010, S. 4) in den Jahren 1950 bis 1960, in denen das vorrangige Ziel war, die Ausbreitung des Kommunismus einzudämmen, die Entwicklungszusammenarbeit in vier Dekaden von 1960 bis 2000 ein (vgl. 2010, S. 4), die im Folgenden als Grundgerüst für den geschichtlichen Abriss dienen sollen.
Die erste Dekade von 1960 bis 1970 war geprägt von dem Glauben an die Macht einer ökonomischen Modernisierung. Es herrschte vielerorts die Vorstellung, durch forciertes Wirtschaftswachstum könne man eine dauerhafte Entwicklung initiieren (vgl. Büschel, 2010, S. 5). Als Ideal für die weniger entwickelten Länder galt aus Sicht der westlichen Industrienationen der Weg der Industrialisierung nach europäischem Vorbild und es wurde darauf geachtet, dass die Entwicklungsländer möglichst auf einem „Westkurs“ steuern.[1] Man hatte nach wie vor Entwicklungszusammenarbeit auch betrieben, um Länder auf die westliche Blockseite in der damaligen bipolaren Welt zu ziehen und um sie zur Unterstützung der eigenen Weltpolitik zu bewegen. Deutschland zum Beispiel fror gemäß der Hallstein-Doktrin Entwicklungszusammenarbeit ein, wenn ein Land die DDR als Staat anerkannte (vgl. Schmidt et al., 2007, S. 534). Betrieben wurde die Hilfe durch Geldtransfers an die betroffenen Länder, man glaubte an einen „Trickle-Down-Effekt, dem ‚Durchsickern‘ eingeflossener Mittel ‚von oben nach unten‘ bis hin zu den einzelnen Bedürftigen“ (Büschel, 2010, S. 5), und durch die Anbindung der Entwicklungsländer an den Weltmarkt. Dies bedeutete, Zölle und Einfuhrabgaben aufzuheben, was sich günstig auf das Wachstum dort auswirken sollte. Entwicklung war auf die Entwicklungsländer bezogen nach den herrschenden Modernisierungstheorien vor allem „ein differenzierte[r] Prozeß des Aufholens und Nachahmens, bis die Moderne erreicht ist“ (Stockmann, 1996, S. 1). Rückständige Nationen sollten nach europäischem Vorbild von armen Agrargesellschaften zu komplexen Industrienationen aufblühen.
Über die Jahre 1970 bis 1980 spricht Büschel als eine „Zeit der Revision“ (2010, S. 5). Den Wandel eingeläutet hatte 1969 der Pearson-Bericht, eine von der Weltbank beauftragte Studie, in dem der kanadische Diplomat und Ökonom Lester Pearson eindringlich das
Scheitern der Entwicklungspolitik der vorherigen 20 Jahre darlegte (vgl. Nuscheler, 2004, S. 78). Der Optimismus und die Fortschrittsgläubigkeit in Bezug auf ökonomische Modernisierung als Heilmittel von Entwicklungsdefiziten haben in Folge des Berichts nachgelassen. Einschneidend war ferner, dass die ursprünglich aus dem lateinamerikanischen Raum stammenden Dependenztheorien Bedeutung erlangten und die modernisierungstheoretischen Erklärungen konterkarierten. Unterentwicklung ist nach diesen Theorien kein „Transformationsstadium auf dem Weg zur Moderne [...], sondern eine Folge der Entwicklung der Industriestaaten“ (Stockmann, 1996, S. 2). Permanenter Ressourcenabfluss und neokoloniale Strukturen sicherten demzufolge den Industriestaaten das Wachstum und zementierten ein System der Ausbeutung und Abhängigkeit mit reichen Industrienationen auf der einen und unterentwickelten Ländern auf der anderen Seite. 1972 wurde auch mit der Veröffentlichung der Studie „The Limits to Growth“ des Club of Rome zum ersten Mal einer breiten Öffentlichkeit Themen der Wachstumsproblematik und Rohstoffverknappung bekannt und es wuchsen auch dadurch Zweifel am „Weltentwicklungsmodell der aufholenden Entwicklung“ (Caspari, 2004, S. 48). Auch die Ölkrisen in den Jahren 1973 und 1979 trugen zur Erkenntnis bei, wie abhängig die westlichen Industrieländer vom Erdöl sind und dass nicht die ganze Welt so leben kann wie sie. In der Entwicklungszusammenarbeit wurde deutlich, dass in den Entwicklungsländern oftmals trotz Geldflüssen das Wachstum ausbleibt, das Geld also, um in der Analogie zu bleiben, irgendwo versickert statt durchzusickern und dass, wenn es zu Wachstum kommt, dieses sehr ungleich verteilt sein kann. Es haben häufig nur die Eliten profitiert und die Armut ist in manchen Regionen sogar weiter angestiegen. Folgerichtig stellte der damalige Präsident der Weltbank Robert McNamara als Lehre aus dem Pearson-Bericht das Scheitern der Prämisse Entwicklung durch Wachstum (vgl. Büschel, 2010, S. 6; Nuscheler, 2004, S. 78) fest. Entworfen wurden stattdessen Konzepte, um die Grundbedürfnisse der Menschen vor Ort zu befriedigen, was nun als Basis jeglicher Entwicklung galt. Mit Kampagnen wie „Nahrung für alle“, „Gesundheit für alle“ und „Bildung für alle“ gingen die internationalen Institutionen diese Aufgabe an (vgl. Büschel, 2010, S. 6).
Dies war sicherlich eine Verbesserung zur vorherigen Dekade, und doch bleibt kritisch anzumerken, dass ähnliche Ideen bereits in der Kolonialzeit umgesetzt wurden, wie bereits erwähnt vorwiegend, um die Bevölkerung ruhig zu stellen und einer Unabhängigkeitsbewegung entgegenzuwirken.
Die nachfolgende Dekade, von 1980 bis 1990, ist geprägt von vielen Rückschlägen in der Entwicklungszusammenarbeit. Die „globale[r] Aufrüstung [...] [sowie] die Ölkrise der 1970er-Jahre, die Wirtschaftskrise zu Beginn der 1980er-Jahre und fallende Rohstoffpreise führten zu einem immensen Anstieg der Auslandsverschuldung der Entwicklungsländer“ (Büschel, 2010, S. 6). Viele von ihnen gerieten infolgedessen in schwere Krisen. Ein im Gegensatz dazu positives einschneidendes Ereignis war 1987 die Veröffentlichung eines Berichts mit dem Titel „Our Common Future“ der Weltkommission für Umwelt und Entwicklung unter Federführung der norwegischen Ministerpräsidentin Gro Harlem Brundtland. Dieser sogenannte Brundtland-Bericht wurde bekannt durch seine Definition von Nachhaltigkeit, beziehungsweise nachhaltiger Entwicklung. Da Nachhaltigkeit die zentrale Kategorie der vorliegenden Arbeit sein soll, lohnt es sich, die beiden aus dem Bericht resultierenden Definitionen genauer zu betrachten. Die erste, bekannte und vielzitierte Definition lautet: „Dauerhafte Entwicklung ist Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, daß künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können“ (Vereinte Nationen, 1987, S. 51, Absatz 49 und S. 54 Absatz 1) und ist in der Essenz das, was man unter Generationengerechtigkeit verstehen kann. Diese Definition hat große Implikationen auf unser heutiges Verständnis von ökologischer Gerechtigkeit und ist seither Bestandteil aller internationalen Umweltabkommen. Die zweite, weniger populäre Definition, „im Wesentlichen ist dauerhafte Entwicklung ein Wandlungsprozeß, in dem die Nutzung von Ressourcen, das Ziel von Investitionen, die Richtung technologischer Entwicklung und institutioneller Wandel miteinander harmonieren und das derzeitige und künftige Potential vergrößern, menschliche Bedürfnisse und Wünsche zu erfüllen“ (Vereinte Nationen, 1987, S. 57, Absatz 15), fordert eine umfassende und holistische Verhaltensänderung und die Berücksichtigung verschiedenster Wechselwirkungen, wird aber in der Politik selten zitiert, da sie viel schwerer umzusetzen ist. Erstmals wurde mit der Brundtland-Kommission ein Zusammenhang hergestellt zwischen weltweiten Umweltproblemen und dem entwicklungspolitischen Konflikt zwischen Nord und Süd und es wurde erkannt, dass die Probleme nur dann lösbar sind, wenn der bestehende Gegensatz von Entwicklungs- und Umweltforderungen überwunden wird (vgl. Caspari, 2004, S. 45).
Die vierte Dekade von 1990 bis 2000 steht in Folge des Brundtland-Berichts nun unter dem Zeichen der Nachhaltigkeit. Entscheidend war dafür im Jahre 1992 die Konferenz für Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro. Gesprochen wurde neben Nachhaltigkeit über Hilfe zur Selbsthilfe, Ressourcenverbrauch und Eigenständigkeit (vgl. Büschel, 2010, S.7). Allerdings wurde nach wie vor die Entwicklung nach westlichen Maßstäben beurteilt, mit der Vorstellung der Industrienationen eine wünschenswerte Entwicklung in den Entwicklungsländern betreiben zu können. Auch das Konzept der nachhaltigen Entwicklung steht eigentlich, wie der deutsche Soziologe Reinhard Stockmann kritisch konstatiert, „ganz in der Tradition westlicher Theoriebildung, die seit der Industrialisierung die weniger entwickelten Länder nicht nur mit Leitbildern versorgt, sondern ihnen auch die Erklärung für ihre Unterentwicklung gleich mitgeliefert hat“ (1996, S. 3). Im Jahr 2000 verabschiedete die 55. Generalversammlung der Vereinten Nationen dann die sogenannten Millenniums-Entwicklungsziele. In Anbetracht neuer Daten über die Armut in der Welt wurden acht Ziele, die bis zum Jahr 2015 zu erreichen sind, definiert: das Beseitigen von extremer Armut und Hunger, die Ermöglichung einer Grundschulbildung für alle Menschen, die Förderung der Geschlechtergleichberechtigung, die Kindersterblichkeit gegenüber dem Niveau von 1990 um zwei Drittel zu senken, die Gesundheit von Müttern zu verbessern, Infektionskrankheiten wie Malaria und AIDS zum Stillstand zu bringen, die ökologische Nachhaltigkeit zu sichern mit dem Unterziel, die Grundsätze der Nachhaltigkeit in Zukunft in möglichst alle einzelstaatlichen Programme mit einzubauen und schließlich, eine globale, nichtdiskriminierende Partnerschaft zur Entwicklung aufzubauen (vgl. Vereinte Nationen, 2000; Nuscheler, 2004, S. 576). Da die Millenniums-Entwicklungsziele nicht direkt ein Teil dieser Arbeit sind, man im Jahr 2015, bis zu dem die Ziele ja zu erreichen sind, das Thema aber nicht ganz ignorieren kann, sei nur kurz angemerkt, dass zwar einige der Ziele tatsächlich schon erreicht wurden, wie die Halbierung der extremen Armut und des Hungers und die Halbierung des Anteils der Menschen, die keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Bei vielen anderen Zielen ist die Weltgemeinschaft aber weit weg und sie werden aller Voraussicht nach nicht erreicht werden. Noch unklar ist, was nach 2015 folgt. Über eine „Post-2015-Entwicklungsagenda“ (BMZ, 2015b) wird viel diskutiert. Im Gespräch ist auch etwas wie „Sustainable Development Goals“, vor dem Hintergrund, dass bei den Millenniums-Entwicklungszielen die ökologische Dimension und die Nachhaltigkeit zu wenig berücksichtigt wurden (vgl. BMZ, 2015b).
Ab dem Jahr 2000 sieht sich die Entwicklungszusammenarbeit zunehmend mit grundsätzlicher Kritik konfrontiert. Reinhard Stockmann unterscheidet zwischen Fundamentalkritikern und Reformisten (vgl. 1996, S. 4).
Erstere gehen, von ganz unterschiedlichen Weltanschauungen herkommend, übereinstimmend von der prinzipiellen Schädlichkeit oder bestenfalls Nutzlosigkeit von Entwicklungszusammenarbeit aus. Hier einzuordnen ist auch, dass vermehrt Stimmen von Vertretern der Entwicklungsländer (vgl. Moyo, 2010, S. 29-47; Shikwati, 2006, S. 6-15) laut werden, die ein Ende aller Entwicklungspolitik fordern, die ihrer Meinung nach nur ein Instrument zur Herrschaftssicherung oder, wie der Friedensforscher Johan Galtung poetisch formulierte, ein „Brückenkopf der Zentralnationen in den Peripherienationen“ (Galtung, 1972, zitiert nach: Stockmann, 1996, S. 5) sei. Auf Grund dieser Kritik und der Vorstellung von einem Ende der Entwicklungszusammenarbeit wird ab 2000 von einem „Post-Development-Zeitalter“ (Büschel, 2010, S. 8) gesprochen. Dies berücksichtigt aber nicht, dass nach wie vor Institutionen aktiv sind und ständig neue Modelle und Konzepte entworfen und ausprobiert werden. Das ist auch die Sichtweise der zweiten Gruppe bei Stockmann, der Reformisten, die noch daran glauben, dass mit Entwicklungszusammenarbeit Veränderungen im wirtschaftlichen wie sozialen Bereich herbeigeführt werden können und dass sich Nutzen und Wirksamkeit der Entwicklungspolitik verbessern lassen (vgl. Stockmann, 1996, S. 4). Von diesem Standpunkt wird oft angemahnt, dass viel zu wenig für Entwicklungszusammenarbeit getan wird. So verfehlt Deutschland wie die allermeisten Geberländer Jahr für Jahr weit das seit 1970 immer wieder selbstgesteckte Ziel, 0,7 Prozent des Bruttonationaleinkommens (früher Bruttosozialprodukt) für Entwicklungsaufgaben bereitzustellen (vgl. Caspari, 2004, S. 52). Auch muss man verstehen, dass die beschriebene Kritik kein Phänomen des 21. Jahrhunderts ist, denn seit und so lange es Entwicklungszusammenarbeit gibt, gibt es auch Kritik an ihr (vgl. Büschel, 2010, S. 8-9; Stockmann, 1996, S. 9). Parallel zu dieser Geschichte der staatlichen Entwicklungsarbeit bildete sich in den letzten Jahrzehnten immer stärker auch ein nichtstaatliches Engagement heraus, dessen Einfluss wächst und zunehmend die Ziele und Methoden der Entwicklungszusammenarbeit prägt, worauf im Kapitel 2.4 detaillierter eingegangen wird.
Eine rückblickende Betrachtung evoziert zunächst den Eindruck, dass jede entwicklungspolitische Periode immer wieder aufs Neue proklamierte Innovationen zur Verbesserung der Entwicklungspolitik gefunden zu haben, letztlich aber vieles „äußerst langlebige, oftmals koloniale Entwicklungskonzepte“ (Büschel, 2010, S. 9) sind. Jedenfalls ist das Patentrezept für die Entwicklungszusammenarbeit sicherlich noch nicht gefunden und der Spielraum für eine Entwicklung der Entwicklungszusammenarbeit bleibt groß.
2.3 Das Umdenken zur Nachhaltigkeit
Mit dem Einzug des Konzepts der Nachhaltigkeit und der einhergehenden ganzheitlicheren Betrachtung kann man jedoch eine gewisse Zäsur in der Geschichte der Entwicklungszusammenarbeit erkennen. Zusehends verabschiedete man sich von der Vorstellung, dass Entwicklung vorwiegend technisch machbar ist oder dass eine Entwicklung von außen in Gang gesetzt werden kann (vgl. Holtz, 2000, S. 5). Dies spiegelt sich auch im Wechsel der Begrifflichkeit seit den 1990er Jahren von Entwicklungshilfe zu Entwicklungszusammenarbeit wieder, was stärker den Dialogcharakter demonstrieren soll. Ebenso versteht man immer besser die Bedeutung von ökologischen Faktoren, die enorme Komplexität von Wechselwirkungen und gesellschaftliche Faktoren wie zum Beispiel die Rolle der Frau für den Entwicklungsprozess in einem Land.
Was aber heißt heute Nachhaltigkeit im Kontext der Entwicklungszusammenarbeit? Was ist darunter zu verstehen? Nachhaltigkeit ist etwas, bei dem erst noch herausgefunden werden muss, was es alles umfasst. Zu allererst ist es oftmals eine Abgrenzung in der Dichotomie neue Entwicklungszusammenarbeit zu früheren, naiven und ignoranten Formen der Entwicklungszusammenarbeit. Es drückt zumindest den Willen aus, möglichst umfassend zu planen. Schon allein der Gedanke zur Planung, also das Denken in größeren Zeiträumen ist eines der Elemente von Nachhaltigkeit. Die Idee der Nachhaltigkeit ist aber deutlich älter und ihre Bedeutung weiter zu fassen. Der deutsche Begriff Nachhaltigkeit findet erstmals nachweisbare Erwähnung zu Beginn des 18. Jahrhunderts in der Forstwirtschaft, namentlich bei Hans Carl von Carlowitz, wobei es darum ging, nur so viel Holz aus einem Wald herauszuschlagen, wie nachwachsen kann, um den Gesamtbestand nicht zu gefährden (vgl. Grunwald / Kopfmüller, 2012, S. 14). Nach wie vor ist dies die Grundlage für die Bedeutung des Begriffes.
In Folge des Brundtland-Berichts, als der Begriff nachhaltige Entwicklung zur Übersetzung des englischen „sustainable development“ gebraucht wurde, erweiterte sich die Bedeutung. Die Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages „Schutz des Menschen und der Umwelt“ legte Nachhaltigkeit dann als eine dauerhafte und zukunftsfähige Entwicklung der ökonomischen, ökologischen und sozialen Dimension menschlicher Existenz fest (vgl. Caspari, 2004, S. 46). Dieses Drei-Säulen-Modell, das besonders im deutschsprachigen Raum bis heute vielfach zur Erklärung von Nachhaltigkeit
herangezogen wird, erweitert die ursprünglich rein ökologische Dimension, die schon lange aus der Forstwirtschaft bekannt war, um die ökonomische Nachhaltigkeit, also das Bestreben, eine Wirtschaft möglichst dauerhaft betreiben zu können, und um die soziale Nachhaltigkeit, das Bestreben, soziale Spannungen und Konflikte zu beruhigen und so zu einem friedlichen Miteinander zu kommen. Kritisiert wird an diesem Modell häufig, dass die ökologische Komponente ihre herausragende Stellung verliert und ihre Bedeutung, wenn auf einer Ebene mit den anderen Dimensionen, unterminiert wird (vgl. Grunwald / Kopfmüller, 2012, S. 53-54).
In der Nachhaltigkeitsdiskussion wird unterschieden zwischen starker und schwacher Nachhaltigkeit. Das Konzept der schwachen Nachhaltigkeit geht davon aus, dass sich ökologische, ökonomische und soziale Ressourcen gegeneinander aufwiegen lassen. Man kann demnach Naturressourcen erschöpfen, wenn sie durch Schaffung von Human- oder Sachkapital kompensiert werden. Die drei Dimensionen sind hier gleichwertig. Die Idee der starken Nachhaltigkeit geht im Gegensatz dazu davon aus, dass Naturkapital praktisch gar nicht durch anderes ersetzbar ist und somit ein Primat der Ökologie herrschen muss (vgl. Pearce, 1996, S. 15-17; Grunwald / Kopfmüller, 2012, S. 37-39).
Eine Beschränkung auf ein Ein-Säulen-Konzept mit der einen Säule ökologische Nachhaltigkeit wird aber der Realität nicht gerecht. Fragen zur gesellschaftlichen Entwicklung, zu dem, was wir unseren Nachfahren hinterlassen, und über die Befriedigung menschlicher Bedürfnisse lassen sich nicht rein ökologisch beantworten. Darum muss man auf jeden Fall verschiedene Dimensionen der Nachhaltigkeit annehmen, aber verstehen, dass diese nicht separat betrachtet werden können. Die Idee eines integrativen Nachhaltigkeitskonzepts, und dieses möchte ich als Grundlage für meine Arbeit nehmen, geht davon aus, dass „Nachhaltigkeitserwägungen nicht getrennt in den Dimensionen“ (Grunwald / Kopfmüller, 2012, S. 53) vorgenommen werden können. Die verschiedenen Säulen stehen also in Wechselwirkung zueinander und ein nachhaltiges Handeln kann nur integrativ in allen Dimensionen betrieben werden, weshalb generelle querschnitthafte Ziele, wie der Fortbestand der menschlichen Existenz, Erhalt des Produktivpotenzials und die Bewahrung der schon in der Einleitung erwähnten Handlungsmöglichkeiten der Gesellschaft, eher geeignet sind als getrennte Ziele. Nachhaltigkeit bedeutet demnach immer auch Gerechtigkeit. Zwischen Ökonomie und Ökologie, zwischen Arm und Reich, zwischen Mann und Frau, zwischen verschiedenen
Völkern, zwischen Nord und Süd und zwischen den Generationen. Nachhaltige Entwicklung basiert somit letztlich auf zwei Fundamenten, auf Verteilungsgerechtigkeit heute und auf einer Zukunftsverantwortung für kommende Generationen (vgl. Grunwald / Kopfmüller, 2012, S. 7).
Abbildung 1: Nachhaltige und optimale Entwicklung (Quelle: Pearce, 1996, S. 9)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Jedes politische oder gesellschaftliche Handeln tut gut daran, sich an dieser Nachhaltigkeitsbegrifflichkeit messen zu lassen, aber besonders in der Entwicklungszusammenarbeit, die zum Teil einen erheblichen Eingriff in ein gesellschaftliches System darstellt, sind Gedanken zu den langfristigen Folgen und den möglichen Wechselwirkungen unentbehrlich. Hierbei kann ein Konflikt auftreten zwischen einer nachhaltigen und einer optimalen Entwicklung, die unter Umständen nicht identisch sind. Es ist stets eine Frage der Diskontierung, wie hoch man Wohlstand heute im Vergleich zu Wohlstand morgen oder in einigen Jahrzehnten wertet. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass eine nachhaltige Entwicklung langsamer abläuft als eine andere, in dem Fall für die Entwicklung optimale.
Das heißt, wie in Abbildung 1 rein schematisch dargestellt, dass das Umschwenken zu einer nachhaltigen Entwicklung kurzfristig die Entwicklung von Wohlstand bremsen, langfristig eine nicht nachhaltige Entwicklung aber überflügeln kann. Im Feld der Entwicklungszusammenarbeit kann dieser Konflikt noch drastischer zutage treten, wenn nämlich zum Beispiel in Form einer „dreckigen“ Industrialisierung sehr viel schneller als auf jede andere Art die Lebensbedingungen einer sehr armen und hungernden Bevölkerung verbessert werden können, so opfert man mit einem Beharren auf eine nachhaltige Entwicklung einen schnelleren Wohlstand und Wohlergehen und im Extremfall das Leben von Betroffenen einem langfristigen Ideal (vgl. Pearce, 1996, S. 8-10). Nachhaltig ist nicht gleichbedeutend mit gut und vor allem ist nicht alles nicht gut, was nicht nachhaltig ist. Man denke nur an kurzfristige Hilfsprogramme, wie die Einsätze von „Médecins Sans Frontières“ oder Lebensmittellieferungen in Krisengebiete. Es wäre falsch, diesen ein Defizit auf Grund mangelnder Nachhaltigkeit vorzuwerfen, da die Zielsetzung eine ganz andere und trotzdem richtige ist. Diese Beispiele zielen aber im engeren Sinne nicht auf Entwicklung ab und es scheint, neben der Unterscheidung zwischen staatlicher und nichtstaatlicher Entwicklungszusammenarbeit, eine weitere Unterscheidung, nämlich zwischen Soforthilfe und langfristiger Entwicklungsarbeit, sinnvoll und es ist festzuhalten, dass immer dort, wo es um langfristigere Entwicklung geht, die Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle spielen muss.
Wenn die Bedeutung so klar ist, stellt sich die Frage, wo überhaupt die Problematik liegt. Warum ist nicht längt alles Vorgehen in der Entwicklungszusammenarbeit zumindest von Gedanken zur Nachhaltigkeit geprägt, oder ist es das vielleicht schon? Als die größten Hemmnisse hierfür sieht der deutscher Politikwissenschaftler Uwe Holtz zum einen die nicht ausreichende und nicht langfristige finanzielle Absicherung und die mangelnde Kompetenz beziehungsweise Sensibilisierung in den Geberländern und zum anderen, bei der staatlichen Entwicklungszusammenarbeit die Überlagerung mit anderen Interessen, wie zum Beispiel der Agrarexportpolitik und darin, dass auf allen Seiten nicht immer ein Interesse besteht, Fehler und Schwächen gängiger Praktiken aufzudecken (vgl. Holtz, 2000, S. 8). Noch heute ist es schwierig, Informationen über vergangene Projekte zu bekommen, es gab lange Zeit, selbst bei staatlichen Entwicklungsprojekten, so gut wie gar keine Ex-Post-Evaluationen und vieles in der Entwicklungszusammenarbeit, besonders zu gescheiterten Projekten, wird weder adäquat aufgearbeitet noch dokumentiert (vgl. Stockmann, 1996, S. 7-8; Caspari, 2004, S. 39-40).
Auch ein gewisser Selbsterhaltungstrieb bei den in der Entwicklungszusammenarbeit Tätigen, in Deutschland immerhin fast 100.000 Menschen, die am liebsten ihren Arbeitsplatz in ihrem Projekt weiterführen wollen, verhindert oft eine kritische Reflexion; die Entwicklungshelfer helfen oft in erster Linie sich selbst (vgl. Seitz, 2010, S. 163-165).
Für die Evaluierung der Entwicklungszusammenarbeit wird die Kategorie Nachhaltigkeit häufig zusammenfassend als „dauerhafte Wirksamkeit“ (Holtz, 2000, S. 2) verstanden. Es geht im allgemeinen Diskurs um die Frage nach dem Fortbestand der Ergebnisse nach Einstellung der Zusammenarbeit über eine angemessene Zeitdauer und um eine Beantwortung dieser Frage unter Einbeziehung möglichst aller komplexen Wechselwirkungen zwischen Umwelt, Politik und Gesellschaft.
Für diese Arbeit möchte ich den Nachhaltigkeitsbegriff in der Entwicklungszusammenarbeit noch einmal erweitern. Das bisher Erläuterte bildet sicherlich den Kern der Nachhaltigkeit, der Begriff der Nachhaltigkeit kann aber noch mehr leisten, dergestalt, dass er auch Aussagen über die Qualität der Leistung eines Entwicklungsprojekts zulässt (vgl. Caspari, 2004, S. 55). Um, wie die Karlsruher Forscher Armin Grunwald und Jürgen Kopfmüller fordern, eine „Kultur der Nachhaltigkeit“ (2012, S. 229-239) im Sinne eines integrativen Konzepts auch in der Entwicklungszusammenarbeit zu etablieren, muss der Aspekt der Sinnhaftigkeit bei allen Nachhaltigkeitsfragen eine Rolle spielen. Natürlich ist darauf zu achten nicht in das Gebiet anderer Evaluierungskriterien wie Relevanz oder Effektivität zu gelangen, mir scheint aber die Zielsetzung einer Maßnahme auch auf die Langfristigkeit, also die engere Definition von Nachhaltigkeit, Auswirkung zu haben. Wenn es um Entwicklung geht, stellt sich immer die Frage: wohin? Von der Vorstellung, Entwicklung ist gleichzusetzen mit Wirtschaftswachstum, ist man mittlerweile abgekommen. Als Ideal scheint jedoch vielerorts, ohne Rücksicht auf regionale oder kulturelle Eigenheiten, nach wie vor das westliche Entwicklungsmodell verbreitet zu sein. Diese verengte Sichtweise, nach der Entwicklung sich in Nachahmung erschöpft, beschränkt Entwicklung oft auf Bruttonationaleinkommen, Industrialisierung und materiellen Wohlstand. Jede so geartete Maßnahme bringt neben erwünschten Wirkungen immer auch viele Nebenwirkungen gerade im Bereich der Nachhaltigkeit mit sich.
Als Gegenentwurf stellt der Harvard-Professor Amartya Sen, der 1998 den Preis für Wirtschaftswissenschaften der schwedischen Reichsbank im Gedenken an Alfred Nobel gewann, sein Konzept der Freiheit dar. In seinem Buch, „Development as Freedom“ argumentiert er, in Anlehnung an die Ideen des englischen Philosophen und Vordenkers der Aufklärung John Locke (vgl. Locke, 2008, S. 13-22, Erstauflage 1689), dass die Vergrößerung der individuellen Freiheiten, im Sinne von Verwirklichungschancen oder „capabilities“, ein sicherer Weg gegen jede Art von Ungerechtigkeiten ist (vgl. Sen, 2000, S. 74-89). Freiheit ist für ihn ein Maßstab für die Entwicklung und Entwicklung ein Prozess der Erweiterung von Freiheiten. Armut auf der anderen Seite ist für ihn konsequenterweise ein Mangel an Verwirklichungschancen und die Qualität eines Lebens ermisst sich an der zugrunde liegenden Freiheit (vgl. Sen, 2000, S. 3). Entwicklungszusammenarbeit sind demnach ganz allgemein Verfahren, die größere Handlungs- sowie Entscheidungsfreiheiten für die Zielgruppe ermöglichen.
[...]
[1] Es sei darauf hingewiesen, dass, obwohl die Begriffe West und Ost verwendet werden, dies in keiner Weise ein homogenes Konzept unterstellen soll und eine kritische Haltung zu den Begrifflichkeiten angebracht ist.
- Arbeit zitieren
- Simon Valentin (Autor:in), 2015, Zur Bewertung der Nachhaltigkeit von Entwicklungszusammenarbeit, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/303354
Kostenlos Autor werden











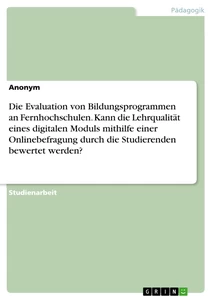






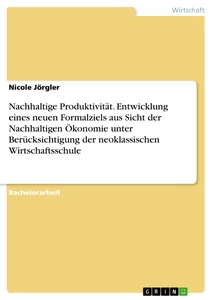



Kommentare