Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Warum Knowledge Management? Der Paradigmenwechsel
2.1 Gesellschaftlicher Wandel
2.2 Veränderungen auf dem Weltmarkt
2.3 Paradigmenwechsel der Managementwissenschaften
2.4 Erste Schritte des Knowledge Management
3 Knowledge Management: Die Theorie
3.1 Der Kernbestandteil: Wissen
3.1.1 Definition
3.1.2 Wissensarten
3.2 Das Konzept: Wissensmanagement
3.2.1 Begriffsdefinition
3.2.2 Aufgaben des Wissensmanagements
3.2.2.1 Einzelne Phasen des Wissensmanagement
3.2.2.1.1 Management der Wissensquellen
3.2.2.1.2 Management der Wissensträger
3.2.2.1.3 Management des Wissensangebots
3.2.2.1.4 Management des Wissensbedarfs
3.2.2.1.5 Management der Kommunikation und der Infrastrukturen zur Wissensverarbeitung
3.2.2.2 Neuinitiierung des Lebenszyklus
3.3 Der Rahmen: Die lernende Organisation
3.3.1 Organisationales Lernen: Eine Definition
3.3.2 Lernende Organisation : Das Konzept
3.3.2.1 Phase 1: Sensibilisierung und Vorbereitung des Unternehmens
3.3.2.2 Phase 2: Aktiver Informationserwerb und -austausch
3.3.2.3 Phase 3: Integration, Synthese und Expansion der Wissensbasis
3.3.2.4 Phase 4: Effektiver Wissenstransfer und Kommunikation
3.3.2.5 Phase 5: Implementierung und Verbesserung der Wissensbasis
4 Unternehmensberatung: Consulting Company
4.1 Vorstellung des Unternehmens
4.2 Durchführung von Interviews: Ist-Aufnahme
4.3 Informationsfluß im Geschäftsablauf: Ist-Analyse
4.3.1 Struktur der Informationsdatenbanken
4.4 Wissensvernetzung aus Perspektive des Wissensmanagements: Schwachstellenanalyse
4.4.1 Kundenakquisition:
4.4.1.1 Erstkontakt: Mitarbeiterprofile / Verfügbarkeit / SW-Präsentation
4.4.1.2 Folgekontakte: "Minenfelder" / Geschäftsvorfall
4.4.1.3 Angebotserstellung: Standards
4.4.2 Projektbearbeitung
4.4.2.1 Projekterfahrungen: "Key-Player"
4.4.2.2 Literaturrecherche: Internet-Adressen / Literatur
4.4.2.3 Einführung der Juniorberater: Vorgehensmodell
4.4.3 Prozeßmanagement: Strategische Tendenzen
4.5 Ungünstige Rahmenbedingungen als Wissensmanagementhindernis
5 Knowledge Management: Das System
5.1 Strukturierung der Wissensbasis
5.1.1 Informationstechnologische Basis
5.1.2 Vorstrukturierung
5.1.2.1 Wissensidentifikation
5.1.2.2 Wissensstrukturanalyse
5.1.3 Umsetzung und Anwendungspotential am Beispiel Consulting Company
5.1.3.1 Kundendatenbank:
5.1.3.2 Mitarbeiterprofile:
5.1.3.3 Projektdatenbank
5.1.3.4 Leitlinien & Standarddokumente
5.1.3.5 Virtuelle Bücherei
5.1.3.6 Produktdatenbank
5.1.3.7 Kommunikationsplattform
5.1.3.8 Virtuelles Adressbuch
5.1.3.9 Termindatenbank
5.1.3.10 Zuliefererdatenbank
5.1.3.11 Wettbewerberdatenbank
5.1.3.12 Datenbank der Partnerunternehmen
5.1.4 Leitlinien zur Dokumentgestaltung
5.2 Methoden und Werkzeuge der Wissensvernetzung
5.2.1 Interne Entwicklung
5.2.1.1 Hinter den Kulissen von Arthur Andersen
5.2.2 Mit Standardsoftware zum Knowledge Management
5.2.2.1 Synapsen eines Gehirns: Lotus Notes
5.2.2.2 Kollaboratives Wissensmanagement: grapeVine
5.3 Suchmechanismen
5.4 Datensicherheit
6 Lösungskonzepte zu Kernproblemen der praktischen Umsetzung: Die Rahmenbedingungen
6.1 Typische Probleme und ihre Lösungskonzepte
6.1.1 Selektion des relevanten Erfahrungswissens
6.1.2 Motivation zur Eingabe des Erfahrungswissens
6.1.2.1 Direkte Anreizfaktoren
6.1.2.1.1 Monetäre Anreize
6.1.2.1.2 Nichtmonetäre Anreize
6.1.2.1.3 Karriere & Konkurrenz
6.1.2.2 Strukturelle Anreizfaktoren
6.1.2.2.1 Systemtransparenz
6.1.2.2.2 Systemmarketing
6.1.3 Nutzung des Systems
6.1.3.1 Wissenstransparenz
6.1.3.2 Aktualität der Wissensbasis
6.1.4 Kosten
6.1.4.1 Investition in ein Knowledge Management System
6.1.4.2 Wettbewerbsvorteile des Knowledge Management
6.1.4.3 Kosten/Nutzen: Gegenüberstellung
6.1.5 Datenschutz: Einwände des Betriebsrats
6.2 Voraussetzungen für den Kulturwandel
6.2.1 Kommunikation
6.2.2 Engagement der Geschäftsführung
6.2.3 Stimmungswandel
6.2.4 Zusammensetzung des Teams
6.2.5 Externe Berater
6.2.6 Zuständigkeiten und zeitlicher Rahmen
6.3 Entwicklung förderlicher Rahmenbedingungen
6.3.1 Lernkultur
6.3.1.1 Transparenz
6.3.1.2 Offenheit
6.3.1.3 Sensibilität
6.3.1.4 Glaubwürdigkeit
6.3.1.5 Vertrauen
6.3.1.6 Courage
6.3.1.7 Vision
6.3.1.8 Produktive Verunsicherung
6.3.2 Lernarchitektur
6.3.2.1 Wissensfreundliche Strukturen
6.3.2.2 Hypertextorganisation
6.3.2.3 Wissensmanager
6.3.3 Lernen zu lernen
6.4 Einführungsstrategie
6.4.1 Wissensprofile feststellen
6.4.2 Wissenskultur analysieren
6.4.3 Schritte in die Umsetzung
6.4.4 Das Nadelöhr
7 Zusammenfassung
8 Ausblick
9 Literaturverzeichnis
10 Anhang
Abbildungsverzeichnis
Abb. 2.1 Produktionsfaktoren im Wandel der Zeit (2, 66)
Abb. 2.2 Die Evolution der Gesellschaftssysteme (1, 6)
Abb. 2.3 Externe Faktoren des Wandels (1, 8)
Abb. 2.4 Der Wandel des Strategieparadigmas (5, 57)
Abb. 3.1 Die Begriffshierarchie Daten, Information und Wissen (10, 3)
Abb. 3.2 Die Beziehungen zwischen den Ebenen der Begriffshierarchie (10, 6)
Abb. 3.3 Implizites und explizites Wissen (33, Kap. 1)
Abb. 3.4 Lebenszyklusmodell des Managements der Ressource „Wissen“ (10, 20)
Abb. 3.5 Die fünf Phasen des organisationalen Lernens (9, 106)
Abb. 3.6 Aufbau einer Lernarchitektur (9, 107)
Abb. 3.7 Interne und externe Lernprozesse (9, 110)
Abb. 3.8 Phasen der Lernkooperation mit der Extended Enterprise (9, 115)
Abb. 4.1 Vergleich des Arbeitsaufwandes ohne und mit Wissensmanagementsystem
Abb. 5.1 Aufgaben des Wissensmanagement (13, 40)
Abb. 5.2 Das Intratom (16, 88)
Abb. 5.3 Arten von Wissenslandkarten (11, 12)
Abb. 5.4 Wissenslandkarte und –strukturdiagramm (11, 42)
Abb. 5.5 Das Hauptmenü des Wissensmanagementsystems
Abb. 5.6 Die Kundendatenbank
Abb. 5.7 Das Mitarbeiterprofil
Abb. 5.8 Die Projektdatenbank
Abb. 5.9 Die Datenbank für Leitlinien und Standarddokumente
Abb. 5.10 Die virtuelle Bücherei
Abb. 5.11 Die Produktdatenbank
Abb. 5.12 Die Kommunikationsplattform
Abb. 5.13 Das virtuelle Adressbuch
Abb. 5.14 Die Termindatenbank
Abb. 5.15 Die Zuliefererdatenbank
Abb. 5.16 Die Wettbewerberdatenbank
Abb. 5.17 Die Datenbank der Partnerunternehmen
Abb. 6.1 Verbesserungspotentiale des Wissensmanagements (11, 8)
Abb. 6.2 Wissensmarktplatz (34, 104)
Abb. 6.3 Anreize zur Erfahrungseingabe
Abb. 6.4 Beurteilung der Eingabequalität
Abb. 6.5 Management-Cockpit von Hewlett-Packard (18, 267)
Abb. 6.6 Elemente der Systemtransparenz
Abb. 6.7 Systemmarketing für Wissensmanagement
Abb. 6.8 Ausgestaltung eines Info-Centers (18, 273)
Abb. 6.9 Wissen "begreifen" durch Visualisierung (18, 279)
Abb. 6.10 Hirngerechte Dokumentgestaltung (18, 276-277)
Abb. 6.11 Todesspirale einer elektronischen Wissensbasis (18, 310)
Abb. 6.12 Konzeptansatz zu Aktualisierung des Wissens
Abb. 6.13 Entgangener Gewinn durch ungenutztes Wissen (26,112)
Abb. 6.14 Das Investitionsvolumen (35)
Abb. 6.15 Entwicklungsschritte eines erfolgreichen Wissensmanagements (11, 23)
Abb. 6.16 Ängste vor Veränderungen im Unternehmen (30, 173)
Abb. 6.17 Offene Kultur (31, 93)
Abb. 6.18 Wertorientierte Führung (31, 98)
Abb. 6.19 Hypertextorganisation (18, 355)
Abb. 6.20 Elemente und Vorgänge des Wissensmanagement (18, 347)
Abb. 6.21 Wissensprofil eines Unternehmens (18, 346)
Abb. 6.22 Paradoxien im Umgang mit Wissens (18, 349)
1 Einleitung
Seit den Jahren des ausklingenden Millenniums zeichnet sich in der weltweiten Unternehmenslandschaft immer deutlicher der Bedarf nach einem Konzept ab, nach dem Erfahrungswissen von Unternehmen zielgerichtet als Produktionsfaktor eingesetzt werden kann. Um den steigenden Anforderungen der Globalisierung nach beschleunigten und flexiblen Organisationsabläufen standzuhalten, wird die unternehmensweit über Ländergrenzen hinweg erarbeitete Expertise, im Rahmen des Wissensmanagements jedem Mitarbeiter weltweit verfügbar gemacht.
Das Ziel des Wissensmanagement ist es, sowohl den Zeitrahmen von Organisationsabläufen durch eine gezielte Abrufbarkeit der Expertise zu verkürzen, als auch durch Verknüpfung der Erfahrungsquellen weltweit Synergien des Wissens zu realisieren, die die Qualität des Arbeitsergebnisses eines Unternehmens wesentlich verbessert.
Mit dieser Arbeit wird das Ziel verfolgt, ein Konzept des Wissensmanagements zu entwerfen, welches sich nicht in die zahlreichen theoretischen Schilderungen dieser Thematik miteinreiht, sondern sich durch einen konzentrierten Praxisbezug kennzeichnen läßt.
Eine erschwerende Voraussetzung für dieses Vorhaben ist, daß die Praxiserfahrungen der Consultinguntenehmen, als den "Pionieren" des Wissensmanagements, zur Sicherung von Wettbewerbsvorteilen nur zu einem sehr geringen Teil öffentlich zugänglich sind. Aus diesem Grunde wurde der Konzeptentwurf auf der Grundlage der unternehmerischen Praxis eines Beratungsunternehmens in Norddeutschland realisiert. Die durchgeführten Interviews dienten dazu den praktische Bedarf eines Beratungsunternehmens detailliert zu analysieren, um beim Konzeptentwurf diesen gerecht zu werden.
Die vorliegende Arbeit läßt sich in folgende Bearbeitungsschritte der Thematik Wissensmanagement untergliedern. Nach der Einleitung wird im Kapitel 2 der Bedarf nach Wissensmanagement aus verschiedenen Perspektiven analysiert. Dies soll dazu dienen, die gegenwärtige Bedeutung von Wissensmanagement bzw. den Handlungszwang zu veranschaulichen.
In Kapitel 3 werden die Begriffe und das theoretische Modell des Wissensmanagements vorgestellt. Darauf folgend wird in Kapitel 4 ein Beratungsunternehmen in Norddeutschland unter dem Pseudonym „Consulting Company“ als Praxisbeispiel aufgeführt. Dabei wird versucht, die Bedarfsstruktur der Consultingbranche bezüglich des zu entwickelnden Systems und der entsprechenden Rahmenbedingungen festzustellen.
Im anschließenden Kapitel 5 wird das System des Wissensmanagement aus der praktischen Perspektive vorgestellt. Dabei werden sowohl die Bedarfsstruktur des Unternehmens Consulting Company als auch Erfahrungsberichte aus der Literatur beim Konzeptentwurf berücksichtigt.
Kapitel 6 veranschaulicht die Rahmenbedingungen unter denen ein Wissensmanagement trotz Hindernissen langfristig "überleben" kann. Da laut erster Erfahrungsberichte weniger die informationstechnologische Realisierbarkeit, sondern eher die Unterstützungsbereitschaft der Mitarbeiter sich als zentrale Barriere der Umsetzung von Wissensmanagement ergibt, werden insbesondere die Möglichkeiten zur Steigerung der Unterstützungsmotivation des einzelnen Mitarbeiters untersucht.
Die anschließende Zusammenfassung der Ergebnisse und ein Ausblick in die Zukunft des Wissensmanagement beschließen diese Arbeit.
2 Warum Knowledge Management? Der Paradigmenwechsel
2.1 Gesellschaftlicher Wandel
Etwa seit Beginn der sechziger Jahre hat sich das Thema des „organisatorischen Wandel „ zu einer zentralen Problemstellung in der Managementliteratur entwickelt.
Die Bewältigung des Wandels wird angesichts der zukünftigen Perspektiven und der Notwendigkeit zur Anpassung an permanent wechselnde Umweltbedingungen als die entscheidende Größe für das Überleben und die weitere Entwicklung von Organisationen angesehen. (1, 1)
Es läßt sich hierbei ein gesellschaftlicher Entwicklungstrend von der Industriegesellschaft, in der Arbeit und Kapital die wichtigsten Produktionsfaktoren darstellen, zur sogenannten „Wissensgesellschaft“, in der Wissen der wettbewerbsentscheidende Produktionsfaktor ist, feststellen, wie in Abbildung 2.1 dargestellt ist.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2.1 Produktionsfaktoren im Wandel der Zeit (2, 66)
Die Phasen der beschriebenen gesellschaftlichen Entwicklung und deren hervorstehende Merkmale zur heute proklamierten Wissensgesellschaft werden in Abbildung 2.2 veranschaulicht.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2.2 Die Evolution der Gesellschaftssysteme (1, 6)
2.2 Veränderungen auf dem Weltmarkt
Organisationen stehen heute mehr denn je vor der Herausforderung, den Wandel zu bewältigen. Als externer Änderungsdruck gelten beispielsweise die in Abbildung 2.3 dargestellten unmittelbaren Faktoren.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2.3 Externe Faktoren des Wandels (1, 8)
Organisationen stehen angesichts dieser insgesamt beschleunigten und in ihrer Komplexität erhöhten Anforderungen an Arbeitswelt und Gesellschaft vor der Aufgabe, den Anpassungsdruck im Rahmen organisatorischer Wandelprozesse gerecht zu werden.(1, 6-7)
Für international tätige Organisationen ergibt sich eine strategische Flexibilität neuen Ausmaßes, wenn sie in der Lage sind, Daten und Dienstleistungen besser als die Konkurrenz auf internationaler Ebene zu koordinieren. Schließlich sind gerade Dienstleistungen und Wissen
diejenigen Fähigkeiten eines multinationalen Unternehmens, die vom jeweiligen Gastgeberland weniger leicht nachgeahmt werden können. Hier liegt bei den Beziehungen zu den Partnerländern, Zulieferfirmen und Kunden in den einzelnen Ländern der entscheidende Vorteil des multinationalen Unternehmens.
Mit dem Ziel der Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit werden in simultaner Produktentwicklung die unterschiedlichen Zeitzonen der einzelnen Ländern derart genutzt, daß für das Produktdesign ein 24 Stunden-Tag zur Verfügung steht.
Ganze Wirtschaftszweige strukturieren sich neu, um bei verschiedenartigsten Projekten simultane Interaktionen auf globaler Ebene zu ermöglichen. Diese Branchen entwickeln sich zu nur lose strukturierten Netzen von „Dienstleistungsunternehmen“, die sich für eine bestimmte Aufgabe (häufig zeitlich begrenzt) zusammenschließen.
Besonders im High-Tech-Bereich kann ein einzelnes Unternehmen nur schwer die ganze Bandbreite der notwendigen Aktivitäten des Entwicklungsprozesses erbringen. Die erforderlichen Spezialkenntnisse, das finanzielle Risiko und der erforderliche Zeithorizont lassen eine weltweit konkurrenzfähige Produktentwicklung innerhalb eines Unternehmens immer seltener zu.
In der Folge kooperieren viele High-Tech-Branchen in Form von Konsortien auf unterschiedlichsten Ebenen, wobei jedes Unternehmen über ein eigenes Vertragspartner- und Informationsnetz verfügt, in das verschiedene Forschungs-, Entwicklungs-, Produktions-, Finanzierungs- und Marketingteams auf der ganzen Welt eingebunden sind. Die Kooperation basiert notwendigerweise mehr auf Information und Kommunikation als auf Eigentumsverhältnissen.(3, 26-30)
Dabei zeichnet sich ab, daß insbesondere für global tätige Unternehmen die Sicherung und der effektive Umgang mit dem Produktionsfaktor Wissen zunehmend zu einer Voraussetzung internationaler Konkurrenzfähigkeit werden.
2.3 Paradigmenwechsel der Managementwissenschaften
Die hohe Geschwindigkeit des Wandels der Rahmenbedingungen unternehmerischen Handelns machen Konzepte zentraler Planung und Steuerung zunehmend unwirksam. Wenn Zeit zu einem kritischen Wettbewerbsfaktor wird, dann verlieren langwierige strategische Analysen und Studien ihre Legitimationsbasis. Was nützen sorgsam recherchierte Fakten, die von Analysen und Planungsstäben zusammengetragen und aufbereitet werden, wenn sie bereits am Tag der Präsentation so veraltet sind, daß sich daraus keine verläßlichen Strategien ableiten lassen?
Das technokratisch-instrumentelle Paradigma, das von der Idee der zentralen Beherrschbarkeit von Komplexität ausgeht, stößt auch bei der internen Steuerung und Kontrolle von Unternehmen an schmerzhafte Grenzen. Der Zwang, immer rascher und unmittelbarer auf Markt- und Technologieveränderungen zu reagieren, entmachtet das „Zentrum“ und weist notwendigerweise denjenigen Organisationsteilen mehr Einfluß zu, die an den “Rändern„ bzw. der Peripherie des Unternehmens angesiedelt sind.
Der Fachmann scheitert immer öfter an der hohen Komplexität der Fragestellung, der nur eine Wissensdisziplin kaum gerecht werden kann.
Hinzu kommt, daß mit zunehmender Komplexität der Produkte sowohl Kunden als auch Lieferanten mit ihrer Expertise an der Produktentwicklung in zunehmendem Maße beteiligt werden müssen.
Der Kunde wird zum Prosument - er ist nicht mehr nur Konsument, der ein bestimmtes Produkt, die EDV-Lösung geliefert haben will, sondern auch Mit-Produzent, weil er das Produkt mitgestaltet, sein Wissen also in die Entwicklung miteinfließt.
Es zeichnet sich ab, daß individuelles Wissen sich nicht mehr im Vordergrund befindet, sondern in immer stärkerem Maße gegenüber dem kollektiven „organisationalen“ Wissen zurückweicht.
Die organisatorische Antwort auf die externe Unübersichtlichkeit und Unberechenbarkeit sind kleine, flexible, den jeweiligen Markt- und/oder Technologiegegebenheiten angepaßte Einheiten mit einem relativ hohen Grad an Autonomie.
Bei einem Großteil der Unternehmen besteht jedoch derzeit immernoch eine Konzentration auf Fachwissen. Die "geheimen Spielregeln" im Unternehmen, das sogenannte Kulturwissen und Handlungswissen bleiben beim traditionellen Expertenmodell außen vor. Als Wissen gilt in erster Linie Fachknowhow. Das spezialisierte Handlungswissen findet sich in den operativen Abteilungen - "die Techniker" sprechen eine andere Sprache und haben eine andere Erfolgslogik als "die Verkäufer", "die Produktion", „die Personalisten“ etc. Die funktionale Arbeitsteilung erlaubt es den Abteilungen, sich ganz auf ihren Wissensbereich zu konzentrieren und den Blick für das Ganze dem Topmanagement zu überlassen. Nicht selten wird dabei der eigene Bereich optimiert, allerdings vorbei am Nutzen des Gesamtunternehmens.(4, 126-128)
Die Einrichtung und permanente Pflege einer flexiblen Lernarchitektur, die kontinuierliche Lern- und Veränderungsprozesse nicht nur zuläßt und fördert, sondern diese auch koordiniert und strategisch nutzt, wird zur zentralen Aufgabe des heutigen Managements.(5, 52-54)
Dabei sind Organisationsarchitekturen zu entwerfen, die das wirksame Management von individuellem und kollektivem Wissen optimal unterstützen. Die Abbildung 2.4 faßt den geschilderten Prozeß zusammen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2.4 Der Wandel des Strategieparadigmas (5, 57)
2.4 Erste Schritte des Knowledge Management
In diesen Zeiten sich beschleunigender globaler Veränderungen scheint als Lösung nur noch der Verweis auf eine ständig lernende Organisation möglich. Während die klassische Organisationsentwicklung Change Management als Ausnahmefall ansah, erwächst in der lernenden Organisation (siehe hierzu Kapitel 3) der Wandel zum Normalfall. Sie weist ein Klima auf, in dem die Individuen ermutigt werden zu lernen und ihr volles Potential zu realisieren. Dabei wird ihre Lernkultur auf Kunden, Lieferanten und andere wesentliche Interessengruppen ausgedehnt.(6, 11-12)
Der Schlüssel des Wissensmanagements liegt in der Wahrung des strategischen Schwerpunkts. Das bedeutet nicht unbedingt eine enge Ausrichtung auf einige wenige Produkte. Materielle Grundlagen, etwa Zugang zu einer Rohstoffquelle, Fabrikanlagen oder eine bestimmte Produktgruppe sichern heute kaum noch die längerfristige Wettbewerbsfähigkeit. Das gilt insbesondere für Fertigprodukte, weil sie nur zu leicht technisch überholt, nachgebaut, kopiert oder mit leicht verbesserter Leistung angeboten werden können.
Der richtige strategische Schwerpunkt liegt in der Entwicklung eines für den Kunden besonders wichtigen Angebotes an den Qualifikatonsfaktoren Erfahrungsvorsprung, Innovationskapazitäten, richtige Markteinschätzung, Datenbasen und Informationsverteilungssysteme. Diese Faktoren sollten möglichst in einer solchen Tiefe vorhanden sein, daß sie das Unternehmen in seinen Leistungen gegenüber dem Kunden auf international konkurrenzfähigem Niveau halten. Ferner konzentriert es seine Ressourcen auf diese Aktivitäten und strebt auf den übrigen Gebieten eine Operation mit erstrangigen Partnern an. Wo betriebsintern nicht das höchste Niveau zu erzielen ist, wird zur Auslagerung von Leistungen übergegangen.(7, 38-43)
Um die kontinuierliche Integration und Synthese der unterschiedlichen Erkenntnisse aller Mitarbeiter durchzuführen und die Wissensbasis der Unternehmung entsprechend zu erweitern, entwickeln immer mehr Unternehmen eigene Knowledge Management-Informationssysteme.
Bei der Staefa Control Systems AG in Stäfa fing man bereits 1987 an, intensiv die Thematik Wissensmanagement zu bearbeiten. Staefa stellte fest, daß durch die hohe Personalfluktuation ein wesentlicher Teil des Know-how verloren. Zusätzlich wurde mit zunehmender Größe des Unternehmens das Spezialwissen schwerer lokalisierbar. Erst 1993 aber ist Staefa das Problem systematisch angegangen. Sämtliche Kenntnisse und Erkenntnisse des Produktentwicklungsprozesses werden seit dem in eine Datenbank eingegeben und den Mitarbeitern zur Verfügung gestellt.(8, 78)
IBM institutionalisierte ein Client/Server-Advisor-System mit einer Datenbank, die das gesamte Firmenwissen der einzelnen Client/Server-Projekte rund um die Welt enthält. Das System beinhaltet bereits mehr als 300 Klientenaufträge mit dokumentierten Systemlösungen, die in mehreren Detailebenen sowohl nach Industrien, Produkten, Technologien oder Informationssystemen aufgerufen bzw. studiert werden können.
Vorreiter von innovativen, umfassenden Knowledge Management Systemen ist vor allem auch die Beraterindustrie. Nahezu alle führenden Beraterfirmen investieren beträchtliche Summen, um ihre ständig neuen Erfahrungen und neu entwickeltes Wissen weltweit zu erfassen, zu integrieren und allen Mitarbeitern jederzeit verfügbar zu machen. Beispielsweise ist Booz Allen & Hamiltons Informationssystem „Knowledge-On-line“, das das Repertoire des firmenweiten intellektuellen Kapitals beinhaltet, seit 1996 erfolgreich im Einsatz.
Es bestand 1997 bereits aus mehr als 2.000 Dokumenten (Zahl wächst rapide), geordnet sowohl nach Industrien als auch nach funktionalen Beratungsfeldern. Außerdem sind Firmenexperten in den verschiedenen Industrie- und Managementbereichen, Lebensläufe der Mitarbeiter, Marketingdokumente, Firmenvereinbarungen und vieles mehr enthalten. Auf das System kann weltweit von allen Mitarbeitern 24 Stunden 365 Tage im Jahr zugegriffen werden.(9, 111-112)
3 Knowledge Management: Die Theorie
In vielen Unternehmen setzt sich die Erkenntnis durch, daß das Management des organisationalen Wissens einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil darstellt. Zur Sicherung und zum Ausbau der Wettbewerbsfähigkeit wird es zunehmend wichtig, Information und Wissen als strategische Ressourcen auf dem internationalen Markt zu nutzen. Wissen wird somit zum Motor und zur entscheidenden Größe im Wertschöpfungsprozeß. Auch für die deutsche Industrie sind deshalb folgende Fragestellungen von Bedeutung, um langfristig am „Standort Deutschland“ wettbewerbsfähig bleiben zu können:
- Wie läßt sich individuelles und organisationales Wissen systematisch nutzen und weiterentwickeln?
- Wie kann relevantes Wissen dort bereitgestellt werden, wo es benötigt wird?
- Wie kann individuelles (implizites) Wissen unternehmensweit transparent gemacht werden (explizites Wissen)?
- Wie ist individuelles Expertenwissen zu identifizieren, zu speichern und unternehmensweit zu transferieren?
Während im folgenden auf die erste Fragestellung eingegangen wird, sollen in den Kapiteln 5 und 6 die übrigen Fragestellungen am konkreten Beispiel der Unternehmensberatung Consulting Company beantwortet werden.
Organisatorisches Lernen äußert sich in der Art und Weise, wie die organisatorische Wissensbasis für die Beteiligten einer Organisation nutzbar gemacht, verändert und fortentwickelt wird. Individuelles Lernen ist zwar eine Voraussetzung für organisatorisches Lernen, darf jedoch nicht hierauf reduziert werden. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, daß prinzipiell zugängliches Wissen in einer konkreten Entscheidungssituation unter Umständen nicht greifbar ist. Dieser Argumentation folgend darf Wissensmanagement sich nicht nur mit dem organisatorischen Lernprozeß als solchem beschäftigen, sondern muß versuchen, die in einer Organisation vorzufindenden Informations- und Kommunikationspathologien zu beseitigen. Auch dieser Aspekt wird in Kapitel 6 näher untersucht werden.(10, 9) Die Gestaltung von Prozessen und Systemen im Rahmen eines ganzheitlichen Wissensmanagements ist ein wesentlicher Gesichtspunkt bei der Beantwortung der oben skizzierten Fragestellungen.
Die Ausschöpfung der herkömmlichen Produktionsfaktoren und eine rein technologische Überlegenheit reichen heute nicht mehr aus, um Wachstum zu fördern. Vielmehr ist es das im Unternehmen verfügbare, in den Köpfen der Mitarbeiter verankerte Wissen über Technologien, Produkte, Prozesse, Strukturen, Kunden und Wettbewerber, welches es Unternehmen ermöglicht, Prozesse zu optimieren, die Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen zu beschleunigen sowie deren Qualität zu verbessern. Wissen muß demnach tatsächlich explizit "gemanaged" werden, um dessen effektiven und gewinnbringenden Einsatz im Unternehmen zu gewährleisten.(11, 7-8)
3.1 Der Kernbestandteil: Wissen
3.1.1 Definition
Für die industrielle Arbeitswelt zeichnet sich derzeit ein Umbruch ab, der in seiner Tragweite mit der Durchsetzung der industriellen Massenproduktion verglichen werden kann. Dabei läßt sich erkennen, daß wir uns von der Agrargesellschaft über die Industriegesellschaft zunehmend in Richtung einer Wissens- bzw. Informationsgesellschaft entwickeln, die durch eine verstärkte Wissensorientierung geprägt ist.
Wissen ist in diesem Kontext der Produktionsfaktor der Zukunft, der Energie und Rohstoffe, aber in zunehmendem Maße auch Arbeit und Kapital ersetzt. Logistisch bedeutet dieses für den Wertschöpfungsprozeß, daß das richtige Wissen, zum richtigen Zeitpunkt, in der richtigen Menge, am richtigen Ort, in der erforderlichen Qualität bereit stehen muß.(10, 9-10)
Gleichzeitig ist Wissen der einzige „Rohstoff“, der durch Gebrauch wertvoller wird. Akquisition, Entwicklung und Nutzung des für ein Unternehmen relevanten Wissens werden zukünftig zu entscheidenden Wettbewerbsfaktoren.(11, 7)
Die Begriffe „Daten“, „Information“ und „Wissen“ werden unterschiedlich gebraucht. Doch wird im Alltag des Unternehmensgeschehens i.d.R. auf eine klare Trennung verzichtet. Abbildung 3.1 zeigt die Begriffshierarchie von Daten, Informationen und Wissen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 3.1 Die Begriffshierarchie Daten, Information und Wissen (10, 3)
Auf der untersten Stufe der Begriffshierarchie befinden sich die Daten. Nach DIN 44300 (DIN 1972) „werden Daten durch Zeichen repräsentiert. Daten sind das Gegebene zur Verarbeitung ohne Verwendungshinweise.“
Auf dieser Stufe der Begriffshierarchie wird also noch keine Aussage über den Verwendungszweck getroffen.
Aus betriebswirtschaftlicher Sicht wird der Begriff „Information“ auf Kenntnisse bezogen, die der Vorbereitung von (ökonomischen) Handlungen dienen. Informationen sind demnach als in den Kontext eines Problemzusammenhangs gestellte Daten zu betrachten. Aus Daten werden Informationen, wenn sie in einen Problembezug eingeordnet und für die Erreichung eines Zieles verwendet werden. Informationen sind somit Kenntnisse, die ein Handelnder benötigt, um eine Entscheidung darüber zu fällen, wie er ein Ziel am günstigsten erreichen kann.
Der Begriff „Wissen“ hat mit Ausnahme des Bezugs zu wissensbasierten Systemen nicht annähernd die gleiche Aufmerksamkeit in der betriebswirtschaftlichen Literatur erfahren wie der Begriff der Information. Wissen wird bezeichnet als die zweckorientierte Vernetzung von Information. Es stellt die Abbildung (externer) realer Verhältnisse, Zustände und Vorgänge auf (interne) Modelle von der Außenwelt dar, über die ein Individuum oder eine Organisation verfügen. Diese Modelle lassen sich formal in Aussagen fassen, die etwas über die Realität behaupten.
Während Information als Kenntnis über Sachverhalte bezeichnet werden kann, ist Wissen als „begründete“ Kenntnis zu verstehen, im Gegensatz zur Meinung (als etwas Vorläufigem, Unbegründetem) und zum "Glauben". Die zweckorientierte Vernetzung von Information erfordert Kenntnisse darüber, in welchem Zusammenhang die Informationen zueinander stehen und wie diese sinnvoll vernetzt werden können, um dem jeweils verfolgten Zweck zu genügen.
Da Wissen stets nur als eine „modellierte Wirklichkeit“ zu verstehen ist, sollte ein Bezug zum Wissenssubjekt ermöglicht werden, das das Wissen unter Einflußnahme seines persönlichen Blickwinkels entwickelt hat. Wissen ist also subjektrelativ und perspektivisch. Ferner ist Wissen stets auf einen Zweck gerichtet und außerhalb dessen nicht in jedem Kontext zu verwenden. Wissen ist demzufolge zweckrelativ und setzt die Kenntnis seiner Herkunft voraus.
Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß Wissen kontextabhängig und subjektrelativ ist. Deshalb ist Wissen nie in einem schlichten Sinne "objektiv". Für das Wissensmanagement bedeutet dieses, daß bei der Verarbeitung von Wissen die Rahmenbedingungen der Wissensgenerierung ersichtlich sein müssen, um Interpretationsfehler zu minimieren.(10, 3-6)
Abbildung 3.2 gibt zusammenfassend die Bezeichnungen zwischen den Ebenen der Begriffshierarchie wieder.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 3.2 Die Beziehungen zwischen den Ebenen der Begriffshierarchie (10, 6)
3.1.2 Wissensarten
Wissen wird differenziert in implizites und explizites Wissen. Implizites Wissen ist schwer formalisierbar und kommunizierbar, da es „tief in den Köpfen einzelner Personen“ gespeichert ist (embodied knowledge). Subjektive Einsichten und Intuition sind beispielsweise implizites Wissen. Es ist in den Handlungen und Erfahrungen von Individuen verankert, ebenso wie in den Idealen, Werten oder Gefühlen.
Explizites Wissen hingegen ist „außerhalb der Köpfe einzelner Personen“ in Medien gespeichert (disembodied knowledge). Es kann daher relativ einfach mittels elektronischer Datenverarbeitung bearbeitet, übertragen und gespeichert werden. Abbildung 3.3 soll die Unterschiede beider Wissensarten veranschaulichen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 3.3 Implizites und explizites Wissen (33, Kap. 1)
Die Beschaffenheit des impliziten Wissens erschwert eine Verarbeitung, Übertragung und Speicherung in einer systematischen Art und Weise. Um implizites Wissen in einer Organisation verarbeiten, übertragen und speichern zu können, muß es in dokumentiertes explizites Wissen überführt werden. Die Zugänglichkeit von implizitem Wissen ist hinsichtlich des Ziels der kollektiven Nutzung von großer Bedeutung. In der Unternehmenspraxis ist es noch durchaus üblich, daß trotz Vorhandenseins relevanten Wissens, das spezielle Objektwissen dem Entscheidungsträger aufgrund struktureller Barrieren nicht zugänglich ist. Diese Art von Wissen wird als latentes Wissen bezeichnet
Geht man von Wissen als eigenständigem Produktionsfaktor aus, so folgt, daß für diese Ressource eigene Managementtechniken zur Planung, Steuerung, Organisation und Kontrolle aufgebaut werden können und müssen. Diese Techniken zum Management der Ressource „Wissen“ sollen im folgenden Abschnitt näher ausgeführt werden.(10, 6-10)
3.2 Das Konzept: Wissensmanagement
3.2.1 Begriffsdefinition
Wissen als das Verständnis über systematische und logische Zusammenhänge von Informationen baut auf Daten auf. Informationen als solche sind wertlos, sofern sie nicht vernetzt sind und mit der jeweiligen Situation in Bezug gesetzt werden. Informations- und Wissensmanagement sind somit klar voneinander abzugrenzen.
Der Begriff „Wissensmanagement“ läßt sich folgendermaßen operationalisieren:
- Wissensbedarf erkennen und Wissensziele formulieren,
- Wertschöpfungsrelevantes Wissen identifizieren und transparent machen,
- Wissen strukturieren und bewerten,
- Wissen speichern und verankern,
- Wissen verteilen, nutzen und multiplizieren,
- Erwerb und Entstehung neuen Wissens fördern,
- Handlungsmaßnahmen zur Erreichung der Wissensziele ableiten und festlegen,
- Kontrolle der erreichten Ziele und Maßnahmen.
Es ist zu betonen, daß zum erfolgreichen Management der Ressource Wissen mehr als nur die Einführung von Informations- und Kommunikationstechnologie gehört. Der Einsatz von unternehmensinternen Netzen (Intra-Netze) und Datenbanksystemen ist zwar einerseits ein wesentliches Element des Wissensmanagements, jedoch andererseits ohne begleitende Maßnahmen nur wenig erfolgversprechend.
Strukturen und Prozesse im Kontext eines ganzheitlichen Wissensmanagement sind so zu gestalten, daß eine eindeutige Zuordnung von Aufgabe, Verantwortung und Kompetenz innerhalb des Unternehmens als Organisation erfolgen kann. Darüber hinaus sind Randbedingungen zu schaffen, die die Mitarbeiter im Unternehmen dazu veranlassen, ihr Wissen zu (ver)teilen.
Neben einer entsprechenden Unternehmenskultur sind in diesem Zusammenhang besonders die Entwicklung sowohl materieller als auch immaterieller Anreizsysteme von entscheidender Bedeutung. Alle Anreizsysteme sind jedoch zum Scheitern verurteilt, wenn nicht eine Unternehmenskultur herrscht, die sowohl durch Offenheit und Ehrlichkeit, als auch durch Vertrauen geprägt ist. Nur wenn die Mitarbeiter Vertrauen in ihr Unternehmen haben, sind sie bereit, ihr Wissen weiterzutragen.
Nicht das Wissen der einzelnen Mitarbeiter, sondern das kollektive Wissen entscheidet langfristig über die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens.(11, 8-11)
Erst wenn sich das Wissen einzelner zu einer kollektiven Wissensbasis vereinigt, entstehen die Synergieeffekte des Wissens, die die Summe der individuellen Wissensinhalte bei weitem übersteigen.
3.2.2 Aufgaben des Wissensmanagements
Die Aufgaben des Wissensmanagements müssen darin bestehen, die infrastrukturellen und organisatorischen Voraussetzungen für eine lernende Organisation (näheres in Kapitel 3.3) zu schaffen, damit die organisatorische Wissensbasis genutzt, verändert und fortentwickelt werden kann.
Die zunehmende Komplexität der Umwelt und die Fluktuation menschlicher Wissensträger macht hierbei den Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien für die Unterstützung des organisatorischen Lernens und damit auch der organisatorischen Wissensbasis unabdingbar.
Das folgende Lebenszyklusmodell veranschaulicht die dem organisatorischen Lernen zugrunde liegende Dynamik. Dabei lassen sich die Aufgaben des Wissensmanagements in folgende Managementphasen unterteilen:
1. Management der Wissensquellen
2. Management der Wissensträger
3. Management des Wissensangebots
4. Management des Wissensbedarfs
5. Management der Kommunikation und der Infrastruktur zur Wissensverarbeitung
Der Zusammenhang dieser einzelnen Managementphasen wird im Lebenszyklusmodell in Abbildung 3.4 veranschaulicht.
Im folgenden Abschnitt werden die Details zu den Managementphasen (1) bis (5) erläutert, um anschließend die Dynamik des Wissensmanagements anhand der Pfeile ( bis ( zu verdeutlichen.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 3.4 Lebenszyklusmodell des Managements der Ressource „Wissen“ (10, 20)
3.2.2.1 Einzelne Phasen des Wissensmanagement
Hinter den einzelnen Managementphasen stehen mehrere Prozesse. Die Inhalte werden in einer prozeßorientierten Sichtweise aufgezeigt, um die Zusammenhänge und einsetzbaren Werkzeuge im Rahmen des Prozeßablaufs darstellen zu können.
In diesem Abschnitt soll also im wesentlichen die Verarbeitung expliziten Wissens verdeutlicht werden. Der wesentlich komplizierter zu organisierenden Zugriff auf implizites Wissen und seine nachfolgende Verarbeitung wird in Kapitel 6 beschrieben.
3.2.2.1.1 Management der Wissensquellen
Der Zyklus beginnt mit dem Erkennen und Erheben von Wissen, das noch keinen Eingang in die Wissensträger gefunden hat. Dies kann sowohl durch eine Neubewertung unternehmensintern und -extern vorhandenen Wissens als auch durch die Schaffung neuen Wissens durch Vernetzung von Informationen erfolgen. Anschließend folgt das Sammeln und Erfassen des Wissens.
Die Sammlung und Erfassung des Wissens ist dezentral und möglichst entstehungsnah durchzuführen, um seine Aktualität zu gewährleisten.
Der Einsatz von Methoden der Wissensakquisition, die Analyse der Zugriffsmöglichkeiten auf bereits bestehende interne und externe Wissensquellen und die Verarbeitung von natürlicher Sprache ergänzen diesen Prozeß.
Aufgabe des Management ist es in dieser Phase, dafür Sorge zu tragen, daß die Wissens- und Informationsquellen systematisch entwickelt und die Prozesse strukturiert werden. Dabei ist die Produktivität der Wissensentwicklungsprozesse stetig zu steigern.
3.2.2.1.2 Management der Wissensträger
Um eine Wissensquelle mehrfach verwenden zu können, muß sie in eine Wissensträger- und Informationsressource überführt werden. Dies geschieht, indem die Wissensquellen zunächst verifiziert werden und anschließend das Wissen auf (vorwiegend elektronischen) Wissensträgern gespeichert wird. Für eine transparente Präsentation des Wissens sind geeignete Methoden zu wählen bzw. zu entwickeln.
Spätestens zu diesem Zeitpunkt sind auch organisatorische, ökonomische Datensicherheits- und Datenschutzgesichtspunkte zu berücksichtigen. Es muß ein physischer und intellektueller Zugang zum gespeicherten Wissen geschaffen, das Wissen gepflegt (Verändern, Aktualisieren) und die elektronischen Wissensträger instand gehalten werden.
Der physische Zugang ist durch eine Vernetzung der Wissensträger untereinander und durch die Einbindung der Nutzer in das Netzwerk der Wissensträger zu realisieren. Eine Unterstützung für den intellektuellen Zugang kann durch Schnittstellen natürlicher Spracheingabe und Auswahl/Navigationshilfen zur Lokalisierung des Wissens geschaffen werden.
Das Management der Wissensträger- und Informationsressourcen ist für die Bereitstellung geeigneter Wissensträger und Zugriffsmöglichkeiten, deren Pflege und Instandhaltung, sowie für die Speicherung und Darstellung des Wissens verantwortlich. Ferner sind auftretende Informations- und Kommunikationspathologien zu beseitigen.
3.2.2.1.3 Management des Wissensangebots
In dieser Phase ist bereits im Vorfeld für die Lösung typischer wissensorientierter Probleme die notwendige Expertise bereitzustellen. Beispielsweise ist zu erwarten, daß das Wissensangebot der unternehmensweit bzw. weltweit zur Verfügung stehenden Daten-, Methoden- und Modellbanken sich nicht ohne weiteres direkt auf spezielle Anwendungsbereiche umsetzen läßt.
Hier ist ein individuelles Gleichgewicht zwischen allgemeiner Verwendbarkeit (Generalisierung) und fachinterner Gültigkeit (Spezialisierung) zu finden. Die Gültigkeitsdimension des jeweiligen Wissens ist dabei exakt festzustellen. Beispielsweise kann eine direkte Umsetzung einer „Erfolgsstrategie“ des Standortes Berlin in Singapur katastrophale Folgen haben aufgrund des anderen Kontextes (Rahmenbedingungen).
In der Regel wird deshalb zumindest zwischen standortspezifischem Wissen (client-specific knowledge) und Wissen von globaler Gültigkeit (core-synthesized knowledge) bereits in der Strukturierung der Wissensbasis unterschieden. Ferner sind sprachliche Reglementarien und ein effektives Wissenscontrolling durch Knowledge-Manager zu institutionalisieren, um Fehlinterpretationen der Wissensdatenbanken „auf der anderen Seite der Welthalbkugel“ zu vermeiden.
Die Wissenselemente und Informationen werden bei der Weitergabe kontinuierlich aufbereitet und erfahren dabei eine Wertsteigerung durch Analysieren, Umordnen, Reproduzieren, Reduzieren, Verdichten und Strukturieren. Anschließend sind sie an die Wissensbenutzer zu verteilen und zu übermitteln.
3.2.2.1.4 Management des Wissensbedarfs
An der Schnittstelle zwischen den Phasen "Management des Wissensangebots" und "Management des Wissensbedarfs" interpretiert der Wissensbenutzer das von ihm gewünschte Wissen und die ihm zugegangenen Wissens- und Informationsprodukte entsprechend dem von ihm verfolgten Zweck und bringt es zur Verwendung. Bei dieser Verwendung durch den Wissensbenutzer entsteht neues Wissen, da der Wissensbenutzer das ihm vom Wissensangebots bereitgestellte Wissen in seine bereits vorhandenen Wissensstrukturen einbindet und damit vernetzt. Dem Wissensbenutzer obliegt in diesem Zusammenhang auch die Bewertung des Wissens. Ergebnis dieser Bewertung kann sein, daß der Wissensbedarf des Wissensbenutzers vollkommen durch das Wissensangebot befriedigt wurde oder das Wissensangebot ausgeweitet oder verändert werden muß.
3.2.2.1.5 Management der Kommunikation und der Infrastrukturen zur Wissensverarbeitung
Da Wissen wie Information immer an einen physischen Träger gebunden sind, hat die Infrastruktur der Wissensverarbeitung eine wesentliche Bedeutung für das Wissensmanagement. Es genügt nicht, sich allein mit dem informatorischen Aspekt von Wissen zu befassen. Auch die personelle und organisatorische Infrastruktur ist zu beachten.
Durch personalpolitische Maßnahmen kann zum einen gewährleistet werden, daß menschliche Wissensträger an ein Unternehmen gebunden werden. Der Aufbau von Austrittsbarrieren materieller und sozialer Natur kann Mitarbeiter daran hindern, die Unternehmung durch eigene Kündigung zu verlassen. Andererseits kann es auch Gründe gegen enge und lang andauernde Bindungen geben, wenn durch Fluktuation neue Mitarbeiter das Lernpotential insgesamt eher erhöhen.
Organisatorisch sind solche Organisationsformen umzusetzen, die eine lernende Organisation begünstigen, wie in Kapitel 3.3 weiter ausgeführt wird.
Die technologische Infrastruktur beinhaltet Telekommunikationsanlagen und die unternehmensweite Vernetzung elektronischen Wissensträger und deren Nutzer. Nur durch Bereitstellung einer solchen Infrastruktur kann ein ungehinderter Zugang zu Wissensträger- und Informationsressourcen für die Mitarbeiter einer Unternehmung gewährleistet werden. Ziel des Wissens- und Informationsmanagements muß es also sein, die insgesamt erforderliche Infrastruktur bereitzustellen, aufzubauen, instand zuhalten und den aktuellen Entwicklungen anzupassen.
3.2.2.2 Neuinitiierung des Lebenszyklus
Generell beginnt das Management der Ressource „Wissen“ mit der Erhebung des Wissensbedarfs. Wenn die Artikulation von Problemen seitens der Wissensbenutzer zur Feststellung einer Lücke im Wissensangebot führt, wird ein neuer Lebenszyklus initiiert der die Deckung des Wissensbedarfs zum Ziel hat. Dazu sind die verfügbaren Wissenselemente und Informationen so lange aufzubereiten, bis sich die Lücke zwischen Wissensangebot und Wissensbedarf auf eine akzeptable Größenordnung reduziert hat. Für eine komplexe Problemstellung kommt eine vollständige Deckung nur selten zustande. Dieser Ablauf wird in Abbildung 3.4 durch die internen Zyklen ( und ( veranschaulicht.
Wurde die Lücke zwischen Wissensangebot und Wissensbedarf in befriedigender Weise geschlossen, so bewirken die neu eingebrachten Wissenselemente die Initiierung eines neuen Lebenszyklus, da das zur Problemlösung gebrauchte Wissen bei seiner Anwendung in einen neuen Kontext gesetzt wird. Diese Initiierung ist mit ( gekennzeichnet.
Der nach oben weisende Initiierungsprozeß ( bringt zum Ausdruck, daß jeder neu eingeleitete Lebenszyklusprozeß sich auf einer höheren Wissensebene bewegt, da die Wissensträger- und Informationsressourcen mit neuen Wissenselementen und Wissensverknüpfungen angereichert werden.
Wissen wird zu einem sich selbst produzierenden und selbst aufrechterhaltenden Netzwerk von Strukturen, in das neue Wissenselemente permanent eingebunden werden. Diese Strukturen müssen durch stetiges Durchlaufen des Lebenszyklusmodells kontinuierlich auf den neuesten Stand gebracht werden.(10, 18-24)
Ein wesentliches Element der Wissensinitiierung ist demzufolge die Selbstorganisation.
Für das Ziel, die notwendigen Rahmenbedingungen des selbstorganisierten Lernens zu entschlüsseln, ist es hilfreich, auf die Erfahrungen der lernenden Organisation (als ein Repräsentant der Selbstorganisation) zurückzugreifen.
Im folgenden Abschnitt soll deshalb geklärt werden, unter welchen Rahmenbedingungen sich selbstorganisiertes Lernen im Unternehmen umsetzen läßt.
3.3 Der Rahmen: Die lernende Organisation
Definitionen organisationalen Lernens weisen eine lange Entwicklung und damit auch eine große Bandbreite auf. Die Organisationslehre spricht zum Beispiel von unternehmerischer Anpassungsfähigkeit während die Soziologie vor allem den Prozeß der unternehmensweiten Bildung gemeinsamer Wertvorstellungen und Rahmenbedingungen betont. Gemeinsam ist diesen Definitionsansätzen, daß organisationales Lernen als die Ansammlung und Integration eigener Erfahrungen in die Organisation verstanden wird. Dabei geht die lernende Organisation weit über die informationstechnologische Ebene der Installation eines „Wissensspeichers“ hinaus.
Der stetige Umbau der gesamten Unternehmenskultur in eine "Lernkultur" ist für eine erfolgreiche Umsetzung von entscheidender Bedeutung. Wissensmanagement gliedert sich in diesem Zusammenhang als ein wesentliches Element in die lernende Organisation mit ein, wie nachstehend zu erkennen sein wird.
Nach einer kurzen Klärung des inzwischen weitverbreiteten, oft jedoch nur ungenau definierten Begriffs "organisationales Lernen" soll in diesem Kapitel aufgezeigt werden, wie lernende Organisationen aktiv entwickelt und geführt werden können. Es wird vor allem das erforderliche (Führung-) Verhalten des Topmanagements und das Zusammenwirken der Mitarbeiter untereinander beschrieben.
3.3.1 Organisationales Lernen: Eine Definition
Allgemein gilt, daß jedes Unternehmen durch verschiedene Prozesse wie beispielsweise Anpassung an die Umwelt und eigene Erfahrung lernt. Generell läßt sich dieser Vorgang als das Ansammeln und Integrieren individueller Kenntnisse in eine unternehmensweite Wissensbasis zusammenfassen. Nahezu alle Definitionen der lernenden Organisation stimmen darin überein, daß dieses noch relativ junge Unternehmenskonzept den Aufbau, die Entwicklung und den Austausch von Wissen sowie kontinuierliche Leistungsverbesserungen und das Management des Transformationsprozesses der Unternehmung selbst umschließt.
Übereinstimmend mit dieser Definition beschreibt beispielsweise Booz Allen & Hamilton sein eigenes Lern- bzw. Knowledge-Programm mit den folgenden sechs "C`s":
- Create:
Aufbau und Entwicklung neuen intellektuellen Kapitals durch die Arbeit mit Klienten, Zusammenarbeit unter den Beratern und Allianzen
- Capture:
Identifikation und Dokumentation des gesamten „besten“ Wissens
- Collaborate:
Globales Verteilen und Austausch des im Beratungsunternehmen erarbeiteten und angesammelten Wissens
- Contribute:
Institutionalisieren des besten Wissens, um anderen zu helfen
- Communicate:
Unterstützung aller Mitarbeiter, das kollektive Wissen und dessen beste interne und externe Anwendung zu lernen
- Consume:
Anwendung dieses kollektiven Wissens in allen Tätigkeitsfeldern der Beratung (9, 103-104)
Organisationales Lernen ist somit ein " sichtbares" und beeinflußbares Phänomen. Bleibt der Prozeß unbeachtet, so hat dies zur Konsequenz, daß die Organisation als Einheit weniger weiß als ihre Mitglieder. Wird er dagegen aktiv als Erfolgspotential behandelt, wird durch den Austausch und die Synergien der verschiedensten individuellen Erkenntnisse eine unternehmensweite Wissensbasis aufgebaut, die größer ist als die Summe der Einzelerkenntnisse aller Mitglieder.
3.3.2 Lernende Organisation : Das Konzept
Eine lernende Organisation entsteht - ähnlich einer Unternehmenskultur - nicht zufällig. "Harte" organisatorische, sowie "weiche" unternehmenskulturelle Vernetzungsmechanismen müssen aktiv entwickelt, initiiert und gepflegt werden, um ein kontinuierliches Lernen im Unternehmen zu ermöglichen.
Auf der unternehmenskulturellen Seite ist die Schaffung einheitlicher Führungsgrundsätze und Werte, eine offene wechselseitige und intensive Kommunikation und schließlich die Förderung von (internationaler) Teamarbeit über mehrere Geschäftseinheiten hinweg sicherzustellen. Die Vernetzungsmechanismen spielen im gesamten Lernprozeß, der sich in fünf einander überlappende Phasen differenzieren läßt, eine bedeutende Rolle. Die Phasen des organisationalen Lernens werden in Abbildung 3.5 veranschaulicht.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb.3.5 Die fünf Phasen des organisationalen Lernens (9, 106)
3.3.2.1 Phase 1: Sensibilisierung und Vorbereitung des Unternehmens
In der ersten Lernphase werden die Mitarbeiter für die Bedeutung des organisationalen Lernens sensibilisiert. Der Aufbau einer umfassenden Lernarchitektur wird vorbereitet, wie in Abbildung 3.6 dargestellt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 3.6 Aufbau einer Lernarchitektur (9, 107)
Um die Lernbemühungen einzelner Mitarbeiter oder Teams effektiv zu nutzen und deren Zusammenfassung und Weiterentwicklung zu gesamtunternehmerischen Stärken zu erleichtern, ist es notwendig, im Detail präzisierte Lernziele festzulegen und diese im gesamten Unternehmen zu kommunizieren.
Eine lernende Organisation bedarf einer ausgeprägten „Lernatmosphäre“ in der gesamten Unternehmung. Allen Mitarbeitern muß klar werden, daß ihre individuellen Lernbemühungen, Verbesserungs- und Innovationsvorschläge für das gesamte Unternehmen sehr bedeutend sind. Ihre Lernbemühungen und Vorschläge sollen daher sichtbar geschätzt, unterstützt, weiterverfolgt und auch entsprechend honoriert werden. Die Rolle der Führungskräfte wird sich zunehmend sowohl auf die Bildung menschlicher Netzwerke also auf die Koordinierung und Unterstützung der Lernprozesse und -initiativen konzentrieren. Dabei treten Beauftragung und Kontrolle immer stärker in den Hintergrund.
Werden auch manchmal erst schwerwiegende interne Probleme ausgelöst, so ist es um so nötiger, bei allen Mitarbeitern das Verständnis dafür zu entwickeln, daß es sich hier nicht um einmalige Anstrengungen handelt, die nach einer gewissen Zeitspanne "erledigt" sein werden, sondern um das Kulturelement einer permanenten Lernbereitschaft im Rahmen kontinuierlicher Abläufe.
Ein erfolgreicher Lernprozeß bedarf einer sichtbaren Lernorganisationsstruktur, durch die der Einsatz einzelner Mitarbeiter zu unternehmensweiten Aktivitäten gefördert werden kann. BMW realisierte beispielsweise ein Konzept "spiegelbildlicher" Funktionsgruppen. Sie kommunizieren und arbeiten seitlich nebeneinander mit ihren "spiegelbildlichen" Kollegen zusammen. Dadurch wird funktionsspezifisch auf Gesamtunternehmensebene ein kontinuierlicher und schnellerer Erfahrungsaustausch und somit Lernen auf einem höheren Niveau unterstützt.
Gemeinsam sind den unterschiedlichen Konzepten einer gesonderten Lernorganisationsstruktur der aktive Austausch und die Zusammenarbeit unterschiedlicher Hierarchieebenen und Unternehmensbereiche. Sie bilden sowohl einen Rahmen für eine offene "top-down" als auch eine "bottom-up" Kommunikation.
Durch die Institutionalisierung einer sichtbaren Lernstruktur werden vor allem Wirklichkeit, Nützlichkeit und Wertschätzung der Lernprozesse der Unternehmung "öffentlich" verkündet. Jeder erkennt die Bereitschaft der obersten Führungsebene, die Lernprozesse mit Zeit und finanziellen Mitteln zu unterstützen und sie dabei als elementaren Bestandteil der Gesamtoperation zu betrachten.
3.3.2.2 Phase 2: Aktiver Informationserwerb und -austausch
Auch die lernende Organisation wird neben der Stimulation und Nutzung der unternehmensinternen Lernfähigkeit auf externes Wissen und Wissensquellen zugreifen. Abbildung 3.7 zeigt neben den unternehmensinternen auch die unterschiedlichen externen Lernquellen bzw. -prozesse im Überblick:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 3.7 Interne und externe Lernprozesse (9, 110)
Ein erfolgreich lernendes Unternehmen wird diese Informationsquellen nicht nur einmalig oder sporadisch angehen, sondern darum bemüht sein, dauerhafte partnerschaftliche Verhältnisse zur effektiven Nutzung dieser externen "Stimulanten" aufzubauen.
Kooperatives Lernen erfordert, daß zunächst die Partner das Geschäft und die jeweiligen Kooperationsziele des anderen genau verstehen und den Eindruck haben, beide Parteien bieten Gleichwertiges zum "Austausch" an. Es muß genau festgelegt werden, was die Partnerschaft für die Beteiligten erbringen soll und in welchem Zeitrahmen dies geschehen kann. Insgesamt ist für den Erfolg einer partnerschaftlichen Lernbeziehung ein Gleichgewicht zwischen gegenseitigem Vertrauen der Partner und einer gesunden Wettbewerbsorientierung von großer Bedeutung. Auch eine partnerschaftliche Lernkooperation hat schließlich nur einen wichtigen Grundsatz - Zusammenarbeit - um sich im Wettbewerb zu stärken.
3.3.2.3 Phase 3: Integration, Synthese und Expansion der Wissensbasis
Eine Unternehmung kann nur in dem Maße lernen, wie die Erkenntnisse, die auf individueller Ebene erworben wurden, in die Wissensbasis der gesamten Unternehmung eingebracht, "übersetzt" bzw. in die firmeneigene Sprache kodiert und integriert werden. Auf diese Weise wird individuelles Wissen übertragbar und allen Unternehmensmitgliedern zugänglich. Für den Lernerfolg ist es entscheidend, daß die unternehmensweit verfaßten Dokumente einen aktiven Kommunikationsaustausch ermöglichen.
In dem Ansatz Wissen systemtechnisch zu vernetzen wird die Überschneidung des Konzeptes der lernenden Organisation mit dem des Wissensmanagements deutlich erkennbar.
3.3.2.4 Phase 4: Effektiver Wissenstransfer und Kommunikation
In der vierten Lernphase wird sichergestellt, daß die neu erworben und nun in die firmenweite Wissensbasis integrierten Kenntnisse allen Mitgliedern der Organisation bekannt und verfügbar sind. Dazu bedarf es einer umfassenden, kontinuierlichen Kommunikation über die Inhalte, Vorteile und den Zugang zu der immer wieder aktualisierten Wissensbasis. Dies kann durch die unterschiedlichsten Maßnahmen erreicht werden. Die Einführungskommunikation für ein unternehmensweites Knowledge-System wird in der Regel mit detaillierten Präsentationen und intensiven Trainingsprogrammen über alle Hierarchieebenen, Funktions- und Geschäftsbereiche hinweg beginnen. Spätere Ergänzungen und Aktualisierungen lassen sich durch weniger aufwendige Maßnahmen, etwa durch das Verteilen von Dokumentationen oder über E-mail kommunizieren.
3.3.2.5 Phase 5: Implementierung und Verbesserung der Wissensbasis
Die fünfte und letzte Lernphase umfaßt schließlich die erfolgreiche Implementierung und Anwendung der ständig neu gewonnenen Erkenntnisse. Der Erfolg in dieser Phase und somit des gesamten unternehmensweiten Lernprozesses hängt davon ab, inwiefern es in den vorherigen Lernphasen gelungen ist, die Wissensbasis mit den Erkenntnissen aller Mitarbeiter zu erweitern und die Akzeptanz bzw. die Identifikation mit den Inhalten bei allen Organisationsmitgliedern zu erreichen. Dies erfordert vor allem die sichtbare Beteiligung und Unterstützung durch die Führungskräfte, denen die Bildung menschlicher Netzwerke obliegt.
Das Management muß die neuen Werte der Kooperation, Zusammenarbeit und des gegenseitigen Austausches innerhalb und außerhalb der eigenen Organisation vorleben und entsprechend durch neue, innovative Anreize der Belohnung, Anerkennung und Beförderung unter allen Mitarbeitern fördern.
[...]
- Arbeit zitieren
- Atila Uruc (Autor:in), 1998, Wissensmanagement in der Consultingbranche. Ein Konzeptentwurf zur Installation von Knowledge Management Systemen bei Beratungsunternehmen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/29956
Kostenlos Autor werden






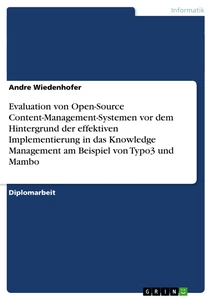

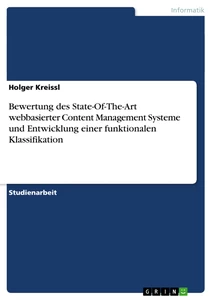

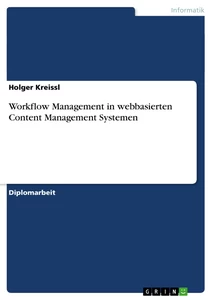

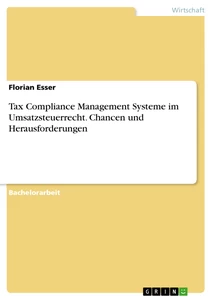




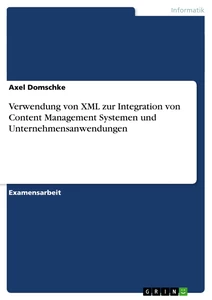

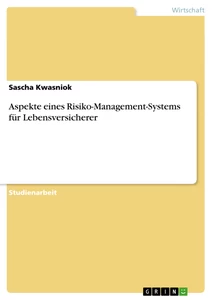
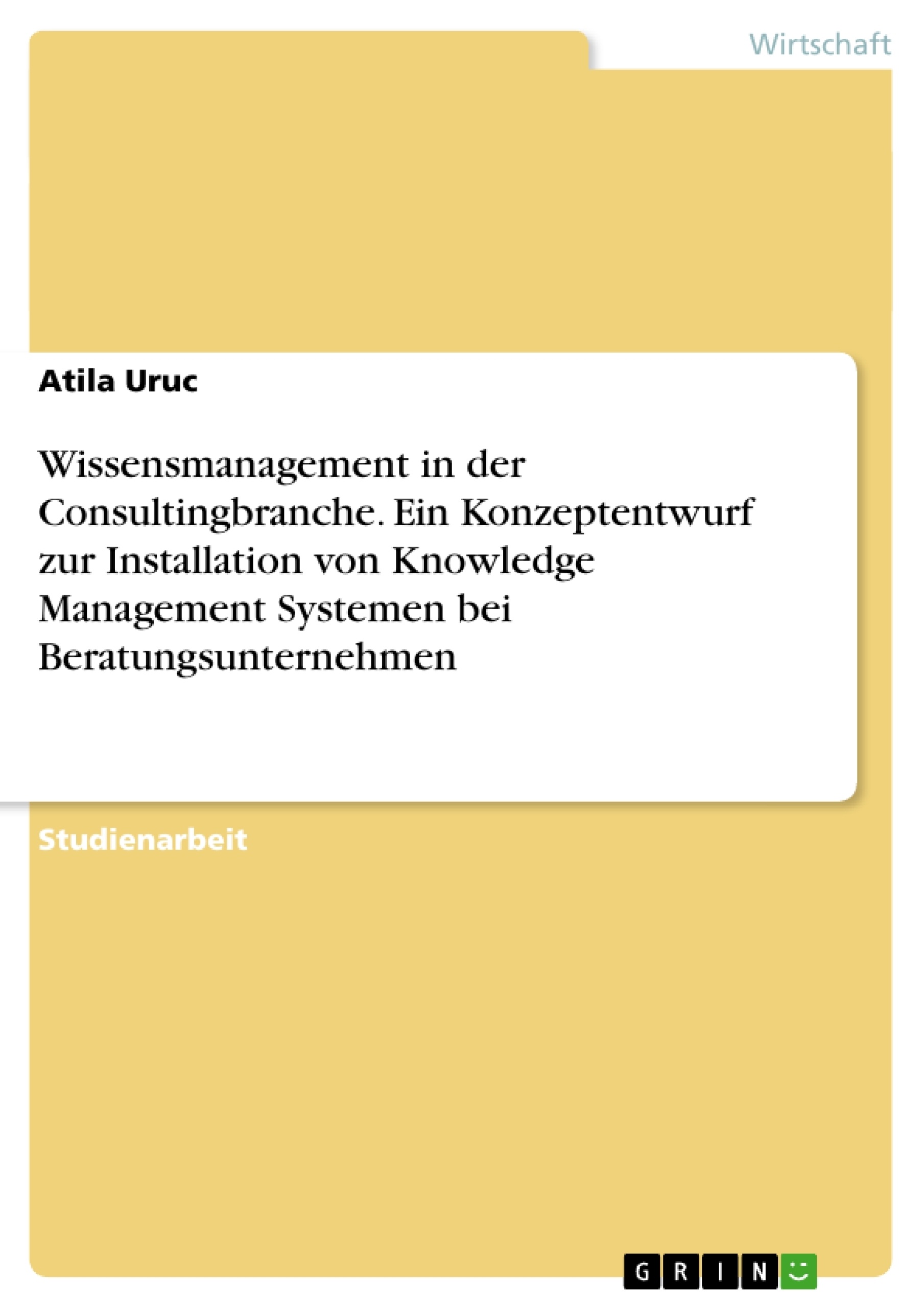

Kommentare