Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1. Die Bindungstheorie und die Bindungsforschung
1.1. Definition Bindung
1.2. Das Bindungs- und das Explorationssystem
1.3. Das Konzept der Feinfühligkeit und Bindungsqualität
1.4. Phasen der Entwicklung einer Bindung
1.5. Innere Arbeitsmodelle und die Bindungsrepräsentation
1.6. Bindungstypen
1.6.1. Bindungstypen im Kleinkindalter
1.6.2 Bindungstypen im Jugendalter
1.7. Intergenerationale Weitergabe
1.8. Relevante Grundannahmen der Bindungstheorie im Überblick
2. Heimerziehung
2.1. Kürzliche Entwicklungen in der Heimerziehung – Ein Überblick
2.2. Rechtliche Grundlagen
3. Die Bindungsrepräsentation von Jugendlichen in Heimerziehung
4. Der Praxisalltag in der Heimerziehung – bindungshemmende Strukturen und typische Problematiken
5. Eine Einzelfallstudie aus der Praxis
5.1. Methodische Vorüberlegungen
5.2. Methodisches Vorgehen
5.2.1. Allgemeine Daten zur Form und zum Selbstverständnis der hier beschriebenen Jugendwohngruppe
5.2.2. Zusammenfassende Personenbeschreibung der Befragten und ihres Lebensverlaufs auf Grundlage des Interviews
5.3. Auswertung des Interviews
5.3.1. Zusammenfassung der Auswertung des Interviews
6. Zusammenhänge zwischen der Bindungsforschung und dem Praxisalltag in der Heimerziehung
Literaturverzeichnis
Anhang
Einleitung
Obwohl die Bindungstheorie, welche sich mit den psychischen Auswirkungen früher Beziehungserfahrungen auf die Persönlichkeitsentwicklung des Individuums auseinandersetzt, ihre wissenschaftlichen Wurzeln im Heimerziehungskontext begründet hat, ist bisher eine angemessene Einbeziehung der Erkenntnisse aus der Bindungsforschung in die Heimpädagogik großteils ausgeblieben. Gerade in Bezug auf die Problematik der Bindungspräsentation bei Kindern und Jugendlichen die in Heimen leben, erscheint die Bindungstheorie jedoch viele geeignete Ansätze zu bieten, dieser durch Verständnis, Wissen und damit einhergehenden Handlungsmöglichkeiten entgegen wirken zu können. In der vorliegenden Ausarbeitung werden zunächst die historischen Hintergründe und Grundannahmen der Bindungstheorie beschrieben, sowie der heutige Erkenntnisstand der Bindungsforschung vorgestellt. Im Anschluss daran werden die für die Heimerziehung in Deutschland relevanten Reformen der letzten Jahrzehnte betrachtet, welche durch programmatische Begriffe wie Entinstitutionalisierung, Professionalisierung, Individualisierung und Lebensweltorientierung geprägt sind. Unter dem Titel „Bindungsrepräsentation in Heimerziehung“ wird eine Studie vorgestellt, welche sich mit der namensgebenden Thematik befasste und dabei zu eindeutigen Ergebnissen kam. In: „Der Praxisalltag in der Heimerziehung – Typische Problematiken und bindungshemmende Strukturen“, wird der gewöhnliche Alltag zeitgemäßer Einrichtungen der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe auf den Prüfstand gestellt. Untersucht werden sie hinsichtlich gegebenen Strukturen, welche die Entwicklung von Bindung nach den Erkenntnissen der Bindungsforschung negativ beeinflussen können, sowie damit einhergehende Problematiken für die Gestaltung der Beziehung zu den Kindern und Jugendlichen. Abschließend wird eine von mir durchgeführte Einzelfallstudie vorgestellt. Durch diese wird versucht, die zuvor beschriebenen Zusammenhänge zwischen den vorgestellten Theorien und Erkenntnissen mit dem Praxisalltag in der Heimerziehung zu erkennen, sowie ihre Bedeutung und Relevanz im tatsächlichen Kontext zu bewerten. Die Besonderheit liegt dabei auf dem Perspektivenwechsel, welcher durch die Befragung einer betroffenen Jugendlichen vollzogen wird. Dieser soll dazu führen, sinnvolle Thesen für die Anwendung der Erkenntnisse aus der Bindungsforschung in die Praxis ableiten zu können. Darüber hinaus ist es ein besonderes Anliegen, dabei der Zuordnung der Relevanz seitens der Betroffenen gerecht zu werden.
1. Die Bindungstheorie und die Bindungsforschung
Im weitesten Sinne kann man die ersten bindungstheoretischen Überlegungen bis in das 18te Jahrhundert zurückverfolgen. In diesem verschriftlichte Karl Phillipp Moritz[1] den ersten psychologischen Roman, sowie die erste psychologische Zeitschrift in der Weltgeschichte. In seinen Werken erfand er das „Konzept der Selbstaufklärung durch Erinnerung“, dabei versuchte er mit Hilfe von Reflexionen, Erklärungen für den Verlauf seines Lebens zu finden. Solche Ansätze und Gedanken lassen sich wissenschaftlich-empirisch fundiert erst im Verlauf der Entwicklung der Bindungstheorie im 20ten Jahrhundert wiederfinden. Anfang der 1940er Jahre veröffentlichte der englische Kinderarzt, -psychiater, und Psychoanalytiker John Bowlby[2] einen Artikel im „International Journal of Psycho-Analysis“. In diesem thematisierte er erstmals die nachteiligen Auswirkungen von frühen Eltern-Kind-Trennungen (z.B. durch Krankenhausaufenthalte). In den folgenden Jahren entwickelte John Bowlby seinen Ansatz weiter und formulierte diesen als „Bindungstheorie“ aus. Entscheidend ergänzt wurde die Theorie durch die Arbeiten Mary Ainsworth[3], welche die frühen Einflüsse auf die emotionale Entwicklung untersuchte und versuchte, die Entstehung und Veränderung von Bindungen während des gesamten Verlauf des Lebens zu erklären.[4] Erweitert wurde das Klassifizierungssystem über das Bindungsverhalten von Mary Main[5] Mitte der 1980er Jahre. Heute hat sich die Bindungstheorie innerhalb der Psychologie etabliert, gilt als eine der am besten fundierten Theorien über die psychische Entwicklung des Menschen und wird stetig durch neue Studien und Erkenntnisse aus der Bindungsforschung weiterentwickelt. Dabei gelten vor allem die Erscheinungsformen von Bindungsqualitäten, die Bindungsrepräsentation in Kindheit und Erwachsenenalter, sowie die Wechselbeziehung zwischen Bindungsverhalten und Bindungsrepräsentation im Verlauf der Entwicklung als das zentrale Interesse in der Forschung. Des Weiteren geht es um das Verknüpfen von Zusammenhängen zwischen der Bindungsrepräsentation, dem Bindungsverhalten und der psychologischen Adaptabilität, sowie dessen statistischen Überprüfung.
1.1. Definition Bindung
„Bindung ist die besondere Beziehung eines Kindes zu seinen Eltern oder Personen, die es beständig betreuen. Sie ist in den Emotionen verankert und verbindet das Individuum mit anderen, besonderen Personen über Raum und Zeit hinweg.“[6] Als Bindung bezeichnet man folglich die enge emotionale Beziehung, welche sich in den ersten Lebensmonaten zwischen dem Kind und einer ausgewählten Bindungsperson etabliert. Die Bindungsperson ist dabei die ältere beziehungsweise erwachsene Person, welche in dieser Zeit den intensivsten Kontakt zu dem Kind pflegt. Dabei wird die „Bindung“ als ein Teil des komplexen Systems der „Beziehung“ angesehen. Die von John Bowlby formulierte Bindungstheorie verbindet ethologisches, entwicklungspsychologisches, systemisches und psychoanalytisches Wissen und Denken. “In ihren Annahmen befasst sie sich mit den grundlegenden frühen Einflüssen auf die emotionale Entwicklung des Kindes und versucht, die Entstehung und Veränderung von starken gefühlsmäßigen Bindungen zwischen Individuen im gesamten menschlichen Lebenslauf zu klären.“[7]
1.2. Das Bindungs- und das Explorationssystem
Das Bindungssystem stellt nach J. Bowlby ein relativ eigenständiges, genetisch verankertes Motivationssystem dar, in welchem die Bindung als Primärbedürfnis gilt. Aus biologischer Sicht spielt dabei die Ausschüttung der Hormone Oxytocin und Endorphin, sowohl bei der Mutter als auch dem Säugling, eine wesentliche Rolle. Es beeinflusst die Bindungsentwicklung, in dem es die Gefühle nach Nähe zueinander, sowie durch Befriedigung dieses Bedürfnisses verspürte Entspannung und Vertrautheit, fördert. Das angeborene Bindungsverhalten ist genetisch vorgeprägt und bei allen gemeinschaftlich lebenden Säugetieren, deren soziale Bindungen die Grundlage ihrer Sozialstrukturen darstellen, entsprechend auch bei dem Menschen, festzustellen. Das konkrete Bindungsverhalten wird vor allem dann aktiviert, wenn der Säugling den Wunsch nach Nähe, Angst oder Stress verspürt. Die Nähe, welche durch Blick- und Körperkontakt zur Bindungsperson sowohl gesucht als auch gewährleistet wird, soll ihm dabei Sicherheit, Schutz und Geborgenheit vermitteln. Das Kind ist in dieser Beziehung ein aktiver Interaktionspartner, welcher in der Lage ist zu signalisieren, wann er das Bedürfnis nach Nähe und dessen Befriedigung verspürt. Darüber hinaus besteht eine wechselseitige Abhängigkeit zwischen dem genetisch verankertem, motivalen Bindungssystem und dem biologischem Verhaltenssystem, dem Explorationssystem. Das Explorationsverhalten des Kindes ist maßgebend für die Erforschung seiner Umwelt, wobei es sich im Idealfall zunehmend als selbsteffektiv und handelnd erproben und erfahren kann. „Während das Bedürfnis nach Nähe und Schutz das Bindungsverhaltenssystem steuert und Neugier das Explorationsverhaltenssystem, betrifft die emotionale Sicherheit beide Systeme: den Zugang zur Bindungsperson bei psychischer Verunsicherung und den Rückhalt durch die Bindungsperson beim Explorieren. […] Beides zusammen gehört zum gesamten Spektrum der psychischen Sicherheit, die aus der Bindungssicherheit entwächst.“[8] Nur wenn das Kind sich sicher fühlt und seine Bindungsperson als Basis nutzen kann, ist es in der Lage seine Umgebung ohne Angst zu explorieren.
1.3. Das Konzept der Feinfühligkeit und Bindungsqualität
Der Säugling ist biologisch so vorprogrammiert, dass er auf die Versorgung durch einen Erwachsenen angewiesen ist, um am Leben erhalten zu werden. Da er dabei durchaus in der Lage ist seine Bedürfnisse zu signalisieren (z.B. durch Anlächeln, Weinen, Festklammern) liegt es an dem Erwachsenen, diese wahrzunehmen, richtig zu deuten und schließlich angemessen zu befriedigen. Umso „feinfühliger“ die Bedürfnisse in ihrer Art und Weise befriedigt werden, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich eine sichere Bindung zwischen dem Kind und der Bindungsperson bildet. Werden die Bedürfnisse hingegen „gar nicht, nur unzureichend oder inkonsistent […] beantwortet, entwickelt sich häufiger eine unsichere Bindung“[9].
1.4. Phasen der Entwicklung einer Bindung
Nach Mary Ainsworth verläuft die Entwicklung einer Bindung typischerweise in vier Phasen. Die erste Phase, auch „Phase der unspezifischen sozialen Reaktionen“ genannt, ist dadurch gekennzeichnet, dass sich die sozialen Reaktionen des Kindes (Ansehen, Umklammern, Weinen etc.) noch nicht spezifisch an eine Person richten. Diese Phase umfasst in etwa die ersten zwei Lebensmonate eines Kindes.
In der zweiten Phase, auch „Phase der unterschiedlichen sozialen Reaktionsbereitschaft“ oder „zielorientierte Phase“ genannt, ist es kennzeichnend, dass die sozialen Reaktionen des Kindes nun bevorzugt an die primäre Bindungsperson gerichtet werden. Darüber hinaus reagiert das Kind auch selbst schneller auf die Äußerungen und Verhaltensweisen der ihm vertrauten Personen. Diese Phase hält in etwa bis zum sechsten Lebensmonat des Kindes an.
Die dritte Phase, oder auch „Phase des aktiven und initiierten zielkorrigierten Bindungsverhaltens“ löst die zweite Phase ab und dauert in etwa bis zum Erreichen des dritten Lebensjahres an. Sie ist durch die zunehmende Mobilität und Vokalisation des Kindes (robben, krabbeln, laufen, sprechen) geprägt, welche es ihm ermöglicht, die Nähe zur Bindungsperson nun aktiver und selbstständiger zu bestimmten, sowie sich differenzierter mitzuteilen. Zudem erlernt es zunehmend die Verhaltensreaktionen seiner Bindungspersonen einzuschätzen. Die vierte Phase oder auch „Phase der zielkorrigierenden Partnerschaft“, beginnt mit der Fähigkeit des Kindes, die Sprache zu verstehen und zu nutzen. Mit diesem wachsendem Verständnis ist es dem Kind nun möglich, Ziele und Absichten Dritter nachvollziehen zu können, eigene Wünsche und Bedürfnisse auszuformulieren und argumentativ zu belegen, sowie in Folge dessen auch Interessenskonflikte aushandeln zu können.[10]
1.5. Innere Arbeitsmodelle und die Bindungsrepräsentation
Auf Grundlage der Erfahrungen, welche das Kind aus der Kommunikation und Interaktion mit der Bezugsperson in seinen ersten Lebensjahren sammelt, bilden sich allmählich sogenannte „innere Arbeitsmodelle“ aus. Diese umfassen dabei sowohl das Verhalten und die damit einhergehende Affekte des Kindes selbst, als auch die seiner Bindungspersonen. Mit ihrer Hilfe versucht das Kind, sich eine Vorhersehbarkeit der Interaktionen herzustellen. Im Verlauf der Entwicklung des Kindes verfestigen sich die inneren Arbeitsmodelle bis zum Erreichen der Adoleszenz zunehmend, während die Möglichkeit der Modifizierung immer geringer wird. In der Bindungsforschung wird dies auch als „Stabilisierung der Bindungsrepräsentation“ bezeichnet. Je gelungener die Entwicklung einer sicheren und stabilen Bindungsrepräsentation verläuft, umso wahrscheinlicher ist es auch, dass sie „Teil der psychischen Struktur wird und damit auch zur psychischen Stabilität beiträgt.“[11]
1.6. Bindungstypen
In der Bindungsforschung wurden diverse „Typen der Bindung“ definiert und unterteilt. Dabei erfolgt eine Trennung der Bindungstypen nach Alter.
1.6.1. Bindungstypen im Kleinkindalter
Mit Hilfe des von Mary Ainsworth entwickelten Verfahrens der „Fremden Situation“ wurde erstmals versucht, die Bindungsmuster von Kleinkindern zwischen dem 12. und dem 19. Lebensmonat zu untersuchen und zu kategorisieren. Ziel dieser Methode ist es, durch eine festgelegte Abfolge von Trennungs- und Wiederkehrungssituationen, das Bindungssystem des Kindes zu aktivieren und dadurch eine Beobachtung des Verhaltens zwischen der Bindungsperson und dem Kind zu ermöglichen, sodass eine zuverlässige Auswertung der kindlichen Bindungsqualität erfolgen kann. Mittlerweile wurde die „Fremden Situation“ „weltweit in verschiedensten Gesellschaftsformen angewandt und hat sich als valides und reliables Instrument erwiesen“[12]. Mary Ainsworth kam zu dem Ergebnis, dass es drei unterschiedliche Bindungstypen (Typ A – unsicher vermeidend; Typ B – sicher; Typ C - unsicher-ambivalent) gibt. Erweitert wurde das Klassifizierungssystem über das Bindungsverhalten von Mary Main[13]. Zu dieser Erweiterung kam es, da es bei der Beobachtung und Klassifizierung in den Längsschnittstudien des Öfteren nicht möglich war, eine eindeutige Zuordnung in die bestehenden Bindungstypen vorzunehmen. Dabei fasste sie alle Phänomene, welche Schwierigkeiten bei der Klassifizierung bereiteten, unter dem Typ D - desorganisiert“ zusammen.[14]
Kinder, welche nach Mary Ainsworth dem „Typ A – unsicher vermeidend“ angehören, zeigten während den Trennungssituationen kein deutliches Bindungsverhalten. Als Reaktion auf die Trennung weinten und protestierten sie kaum bis gar nicht. Viel mehr setzten sie ihre Tätigkeiten fort, auch wenn sie das Verschwinden der Mutter bewusst wahrnahmen. Bei der Rückkehr der Mutter reagierten sie eher mit Ablehnung, sie suchten ihre Nähe nicht auf, teilweise mieden sie diese sogar. Zu einem intensivem Körperkontakt kam es in der Regel nicht. Kinder, die dem „Typ B – sicher“ zugeordnet wurden, zeigten hingegen ein deutliches Bindungsverhalten nach den Trennungssituationen. Sie protestierten, in dem sie weinten oder der Mutter nachliefen, wenn diese den Raum verließ. Bei ihrer Rückkehr zeigten sie eindeutige Zeichen der Freude, suchten gezielt ihre Nähe und wollten von ihr getröstet werden. Hatten sie diese ausreichend erhalten, widmeten sie sich relativ schnell wieder ihrem Spiel zu und explorierten ihre Umgebung.
Kinder, die „dem Typ C – unsicher-ambivalent“ zugeordnet wurden, unterscheiden sich von den beiden anderen Typen darin, dass sie unangepasstes Verhalten aufzeigten. „Kennzeichnend ist das ausgeprägte, widersprüchliche, übertriebene und dramatisch wirkende Bindungsverhalten, das mit Ärger vermischt ist.“[15] Selbst in der Gegenwart der Bindungsperson hatten diese Kinder Schwierigkeiten, sich von ihr zu lösen und ihre Umgebung zu explorieren. Es scheint, als würde alles ihr Bindungssystem aktivieren. Nach der Trennung von der Bindungsperson protestieren und weinen die Kinder stark. Der starke Protest ist jedoch weniger ein Zeichen von besonders starker Bindung, als viel mehr von ständiger Angst davor, die Bindungsperson zu verlieren.[16] Auch bei Rückkehr der Mutter lassen sie sich kaum beruhigen und benötigen relativ viel Zeit, bis sie sich wieder etwas anderem zuwenden können. Zudem ist ihre Suche nach Nähe zur Bindungsperson von ambivalentem Verhalten geprägt. „Wenn sie von ihren Müttern auf den Arm genommen werden, drücken sie einerseits den Wunsch nach Körperkontakt und Nähe aus, während sie sich andererseits gleichzeitig aggressiv gegenüber der Mutter verhalten (Strampeln mit den Beinen, Schlagen, Stoßen oder Sichabwenden).“[17] Kinder, die dem „Typ D – desorganisiert“ zugeordnet werden, zeigten vor allem bei der Rückkehr der Mutter widersprüchliche Verhaltensweisen. So brachen sie zum Beispiel die Suche nach Nähe mitten im Prozess ab, zeigten stereotype Verhaltensmuster oder erstarrten mitten in Bewegungen. Obwohl das Bindungssystem während der Trennung von der Mutter aktiviert wurde, konnten die Kinder auf keine ausreichende Verhaltensstrategie zurückgreifen, um die Situation zu bewältigen. Dies zeigt sich zum Beispiel, wenn das Kind viel Vermeidung der Bindungsperson während ihrer Verfügbarkeit, gleichzeitig aber auch einen starken Protest bei der Trennung von dieser aufzeigt. Die Ursachen für ein desorganisiertes Bindungsverhalten sind vielseitig. Sie können sowohl genetisch, biologisch als auch sozialisations bedingt sein. Der „Typ D – desorganisiert“ kann parallel zu den drei anderen Bindungstypen zugeordnet werden. Dabei wird die Bindungsdesorganisation als bindungsunsicher charakterisiert.
1.6.2 Bindungstypen im Jugendalter
In dem Jahr 1985 entwickelten George Kaplan und Mary Main das „Adult Attachment Interview“ (AAI), welches sprachlich die Einstellungen von Erwachsenen zu Bindungen erfasst und zu Weilen als Standardmethode in der empirischen Bindungsforschung verwendet wird. Die Fragen des halbstrukturierten Interviews beziehen sich dabei auf frühe Erfahrungen mit den Eltern, unter besonderer Berücksichtigung von bindungsrelevanten Situationen und den durch sie hervorgerufenen Emotionen. Diese Methode, welche ab dem Jugendalter angewandt werden kann, erlaubt eine Einteilung in Bindungstypen durch speziell für die Auswertung des AAI geschultes Personal. Dabei geht es weniger um die Auswertung des inhaltlichen Aspekts des Interviews, als viel mehr darum, ob die getroffenen Aussagen in sich schlüssig sind, die Antworten in einem nachvollziehbarem Kontext zu den Fragen stehen und ob der Befragte im Redefluss eine narrative Kohärenz aufweist. Vor Allem geht es auch um „die Art und Weise, wie die Kindheitserlebnisse mit den Eltern und die Einschätzung der Bedeutung dieser Erlebnisse für das gegenwärtige Leben geäußert werden.“[18] Zudem wird vermehrt darauf geachtet, dass die Erzählungen durch Beispiele belegt werden können oder ob es sich eher um oberflächliche Ausschweifungen handelt, welche nicht konkretisiert werden. Ist die Erzählstruktur des Befragten als gut und kohärent zu bewerten, so weist dies darauf hin, dass bindungsrelevante Erinnerungen gut integriert wurden und mit einer gewissen Distanz über diese Erinnerungen nachgedacht und gesprochen werden kann. Die für Jugendliche und Erwachsene herausgebildeten Bindungstypen lassen sich in sicher-autonom (F), unsicher-distanziert (Ds), unsicher-verstrickt (E), unsicher-unverarbeitet (U) und nicht klassifizierbar (CC) unterteilen, was der Kategorisierung des Bindungsmusters bei Kleinkinder nicht unwesentlich ähnelt. Dies veranschaulicht die folgende Tabelle:[19]
Bei sicher-autonom (F) eingestuften Jugendlichen und Erwachsenen wird der Bindungsrepräsentation ein hoher Wert, den Bindungspersonen eine große Bedeutung zugemessen. Die Aussagen in der Interviewsituation sind für Dritte nachvollziehbar, sowie geäußerte Gefühle glaubhaft. Es scheint, als sei es der interviewten Person mit im Laufe der Zeit gelungen, „mit einer gewissen Distanz auf ihre bindungsrelevanten Kindheitserlebnisse zu schauen. Ihre Antworten lassen erkennen, dass sie in der Lage sind, ihre Bindungserfahrungen mit der jeweiligen Situation, den eigenen Gefühlen und mit dem eigenen Verhalten in Verbindung zu bringen.“[20] Es gelingt ihnen kurz gesagt, eine der Entwicklung angemessene Befriedigung von Sicherheits- und Autonomiebedürfnissen.
Eine unsicher-distanzierte (Ds) Bindungsrepräsentation wird dann als solche eingestuft, wenn die vom Befragten gegebenen, meist knappen Antworten „entweder eine Tendenz zu einer emotional eher unbeteiligten Abwertung oder aber zu einer nicht überzeugenden Idealisierung widerspiegeln“[21], welche sich nur unzureichend belegen und nachvollziehen lassen. Diese nicht kohärent erscheinende Redestruktur, sowie die zudem auffallende Vermeidung von emotionalen Themen und der teilweise erschwerte Zugang zu Erinnerungen lässt vermuten, dass unsicher-gebundene Personen einen beeinträchtigten Zugang zu ihren Gefühlen haben. Wichtige Bindungspersonen, zumeist die Eltern, werden insgesamt als wenig verfügbar und offen, oder gar als verdeckt zurückweisend beschrieben.
Bei unsicher-verstrickten (E) Bindungsrepräsentationen lassen die gegebenen, eher ausschweifend gehaltenen Antworten vermuten, dass es sich aktuell noch um eine konfliktreiche Beziehung zu ihren Bindungspersonen handelt. Geäußerte Gefühle bezüglich ihren Bindungspersonen sind nicht selten widersprüchlich und von Wut und Ängstlichkeit geprägt. Insgesamt wird eine eher mangelhafte Autonomie deutlich, welche sich vor Allem in der übermäßigen Orientierung an Beziehungen, sowie dem äußern von kindlichen und anmutenden Versorgungswünschen widerspiegelt. Eine angemessene Distanz zu, sowie Integration des Erlebten scheint noch nicht erfolgt zu sein.
Die Zuordnung zu der Bindungskategorie unsicher-unverarbeitet (U) wird „mithin schon dann vorgenommen, wenn sich Hinweise für eine inkohärente Darstellung einer traumatischen Situation finden, auch wenn bei der Erörterung anderer Themen die Erzählweise durchaus kohärent erscheint.“[22] Charakteristisch ist hier das vorliegen eines unverarbeiteten Traumas, welches die Beziehung zur Bindungsperson nachhaltig beeinflusst und erschwert hat. Exemplarisch seien hier Kindesmisshandlung oder auch Kindesmissbrauch angeführt. In der Interviewsituation selbst fallen vor Allem verwirrende Äußerungen auf, die nicht selten unvereinbar mit der Realität erscheinen. Beispielhaft sei hier die „Auferstehung“ einer bereits für tot erklärten Person, in einer zeitlich später stattfindenden Erzählung genannt.
Lassen sich im Interview Hinweise auf ganz unterschiedliche Bindungsrepräsentationsanteile finden, so lässt dies die Annahme zu, dass es der befragten Person bisher noch nicht gelungen ist, eine einheitliche und organisierte Bindungsrepräsentation zu entwickeln. Hier wird eine Zuordnung in die noch recht junge Kategorie nicht klassifizierbar (CC) vorgenommen.
1.7. Intergenerationale Weitergabe
Die Wahrscheinlichkeit, dass Eltern die Qualität ihrer eigenen Bindungserfahrungen an ihre Kinder weitergeben, ist recht hoch. Dies kann mit unter dadurch erklärt werden, dass ihr Erziehungsverhalten durch die Repräsentation ihrer eigenen Bindungserfahrungen grundlegend beeinflusst wird. Es gilt dabei jedoch zu beachten, dass zwischen der Bindungsrepräsentation der Bezugspersonen und dem Bindungstyp der Kinder kein Kausalzusammenhang vorliegt. Dies bedeutet anders ausgedrückt, dass die Wahrscheinlichkeit einer Übertragung der Bindungsrepräsentation von einer Generation in die nächste zwar sehr hoch ist, sie aber kein Muss darstellt. So ist es mitunter möglich, bereits gemachte, negative Bindungserfahrungen durch spätere, positivere Erfahrungen auf- und verarbeiten zu können.
1.8. Relevante Grundannahmen der Bindungstheorie im Überblick
Abschließend zu den theoretischen Grundlagen der Bindungstheorie wird nochmals auf die für die Heimerziehung von besonderer Bedeutung erscheinende Aspekte eingegangen. Die mittlerweile in der Psychologie zu den am meist empirisch belegten und fundierten Theorien gehörende „Bindungstheorie“ konnte nachweisen, dass es einen bedeutenden Zusammenhang zwischen einer sicheren Bindung und den kognitiven Leistungen eines Menschen gibt. Das durch eine sichere Bindung geförderte Explorationsverhalten des Kindes ermöglicht es diesem, seine Umwelt neugierig zu erkunden und zu erforschen. Sicher gebundene Kinder erhalten dabei eine positive und bestärkende Rückmeldung ihrer Eltern. Dadurch erhalten diese Kinder die Möglichkeit, Erfolge in ihrem Alltag zu erzielen und diese zudem auf ihre eigenen Fähigkeiten zurückführen zu können. Dies begünstigt das Entwickeln eines positiven Selbstbilds maßgebend. Ausgehend von diesem positiven Selbstbild fällt es sicher gebundenen Kindern zudem einfacher, mit Frustrationen und Fehlschlägen umzugehen. Kinder, die ein eher negatives Selbstbild entwickelt haben hingegen fühlen sich durch Frustrationserfahrungen in ihrem Selbstbild bestätigt und werten erzielte Erfolge in ihrem Leben ab. Auch das Konzept der Selbstwirksamkeit ist hier beteiligt. Reagieren Bindungspersonen feinfühlig auf ihre Kinder, so erlernen diese, dass sie selbst als handelnde Personen eine Wirkung auf ihre Umwelt haben und diese auch bewusst erzielen können. Ebenso ermöglicht eine sichere Bindung eine gelungene Entwicklung der sogenannten „Theory of Mind“. Diese beschäftigt sich mit der Annahme, dass sicher gebundene Kinder, welche beständig die Erfahrung sammeln konnten, dass ihre Bindungspersonen versuchten sie zu verstehen und nachvollziehen zu können, diese Einstellung auch für sich selbst übernehmen. Folglich erlernen sie es schneller, Absichten und Handlungen anderer Personen einschätzen und vorhersehen zu können. Dies bildet die Voraussetzung, Empathie entwickeln und somit sozial Agieren zu können. Es kann dem entsprechend davon ausgegangen werden, dass sicher gebundene Kinder über ein höheres Maß an Fähigkeiten verfügen, welches es ihnen ermöglicht stabilere und harmonischere Beziehungen zu anderen Menschen eingehen zu können, als dies bei unsicher gebundenen Kindern der Fall ist. Eine der, vor dem Kontext dieser Ausarbeitung betrachtet, wichtigsten und nicht selten wenig beachteten Erkenntnisse aus der Bindungsforschung, bildet die Annahme, dass Bindungserfahrungen und damit einhergehende Bindungsrepräsentation korrigiert werden können. Voraussetzung hierfür ist es, die Chance zu erhalten und zu nutzen, die eigenen unglücklichen Bindungserfahrungen so verarbeiten zu können, dass sie sich in die Lebensgeschichte integrieren lassen. „So kann die Partnerschaft mit einem Menschen, für den die Wichtigkeit von Bindung außer Frage steht, eine solche Chance eröffnen, ist es doch nun möglich, mit einem Menschen, der als Bindungsperson akzeptiert wird, über die eigenen Erfahrungen zu reden […].“[23] Doch nicht nur eine Partnerschaft im Sinne einer Liebesbeziehung kann sich dieser Chance bedienen. Eine nachweisbar wirksame Hilfe leistet hier bereits seit längerem die Psychotherapie. Inwiefern sich dieses Wissen auch im Praxisalltag der Heimerziehung verwenden lassen kann, soll im weiteren Verlauf der vorliegenden Ausarbeitung erörtert werden.
2. Heimerziehung
Will man Zusammenhänge zwischen den Erkenntnissen der Bindungsforschung und dem Praxisalltag der Heimerziehung evaluieren, so ist es neben dem Wissen über bindungstheoretische Grundlagen zudem von Nöten, über die hier verwendete Auffassung der Heimerziehung als gemeinsame Grundlage zu verfügen. Dabei ist die Geschichte der Heimerziehung in Deutschland lang und lässt sich über mehrere Jahrhunderte hinweg zurückverfolgen. In diesen war und ist das in der Gesellschaft vertretene Bild von Heimen stets recht negativ behaftet gewesen. Eine nicht selten präsente Veranschaulichung dessen lässt sich zum Beispiel in der Androhung der Heimunterbringung bei Fehlverhalten im familiären Kontext wiederfinden. Per Definition handelt es sich bei der Unterbringung im Heim um eine institutionelle Form der Fremdenunterbringung von Kindern und Jugendlichen. „Sie bietet einen kurz- oder langfristigen Lebensort in unterschiedlichen Formen: in Heimen oder anderen betreuten Wohnformen wie familienähnlichen Betreuungsangeboten, Wohngemeinschaften, Jugendwohnungen, aber auch Formen des betreuten Einzelwohnens wie der mobilen oder flexiblen Betreuung.“[24]
In den folgenden Unterpunkten wird es um die Entwicklungen der Heimerziehung in den letzten Jahrzehnten, sowie über die heute rechtlichen Grundlagen der Heimunterbringung gehen.
2.1. Kürzliche Entwicklungen in der Heimerziehung – Ein Überblick
Als nach wie vor bedeutend für den heutigen Praxisalltag in Deutschland kann man sich, wenn man die historischen Hintergründe der letzten Jahrzehnte betrachten möchte, auf die stattgefundenen Reformwellen der Erziehungshilfen in den 1970er und 1980er Jahren konzentrieren. Einen bedeutenden Anstoß zum Erkennen eines Reformbedarfs lieferten damals die verschriftlichten Feldbeobachtungen Ervin Goffmans[25], welche im Original bereits 1961, sowie 1973 unter dem deutschen Titel: „Asyle. Über die soziale Situation psychiatrischer Patienten und anderer Insassen“[26], erschienen. In seinem Werk widmete er sich den „totalen Institutionen“, welche er als Unterform des Begriffs „sozialer Institutionen“ verwendet und weiteren charakteristischen Merkmalen zuordnet. In diesem Begriff eingeschlossen, finden sich auch Waisen- und Kinderheime wieder. Inhaltlich beschreibt E. Goffmann die Auswirkungen der damals gängigen Unterbringungsformen für das Individuum, welche er zusammenfassend als „Einschränkung des Selbst“ beschreibt und des weiteren als Begünstigung für die Entwicklung neuer Pathologien und Devianzen identifiziert. Das Resümee aus E. Goffmans Forschungen, welche einen zentralen Kritikpunkt in den folgenden Reformbewegungen einnahm, war die Forderung nach der Berücksichtigung des Erlebens und der Bedürfnisse der Nutzer dieser „totalen Institutionen“ als Individuen. Ein weiterer und ebenso wichtiger Diskurs entstand zudem um die Rolle der Sozialen Arbeit, welche weithin als Disziplinierungs- und Kontrollinstanz der herrschenden Klasse wahrgenommen wurde. Im Bereich der erzieherischen Hilfen führten die Reformbemühungen in den folgenden Jahren zu einer Dezentralisierung der Hilfsangebote (u.a. Jugendwohngruppen, Pflegefamilien) und förderte zugleich das sozialarbeiterische Selbstverständnis hin zu der Orientierung an der Lebenswelt der Klienten.
2.2. Rechtliche Grundlagen
Im deutschen Gesetz verankert ist die Heimerziehung als Bestandteil der „Hilfen zur Erziehung“, welche im SGB VIII ab dem §27 festgeschrieben sind. Dem nach hat ein Personensorgeberechtigter den Anspruch auf die „Hilfe zur Erziehung“, insofern diese als notwendig und geeignet erscheint, um das Wohl des Kindes zu schützen.[27] Konkreter wird die Heimerziehung in §34 SGB VIII genannt. Hier ist festgehalten, dass während einer Fremdenunterbringung über Tag und Nacht (Heimerziehung), die Kinder und Jugendlichen in ihrem Alltagserleben zu begleiten sind, sowie ihre Entwicklung zu fördern ist, indem pädagogische und therapeutische Angebote mit diesem verbunden werden. Zudem sollen die Jugendlichen in Fragen der Ausbildung und Beschäftigung, sowie der allgemeinen Lebensführung beraten und unterstützt werden. Als Grundsatz gilt es dabei, das Alter und den Entwicklungsstand der Kinder und Jugendlichen angemessen zu berücksichtigen. Als Ziel gilt es, entweder die Rückkehr des Kindes in die Familie zu erreichen, die Erziehung in eine andere Familie vorzubereiten oder den Kindern und Jugendlichen eine auf längere Zeit angelegte Lebensform zu bieten und auf ein selbstständiges Leben vorzubereiten.[28]
3. Die Bindungsrepräsentation von Jugendlichen in Heimerziehung
Das im Jahr 2002 von Susanne Müller und Roland [29]Schleiffer veröffentlichte Forschungsprojekt „Die Bindungsrepräsentation von Jugendlichen in Heimerziehung“, stellt die bisher einzige empirische Untersuchung zu dieser konkreten Thematik dar. Ziel war es, die Bindungsrepräsentation von Jugendlichen, die in einem Heim der öffentlichen Jugendhilfe leben, sowie Zusammenhänge zwischen den jeweiligen Bindungskonzepten und einzelnen Persönlichkeitsmerkmalen zu erfassen Durchgeführt wurde die Untersuchung mit 72 Jugendlichen im Alter von 12 bis 23 Jahren. Als methodisches Instrument wurde das Erwachsenenbindungsinterview (AAI) angewandt. Zudem wurde das Ausmaß der psychischen Auffälligkeit erfasst, in dem einerseits die Betreuer mit dem Elternfragebogen über das Verhalten von Kindern und Jugendlichen (CBCL), sowie andererseits die Jugendlichen selbst mit dem Offer-Selbstbildfragebogen befragt wurden. Des Weiteren wurde die „Fremde Situation“ bei einer Untergruppe von jungen Müttern durchgeführt, um die Bindungsorganisation ihrer Kinder einschätzen zu können. Das Ergebnis war überraschend eindeutig: „Die Jugendlichen dieser Stichprobe erwiesen sich als psychopathologisch hoch belastet. Sie verfügten fast ausschließlich nur über eine unsichere und mehrheitlich gar eine hoch-unsichere Bindungsrepräsentation.“[30] Darüber hinaus konnte ein Zusammenhang zwischen dem Vorhandensein einer hochunsicheren Bindungsrepräsentation und dem gleichzeitigen Bestehen von starken externalisierenden und internalisierenden Problemmustern im Sinne einer Komorbidität festgestellt werden. Die Folgende Tabelle bietet eine Übersicht der Verteilung der Bindungsrepräsentanz bei den Jugendlichen, getrennt nach dem Geschlecht:[31]
Als auffallend zu werten ist hier, dass es bei der Gruppe der im Heim lebenden Mädchen im Vergleich zu den im Heim lebenden Jungen häufiger um eine hochunsichere Bindungsrepräsentation handelt. Dieser geschlechtliche Unterschied wurde im Hinblick auf die Bindungsrepräsentation von Kindern, die der Normalpopulation angehören nicht festgestellt. Bei der Untersuchung des Selbstbilds zeigte sich im Vergleich zu einer unauffälligen Vergleichsgruppe, dass die Jugendlichen die Qualität der Beziehung zu ihren Eltern als eher gering einschätzten. Darüber hinaus gaben sie an, sich selbst als tendenziell weniger „zufrieden mit sich selbst und der Welt zu erleben“. Die erfassten Korrelationen stellen zwar lediglich eine Momentaufnahme dar und lassen keine Rückschlüsse auf kausale Zusammenhänge erkennen, dennoch lässt sich in Anbetracht der bekannten, von Missbrauch und Misshandlungen gekennzeichneten Biografien der hier untersuchten Jugendlichen vermuten, dass sie in ihrem bisherigen Lebensverläufen noch nie über eine sichere Bindungsorganisation verfügt haben dürfen.[32] „Ein Wissen um die diesen Jugendlichen zur Verfügung stehenden Bindungsrepräsentation kann zu einem verbesserten Verständnis beitragen für die Probleme, die sich im Umgang mit dieser durchaus erziehungsschwierigen Klientel auftun. Schließlich wird die pädagogische Arbeit stark beeinflusst durch die inneren Arbeitsmodelle, mit denen die Jugendlichen die Beziehung zu ihren Erzieherinnen gestalten.“[33] An dieser Stelle soll nochmals betont werden, dass der relativ hohe Anteil der als nicht-klassifizierbar eingestuften Jugendlichen (44.4 %) noch keine feste Bindungsstrategie entwickelt hat. Sie sind tendenziell also eher offen für bindungskorrigierende Erfahrungen. Auch die als unsicher-verstrickt eingestuften Jugendlichen (12 %) bieten aufgrund ihres Beziehungswunsches ein gewisses Potential bindungskorrigierende Erfahrungen wahrnehmen zu können. An diesem kann die Pädagogik in der Heimerziehung ansetzen und versuchen, den Jugendlichen dazu zu verhelfen, für sich eine konstante Bindungsstrategie zu entwickeln.
4. Der Praxisalltag in der Heimerziehung – bindungshemmende Strukturen und typische Problematiken
Die eine Heimerziehungsform gibt es wie oben erwähnt, schon seit geraumer Zeit nicht mehr. Neben den bekannten, klassischen Zentralheimen existieren heute die verschiedensten Wohnformen. Darunter zählen zum Beispiel Außenwohngruppen, therapeutische Wohngruppen, heilpädagogische Wohngruppen, Verselbstständigungsgruppen, Pflegenester, sowie das betreute Wohnen. Jede einzelne dieser und weiterer Wohnformen unterscheiden sich bei näherer Betrachtung in vielfältiger Weise. Zugleich lässt sich aber auch eine Unsumme an Gemeinsamkeiten wiederfinden, auf welche sich der folgende Abschnitt zu konzentrieren versucht.
Bezieht man sich an dieser Stelle lediglich auf die bisher vorgestellten wissenschaftlichen Erkenntnisse, so lassen sich bereits einige typische Problematiken im Praxisalltag der Heimerziehung ableiten. Auf der einen Seite wären da die Kinder und Jugendlichen, welche mit erhöhter Wahrscheinlichkeit psychopathologisch belastet sind, Verhaltensauffälligkeiten, sowie zudem problematische Bindungsrepräsentationen aufweisen. Mit der Unterbringung an sich fügen sich noch weitere belastende Situationen ihrem Lebenslauf hinzu. Exemplarisch genannt sei hier die Trennung vom bisherigen Umfeld, sowohl familiär, als auch gegebenenfalls geografisch und damit verbunden vom weiteren Sozial- und Schulumfeld. Diese Trennungen können sich schwer belastend auf den Betroffenen auswirken. Zudem steht das Kind oder auch der Jugendliche vor der Herausforderung, sich in seinem neuen Umfeld zu integrieren. Dies bedeutet nicht nur, sich mit den neuen Rahmenbedingungen und Strukturen der Einrichtung und der Betreuer ab-, sowie zurechtzufinden, sondern auch seine Position unter den Bewohnern zu finden, einzunehmen und stetig zu verteidigen. Erschwerend bei der Aufnahme in eine Einrichtung ist es zudem, dass es recht häufig keine Vorbereitungszeit für die Bewohner gibt. Sie erfahren erst wenige Stunden bis Tage vorher von der neuen Situation, haben weder Zeit sich angemessen von den ihnen wichtigen Familienmitgliedern und Freunden zu verabschieden, noch sich allmählich auf die ihnen bevorstehende, einschneidende Veränderung einstellen zu können. Nicht selten führt dies zu einer anfänglich ablehnenden Haltung gegenüber dem „neuen Zuhause“. Frustrationserlebnisse seitens der Betreuer, welche eine hilfreiche Beziehung anbieten, eingeschlossen. „Eine bindungstheoretische Betrachtung kann damit das bekannte „Hilfeparadox“ erklären, wonach diejenigen, die „objektiv“ Hilfe am meisten nötig haben, psychisch am wenigsten in der Lage sind, ein Hilfeangebot auch zu nutzen.“[34]
Bewohner selbst unterliegen Fluktuationen. Dabei kommt es nicht selten zu einem freiwilligen, als auch notwendigen Wechsel der Einrichtung, einer Rückkehr in die familiäre Häuslichkeit oder auch mit erreichen der Volljährigkeit und vorausgesetzten Selbstständigkeit der Bezug der ersten eigenen Wohnung. Dies führt mitunter zu einer Förderung der Instabilität der Gruppen, welche der Heimerziehung angehörig sind. Die immer wiederkehrenden Wechsel und damit verbundene Abschiede und Neuaufnahmen stellen dabei eine besondere emotionale Herausforderung für die Bewohner dar. Haben sie sich an ihre Mitbewohner gewohnt, eventuell sogar enge Freundschaften schließen können, so müssen sie dennoch mit einem absehbaren Abschied rechnen. Nicht selten ist dieser mit einer räumlichen Distanz verbunden, welche es den Bewohnern zudem erschwert, den Kontakt weiter aufrecht zu erhalten. Der frei gewordene Wohnplatz in der Einrichtung wird in der Regel binnen kürzester Zeit neu vergeben. Die Bewohner müssen sich immer wieder auf neue Persönlichkeiten in ihrem vorübergehendem Zuhause einstellen, ihre Hierarchie neu ordnen und ihre eigene Stellung in dieser festigen. Gegebenenfalls können sie die Neuzugänge nutzen und neue freundschaftliche Beziehungen eingehen. Doch auch diese werden sich dem Alltag des Kommen und Gehens in der Heimerziehung nicht entziehen können. Dies führt dazu, dass die in der Heimerziehung gemachten Bindungserfahrungen unter den Bewohnern oft als nicht dauerhaft, unzuverlässig und austauschbar erlebt werden.
Auf der anderen Seite sind die Mitarbeiter zu nennen. Diese bekommen meist ein vorbestimmtes Kontingent an „Bezugskindern“ zugeordnet, um welche sie sich im besonderen Maße bemühen sollen. Dies beinhaltet zum Beispiel die Zusammenarbeit mit dem zuständigen Mitarbeiter des Jugendamts, die Elternarbeit, als auch die Gesprächsführung mit dem Bezugskind, wenn Besonderheiten im Alltag dies erfordern. Problematisch ist hier, dass die Zuordnung der Bezugskinder seltener auf Grundlage der persönlichen Beziehung, als viel mehr auf ein rotierendes System der Entlassungen und Neuaufnahmen von Bewohnern beruht. Da die Bewohner sich ihre „Bezugsbetreuer“ jedoch selbst wählen und diese bei einem von ihnen persönlich empfundenem Bedarf kontaktieren, kommt es zudem öfters zu einer Art von Belagerung der beliebteren Erzieher, und einer Abweisung der Zuwendung gegenüber der weniger beliebten Erzieher. Dies kann dem entsprechend zu einer Überforderung des einen Mitarbeiters und zu einem „aus der Verantwortung ziehen“ des anderen Mitarbeiters führen. Maßgebend ist hier die Dynamik der Mitarbeiter als Team. Einen weiteren und gewichtigen Punkt in der Beziehung zwischen den Bewohnern und Mitarbeitern ist, dass die Heimerziehung professionelle Erziehung in einer Einrichtung ist. Sie dient seitens der Mitarbeiter also nicht dem Selbstzweck, sondern als Einnahmequelle für deren Lebensunterhalt. Folglich unterliegt auch die Arbeit in einem Heim den typischen Karriereverläufen aus anderen Berufsbereichen. Es kommt regelmäßig zu Erzieherfluktuationen, teilweise zu Unterbesetzungen oder auch schlicht zu einem Feierabend für den Mitarbeiter. Die Erreichbarkeit des Erziehers durch den Bewohner ist folglich durch starke Einschränkungen geprägt. „Das Verhältnis zwischen den betroffenen Adressaten der Heimerziehung und deren Betreuern ist kein freiwilliges, auf emotionaler Zuneigung basierendes Zusammenspiel, sondern ein Zweckbündnis, das sich von familiärer Erziehung in vielfältiger Weise unterscheidet.“[35] Diese Tatsache kann bei Missverstehen auf beiden Seiten zu einer ungünstigen Verteilung von Nähe und Distanz führen, welche auf Dauer vielfältige und einschneidende negative Auswirkungen hervorrufen kann. Eine Vermeidungsstrategie seitens der Bewohner könnte es hier sein, sich erst gar nicht auf eine engere Bindung mit Mitbewohnern und Betreuern einzulassen. Können sich die Bewohner so doch das Risiko eines schmerzhaften Trennungserlebnisses von vornherein ersparen.
[...]
[1] Karl Philipp Moritz (*1756 in Hameln; † 1793): U.a. Schriftsteller, Schauspieler, Lehrer, Redakteur, Spätaufklärer, Philosoph, Kunsttheoretiker.
[2] John Bowlby (* 1907 in London; † 1990): Kinderpsychiater, Psychoanalytiker.
[3] Mary Ainsworth (* 1913 in Glendale, Ohio; † 1999): Entwicklungspsychologin.
[4] Brisch S.35
[5] Mary Main (* 1943): Entwicklungspsychologin und Vertreterin der Bindungstheorie
[6] Ainswort, Mary (1973): „Introductory remarks to the symposium on Anxious Attachment and Defensive Reactions. Symposium at the Biennal Meeting of the Society for Research in Child Development. Philadelphia. S.54
[7] Brisch, Karl Heinz (2009): „Bindungsstörungen. Von der Bindungstheorie zur Therapie“. Klett-Cotta-Verlag, Stuttgart. S.35
[8] Grossmann, Karin, Grossmann, Klaus E. (2004): „Bindungen. Das Gefüge psychischer Sicherheit“. Klett-Cotta-Verlag, Stuttgart. S. 54-55
[9] Brisch, Karl Heinz (2009): „Bindungsstörungen. Von der Bindungstheorie zur Therapie“. Klett-Cotta-Verlag, Stuttgart. S.37
[10] Vgl.: Grossmann, Karin, Grossmann, Klaus E. (2004): „Bindungen. Das Gefüge psychischer Sicherheit“. Klett-Cotta-Verlag, Stuttgart. S. 73 ff.
[11] Brisch, Karl Heinz (2009): „Bindungsstörungen. Von der Bindungstheorie zur Therapie“. Klett-Cotta-Verlag, Stuttgart. S.38
[12] Brisch, Karl Heinz (2009): „Bindungsstörungen. Von der Bindungstheorie zur Therapie“. Klett-Cotta-Verlag, Stuttgart. S.49
[13] Mary Main (* 1943): Entwicklungspsychologin und Vertreterin der Bindungstheorie
[14] Vgl.: Grossmann, Karin, Grossmann, Klaus E. (2004): „Bindungen. Das Gefüge psychischer Sicherheit“. Klett-Cotta-Verlag, Stuttgart. S.154
[15] Grossmann, Karin, Grossmann, Klaus E. (2004): „Bindungen. Das Gefüge psychischer Sicherheit“. Klett-Cotta-Verlag, Stuttgart. S.151
[16] Vgl. Grossmann, Karin, Grossmann, Klaus E. (2004): „Bindungen. Das Gefüge psychischer Sicherheit“. Klett-Cotta-Verlag, Stuttgart. S.151 ff.
[17] Brisch, Karl Heinz (2009): „Bindungsstörungen. Von der Bindungstheorie zur Therapie“. Klett-Cotta-Verlag, Stuttgart. S.52
[18] Schleiffer, Roland (2014): „Der heimliche Wunsch nach Nähe. Bindungstheorie und Heimerziehung.“ 5., durchgesehene Auflage. Beltz Juventa Verlag. Weinheim und Basel. S. 51.
[19] Schleiffer, Roland (2014): „Der heimliche Wunsch nach Nähe. Bindungstheorie und Heimerziehung.“ 5., durchgesehene Auflage. Beltz Juventa Verlag. Weinheim und Basel. S. 51.
[20] Schleiffer, Roland (2014): „Der heimliche Wunsch nach Nähe. Bindungstheorie und Heimerziehung.“ 5., durchgesehene Auflage. Beltz Juventa Verlag. Weinheim und Basel. S. 51 ff.
[21] Schleiffer, Roland (2014): „Der heimliche Wunsch nach Nähe. Bindungstheorie und Heimerziehung.“ 5., durchgesehene Auflage. Beltz Juventa Verlag. Weinheim und Basel. S. 52.
[22] Schleiffer, Roland (2014): „Der heimliche Wunsch nach Nähe. Bindungstheorie und Heimerziehung.“ 5., durchgesehene Auflage. Beltz Juventa Verlag. Weinheim und Basel. S. 53
[23] Schleiffer, Roland (2014): „Der heimliche Wunsch nach Nähe. Bindungstheorie und Heimerziehung.“ 5., durchgesehene Auflage. Beltz Juventa Verlag. Weinheim und Basel. S. 55.
[24] Kreft, Dieter, Milenz, Ingrid (Hrsg.) (2005): „Wörterbuch Soziale Arbeit. Aufgaben, Praxisfelder, Begriffe und Methoden der Sozialarbeit und Sozialpädagogik.“ 5. vollst. Überarbeitete und ergänzte Auflage. Juventa Verlag. Weinheim. S.413.
[25] Erving Goffman(* 11. Juni 1922 in Mannville, Kanada; † 19. November 1982 ): Soziologe.
[26] Goffmann, Erving (1973): „Asyle. Über die soziale Situation psychiatrischer Patienten und anderer Insassen.“ Suhrkamp, Frankfurt am Main. [Orig.: „Asylums. Essays on the Social Situation of Mental Patients and other Inmates.“ Chicago 1961]
[27] Vgl. § 27 Abs. 1 SGB VIII
[28] Vgl. § 34 SGB VIII
[29] Müller, Susanne, Schleiffer, Roland (Hrsg.) (2002): „Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie : Ergebnisse aus Psychotherapie, Beratung und Psychiatrie“. Vandenhoeck Ruprecht Verlag. Göttingen. S.747-765.
[30] Müller, Susanne, Schleiffer, Roland (Hrsg.) (2002): „Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie : Ergebnisse aus Psychotherapie, Beratung und Psychiatrie“. Vandenhoeck Ruprecht Verlag. Göttingen. S.747
[31] Müller, Susanne, Schleiffer, Roland (Hrsg.) (2002): „Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie : Ergebnisse aus Psychotherapie, Beratung und Psychiatrie“. Vandenhoeck Ruprecht Verlag. Göttingen. S. 756.
[32] Vgl. Müller, Susanne, Schleiffer, Roland (Hrsg.) (2002): „Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie : Ergebnisse aus Psychotherapie, Beratung und Psychiatrie“. Vandenhoeck Ruprecht Verlag. Göttingen. S.757 ff.
[33] Müller, Susanne, Schleiffer, Roland (Hrsg.) (2002): „Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie : Ergebnisse aus Psychotherapie, Beratung und Psychiatrie“. Vandenhoeck Ruprecht Verlag. Göttingen. S. 761
[34] Müller, Susanne, Schleiffer, Roland (Hrsg.) (2002): „Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie : Ergebnisse aus Psychotherapie, Beratung und Psychiatrie“. Vandenhoeck Ruprecht Verlag. Göttingen. S. 761.
[35] Normann, Edina (2003): „Erziehungshilfen in biografischen Reflexionen: Heimkinder erinnern sich.“ Verlagsgruppe Beltz, Berlin. S. 140
- Arbeit zitieren
- Elena Krug (Autor:in), 2014, Heimerziehung und Bindungstheorie. Zusammenhänge erkennen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/298820
Kostenlos Autor werden

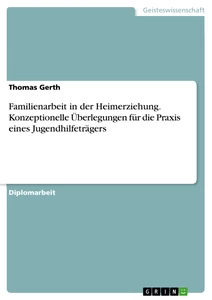




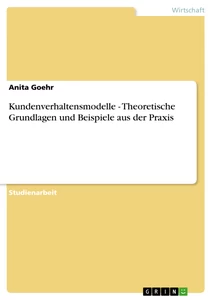

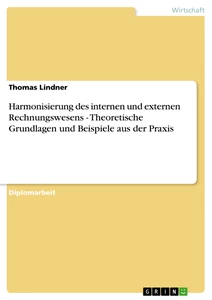

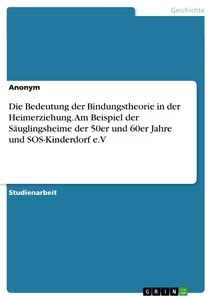









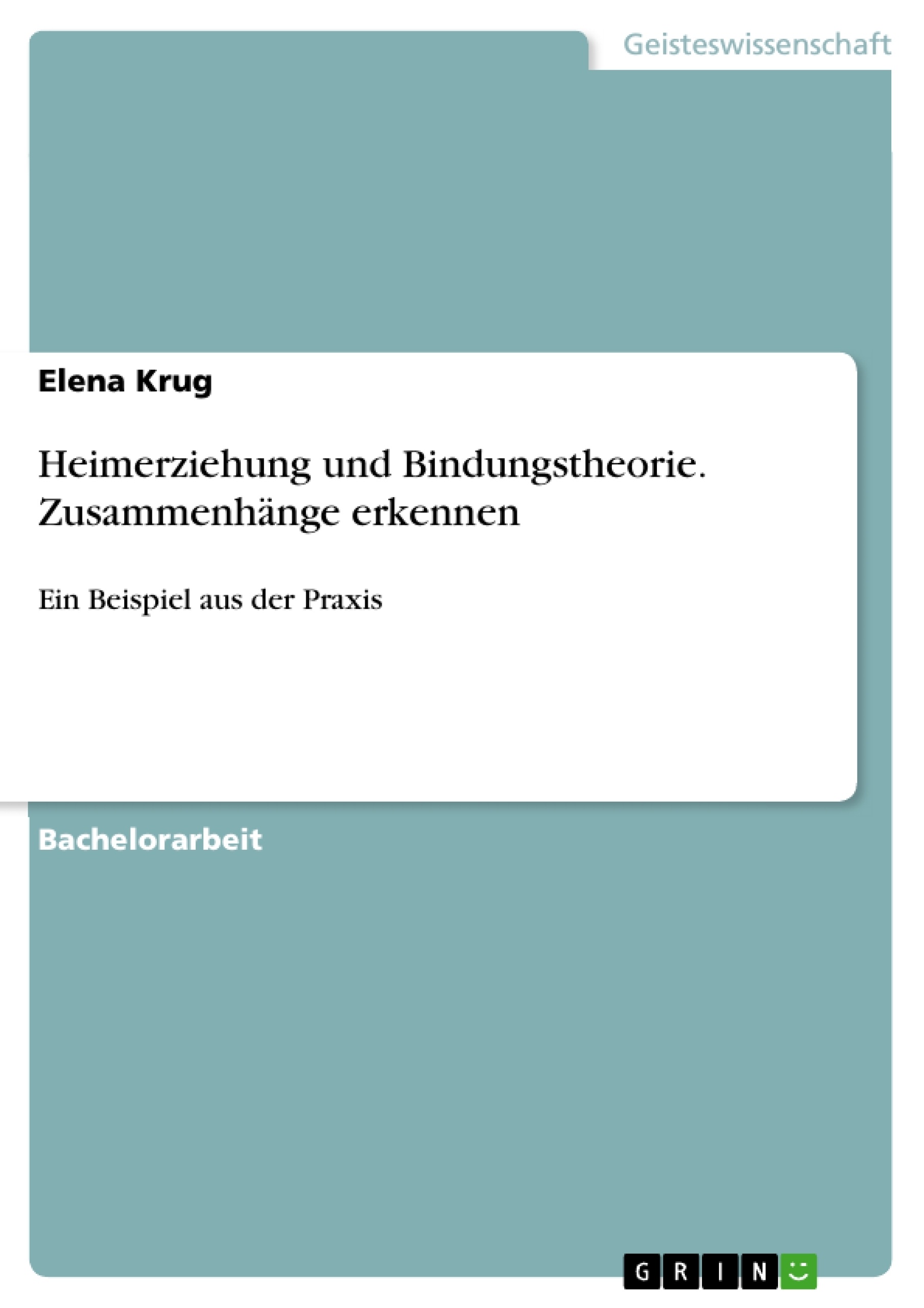

Kommentare