Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Mein Ethischer Kontext zum Thema
3 Die Methode der hermeneutischen Fallbesprechung
3.1 Die Vorbereitung
3.2 Schritt 1: Analyse der problematischen Situation
3.3 Schritt 2: Ethischer Kontext
3.4 Schritt 3: Verschiedene Szenarien
3.5 Schritt 4: Argumentationen Pro und Kontra
3.6 Schritt 5: Weiteres Vorgehen
4 Auswertung und Fazit
5 Literaturverzeichnis
1 Einleitung
Pädagogisches Handeln steht immer in Zusammenhang mit ethischen Fragen. Soll ich etwas tun oder lassen? Welche Gründe sprechen für das Handeln bzw. für das Nicht-Handeln? Das pädagogische Handeln wird bestimmt durch den eigenen Werte und Normenhorizont; nicht selten unreflektiert, aber meistens legitimiert durch eine Art pädagogischen Ethos. Jeder Pädagoge hat seine eigene Haltung von Richtig und Falsch. Er rechtfertigt durch sein Menschenbild das Handeln und beeinflusst damit den Entwicklungsprozess seines Klienten. Man könnte sagen Pädagogisches Handeln ist immer auch ethisches Handeln (vgl. Dederich, 2001, S.15). Die Frage nach der prinzipiellen Legitimation von Erziehung unter dem Aspekt subjektiver Normengeleitetheit ist im Spannungsfeld von Abhängigkeit und Autonomie, Fremdbestimmung und Selbstbestimmung gerade in der Behindertenpädagogik entfacht. Auf welcher ethisch argumentativen Grundlage werden Entscheidungen begründet? In einer auf Pluralismus und Heterogenität ausgelegten Gesellschaft ist die Frage nach einem ethischen Fundament in der Behindertenpädagogik von großer Bedeutung.
Viele Reformen Behindertenhilfe betreffender Gesetze (Grundgesetz, Betreuungsrecht, Wohn- und Teilhabegesetz, Antidiskriminierungsgesetz, UN Behindertenrechtskonvention um die wichtigsten zu nennen) haben die rechtliche Grundlage für diese Pluralität geschaffen.
Noch vor weniger als 20 Jahren zum Beispiel galt sexueller Kontakt zwischen Menschen mit Behinderung als moralisch verwerflich. Heute haben sich diese moralischen Grundlagen verändert. Es gibt viele Ansätze gelebter Sexualität zwischen Menschen mit geistiger Behinderung, auf Fachtagen werden moderne Konzepte partnerschaftlichen Wohnens vorgestellt und in Einrichtungen sind Paarwohnungen und „richtige“ Hochzeiten keine Seltenheit mehr.
Zu einer überdauernden Partnerschaft gehört auch das Thema Kinder. Ich kenne kein Paar aus meiner beruflichen Praxis, das nach einiger Zeit nicht auch einen Kinderwunsch äußert. Orientiert an diesen Einzelfällen, mit Blick auf den konkreten Menschen, habe ich eine Elternschaft stets kritisch beurteilt.
In dieser Portfolioarbeit geht es um das Dilemma zwischen dem Recht auf Selbstbestimmung einer eigenen Familienplanung für Menschen mit geistiger Behinderung (am Beispiel von J.) und dem Unbehagen eines Teams mit dem Impuls dagegen pädagogisch intervenieren zu müssen. Erkenne ich den Wunsch des anderen an, oder gibt es gute Gründe der Ausgrenzung? Was tun, wenn unser auf Autonomie und Selbstbestimmung ausgerichteter pädagogischer Auftrag mit unseren eigenen Vorstellungen und Werten kollidiert? An einem aktuellen Fallbeispiel bin ich mit den verantwortlichen Fachkräften dieser Frage nachgegangen. Wir haben ausprobiert, ob uns mit dem Mittel der hermeneutischen Fallbesprechung ein besseres Verstehen dieses Dilemmas gelingt. Ich werde das Prinzip der hermeneutischen Fallbesprechung kurz vorstellen und anschließend den Verlauf der konkreten Durchführung darstellen.
In Kapitel 2 und später im Fazit werde ich mich auch kritisch mit meiner eigenen Haltung auseinandersetzen und mir die Frage nach der besonderen Verantwortung als Führungskraft stellen.
2 Mein Ethischer Kontext zum Thema
Seit 1987 bin ich im Bereich der Behindertenpädagogik tätig. Zunächst im regulären Gruppendienst übernahm ich 1996 die Leitung eines zweigruppigen Wohnhauses der Arbeiterwohlfahrt. Seit 2013 bin ich als verantwortliche Regionalleitung für alle Angebote der Eingliederungshilfe dieses Trägers zuständig.
Zu Beginn meiner Tätigkeit Mitte der achtziger Jahre, entwickelte sich zunehmend eine Diskussion über die Anerkennung des Rechts auf Sexualität und Partnerschaft von Menschen mit Behinderung. Die Normalisierungsdebatte und die Empowermentbewegung forderten in immer stärkerem Maße autonomere Wohnformen, wie zum Beispiel das Zusammenleben in Partnerschaften. Einzelne Träger wagten neue Konzepte, es gab viele Vorbehalte. Eine neue inhaltliche, ethische Orientierung wurde notwendig und in den Teams wurde eifrig darum gerungen.
Bei mir haben sich im Kern vier Bedenken herausgebildet, die mich bei der Frage nach einer Elternschaft behinderter Menschen bisher geleitet haben. Diese Bedenken unterliegen in meinem beruflichen Handeln einem kontinuierlichen Prozess. So ist der erste Punkt heute nicht mehr für mein Handeln von Bedeutung, ich benenne ihn dennoch, stellvertretend für den Entwicklungsverlauf meiner eigenen Haltung:
1. Kinder von geistig behinderten Eltern sind überwiegend ebenfalls geistig behindert.
2. Es besteht eine mangelhafte, unzureichende Elternkompetenz und damit eine Gefährdung des Kindeswohls
3. Fehlende Entwicklungsmöglichkeiten der elterlichen Kompetenz
4. Zwangsläufige Fremdunterbringung der Kinder
Punkt eins ist eine weit verbreitete Annahme und in meinem Tätigkeitsbereich immer noch erstaunlich gängige Meinung. Die Ursprünge dieser Annahmen entstanden aufgrund von Untersuchungen in den 20er und 30er Jahren des 20. Jahrhunderts und gelten mittlerweile als widerlegt. Zum einen wurde damals von einem anderen Verständnis der Entwicklungsverzögerung ausgegangen, zum anderen weiß man heute dass es keinen kausalen, genetischen Zusammenhang zwischen einer geistigen Behinderung der Eltern und einer geistigen Behinderung der Kinder gibt. Eltern mit einer geistigen Behinderung können allerdings ein familiäres Klima bieten, das das Risiko für die kindliche Entwicklung erhöht (vgl. Prangenberg, 2008, S.39f).
Die Frage nach der unzureichenden elterlichen Kompetenz und einer potentiellen Gefährdung des Kindes erzeugt bei mir und wie wir später sehen werden, auch in der speziellen Fallvorstellung bei den Pädagogen das größte Unbehagen. Insbesondere bei Pädagogen mit eigener Elternschaft entstehen schnell Fragen: „Wie soll jemand für ein Kind sorgen können, der für sich selbst nicht sorgen darf?“
Wenn Eltern mit geistiger Behinderung für sich selbst und für ihre eigenen Angelegenheiten einen Betreuer brauchen, wie können sie das Sorgerecht für ihr Kind ausüben? Wer ist zuständig im Sinne der Aufsichtspflicht für das Kind, wenn die Eltern bei uns in der Einrichtung leben, wir oder die Eltern?
Aus rechtlicher Sicht sind zwar die Begriffe des Kindeswohls und der elterlichen Kompetenz nicht eindeutig definiert, dennoch hat dazu jeder eigene Bilder im Kopf, die seine Haltung bestimmen. Reicht zur Bestimmung der elterlichen Kompetenz allein die Fähigkeit zur physischen Versorgung aus, (vgl. Pixa-Kettner, 2008 S.225) oder ist die Fähigkeit zur Inanspruchnahme von Hilfeangeboten ein Kriterium? Sind Entwicklungsverzögerungen als Folge einer familiären Minderbegabung der Eltern nicht zwangsläufig bei dem Kind zu erwarten?
Einige Untersuchungen belegen ein erhöhtes Maß an Missbrauchserfahrungen von Kindern geistig behinderter Eltern (vgl. Prangenberg, 2008, S.42f). Auch wenn diese Studien nicht wirklich eindeutig eine monokausale Kindeswohlgefährdung belegen, weil sie nicht auf repräsentativem Datenmaterial beruhen (in der Regel wurden nur Familien untersuchten die bereits behördlich in Erscheinung getreten sind) bleibt das Unbehagen. Wer würde ohne Zögern einer geistig behinderten Mutter sein zweijähriges Kind überlassen?
Der dritte Punkt geht von der Annahme aus, dass Menschen mit geistiger Behinderung sich prinzipiell nicht grundlegend weiterentwickeln (können). Unbehagen bereitet mir dabei die Vorstellung, dass ihre eigenen Kinder sie im Laufe ihrer Entwicklung „überholen“, dass ihre geistigen Fähigkeiten die ihrer Eltern übersteigen. Werden sie sich dann für ihre Eltern schämen? Wie können die Eltern sie dann durch die noch bevorstehenden Entwicklungsstufen z.B. der Adoleszenz begleiten?
Die Fremdunterbringung von Kindern geistig behinderter Eltern erlebte ich bisher als Automatismus. Die Gefahren für das Kind aufgrund der eingeschränkten Erziehungskompetenz der Eltern sollten so früh wie möglich durch eine Fremdunterbringung verringert werden. In einem konkreten Fall, wurde die Überforderung der geistig behinderten Eltern nicht rechtzeitig erkannt, auch die installierten Helfersysteme reagierten nicht. Großeltern hielten unbedingt am Schein der funktionierenden Familie fest. Erst als ein Kinderarzt ein Schütteltrauma diagnostizierte, wurde die Gefährdung offenbar und das Kind wurde in Obhut genommen.
Zum Dilemma werden diese Fragen für mich, weil ihnen gegenübergestellt mein Grundverständnis einer Autonomiepädagogik und die rechtliche Gleichstellung aller Menschen stehen. Niemand darf aufgrund einer Behinderung benachteiligt werden (Art.3 GG). Gesetzliche Betreuer sind dem Grundsatz der selbstbestimmten Lebensführung verpflichtet (§1901 BGB). Also haben Menschen mit Behinderung genauso das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben, ein Recht Entscheidungen über das eigene Leben und die eigene Lebensplanung zu treffen (Art.23 UN Behindertenrechts-Konvention).
Dennoch, in meiner Rolle als Pädagoge und verantwortliche Leitungskraft habe ich mich bisher entschieden die Frage, ob die Freiheit eines Einzelnen und die durch sein Handeln entstehenden Risiken durch Pädagogik eingedämmt oder zumindest in eine bestimmte Richtung kanalisiert werden müssen, stets mit Ja beantwortet.
Wohlwissend des Dilemmas zwischen meiner Überzeugung nach Selbstbestimmung und Autonomie und den beschrieben Bedenken, gab in konkreten Einzelfällen meine institutionelle Verantwortung den entscheidenden Impuls, Elternschaft zwischen geistig Behinderten Bewohnern möglichst zu vermeiden. Zu viele Fragen blieben unbeantwortet, zu viele Risiken schienen mir damals unkalkulierbar. Zu viele erlebte Schicksale und die Hilflosigkeit der zuständigen pädagogischen Mitarbeiter, bewogen mich eine Elternschaft geistig Behinderter Menschen nicht offensiv zu gestalten. Dies vertrat ich auch gegenüber Eltern, Angehörigen und Mitarbeitern, übrigens mit großer Zustimmung.
3 Die Methode der hermeneutischen Fallbesprechung
Unter Hermeneutik versteht man die Lehre vom Verstehen und der Interpretation. Ursprünglich bezog sie sich auf das Verstehen und Auslegen von Texten als Hilfswissenschaft der Theologie und Philosophie. Heute ist sie eine anerkannte wissenschaftliche Methode. Nach Heidegger (1979) ging es bei der Hermeneutik um die Entwicklung eines Grundverständnisses menschlichen Seins. Erst analysiert sie viele Einzelphänomene, um anschließend ein genaueres Verständnis des Daseins insgesamt zu ermöglichen (vgl. Steinkamp 2010, S.283). Im Laufe des 20.Jahrhundert hat sich die Hermeneutik als Methode zum verstehenden Erkenntnisgewinn weiterentwickelt. Hans-Georg Gadamer (1990)vertritt den Ansatz, dass dies am besten durch ein Gespräch mit gemeinsamer Fragestellung möglich ist. Das Gespräch stellt sich unter „die Führung der Sache“ (s. Gadamer, 1990, S.373), zentrales Element ist nicht die Argumentation, sondern die Kunst des Fragens. Das Gesagte wird nicht auf seine Schwäche hin untersucht, sondern ist Bestandteil der Wahrheit (vgl. Steinkamp, 2010, S.284).
Dies entspricht zwar nicht dem Anspruch wissenschaftlicher Objektivität, gilt aber als Ansatz zu einer Psychologie des Verstehens. Neuere Ansätze sprechen z.B. von einer „hermeneutischen Spirale“ (Jürgen Bolten). Das Verstehen des Ganzen wird laufend ergänzt durch ein genaues Verständnis des Einzelnen. Dadurch kommt es zu einem ständigen Verstehens-Prozess und ist damit „kein zirkuläres Zurückkehren zu seinem Ausgangspunkt“ (s. Bolten 1985, S.362).
Auch bei der hermeneutischen Methode der Fallbesprechung geht es darum, die Erfahrungen des Einzelnen im Umgang mit seinem Klientel und seinen Kolleg_innen in einem Gespräch darzulegen, sie besser zu verstehen. Nicht die konkrete Entscheidung oder die Begründung für eine Entscheidung steht dabei an erster Stelle, sondern eine bessere Orientierung über sein mögliches Handeln zu bekommen. Die hermeneutische Fallbesprechung wird in fünf Schritte unterteilt (vgl. Steinkamp 2010, S.281f):
1. Analyse der problematischen Situation
2. Ethischer Kontext, auf den die Situation verweist
3. Bestimmung verschiedener möglicher Szenarien
4. Auseinandersetzung, Debatte, Argumentation über die verschiedenen Szenarien
5. Vorschlag für das weitere Vorgehen
[...]
- Arbeit zitieren
- Stefan Cornelius (Autor:in), 2015, Tabu oder Normalität? Elternschaft von Menschen mit geistiger Behinderung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/295327
Kostenlos Autor werden






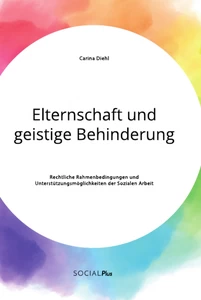












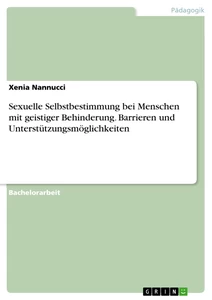
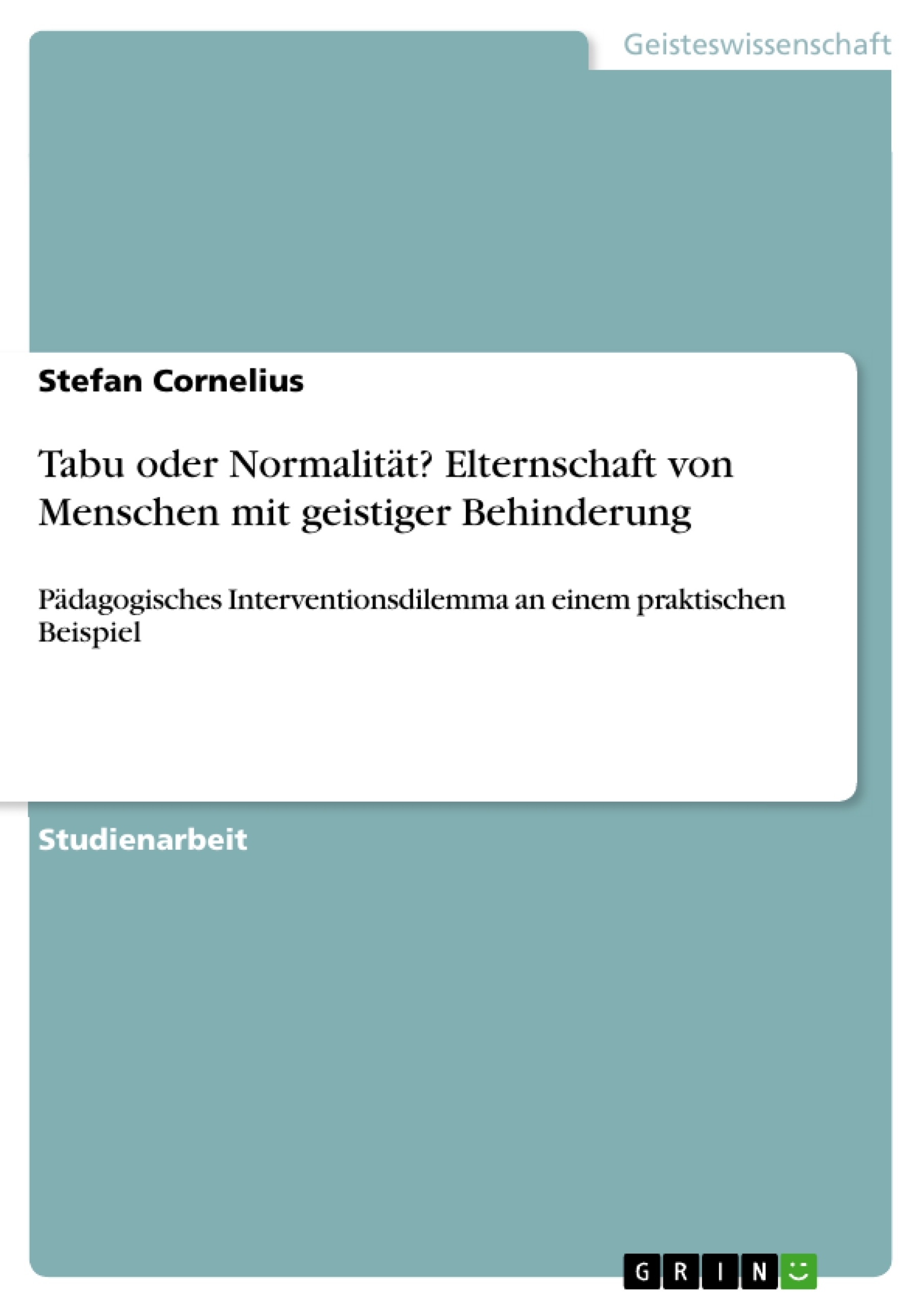

Kommentare