Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1 Theoretische Auseinandersetzung mit dem Konstrukt des Fähigkeitsselbstkonzepts
1.1 Selbstwirksamkeitserwartung
1.2 Attributionsstil
1.3 Bezugsnormorientierung
1.4 Handlungsmotivation
2 Fähigkeitsselbstkonzepte in der Entwicklungsphase Grundschulkind
2.1 Das Kind auf der Konkret-Operationalen Stufe nach Jean Piaget
2.2 Das Kind in der Latenzphase nach Sigmund Freud
2.3 Das Kind im Konflikt zwischen Werksinn und Minderwertigkeitsgefühl nach …..Erik H. Erikson
2.4 Die Relevanz des Grundschulalters für die Fähigkeitsselbstkonzeptentwicklung
3 Einflussfaktoren auf die Fähigkeitsselbstkonzeptentwicklung im Kontext ...der Grundschule
3.1 Einflussebenen
3.1.1 Das Kind als Subjekt
3.1.2 Die Bezugsgruppe und soziale Vergleiche
3.1.3 Die Lehrkraft und der Unterricht
3.1.4 Die elterliche Interaktion und familiäre Lebenslage
3.1.5 Die Schule als Institution
3.2 Positive und negative Einflussfaktoren
3.3 Mögliche Folgen niedriger Fähigkeitsselbstkonzepte von Grundschulkindern
4 Grundschulkinder stärken – Intervention auf verschiedenen Ebenen
4.1 Das Münchner Motivationstraining
4.2 LehrerInnenarbeit
4.3 Einbeziehung der Eltern
4.4 Bildungspolitische Initiative
Schlussfolgerung
Literaturverzeichnis
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Einleitung
„Nothing splendid has ever been achieved except by those who dared believe that something inside themselves was superior to circumstance.“ (Barton 1925, 13)
Der hohe Einfluss der Selbsteinschätzung eigener Stärken und Schwächen auf Motivation und Verhalten ist in der pädagogisch–psychologischen Forschung heute bestätigt (vgl. Hellmich 2011, 11). Wie im Zitat beschrieben, ist der Glaube an die eigenen Fähigkeiten Voraussetzung für die Erbringung von Leistung, sodass nicht zuletzt das starke Vertrauen in die eigene Wirksamkeit Menschen zu höherer Leistungsbereitschaft treibt (vgl. Mummendey 2006, 74f.). Als eine kognitiv-motivationale Schlüsselvariable wird in diesem Zusammenhang das Selbstkonzept eigener Fähigkeiten betrachtet. Durch selbstzuschreibende Fähigkeitsannahmen kann es das künftige Verhalten in (Leistungs-) Situationen determinieren und auf diese Weise eine weiterführend negative oder positive Leistungs- und Lernstruktur begünstigen und aufrechterhalten (vgl. Faber 2012, 2). In seiner Relevanz für Lernverhalten und -erfolge erfährt das Fähigkeitsselbstkonzept vor allem im Bildungswesen zunehmende Aufmerksamkeit (vgl. Günther/Hellmich 2011, 19). Einerseits ist die Förderung eines positiven Fähigkeitsselbstkonzepts von SchülerInnen als pädagogisches Ziel von Schule vorgesehen (vgl. Dickhäuser 2006, 5). Andererseits kann das Schulwesen durch Leistungsanforderungen, normativen Charakter und negativ gehaltene Rückmeldungen einer positiven Fähigkeitsselbstkonzeptentwicklung auch entgegenwirken (vgl. Tillmann 2010, 183). Bereits in der mittleren Kindheit entwickelt sich ein Fähigkeitsselbstkonzept, welches im schulischen Kontext entscheidend geformt wird (vgl. Breuker/Rost 2011, 243). Andauernde Misserfolgserfahrungen im Grundschulalter beeinflussen langfristig nicht nur das Lernverhalten der SchülerInnen, sondern im Weiteren auch ihr sozial-emotionales Wohlergehen (vgl. Faber 2012, 2). So „hat Misserfolg in der Schule umso mehr Symptome der Angst und Depression zur Folge, je niedriger das Fähigkeitsselbstkonzept der Schüler und Schülerinnen ist“ (Schöne/Stiensmeier-Pelster 2008, 62).
Im Rahmen dieser Arbeit soll der Fragestellung nachgegangen werden, welche Einflussfaktoren auf die kindliche Fähigkeitsselbstkonzeptentwicklung sich im Kontext der Grundschule ergeben. Tendenziell hemmende und fördernde Faktoren sollen differenziert werden, um das Kind in seiner Selbstkonzeptentwicklung positiv unterstützen und stärken zu können. Dabei stehen Kinder im Zentrum der Betrachtung, die von negativer Selbstkonzeptentwicklung bedroht sind, sich Herausforderungen nicht zutrauen und im schulischen Kontext eher Probleme haben. Hochbegabte Kinder werden in dieser Arbeit nicht explizit thematisiert. Für sie können in der Selbstkonzeptentwicklung andere Schwerpunkte gelten (vgl. Hanses et al. 2011, 68ff.).
Zunächst wird eine theoretische Auseinandersetzung mit dem Konstrukt des Fähigkeitsselbstkonzepts erfolgen. Anhand entscheidender Kategorien werden tendenziell förderliche, beziehungsweise hemmende selbstbezogene kognitive Verarbeitungsweisen benannt, als da sind: Selbstwirksamkeitserwartung, Attributionsstil, Bezugsnormorientierung sowie Handlungsmotivation. Als roter Faden begleitet diese Kategorien die Frage, inwiefern sie mit interindividuell unterschiedlichen Annahmen über die Stabilität von Fähigkeiten in Zusammenwirkung stehen. Wie sich im Laufe der Arbeit zeigen wird, ist die Einschätzung der Stabilität von Fähigkeiten von besonderer Bedeutung für die Ausformung des Fähigkeitsselbstkonzepts.
Im zweiten Kapitel wird darauf aufbauend der altersspezifische kognitive und emotionale Entwicklungsstand von Kindern im Grundschulalter Beachtung finden. Hier wird anhand dreier Klassiker der Entwicklungspsychologie die phasentypische Bedeutsamkeit des Grundschulalters für die Genese des Fähigkeitsselbstkonzepts herausgearbeitet. Entsprechend den Theorietiteln setzen Jean Piagets Stufentheorie der geistigen Entwicklung, Freuds psychosexuelle- sowie Eriksons psychosoziale Phasentheorie der kindlichen Entwicklung ihre inhaltlichen Schwerpunkte unterschiedlich, sodass eine Betrachtung der Entwicklungsphase Grundschulkind1 aus verschiedenen Blickwinkeln möglich ist. Anschließend werden die Erkenntnisse der Theorien in ihrer Relevanz für die Fähigkeitsselbstkonzeptentwicklung zusammengefasst.
Nachdem eine Einführung des Fähigkeitsselbstkonzepts unter Berücksichtigung der das Grundschulkind kennzeichnenden Entwicklungsphase geschaffen wurde, kann im dritten Kapitel die Erarbeitung der zentralen Fragestellung dieser Arbeit erfolgen. Hier werden Erkenntnisse über Einflussfaktoren der Fähigkeitsselbstkonzeptgenese im schulischen Kontext vorgestellt, wobei die Einflussebenen Kind, Bezugsgruppe, Lehrkraft, Eltern und Schule als Institution differenziert und jeweilige relevante Erkenntnisse aufgeführt werden. Im Anschluss an deren Erörterung erfolgt eine strukturelle Zusammenfassung.
Mit Blick auf die gewonnenen Erkenntnisse sollen im vierten Kapitel Interventionsmöglichkeiten zur Stärkung positiver Fähigkeitsselbstkonzepte von Grundschulkindern herausgearbeitet werden. Auch hier werden die genannten Einflussebenen differenziert. Mit Bezug auf die direkte Interaktionsebene mit dem Kind wird das Münchner Motivationstraining vorgestellt. Als schulisches Motivationstraining bietet es die Möglichkeit praktischer Einsetzbarkeit. Weiter wird aufgezeigt, wie Unterstützung der Lehrkraft und Optimierung des Unterrichts im Sinne positiver kindlicher Selbstkonzeptentwicklung umgesetzt werden kann. Auch die Bedeutung einer Einbeziehung der Eltern in ein Förderkonzept wird berücksichtigt. Nachfolgend wird diskutiert, wie bildungspolitische Initiative aus einer gesamtgesellschaftlichen Perspektive heraus entsprechenden Negativentwicklungen und Zwängen entgegentreten kann.
Zum Abschluss dieser Arbeit erfolgt eine inhaltliche Zusammenfassung sowie Stellungnahme der Verfasserin.
1 Theoretische Auseinandersetzung mit dem Konstrukt des Fähigkeitsselbstkonzepts
Die Erforschung des Selbst hat für die Psychologie seit ihrer Entstehung eine zentrale Bedeutung, sodass bis heute entsprechend viele Theorien aus verschiedenen Blickrichtungen dieses Gebilde zu erfassen versuchen (vgl. Greve 2000, 15ff.; Mummendey 2006, 30ff.). Allgemeiner wissenschaftlicher Konsens besteht in der Annahme, dass das Selbstkonzept all jene Kognitionen2 umfasst, die sich auf das eigene Selbst beziehen, präziser gesagt, auf die eigene Person in ihren Eigenschaften, Fähigkeiten und Merkmalen (vgl. Mummendey 2006, 38). Diese selbstbezogenen Kognitionen haben dispositionale und situative Komponenten, welche je nach Person und Situation unterschiedlich stark ausgeprägt sind (vgl. Greve 2000, 18f.).
Ausgehend davon, dass ein generelles Selbstkonzept sich aus einer Vielzahl von Unterkonzepten bildet, lässt sich das Fähigkeitsselbstkonzept als Teilselbstkonzept betrachten, wobei dieses sich wiederum in viele Unterteilkonzepte gliedert. Die Hierarchieebenen beeinflussen sich dabei multidirektional (vgl. Bolus/Shavelson 1981, 3ff.). In der Literatur wird der Begriff des Fähigkeitsselbstkonzepts teils synonym mit dem des akademischen Selbstkonzepts verwendet (vgl. Dickhäuser et al. 2002, 394). Die folgende Arbeit wird sich jedoch von dieser Gleichsetzung distanzieren, da hier unter Fähigkeiten alle individuellen Kompetenzen und Voraussetzungen zur Erbringung von Leistung verstanden werden, und nicht nur diejenigen, die für den beruflichen Werdegang von Bedeutung sind3 (vgl. Starke-Perschke 2001, 156). Das Fähigkeitsselbstkonzept meint hier in Orientierung an Schöne und Stiensmeier-Pelster (2008, 62) „die Gesamtheit der kognitiven Repräsentationen eigener Fähigkeiten.“
Ein hohes (Teil-)Fähigkeitsselbstkonzept impliziert das Selbstverständnis eines Individuums in einem Bereich ausgeprägte Fähigkeiten zu haben (vgl. Schöne/Stiensmeier-Pelster 2011, 49). Diese Einschätzung (hoch/niedrig) steht in Verbindung mit der weiteren Motivation und dem Handeln des Individuums, bildet jedoch allein kein gutes Prognosemittel über die Leistungs- und Lernentwicklung. Verstärkte Aufmerksamkeit wurde im wissenschaftlichen Diskurs deshalb den impliziten Fähigkeitstheorien geschenkt, welche bis dato noch nicht ausführlich erforscht wurden (vgl. Dresel/Schloz 2011, 81). Diese beziehen sich auf die Annahme des Individuums, inwieweit Fähigkeiten generell, also für alle Menschen, überhaupt erwerbbar und veränderbar sind. Dabei wurde aufgezeigt, dass Menschen verschiedene Annahmen über die Stabilität von Fähigkeiten haben. Geht eine Person von Fähigkeiten als etwas Verbesserbarem und Flexiblem aus, wird von einer impliziten Modifizierbarkeitstheorie gesprochen, betrachtet sie Fähigkeiten hingegen als determiniert und unveränderbar, von einer impliziten Entitätstheorie (vgl. Dweck/Leggett 1988, 256ff.). Dweck und Leggett (1988, 268f.) entwickelten ein theoretisches Modell, das die implizite Fähigkeitstheorie in Kombination mit der Höhe des Fähigkeitsselbstkonzept setzt, wobei sie annahmen, dass die verschiedenen Verknüpfungen in Misserfolgssituationen tendenziell eher zu hilflosem oder bewältigendem Verhalten führten.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten.
Abbildung 1: Theoretische Annahmen zum Zusammenspiel von impliziter Fähigkeitstheorie und Fähigkeitsselbstkonzept bei der Entstehung von Reaktionsmustern nach Misserfolg (Dweck/Leggett 1988 zitiert nach Dresel/Schloz 2011, 85)
Nach diesem Modell führt eine implizite Modifizierbarkeitstheorie sowohl bei hohen als auch niedrigen Fähigkeitsselbstkonzepten zu einem bewältigenden Verhaltensmuster nach Misserfolg. Eine implizite Entitätstheorie hingegen führe nur bei hohem Fähigkeitsselbstkonzept zu bewältigendem Verhalten, bei Personen mit niedrigem Fähigkeitsselbstkonzept jedoch zu Hilflosigkeit (vgl. Dweck/Leggett 1988, 268f.). Inwiefern das gezeigte Modell die kognitiven Zusammenhänge von Fähigkeiten korrekt widerspiegelt, soll in den kommenden Abschnitten (vor allem 1.1 und 1.2) thematisiert werden. In seiner Vereinfachung dient das Modell einem guten Einstieg in die Thematik und gibt eine Vorstellung über hemmende oder fördernde selbstbezogene Kognitionen. Wird im Folgenden jedoch von Fähigkeitsselbstkonzept gesprochen, so nicht von einem wie im Modell von Dweck und Leggett auf die Dimension der Höhe beschränkten, sondern in Orientierung an Schöne und Stiensmeier-Pelster von einem auf alle Kognitionen über die eigenen Fähigkeiten bezogenen, die implizite Fähigkeitstheorie mit eingeschlossen (vgl. Schöne/Stiensmeier-Pelster 2008, 62). In weiterer Annäherung an dieses komplexe Konstrukt des Fähigkeitsselbstkonzepts geht es im Besonderen darum, hemmende und förderliche selbstbezogene Verarbeitungsweisen voneinander abzugrenzen.
1.1 Selbstwirksamkeitserwartung
Die Selbstwirksamkeitserwartung als Konzept nach Albert Bandura beschreibt die Erwartung, aufgrund von eigenen Fähigkeiten Situationen bewältigen zu können. Ist eine Person der Überzeugung, eine Situation durch ihr Handeln in ihrem Sinne beeinflussen zu können, wird nach Bandura von einer hohen Selbstwirksamkeitserwartung gesprochen. Bei einer niedrigen Selbstwirksamkeitserwartung glaubt die Person sich Geschehnissen gegenüber ausgeliefert (vgl. Bandura 1997, 36f.).
Die Selbstwirksamkeitserwartung spielt eine zentrale Rolle für die menschliche Motivation. Das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zur Bewältigung einer Aufgabe ist von wesentlicher Notwenigkeit, um die erforderliche Anstrengungsbereitschaft und Ausdauer zu zeigen. Erst dadurch kann Kompetenz erworben, Leistung erbracht werden und schließlich ein positives Konzept der eigenen Fähigkeiten entstehen. Der Zweifel an oder die Verneinung der eigenen Fähigkeiten können hier zur Sich-selbst-erfüllenden Prophezeiung werden (vgl. Hannover/ Kessels/Wolter 2011, 120).
„Skills can be easily overuled by self-doupts, so that even highly talented individuals make poor use of their capabilities under circumstances that undermine their beliefs in themeselves.“ (Bandura 1997, 37)
Die Erwartung der Selbstwirksamkeit in einer zukünftigen Situation begründet sich primär durch bereits erlebte und jeweils subjektiv empfundene und bewertete Geschehnisse. So haben erlebte (Miss-)Erfolge einen großen Einfluss auf die zukünftige Selbstwirksamkeit. Auch die (Miss-)Erfolge stellvertretender Personen, mit denen sich das Individuum identifiziert, können die Selbstwirksamkeitserwartung mitbestimmen (vgl. Bandura 1997, 37). Die Subjektivität der Beurteilung eigener Selbstwirksamkeit begründet sich unter anderem in der selektiven Wahl von Informationen, die der Mensch für die Beurteilung überhaupt heranzieht. So können zwei Personen mit einer identischen Leistung unter scheinbar gleichen Rahmenbedingungen jeweils zu den unterschiedlichen Ergebnissen Erfolg und Misserfolg kommen, da sie beispielsweise unterschiedliche Informationen für die Definition von Erfolg heranziehen (Bezugsnormorientierung) oder unterschiedliche Ursachen als zentral für den Ausgang der Situation betrachten (Attributionsstil) (vgl. Rheinberg 2008, 88f.; Seligman 2006, 31ff.). Diese kognitiven Prozesse sind eher unbewusst und für den Menschen zunächst schwer zu kontrollieren (vgl. Arnold 1985, 33). Auf sie soll im Folgenden (1.2 und 1. 3) ausführlich eingegangen werden.
Macht eine Person nun in ähnlichen Verhaltensbereichen die gleichen Selbstwirksamkeitserfahrungen, kann sie zu einer generalisierten Selbstwirksamkeitserwartung gelangen. Diese Erwartung überträgt sich dann auf andere ähnliche Bereiche, in denen noch keine eigene Erfahrung gemacht wurde (vgl. Bandura 1997, 50f.). Wie leicht vorstellbar, wirkt sich eine hohe generalisierte Selbstwirksamkeitserwartung sehr positiv auf das Selbstbewusstsein und Selbstkonzept einer Person aus. Werden jedoch geringe Selbstwirksamkeitserwartungen generalisiert, kann dies Depressionen und Ängste begünstigen (vgl. Bandura 1997, 39).
Die menschliche Tendenz, Selbstwirksamkeitserwartungen zu generalisieren, darf aber nicht zu dem Schluss führen, dass diese stets vorhersehbar und kalkulierbar seien. So betont gerade Bandura die Spezifität von Selbstwirksamkeitserwartungen (Bandura 1997, 42f.). In einem Experiment von Cervone und Peake konnte gezeigt werden, wie leicht sich Selbstkonzepterwartungen durch situative Faktoren beeinflussen lassen. Hier wurden Testpersonen gebeten, bezüglich einer Testaufgabe zu beurteilen, ob sie mehr oder weniger als Anzahl X der Aufgaben lösen könnten. Je nach willkürlich von der Testleitung vorgegebener Zahl X (z.B. 3 von 10 Aufgaben oder 9 von 10 Aufgaben) neigten die Testpersonen dazu, sich in ihrer Selbstwirksamkeitserwartung diesem Wert anzunähern. Testpersonen, die einer hohen Vergleichszahl X ausgesetzt wurden, zeigten eine entsprechend höhere, diejenigen mit einer niedrigen Vergleichszahl X eine niedrigere Selbstwirksamkeitserwartung (vgl. Cervone/Peake 1986, 492ff.). Darüber hinaus konnte dieser Test zeigen, dass entsprechend der Selbstwirksamkeitserwartungen (niedrig/hoch) auch beim Bearbeiten der Testaufgaben die Ausdauerbereitschaft entsprechend (niedrig/hoch) ausfiel (vgl. Cervone/Peake 1986, 492ff.). Dass die Selbstwirksamkeitserwartung bisweilen sogar ein besseres Prognosemittel für zukünftige Leistungen sein kann als die bisherige Leistung, konnte unter anderem in einem Versuch von Gould, Jackson und Weinberg gezeigt werden. In einem sportlichen Wettkampf zwischen Männern und Frauen wurden die Selbstwirksamkeitserwartungen der TeilnehmerInnen manipuliert, indem ihnen Informationen über die Leistungsfähigkeit (hoch/niedrig) der GegnerInnen vermittelt wurden. Die jeweils motivierenden oder einschüchternden Informationen beeinflussten die Selbstwirksamkeit der Testpersonen so sehr, dass die ursprünglich großen Geschlechtsunterschiede hinsichtlich körperlicher Kraft nicht mehr feststellbar waren (vgl. Gould/Jackson/Weinberg 1979, 320ff.).
Wie lässt sich die Selbstwirksamkeitserwartung nun in das Modell zur impliziten Fähigkeitstheorie von Dweck und Leggett (Abb.1) einordnen? Zunächst scheinen sich die Konstrukte nicht zu widersprechen. Geht eine Person von der generellen Veränderbarkeit von Fähigkeiten aus (Modifzierbarkeitstheorie) schließt dies den Gedanken ein, Fähigkeiten steigern zu können, also selbstwirksam Situationen beeinflussen zu können. Demnach kann die Person unabhängig von der Höhe des Selbstkonzepts bewältigend auf einen Misserfolg reagieren, da sie von diesem Misserfolg nicht auf weitere Misserfolge schließt. Die Annahme von festgelegten Fähigkeiten (Entitätstheorie) in Kombination mit einem niedrigen Fähigkeitsselbstkonzept führt zu einem geringen Glauben an die eigene Selbstwirksamkeit und daher zu einem hilflosen Verhalten bei Misserfolg (vgl. Dresel/Schloz 2011, 83). Andererseits postulieren Dweck und Leggett, dass eine verinnerlichte Entitätstheorie in Kombination mit einem hohen Fähigkeitsselbstkonzept auch bei Misserfolgen zu bewältigendem Verhalten führt (vgl. Abb. 1). Diese Bewältigung müsste aber voraussetzen, dass der Misserfolg nicht durch die Fähigkeiten begründet wird, da diese als hoch eingestuft werden. Nach diesem Verständnis müssten andere Umstände als die eigene Fähigkeit für den Misserfolg verantwortlich gemacht werden. Dies vermittelt der Person aber das Gefühl, keinen großen Einfluss auf die Geschehnisse zu haben, was gleich zu setzen ist mit einer geringen Selbstwirksamkeit. Dieser Mechanismus kann in seiner Konsequenz, also dem weiteren Verhalten der Person, zu einer Schwächung des Fähigkeitsselbstkonzepts führen. Dweck und Leggetts Annahme, dass eine implizite Entitätstheorie in Kombination mit einem hohen Fähigkeitsselbstkonzept bei Misserfolgen in jedem Fall zu einem bewältigenden Verhalten führt, muss diskutiert werden (vgl. Freiberger/Spinath 2011, 113f.).
Insgesamt werden im Kontext der Selbstwirksamkeitserwartung die Vorteile einer verinnerlichten Modifizierbarkeitstheorie für die Entwicklung des Fähigkeitsselbstkonzepts deutlich. Im Gegensatz zur Entitätstheorie beinhaltet sie die Annahme der Kontrollierbarkeit und Steigerungsfähigkeit der eigenen Fähigkeiten und führt hierbei zu Ausdauerbereitschaft und hoher Selbstwirksamkeitserwartung (vgl. Dresel/Schloz 2011, 83).
1.2 Attributionsstil
Wie oben bereits erwähnt, ist bei der Selbstkonzeptbildung auch von Bedeutung, welche Ursachen eine Person als ausschlaggebend für Erfolge oder Misserfolge betrachtet. Es sind die Attributionstheorien, die sich mit den menschlichen Kausalerklärungen für Geschehnisse beschäftigten. Fritz Heider, der Begründer dieser psychologischen Denkrichtung, konnte zeigen, dass Menschen als naive Psychologen dazu neigen, Erklärungen für Geschehnisse heran zu ziehen (vgl. Heider 1958, 15). Diese Erklärungen fallen jedoch, je nach Person, sehr unterschiedlich aus und differieren darin, ob die Ursache eher in der eigenen Person oder in den äußeren Umständen gesehen wird (internale oder externale Kontrollorientierung). Weiter wird differenziert, ob die Person eher daran glaubt, dass diese Ursache dauerhaft Situationen bestimmt oder eher veränderbar sei (stabil oder variabel). Dabei eignen sich Menschen in ihrer Entwicklung die Tendenz zu bestimmten Attributionsstilen an, also dauerhaft gleiche Ursachentypen als entscheidend zu betrachten (vgl. Heider 1958, 15ff.). Die folgende Abbildung nach Gerrig und Zimbardo soll am Beispiel einer Prüfungssituation verdeutlichen, welche Ursachentypen, je nach Attributionsstil bei Erfolg oder Misserfolg herangezogen werden können.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten.
Abbildung 2: Ursachenattributionen für Konsequenzen von Verhaltensweisen (Gerrig, Zimbardo 2008, 444)
Nach diesem Modell sieht eine Person, die den Ausgang einer Prüfungssituation internal und stabil attribuiert, die zentrale Ursache in den eigenen Fähigkeiten, wohingegen diejenige, die den Ausgang der Situation internal und variabel attribuiert, die Ursächlichkeit zentral in ihrer Anstrengung begründet sieht. Entsprechend lenkt eine externale, stabile Ursachenattribution kausal auf die Aufgabenschwierigkeit, eine externale, variable Attribution hingegen auf die Annahme von Glück. Martin Seligman beschäftigte sich in Weiterführung von Heiders Theorie vor allem mit der Frage, welche Erklärungsstile eher zu einer optimistischen oder pessimistischen Haltung führen. Er konnte zeigen, dass Menschen mit einem depressiven Attributionsstil sich Erfolge eher durch Glück, negative Ereignisse hingegen durch unzureichende Fähigkeiten erklären. Menschen mit einem optimistischen Attributionsstil neigen hingegen dazu, sich Erfolge durch ihre Fähigkeiten zu erklären und Misserfolge durch zu große Aufgabenschwierigkeit (vgl. Seligman 2006, 43ff.). Ist diese Feststellung nun nahtlos auf das Konstrukt des Fähigkeitsselbstkonzepts anwendbar und ein auf Fähigkeit zielender Attributionsstil auch hier ein besonders erstrebenswertes Selbst-Erklärungsmuster in Erfolgssituationen? Wie bei dem Modell von Dweck und Leggett zur impliziten Fähigkeitstheorie ist beim Attribuieren die Annahme der Stabilität von Fähigkeiten nicht durchweg vorteilhaft. Zwar verbindet sich die Attribution eigener Fähigkeit mit einer optimistischen Haltung in Erfolgssituationen, doch ist vor allem der Umgang mit Misserfolgen entscheidend, da sie eine besonders prägende Erfahrung darstellen (vgl. Stiensmeier-Pelster 1994, 194). Kommt die Person hier zu der gleichen Ursachenannahme, führt dies wiederum zu einem hilflosen Verhaltensmuster. Der Gedanke an stabile Fähigkeiten signalisiert, im Gegensatz zur Anstrengung, eine Determination. Entweder ist Mensch fähig oder unfähig. Innerhalb eines solchen Attributionsstils neigt eine Person dazu, Misserfolge mit Unfähigkeit in Verbindung zu bringen. Sie wird wahrscheinlich auch davon ausgehen, dass diese Unfähigkeit stabil weiterbesteht, sodass sie für zukünftige Ereignisse über geringere Motivation und Anstrengungsbereitschaft verfügt (vgl. Stiensmeier-Pelster 1994, 199). Zwar verdrängen auch Personen, die Misserfolge external attribuieren, ihre Selbstwirksamkeit, indem sie Ursachen nicht bei sich sehen. Sie vermögen damit Schamgefühl und Selbstzweifel von sich zu weisen. Der Preis dafür ist jedoch die Vermeidung von Selbstreflexion, woraus sich die Weigerung ergibt, aus eigenen Fehlern zu lernen und in zukünftigen ähnlichen Situationen optimierter zu handeln (vgl. Rheinberg 2008, 85). Um das Konstrukt der äußeren widrigen Umstände als Ursache von Misserfolgen aufrecht zu erhalten, sorgen manche Menschen im Voraus für ein Scheitern, um dieses dann durch die äußeren Umstände erklären zu können und nicht Gefahr zu laufen, sich mit dem eigenen Scheitern auseinanderzusetzen (self-handicapping). Zwar dient dies oberflächlich der Aufrechterhaltung von Selbstwert und Selbstkonzept, schränkt die Person aber ein und bewirkt letztendlich das Gegenteil (vgl. Knee/Uysal 2012, 59).
Auch hinsichtlich des Attributionsstils zeigt sich so für das Fähigkeitsselbstkonzept der Aspekt der Kontrollierbarkeit als entscheidend. Dabei gilt ein internales, variables Attribuieren als erstrebenswert, da hier auf die eigene Anstrengung fokussiert wird. Die Person behält den Spielball in den eigenen Händen und reagiert auf Misserfolge eher bewältigend (vgl. Fösterling 1994, 238).
1.3 Bezugsnormorientierung
Um ein Fähigkeitsselbstkonzept zu entwickeln, also auch die eigenen Fähigkeiten einordnen zu können, bewerten Menschen ihre Fähigkeiten und zwar ständig (vgl. Mummendey 2006, 144). Zur Bewertung der eigenen Fähigkeiten bedarf es einer Bezugsnorm, eines Maßstabs, mit dem die Fähigkeit ins Verhältnis gesetzt wird. Es findet eine Auseinandersetzung mit der Umwelt anhand von Vergleichen statt, wobei sich verschiedene Arten des Vergleichens zeigen. Verschiedene Vergleichsarten/Bezugsnormen führen zu verschiedenen Ergebnissen und ziehen damit unterschiedliche Konsequenzen für das Fähigkeitsselbstkonzept nach sich. Wie auch bei den bereits genannten kognitiven Verarbeitungsstilen neigen Menschen hier zur dauerhaften Orientierung an einer bestimmten (interindividuell unterschiedlichen) Bezugsnorm. Diese Tendenz wird, vor allem im Kontext der schulischen Fähigkeiten, als Bezugsnormorientierung gekennzeichnet. Dabei wird zwischen sozialer, individueller und sachlicher Bezugsnorm unterschieden (vgl. Rheinberg 2002, 61ff.). Leon Festinger befasste sich ausführlich mit sozialen Vergleichen, durch die Menschen Informationen über sich selbst gewinnen. Aus den Vergleichen mit unseren Mitmenschen leiten wir einen Großteil der Informationen über uns und unsere Fähigkeiten ab. Diese sozialen Vergleiche können wiederum sehr unterschiedlich ausfallen und dabei das bis dahin gültige Fähigkeitsselbstkonzept mehr oder weniger stützen (vgl. Festinger 1954, 118). Nach Festinger können drei soziale Gruppen unterschieden werden, anhand derer eine Person Vergleiche vornimmt. Die erste Gruppe ist die der Gleichgestellten, also diejenigen, die einem ähnlich sind. Wenn es gilt, zu einer aussagekräftigen Selbsteinschätzung zu gelangen, ist dies die bevorzugte Vergleichsgruppe (vgl. Festinger 1954, 120). Menschen, die einem hinsichtlich der eigenen Fähigkeit unterlegen scheinen, bilden die zweite Gruppe. Diese abwärtsgerichteten Vergleiche stützen das Selbstbewusstsein und scheinen vor allem dann attraktiv, wenn der Selbstwert bedroht ist (vgl. Fahr/Früh/Peter 2012, 163). Aufwärtsgerichtete Vergleiche bezüglich Personen, die einem in einer in Frage stehenden Fähigkeit überlegen scheinen, können insoweit nützlich sein, als dass sie Verbesserungsmöglichkeiten für das eigene Verhalten liefern. Sie spiegeln das natürliche Verlangen des Menschen zur Steigerung der eigenen Fähigkeiten wider. Andererseits können diese Vergleiche auch demotivierend und einschüchternd wirken (vgl. Festinger 1954, 124). Es zeigt sich, dass soziale Vergleiche in ihrer Vielfalt und Dynamik keine stabile Rückmeldung für das Fähigkeitsselbstkonzept bilden. Darüber hinaus können sie verunsichern und dem Fähigkeitsselbstkonzept schaden, wenn soziale Vergleiche zu der Annahme stabil ungenügender Fähigkeiten führen (vgl. Rheinberg 2002, 64).
Neben der Orientierung an der sozialen Bezugsnorm können Menschen die Beurteilung ihrer Fähigkeiten jedoch auch durch individuelle, also in der eigenen Person liegende Bezugsnormen vollziehen (vgl. Rheinberg 2002, 64f.). Hier wird die eigene Fähigkeit mit derselben Fähigkeit zu einem früheren Zeitpunkt verglichen. Diese Bezugsnorm kann eine solide Basis für die Entwicklung des Fähigkeitsselbstkonzepts abgeben. In der Auseinandersetzung mit der Veränderbarkeit eigener Fähigkeiten (Zeitpunkt A und B) verdeutlicht sich das Individuum seine Möglichkeiten zur Verbesserung durch Anstrengung und Ausdauer. Hierin lenkt es die Aufmerksamkeit auf den Prozess und nicht auf das Ergebnis und gewinnt so an Handlungsfähigkeit/Selbstwirksamkeit hinzu (vgl. Dresel /Schloz 2011, 83).
Schließlich können wir als dritte Bezugsnormorientierung den sachlichen Vergleich unterscheiden. Hier orientiert die Person sich an einem sachlichen Leistungsauftrag, zum Beispiel an den Ergebnissen einer Prüfung. Dieses Ziel kann erreicht oder nicht erreicht werden. Zwar steht der Person auch hier ein solider Orientierungsrahmen zur Verfügung, wird das Ziel jedoch nicht erreicht, werden eventuelle Lernfortschritte nicht mehr wahrgenommen. So kann auch diese Bezugsnormorientierung demotivierend wirken (vgl. Rheinberg 2002, 66ff.).
1.4 Handlungsmotivation
Um die theoretische Annäherung an sozialkognitiven Prozesse, die das Fähigkeitsselbstkonzept bilden und prägen, abzuschließen, sollen zuletzt die Handlungsmotivationen beschrieben werden, welche den Menschen überhaupt dazu veranlassen, Fähigkeiten zu entwickeln und Leistungen zu erbringen.
Die Motivation (lat. Bewegen), als Streben hin zu einem Zielzustand, ergibt sich auf grundsätzlichen Ebene aus einer Wechselbeziehung zwischen der jeweiligen Situation und den Motiven (Beweggründen), die als überdauernde Personenmerkmale relativ stabil sind (vgl. Rheinberg 2008, 13ff.). Dabei haben Menschen vorerst die allgemeine Motivation, ihre Grundbedürfnisse (Schlafen, Essen, Sexualität etc.) zu befriedigen, da sie dem Überlebenserhalt dienen und als physiologische Bedürfnisse elementar für den Menschen sind (vgl. Maslow 1943, 370ff.). Durch Instinkte, also grundlegende Verhaltenstendenzen, verhält sich schon der Säugling lebensweltangepasst, ohne dies bewusst reflektieren zu können. So lässt sich beispielsweise die unbeirrbare kindliche Motivation zum Gehen lernen erklären, auch wenn die Rückfälle noch so häufig sind und das Kind die positiven Folgen (Autonomie) des Gehen-Könnens noch gar nicht begreift (vgl. Rheinberg 2008, 21ff.).
Auf einer höheren kognitiven Ebene lassen sich nach David McClelland drei verschiedene menschliche Motive differenzieren: Das Leistungsmotiv, das Machtmotiv und das Anschlussmotiv (vgl. Weinert 2004, 194). Atkinson, Clark, Lowell und McClelland (1976, 320) konnten in Untersuchungen, bei denen Testpersonen auf der Grundlage mehrdeutiger Bilder Geschichten erzählen sollten, aufzeigen, dass sich in den Erzählungen die genannten Motivationsarten interindividuell widerspiegelten. In Bezug auf das Fähigkeitsselbstkonzept scheint vor allem das Leistungsmotiv von Interesse. Ein Kriterium für Leistungsmotiviertheit folgert aber nicht zwingend aus der geleisteten Anstrengung. So kann die Anstrengungsbereitschaft beispielsweise im Beruf auch auf einer Motivation gründen, bei der sich die Person durch eine Beförderung mehr Gehalt und Einfluss erhofft (Machtmotiv) oder nach Beliebtheit unter Kollegen strebt (Anschlussmotiv) (vgl. Weinert 2004, 194). Leistungsmotiviert im engeren psychologischen Sinne ist ein Verhalten nur dann, wenn es auf die Verbesserung und Weiterentwicklung der eigenen Leistung abzielt, und zwar um ihrer selbst willen. Das Ziel ist hier also nicht primär eine Belohnung durch äußere Reize, sondern eine intrinsische Zufriedenheit durch den Prozess des Wachstums (vgl. Rheinberg 2008, 60f.). Als „Ein-Personen-Spiel“ führt dieses Motiv eher zu einem autonomen Verhalten, während das Macht- und Anschlussmotiv immer in Abhängigkeit zu den Mitmenschen stehen (McClelland 1978, 185). In Bezug auf das Fähigkeitsselbstkonzept ist es demnach erstrebenswert, wenn sich Leistung aus einer Leistungsmotivation im genannten Sinn heraus ergibt. Verbindet sich eine so gekennzeichnete Tätigkeit mit einem günstigen Schwierigkeitsgrad, der sowohl Unter- wie Überforderung meidet, kann ein mentaler Zustand auftreten, der als Flow bezeichnet wird (vgl. Csikszentmihalyi 2010, 62). Er beschreibt das Gefühl des lustvollen Vertiefens und Aufgehens in einer Tätigkeit. In diesem Zustand erscheint die Person vollkommen der Aufgabe zugewannt und gegenüber Ablenkungen unempfindlich. Sie verliert dabei ein Gefühl für die Zeit, für Anschluss- und Machtmotive (vgl. Csikszentmihalyi 2010, 61).
Die Reflexion der bisher aufgeführten kognitiven Prozesse der impliziten Fähigkeitstheorie, der Selbstwirksamkeitserwartung, des Attributionsstils, der Bezugsnormorientierung und der Handlungsmotivation geben eine Vorstellung der Komplexität jener Umstände, die in das Fähigkeitsselbstkonzept einfließen. Sie zeigt auf, wie Kognitionen das Fähigkeitsselbstkonzept unterschiedlich beeinflussen und dabei eher hemmen oder fördern können. Die genannten kognitiven Prozesse allein können jedoch noch nicht die Entwicklung des Fähigkeitsselbstkonzepts von Grundschulkindern erklären. Denn zu den kognitiven Verarbeitungsweisen, die hier nur angeschnitten werden konnten, kommt der altersspezifische Entwicklungsstand in der mittleren Kindheit sowie die umweltbedingten Einflüsse, wobei in der vorliegenden Arbeit der Kontext Schule fokussiert wird.
2 Fähigkeitsselbstkonzepte in der Entwicklungsphase Grundschulkind
Wurde das Fähigkeitsselbstkonzept im ersten Kapitel auf einer theoretischen und damit eher abstrakten Ebene einführend behandelt, gilt es nun, dieses Konstrukt auf das Kind im Grundschulalter zu beziehen. Dabei muss der kognitive und emotionale Entwicklungsstand des Grundschulkindes Berücksichtigung finden. Die Entwicklungsphase Grundschulkind wird hier anhand Piagets kognitiver, Freuds psychosexueller sowie Eriksons psychosozialer Entwicklungstheorie behandelt. Alle drei Theorien implizieren die Annahme der Diskontinuierlichkeit von Entwicklung, also eines Wachstums in stufenweisen Entwicklungsschüben (vgl. Berk 2011, 32). Andere wichtige Entwicklungstheorien wie der Behaviorismus, die soziale Lerntheorie oder der Informationsverarbeitungsansatz gehen eher von einer fortlaufenden Entwicklung des Menschen aus (vgl. Bandura 1986, 18ff.; Klahr/MacWhinney 1998, 631ff.; Watson 1976, 40ff.). In neuen Theorien wiederum wird die Ansicht vertreten, dass Entwicklung sowohl kontinuierliche als auch diskontinuierliche Elemente beinhaltet (vgl. Bronfenbrenner/Morris 2006, 297ff.; Vygotskij 2002, 387ff.). Dennoch werden die genannten drei Klassiker der Entwicklungspsychologie hier vorrangig behandelt, da anhand ihrer Differenzierung in Entwicklungsphasen die Bedeutsamkeit des Grundschulalters, in seinem relativ festen Bedingungsgefüge, auch in Abgrenzung zum Vorschulalter und der sich anschließenden Adoleszenz, für das Fähigkeitsselbstkonzept besonders gut herausgearbeitet werden kann. Die Erfassung des Entwicklungstandes von Grundschulkindern in diesem Kapitel wird aufzeigen, dass die in Kapitel Eins genannten kognitiven Mechanismen schon bei Grundschulkindern sehr unterschiedlich ausfallen und das je eigene Fähigkeitsselbstkonzept demnach bereits äußerst sensibel gegenüber hemmenden und fördernden Faktoren ist.
2.1 Das Kind auf der Konkret-Operationalen Stufe nach Jean Piaget
Der Schweizer Entwicklungspsychologe Jean Piaget (1896-1980) setzte sich intensiv mit kindlichen Kognitionen auseinander. Diese erforschte er vor allem anhand der Interaktion des Kindes mit seiner Umwelt, wobei für ihn die Frage, wie sich das Weltbild von Kindern zusammensetzt und entwickelt, von besonderem Interesse war (vgl. Piaget 2004, 9). Auf dieser Grundlage erarbeitete Piaget eine Stufentheorie der geistigen Entwicklung. Er nahm an, dass die geistige Entwicklung des Menschen in einer invarianten hierarchischen Reihenfolge erfolgt (vgl. Piaget 2003, 95). Zwar wurde dieser Ansatz einer universalen diskontinuierlichen Entwicklung der Kognitionen entlang von Stufen im wissenschaftlichen Diskurs kritisiert und auch zu Teilen widerlegt, dennoch soll sich hier auf Piagets Theorie bezogen werden, da er als Vorreiter der kognitiven Entwicklungspsychologie einen wichtigen Beitrag zum Verständnis der geistigen Entwicklung von Kindern schuf. Er bietet noch heute einen guten Überblick über die Unterschiede der kindlichen Kognitionen zu verschiedenen Zeitpunkten ihrer Entwicklung (vgl. DeLoache/Eisenberg/Siegler 2008, 197f.).
Zu Piagets Grundannahme gehört, dass Menschen Informationen aus der Umwelt adaptieren, also verarbeiten, indem sie sie entweder assimilieren oder akkommodieren. Wird eine Information assimiliert, so wird sie an bereits vorhandene kognitive Schemata angepasst. Hat das Kind das Schema Nahrung entwickelt, kann es zum Beispiel eine Suppe diesem Schema zuordnen. Es hilft dem Kind die Situation einzuordnen und Nahrung als essbar zu identifizieren. Wird dem Kind nun ein sehr hartes Vollkornbrot vorgesetzt, obwohl es sehr weiche Nahrung gewohnt ist, wird sein bisheriges Schema über Nahrung in Teilen unbrauchbar. Daraufhin akkommodiert das Kind, also differenziert das Schema Nahrung in die Schemata Weiche Nahrung und Feste Nahrung. Neue Erfahrungen sind demnach notwendig, um Denkschemata zu erweitern (vgl. Piaget 1981, 41ff.).
Auf Piagets Stufenlehre bezogen, befindet sich der Säugling/das Kleinkind zunächst auf der Sensomotorischen Stufe. Es ist in seinen Kognitionen auf Sinneswahrnehmungen und motorische Systeme beschränkt. Dabei baut es im Laufe der Zeit ein Körperschema auf, durch das bereits eine Differenzierung zwischen der eigenen Person und der Umwelt möglich wird. Als Kleinkind hat es erste Selbstkategorisierungen entwickelt und kann beispielsweise seinen Namen sich selbst zuordnen (vgl. Piaget 2004, 15ff.). Im nächsten Entwicklungsschritt gelangt das Kind in der frühen Kindheit, also circa vom zweiten bis sechsten Lebensjahr, in die präoperationale Phase, eine Vorstufe operationalen Denkens4. Das Niveau selbstbezogener Kognitionen entwickelt sich hier weiter. Piaget konnte aber auch Denkfehler, die typisch für diese Entwicklungsstufe sind, aufzeigen. So ist das Weltbild des Vorschulkindes egozentrisch gefärbt, das heißt, es zeigt eine Unfähigkeit, Situationen aus einer anderen Perspektive als der eigenen zu betrachten. Da dem Kind noch kaum soziale Vergleiche möglich sind, zeigt sich seine Selbstwertung in der Regel als unrealistisch positiv, zumal es zwischen erwünschten und realen Kompetenzen noch wenig differenzieren kann (vgl. Piaget 1988, 43f.).
Weiter ist es tendenziell unfähig, die Konstanz von Dingen zu erkennen, wenn diese ihre Form verändern. Beispielsweise geht ein Vorschulkind davon aus, dass Wasser, von einem Glas in eines mit anderer Form geschüttet, sein Volumen verändert. Diesen Irrtum erklärt Piaget unter anderem durch die Zentriertheit im Denken des Kindes. Es konzentriert sich so sehr auf einen Aspekt der Situation, in dem Beispiel auf den Wasserpegel im Glas, dass es dabei andere wichtige Situationsvariablen vernachlässigt. Weiter fällt es ihm schwer, hierarchische Klassifikationen herzustellen, also Objekte in Klassen und Unterklassen einzuteilen und Klasseninklusion zu begreifen. So würde ein Vorschulkind auf die Frage Sind hier mehr Kinder oder mehr Menschen? beispielswiese mit Mehr Kinder antworten, da es die Klassifizierung Kind noch nicht zur Klasse Mensch zuordnen kann (vgl. Berk 2011, 302ff.; Piaget 2004, 105f.).
Dem Grundschulkind wird die konkret-operationale Stufe zugeordnet, wobei es die Fähigkeit zum logischen (operationalen) Denken entwickelt. Die Entwicklungsstufe ist geprägt durch größere Flexibilität und Dezentriertheit, da es dem Kind leichter fällt, sich auf mehrere Aspekte eines Problems zu konzentrieren. Seine Kognitionen werden organisierter und die Fähigkeit zur Reversibilität entwickelt sich. Das Kind kann nun einen Vorgang in Schritte aufteilen und diese wieder bis zur Ausgangssituation zurückverfolgen. Es kommt beispielsweise zu dem Ergebnis, dass sich das Volumen des Wassers (siehe oben) nicht geändert hat, da es zurückverfolgt, dass seit der Ausgangssituation kein Wasseranteil entwendet wurde (vgl. Piaget 2004, 97ff.). Kinder dieser Altersstufe setzen sich oft intensiv mit hierarchischen Klassifizierungen auseinander, indem sie etwa Fußballsticker und Spielzeugarten sammeln (vgl. Berk 2011, 402). Das Kind löst sich aus seinem egozentrischen Weltbild und weitet seine Fähigkeit zur Empathie aus (vgl. Piaget 2004, 122ff.).
Die Kennzeichnung dieser Phase als konkret-operational weist jedoch auch auf eine Eingeschränktheit des operationalen Denkens hin. Das Kind bezieht hierbei seine Informationen aus konkret wahrnehmbaren Situationen und bearbeitet eine Aufgabe Schritt für Schritt. Zur Lösung hypothetischer Aufgaben wie In Glas A ist mehr Wasser als in Glas B und in Glas B mehr als in Glas C. In welchem Glas ist am meisten Wasser? reichen die kognitiven Fähigkeiten derweil noch nicht. Hierfür wäre die Fähigkeit einer gleichzeitigen mentalen Bearbeitung von Informationen von Nöten (vgl. Berk 2011, 403). Gleichwohl haben die neu erworbenen kognitiven Fähigkeiten eine immense Auswirkung auf das kindliche Selbstkonzept.
Indem das Grundschulkind die Konstanz von Objekten begreift, entwickelt es nun auch ein Verständnis für die Konstanz des eigenen Körpers und weiterer personenbezogener Merkmale. Galt ihm vorher beispielsweise die Zugehörigkeit zu einem Geschlecht noch durch Kleidung, Frisur oder Stimme als veränderbar, erkennt es nun, dass es ein Leben lang einem Geschlecht zugeordnet bleibt (vgl. Kohlberg 1974, 459). Durch die unveränderbare Zuordnung zu einer Kategorie, wie Geschlecht, Aussehen, Religion oder Behinderung, findet eine starke Identifizierung mit diesbezüglichen Aspekten der Persönlichkeit statt. Sie werden zum unverrückbaren Teil des Selbstkonzepts. Diese festlegende Zuordnung zu einer Eigenschaft ist nach Lawrence Kohlberg Voraussetzung für merkmalstypische Einstellungs- und Verhaltensmuster. Sobald das Kind sich stabil einem Merkmal entsprechend kategorisiert, wird es dazu tendieren, jenes positiv zu bewerten, das es mit diesem Selbstkonzept assoziiert. Das Kind versucht sich aspekt-konforme Eigenschaften, Merkmale und Verhaltensweisen anzueignen. Die Wahl der Leistungshandlungen und die Konzeptbildung von Fähigkeiten können hierbei dem Wunsch unterliegen, ein bestimmtes Selbstkonzept auszubilden, beispielsweise typisch weiblich oder typisch männlich zu sein. Ab dem achten Lebensjahr wird die Starrheit dieser Selbstkategorisierung jedoch wieder flexibler (vgl. Kohlberg 1974, 373ff.). Indem das Kind seinen Egozentrismus verliert, wird es empfänglicher für die Sichtweisen seiner Mitmenschen. Durch die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme wird das Kind sensibel für die Meinungen anderer. So wird das Selbstkonzept im Grundschulalter entscheidend durch soziale Vergleiche und die soziale Integrationsfähigkeit geprägt (vgl. Piaget 2004, 122ff.).
Die kognitive Fähigkeit zur hierarchischen Klassifizierung (siehe oben), also Unterklassen von Charakteristika bilden und zuordnen zu können, ermöglicht es dem Kind, sich differenzierte Persönlichkeitseigenschaften zuzuschreiben, indem einzelne untergeordnete Merkmale zu übergeordneten Eigenschaften zusammengefasst werden. So ist das Grundschulkind nun in der Lage, komplexe Äußerungen über sich treffen, zum Beispiel sich als fleißig, hilfsbereit oder neugierig zu kategorisieren. Das Bewusstsein einzelner Fähigkeiten geht so in ein differenziertes Fähigkeitsselbstkonzept ein. Weiter ermöglicht die hierarchische Klassifizierung ein differenzierteres Selbstkonzept bezüglich vermeintlicher Wiedersprüche. Neigt das Vorschulkind noch sehr zum Alles-oder-Nichts-Denken, kann das Grundschulkind widersprüchliche Aspekte der Selbstwahrnehmung besser verarbeiten und annehmen. So ist es beispielsweise in der Lage, die Feststellung zu treffen, dass es im Deutschunterricht insgesamt sehr gute Leistungen zeigt, mit der Groß- und Kleinschreibung jedoch noch Probleme hat (vgl. Piaget 2004, 105f.).
Das Grundschulkind beginnt eine Vorstellung von geistigen Aktivitäten zu entwickeln, auf die es aktiv Einfluss nehmen kann. So ist ihm bewusst, dass die Lösung einer schwierigen Aufgabe Aufmerksamkeit erfordert und es unter Aufbietung von Anstrengung und Konzentration erfolgreich sein kann. Das Kind kann damit die investierte Anstrengung als Erklärung für die eigene Leistung heranziehen (vgl. Bigi/Miller 1979, 235ff.).
2.2 Das Kind in der Latenzphase nach Sigmund Freud
Auch Sigmund Freud (1856-1939), Begründer der Psychoanalyse, ging davon aus, dass das Kind eine Reihe von Entwicklungsphasen durchläuft, wobei seine Aufmerksamkeit hier nicht den kognitiven Veränderungen galt, sondern den phasentypischen psychosexuellen Konflikten, die sich aus der Diskrepanz zwischen inneren libidinösen Triebregungen und Anforderungen der Außenwelt ergeben (vgl. Freud 1905, 103ff.). Die Überwindung dieser Konflikte ist nach Freud die Grundvoraussetzung einer gesunden psychischen Entwicklung. Damit betrachtet er die Kindheit als entscheidend für die weitere Entwicklung der Persönlichkeit des Menschen. Er ging davon aus, dass spätere Neurosen auf unverarbeitete Konflikte in der psychosexuellen Entwicklung des Kindes zurückzuführen sind sowie menschliches Handeln generell einer psychischen Determiniertheit, also Ursächlichkeit, unterliegt (vgl. Freud 1905, 83). Die Beeinflussung des Handelns durch innere psychische Prozesse ist für den Betroffenen selbst jedoch zunächst nicht nachvollziehbar, da diese unbewusst, dem Menschen nicht direkt zugänglich, ablaufen (vgl. Freud 1923, 283ff.). Freud ging von einer dreiteiligen psychischen Struktur des erwachsenen Menschen, gegliedert in Es, Ich und Über-Ich, aus (vgl. Freud 1923, 288ff./296ff.). Die psychischen Instanzen bilden sich dabei zu verschiedenen Zeitpunkten der kindlichen Ontogenese.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten.
Abbildung 3: Herausbildung des psychischen Apparats nach Freud (Tillmann 2010, 78)
Die Psyche des Säuglings ist geprägt durch das Es, dem Ursprung der Triebe. In seinem Triebdrang folgt das Es dem Lustprinzip und strebt nach sofortiger Befriedigung seiner Bedürfnisse (vgl. Freud 1953, 10f.). In Auseinandersetzung mit der Außenwelt entwickelt die kindliche Psyche in den ersten Lebensjahren das Ich. In der zunehmenden Berücksichtigung des Realitätsprinzips versucht es, den Triebdrang des Es mit den Erfordernissen der Umwelt zu vereinbaren, wobei Ich-Funktionen wie Denken, Gedächtnis und Wahrnehmung eingesetzt werden. Nach Freuds psychosexueller Phasentheorie bildet sich daraufhin das Über-Ich im Überwindungsmoment der ödipalen Phase5 und führt schließlich in die Latenzphase (circa ab 6. Lebensjahr) (vgl. Freud 1953. 10f.). Die ödipale Phase, beziehungsweise der ödipale Konflikt, wird bei gesunder Entwicklung durch die Identifikation mit dem gleichgeschlechtlichen Elternteil und der Umwandlung des libidinösen Begehrens des gegengeschlechtlichen Elternteils in Zuneigung überwunden (vgl. Laplanche/Pontalis 1973, 351). In diesem Prozess verinnerlicht das Kind die Werte und Normen der Eltern, beziehungsweise der Gesellschaft (vgl. Freud 1925, 265). Das Ich versucht fortan, zwischen den beiden Instanzen Es und Über-Ich unter Berücksichtigung der Anforderungen durch die Außenwelt zu vermitteln. Dem Ich kommt somit die Rolle der ausführenden Instanz zu (vgl. Freud 1953, 8). Während die anderen psychosexuellen Entwicklungsphasen des Kindes durch die libidinöse Fixierung auf eine bestimmte erogene Körperzone geprägt sind, zeigt sich in der Latenzphase unter Dominanz des Über-Ichs die Besonderheit, dass die libidinöse Energie nicht auf einen bestimmten Körperteil bezogen ist, sondern zu anderen, höher bewerteten Tätigkeiten sublimiert, also umgewandelt wird (vgl. Laplanche/Pontalis 1973, 278). Das Über-Ich konfrontiert das Ich mit moralischen Ansprüchen, Ekel- und Schamgefühlen, sodass sexuelle Impulse abgewehrt, unterdrückt und umgewandelt werden. In der Sublimierung der libidinösen Energie hin zu höheren Tätigkeiten spielen nach Freud in der Latenzphase die freundschaftlichen Aktivitäten mit Gleichaltrigen, der Ausbau intellektueller Fähigkeiten und sinnvoller Tätigkeiten eine zentrale Rolle (vgl. Freud 1925, 265). Das Kind setzt seine Tatkraft hierbei zweckgerichtet für eine nützliche Teilhabefähigkeit im Gesellschaftsleben der Erwachsenen ein.
Freuds Annahme der Bedeutsamkeit kindlicher Sexualität für die psychische Entwicklung wurde und wird, AnhängerInnen der Psychoanalyse eingeschlossen, vielfach bezweifelt und abgelehnt, wobei die Kritik sich vor allem gegen Freuds Vorstellungen der ödipalen Phase richtet (vgl. Berk 2011, 18; Tillmann 2010, 93ff.). Unabhängig vom Diskurs zum Stellenwert der kindlichen Sexualität ermöglicht Freuds Entwicklungstheorie durch die ausführliche Entwicklungsbeschreibung von Es, Ich und Über-Ich eine besonders produktive Charakterisierung der Latenzphase. Durch die starke Präsenz des Über-Ich befindet sich das Grundschulkind nicht nur kognitiv, sondern auch emotional in einem Stadium, in dem die Auseinandersetzung mit Gleichaltrigen und den eigenen Fähigkeiten von besonderer Bedeutung sind. Das Kind zeigt sich nun stark empfänglich für wertende gesellschaftliche Anforderungen. Um diesen gerecht zu werden, strebt es danach, sein reales Selbstkonzept dem vom Über-Ich gesetzten idealen Selbst anzunähern. Im eigenen Streben nach Nützlichkeit und Normerfüllung gilt dies für das Fähigkeitsselbstkonzept im besonderen Maße (vgl. Mummendey 2006, 98ff.).
[...]
1 In der mittleren Kindheit (circa 6. bis 10. Lebensjahr) findet üblicherweise der Grundschulbesuch statt, sodass hier der Einfachheit halber von der Entwicklungsphase Grundschulkind gesprochen wird. Ein Grundschulbesuch ist als Voraussetzung für diese Entwicklungsphase prinzipiell aber nicht zwingend.
2 Der Begriff Kognition umfasst die Gesamtheit informationsverarbeitender Prozesse und Strukturen, wie Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Gedächtnis, Denken, Problemlösen oder Sprache (vgl. Hoffmeister/Kirchner/Michaelis 1998, 346f.).
3 Zwar wird das Fähigkeitsselbstkonzept folgend im Kontext der Schule behandelt, jedoch davon ausgehend, dass dieser in seinem Einfluss auch das Fähigkeitsselbstkonzept in seiner Gesamtheit und außerschulische Fähigkeitsselbstkonzepte im Einzelnen betrifft.
4 Operationales, beziehungsweise logisches Denken bedeutet die Fähigkeit, mentale Aktionen durchführen zu können, die logischen Regeln folgen (vgl. Berk 2011, 304).
5 In der ödipalen Phase (circa 3-6 Jahre) wird das kindliche Genital zum Zentrum der Libido. Nach Freud kommt es hier zum Ödipuskonflikt, wobei das Kind rivalisierende Gefühle bezüglich des gleichgeschlechtlichen Elternteils hegt, da es sexuelle Wünsche gegenüber dem andersgeschlechtlichen Elternteil verspürt und dieses Elternteil in seiner Begierde nicht teilen möchte (vgl. Freud 1982, 247f.).
- Arbeit zitieren
- Holle Börnsen (Autor:in), 2015, Zur Entwicklung kindlicher Fähigkeitsselbstkonzepte im Kontext der Grundschule, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/295169
Kostenlos Autor werden










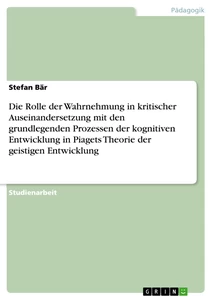








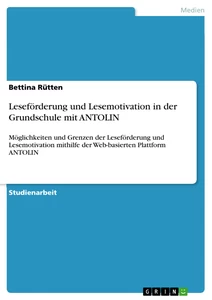


Kommentare