Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Über Diskriminierungen von männlicher Homosexualität und Fritz Morgenthalers psychoanalytisch orientierter Sicht als Beitrag zur Entpathologisierung
Vorwort
1. Einleitung
2. Zur Person von Fritz Morgenthaler und zu seinem Buch „Homosexualität, Heterosexualität, Perversionen“
3. Zur Definition der Begriffe
4. Über diskriminierende und ambivalente Einstellungen gegenüber Homosexualität
5. Die Neubewertung von Homosexualität als normale sexuelle Orientierung und Entwicklung durch Fritz Morgenthaler
6. Zur gegenwärtigen Debatte über die Identität von schwulen Männern
Resümee
Anlage
Literaturverzeichnis
Fußball und Männlichkeit
1. Einleitung
2. Fußball und Männlichkeit
3. Andersartigkeit im Fußball
4. Zusammenfassung
Literaturverzeichnis
Anhang
Homosexualität und Leistungssport
1. Einleitung
2. Gesellschaft und Homosexualität
3. Sport und Gesellschaft
4. Homosexualität und Leistungssport
5. Schlussbetrachtungen
6. Bildmaterial
7. Quellen
Einzelpublikationen
„Über Diskriminierungen von männlicher Homosexualität und Fritz Morgenthalers psychoanalytisch orientierter Sicht als Beitrag zur Entpathologisierung“ von Dirk Wagner
2005
Vorwort
Die vorliegende Arbeit ist die Fortentwicklung eines Seminarreferats. Sie verfolgte nicht den Anspruch auf Neuentdeckungen, Neuinterpretationen oder eine Einschätzung von Morgenthalers Rolle und Einfluss in der Psychoanalyse. Die Arbeit geht mehr in die Breite als in die Tiefe. Ihr Bestreben ist eher ein Verstehen des Modells von Morgenthaler, dessen Einordnung in den Kontext von Geschichte und Gesellschaft sowie eine kritische Auseinandersetzung damit.
Der Titel dieser Hausarbeit und der Titel des Thesenpapiers („Zu Fritz Morgenthalers Sicht auf männliche Homosexualität – ein Weg aus der psychoanalytischen Störungsperspektive“) zur Seminargestaltung im Juli 2005 unterscheiden sich voneinander. Grund dieser Änderung ist, dass dem Verfasser dieser Arbeit während des Arbeitsprozesses deutlicher wurde, dass die speziell der Psychoanalyse zugeschriebene oder unterstellte Perspektive der Störung wahrscheinlich doch nicht typisch psychoanalytisch war (vgl. Kapitel 3 und besonders 4). Sicherlich haben zahlreiche Psychoanalytiker zur Diskriminierung von Homosexuellen beigetragen und mit ihren Theorien, Homosexualität sei eine Entwicklungsstörung usw., auch anderen Stellen und Personen Ressentiments und Argumentationshilfen geliefert. Aber die Entwicklung psychoanalytischer Diskurse ist nicht losgelöst von gesellschaftlichen Debatten einzuordnen, auch wenn Freud selber sich in seinen Ansätzen weit von damals populären Meinungen und der zeitgenössischen Sexualwissenschaft entfernt und vieles neu entdeckt oder neu formuliert hat. Insgesamt gab es in der Psychoanalyse einerseits zur Homosexualität aufgeschlossene Kreise wie eben Freud und Morgenthaler und andererseits diskriminierende Kreise. Darin spiegelt sich vielleicht eine Stimmung der Gesellschaft wieder. Der Ursprung von Diskriminierung gegenüber Homosexualität ist sicher nicht der Psychoanalyse anzulasten. Ihr wäre eher anzulasten, dass sie die Stigmatisierungen nicht kritischer hinterfragt hat. Diskriminierungen gingen aus von der Kirche, der Politik, vom Staat und eben auch von Psychiatrie, Psychotherapie und Psychoanalyse.
Es war (ist) in weiten Teilen Konsens, Homosexualität zu diskriminieren, wenn manche dabei auch sicher nicht ein Bewusstsein dafür hatten (haben), dass sie diskriminieren. Es scheint heute so zu sein, dass die Schwulenbewegung (hierunter ist an dieser Stelle zu verstehen, dass homosexuelle Männer sich in verschiedenen Formen in einem emanzipatorischen Sinn offen zeigen) aufklärend bis in fast alle Teile der Bevölkerung hineingewirkt und einen Einstellungswandel bewirkt hat, auch in der Psychoanalyse.
1. Einleitung
Fritz Morgenthaler erklärte zu Beginn der 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts, Homosexualität sei wie Heterosexualität eine normale sexuelle Orientierung. „Was war daran so besonderes?“ könnte darauf mancher moderne Zeitgenosse begegnen. Um die Leistung und auch den Mut von Morgenthaler heute angemessen einschätzen und würdigen zu können, ist es ratsam, einen Blick in die deutsche Vergangenheit zu werfen: Homosexuelles Verhalten wurde im 19. Jahrhundert mit einem negativen Beigeschmack als Perversion aufgefasst, in Psychiatrien wurden im letzten Jahrhundert zahlreiche „Behandlungen“ mit dem Ziel der Transformation zur Heterosexualität durchgeführt und in der BRD waren „Homosexuelle Handlungen“ noch bis 1969 im § 175 StGB generell verboten. Gleichgeschlechtliche Küsse im Fernsehen oder Diskussionen über Elternschaften von Schwulen und Lesben waren zu Lebzeiten Morgenthalers kaum vorstellbar. Zudem arbeitete Morgenthaler psychoanalytisch, d.h. in der Therapierichtung, der z.B. Wiesendanger (der zum Thema Schwule und Lesben in der Psychotherapie arbeitet) vorwirft, sie habe Schwule und Lesben besonders pathologisiert und diskriminiert (Wiesendanger, 2001, S. 49 ff.).
Die vorliegende Arbeit setzt sich mit Morgenthalers Theorie zur Homosexualität, welche in dem Buch „Homosexualität, Heterosexualität, Perversionen“ wiedergegebenen wird, auseinander. Zunächst wird in Kapitel 2 die Person Morgenthalers vorgestellt. In Kapitel 3 werden die relevanten Begriffe definiert. Um Morgenthalers Thesen im Kontext der Zeit besser einordnen zu können, werden in Kapitel 4 Diskriminierungen gegenüber Homosexualität erörtert. Der Bereich Psychiatrie und Psychoanalyse wird dabei besonders betrachtet. In Kapitel 5 wird dargelegt und kritisch diskutiert, wie Morgenthaler die Entwicklung zur Homosexualität erklärte. In Kapitel 6 wird die anlässlich der Jahrtausend-wende von Wissenschaftlern geführte Debatte zum Stand der homosexuellen Identität reflektiert und auch in Verbindung zu Morgenthalers Modell gesetzt. Im abschließenden Kapitel 7 wird die Hausarbeit inhaltlich zusammengefasst und ein Resümee gezogen.
Es geht dabei in erster Linie um männliche Homosexualität. Grund dafür ist, neben einer Eingrenzung des Themas, dass Morgenthaler seine Erkenntnisse überwiegend durch das Studium männlicher Homosexueller gewonnen hat. Er argumentierte, dass man die Homosexualität von Frauen nicht einfach umkehren könne und diese einer besonderen Betrachtung bedürfe (Morgenthaler, 2004, S. 102). Auch die in Kapitel 6 verwendete Literatur bezieht sich dem Thema entsprechend in erster Linie auf männliche Homosexuelle.
2. Zur Person von Fritz Morgenthaler und zu seinem Buch „Homosexualität, Heterosexualität, Perversionen“
Fritz Morgenthaler hat sich in seiner psychoanalytischen Praxis mit sexuellen Fragen und besonders mit männlicher Homosexualität beschäftigt. Seine Publikationen dazu aus den Jahren 1961 – 83 sind in dem bereits erwähnten Buch 1984 erschienen und wurden von ihm zu Lebzeiten noch überarbeitet.
In der jüngeren Gegenwart fand aus Anlass des 20. Todestages von Morgenthaler eine Wiederbeschäftigung mit seiner Person und seinen Thesen statt. Zum einen wurde das in der Überschrift benannte Buch 2004 in einer Neuauflage der Ausgabe von 1994 gedruckt und findet sich in vielen Versandgeschäften aufgelistet (Literatur über Fritz Morgenthaler hat der Verfasser dieser Hausarbeit hingegen nicht gefunden). Zum anderen fand zur Erinnerung an Morgenthaler 2004 in Zürich ein Kongress des Psychoanalytischen Seminars Zürich (PSZ – das nach Eigendarstellung größte Ausbildungsinstitut für Freudsche Psychoanalyse in der Schweiz; Morgenthaler war einer der Gründer; www.psychoanalyse-zuerich.ch/) statt. Teilnehmer waren überwiegend psychoanalytisch tätige Menschen, u. a. der Sexualwissenschaftler Volkmar Sigusch, in dessen Auftrag Morgenthaler seinerzeit einen Text schrieb (vgl. Kapitel 5). Während des Kongresses „Faire travailler Morgenthaler“ (deutsch: Morgenthaler zum Arbeiten bringen) wurde Morgenthaler gewürdigt und sich mit der Aktualität seiner Erkenntnisse beschäftigt. In den Zeitungsartikeln zu dem Kongress wird inhaltlich besonders hervorgehoben, dass Morgenthaler zu Sexualität geforscht hat, dass er Homosexualität als gewöhnliche sexuelle Orientierung verstand und an die Kraft einer zu befreienden Sexualität glaubte. Gegen Ende seines Lebens habe er für sich in Anspruch genommen, dass Freudsche Sexualverständnis erweitert zu haben. (Feddersen, 2005; Binswanger, 2005).
Fritz Morgenthaler wurde lt. dem Nachwort des o. g. Buches 1919 in eine großbürgerliche Künstlerfamilie geboren, sein Vater war impressio-nistischer Maler, seine Mutter gestaltete Puppen. In Paris besuchte er die Volksschule, in Zürich ging er aufs Gymnasium und zur Universität.
1945 schloss er sein Medizinstudium ab. Morgenthaler arbeitete als Arzt und absolvierte gleichzeitig eine Ausbildung zum freudianisch geprägten Psychoanalytiker, ab 1952 führte er in dieser Funktion eine Praxis in Zürich. Mit Paul Parin und dessen Ehefrau Goldy Parin-Matthéy gründete er 1958 das Psychoanalytische Seminar Schweiz und leitete es mehrere Jahre. Morgenthaler war in vielen Instituten als Dozent der Psychoanalyse tätig, in den letzten Jahren besonders in Italien. Morgenthalers Reisen finden eine besondere Erwähnung in dem Nachwort, da sie ihn inspiriert hätten. Beruflich unternahm er mit dem Ehepaar Parin „ethnopsycho-analytische Forschungsreisen“ und auch privat unternahm er mit seiner Ehefrau Ruth viele Fernreisen auf andere Kontinente. Das Ehepaar Morgenthaler hatte gemeinsam zwei Söhne. In den letzten Jahren wandte Morgenthaler sich zunehmend der Malerei zu und hatte auch Ausstellungen seiner Aquarelle, Ölbilder und Kreidezeichnungen. 1984 starb Morgenthaler auf einer Reise in Äthiopien 65jährig an einem Herzinfarkt (Parin, 2004, S. 199 f.).
Die von Morgenthaler vertretene Auffassung zur Homosexualität war zur damaligen Zeit gewagt und keinen Konsens in der deutschen Gesellschaft oder in Psychiatrie und Psychotherapie. Man kann fragen, wie er zur Entwicklung seiner Thesen kam. Sein Kollege Parin schreibt dazu, dass Morgenthaler sich in einem Umfeld von Künstlern und relativ frei von Einschränkungen bewegt habe. Er habe auf Reisen viele Erfahrungen gesammelt und sich „mit Körper, mit Formen und Farben intensiv beschäftigt“. Parin beschreibt Morgenthaler mit Begriffen wie „unabhängig“, „frei“, „kreativ“, „vorurteilslos“, er habe ein Lebensgefühl gehabt, „das ihm den Zugang zum Sexuellen in jeder Form ermöglicht“ (Parin, 2004, S. 204 f.). Parins Formulierung legt die Frage nahe, was damit genauer gemeint sein könnte. Ist es ein Hinweis darauf, dass Morgenthaler neben dem beruflichen Kontext auch privat einen besonderen Zugang zum Thema Homosexualität hatte? Auf dem erwähnten Kongress zu Morgenthaler berichteten Teilnehmer/innen über jüngere Männer, „die im privat-homosexuellen Leben des Fritz Morgenthaler größere Aufmerksamkeit erhielten als dessen Ehefrau“ (Feddersen, 2005). Demnach existiert eine Debatte über Morgenthalers sexuelle Orientierung. Man kann die Frage stellen, ob Morgenthaler seine Thesen auch vor dem Hintergrund seiner eigenen Biographie formuliert hat. Es war scheinbar seine bewusste Entscheidung, die eigene sexuelle Orientierung nicht (deutlich) zu offenbaren. Zumindest wollte er nicht, dass man als Analytiker in einem therapeutischen Setting zuviel darüber verrät: „Die eigene Einstellung und Ansicht zur Homosexualität soll nicht aufgedeckt werden. Damit würde man der Verführung, die in der Neugier liegt, nachgehen“ (Morgenthaler, 2004, S. 63). Bei dieser Argumentation stellt sich die Frage, ob Morgenthaler auch geschrieben hätte, dass man seine Einstellungen und Ansichten zur Heterosexualität nicht aufdecken solle.
3. Zur Definition der Begriffe
3.1. Diskriminierung
„Verstöße gegen die Gleichberechtigung werden als Diskriminierung bzw. Privilegierung bezeichnet (...) Gleichberechtigung bezeichnet die rechtliche Gleichheit verschiedener Rechtssubjekte in einem bestimmten Rechtssystem (…) Erst im zwanzigsten Jahrhundert erfolgte in Europa die Gleichberechtigung der Frau im Staat, wie sich an der Einführung des Frauenwahlrechts nachzeichnen lässt (...) Der Gleichheitsgrundsatz ist in Artikel 3 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland garantiert:
(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. (2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. (3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.“ (Wikipedia, 2005, http://de.wikipedia.org/wiki/Gleichberechtigung).
„Die Antidiskriminierungsstelle der Stadt Wien definiert Diskriminierung umfassender als am rechtlichen Aspekt: „Es gibt sehr viele im Detail unterschiedliche Definitionen von Diskriminierung. Auf den Punkt gebracht aber, ist Diskriminierung jede Form von Benachteiligung, Nichtbeachtung, Ausschluss oder Ungleichbehandlung von einzelnen Menschen oder Gruppen auf Grund ihnen angedichteter oder in einem bestimmten Zusammenhang nicht relevanter Merkmale“ (Antidiskriminierungsstelle der Stadt Wien, 2005).
In dieser Hausarbeit wird unter Diskriminierung gegenüber homosexuellen Männern verstanden, dass diese wegen ihrer sexuellen Orientierung benachteiligt, nicht beachtet, ausgeschlossen oder ungleich behandelt werden.
3.2. Homosexualität
„ Homosexualität bezeichnet eine sexuelle Orientierung, bei der romantische Liebe und sexuelles Begehren ausschließlich oder vorwiegend gegenüber Personen gleichen Geschlechts empfunden werden.“ (Wikipedia, 2005, http://de.wikipedia.org/wiki/Homosexualit%C3%A4t)
Der Begriff Homosexualität ist eine Wortneubildung aus griechisch homo (gleich, gleichartig) und lateinisch sexus (das männliche und das weibliche Geschlecht). Der Begriff wurde 1869 von dem Schriftsteller Karl Maria Kertbeny geprägt. Homosexuelle Männer werden auch Schwule bezeichnet. Der ursprünglich abwertend gebrauchte Begriff schwul wurde von der Schwulenbewegung als politischer Kampfbegriff übernommen. Damit wurde die abwertende Bedeutung zurückgedrängt, so weit, dass der Begriff heute im Sprachgebrauch der Gesetzgebung auftaucht. „In der Jugendsprache findet sich das Wort schwul dagegen immer noch beziehungsweise wieder als Schimpfwort, das als Synonym für langweilig, weichlich oder enervierend benutzt wird“ (ebd.). Zunehmend werden ab den 90er Jahren in der Homosexuellenszene auch die aus dem englischsprachigem Raum stammenden Wörter gay (fröhlich, bunt; wird oft als allein auf Männer bezogen verstanden) oder queer (seltsam, komisch; bezieht Männer, Frauen, Bisexuelle und Transgender mit ein) verwendet. In vielen nicht westlich geprägten Sprachen gibt es scheinbar keine feststehenden Begriffe für homosexuelle Personen, z.B. im Arabischen (ebd.).
Vergleicht man diese Definitionen zur Homosexualität mit solchen aus früheren Zeiten, so lässt sich feststellen, dass im 19. Jahrhundert Begriffe wie Liebe oder Romantik nicht verwendet wurden. Der Wissenschaftler Richard von Krafft-Ebing (vgl. Kapitel 3 u. 4) subsumierte 1879 noch jegliche Art der geschlechtlichen Befriedigung als pervers, die nicht der Fortpflanzung dient (Wiesendanger, 2001, S. 48). Perversion wurde als Abgrenzung zur so genannten normalen Sexualität verstanden, sie wurde unterteilt in die Hauptklassen Sadismus, Masochismus, Fetischismus und Homosexualität (Kölling, 2000, S. 7).
Von Interesse ist die Frage nach der Häufigkeit von Lesben und Schwulen. Dazu gibt es unterschiedliche Zahlen, die zwischen einem und zehn Prozent schwanken. Als Grund dafür werden abweichende Definitionen des Gegenstandes genannt. In mancher Untersuchung wird nach dem sexuellen Verhalten gefragt, in manch anderen nach dem sexuellen Erleben. Auch lassen sich die damit verbundenen Graubereiche und Tabuzonen schwer erfassen (Wikipedia, 2005, Homosexualität; Wiesendanger, 2001, S. 22 ff.). Anhand der Untersuchungen kann man aber festhalten, dass weite Teile der Bevölkerung über gleichgeschlechtliche sexuelle Erfahrungen verfügen, wenn auch mit unterschiedlicher Intensität und Dauer. Gleichzeitig bestehen in Teilen der Bevölkerung Ambivalenzen und Berührungsängste bis hin zu offener Ablehnung gegenüber Homo-sexualität.
3.3. Heterosexismus
„Heterosexismus oder auch Homophobie bezeichnet die übersteigerte Angst vor der gleichgeschlechtlichen Liebe. Als homophob werden Menschen bezeichnet, die Homosexuellen gegenüber feindlich oder aggressiv eingestellt sind (…) Der häufig verwendete Begriff ‚Homophobie’ wird mancherorts als irreführend betrachtet, da er ein klinisches Krankheitsbild suggeriert. Daher wird versucht, auf den Begriff Heterosexismus auszuweichen, der die sexuelle Diskriminierung verdeutlicht“ (Wikipedia, 2005, http://de.wikipedia.org/wiki/Heterosexismus)
Ergänzend eine Definition von Wiesendanger:
„In unserer Kultur stellt Heterosexismus eine meist unreflektierte, omnipräsente Größe gesellschaftlicher Umgangsform dar, in der von frühester Kindheit an (fast) alle Menschen aufwachsen und der sich niemand entziehen kann…Mit Recht kann behauptet werden, dass wir in einer heterosexistischen Welt leben. Dieser Heterosexismus zeigt sich in allen gesellschaftlich relevanten Bereichen: in der Familie, der Schule, der Kirche, am Arbeitsplatz, in den Medien, in Werbebotschaften, in der Wissenschaft und bleibt in den allermeisten Fällen unhinterfragt“ (Wiesendanger, 2001, S. 27).
Als Gründe für Heterosexismus werden konservative Vorstellungen von Geschlechterrollen (diese könnten demnach durch Homosexualität in Frage gestellt werden und bei Betroffenen zu einer grundlegenden Verunsicherung führen) und/oder die Verdrängung eigener homosexueller Anteile (1996 wurde in einer Untersuchung an der University of Georgia festgestellt, dass als homophob eingestufte Männer beim Betrachten pornographischer Darstellungen eines Sexualaktes zweier Männer deutliche und lang anhaltende Erektionen hatten) genannt (Wikipedia, 2005, http://de.wikipedia.org/wiki/Heterosexismus).
4. Über diskriminierende und ambivalente Einstellungen gegenüber Homosexualität
Die 1993 veröffentlichte Repräsentativumfrage des Soziologen M. Bochow über Einstellungen und Werthaltungen zu homosexuellen Männern in Deutschland hatte zum Ergebnis, dass die Bevölkerung ungefähr in drei Einstellungsgruppen aufzuteilen ist: „Ein Drittel ist antihomosexuell eingestellt, ein weiteres Drittel äußert sich ambivalent und ein anderes Drittel kann als wertneutral oder wertschätzend bezeichnet werden (Bochow, 1993). An dieser Stelle ist zu fragen, welche konkreten Auswirkungen solche antihomosexuellen oder ambivalenten Einstellungen im Alltag haben. Nach Wiesendanger haben schwule Männer ein hohes Risiko, Opfer physischer und psychischer Gewalt zu werden. Für ihn gehört dazu, dass Schwule in vielen Filmen, der belletristischen Literatur oder der Presse ignoriert oder in einem zwielichtigen Zusammenhang dargestellt werden. Im beruflichen Alltag zählt er Entlassungen, Mobbing oder Übergangenwerden bei Beförderungen sowie unter Jugendlichen das Beschimpfen oder Belachen auf den Pausenplätzen zu den konkreten Diskriminierungen. Auch müssten Pädagogen mit Anfeindungen rechnen, wenn den Eltern ihre sexuelle Orientierung bekannt wird. Wiesendanger erinnert daran, dass während des Nationalsozialismus ca. 50.000 Schwule und Lesben ermordet wurden (Wiesendanger, 2001, S. 29 ff.). Von Interesse ist die Frage, wann diese Diskriminierungen historisch entstanden sind.
4.1. Geschichtliche Wurzeln der Diskriminierungen
Dem Mittelalter von etwa 500 bis 1500 kann man gemäß Hergemöller (Prof. für mittelalterliche Geschichte an der Universität Hamburg) keine „einheitliche Terminologie des gleichgeschlechtlichen Handelns und Verhaltens“ unterstellen, weil „sich erst im 12. Jahrhundert eine lebendige Reflexion der Rechts-, Natur- und Sexualproblematik zu entwickeln beginnt“ (Hergemöller, 2000, S. 17). Gleichwohl wurde schon im 1. Jahrhundert n. Chr. in dem Römerbrief des Paulus „eine Demarkationslinie zwischen Erlaubtem und Verbotenen, zwischen Gut und Böse, zwischen Tugend und Schande gezogen“. In dieser Zweiteilung galt auf Fortpflanzung ausgerichtete Sexualität als ‚naturgemäß’, während die ihr zuwiderlaufende als ‚widernatürlich’ bezeichnet wurde (ebd., S. 18). Diese Paulus-Schrift ist aber im Kontext der damaligen Grundannahmen der Zeit zu verstehen. Die sozialen Rollen, auch die der Frauen, waren von einem Prinzip der Unterordnung gekennzeichnet. Paulus bezog seine Ansichten zur Homosexualität auf Päderastie und männliche Prostitution. Die Vorstellung einer „homosexuellen Natur“ kannte er nicht, er verdammte homosexuelle Praktiken, die durch Heterosexuelle ausgeübt werden (Davis, K.C., 1998, S. 476). Im Mittelalter verstand man unter ‚widernatürlich’ zwischenmännliche Sexualkontakte, Oral- und Analverkehr zwischen Eheleuten sowie Sexualkontakte mit Tieren. Der mittelalterliche Begriff der ‚Ketzerei`, der für Glaubenszweifel oder Irrlehre stand, wurde zunehmend auf Analverkehr und auf homosexuelle Akte jeder Art übertragen. Seit dem 13. Jahrhundert wurde auch der Begriff der „stummen Sünde“ von Theologen für gleichgeschlechtlichen Sexualverkehr verwendet, damit brauchte man das „Verwerfliche“ nicht zu verbalisieren (Hergemöller, 2000, S. 19). Die seinerzeit auch verwendete Bezeichnung ‚Sodomita’ wurzelt im Alten Testament auf der Erzählung Genesis 19. Demnach wurden die Bewohner der Stadt Sodom, die Sodomiter, durch Gott mit Feuer und Schwefel vernichtet, u. a. weil sie mit männlichen Gästen sexuell verkehrten. Dies provozierte Gott dermaßen, dass er Rache übte und Kollektivstrafen wie Kriege, Wasser, Feuer, und Erdbeben auch gegen Unschuldige veranlasste (ebd., S. 19 f.). Nach Hergemöller bestand im späten Mittelalter „zumindest in großen Städten, das Bewusstsein von der Existenz kleinerer oder größerer Sodomitergruppen“ (ebd., S. 22). Zusammenfassend lässt sich sagen, dass man bei der Suche nach Wurzeln homosexueller Diskriminierung an einer Diskussion über die Rolle der Kirche nicht umhin kommt.
1789 war es laut Hekma (Historiker, Dozent im Bereich ‚Homostudien’ an der Universität Amsterdam) die Französische Revolution, „die jenem Zeitalter ein Ende bereitete, das Sodomie in weiten Teilen Europas als Kapitalverbrechen bestrafte“ (Hekma, 2000, S. 43). Durch die Trennung von Kirche und Staat wurden auch Öffentlichkeit und Privatsphäre voneinander getrennt. Der Staat war fortan mehr für den öffentlichen Bereich verantwortlich, der Bürger für den privaten. Die Revolution versprach Freiheit, Gleichzeit und Brüderlichkeit. Zunächst waren damit aber in erster Linie (heterosexuelle) Männer gemeint, diese konnten sich besser von der Kontrolle durch Staat, Kirche und Familie lösen. Die Aufklärung eröffnete neue Möglichkeiten, der Zweck der Sexualität blieb aber zunächst weiterhin die Fortpflanzung, weniger das Vergnügen. Frauen wurde ein lustvolles Wesen aberkannt, eine negative Grundhaltung zur Sodomie wurde bewahrt, auch Onanie wurde verurteilt (ebd., S. 45 ff.). Die Aufklärung „neigte zur Rationalität und nicht zu Hamanns Sinnlichkeit, sie verfolgte eher eine männliche als weibliche Perspektive und eine Ökonomie der Knappheit statt des Überflusses“ (ebd., S. 46; Hamann war ein Vertreter der Gegenaufklärung, ebd. S. 44 ff.).
4.2. Zwei geistige Lager zur Homosexualitätstheorie im 19. Jahrhundert
Im 19. Jahrhundert bildeten sich in Deutschland zwei geistige Lager der Homosexualitätskonstruktion heraus. Eines, welches männerliebende Männer als „Urninge“ oder „drittes Geschlecht“ bezeichnete, auf der anderen Seite das der „konträren Sexualempfindung“.
Das Lager des dritten Geschlechts vertrat die Auffassung, dass der „Urning“ eine weibliche Seele habe, die in einem männlichen Körper eingeschlossen sei. Hauptvertreter dieser Darstellung waren der Jurist und Publizist Karl Heinrich Ulrichs (1825 – 1895) und der Sexualwissen-schaftler Magnus Hirschfeld (1868 – 1935). Hirschfeld vertrat u. a. die Auffassung, dass bei Menschen viele ‚sexuelle Zwischenstufen’ existieren (Hergemöller, 2000, S. 24 ff.). Obwohl die von Ullrichs und Hirschfeld vertretenen Thesen heute als überholt gelten und nicht mehr vertreten werden, sind beide als wichtigste Personen des Beginns der Homosexuellenbewegung zu verstehen (Sigusch, 2000, S. 76 ff.).
Auf der anderen Seite der Theoriebildung stehen besonders der Nervenarzt Dr. Carl Westphal (1833 -1890) und der Professor für Psychiatrie Richard von Krafft-Ebing (1840 -1902). Krafft-Ebing lehnte die Theorie eines dritten Geschlechts ab und hielt an negativ besetzten Begriffen wie „Abweichung“, „Perversion“ und „Entartung“ fest. Die Theorie zur „konträren Sexualempfindung“ basierte auf der Annahme einer Zweiteilung zwischen „angeborener“ und „erworbener“ Konträrsexualität. Die angeborene verlangte nach psychiatrischer, die erworbene nach strafrechtlicher Behandlung (Hergemöller, 2000, S. 24 ff.).
In dieser Theorie galt Homosexualität gemäß Hergemöller als „angeborene, im Gehirn lokalisierte, ärztlich zu behandelnde Entwicklungsstörung“ (ebd., S. 32). Der dazu gehörende Personenkreis wurde in dieser Theorie als krankhafte Gruppe definiert, die oft auch äußerlich erkennbar sei (S. 32 f.). Für Krafft-Ebing war die ‚perverse’ Empfindung gegenüber dem eigenen Geschlecht entscheidend und nicht der Akt (S. 32).
„Das pathologische Modell der ’konträren Sexualempfindung’ wiederum hatte nachhaltige Auswirkungen auf die künftige Psychiatrie und Psychoanalyse von Sigmund Freud bis Hans Bürger-Prinz, die trotz aller Unterschiede prinzipiell an der Dichotomie zischen ’Normalität’ und ’Abweichung’ beziehungsweise ’Inversion’ festhielten.“ (Hergemöller, 2000, S. 33).
Für Freud verlangte Sexualität nach Erklärungen, wenn sie nicht zum heterosexuellen Sexualobjekt und dem „normalen“ Sexualziel Koitus strebte. Abweichungen vom „normalen“ Sexualziel verstand Freud vorrangig als Perversionen; Abweichungen in Bezug auf das Sexualobjekt wurden eher als Variationen gedacht (Köhler, 2000, Kap. 4.2.). Direkt zur Homosexualität äußerte Freud sich in dem „Brief an eine amerikanische Mutter“, deren Sohn homosexuell war:
„Homosexualität ist gewiss kein Vorzug, aber es ist nicht etwas, dessen man sich schämen muss, kein Laster, keine Erniedrigung und kann nicht als Krankheit bezeichnet werden (...) Viele hochachtbare Personen in alten und neuern Zeiten sind Homosexuelle gewesen, unter ihnen viele der größten Männer (Plato, Michelangelo, Leonardo da Vinci et cetera). Es ist eine große Ungerechtigkeit, Homosexualität als ein Verbrechen zu verfolgen, und auch eine Grausamkeit“ (Siegmund Freud, 1935, zit. nach Wiesendanger, 2001, S. 49).
4.3. Zur Einschätzung von Homosexualität in Psychiatrie und Psychoanalyse
Nach Wiesendanger blieb Krafft-Ebings Perversionsthese „über Jahrzehnte Grundlage für das ’Verständnis’ der Homosexualität in der Psychiatrie und bewirkte (…) menschenverachtendes Denken und teilweise grausamstes Handeln gegenüber Lesben und Schwulen“ (Wiesendanger, 2001, S. 48). Gehirnoperationen, Zwangskastrationen und -sterilisationen fanden ihren Höhepunkt während der NS-Zeit, wurden aber auch schon länger vorher und noch Jahre danach praktiziert (ebd., S. 48). Auch Schulen der Freudschen Psychoanalyse pathologisierten Homosexualität. Wiesendanger nennt hier zum einen C.G. Jung (dem Kritiker eine Kollaboration mit dem NS-Staat und in der Zeit danach eine NS-Verklärung vorwerfen, vgl. Gebhard, 1997), für den Homosexualität eine psychische Unreife als Ergebnis einer ungelösten Mutterbindung darstellte, die mit einer Störung der Geschlechtsidentität einhergehe. Nach dessen Vorstellung neigte jemand umso mehr zur Untreue und Knabenverführung, je eindeutiger er homosexuell sei. Homosexuelle Männer seien „effeminiert“, was einem Mann nicht zustünde. Wiesendanger nennt Schüler von Jung wie Jacobi, Franz oder Nolte und zwei Vertreter der amerikanischen Psychoanalyse, Bieber und Socarides, die jeweils in der Homosexualität überwiegend pathologisches erkannt haben wollen (Wiesendanger, 2001., S. 49 ff.). Noch 1985 sei der Psychoanalytiker O. F. Kernberg zu der Aussage gekommen, er fände keine männliche Homosexualität ohne ausgeprägte Charakterstörung (ebd., S. 51).
Neben den Vertretern der pathologisierenden Theorien gab und gibt es Stimmen, die zu einer anderen Betrachtungsweise auffordern. Morgenthaler kritisierte, dass, nach der Psychoanalyse, Homosexualität als Folge einer „irreversiblen Störung der psychischen Entwicklung“ betrachtet werde und eine ungünstige Prognose habe (Morgenthaler, 2004, S. 96). Gemäß Morgenthaler wurde auch in der Psychoanalyse das Bedürfnis befriedigt, „das gesunde Heterosexuelle vom kranken Homosexuellen zu unterscheiden“ (ebd., S. 96). Ziel therapeutischer Behandlungen war in der Regel die Transformation vom Homo- zum Heterosexuellen:
„Die zahlreichen Aspekte, die heute in der psychoanalytischen Wissenschaft über Homosexualität diskutiert werden, enthalten fast alle eine offene oder verdeckte Forderung, auch etwas durchgreifendes gegen dieses ’Übel’ zu unternehmen“ (Morgenthaler, 2004, S. 48)
Aufgabe der Analyse sei es, Verdrängungen aufzuheben, die zu Symptomen führen, und nicht eine bestimmte Form des Liebeslebens beim homosexuellen Analysanden erzielen zu wollen (ebd, S. 49). Rauchfleisch kritisiert an der Psychoanalyse, dass sie Schwule und Lesben durch ihre sie gering schätzende Theoriebildung diskriminiere und sie auch in vielen Institutionen von der Ausbildung ausschließe (Wiesendanger, 2001, S. 52f).
Für Wiesendanger hat dieser Ausschluss zur Folge, dass schwule Psychoanalytiker nicht offen zu ihrer Orientierung stehen (können) und heterosexuelle Analytiker sich nicht mit ihnen auseinandersetzen. So könnten sich pathologisierende Theorien leichter durchsetzen und ein Kreislauf schließe sich (ebd., S. 53). Der Psychoanalytiker Kreische (Vorsitzender des psychoanalytischen „Lou Andreas-Salomé-Instituts“ in Göttingen) betont, dass Diskriminierung und Pathologisierung von Homosexualität nicht mehr „dem modernen wissenschaftlichen Verständ-nis der Psychoanalyse“ entsprächen. Er nennt die Institutionalisierung der Psychoanalyse als Grund, dass es „bei den Schülern Freuds zu einer ideologischen Einengung der Freudschen Theorien und zu einer Festschreibung der Homosexualität als Pathologie“ kam, welche „erst seit den Siebzigerjahren des vorigen Jahrhunderts und bis in die Gegenwart von einer konstruktiven Weiterentwicklung der Theorie abgelöst wurde“. Als Grund für die „Irrwege in der Geschichte der Psychoanalyse“ nennt er folgendes:
„Die Diskriminierung von Minderheiten ist meist das Ergebnis einer Angst vor Fremden, vor allem dem, was uns in uns selbst fremd ist und das wir deshalb auf andere Menschen projizieren“ (Kreische, 2005, S. 120).
Der Verhaltenstherapie (VT) beispielsweise kann man bis in die 50er Jahre schwer Diskriminierungen nachweisen, weil sie im deutschen Sprachraum faktisch nicht vertreten war, bzw. nur ihre lerntheoretischen Vorläufer. Mitte der 60er Jahre hingegen praktizierte die VT bei vielen Homosexuellen die so genannte Aversions-Therapie. Dabei sah sich der Klient bei einem Verfahren Bilder von attraktiven Männern an, sobald ein spezielles Mess-gerät eine Peniserektion anzeigte, erhielt der Klient einen unangenehmen Elektroschock am Arm (Wiesendanger, 2001, S. 55). Diese Therapie hatte oft zur Folge, dass die Behandelten jegliche Lust auf Sexualität verloren. Von den heute gängigen psychotherapeutischen Methoden war die Psychoanalyse zu diesem Zeitraum die am weitesten verbreitete Richtung, eine kritische Auseinandersetzung mit ihrer Vergangenheit ist somit eher möglich als bei anderen psycho-therapeutischen Richtungen.
Wiesendanger kritisiert, dass man nahezu allen psychotherapeutischen Schulen vorwerfen könne, von einigen Protagonisten abgesehen, dass sie Schwulen und Lesben nur geringe Beachtung schenken. Ihm ist nur der Ansatz der prozessorientierten Psychologie bekannt, dessen Vertreter A. Mindell speziell Homophobie neben Rassismus als eines der zentralen Probleme im sozialen Umgang beschreibt. Danach ist nicht der gleichgeschlechtlich Empfindende oder der Mensch mit einer anderen Hautfarbe krank, sondern der Umgang mit der stigmatisierten Gruppe. In dieser Prozessarbeit erhalten die Diskriminierten in der Bewusstheit erlittener Diskriminierungen eine besondere Wertschätzung (Wiesen-danger, 2001, S. 58). Den Stand der wissenschaftlichen Ausein-andersetzung könne man so zusammenfassen, dass „eindeutig ein Trend zur Entpathologisierung von Homosexualität zu beobachten“ ist, „allerdings gibt es nach wie vor Fachleute verschiedener Ausrichtungen, die in Lesben und Schwulen psychisch kranke Menschen sehen, die es zu heilen gilt“ (ebd., S. 60).
5. Die Neubewertung von Homosexualität als normale sexuelle Orientierung und Entwicklung durch Fritz Morgenthaler
Zunächst wird in diesem Kapitel ein kurzer Einstieg ins Thema gegeben und zwei wesentliche Arbeiten von Morgenthaler für das Thema der Hausarbeit werden vorgestellt. Morgenthalers Sicht zur Entwicklung von Homosexualität wird in den Kapiteln 5.1. bis 5.4. paraphrasiert. In Kapitel 5.5. wird dieses Modell kritisch und distanziert diskutiert.
Morgenthaler verstand seine Arbeit als Grundlage einer neuen Sexualtheorie und als Erweiterung der Sexualtheorie von Freud („Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie“) (Parin, 2004, S. 199 ff.). Morgenthalers Mitarbeiter Parin schreibt, Freud habe „die sexuelle Entwicklung der Kindheit entdeckt und die bisexuelle Anlage des Menschen erkannt. Von der Anerkennung der Homosexualität und anderer Formen der Sexualität als gleichwertige, gültige Möglichkeiten (…) hat nicht nur der Entdecker der Psychologie des Unbewussten, sondern haben auch die meisten Nachfolger Freuds halt gemacht“ (Ebd., 1993, S. 204)
Morgenthaler hat sich in seinen Analysen männlicher Homosexueller besonders mit den wechselseitigen Gefühlen zwischen Analytiker und Analysanden beschäftigt und darauf aufbauend sein Modell entwickelt. Nach diesem gibt es gleichermaßen eine normale Entwicklung zur Heterosexualität wie zur Homosexualität, bei der zuletzt genannten kommt der autoerotischen Triebentwicklung eine besondere Bedeutung zu. Kommt es zu neurotischen Störungen, so gilt in beiden Fällen, dass sie im Zusammenhang mit den Entwicklungsphasen zu verstehen sind (S. 201 f.).
„Psychoanalytische Technik bei der Behandlung neurotischer Homosexueller“
In diesem 1961/62 veröffentlichten Text reflektierte Morgenthaler u. a. über die Rolle und die Empfindungen des Psychoanalytikers bei einer Analyse Homosexueller. Demnach weiß ein selbst gründlich analysierter Analytiker:
„an welchen Stellen seiner Entwicklung die homosexuellen Tendenzen und Neigungen nicht wegzudenken sind, weil sie als Brücke dazu dienten, mit seinen gleichgeschlechtlichen Freunden, Verwandten und Kollegen auszukommen“ (Morgenthaler, 2004, S. 48)
Die „feindliche“ öffentliche Meinung beeinflusse die psychoanalytische Arbeit mit Homosexuellen. „Nachdem weder Gesetz noch Strafe, weder Erziehung noch Glauben diesen Ausdruck ‚menschlicher Lasterhaftigkeit’ wirksam entgegentreten konnten“, habe nun die Psychoanalyse „den Kampf im Dienste der Gesellschaft“ aufgenommen (ebd., S. 48). Der „Heilungswunsch“ des Psychoanalytikers im Bezug zum Homosexuellen habe auch damit zu tun, dass der Analytiker sich „durch Reaktivierung eigener homosexueller Tendenzen bedroht“ fühle (S. 49). Für Morgenthaler war es eine „eigenartige Tatsache“, dass der Analytiker mit heterosexuell gefärbten Übertragungen „viel leichter fertig wird“ (S. 49).
Morgenthaler setzt sich in diesem Text weiter mit der psychoanalytischen Theorie zur Homosexualität kritisch auseinander: „Bekanntlich leitete die Psychoanalyse die Entstehung der Homosexualität vom Ödipus-Komplex ab. Dabei hat sie aber nie zwischen neurotischer Homosexualität und einer nicht-neurotischen Entwicklung zur Homosexualität unterschieden“ (S. 51). Während viele Aussagen der Psychoanalyse Homosexualität als psychopathologisch einstuften, entwarf er ein Modell, wonach es sowohl eine nicht-neurotische als auch eine neurotische Entwicklung zur Homosexualität gibt. Er erklärte hier, wie sich durch eine ödipale Problematik eine neurotische Homosexualität entwickeln kann, nämlich indem sich der neurotische Homosexuelle mit einer Bindung an seine Mutter identifiziert (S. 51). Darauf soll hier aber nicht näher eingegangen werden. Thema ist eher sein Modell, wie sich „unneurotische Homosexualität“ im Gegensatz zur Heterosexualität entwickelt. Darauf geht Morgenthaler in diesem Text aber noch nicht ein. Er beschreibt hier hingegen näher seine Interpretation der Geschlechtsrolle Homosexueller, die in Kapitel 5.4. vorgestellt wird.
„Homosexualität“
Dies ist Morgenthalers bedeutendster Text zum Thema gleich-geschlechtlicher Liebe. Die 1980 veröffentliche Arbeit schrieb er im Auftrag von Volkmar Sigusch für einen Sammelband zur Therapie sexueller Störungen. Eine vereinfachte Fassung des Textes wurde 1979 in der „Neuen Zürcher Zeitung“ und 1980 in der „Berliner Schwulenzeitung“ veröffentlicht, was laut Parin zu einem großen Echo in der Schwulenbewegung und einer Diskussion zwischen dieser und Morgenthaler führte (Parin, 2004, S. 197).
Morgenthaler entwickelte in diesem Text seine Theorie des Zusammenhangs von Heterosexualität und dem Bedürfnis nach Identität sowie von Homosexualität und dem Bedürfnis nach Autonomie. Er formuliert die These einer prinzipiell möglichen nicht-neurotischen, nicht pathologischen Entwicklung zur Homosexualität (ebd., S. 197). Die Erfahrung der Menschen aller Kulturen zeige, „dass Homosexualität eine der Möglichkeiten ist, wie sich normalerweise menschliches Sexualleben ausformt“ (Morgenthaler, 2004, S. 86). Er stellt seine These vor, wonach es bei der Entwicklung zur Homosexualität drei typische Stationen gebe, an denen die Weichen gestellt würden.
„Diese Stationen sind keine Engpässe in der Entwicklung, wo unüberbrückbare Konflikte Fixierungen hinterlassen, die im späteren Leben regressive Prozesse einleiten und zur Neurose führen“ (ebd., S. 86)
Vielmehr ging er davon aus, dass die Störfaktoren, die zu einer Schädigung führen könnten, auf den nächsten Entwicklungsstufen soweit reduziert werden, dass keine Schädigung erfolgt. Es handelt sich demnach bei den Weichenstellungen um progressive Dispositionen, die eine Umorientierung bewirken.
5.1. Zu den Vorgängen in der frühen Kindheit
Wenn das Kleinkind beginnt, sich mehr und mehr als selbständiges Wesen zu begreifen, bildet sich die Selbstrepräsentanz, das innere Bild der eigenen Person, heraus. Dabei entwickelt sich sowohl ein Bedürfnis nach Identität (zu wissen, wer man ist) als auch nach Autonomie (selbständig entscheiden und handeln können). Je nach Belastung kann entweder das Bedürfnis nach Identität oder das nach Autonomie in den Vordergrund treten. Wenn ein Kleinkind mit Leistungsansprüchen überfordert wird, wird sich sein Bedürfnis nach Identität stärker entwickeln, weil die Überforderungen bereits zu viel Selbständigkeit verlangen. Ist das Kleinkind hingegen einem stark kontrollierendem Einfluss ausgesetzt, steht sein Bedürfnis nach Autonomie im Vordergrund (Morgenthaler, 2004, S. 87). In dieser Phase spielt die Beziehung zum eigenen Körper eine wichtige Rolle. Bei der Identitätsentwicklung spielt die Körperbeherrschung, bei der Entwicklung der autonomen Funktion spielt die Entdeckung lustbetonter Körpergefühle eine besondere Rolle. Wenn das Kleinkind onaniert, experimentiert es damit, sich unabhängig von der Mutter Befriedigung zu schaffen, spätere autonome Funktionen des Ich werden vorausgeplant (ebd.).
Die erste Weichenstellung zur Homosexualität folgt durch die Betonung des Bedürfnisses nach Autonomie. Dieses Bedürfnis wird in der frühen Kindheit durch eine Überbesetzung autoerotischer Aktivitäten befriedigt.
„Diese Weichenstellung hat zur Folge, dass fortan Insuffizienz-erscheinungen im seelischen Gleichgewicht durch einen Autonomie-zuwachs im Selbstgefühl ausgeglichen werden“ (S. 88)
Dies kann nur so lange durch verstärkte autoerotische Aktivitäten erfolgen, wie sich die Regulation des seelischen Gleichgewichts durch ein diffuses, affektives Wohlbefinden steuern lässt. Im weiteren Verlauf der Entwicklung werden dann höhere, nicht sexuelle Stufen der Regulation erforderlich, die autonomen Funktionen ziehen ihre Quellen nicht mehr aus der Autoerotik. Bei der Entwicklung zur Homosexualität bleiben alle Aktivitäten innerhalb des sozialen Lebens von den autonomen Funktionen der Persönlichkeit abhängig. Bei Homosexuellen bleibt als Erbe dieser ersten Weichenstellung die enge Beziehung zwischen Autoerotik und Autonomiestreben dauerhaft erhalten. „Die Neugier richtet sich auf das, was man mit sich selbst oder mit anderen, die einem gleichen, erleben kann“ (S. 88).
Demgegenüber räumen Heterosexuelle in ihrem Selbstbild dem Identitätsbewusstsein und -gefühl Priorität ein.
„Sie orientieren sich nach polaren Gegensatzpaaren, um genau zu spüren und zu wissen, wer sie sind“ (S. 89)
Homosexuelle haben das Bedürfnis nach Identität auch, doch erst in zweiter Linie, ohne dass sie dadurch verunsichert werden. Heterosexuelle besetzen auch ihre Autonomie, doch nicht soweit, dass ihre Identität dadurch in Frage gestellt wird (S. 87 ff.). Heterosexuelle können sich gelassener in Abhängigkeit begeben, in dieser Hinsicht sind sie weniger konfliktanfällig (S. 88 f.).
„Die Vorgänge, die bei der ersten Weichenstellung eingeleitet werden, sind unbewusst, und werden mit der Ausbildung der Selbstrepräsentanzen in der frühen Kindheit integriert“ (S. 94)
5.2. Zu den Vorgängen in der Zeit des ödipalen Konflikts
Im Alter von drei bis fünf Jahren ist die Triebentwicklung des Kindes soweit fortgeschritten, dass es Liebeswünsche nach außen richtet. Außer der geliebten Person wird jede andere als störend empfunden, was zum ödipalen Konflikt führt. Das Liebes- und Sexualleben wird durch die darin gemachten Erfahrungen nachhaltig geprägt. Das Kind entwickelt seine erste Liebesbeziehung in der ödipalen Phase gewöhnlich gegenüber einer der beiden Elternfiguren. In der Regel ist es für den Knaben die Mutter, für das Mädchen der Vater. Dies würde sich auch nicht ändern, wenn die Eltern homosexuell wären, „weil die Eltern eigentlich nie direkt sexuell, sondern immer zielgehemmt reagieren“ (S. 89). Auf dem Höhepunkt des ödipalen Konflikts entdeckt das Kind durch die Sexualneugier die Merkmale und Unterschiede der Geschlechter. Diese werden im Zusammenhang mit erotischen Gefühlen gegenüber dem ödipalen Liebespartner gebracht. Die Art der Verknüpfung der Geschlechtsrollen und der biologischen Geschlechtsmerkmale bestimmt später im Erwachsenenalter die Sexualorganisation der Frau und des Mannes.
Bei der Entwicklung zur Heterosexualität werden die Geschlechtsrollen und die biologischen Geschlechtsmerkmale als etwas Zusammengehöriges erlebt. Diese Übereinstimmung fördert „die Vorstellung eines polaren Gegensatzes zwischen Mann und Frau und stärkt die eigene sexuelle Identität, die in der Struktur der Selbstrepräsentanzen Heterosexueller an erster Stelle steht“ (S. 90).
Bei der Entwicklung zur Homosexualität folgen die Liebeswünsche der vorgebildeten Tendenz, das Interesse auf die eigene Person oder andere, die ihr ähnlich sind, zu richten. Der Knabe liebt die Mutter und erlebt sie als Person, die ihm gleicht. Das Fremde wird beim Knaben in der störenden Vaterfigur erlebt. Die Angst, diesem Rivalen zu unterliegen, stellt beim Kind die Kastrationsangst dar. Mit der Entdeckung der Geschlechts-merkmale entdeckt der Knabe, dass der gefürchtete Vater ihm diesbezüglich gleicht und dieser kommt dann als autoerotischer Partner in Betracht. Beim Knaben lässt dadurch das Interesse an der Mutter nach, weil sie jetzt das Andere und Fremde darstellt.
„Dabei geht es nicht darum, dass das gegengeschlechtliche Liebesobjekt durch das homosexuelle ersetzt wird. Der Schwerpunkt liegt vielmehr auf der Entdeckung, dass die Elternfiguren zwei sich widersprechende Rollen verkörpern. Sie haben ein doppeltes Gesicht“ (S. 91)
Durch die Entdeckung der verschiedenen Geschlechtsmerkmale verliert der Inzestwunsch seine Inhalte und der ödipale Konflikt enddramatisiert sich.
„Damit geht der Ödipuskomplex beim Homosexuellen unter (…) Homosexuelle identifizieren sich in erster Linie mit dieser Doppelgesichtigkeit der ödipalen elterlichen Figuren und entwickeln in ihrem zukünftigen Liebesleben selbst das typische Doppelgesicht, das sie in der ‚Gesellschaft der polaren Gegensätze’ diskriminiert“ (S. 91)
Der Knabe erlebt somit zwei Erlebnisweisen. Zum einen führt die ödipale Reaktion zu Inzestwunsch, Rivalität und Kastrationsangst, wodurch das Kind in eine passiv-unterwürfige Haltung gedrängt wird. Nachdem das Kind dann die Anziehung des gleichgeschlechtlichen Elternteils, der zuvor noch gefürchtet war, erkannt hat, führt dies zu einer Stärkung des Selbstwertgefühls und zu einer Steigerung sexueller Aktivitäten. Das Kind erlebt beide Verhaltensweisen: Sich passiv abwartend und sich aktiv suchend zu verhalten. Beide Tendenzen liegen später auch im Partnerschaftsverhalten bereit und wechseln sich immer wieder aus (S. 91 f.). Die Umorientierung auf dem Höhepunkt der ödipalen Phase „stützt sich auf die bewusste Wahrnehmung und Verarbeitung der subjektiv erlebten Diskrepanz zwischen Geschlechtsrollen und Geschlechtsmerkmalen“ (S. 94). Diese Bewusstseinsprozesse verfallen mit Einsetzen der Latenz und der Verdrängung (S. 94).
5.3. Zu den Vorgängen in der Adoleszenz und im Erwachsenenalter
Die Sexualität des Homosexuellen steht in einem Widerspruch zu den Normen der Gesellschaft.
„Die größten Belastungen, denen Homosexuelle ausgesetzt sind, gehen von der Gesellschaft aus“ (S. 93)
Der Homosexuelle setzt sich mit dieser Situation in seinem ‚Coming out’ auseinander, dieses „stellt einen Bewusstseinsprozess dar, in dem sich der Homosexuelle als solcher erkennt und zu erkennen gibt“ (S. 93). Die eigene Geschlechtsrolle zu definieren und auszubilden stellt für den Homosexuellen die dritte Weichenstellung dar.
Wenn diese Weichenstellung gelingt, geht es darum, das Liebesleben frei von gesellschaftlich vorgezeichneten Mustern zu gestalten, auch wenn sie in anderen Belangen diesen Mustern folgen.
„Die homosexuelle Liebesfähigkeit ist eben dadurch charakterisiert, dass Vorstellungen über Männlichkeit und Weiblichkeit, über Aktivität und Passivität fließend ineinander übergehen und scharf gezeichnete Gegensätze mit ihr unvereinbar sind“ (S. 93 f.).
„In der Adoleszenz taucht das Verdrängte unter dem Druck der Sexualtriebe in der homosexuellen Objektwahl wieder auf (…) Erst in der dritten Weichenstellung wird die Homosexualität in das Bewusstsein integriert. Es kommt zu einer Trennung zwischen den Bedingungen der gesellschaftlichen Anpassung und den Bedingungen, die das Liebesleben erfordert (S. 94)
5.4. Zur Geschlechtsrolle von Homosexuellen und zu ihrem Liebesleben
In der geltenden „Gesellschaftsmoral“ sind die biologischen Geschlechtsmerkmale mit bestimmten Geschlechtsrollen identisch. Zu favorisieren sei hingegen eine Moral, wo diese Beziehung „fakultativ und locker“ ist (Morgenthaler, 2004, S. 120). Die Geschlechtsrolle Homo-sexueller ist durch das „typische Doppelgesicht“ definiert, von „auswechselbaren Verhaltens- und Erlebnismustern bestimmt“. Das Bild ist vergleichbar mit einem „Januskopf“, „von dessen zwei Gesichtern immer nur das eine sichtbar ist“ (ebd., S. 55).
Bei der Partnersuche wurden „aktive und passive Tendenzen, männliche und weibliche Züge in jedem Homosexuellen nachgewiesen“.
„Man erkannte, dass der Homosexuelle in seiner Beziehung zum gleichen Partner, ja in der gleichen Stunde seines Zusammenseins mit ihm die eine oder andere Haltung einnehmen kann“ (S. 52)
Die Neigung, „sich passiv abwartend und zur Unterwerfung verfügbar zu zeigen“ und auch „sich aktiv suchend und erobernd einzustellen“, sind „Tendenzen, die normalerweise bei beiden Partnern bereitliegen und in der Beziehung immer wieder ausgewechselt werden“ (S. 92).
Das Andere sucht der Homosexuelle in Eigenschaften seines Partners, die er selber gerade nicht einnimmt, auf die er aber in spielerischer Weise zurückgreifen kann, wie es der Partner auch tut (S. 55).
In der homosexuellen Lebenspraxis und auch schon bei der Partnerwahl ist es so, dass der eine Partner „die eine oder andere Erlebnisweise der beiden ödipalen Dispositionen reaktiviert“ (S. 92). Fühlen sich die Partner gegenseitig bestätigt, so entspricht dies der Entdeckung anziehender Merkmale beim anderen (S. 92). Wenn in der frühen Kindheit der Autonomiezuwachs durch Onanie erfolgte, so wird in der erwachsenen Objektbeziehung der Autonomiezuwachs in den Dienst einer echten Liebesbeziehung gestellt (S. 89 f.).
Eine Störung der Liebesfähigkeit kann vorliegen, wenn „an sich gesunde Homosexuelle“ Schwierigkeiten mit „gesellschaftlichen Zwängen“ haben und dadurch das „alternierende Rollenverhalten im Sexualverhalten“ beeinträchtigt wird (S. 132). Folgen davon können sein, dass sie sich nicht mehr eingehend auf einen Partner einlassen und in der Anonymität sexuelle Befriedigung suchen oder sie flüchten in bestimmte Familien-konstruktionen, z.B. dass der homosexuelle Mann bei seiner Mutter lebt. In Bezug auf die Partnerwahl liegt eine neurotische Objektwahl dann vor, „wenn im Partner befremdende Züge, im Vergleich zum Bild der eigenen Person, anziehend erscheinen“ (S. 110).
5.5. Kritische Einschätzung des Modells von Morgenthaler
Fritz Morgenthaler stellte in seinen Überlegungen dar, wie sich Homosexualität gleichwertig und nicht pathologisch gegenüber Heterosexualität entwickelt. Er unternahm damit einen Perspektiven-wechsel: Während lange Zeit der Homosexuelle selber als pathologisch galt, gingen nach Morgenthaler die „größten Belastungen“ (S. 130) für Homosexuelle von der Gesellschaft aus. Diese würden z.B. in militärischen Organisationen, in Schulbetrieben oder Vereinen „verleugnet, ausgemerzt, verboten oder (…) unterdrückt“ (S. 130). Man fühlt sich bei dieser Auffassung an den Titel des Films „Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt“ aus dem Jahr 1971 des Regisseurs Rosa von Praunheim erinnert. Sowohl bei Morgenthaler als auch in dem Filmtitel hört man als Ziel heraus, dass einerseits Homosexuelle ihre Außenseiterposition überwinden sollten und andererseits die Gesellschaft eine tolerantere Einstellung entwickeln sollte.
Ein anderes Bild entwickelte Morgenthaler auch zur Onanie. Während diese Mitte des 19. Jahrhunderts noch als „sexuelle Abweichung“ eingestuft wurde und auch Freud vor einer Verharmlosung warnte, spielen autoerotische Befriedigungen nach Morgenthaler „bei allen Menschen während des ganzen Lebens eine große Rolle“ (S. 105), da sie „Störungen in der narzisstischen Homöostase ausgleichen“ können. Beim Kleinkind stellt es eine Art Training dar, „sich unabhängig von anderen, also meist unabhängig von der Mutter, selbständig und ohne äußere Hilfe Befriedigung zu verschaffen“ (S. 105).
Morgenthaler setzt sich kritisch mit der Rolle der Analytiker auseinander, welche sich durchaus von homosexuellen Analysanden bedroht fühlen können. Er bringt damit zum Ausdruck, dass Homosexuelle in einer solchen Situation keineswegs von einer neutralen, unvoreingenommenen Haltung ihres Gegenübers ausgehen können sollten.
Zur Entwicklungstheorie bei Homosexualität muss man fragen, ob ein kleinkindlichen Bedürfnis nach Autonomie bzw. nach Identität wirklich nachweisbar für die Entwicklung der sexuellen Orientierung entscheidend ist. Ist es wirklich so, dass eine Überbesetzung von Autonomie Homosexualität zur Folge hat? Eltern oder andere Erziehungsberechtigte wüssten nach diesem Modell scheinbar, wie sie Einfluss auf die sexuelle Orientierung ihrer Kinder nehmen könnten. Man bräuchte die Theorie nur etwas weiterdenken: Wer beispielweiße wollte, dass sich sein Sohn schwul entwickelt, müsste ihn also als Kleinkind stark kontrollieren, so dass sich ein Bedürfnis nach Autonomie mit einer Überbesetzung autoerotischer Aktivitäten entwickeln würde. Das klingt ein bisschen simpel und es ist zu fragen, ob Morgenthaler es so verstanden haben wollte.
Es ist auch kritisch zu hinterfragen, warum gemäß dem Modell die Körperbeherrschung für die Identität und die Entdeckung der körpereigenen Gefühle für die Autonomie eine wesentliche Rolle spielen. Warum ist diese Annahme so und nicht umgekehrt? Man könnte sich auch vorstellen, dass je ausgeprägter die Körperbeherrschung funktioniert, desto größer das autonome Repertoire ist.
Oder auch, dass Selbstempfindung und Identität in einem engen Verhältnis zueinander stehen. In Morgenthalers Theorie ist auch nicht definiert, welche psychischen Phänomene der Autonomie und welche der Identität zugeordnet sind. Man hat den Eindruck, dass die Trennung von Autonomie und Identität etwas willkürlich vorgenommen wurde. Es wird zwar erläutert, wie beide Begriffe definiert werden, aber es ist nicht mit Beispielen verdeutlicht, welches kindliche Verhalten jeweils welchem Begriff zugeschrieben wird. Auch der Begriff der Autoerotik ist nicht eindeutig belegt. Mal wird er als Begriff für Selbstbefriedigung verwendet, mal steht er für ein Bedürfnis nach Erotik mit Personen, die einem gleichen. Zu bemerken ist ebenfalls, dass Morgenthaler den Begriff Identität in erster Linie mit der geschlechtlichen Rolle gleichsetzt und nicht darauf eingeht, dass zur Identitätsbildung auch Faktoren wie Herkunft, Bildung, Körper usw. gehören.
Bei den Darstellungen Morgenthalers zur Entwicklung der Homosexualität handelt es sich um eine Theorie oder ein Modell. Es gibt keine empirischen Belege für seine Erkenntnisse. Morgenthaler hat aus Erzählungen von Patienten etwas konstruiert und daraus seine Theorie entwickelt bzw. bestehende Theorien ausgebaut; Kleinkinder hat er vermutlich nicht beobachtet. Auch wenn die Ausführungen in sich logisch klingen - er liefert keine Nachweise und bemüht sich auch nicht darum, dass sein Modell ein Abbild der Wirklichkeit darstellt. An einer Stelle bringt er selber Zweifel an seinem Entwicklungsmodell zum Ausdruck:
„Es lassen sich (…) Stationen abgrenzen, die eine Entwicklung zur Homosexualität ermöglichen“ (S. 101)
Demnach versteht Morgenthaler es selbst nicht als zwingend, dass man sich auch innerhalb der Annahmen seiner Theorie in jedem Fall homosexuell entwickelt.
In Bezug auf die Geschlechtsrolle ist zu fragen, in wie weit die postulierte doppelgesichtige Geschlechtsrolle auf Akzeptanz stößt. Vorstellbar ist auch, dass viele Homosexuelle sich mit einer eingesichtigen Geschlechtsrolle identifizieren. Morgenthaler liefert keine Belege, inwieweit seine Annahme über die Doppelgesichtigkeit der Geschlechtsrolle im Alltag zutreffend ist oder auf Zustimmung stößt.
Es heißt bei Morgenthaler zunächst, dass der Homosexuelle als Erbe der ersten Weichenstellung durch die enge Beziehung zur Autoerotik einen Partner suche, der ihm gleiche.
Demnach könnte man annehmen, dass der eher männliche Homosexuelle einen eher maskulinen Partner sucht und der eher feminine einen ebensolchen. Nach den Beschreibungen zur Partnerschaftsstruktur hat man hingegen den Eindruck, dass der Homosexuelle ebenso wie der Heterosexuelle den polaren Gegensatz sucht, nur eben innerhalb der Homosexualität. Hier besteht ein Widerspruch in der Theorie.
Es ist bei Morgenthalers Modell oft unklar, mit welchem Inhalt verwendete Begriffe gefüllt sind. Es bleibt offen, wie die verwendeten Gegensätze ‚aktiv’ und ‚passiv’ zu verstehen sind. Es scheint so, als sei damit eine getroffene Zuordnung nur auf Verhalten beim Geschlechtsakt gemeint. Es ließe sich an konkreten Beispielen sicher auch kontrovers diskutieren, welches Verhalten den Begriffen ‚weiblich’ oder ‚männlich’ zuzuordnen wäre.
Die von Morgenthaler unterstellten Übereinstimmungen zwischen Geschlechtsrollen und Geschlechtsmerkmalen sind in der Gegenwart doch erheblich in Bewegung gekommen. Das verwendete Geschlechterbild erscheint zu starr und es ist zu fragen, ob es auch zu Morgenthalers Lebzeiten noch aktuell war. Man kann dem entgegenstellen, dass Männer und Frauen sich sowohl aktiv als auch passiv verhalten. Man könnte darüber diskutieren, ob die den Homosexuellen zugeschriebene Doppelgesichtigkeit nicht vielmehr auch für Heterosexuelle eine Tendenz der neueren Zeit ist. Die sich verändernden Geschlechterrollen und auch ökonomisch eingeforderten Flexibilisierungserscheinungen könnten als Erklärungsversuche dafür diskutiert werden.
Dass die empfundene oder zugeschriebene Geschlechtsrolle Homosexueller ein wichtiges Thema ist, belegt u. a. die Tatsache, dass sie im Laufe der Zeit immer wieder neu beschrieben wurde. Mal scheint sie eher weiblich, mal eher männlich, mal ein drittes Geschlecht oder eben doppelgesichtig zu sein.
Eine ausführlichere Auseinandersetzung damit wäre ein spannendes Thema für weitere Arbeiten.
Es wäre interessant zu wissen, in wie weit sich andere Psychoanalytiker oder Wissenschaftler mit Morgenthalers Thesen beschäftigt haben, ob diese untersucht oder fortentwickelt wurden. Der Verfasser dieser Arbeit vermutet, dass dies nicht im größeren Umfang der Fall ist, bei einer Internetrecherche hat er nichts gefunden. Aber auch dies wäre das Thema weiterer Forschungen und einer anderen wissenschaftlichen Arbeit.
6. Zur gegenwärtigen Debatte über die Identität von schwulen Männern
In diesem Kapitel wird die Debatte von Wissenschaftlern über „die Geschichte der Homosexualitäten und die schwule Identität an der Jahrtausendwende“ aus dem gleichnamigen Buch aus dem Jahr 2000 in Verbindung zu Morgenthalers Aussagen gestellt. Es geht darum, welche von Morgenthaler vertretenen Auffassungen, Themen und Fragen heute noch aktuell sind und diskutiert werden, oder welche überholt sind und wo sich die Diskussion in eine andere Richtung entwickelt hat.
Zunächst soll es um die Begriffswahl gehen. Morgenthaler schreibt in seinen Texten von homosexuellen Männern. Es war damals nicht üblich, in seriösen Texten den Begriff schwul zu verwenden, dieser wurde erst im Laufe der Zeit auch im offiziellen Sprachgebrauch übernommen. In der o. g. Debatte fällt auf, dass die dort vertretenen Autoren unterschiedliche Begriffe für Homosexuelle benennen, die je nach gesellschaftlichen und geschichtlichen Zusammenhang zu variieren scheinen. Für Hergemöller sind Urninge, Homophile, Homosexuelle oder auch Schwule „historische Erscheinungsformen“ einer „vielschichtigen Entwicklung“ (Hergemöller, 2000, S. 39 f.). Hutter (ehem. wiss. Mitarbeiter der Universität Bremen) nennt seinen Beitrag zu der Debatte gar „Von der Sodomie zu Queer-Identitäten“ (Hutter, 2000, S. 141 ff.). Einen weiteren Hinweis für sich ändernde oder variierende Begriffe liefert die September-Ausgabe 2005 des Berliner Magazins „Siegessäule“, ab der im Untertitel das Wort schwul/lesbisch durch queer ersetzt wird. Gleichzeitig sind im Magazin die Bezeichnungen schwul, gay und homosexuell präsent. Das Phänomen der wechselnden Begriffe fällt auf und es ist zu fragen, was die Gründe dafür sind, ob sich das Lebensumfeld Homosexueller oder deren Identität so grundlegend verändert, dass alle Jahrzehnte eine neue Bezeichnung zu verwenden ist.
Morgenthaler definiert die Identität homosexueller Männer vorrangig an ihrer Geschlechtsrolle. Mit der Geschlechtsrolle beschäftigt sich indirekt auch Hutter, obwohl er diesen Begriff nicht verwendet, wenn er schreibt, dass sich die vormals effeminierte Identität ab den 1970er Jahren zu einer maskulinen schwulen Identität verändert habe. „Die Partnerschaften werden mit gleichberechtigten und in etwa auch gleichaltrigen Partnern gelebt; die Rollen beim Geschlechtsakt sind austauschbar“ (ebd., S. 166). Eine anderes „Muster des homosexuellen Verhaltens“ beschreibt er bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts. Demnach waren in einer festen Rangordnung zwischen Klassen, Geschlechtern und Generationen homo- wie heterosexuelle Kontakte zwischen Hausherrn und Dienstpersonal unter Zwang oder mit Hilfe von Vergünstigungen durchaus üblich. Wenn es auch eine feste Rollenaufteilung gegeben habe, so hätten sich beide miteinander Verkehrenden als Männer verstanden (S. 143 ff).
Mit der von Morgenthaler so genannten Geschlechtsrolle beschäftigt sich Dannecker (Autor zahlreicher Veröffentlichungen) in dieser Debatte nicht. Er fragt vielmehr danach, was die scheinbar so verschiedenen Lebensstile der Homosexualität gemeinsam haben. Betrachte man verschiedene Lebensstile wie „Lederszene“ oder „Technopartie“ als kulturelle Phänomene, könne man sie nicht als zwei Seiten desselben Phänomens begreifen. Bringe man es aber mit dem Begehren nach einem gleichgeschlechtlichen Partner in Zusammenhang, so habe das Verschiedene doch eben diese Gemeinsamkeit. Schwule Ledertypen träfen sich mit schwulen Ledertypen, auch wenn es unter Heterosexuellen ebenso eine Lederszene gibt. Dannecker begreift Lebensstile als nichts festes, als einer Dynamik unterliegend. Aus dem Dauergast von Parks und Saunen könne zum anderen Zeitpunkt die Hälfte eines Pärchens aus der Vorstadt geworden sein und umgekehrt (Dannecker, 2000, S. 183 ff.).
Ein bedeutender Punkt in dieser Identitätsdebatte ist die Einschätzung von Diskriminierungen. Als einschneidende Veränderung gilt die Zeit zwischen 1969 und 1973, in die die Liberalisierungen des § 175 StGB fallen. Sigusch beschreibt diese Zeit so, dass männerliebende Männer zum ersten Mal die Chance hatten, ihre Eigenart „ohne Gefahr für Leib und Leben zu bekennen und zu einer gewissen Bewusstheit ihrer selbst zu gelangen konnten (Sigusch, 2000, S. 85). Dannecker schreibt rückblickend, dass „die Spannung zwischen der Negation der Homosexualität in der ‚normalen Welt’ und der Akzentuierung der Homosexualität in der Subkultur“ zur „Grundexistenz“ zumindest der damals befragten Homosexuellen (vgl. Dannecker/Reiche: Der gewöhnliche Homosexuelle) gehörte (Dannecker, 2000, S. 179). Heute seien Homosexuelle „völlig anders in der Normalität positioniert“ (ebd., S. 183).
„Nicht nur die Schwulen sind hipp. Schwulsein ist es nicht minder“ (S. 177)
Auf Bildern von schwulen Events sei auch noch „das alte Lied der Verfolgung“ dargestellt, welches jedoch „merkwürdig unzeitgemäß“ wirke (S. 177). Aber nur oberflächlich betrachtet könne man zu dem Eindruck gelangen, Homosexualität sei frei von den Stigmata wie Sünde, Verbrechen, Krankheit und Verfolgung. Das Coming out beginne auch gegenwärtig oft mit einer jahrelangen Flucht vor dem gleichgeschlechtlichen Verlangen und sei geprägt durch Scham und Angst (S. 191). Vielen „postmodernen Homosexualitätsforschern“ sei die Frage nach den Gemeinsamkeiten der Homosexuellen aber „zutiefst suspekt“. Dies könne den ersehnten Wunsch nach „Normalisierung“ behindern (S. 186 f.). Als andere Seite der Normalität gebe es die Opfer antischwuler Gewalt, zu der es kommen könne, wenn sich die Homosexualität am falschen Ort artikuliere. Es sei ein Schein, dass die sexuelle Orientierung keinen Unterschied mehr mache, der an Orte wie Paraden, Discotheken und Kneipen gebunden sei. Im Bewusstsein und der Erfahrung von Diskriminierung hätten sich viele eine „flexible Umgangsweise“ zugelegt, man entscheide nach Situation, ob man von seiner Homosexualität etwas zu erkennen gebe oder nicht (S. 187 ff.).
Veränderte gesellschaftliche Debatten, Strukturen oder gesetzliche Bestimmungen haben einen identitätsbildenden Einfluss. Dies ist u. a. an den Darstellungen Hutters erkennbar, wenn er bspw. schreibt, dass mit Beginn des 18. Jahrhunderts und der Überwindung des Feudalismus sich besonders in England und den Niederlanden städtische Kulturen entwickelten, die als Voraussetzung für das Entstehen von Subkulturen dienten (Hutter, 2000, S. 145 ff.).
In der Identitätsdebatte wird auch über schwulenpolitische Ziele und Strategien diskutiert. Hutter beschreibt, dass man sich ab 1970er offen zur schwulen Identität bekennen konnte und dass das westliche Konzept der Homosexualität global ausgerichtet war. Trotz interner Streitereien lautete das Ziel der Schwulenbewegung: ‚Coming-out-all-over’, also raus aus der Außenseiterecke, um die Randsituation zu überwinden. Hutter unterstellt der „Schwulenbewegung alten Typus“, sie habe „sehr rigorose Vorstellungen“ über ein „richtiges schwules Leben“ gehabt. Heute hingegen sei „Pluralität Trumpf“ (Hutter, 2000, S. 169 ff.).
Was macht aber nun die gegenwärtige homosexuelle Identität aus? Nach der Entwicklungstheorie von Hutter kollidiert eine einheitliche schwule Identität mit den unterschiedlichen Lebenserfahrungen in Bezug auf Alter, Wohnsitzverhältnissen, Herkunft, Ausbildung. Dementsprechend stelle die neue Queer Theory die „Brüchigkeit und Vielgestaltigkeit sexueller und geschlechtlicher Identitäten in den Mittelpunkt“. Die Konzeptionen von ‚männlich’ und ‚schwul’ gelten in dieser Theorie „als historisch gewachsene, normative Konstruktionen“ (S. 170). Hutter entwickelt eine Typologie schwuler Identitäten, die „in der Denktradition der Queer Theory“ steht, „da sie die Pluralität schwuler Identitäten unterstreicht und auf ihre soziale Bedingtheit verweist“ (S. 171). Er skizziert sechs Typen, die hier nicht erklärt (S. 171 f.), aber zumindest erwähnt werden sollen: Der „Gliedschwule“, der „Kopfschwule“, der „Zehenspitzenschwule“, der „Herzschwule“, der „Verletzte“ und schließlich auch der heterosexuelle Stricher (S. 170 f.).
Dannecker definiert homosexuelle Identität damit, „dass sich jemand das Recht einräumt, als Mann einen Mann zu lieben“ (Dannecker, 2000, S. 194). Gerade in der schwierigen Phase des Coming out versuchten junge Schwule das zu realisieren, was der „postmoderne Homosexualitäts-diskurs“ von ihnen verlange, nämlich keine homosexuelle Identität aufzubauen. Das Begehren widersetze sich einer Zerstreuung der sexuellen Orientierung, bei allen unterschiedlichen Präferenzen, Varianten oder Fetischen. Demnach bauen sich unterschiedliche homosexuelle Identitäten auf, die in der Verbindung mit der sexuellen Orientierung bleiben. Man könne eine homosexuelle Identität haben und zugleich, je nach dem, Lederfetischist sein, als Katholik frei von realen Erfahrungen sein, mit einem Geliebten monogam zusammenleben, schwache Berührungspunkte zur Subkultur haben, mit einer Frau verheiratet sein usw. Man würde sich als homosexuell begreifen, auch wenn man auf unterschiedliche Weise sein Leben führe. Folgendes kennzeichne bei allen Unterschieden den gegenwärtigen Homosexuellen:
„Nicht viel mehr als sein Begehren nach einem Mann und sein Wunsch nach gesellschaftlicher Anerkennung seines Begehrens sowie die mehr oder weniger bewussten Zweifel daran, ob das jemals der Fall sein wird“ (Ebd., S. 195)
[...]
- Arbeit zitieren
- Anne Baumann (Autor:in)Christian Brügel (Autor:in)M.A. Steven Oklitz (Autor:in)Dirk Wagner (Autor:in), 2015, Fußball und Homosexualität. Immer noch Grund für eine rote Karte?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/294615
Kostenlos Autor werden







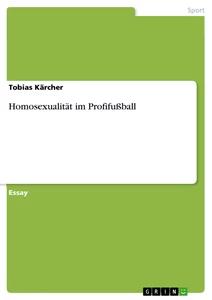





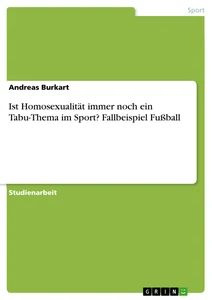

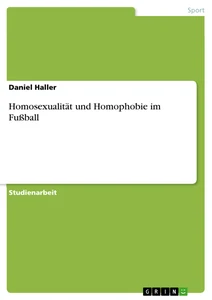


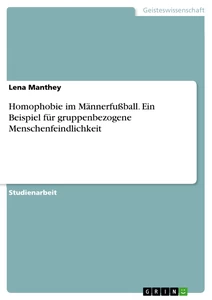



Kommentare