Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
1.1 Kurze allgemeine Darlegung zur Themenwahl/ Bedeutung der Darwinschen Evolutionstheorie für das Verständnis von Kunst
1.2 Thematisierungsabfolge des Hauptteils
2. Hauptteil- Kunst und Evolution
2.1 Einführung in die zentralen Fragestellungen der Kunstphilosophie
2.2 Einführung in die Evolutionstheorie Darwins
2.3 Kunst und Evolution – exemplifiziert am Beispiel des Buches „Wozu Kunst?“ von Menninghaus
2.3.1 Werbung, Wettbewerb, Wahl: Darwins Konkurrenzmodell der Künste
2.3.2 Das Gegenmodell: Die Künste als Agenten sozialer Kooperation und Kohäsion
2.3.3 Sexuelle Werbung, Spiel, Technologie und Symbole: Vier evolutionäre Vektoren der Künste
2.3.4 Ästhetische Selbstpraktiken
2.4 Rezeptionsgeschichte/ Weiterentwicklung
2.4.1 Kritische Einwände zum Zusammenhang von Evolutionsbiologie und Kunstphilosophie
2.4.2 Weiterentwicklung eines Zusammenhangs in anderen philosophischen Konzepten
2.4.3 Die geistigen Voraussetzungen für Kunst
3. Kritische Evaluation und Schluss
3.1 Kritische Betrachtung von Menninghaus „Wozu Kunst“
3.2 Kritische Betrachtung- in Bezug auf Individuum und Gesellschaft
3.3 Evaluation von Kunst und Evolution- die Natur des Menschen
3.4 Schluss- Fazit zur Bedeutung von Kunst und Evolution
4.Literaturverzeichnis
1. Einleitung
1.1 Kurze allgemeine Darlegung zur Themenwahl/ Bedeutung der Darwinschen Evolutionstheorie für das Verständnis der menschlichen Künste
Ich möchte in meiner Bachelorarbeit „Kunst und Evolution“ untersuchen, inwiefern das künstlerische Ausdrucksvermögen des Menschen von seiner evolutionsbiologischen Entwicklungsgeschichte abhängt. Es geht also um die Herstellung einer Verbindung zwischen Kunst und Evolution.
Mit dem Phänomen der Kunst beschäftigen sich neben der Philosophie viele weitere Wissenschaften, wie zum Beispiel die Psychologie und die Anthropologie.
Ausgehend von Darwins Evolutionsbiologie sind mittlerweile evolutionsbiologische Erklärungsmodelle zur Fähigkeit der Kunst entstanden. Diese gilt es zu erläutern.
Als Hauptanhaltspunkt soll hierbei Winfried Menninghaus Werk „Wozu Kunst? Ästhetik nach Darwin“ dienen, da es den von mir gewählten Themenbereich wissenschaftlich bearbeitet. Deshalb möchte ich den Hauptteil einer gründlichen Betrachtung des Werkes widmen.
Es liegt nahe das Thema möglichst interdisziplinär zu beleuchten. Ziel ist es einen Überblick zu schaffen, in dem sich die verschiedenen Ansichten und Aspekte idealerweise gegenseitig ergänzen.
1.2 Kurzer Abriss der Thematisierungsabfolge
Das Thema soll in mehreren Schritten erörtert werden.
Um sich mit den Ursprüngen und Zielen der Künste auseinandersetzen zu können, liegt es zunächst nahe, sich mit dem Wesen der Künste zu beschäftigen.
Deshalb werde ich in die Grundlagen der Ästhetik und Kunstphilosophie einführen. Hier bietet es sich unter anderem an, die zentralen Fragestellungen vorzustellen und den Begriff der Kunst einzugrenzen.
Entsprechend werde ich in einem zweiten Schritt das Augenmerk auf das Wesen des Menschen richten und ein Kapitel ausschließlich der Evolutionstheorie Darwins widmen, damit sichergestellt ist, dass die biologischen Grundlagen geklärt worden.
Im nächsten Schritt können dann Kunsttheorie und Evolutionsbiologie aufeinander bezogen werden; mit dem Ziel die Übergänge verdeutlichen zu können.
Ich orientiere mich hier, wie bereits erwähnt, ausschließlich an dem Werk „Wozu Kunst? Ästhetik nach Darwin, von Menninghaus, aus dem Jahre 2011.
Nach dieser Kern-Analyse, sollen die Auswirkungen des zuvor geschilderten Ursprungs der Künste, in anderen philosophischen Konzepten betrachtet werden.
Abschließend können die Folgen und Konsequenzen eines möglichen Zusammenhangs in mehreren Schritten kritisch betrachtet und gegebenenfalls erweitert werden.
2. Kunst und Evolution
2.1 Einführung in die zentralen Fragestellungen der Kunstphilosophie
Die Kunstphilosophie lässt sich in das Feld der philosophischen Ästhetik einordnen. Diese Disziplin kam in Folge des Rationalismus auf und ist unter anderem auf den von Alexander Gottfried Baumgarten im 19. Jahrhundert eingeführten Ästhetik-Begriff zurückzuführen. Er sah in ihr vor allem die „Wissenschaft von der sinnlichen Erkenntnis.“ (Im Griechischen bedeutet das Wort „ästhesis“ soviel wie „sinnliche Wahrnehmung.“)
Obwohl sich schon in der antiken Philosophie Ansätze einer Ästhetik zeigten, unter anderem bei Platon und Aristoteles, hat sich diese als eigenständiger Bereich erst seit dem Aufkommen verschiedenster Kunstrichtungen Anfang des 19. Jahrhunderts etabliert.
Man kann drei Hauptgegenstände der philosophischen Ästhetik unterscheiden. Neben der Beschäftigung mit Kunst gibt es noch die Theorie des Schönen und die der sinnlichen Erkenntnis. Somit verklammert die Ästhetik erstmals die Theorie des Schönen mit den Künsten und der sinnlichen Erkenntnis.
Grundsätzlich wird die Ästhetik als „Wissenschaft“ betrachtet. Dies setzt eine objektive Herangehensweise voraus, die grundsätzlich emotionale Distanziertheit erfordert. Die philosophische Ästhetik ist „allgemein“ und „nicht empirisch“. Auf der Grundlagenebene von Ästhetik lassen sich verschiedene Auffassungen von ihr unterscheiden. Es gibt deshalb eine große Bandbreite an möglichen, treffenden Definitionen der Ästhetik. Es heißt, sie sei „auf Wahrnehmung, nicht auf Begriffe gegründet“. Eine mögliche, alternative Definition lautet: „Ästhetik ist die Theorie der ästhetischen Erfahrung, der ästhetischen Gegenstände und der ästhetischen Eigenschaften“ (siehe S.16, in Maria Reicher).
Es werden Fragen nach der Gültigkeit ästhetischer Urteile gestellt. Wie gehen wir vor, wenn wir etwas als schön oder hässlich betrachten? Sind unsere Geschmacksvorstellungen zwangsläufig subjektiver Natur, und welche Kriterien wenden wir an?
Einer der (vielleicht) wichtigsten Gegenstände der philosophischen Ästhetik ist die Frage nach dem Wesen ästhetischer Erfahrungen. Man geht davon aus, dass es sich bei ästhetischen Erlebnissen und Einstellungen um komplexe psychische Phänomene handelt. Diese lassen sich gliedern in Vorstellungen, Überzeugungen und Emotionen. Wo Kant noch ein „interesseloses Wohlgefallen“ sah und die psychische Distanz als notwendig betrachtete, werden Emotionen heute nicht mehr als Störfaktor, sondern gemeinsam mit der ästhetischen Einstellung, der „sinnlichen Wahrnehmung“, dem Intellekt und den richtigen „Wahrnehmungsbedingungen als Voraussetzung gesehen.
Da in dieser Arbeit der Begriff der Kunst einen ganz wesentlichen Stellenwert hat, soll in diesem Abschnitt vor allem der Kunstbegriff näher betrachtet werden. Es gilt herauszufinden, wann man von Kunst spricht und was man darunter versteht. Neben möglichen Definitionen von Kunst lassen sich außerdem verschiedene Kunstformen unterscheiden. Was genau zeichnet diese aus und wo liegen die Grenzen beziehungsweise Unterschiede zwischen den Künsten?
Aufbauend auf dem Begriff der Kunst und den einzelnen Kunstformen bietet es sich an, das Wesen von „Kunstwerken“ näher in Betracht zu ziehen. Die Kunstphilosophie geht demnach von verschiedenen Eigenschaften von Kunstwerken aus, die sie eindeutig von sogenannten Nicht-Kunstwerken unterscheiden.
Außerdem muss in diesem Zusammenhang nach der Rolle des Kunstschaffenden bzw. Künstlers und auch der des „Kunstgenießers“, also des Betrachters, Zuhörers usw. (Rezipienten), gefragt werden. Es gilt unter anderem herauszufinden, was künstlerische Begabung sein kann und was es bedeutet, Kunst zu machen beziehungsweise wo genau die Auswirkungen und Effekte liegen. Gibt es außerdem eine genaue Grenze von Kunst und Wissenschaft und wofür sind diese Bereiche jeweils zuständig? Letztlich läuft alles auf die Frage hinaus, ob allen Kunstformen ein gemeinsamer Ursprung zu Grunde liegt, ob Kunst etwas typisch Menschliches ist und worin sie ihre Begründung findet.
Wie bereits erwähnt, geht es aber zunächst um eine Eingrenzung des Kunstbegriffs.
Obwohl die Kunst ganz unterschiedliche Stellungen in der Geschichte der Kulturen einnimmt und im Laufe der Geschichte ganz verschieden praktiziert worden ist, scheint es sie doch (in der Geschichte der Menschheit) immer gegeben zu haben. Mal wurde sie eindeutig von der Wissenschaft abgegrenzt, mal mit ihr verbunden (in der Renaissance unter anderem von Leonardo da Vinci). Der Kunstbegriff untersteht entsprechend einem ständigen Wandel. Es ist also keineswegs eindeutig, was Kunst eigentlich bedeutet. Die Kunstphilosophie unterscheidet hier mehrere Theorien der Kunst, die alle zur Klärung des Kunstbegriffes führen sollen. Diese sind wie folgt: Die Darstellungstheorie und die Ausdruckstheorie als historische Theorien der Kunst, der kunstästhetische Formalismus, die Institutionstheorie und zuletzt „Kunst als ästhetische Kommunikation“, in die ich anschließend je eine kurze Einführung geben möchte. Wie bereits angedeutet, wird der Kunstbegriff in verschiedenen Bedeutungen verwendet. Früher wurde darunter oft eine besondere Fähigkeit von handwerklicher, wissenschaftlicher oder eben künstlerischer Natur verstanden. Dieses Verständnis ist jedoch nicht Gegenstand der Kunstästhetik. Man unterscheidet das Handwerk von den sogenannten „schönen Künsten“, der Musik, Malerei, Bildhauerei, Literatur usw. Diese „schönen Künste“ wurden als Abgrenzung zu den handwerklichen und wissenschaftlichen Fähigkeiten eingeführt. (Es ist nicht in meinem Sinne, die folgenden Theorien ausführlich darzustellen; sie sollen vielmehr nur zum bloßen Überblick grob skizziert werden. Es sei an dieser Stelle noch betont, dass sie alle nicht endgültig sind, da sie je ihre theoretischen Stärken und Schwächen besitzen. Letztlich ist diejenige Theorie mit den meisten Vorteilen oft diejenige, auf die sich gestützt wird.)
Die Darstellungstheorie:
Eine Möglichkeit zur Eingrenzung des Kunstbegriffs bietet die Darstellungstheorie. Sie betont den „Darstellungscharakter“ der Kunst. Demnach ist etwas dann Kunst, wenn es etwas darstellt. Aber was genau bedeutet es, dass etwas etwas darstellt? Zunächst einmal muss das Abbild dem Original ähnlich sein. Es wird hier also von einer Form der Nachahmung ausgegangen. Außerdem wird der symbolische Charakter jeder Art des Darstellens betont. Demnach werden (bildliche) Darstellungen „erkannt“ und ein Abbild wird „als etwas anderes“ gesehen. Jedoch fordert dies eine bestimmte Weise der Wahrnehmung. Damit also etwas als eine Darstellung von etwas akzeptiert werden kann, müsste eine Mehrheit (des Zielpublikums) diese als solche erkennen. (Hier kann es natürlich auch zu Fehlinterpretationen kommen.) Es ist nachvollziehbar, dass man Kunst als etwas betrachtet, was etwas Bestimmtes darstellt. Jedoch scheint dieses Charakteristikum viel zu eng, um als Grundlage einer Kunsttheorie gelten zu können. Es werden ganze Kunstgattungen (wie zum Beispiel Musik, Literatur und Architektur) scheinbar ausgeschlossen, da sie nicht unmittelbar etwas darzustellen vermögen. Man kann davon ausgehen, dass diese Theorie wesentlich auf die Zeit um Platon und Aristoteles zurückgeht, in der der Darstellungscharakter, zum Beispiel im Theater, wesentlichen Stellungswert genoss.
Die Ausdruckstheorie:
Die Ausdruckstheorie der Kunst betont den „Ausdruckscharakter“ der Kunst (im Gegensatz zur Darstellungstheorie). Demnach drücken alle Kunstwerke etwas Bestimmtes aus und werden beispielsweise mit Gefühlen verglichen. Der Ausdruck liegt demnach in der Ähnlichkeit von Werk und Emotion. Positiv an dieser Theorie ist, dass sie Kunstwerke erstmals als komplexe Gegenstände versteht, die oft Geschichten erzählen und Emotionen hervorrufen können. Somit sind Kunstwerke nicht rein auf die sinnlichen Erscheinungen des Werkes reduzierbar. Jedoch kann das Wesen der Kunst nicht einzig im Ausdruck geistiger Inhalte bestehen. Diese Theorie vernachlässigt also die Form von Kunstwerken. (Andernfalls könnten selbst Zeitungsartikel, die natürlich auch etwas ausdrücken, als Kunst verstanden werden.) Es muss also noch mehr hinter dem Gehalt eines Kunstwerkes stecken, als sein Inhalt oder Ausdruck. Es kann nun die Frage gestellt werden, ob sich Kunstwerke einer bestimmten Gattung einfach in eine andere übertragen lassen oder ob dann der „Gehalt als Ganzes“ bei der Veränderung der Form verloren geht. Hierauf kann man antworten, dass diese Verschiebungen durchaus machbar sind, wie es sich beispielsweise an der „Literaturverfilmung“ veranschaulichen lässt. Jedoch gehen dabei immer auch automatsch Aspekte des Originals verloren, während neue Aspekte hinzukommen. Folglich muss die Form eines Kunstwerkes auch für ihr Wesen von Bedeutung sein.
Der kunstästhetische Formalismus:
In dieser Theorie der Kunst bilden die formalen Aspekte die Grundlage einer ästhetischen Betrachtung. Das bedeutet, dass die Werke allein anhand ihrer „formalen Qualitäten“ als Kunstwerke betrachtet werden. Demnach besitzen sie eine bestimmte „signifikante Form“, die „ästhetische Emotionen“ auslösen und sie so als Kunstwerke klassifizieren. Die „autonome“ Betrachtung des Werkes ist hier entscheidend, während beispielsweise biographische Aspekte oder andere Hintergrundinformationen zum Werk (zum Beispiel politische) bei der Beurteilung ignoriert werden.
Diese Theorie ist als „Reduktion“ zur reinen Ausdruckstheorie der Kunst zu verstehen, da sie auf die formalen Aspekte der Kunst hinweist. Jedoch scheint schlussendlich „die Verbindung von Form und Inhalt“ das Wesen eines Kunstwerkes auszulösen, nicht allein die Form, wie hier beschrieben.
Die Institutionslehre:
Eine ganz andere Vorstellung von Kunst vermittelt die Institutionslehre. Diese geht davon aus, dass etwas dann Kunst ist, wenn es in der „Kunstwelt“ eine Rolle spielt. Das bedeutet, dass die Kunstwelt (bestehend aus Künstlern, Kunstwerken, Galerien, Publikum, Museen, Kunstzeitschriften usw.) letztlich ausschlaggebend ist, ob etwas als Kunstwerk verstanden wird oder eben nicht. Diesem Verständnis nach kann etwas nur dann Kunst sein, wenn es als Kunstwerk „hingestellt“ wird. (Beispielsweise, wenn es in einem Museum ausgestellt wird.) Als Verdeutlichung für diese Sichtweise werden sogenannte „Ready-mades“ herangezogen. Hier werden normalerweise alltägliche Gebrauchsgegenstände ihrer ursprünglichen Bestimmung entzogen, indem sie beispielsweise auf einem Sockel ausgestellt werden. In diesem Sinne verfremdet, ändere sich automatisch die Betrachtungsweise und sie müssten als „Kunstwerke“ akzeptiert werden. Es ist verständlich, dass die Kunstwelt einen Einfluss auf die Akzeptanz jeweiliger Kunstwerke hat, jedoch wirft diese Theorie vielerlei Fragen auf. Wer genau bestimmt, wer zur Kunstwelt gehört? Müssen jene Kunstexperten sein? Außerdem scheint die Anerkennung eines Werkes oft abhängig von zeitlichen und anderen Umständen zu sein, da es oftmals auch „unveröffentlichte oder unbekannte Werke“ gibt. Diese von der Kunstwelt „ignorierten“ Werke dürften demnach keinen Kunststatus haben, was sehr fraglich ist. Außerdem könnte es möglich sein, dass sich die Kunstwelt von Zeit zu Zeit in ihrer Beurteilung irrt und wenn dem so sei, dann scheinen die Gründe für die Anerkennung eines Kunstwerkes nicht klar festgelegt zu sein.
Kunst als ästhetische Kommunikation:
Auch diese Theorie möchte die Ausdrücke „Kunst und „Kunstwerk“ klären. Sie schlägt vor, Kunst als eine „spezielle Form der Kommunikation“ zu betrachten. Demnach unterscheide sich die künstlerische Kommunikation insofern von der „nicht künstlerischen Kommunikation“, als dass sie versuche, ein „ästhetisches Erlebnis“ zu vermitteln. Es gäbe hierbei gelungene sowie nicht gelungene Kommunikation in der Kunst, was dann entsprechend gute oder schlechte Kunst erkläre. Jedoch sei schlechte Kunst immer noch (eine Form der) Kunst. Sie besitze einen Sender (hier: Produzenten) und einen Empfänger (den Betrachter). Diese kommunikationstheoretische Definition scheint viele Vorzüge gegenüber anderen Theorien zu haben, unter anderem, da sie eine „sehr weite“ Definition zum Verständnis von Kunst vermittelt. Wenn jedoch die ästhetische Erfahrung so entscheidend ist, dann muss geklärt werden, was diese genau ist. Außerdem muss nach der genauen Abgrenzung von Kunst und Kritik gefragt werden, während die Grenze zwischen Kunst und „Nicht-Kunst“ bisher eher fließend zu sein scheint.
Ich möchte nun von dem Begriff der Kunst im Allgemeinen zu dem der Kunstwerke übergehen, um dann im Anschluss näher auf die Besonderheiten und Schwierigkeiten einer wissenschaftlichen Eingrenzung der Kunst zu sprechen zu kommen. Was genau sind Kunstwerke? Sie sind zunächst einmal Gegenstände materieller oder immaterieller Natur. Wenn sie nicht materieller Natur sind, dann sind sie entweder psychische oder abstrakte Gegenstände. Unter abstrakte Gegenstände fielen beispielsweise die Literatur und Musik. Die Frage ist nun, wann etwas zu einem Kunstwerk wird und wie es sich beispielsweise von einem „Nicht- Kunstwerk“ abgrenzt. Junker hat „vier interessante Eigenschaften eines Kunstwerkes“ herausgestellt: Ein Kunstwerk sei erstens ästhetischer Natur und zweitens ohne unmittelbaren lebenspraktischen Nutzen. Außerdem habe es eine erkennbare Bedeutung (Ausdruck) und es sei zuletzt immer ein Element der Fantasie (entferne sich also von der Realität). Unklar bleibt jedoch die Frage, wie diese Elemente genau zusammen kommen müssen und wer das anhand welcher Kriterien der Beurteilung festlegen kann. Sind diese Beurteilungskriterien rein subjektiver Natur? Als eine Eigenschaft von Kunstwerken wird angesehen, dass sie Erlebnisse (sogenannte „Erlebnistypen“) hervorrufen, die jedoch nicht vollständig zu bestimmen seien. Es geht also um die Festlegung der Qualitäten eines Erlebnisses. Man kann davon ausgehen, dass persönliche Aspekte das „Gesamterlebnis“ färben, was dazu führt, dass jedes Kunstwerk sowohl objektive als auch subjektive Aspekte (S.114) besitzt. Somit wäre ein Kunstwerk als ein Komplex, bestehend aus zwei Typen (ein Erlebnistyp und ein Typ eines physikalischen Gegenstandes), zu verstehen. Viele Kunstwerke lassen Raum für freie Interpretationen des Zuschauers oder Hörers usw.
Nun kann man des Weiteren nach der „Entstehung“ eines Werkes fragen. Zunächst gibt es realisierte und nicht-realisierte Werke der bildenden Kunst. Das spricht dafür, dass Werke nicht die Werke selbst sind, sondern (nur) als „Realisierungen“ derselben verstanden werden können. Man geht also von der Herstellung eines Plans oder Konzepts für ein Werk aus. Jedoch könnte es verschiedene korrekte Realisierungen eines Konzepts geben, indem beispielsweise „Unvollständigkeitsstellen“ von den Interpreten ausgefüllt würden. Das wiederum bedeutet, dass niemals alle Eigenschaften möglicher Realisierungen festgelegt werden und es qualitativ verschiedene korrekte Realisierungen gibt. (Hierbei gibt es nicht so große Unterschiede zwischen den einzelnen Kunstformen. Auch Werke der bildenden Kunst können schließlich abstrakte Aspekte haben und müssen nicht rein materielle Gegenstände sein.)
Zum Schluss dieses Kapitels möchte ich noch auf weitere wichtige Fragestellungen der Kunstphilosophie zu sprechen kommen, von denen einige schon zuvor von mir angedeutet worden sind. Gibt es grundlegende Unterschiede von Kunst und Wissenschaft, die eventuell erklären können, warum es so schwierig scheint, eine philosophisch begründete Definition von Kunst zu liefern? Wo liegen die Unterschiede in der Vorgehensweise und der Zielsetzung beider Disziplinen? Außerdem möchte ich es nicht unterlassen, auf die Rolle des Künstlers und die des „Kunst-Rezipienten“ einzugehen. Was bedeutet es, Kunst zu machen oder Kunst zu erfahren? Welche Fähigkeiten sind dafür jeweils von Nöten und was kann „künstlerische Begabung“ bedeuten?
Zunächst einmal ist die Besonderheit der Kunst, dass sie im Gegensatz zur Wissenschaft, einen sehr individuellen und „unmethodischen Charakter“ besitzt. Das bedeutet, sie ist weder einsehbar noch vorher bestimmbar, was insgesamt einer wissenschaftlichen Vorgehensweise widerspricht. Deshalb scheint eine wissenschaftliche Forderung in der Kunst zumindest unangemessen; schließlich hebe sie die Möglichkeit zur individuellen Gestaltung auf. Außerdem scheint die Zielsetzung beider Disziplinen unterschiedlich zu sein. Während die Wissenschaft die „Erkundung und Mehrung von Wissen“ im Blick hat, spricht die Kunst oftmals die „bewusste Erfahrung des Seins in dieser Welt“ an und kann zu den Sinnen zurückführen. Die Kunst besitzt demnach eine „erfahrbare Qualität“ im Gegensatz zu einer „objektiv messbaren Qualität“ in der Wissenschaft. Das erklärt, warum Aussagen über Kunst nur subjektiv möglich zu sein scheinen. Außerdem würden Regeln und Definitionen die Kunst so einschränken, dass sie enden würde; denn „wo die Regel“ regiert, verlören menschliche Handlungen ihre kreative Freiheit. Eine weitere Besonderheit der Kunst ist, dass sie praktisch immer am Ziel zu sein scheint und immer einen „Einmaligkeitsaspekt“ (S.54) zu besitzen scheint. Im Gegensatz dazu gliedert sich die wissenschaftliche Forschung stets in eine Kette vorangegangener Forschungen und bereitet zukünftige Forschungen vor; ist also stets „auf dem Weg“. Das bedeutet folglich, dass man, um Wissenschaft richtig betreiben zu können, ein gewisses Maß an Vorwissen auf dem jeweiligen Gebiet und Wissen um die entsprechenden Methoden besitzen muss. In der Kunst scheint das etwas anders auszusehen. Hier ist eine „andere Herangehensweise“ gefragt, die als Grundlage eine „persönliche Involviertheit“ zu fordern scheint. Eine Voraussetzung zum Verständnis von Kunst scheint zunächst, sie als solche zu akzeptieren. Während in den Wissenschaften analytische Fähigkeiten im Vordergrund stehen, muss es dem Künstler gelingen, seine „bewussten wie unbewussten Kräfte“ zusammenzuführen, um etwas Eigenes, Neues zu schaffen. Das bedeutet wiederum auch immer eine Preisgabe von etwas von sich selbst für den Künstler. Aber was genau leistet die Kunst für den, der sie schafft und für denjenigen, der sie betrachtet? Immerhin nimmt sie einen erheblichen Stellenwert im alltäglichen Leben eines jeden ein, ob er sie nun bewusst praktiziert oder sie unbewusst wahrnimmt (konsumiert). Die Kunst scheint die Fähigkeit zu besitzen, Einfluss auf Menschen auszuüben. Durch das Betrachten eines Bildes oder das Hören von einem Musikstück kann sich „die Sicht des Menschen auf die Welt“ ändern und eine neue Perspektive eingenommen werden. (Dies scheint die Kunst unter anderem mit der Religion oder auch der generellen Spiritualität in Verbindung zu bringen. Dies sei hier aber nur am Rande erwähnt.) Welche Effekte welches Kunstwerk auf welche Personen haben kann, ist tatsächlich nicht festgelegt. Entscheidend ist, dass Kunst unterschiedlichste Möglichkeiten einer „Weltaneignung“ (S.291) bietet. Sie besitzt das Potenzial, Einstellungen zu ändern, Gefühle anzuregen und ganz neue Zusammenhänge zu schaffen, ob sie nun in Form eines Musikstückes, Theaterstückes oder eines Bildnisses usw. auftritt.
Ein Wegfallen der Kunst würde demnach bedeuten, dass dieser Raum der kreativen Möglichkeiten, immer neue Erfindungen (Werke) hervorzubringen, nicht bestünde. Aber gerade diese „Werke“ scheinen für das Wohlergehen und die Orientierung der Menschen in kultureller Sicht unverzichtbar. Verbiete man die Kunst, verbiete man einen Teil des menschlichen Wesens, welches sich auf immer unterschiedliche Weise auszudrücken sucht und seine „Mitmenschen“ durch seine „Schöpfungen“ einnehmen kann, wie es auf keine andere Weise geschehen könnte. Das erklärt vielleicht, warum es so viele verschiedene Kunstformen und Ausdrucksmöglichkeiten gibt, die scheinbar alle miteinander in Verbindung stehen und etwas gemeinsam haben, indem sie unter anderem (jeweils auf ihre eigene Weise) auf den Menschen einwirken und ihn „lenken“ können.
2.2 Einführung in die Darwin’sche Evolutionstheorie
Nach Darwin entstammen alle Lebewesen der Evolution. Im Jahre 1859 erschien sein evolutionstheoretisches Hauptwerk „On the Origin of Species by Means of Natural Selection“. Evolution bedeutet ganz allgemein „Entwicklung“ und so liefert die Evolutionstheorie eine wissenschaftliche und „umfassende Erklärung für den Wandel der Organismen seit der Entstehung des Lebens vor über 3 Millionen Jahren“ (Vgl. Mayr 2003, S.26 in: „Der Mensch- Evolution, Natur und Kultur“). Das evolutionäre Denken kann als eine der größten Umwälzungen in der Geschichte der biologischen Gedankenwelt verstanden werden (siehe Mayr 1984), gilt „Evolution“ heute doch als „der wichtigste Begriff der gesamten Biologie“.
Mein Ziel in diesem Abschnitt ist es, einen groben Überblick der Evolutionstheorie zu schaffen, indem ich ihre wichtigsten biologischen Begriffe kläre und die Zusammenhänge unter ihnen skizzenhaft darlege. So sollen die Grundlagen der evolutionären Prozesse veranschaulicht werden. Da es sich bei der Evolutionstheorie um eine sehr umfassende, komplexe Theorie handelt, sollen jedoch auch ihre Methoden und Fragestellungen geklärt werden, um ihre Rolle für das Verständnis der Welt und ihre Lebewesen nachzuvollziehen.
Das Vorkommen aller Lebensformen ist auf einen generationsübergreifenden Prozess der jeweiligen Anpassung an die natürlichen Umweltbedingungen zurückzuführen. Das bedeutet, es herrschen unterschiedliche Verwandtschaftsgrade zwischen einzelnen Arten und die Nähe dieser Verwandtschaft definiert jeweils eine Art oder trennt zwei Arten voneinander.
Aber was genau bedeutet „Anpassung“ in diesem Zusammenhang zunächst einmal? Es bedeutet, dass die Natur immer versucht, die Merkmale einer Generation, die für das Überleben von Vorteil sind, zu fördern und diejenigen, die von Nachteil sind, zu unterdrücken. Bei den Merkmalen handelt es sich hierbei sowohl um Strukturen als auch um Verhaltensweisen; also sowohl körperliche Merkmale wie geistige Fähigkeiten.
Entsprechend sind nicht nur physiologische und morphologische Eigenschaften, sondern auch Verhaltensweisen und der Geist Produkte der Anpassung (siehe hierzu S.140/141).
Dieser allem zu Grunde liegende Prozess wird als „natürliche Auslese“ bezeichnet. Darwin ging davon aus, dass man, „von jeder Einzelheit der Struktur in jedem lebenden Geschöpf annehmen (kann), dass sie entweder von besonderem Nutzen für einen Vorfahren war oder sie jetzt von Nutzen für die Nachkommen dieser Form ist, entweder direkt oder indirekt durch die komplexen Gesetzte des Wachstums“ (Darwin 1859, S. 199 f.).
Die Nützlichkeitstheorie besagt also, dass sich sämtliche Merkmale nur „halten“, wenn sie von „biologischen Nutzen“ sind, also den Aufwand an Zeit und Energie, den sie kosten, durch ihren jeweiligen Nutzen überbieten.
Aber wie genau funktioniert die natürliche Auslese? Wie kommt es zu einer „Beibehaltung der vorteilhaften Abweichungen und der Eliminierung, also der „Verwerfung“ der nachteiligen Abweichungen (Darwin 1859, S.121)?
Um den Prozess der natürlichen Auslese samt ihrer Auswirkungen und Folgen richtig zu begreifen, ist es wichtig, sich vor Augen zu halten, dass es sich hierbei um einen „Zwei-Stufen-Prozess“ handelt. Der erste Schritt ist die „Herstellung von Variation in jeder Generation“, von zahllosen genetischen oder phänotypischen Varianten, die als Ausgangsmaterial der Selektion dienen können (S.125). Die Selektion ist somit (nur) der zweite Schritt der natürlichen Auslese.
Betrachten wir zunächst den ersten Schritt der natürlichen Auslese:
Ursprung aller Variation und ihrer Vererbung sind die „Mendelschen Gesetze“, die um 1900 entdeckt wurden (vgl. S.125). Bei der Verbindung handelt es sich um eine „Neuordnung der Gene“, was als „genetische Rekombination“ bezeichnet wird. Dies betrifft die sexuelle Fortpflanzung und schafft eine enorme Vielfalt von Variationen.
Dies bedeutet, dass in jeder Generation ein von Grund auf neues Genreservoir vorhanden ist und jedes Individuum sozusagen als „neues Experiment der Natur“ betrachtet werden kann. Es existieren komplexe Informationsprogramme in der DNA des Keimplasmas (S.48), die eine gewisse Regelmäßigkeit der vererbten Merkmale verursachen, jedoch ist die Variation niemals zielgerichtet, unterliegt sie doch zudem zahlreichen Mutationen, die (selbst) wiederum dem Zufall unterliegen (S.126, Z.7/8).
Somit besteht keine direkte Beziehung zwischen der Entstehung neuer Genotypen und den Anpassungsbedürfnissen eines Organismus in einer bestimmten Umgebung (siehe hierzu Mayr 1963, S.176).
Fest steht jedoch, dass die Variation für Unterschiede in den Geno- und Phänotypen der Individuen sorgt. Das führt (zwangsläufig) auch zu jeweils unterschiedlicher „Fitness“.
Unter der „Fitness“ wird in der Biologie die „Fähigkeit des Beitrags zum Genpool“ verstanden. Genauer gesagt, ist die Fitness eines Organismus seine Veranlagung, in einer spezifischen Umwelt und Population zu überleben und sich zu reproduzieren (vgl. Mills und Beatty 1979, S.42, Brandson 1978, Beatty 1990).
Hiermit sind wir im zweiten Schritt der natürlichen Auslese angelangt, der „Selektion“.
„Selektion ist ..., weil diese Individuen zufällig über eine Kombination von Merkmalen verfügen, die sie in der Konstellation von Umweltbedingungen, auf die sie in ihrem Leben treffen, begünstigen“ (S.122).
Wichtiger Faktor der Selektion ist die „sexuelle Auslese“, die, wie schon angesprochen, die „erfolgreiche Fortpflanzung“ anstrebt. Da aufgrund der Variation die Individuen so unterschiedliche Ausprägungen haben, lastet jeweils ein unterschiedlicher „Selektionsdruck“ auf ihnen. Dasjenige Individuum, welches die in Bezug auf die jeweiligen Lebensbedürfnisse optimalsten Strukturen und Verhaltensweisen aufweist, wird es in der Regel leichter haben, in einer Umwelt zurecht zukommen und sich fortzupflanzen. Betont seien hier die „relativ“ optimalen Strukturen und Verhaltensweisen, da diese je nach Umweltbedingungen wandelbar sind. Das bedeutet, dass „Perfektion“ oder „perfekte Angepasstheit“ im Sinne der Selektion relativ sind (also je nach Umwelt) (vgl. S.119). Somit kann Perfektion in der Angepasstheit niemals ganz bestehen, was einer „Unvollkommenheit“ in der Natur gleich kommt.
Aber zurück zur sexuellen Auslese. In der Regel kommt es bei „ sich sexuell fortpflanzenden“ Lebewesen zu einer „female choice“, was soviel bedeutet wie eine Wahl durch die Weibchen. Die Männchen sind von Natur aus danach bestrebt, sich so schnell wie möglich, so oft wie möglich und mit so vielen Partnerinnen wie möglich zu paaren und in der Folge ihre Gene so oft wie möglich weiterzugeben. Unterbunden wird dies durch verschiedene Faktoren. Wichtigste Einschränkung in der sexuellen Selektion stellt die Konkurrenz zu anderen Männchen dar. Oft kommt es hier zu einem „Konkurrenzkampf“, der sich in einem Kräftemessen äußert. Alternativ kann es auch zu einer „inszenierten Selbstdarstellung“ der eigenen „Vorteile“ kommen, die den Gegner einerseits einschüchtern und andererseits das Weibchen beeindrucken soll. So kann unter Umständen der „Kampf“, der oft auch tödlich enden kann, umgangen werden. Die Weibchen ziehen dann in der Regel den „Gewinner“ dieses Kräftemessens für die Paarung vor oder entscheiden sich aufgrund vieler Faktoren für denjenigen, den sie jeweils als „geeigneter“ befinden. Schwächere Individuen oder weniger beliebte Männchen werden so automatisch von der Fortpflanzung ausgeschlossen oder haben zumindest nur übermäßig selten die Möglichkeit, ihre Gene an die nächste Generation weiterzugeben.
Es muss an diesem Punkt jedoch beachtet werden, dass es sich bei der „sexuellen Auslese“ oft auch um eine „rein egoistische Auslese“ (S.134) handelt. Das bedeutet, dass es aufgrund „selbstsüchtiger“ Selektion für den reproduktiven Erfolg durchaus passieren kann, dass nicht immer die „vorteilhaften“ Gene vererbt werden (S.135, Z.2, 3).
Ergebnis ist, dass sich die „Anlage zur Fitness“ manchmal sehr von der „tatsächlichen Fitness“ unterscheidet und dass eben trotz vorteilhafter Erbanlagen der Beitrag zum „Genpool“ ausbleibt. Dies kann beispielsweise dadurch passieren, dass ein Individuum, welches „eine hohe Fitness“ besitzt, durch Zufall stirbt, bevor es sich fortpflanzen kann oder auch, wenn dieses Individuum trotz guter Gene kein Interesse am anderen Geschlecht zeigt, sein Verhalten also „nicht gerade förderlich“ im Sinne der sexuellen Selektion ist.
Es gibt also in jeder Generation „unzählige Lösungsmöglichkeiten“ (S.124), somit unterliege der „Optimierungsprozess“ der natürlichen Auslese, welcher dazu tendiert, „jedes Lebewesen genauso vollkommen oder ein wenig vollkommener zu machen, als die vorangegangene Generation“ (1859 S.201 und S.472, S.135, 2. Abschnitt). Die Auslese unterliegt auch im zweiten Schritt der Selektion zahlreichen „Einschränkungen“. (Kann also, wie zuvor schon angesprochen, nie zur „Perfektion“ führen.)
Zudem kodieren Gene jeweils mehrere Merkmale: Beeinflusst ein Gen viele Merkmale, so wird es aufgrund der Wichtigsten dieser Eigenschaften selektiert; die anderen Merkmale werden beiläufig mitgenommen (vgl. S.143/144). Diese „Zufälligkeit“ vieler biologischer Prozesse sorgt dafür, dass es bei den meisten von Ihnen nur einen statistischen Voraussagewert geben kann. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass es keinen Kausalzusammenhang der biologischen Prozesse gibt (denn die Voraussagbarkeit ist keine notwendige Komponente der Kausalität) (vgl. S.41).
Wie sehr es bei der natürlichen Auslese auch um die Rolle des Individuums und der Population geht, lässt sich (nur) begreifen, indem man sich näher mit dem Begriff der Spezies auseinandersetzt; was im folgenden Abschnitt geschieht:
Die Untersuchung der Spezies wird denn auch oft als die „Hauptaufgabe“ der Biologie verstanden. Darwins „Ursprung der Arten“ erschien 1889. Der Begriff der Art ist synonym zu dem Begriff der Spezies. Die Artbildung wird denn auch als „Speziation“ bezeichnet.
Das biologische Artkonzept geht von verschiedenen „Verwandtschaftsbeziehungen“ aus. Das bedeutet, dass alle lebenden Organismen grob genommen miteinander „verwandt“ sind oder besser ausgedrückt, einen „gemeinsamen Ursprung“ haben. Entscheidend hierbei ist die Nähe beziehungsweise Entfernung dieser Verwandtschaft, also wie weit diese genetische Verbindung jeweils zurückliegt.
Um das genau zu verstehen, muss man sich vor Augen führen, dass Arten „veränderlich und vergänglich“ sind. Jeder Organismus, jedes Lebewesen ist (wie schon zuvor angesprochen) ein Produkt einer langen Geschichte, ein „Glied einer Evolutionskette sich wandelnder Formen...“, hat also einen geschichtlichen Hintergrund (vgl. S.38).
Man könnte auch sagen: „Eine evolutionäre Spezies ist eine Abstammungslinie (eine Vorfahren-Nachkommen-Sequenz von Population), die sich unabhängig von anderen und gemäß ihrer eigenen, einzigartigen evolutionären Bedeutung und ihrer Tendenzen entwickelt“ (S.213; Simpson 1961, S.153).
Dies wäre dann der evolutionäre Speziesbegriff, eine von verschiedenen (möglichen) Speziesdefinitionen (je nachdem, aus welcher Perspektive die Spezies betrachtet wird). Daneben gibt es noch weitere Speziesdefinitionen und Begriffe, wie (beispielsweise) den typologischen, den nominalistischen und den biologischen Speziesbegriff.
Schauen wir uns den „biologischen Speziesbegriff“ etwas näher an. Er definiert die Spezies, als Population, in der die Individuen durch einen gemeinsamen „Genpool“ miteinander verbunden sind (S.201). (Genpool bezeichnet die Gesamtheit aller Gene einer Population. Der gemeinsame Genpool meint also, dass die DNA der Populationen sehr „ähnlich“ ist beziehungsweise, dass es sich um de gleiche Art von DNA handelt). Verbunden meint in diesem Sinne die „Durchmischung der Gene untereinander“ oder genauer gesagt, die Fähigkeit, sich untereinander kreuzen zu können. Entsprechend ist eine Art von anderen Arten (deren DNA ungleich ihrer ist) reproduktiv isoliert. (vgl. Mayr, S.59: „Eine Art ist eine Gruppe natürlicher Populationen, die sich untereinander kreuzen können und von anderen derartigen Gruppen reproduktiv isoliert ist.)
Zur Veranschaulichung soll folgendes Beispiel dienen: Ein Perserkater kann sich mit einer Kartäuserkatze paaren und Nachkommen zeugen. Die Nachkommen werden umgangssprachlich als „Mischlinge“ bezeichnet, entstammen sie doch zwei verschiedenen Katzenrassen und besitzen sowohl Merkmale der einen als auch der anderen Rasse. Das bedeutet gleichzeitig, dass es sich bei ihnen um dieselbe Spezies (die der Katzen) handelt, mit einem gemeinsamen Genpool, der sie verbindet. Die Paarung zwischen einer Katze und einer Raubkatze (zum Beispiel einem Tiger) ist jedoch nicht mehr möglich, da es sich um zwei getrennte (wenn auch nah verwandte) Spezies handelt.
Manchmal fällt die Abgrenzung aber schwieriger aus, da die Merkmale nicht ganz so eindeutig scheinen: Beispielsweise kann sich das Pferd mit einem Esel paaren und infolge dessen auch Nachwuchs zeugen. Dieser Nachwuchs wird dann als „Maultier“ bezeichnet und besitzt sowohl Merkmale des Pferdes (seine Größe) als auch Merkmale des Esels (seine langen Ohren). Handelt es sich nun bei Pferd und Esel um die gleiche Art? Nicht ganz. Die DNA von Esel und Pferd scheint zwar ähnlich genug zu sein, um sich zu kreuzen und Nachwuchs zeugen zu können, jedoch (und das ist der entscheidende Punkt) kann sich das Maultier selbst nicht fortpflanzen (weder mit einem Pferd noch einem Esel noch einem anderem Maultier), was bedeutet, dass es (wenn auch verspätet) „reproduktiv isoliert“ ist. Die Verwandtschaft von Esel und Pferd scheint also evolutionsbiologisch relativ nah beieinander zu liegen, jedoch greifen bereits „Isolationsmechanismen“ ein, die von einem Artenwechsel zeugen. Es gibt verschiedenste Sorten von „Isolationsmechanismen“ (S.122 Mitte). Wenn man von einer Gründerpopulation ausgeht, kann sich diese aus verschiedenen Gründen in zwei oder mehrere Populationen aufsplittern und letztlich kann der genetische Drift jeweils so stark sein, dass es zur Trennung der Ursprungspopulation kommt und eigenständige Arten entstehen, deren Genfluss nun unterbunden ist. Es kann hierbei die „allopatrische, sympatrische und die parapatrische Artbildung“ differenziert werden, welche jeweils von anderen Ursachen der Isolation ausgeht. Diese sollen an dieser Stelle skizzenhaft erläutert werden:
Die allopatrische Artbildung setzt eine „geographische Isolation“ voraus. Diese räumliche Trennung der Individuen der Ausgangspopulation in zwei oder mehrere Teilpopulationen kann beispielsweise durch Umweltkatastrophen, Kontinentaldrift, Inselbildung oder Gebirgsbildung entstehen. Der Genfluss wird somit gezwungenermaßen unterbunden, da die Populationen nicht aufeinander treffen können, indem sie räumlich voneinander entfernt sind. Aufgrund unterschiedlicher Selektionsfaktoren, die in unterschiedlichen Umweltverhältnissen herrschen, und zahlreichen zufälligen Mutationen, die sich im Genpool der jeweiligen Teilpopulation verbreiten, entwickeln sich die „Teilpopulationen“ jeweils unterschiedlich und driften förmlich auseinander („Gendrift“). Am Anfang dieses Stadiums, also zu Beginn der Trennung, fallen die unterschiedlichen Entwicklungsbahnen noch nicht so stark ins Gewicht, ein Genfluss untereinander wäre also theoretisch noch möglich; jedoch kommt es nach einigen Generationen der örtlichen Trennung, in denen kein Genfluss stattfindet, automatisch zur „reproduktiven Isolation“, da die DNA der jeweiligen Population sich zunehmend voneinander unterscheidet.
Bei der sympatrischen wie auch parapatrischen Artbildung erfolgt die Aufspaltung der ursprünglichen Art ohne örtliche Trennung, also im selben Gebiet. Selektionsmechanismen sind hier die „sexuelle Selektion“, die ich zuvor schon angesprochen habe, sowie die unterschiedliche Besetzung von Nischen (im selben Gebiet). Hierzu passt beispielsweise die folgende Definition: „Eine Spezies ist eine reproduktive Gemeinschaft von Populationen, die in der Natur eine spezifische Nische besetzt.“ (1982, S.273).
Aber wie genau geht hier der Artbildungsprozess vor sich, also wie entwickeln sich hier aus einer Spezies mehrere? Durch die Variation an Merkmalen, die in jeder Generation vorhanden ist und zusätzlich durch zufällig auftretende Mutationen verstärkt wird, kann es passieren, dass sich die Individuen einer Art auf jeweils unterschiedliche Weise an ihre Umwelt anpassen. Ein Beispiel hierzu: Ein besonders schnelles Individuum einer Art vermag, hinter einem schnellen Hufentier herzujagen und dieses zu erfassen. Es wird ihm leicht gemacht, dieses Hufentier als Hauptnahrungsquelle wahrzunehmen. Sein Organismus wird sich entsprechend auf diese Form des Nahrungserwerbs einstellen. Weniger schnelle Individuen der gleichen Art werden dem Konkurrenzdruck bei der Jagd nach Hufentieren unterliegen. Das muss aber nicht zwangsläufig bedeuten, dass sie durch den Prozess dieser natürlichen Selektion aussterben. Es kann auch dazu kommen, dass ihre zufällige Andersartigkeit in Bezug auf andere Nahrungsquellen (die in demselben Gebiet vorkommen) von Vorteil ist. Sind sie beispielsweise besonders gute Kletterer, werden sie es wahrscheinlich leicht haben, an Beute zu gelangen, die auf Bäume flüchtet. Je stärker dann die jeweils geforderten Merkmale, wie beispielsweise lange Krallen usw. ausgeprägt sind, desto erfolgreicher werden diese Individuen bei der Nahrungsbeschaffung sein. Da sich beide Populationen, die Jagenden und die Kletternden trotzdem im selben Gebiet befinden, kann es noch lange Zeit zu Kreuzungen zwischen ihnen kommen. Deshalb verläuft der Artenwechsel hier viel langsamer als bei der allopatrischen Artbildung. Trotzdem werden sich im Laufe der Generationen die zwei Populationen sehr wahrscheinlich unterschiedlich und letztlich auseinander entwickeln. Idealerweise wird sich die eine Population ausschließlich auf das Jagen im Lauf spezialisieren und die andere auf das Klettern, bis sich beide Populationen in ihren Merkmalen so sehr unterscheiden, dass der Genfluss untereinander automatisch unterbunden ist und zwei verschiedene (sehr nah verwandte) Arten vorliegen.
Durch die Auflistung dieser verschiedenen Möglichkeiten zur Artentstehung sollte deutlich geworden sein, wie komplex (und langwierig) die Vorgänge der Evolution sind. Wichtig anzumerken ist, dass die „Verbindungsglieder“ der Populationen einer Art meist nur kurze Zeit bestehen und deshalb, nachdem lange Zeit vergangen ist, nicht leicht nachzuweisen sind; was die „Nachverfolgung“ des jeweiligen Artentstehungsprozesses oft erschwert.
Für den genetischen Drift mitverantwortlich sind noch viele weitere Faktoren, wie beispielsweise die „Größe der Population“. In kleineren Populationen wirken sich zufällig auftretende Mutationen natürlich viel stärker auf den Genpool der Gesamtpopulation aus, als in großen; Veränderungen verlaufen hier also entsprechend schnell.
Wichtig neben der Konkurrenz zwischen den Individuen einer Spezies ist zudem die Konkurrenz zwischen den Spezies. Der Konkurrenzkampf zwischen den Arten gilt mit als einer der wichtigsten Selektionskräfte (der natürlichen Auslese). Es herrschen zahlreiche ökologische Wechselbeziehungen zwischen den Spezies (Lack 1944, S.179), die den Verlauf ihrer jeweiligen Entwicklung entscheidend mitbeeinflussen. Jede Art besetzt ihre jeweilige Nische und idealerweise können die verschiedenen Arten so auf lange Zeit nebeneinander (oder eben räumlich voneinander getrennt) leben. Sowohl ihr Aussehen als auch ihr Verhalten wird im Laufe der Evolution (mehr oder weniger perfekt) auf die jeweiligen Lebensumstände angepasst. Ändern sich die Umweltverhältnisse sehr schnell, braucht es etwas Zeit, bis sich die Organismen den neuen Verhältnissen wieder angepasst haben. In jedem Fall unterstehen sie einem stetigen Wandel.
Die jeweiligen Merkmale einer Art lassen sich von Forschern untersuchen, indem man sie in Komponenten zerlegt und diese verfolgt. So werden Rückschlüsse auf die jeweiligen Selektionsbedingungen gezogen. Außerdem lässt sich die exakte Nähe der Verwandtschaft mittlerweile durch DNA-Tests bestimmen. Je weiter die Zweigstelle der Verwandtschaft evolutionär betrachtet entfernt ist, desto geringer sind Gemeinsamkeiten in der DNA und entsprechend spricht eine sehr ähnliche DNA für die sehr nahe Verwandtschaft zweier Spezies, beispielsweise dafür, dass die gemeinsamen Wurzeln (evolutionär betrachtet) nicht lange zurückliegen. Des Weiteren gibt es natürlich archäologische Funde, die die Untersuchung ergänzen und die idealerweise in ihren Ergebnissen übereinstimmen. Durch die in sich stimmigen Ergebnisse der unterschiedlichsten Forschungsarbeiten wird die Evolutionstheorie immer wieder in ihrer wissenschaftlichen Korrektheit bestätigt. Wenn man das Prinzip der Evolutionstheorie einmal verstanden hat, eröffnet sich ein tieferes Verständnis für jegliche Erscheinungen und Vorgänge, die sonst unerklärlich erscheinen. Selbst komplexe Verhaltensweisen und eigene Besonderheiten der jeweiligen Arten lassen sich auf die evolutionäre Entwicklung zurückführen. Sie sind zwar nicht zwangsläufiges Ergebnis dieser Hintergründe, jedoch direkte Ergebnisse der natürlichen Auslese (mit all ihren Prinzipien und Zufälligkeiten). (Die Lebewesen sind (metaphorisch ausgedrückt) wie Spieler, die an einen gewissen Verhaltensspielplan (bestimmte Spielregeln) gebunden sind. Jeder Spielzug in die eine oder andere Richtung ist mit Konsequenzen für den Ausgang des Spiels verbunden. Es müssen also individuelle Strategien entwickelt werden, um sich im Spiel zurecht finden zu können und nicht „aus dem Spiel auszuscheiden“). Spielerisch wird das Ganze jedoch von den Teilnehmern nicht genommen, denn was auf dem Spiel steht, ist nicht mehr oder weniger als ihre Existenz.)
Hier kann angemerkt werden, dass die Entstehung und das Aussterben von Arten ein ewiger Kreislauf (des Lebens) ist. Mehr als 99 Prozent aller Spezies, die je auf Erden existiert haben, sind mittlerweile ausgestorben. Es geht also immer nur um die Dauer ihrer Existenz, sie besitzen also niemals eine Garantie für Ewigkeit. So gut die natürliche Auslese auch funktioniert, sie scheint die Arten nie perfekt an ihre Umwelt anpassen zu können. Sie befinden sich jeweils in einem ständigen „Wettrüsten“ und unterliegen insofern oft Krankheitserregern, Konkurrenzkampf usw. Hinzu kommen ferner Klimakatastrophen und ähnliche Umweltveränderungen, die ebenfalls zum Aussterben von Arten führen können.
Nachfolgend soll auf die komplexen Verhaltensweisen zurückgekommen werden, die sich evolutionär entwickelt haben. Hierzu lässt sich auch das „Sozialverhalten“ zählen, welches oft als „evolutionäres Erfolgsmodell“ bezeichnet wird. Lebewesen, die zu Sozialverhalten fähig sind und in sozialen Gruppen leben, können untereinander kooperieren und kommunizieren. Dies macht beispielsweise „Aufgabenverteilung“ möglich. Zahlreiche Lebewesen verhalten sich denn auch auf ihre jeweils individuelle Weise „sozial“. Es ließen sich hierzu zahlreiche Beispiele aufführen, die jedoch den Umfang der Arbeit sprengen würden. Deshalb hier nur eine sehr knappe Auflistung von Beispielen am Rande, auf die jedoch nicht weiter eingegangen werden soll. So lässt sich die: Herdenbildung bei Elefanten, Rudelbildung bei Löwen, Koloniebildung bei Bienen oder auch Schwarmbildung bei Fischen nur durch die Fähigkeit zu Sozialverhalten erklären. Die soziale Gruppe bietet aus evolutionärer Sicht zahlreiche Vorteile für das Überleben von Spezies (worauf „an dieser Stelle“ nicht weiter eingegangen werden soll). Hieraus ergeben sich wiederum zahlreiche andere Verhaltensweisen, die, da sie für das Leben in Gruppen von Vorteil zu sein scheinen, sich evolutionär weiterentwickeln, verfeinern und verfestigen konnten. (Inwiefern „Moralvorstellungen“, wie beispielsweise der Altruismus, hierauf zurückzuführen sind, lässt sich an dieser Stelle nur erahnen. Die Tatsache, dass diese komplexen Fähigkeiten existieren, ist ein Zeichen für die weitreichenden Auswirkungen der Evolutionstheorie.)
[...]
- Arbeit zitieren
- Lotte Virnich (Autor:in), 2014, Kunst & Evolution in Winfried Menninghaus "Wozu Kunst?", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/293717
Kostenlos Autor werden
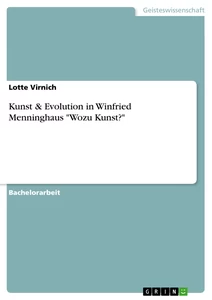
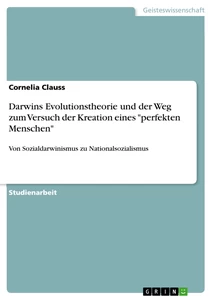












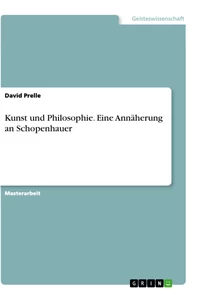
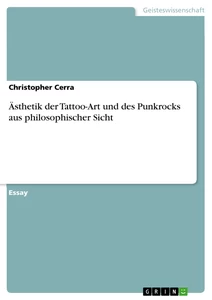




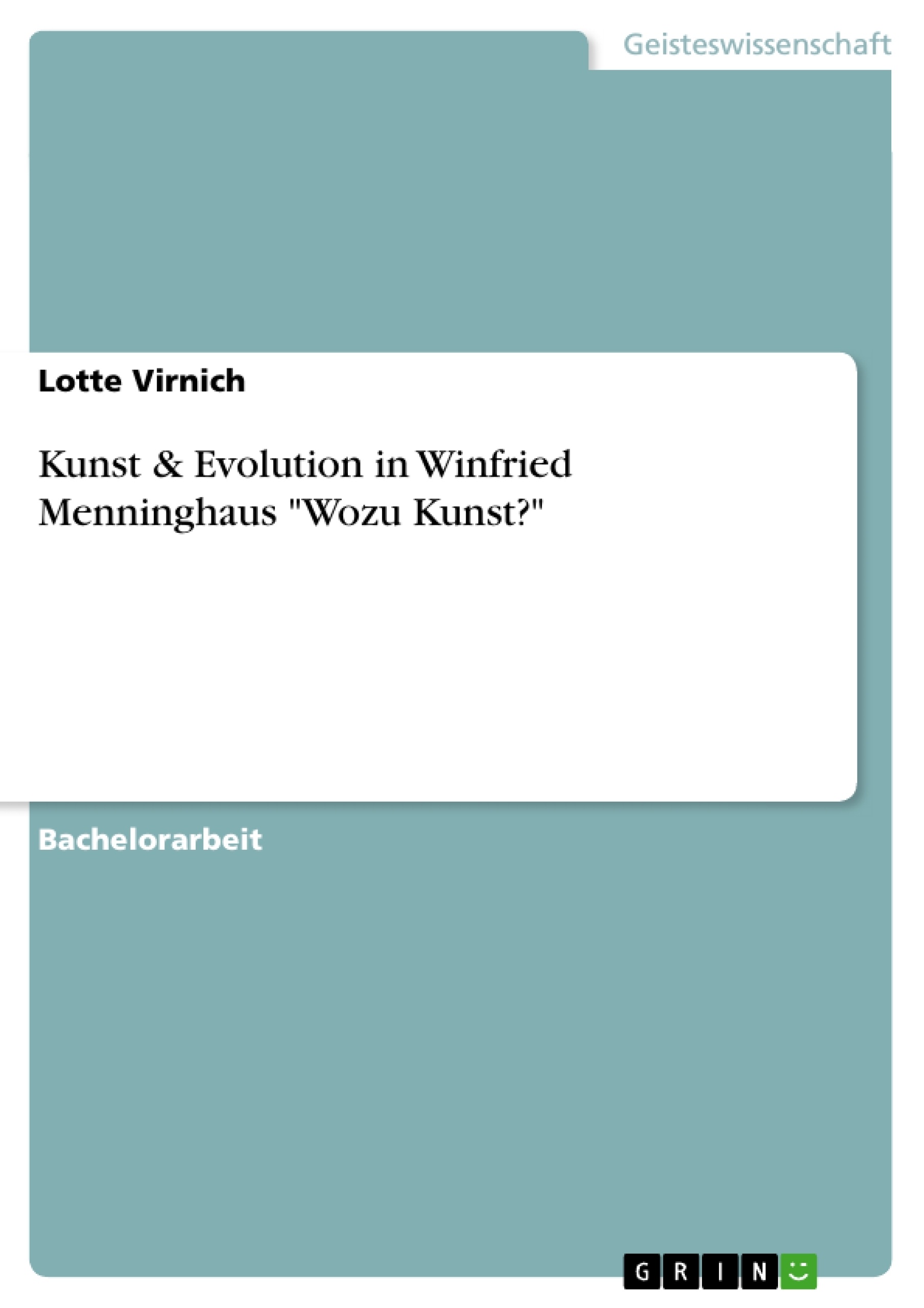

Kommentare