Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Theoretische Hinführung
2.1 Sex und Gender
2.2 Homosexualität
2.3 Lesbische Identität
2.4 Die Geschichte des Frauenfußballs
3. Methodisches Vorgehen
3.1 Problemzentriertes Interview
3.2 Vorstellung der Befragten
3.3 Leitfaden
4. Identitätsfindung und Geschlechterrollen
4.1 Geschlechterrollen im Frauenfußball
4.1.1 Zwischen Sportlerin-Sein und Frau-Sein
4.1.2 Geschlechterrolle im Fußball versus Geschlechterrolle im Alltag
4.1.3 Neutralisierung von Geschlecht im Frauenfußball
4.1.4 Das Spiegelbild der eigenen Geschlechterrolle
4.2 Mediale Darstellung von Geschlecht im Sport
4.2.1 Mediale Darstellung von Fußballerinnen
4.2.2 Mediale Darstellung von lesbischen Fußballerinnen
4.2 Sexuelle Identitätsentwicklung und Coming-Out
4.3 Identitätskonflikte
5. Frauenfußball und Homosexualität
5.1 Homosexualität im Verein
5.2 Das Klischee „Kampflesbe“
5.3 Homophobie
6. Fazit
7. Literatur- und Quellenangaben
8. Anhang
1. Einleitung
„Blond und heterosexuell ist ein Glücksfall", lautet die Schlagzeile über Fußballna-tionalspielerin Nia Künzer, in einem Artikel der Welt online im September 2007.[1] Nia Künzer war das so genannte „Golden-Girl" der Fußballweltmeisterschaft 2007 in China. Doch warum ist ihre Heterosexualität ein Glücksfall?
Auch Gerhard Hofer veröffentlichte im Juni 2009 einen Artikel bei DiePresse.com in dem er eindeutig die Sexualität von Fußballspielerinnen thematisiert: „80 Prozent der Fußballerinen sind lesbisch" lautet der Titel.[2] Solche Aussagen regen zum Nachfragen an. Wie viel Wahrheit steckt darin? Stimmt es, dass vor allem lesbische Frauen Fußball spielen? In dieser Arbeit soll darum der Zusammenhang von Homosexualität und Frauenfußball diskutiert werden.
Anhand von problemzentrierten Interviews mit neun lesbischen Fußballspielerinnen - aktiv in unterschiedlichen Vereinen im Raum Mainz, Frankfurt/Main und Landau/Pfalz - und einem Kurzinterview mit Monika Koch-Emsermann - Pionierin des Frauenfußballs und ehemalige Trainerin und Managerin des FSV Frankfurt - werde ich analysieren, welchen Einfluss Fußball und das soziale Umfeld des Fußballs auf die Geschlechtsidentität von Frauen hat. Oder umgekehrt: Inwiefern die Geschlechtsidentität von Frauen sie dazu bewegt, Fußball zu spielen.
Um bestmöglich alle Themengebiete abzudecken, die den Zusammenhang zwischen Homosexualität und Frauenfußball erklären können, ist die Arbeit folgendermaßen gegliedert: Kapitel 2 wird zum einheitlichen Verständnis eine Einführung von Begriffen wie Sex und Gender, Homosexualität und lesbischer Identität geben. Auch die Geschichte des Frauenfußballs wird dort in kurzen Zügen erläutert. Es darf nicht außer Acht gelassen werden, dass Frauenfußball in Deutschland lange Zeit keine Selbstverständlichkeit war.
Die Übersicht über den aktuellen Forschungsstand, die Wahl der Methode, ein Interviewleitfaden und die Präsentation der Befragten werden in Kapitel 3 dargestellt.
Der größte Themenkomplex der Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema Geschlechterrollen und Identitätsfindung in Kapitel 4.
Fußball - die Männerdomäne in Deutschland - beeinflusst durch das körperbetonte Spiel, Aggressivität und kämpferische Grundhaltung Geschlechterrollen von Fußbal- lerinnen (Kapitel 4.1) und deren mediale Repräsentation (Kapitel 4.2). Interessant ist zu erfahren, welchen Einfluss das Bild von Fußballerinnen in den Medien und welchen Einfluss Mannschaftsmitglieder auf die Geschlechterrollen von Fußballerinnen haben. Schließlich können Geschlechterrollen - müssen aber nicht zwingend - Einfluss auf die Geschlechtsidentität einer Person haben. Zur Verdeutlichung wird ein Unterschied zwischen Geschlechterrollen im Alltag und im sozialen Umfeld Fußball gemacht (Kapitel 4.1.2).
Da sich Identität am Körper, nah an der Geschlechterrolle und durch Kontakt zu Mitmenschen entwickelt, werden wir uns in Kapitel 4.3 der Frage widmen, wie Fußballerinnen ihre Identitätsentwicklung erleben, und ob sie ihre Homosexualität mit dem Fußball in Verbindung bringen können. Inwiefern die Befragten Identitätskonflikte innerhalb und außerhalb des Fußballs aufgrund ihres Sports, ihrer Geschlechterrolle oder ihrer Homosexualität erfahren müssen/mussten, wird in Kapitel 4.4 thematisiert. Es gilt zu analysieren, ob der Rahmen, in dem Frauenfußball stattfindet, Fußballerinnen einen Fluchtort bietet und das Ausleben von Homosexualität begünstigt. Auch wird untersucht ob in den letzten Jahren, durch die steigende Anzahl an Fußballerinnen in Deutschland, eine Veränderung des Lesbenanteils im Fußball festgestellt werden kann.
In Kapitel 5 geht es um den sichtbaren Zusammenhang von Frauenfußball und Homosexualität. Prozentangaben aus verschiedenen Quellen und aus den Interviews, die Auskunft über den Lesbenanteil im Fußball geben, werden dort präsentiert.
In Kapitel 5.1 werden wir herausfinden, welche Bedeutung der Verein selbst für lesbische Frauen hat. Es wird diskutiert, welche Art von Umfeld ein Verein den Spielerinnen bietet, und welchen Einfluss dieses auf den Alltag von Spielerinnen hat. Dabei unterscheiden wir zwischen Vereinen auf dem Land und in der Stadt, um herauszufinden, ob der Verein - dort wo keine lesbische Szene etabliert ist - eventuell als Treffpunkt für lesbische Frauen fungiert.
Klischees von „Kampflesben“ im Fußball und der Tatsache, dass sich weder im Männer- noch im Frauenfußball SpielerInnen geoutet haben, sowie die Thematik von Homophobie im Fußball werden in Kapitel 5.2 und Kapitel 5.3 näher beleuchtet.
Da sich die Problematik von Homosexualität im Frauenfußball von der des Männerfußballs unterscheidet, wird der Fokus dieser Arbeit hauptsächlich auf Frauenfußball gelegt. Gerade weil es hier um einen in Deutschland klar definierten
Männersport geht, muss die Analyse von Homosexualität im Frauenfußball von der im Männerfußball getrennt werden.
Da über homosexuelle Frauen im Fußball bisweilen nur wenig geschrieben worden ist und generell - auch während der Frauenfußball Weltmeisterschaft 2011 - nur am Rande aus dem Privatleben von Fußballerinnen berichtet wird, spielen die Interviews eine große Rolle bei dem Bestreben mehr über die Existenz von Homosexualität im Frauenfußball zu erfahren.
2. Theoretische Hinführung
Um in den folgenden Kapiteln keine Missverständnisse aufkommen zu lassen und sicherzugehen, dass Begriffe einheitlich verstanden werden, nutze ich diesen Abschnitt für eine theoretische Hinführung zu den Begrifflichkeiten von Sex und Gender, Homosexualität und speziell lesbische Identität. Außerdem sollen Daten und Fakten über die Geschichte des Frauenfußballs zur Sprache kommen. All diese Punkte sind bei der Analyse einer möglichen Entwicklung von lesbischer Existenz im Frauenfußball zu berücksichtigen.
2.1 Sex und Gender
Sex und Gender sind zwei unterschiedliche Begriffe, die es nicht zu verwechseln gilt, da sie verschiedene Bedeutungen haben.Sex (das biologische Geschlecht) orientiert sich am Bau der Geschlechtsorgane beziehungsweise an der Anatomie des Körpers und wird als unveränderliches Faktum betrachtet. Gender (das soziale Geschlecht) bezeichnet die gesellschaftlich, sozial und kulturell geprägten Geschlechterrollen von Frauen und Männern, die erlernt werden und veränderbar sind. (Haubenberger 2009, 9)
Demnach hat jede Person ein biologisch gegebenes Geschlecht (Sex) und ein soziales Geschlecht (Gender). Das soziale Geschlecht lässt sich unter anderem durch die Interessen und Abneigungen einer Person, den Kleidungsstil, Gestik, Mimik und speziellen Verhaltensweisen charakterisieren. Die Geschlechterrolle kann Einfluss auf die sexuelle Identität einer Person haben, sie setzt aber keine bestimmte sexuelle Identität voraus.
Bis heute ist die gesellschaftliche Erwartungshaltung, dass eine Person des weiblichen Geschlechts auch eine weibliche Geschlechterrolle (Gender) entwickeln wird. Eine Kohärenz von Sex und Gender wird als quasi natürlich voraus- und Sex mit Gender gleichgesetzt. Als Grundlage für diesen Gedanken, scheint der biologische Ablauf der Reproduktion zu dienen: „Männer spenden Samen, Frauen gebären Kinder [...] für diesen Zweck - das leuchtet allen ein - müssen Mann und Frau sich zusammentun“ (vgl. Helfferich 1994, 16). Die menschliche Fortpflanzung bestätigt also [...] die Annahme, dass es entweder das eine oder das anderen Geschlecht gibt (Dichotomie), dass alle Menschen ihr Leben lang das gleiche Geschlecht haben (Konstanz) , und dass die Zugehörigkeit zu einem der beiden Geschlechtstypen aus biologischen Gründen von Natur aus gegeben sei (Naturhaftigkeit). (vgl. Hirschauer 1996, In: Hartmann-Tews 2003,18)
Allerdings gibt es weitaus mehr als nur das biologische Geschlecht (Sex). Unsere Geschlechterrolle verändert sich im Laufe des Lebens, niemand bekommt festgelegte Eigenschaften in die Wiege gelegt. „Mit der Einteilung in nur zwei Geschlechter sind Handlungen, Erwartungen und Zwänge verbunden [...] ", die beim Versuch der festen Einhaltung zu extremen Identitätskonflikten führen können (vgl. Walther- Ahrens 2011,26).
Schon Mitte der 1970er Jahre wurde erkannt, dass Zusammenhängen zwischen biologischen und kulturellen Prozessen weitaus mehr Beachtung entgegengebracht werden muss, als vorher angenommen. Jede Person entwickelt individuell, bezogen auf ihr Umfeld, ein soziales Geschlecht, welches nicht zwingend ihrem biologischen Geschlecht entsprechen muss. Der Prozess in dem wir kontinuierlich unser soziales Geschlecht definieren, wird als Doing Gender beschrieben (vgl. West/Zimmerman 1987, 126). Doing Gender ist Produkt aktiver Auseinandersetzung eines Individuums mit seinem Umfeld. Das soziale Geschlecht ist dementsprechend etwas was man in Interaktion mit anderen tut, nicht unbedingt etwas was man ist (vgl. ebd., 140).
Gesellschaftlich gesehen ist es nicht immer möglich, sich in der eigenen Geschlechterrolle zu bewegen, da gewisse soziale Bereiche nach dem biologischen Geschlecht eingeteilt sind.
Als Lösung schlägt Hirschauer (2001) hierzu den konträren Begriff des Undoing Gender, also die Neutralisierung der Geschlechter, vor. Dies würde uns von der zweigeschlechtlichen Gesellschaft entfernen und einer Person nicht mehr auferlegen, sich einem der Geschlechter zuordnen zu müssen. Die Aktualisierung von Geschlecht als soziale Ordnung scheitert jedoch in vielen Bereichen. Beispiele hierfür sind bestehende Kleiderordnungen, geschlechtlich segregierte Praxisfelder und getrennte sanitären Anlagen (vgl. Hirschauer 2001, 217 In: Hartmann-Tews 2003, 22f). Es ist also nicht leicht, die Zweigeschlechtlichkeit unserer Gesellschaft wegzudenken. Palzkill (1995) versucht durch eine Neudefinition des Begriffes der Weiblichkeit zumindest im Bereich der Semantik, den Geschlechtern mehr Freiraum einzugestehen. Weiblichkeit sollte laut Palzkill so definiert werden, dass sie nicht unbedingt das Gegenteil zu Männlichkeit darstellt. Eine Frau soll „männliche" Züge haben können, ohne ein Mann zu sein.
Ich habe den Begriff der ,weiblichen Identitätsbildung’ durch ,Identitätsbildung von Frauen’ ersetzt, da diese keineswegs zwangsläufig ,weiblich’, also der weiblichen Geschlechtsrolle entsprechend ist. Entsprechend wurde ,weiblicher Körper’ durch ,Frauenkörper’ (der durchaus männlich’ sein kann) und männliche Räume’ durch ,Männer-Räume’ ersetzt. Hierdurch soll die Selbstverständlichkeit der Zuordnung von ,Männlichkeit’ an Männer und Weiblichkeit’ an Frauen durchbrochen werden. (Palzkill 1995, 33)
Die gezielte Wortwahl von Palzkill weist hiermit schon auf die Vielfalt der Geschlechterrollen hin. Bierhoff-Alfermann (1989) löst sich auch von der Annahme, es gäbe nur zwei Geschlechter. Anhand des Androgynie-Konzepts unterscheidet sie in zwei weitere Typen, [...] nämlich die Androgynen und die Undifferenzierten. Rein deskriptiv sind dabei die Maskulinen und die Femininen diejenigen Personen, die nur jeweils auf einer Dimension hohe Werte aufweisen, die Undifferenzierten diejenigen, die auf keiner der beiden Dimensionen eine höhere Ausprägung aufweisen, und die Androgynen diejenigen, die sowohl Maskulinität wie Feminität in sich vereinen, also auf beiden Dimensionen überdurchschnittlich hohe Werte erreichen. (Bierhoff- Alfermann 1989, 19)
Androgyn zu sein bedeutet demnach, eine weibliche sowie männliche Geschlechtsrollenidentität zu bilden (vgl. ebd.19).
„Gelingt einer Frau die völlige Übernahme der sozialen Geschlechtsrolle, dann kann sexuelle Identität und Geschlechtsrollenidentität zusammenfließen“ (Gissrau 1997, 40). Letzteres ist, wie in diesem Abschnitt beschrieben, keine Selbstverständlichkeit und in unserem Fall von großer Bedeutung, wenn es später um die Geschlechterrollen von Fußballerinnen geht. Mit der Selbstverständlichkeit, dass Personen die zu ihrem biologischen Geschlecht kongruente Geschlechtsrolle entwickeln, gaben bisweilen Abweichungen davon Anlass zu Besorgnis. Es wurde vermutet, darin einen Ansatzpunkt für Homosexualität zu finden (vgl. Bierhoff- Alfermann 1989, 28).
2.2 Homosexualität
Homosexualität wurde und wird in unserer Gesellschaft noch immer stark diskutiert. Eltern von homosexuellen Kindern fragen sich was sie „falsch“ gemacht haben und warum gerade ihr Kind nicht „normal“ ist.
Da wir in einer heteronormativen Gesellschaft leben, das heißt in einer Gesellschaft, die Heterosexualität als Norm voraussetzt, ist Homosexualität weiterhin eher die Ausnahme als die Regel. So kommt es, dass Homosexualität oft als ein Scheitern an der Übernahme der zum biologischen Geschlecht konformen Geschlechtsrolle interpretiert wird (vgl. Helfferich 1994, 171).
Aufgrund der Annahme, Homosexualität wäre etwas Anormales, das den Normen und Gesetzen einer Gesellschaft widerspricht, wird sie bis heute in manchen Ländern mit dem Tode bestraft. Einige Länder behandeln Homosexualität als nicht existent und thematisieren sie nicht, andere wiederum beschreiben sie als Krankheit.
WissenschaftlerInnen versuchen herauszufinden, wieso manche Menschen Homosexualität entwickeln und worin der „Auslöser" liegen könnte. Die zentrale Frage ist die nach dem Wesen der Homosexualität, und ob diese biologisch/genetisch oder sozial bestimmt ist.
Der Ausdruck homosexuell stammt von der griechischen Vorsilbe homo her, die sich auf die Gleichartigkeit der beteiligten Personen bezieht, und nicht von dem lateinischen Wort homo, der Mensch. Er steht im Gegensatz zu dem Ausdruck heterosexuell, mit dem man Reaktionen und Beziehungen zwischen Personen verschiedenen (hetero) Geschlechts bezeichnet.
(Kinsey 1964,342)
Liebe und sexuelles Begehren unter Menschen des gleichen Geschlechts wird - wie auch Alfred Kinsey schon in den 1960er Jahren in den USA schrieb - in unserer westlichen Kultur als homosexuell bezeichnet. Bei der Frage, ob eine Person schon von Geburt an homosexuell ist oder es im Laufe des Lebens wird, gehen die Meinungen auseinander. Palzkill schreibt, dass Fritz Morgenthaler (Schweizer Psychoanalytiker) zufolge die Prädisposition zur Homosexualität schon nach Beendigung der ödipalen Phase besteht, also mit etwa sechs Jahren. In der Pubertät und darüber hinaus geht es prinzipiell nur darum, sich als homosexuell zu erkennen zu geben (vgl. Palzkill 1995, 27).
Glauben wir Freud, so kann nahezu alles zu einem sexuellen Reiz für eine Person werden. Er glaubte nicht, dass Homo- und Heterosexualität genetisch bedingt wären (vgl. Gissrau 1997, 32).
Auch Alfred Kinsey (1964) schließt sich der freudschen Meinung an. Für ihn dienen die Ausdrücke „homosexuell" und „heterosexuell" nicht zur Charakterisierung einer Person, sie definieren ausschließlich die Quelle des sexuellen Reizes.
Dies scheint zu bedeuten, dass jedes Individuum derartig reagieren könnte, falls sich Gelegenheit böte und es nicht durch seine Erziehung zur Ablehnung einer derartigen Reaktion veranlasst würde. Man braucht keine speziellen hormonalen Faktoren anzunehmen [...], wir haben keinen Beweis für derartige Faktoren. (Kinsey 1964, 343)
Von Bedeutung für die Interpretation der Interviews sind Alfred Kinseys Überlegungen über das Entstehen von Homosexualität. Er nennt folgende mögliche Faktoren:
- Die grundsätzliche physiologische Fähigkeit jedes Säugetiers, auf jeden ausreichenden Reiz zu reagieren.
- Der Zufall, der eine Person bei ihrer ersten sexuellen Erfahrung zu einem gleichgeschlechtlichen Partner führt.
- Die prägende Wirkung einer solchen Erfahrung
- Der indirekte, aber machtvolle Einfluss von anderen Personen/Gesellschaft (vgl. Kinsey 1964, 343)
Nach den Erkenntnissen von Kinsey in den 1960er Jahren, findet sich wenig weitere Literatur zur Entstehung von Homosexualität. Lisa M. Diamond, Psychologin an der
Universität Utah in den USA, ist eine der wenigen WissenschaftlerInnen, die an den Untersuchungen von Kinsey anknüpft. Sie interviewte alle zwei Jahre, über eine Zeitspanne von 10 Jahren, fast hundert Frauen über ihre sexuelle Entwicklung. In ihrem Buch Sexual Fluidity - Understanding Women’s Love and Desire (2008) beschreibt sie die „sexual fluidity" von Frauen mit den Erkenntnissen aus ihren Interviews. Darunter versteht sie die situationsabhängige, flexible Anpassung von sexueller und emotionaler Anziehung: Unabhängig von der eigentlichen Sexualität einer Frau, kann sie unter manchen Umständen Lust für Männer und Frauen empfinden. Sexualität bleibt demnach nicht lebenslänglich gleich, sie ändert sich durch die Menschen denen wir begegnen (vgl. Diamond 2008, 3).
Most important in terms of sexual fluidity, women show more discontinuous experiences of same-sex sexuality than do men. In other words, they report more changes in sexual attractions and behaviors over time and in different situations. (Diamond 2008, 50)
Generell kann die Kategorisierung in „homosexuell" und „heterosexuell" also weniger leicht vorgenommen werden als gedacht.
Diamond, Kinsey und Freud behaupten demnach, dass Sexualität durch Umwelteinflüsse bestimmt wird. Als auslösender Faktor sollten die Lebensstile von hetero- und homosexuellen Menschen berücksichtigt werden, da diese oftmals voneinander abweichen. Wie wir in den späteren Abschnitten sehen werden, kann FußballerinSein ein Lebensstil sein und dieser Lebensstil kann auch Auswirkungen auf die Sexualität der Sportlerinnen haben. Generell wird, laut Tanja Walther-Ahrens (2011), der Lebensstil von „HomoSEXuellen" zu sehr auf Sex reduziert. „Es wird völlig ausgeblendet, dass mit gleichgeschlechtlichen Lebensweisen weit mehr verbunden ist, als die Art und Weise der sexuellen Befriedigung. Homosexualität ist eine von vielen Möglichkeiten, Leben zu gestalten und auszufüllen" (Walther-Ahrens 2011, 21).
Wie wir in den späteren Abschnitten sehen werden, kann sich das Fußballerin-Sein zu einem Lebensstil entwickeln, der wiederum auch Auswirkungen auf die Sexualität der Sportlerinnen haben kann.
Günter Reisbeck unterscheidet „ [...] zwischen homosexuellem Verhalten, homosexuellem Begehren und homosexueller Identität." Dies sei notwendig, da es jeden dieser Aspekte auch ohne den anderen geben könne (vgl. Reisbeck 1998, 56).
Als Beispiele hierfür führt er an, dass ein heterosexuell lebender Mann im Gefängnis durchaus homosexuelles Verhalten zeigen kann, ohne eine homosexuelle Identität zu entwickeln. Ein Pfarrer hingegen kann homosexuell begehren, aber aufgrund sei- ner Religion womöglich weder homosexuelles Verhalten noch eine homosexuelle Identität ausleben(vgl.ebd, 56).
Es gibt nicht nur einen Unterscheid zwischen verschiedenen homosexuellen Lebensstilen, es gibt vor allem auch bedeutende Unterschiede zwischen männlicher und weiblicher Homosexualität.
Die Einrichtungen, die sich rund um die männliche Homosexualität entwickelt haben, umfassen Cafés, Kneipen, Nachtklubs, öffentliche Bäder, Turnhallen, Schwimmbäder, Magazine für Körperkultur und spezifisch homosexuelle Magazine, sowie organisierte homosexuelle Diskussionsgruppen; bei Frauen findet sich derartiges nur selten. (Kinsey 1964, 369)
Bis heute behält Kinsey mit diesen Zeilen Recht. Die aktive homosexuelle Szene wird vor allem mit Schwulen in Verbindung gebracht. Journalistin Elke Amberg (2011) bestätigt dies mit ihrer Studie Sag‘ mir wo die Lesben sind, die im Herbst 2011 erschienen ist. Sie fand heraus, dass in Zeitungen wie zum Beispiel der Süddeutschen Zeitung, Müncher Merkur oder tz, kaum Lesben erwähnt werden und Homosexualität meist in Bezug auf Schwule thematisiert wird (vgl. Amberg 2011,1). So entsteht das Bild, dass schwule Männer aktiver seien und dass sie mehr Möglichkeiten hätten, ihre Sexualität auszuleben. Doch wohin gingen und gehen lesbische Frauen? Hier bleibt nur zu vermuten, dass auch lesbische Frauen eine Szene entwickelten, nur eben weniger öffentlich und offiziell, als die der homosexuellen Männer. Demnach ist im Rahmen dieser Arbeit die Subkultur lesbischen Lebens zu beachten, die im und durch Frauenfußball entstehen kann. Unabhängig davon, ob sie spezifisch und bewusst als solche benannt wird oder nicht (siehe Kapitel 5.1).
Schwule schreiben einen großen Teil der homosexuellen Kulturgeschichte. Lesben sind zwar in der Frauenbewegung präsent, aber hier ist nicht ganz eindeutig inwiefern sie für die Anerkennung der Frau, oder eben gezielt für ihre Homosexualität auf die Barrikaden gingen. Wie Sigusch (2010) feststellt, ist „ [...] keine Sexualform in den vergangenen Jahrzehnten kulturell und individuell so stark verändert worden wie die Homosexualität, die weibliche Sexualität als Geschlechtsform einmal ausgenommen" (Sigusch 2010, 5f).
Schauen wir uns die Gesetzbücher an, so beschreibt die Rechtsprechung lediglich die männliche Homosexualität. Folglich werden/wurden nur Schwule für ihre Sexualität bestraft; auch die Bibel und der Talmud erwähnen ausschließlich Strafen für männliche Homosexuelle. Dem liegt zugrunde, dass Frauen schlicht nicht als sexuelle Wesen betrachtet werden (vgl. Kinsey 1964,375).
Die interessante Frage nach der genauen Prozentzahl von homosexuellen Menschen in unserer Gesellschaft kann von vielen WissenschaftlerInnen nur geschätzt werden, es gibt keine repräsentativen Befragungen dazu. Vermutet wird, dass in der westlichen Gesellschaft 5 bis 10 Prozent der Menschen homosexuell veranlagt sind.[3]
Festzuhalten ist, dass bei der Analyse zur Entstehung von Sexualität, Homosexualität und Heterosexualität gleichermaßen hinterfragt werden müssen. „Wer nur noch die ,Abweichung’ für erklärungsbedürftig hält, verlässt den fruchtbaren Boden kritischer psychoanalytischer Erkenntnissuche und verfällt gesellschaftlichen Vorurteilen" (Gissrau 1997, 33).
2.3 Lesbische Identität
Sexuelle Beziehungen unter Frauen werden als lesbisch beschrieben. Der Ursprung dieser Bezeichnung spielt auf die homosexuelle Lebensgeschichte der Dichterin Sappho an, die in der Antike auf der griechischen Insel Lesbos lebte (vgl. Kinsey 1964, 342). Von circa 612-560 v.Chr. soll sie ihre Gedichte auf der Insel Lesbos gelehrt haben, und unter anderem auch mit ihren Schülerinnen erotische Beziehungen eingegangen sein.[4] Wie wir an der Wortgeschichte sehen, ist gleichgeschlechtliche Liebe unter Frauen keine neue Erfindung unserer Zeit, sondern eine seit Jahrtausenden existierende Art der Sexualität.
Chris Paul (1990) beginnt ein Gedicht über lesbische Liebe mit den folgenden Worten: „Es fängt mit Herzklopfen an [...] Lesbischsein geht mit Herzklopfen weiter. Nicht vor Aufregung, Erwartung und Lust. Sondern aus Angst [...] " (In: Gissrau 1997, 208). Da lesbische Frauen in der Gesellschaft selten sichtbar sind und einander wenige Möglichkeiten zur Identifikation bieten, ist die Identitätsbildung für junge Frauen schwierig. Entdecken sie ihre Homosexualität, so kann es durchaus zu Angst und Ratlosigkeit, wie Chris Paul (ebd.) beschreibt, kommen. Wird eine lesbische Frau nicht direkt in einem lesbischen Umfeld sozialisiert, so wird sie sich mit sich selbst beschäftigen müssen, um zu erfahren wer sie ist, und wie sie mit ihren Gefühlen umzugehen hat.
Noch 1995 beschrieb Palzkill die weitreichende Tabuisierung von Homosexualität, Homoerotik und Homosozialität als eine Form von Diskriminierung (vgl. Palzkill 1995, 116).
Es geht also nicht darum, dass Lesben in der Gesellschaft besonders schlecht behandelt werden, nein, sie erfahren einfach wenig Beachtung. Findet eine homosexuelle Frau aber kein lesbisches Netzwerk oder keinen „Raum", in dem sie sich so bewegen kann, wie sie ist, kann dies eine große Last sein, obwohl ihr direkt kein Schaden zugefügt wird. Auch weil lesbische Frauen gegen die Anforderungen der tradierten weiblichen Geschlechtsrolle verstoßen, und somit das hierarchische Geschlechterverhältnis ins Schwanken bringen, müssen sie unsichtbar bleiben (vgl.ebd, 1995, 15).
Sichtet man die Literatur der letzten zwei Jahrhunderte, so kann dies bestätigt werden: „Weibliches Begehren aus der Sicht von Frauen wird nicht dargestellt und lesbisches Begehren bezogen auf andere Lesben schon gar nicht. Es sei denn als Männerphantasie, zur sexuellen Stimulation" (Amberg 2011, 1). Bei Männern finden lesbische Frauen demnach aus rein erotischem Interesse viel Anklang (vgl. Kinsey 1964, 368). Unter lesbischen Frauen kann dies zu Aufregungen führen, da sie durch ihre zu starke Erotisierung entfremdet werden.
Wo ich mir dann immer denke, wenn ihr euch Frauen im Bett vorstellt, dann stellt ihr euch auch immer nur schöne und ästhetische Frauen vor, aber es gibt auch Mannslesben, die nicht in eurem Sinne ästhetisch sind und auch miteinander im Bett sind; an dieses Bild denkt keiner, das regt mich genauso auf. (Befragte 6, 137)
„Lesbisch-Sein" ruft in unserer Gesellschaft unterschiedliche Vorstellungen hervor. Viele lesbische Frauen müssen sich mit dem Klischee der „Mannsweiber" auseinandersetzen. Sie sind die eher androgynen und männlichen Frauen, und gleichzeitig die lesbischen Frauen, die in der Gesellschaft am sichtbarsten sind. Sehr feminine Lesben bleiben hingegen oftmals unerkannt. Für Letztere ist es schwer, als lesbische Frau wahr- und ernst genommen zu werden. „Alle frauenliebenden Frauen, die diesem Stereotyp des Mann-Weibs nicht entsprechen, werden kurzerhand als ,pseudo- homosexuell‘ definiert" (Palzkill 1995, 26). Es besteht also die Annahme, dass Frauen die Frauen lieben, eher eine männliche Geschlechterrolle einnehmen und allein aufgrund der Tatsache, dass sie Gefühle für eine Frau entwickeln, am liebsten ein Mann wären.
Dahinter verbirgt sich auch etwas Wahres. Es gibt lesbische Frauen, die maskulin wirken, dazu stehen und bewusst ein „starkes" und „burschikoses" Auftreten haben.
Dies bedeutet jedoch nicht, dass alle von ihnen auch gerne ein Mann wären. Wiederum darf auch nicht davon ausgegangen werden, dass eine maskuline Frau automa- automatisch auf Frauen steht. Hier muss zwischen der Geschlechtsidentität und der sexuellen Orientierung unterschieden werden. Ein Mädchen kann eine weibliche Geschlechtsrolle entwickeln und wissen, „ [...] dass es ein Mädchen ist, seine Liebesgefühle kann es aber immer noch auf sich selbst, auf Männer, Frauen, Tiere oder Objekte lenken" (vgl. Gissrau 1997, 148).
Lesbisch-Sein kann auch politisch gesehen werden. Manche Frauen wollen nicht auf ihre weibliche Geschlechtsrolle reduziert werden. Ihre lesbische Existenz steht somit in Verbindung zur Verneinung ihrer Geschlechtsrolle (vgl. Palzkill 1992, 107).
„In einer bestimmten Phase der feministischen Bewegung wurde Lesbisch-Sein eine politische Kategorie, die mit sexuelle Orientierung nur noch wenig zu tun haben scheint" (Reisbeck 1998, 57).
Trotz der oben angesprochenen Unsichtbarkeit lesbischer Frauen in der Gesellschaft, sind Lesben im 21.Jahrhundert präsenter als noch vor einigen Jahren. Sie sind Teil der Medien: als Sängerinnen, Politikerinnen, Schauspielerinnen. Und sie sind Teil des Alltags: als „offen" lebende Freundinnen und Verwandte. Sportlerinnen werden bewusst nicht erwähnt, da diese aufgrund der auf Geschlechterrollen fixierten Sportarten oftmals ihre Sexualität nicht an die Öffentlichkeit tragen. Kapitel 5 wird dies näher erläutern.
Lesbische Frauen können in einem offenen und toleranten Umfeld heute ein Leben führen wie heterosexuelle Frauen auch. Stoßen sie auf Aspekte wie Heirat und Nachwuchs, so ist die Gleichberechtigung bereits auf dem guten Weg, aber noch nicht vollendet. Lesbische Frauen, „ [...] erben nicht nur, was bereits existiert, sondern bestimmen auch, was in Zukunft lebbar sein kann " (vgl. Hark 1998, 38). Sie sollten also aktiv bleiben und auch in der Öffentlichkeit zu ihrer Homosexualität stehen, um allgemein die Berührungsängste mit Homosexualität zu verringern
2.4 Die Geschichte des Frauenfußballs
Die Geschichte des Frauenfußballs und seine gesellschaftliche Bedeutung in Deutschland darf hier nicht außer Acht gelassen werden, sie muss als einflussstarke Komponente berücksichtigt werden. Frauenfußball ist in Deutschland noch nicht sehr lange selbstverständlich, denn „Sport war Teil der außerhäuslichen Kultur und gehörte damit zur Lebenswelt der Männer, die die öffentliche Sphäre besetzt hielten" (Palzkill 1995, 18). Durch den Krieg veränderte sich jedoch in den 1920er Jahren die traditionelle Rolle der Frau. Frauen nahmen mehr am öffentlichen Leben teil als zuvor und sie begannen sich intensiver mit Sport zu befassen. Damals rieten Ärzte den Frauen allerdings von Kampfsport ab, mit der Begründung, er könne ihre Fruchtbarkeit einschränken.
Die Metzgerstochter Lotte Specht gründete 1930 mit dem 1.DFC Frankfurt Deutschlands ersten Damenfußballklub. Dieser Fußballclub existierte ein Jahr, Lotte Specht und die anderen acht Fußballerinnen hatten eine schwere Zeit und nicht jedermanns Einverständnis auf ihrer Seite (vgl. Hoffmann/Nendza 2006, 1). Lotte Specht: „Die Männer haben sogar Steine nach uns geworfen. Und die Zeitungen haben uns durch den Kakao gezogen und geschimpft" (ebd. 1).
Dies änderte sich nicht zur Zeit der Nationalsozialisten, dort war Sport nur den wehrtüchtigen Männern erlaubt; Frauen sollten sich ganz auf ihre Rolle als Hausfrau konzentrieren (vgl. Fechtig 1995, 25f).
Der Deutsche Fußball Bund (DFB) wurde 1949 gegründet. Mit dem Sieg der deutschen Herrenfußballmannschaft bei der Weltmeisterschaft 1954 gewann der Fußball in Deutschland sehr an Attraktivität und seine Präsenz in den Medien wurde stärker. Frauenfußballvereine hingegen waren privat und hatten wenig Bedeutung.
1955 wurde die offizielle Anerkennung der Fußballerinnen diskutiert, dies endete am 30.07.1955 in einer einstimmigen Ablehnung des Damenfußballs durch den DFB.
Es hieß, Fußball sei für Frauen weder physisch noch seelisch geeignet. Dr. Hubert Claessen, späteres DFB Vorstandsmitglied, erwähnte zu diesem Zeitpunkt, dass der DFB Damenfußball aus ästhetischen Gründen ablehne (vgl. Hoffmann Nendza 2006, 2). „Damals sind irgendwelche Manager durch die Lande gezogen, die mit brüstewackelnden Frauen Geld verdient haben. So etwas haben wir abgelehnt." So zitiert Autorin Beate Fechtig den DFB-Mitarbeiter Horst Schmidt in ihrem Buch Frauen und Fußball (Fechtig 1995, 23).
Die Spiele der Damen waren somit verboten und sobald ein Verein versuchte ein Damenspiel auszutragen, konnte es zu großen Auseinandersetzungen kommen. Es kam durchaus vor, dass Sportplätze von der Polizei geräumt werden mussten.
Auch in den 1960er Jahren blieb Frauenfußball in Deutschland ein Tabu. Nachbarländer wie
Dänemark, Schweiz und die Tschechoslowakei hatten hingegen schon bewiesen, dass Frauenfußball nicht gesundheitsschädlich für Frauen ist und besaßen offizielle
Frauenfußballmannschaften. Trotz alledem gab es in den 1960er Jahren 40.000-60.000 Kickerinnen bundesweit. Durch die 1968er Revolution, die mit der Studierendenbewegung und der neu etablierten Frauenbewegung einherging, ließen sich ambitionierte Fußballspielerinnen nicht mehr zurückhalten. Auch der DFB begann umzudenken: Am 30.Oktober 1970 wurde in Deutschland das Verbot des Damenfußballs aufgehoben und die Frauen im DFB aufgenommen (vgl. Fechtig 1995, 22f). Die Funktionäre verordnen den Frauen zunächst einmal ein gesondertes Regelwerk. Die Spielzeit wird auf 2x30 Minuten verkürzt, man betrachtet den kleineren Jungenball als eher frauengemäß und verbietet dem weiblichen Geschlecht das Tragen von groben Stollenschuhwerk. (Hoffmann Nendza 2006, 2)
Die Bedeutung des Damenfußballverbots bis 1970 muss in die Analyse zur Geschlechtsidentität im Fußball mit einbezogen werden. Das Verbot betonte die vorherrschende Stärke von Männlichkeit und die entsprechend deklarierte Schwäche des weiblichen Körpers. Gerade dies bewegte manche Frauen dazu unter Beweis zu stellen, dass auch sie Fußball spielen können:
Vielleicht ist gerade die Überwindung der Widerstände das Geheimnis. Zumindest in den Anfängen des Frauenfußballs gab es solche, die sich gegen das Vorurteil ,Fußball ist MännerspoiT auflehnten und den neugeschaffenen Freiraum für sich nutzen wollten. (Fechtig 1995, 52)
Hiermit ließe sich auch erklären, weshalb lesbische Frauen vermehrt Interesse am Fußball hatten, schließlich verwies in den 1970ern und 1980ern
[...] das Wort ,lesbisch’ im feministischen Kontext nicht nur auf die Liebe zwischen Frauen, sondern als politisierte Geschlechtsidentität auch auf das Streben nach einem frauenbezogenen Leben in Unabhängigkeit von der männlich dominierten Gesellschaft. (Gammerl 2010, 11) Lesbisch-Sein und Frauenfußball haben im Laufe der Jahre zwar den politischen Aspekt verloren, trotz alledem mag Frauenfußball, rein historisch, ein von Lesben besetzter Raum geblieben sein. Früher wurde der Frauenfußball den Frauen nicht gewährt und diente somit auch als Raum für Emanzipation. Heute hat sich dies geändert, Frauen dürfen Fußball spielen, aber nur wenige nehmen davon Notiz (vgl. Fechtig 1995, 49).
Holsten/Wörner hingegen beschreiben keinerlei politischen Absichten der Frauen durch den Fußball, denn [...] von den Vorreiterinnen selbst, den Spielerinnen der 1950er und 1970er Jahre ebenso wie den aktuellen Sportlerinnen, wird das Fußballspiel selten als bewusster emanzipatorischer Akt, sondern eher als Teil eines emanzipierten Selbstverständnisses genannt. Gleichwohl ging und geht es immer auch um das Recht auf selbstverständliche Teilhabe an einem selbst gewählten Sport. (vgl. Holsten/Wörner 2011,26)
In den Jahren nach der Aufhebung des Verbots nahm diese Selbstverständlichkeit zu und damit die Präsenz des Frauenfußballs. Parallel zur Sichtbarkeit stieg das Interesse langsam, aber stetig an. Durch die zunehmende Akzeptanz ging auch der Kampf um die Anerkennung der Frau, der durch den Fußball stattfand, verloren.
Ab 1990 wurde eine zweigleisige Bundesliga mit jeweils zehn Mannschaften eingeführt. Die Bundesliga war lange kein „Novum" mehr und gehörte in den Alltag, die Presse hatte sich allerdings zurückgezogen. Sie kam nur noch zu wichtigen Spielen,drei Mal im Jahr (vgl. Fechtig 1995, 42). In der Saison 1997/98 sollte die Einführung der eingleisigen Bundesliga das Problem lösen. Für die damaligen Spielerinnen bedeutete dies jedoch auch mehr Stress. Wie ihre Kollegen mussten sie viel trainieren, wurden aber geringfügig bezahlt und mussten gleichzeitig ihren Lebensunterhalt verdienen (vgl. ebd., 42f). In den 1980er Jahren gab es die ersten offiziellen Teilnahmen von deutschen Fußballerinnen auf internationaler Ebene. 1981 bekam Deutschland eine Einladung zur inoffiziellen Weltmeisterschaft in Taiwan, dabei hatte der DFB zu diesem Zeitpunkt noch gar keine Frauenauswahl im Verband. 1982 spielten die Frauen ihr erstes Länderspiel in Koblenz mit Trainer Gero Bisanz und gewannen dieses auch prompt. 1989 schafften sie den Durchbruch, als sie die Frau- en-Europameisterschaft im eigenen Land gewannen. Als Prämie bekamen sie dafür das oft belächelte Kaffeeservice (1B-Ware) vom DFB (vgl. Hoffmann/Nendza 2006, 3). Darauf folgte die erste offizielle Weltmeisterschaft 1991 in China und im selben Jahr die Europameisterschaft, wo sie erneut den Sieg davontrugen. Bis 2005 gewannen die deutschen Frauen sechs Mal die Europameisterschaft. Einen besonders großen Auftrieb bekam der Mädchen- und Frauenfußball in Deutschland durch die Weltmeistertitel 2003 in den USA und 2007 in China. Allein 2005 zählte der Mädchenfußball des DFB 870.000 Mädchen (ebd., 3).
Das Jahr 2011 wurde durch die Weltmeisterschaft im eigenen Land ein großes Ereignis für den Frauenfußball. Der DFB hatte große Kampagnen gestartet, um den Frauenfußball von seiner besten Seite zu präsentieren und, wenn möglich, neue Spielerinnen für sich zu gewinnen. Trotz „Heimspiel" reichte es für die deutschen Spielerinnen 2011 nicht bis ins Finale.
Bis heute bleibt der Fußballsport „ [...] Nationalsport der männlichen Bevölkerung und es wird argumentiert, dass das, was die Frauen machen, etwas Anderes sei, nicht Fußball sondern Frauenfußball" (vgl. Kleindienst-Cachay im Interview bei Krone 2011, 40). Hier wird offensichtlich bewusst zwischen Fußball und Frauenfußball unterschieden und somit eine zweite Kategorie, womöglich ein zweiter Sport, kreiert. Auch die Namensgebung der Sportevents zeigt dies. 2006 fand die FIFA-Fußball- Weltmeisterschaft statt und 2011 die FIFA-Frauen-Weltmeisterschaft. Das Wort „Fußball" ist ganz verschwunden (vgl. Müller 2011, 33).
Diese Unterscheidung hat auch negativen Einfluss auf die Medien und den Bekanntheitsgrad der Frauenfußballvereine. Ein erfolgreicher Männerfußballverein
bekommt mehr Sponsoren, somit mehr finanzielle Unterstützung und hat mehr Hoffnung auf Erflog und Ansehen. Aus diesem Grund finden sich erfolgreiche (Frauen-)Vereine in Deutschland dort, wo keine Männermannschaften in den höheren Klassen spielen. Hier können die Frauen im Vordergrund stehen und werden auch finanziell unterstützt (vgl. Palzkill 1995, 73).
Auch wenn das Geschlecht einen Einfluss auf das Verhalten und die Einstellung im Sport hat, ist es nicht das, was den Frauenfußball bis heute als weniger interessant erscheinen lässt. Vielmehr sind es die Vorstellungen, die mit der Kategorie Geschlecht einhergehen, die den Sport für das jeweilige Geschlecht bestimmen (vgl. Klein 1983, 8). In der Geschichte des Fußballs spielt auch die Einstellung der Frauen selbst eine große Rolle. So glauben zum Beispiel nur wenige Fußballerinnen durch Erfolg in der Männerdomäne Fußball, Bewunderung erlangen zu können (vgl. Pfister 1999, 153).
Diese unterschiedliche Wertschätzung von Frauen- und Männerfußball - auch wenn sie durch die Hervorhebung der Weiblichkeit von Fußballerinnen während der Fußball WM 2011, zu verschwinden schien - bleibt bis heute präsent. Frauenfußball kann nicht von heute auf morgen „weiblich" gemacht werden, sondern er wird es oder er wird es nicht, durch die Spielerinnen die ihn ausüben. Ganz zugunsten der eingesessen Männerfußball-Anhänger, schließlich bedeutete „ [...] die männliche Seite des Frauenfußballs [...] immer eine Selbst-Versicherung von Männern, dass die Ge- schlechter-Differenz existiert" (vgl. Marschik 2003, 411).
Geschlechterrollen im Sport, die über die Geschichte überliefert worden sind, sollen in dieser Arbeit diskutiert werden. Es ist zu hinterfragen, ob Fußballerinnen selbst einen „weiblicheren" Fußball wollen, ob sie ihn überhaupt als „männlich" definieren, und inwiefern „Weiblichkeit" im Fußball Einfluss auf Homosexualität innerhalb der Vereine und Mannschaften haben kann beziehungsweise haben könnte.
3. Methodisches Vorgehen
Auf der Suche nach Literatur und allgemeinen Informationen über lesbische Frauen im Fußball stößt man auf ausgesprochen wenige Texte, die sich gezielt mit diesem Thema auseinandersetzen. Es gibt Literatur über „Geschlechterrollen im Sport", „Sport und Geschlecht" und „Frauen im Sport", auch teilweise über weibliche Homosexualität und Sport. Gezielt zu Frauenfußball und Homosexualität ist aller- dings kaum etwas zu finden. Allgemein wird mehr darüber berichtet, dass es einen hohen Anteil von homosexuellen Frauen im Sportbereich gäbe, als dass eine Erklärung dafür gesucht, beziehungsweise erforscht worden wäre.
Birgit Palzkill und Gudrun Fertig sind zwei Autorinnen, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben. In ihrem Buch „Zwischen Turnschuh und Stöckelschuh“ (1995), geht Palzkill auf das Thema „Homosexualität im Leistungssport" ein und schildert die Lebensweisen und Konflikte von Sportlerinnen. Sie hat dazu 19 lesbische Leistungssportlerinnen interviewt.
Fertig (2011) berichtet etwas aktueller über die Frauenfußball Weltmeisterschaft 2011 in Deutschland und behandelt in mehreren Artikeln des Magazins für Lesben L- Mag, die Thematik lesbischer Fußballspielerinnen.
Aufgrund des unzureichenden Forschungsstandes ist es sinnvoll einen empirischen Weg einzuschlagen, den des problemzentrierten Interviews.
Qualitativ vorzugehen scheint hier am sinnvollsten, da durch die Interviews ein direkter Einblick in die Lebenswelt der Fußballerinnen möglich ist. Durch das entwickelte Vertrauen innerhalb des Gesprächs kann man in diesem Kontext hier, mehr über die Entwicklung von Identität, Persönlichkeit und den Zusammenhang von Homosexualität und Fußball erfahren. Dabei wird nach der Definition von Pfister (1999) vorgegangen:
Qualitative Untersuchungen zielen nicht darauf, Thesen und Fragen zu operationalisieren, Häufigkeiten, Korrelationen und Signifikanzen fest zustellen. Sie wollen vielmehr Themen vertiefen, individuelle Situationen, Erfahrungen und Strategien, subjektive Sinnzuweisungen, Interpretationen und Wirklichkeit erfassen, Zusammenhänge herausarbeiten und die Ergebnisse mit theoretischen Ansätzen verbinden. (Pfister 1999, 28)
Es werden demnach nur Ausschnitte aus unterschiedlichen Lebenswelten festgehalten, mit dem Bewusstsein, dass die Anzahl von neun Interviews sehr gering ist und nicht repräsentativ sein kann. Gemeinsamkeiten und Besonderheiten aus den Interviews werden herausgearbeitet, verglichen und mit theoretischen Ansätzen zu Homosexualität und anderen Interviews mit lesbischen Sportlerinnen in Verbindung gebracht. Durch den Vergleich der Ergebnisse kann am Ende der Arbeit trotz geringer Repräsentativität hoffentlich eine generalisierte Aussage getroffen werden.
Pfister schreibt auch, dass eine qualitative Vorgehensweise besonders beim Entdecken und Explorieren von weitgehend unbekannten Forschungsfeldern, besonders interessant sei (vgl. Pfister 1999, 28).
Die hierzu angewendete Methode des problemzentrierten Interviews wird im folgenden Kapitel näher erläutert.
3.1 Problemzentriertes Interview
Andreas Witzel ist der Begründer des problemzentrierten Interviews (PZI), er nennt es ein „ [...] theoriegenerierendes Verfahren, das den vermeintlichen Gegensatz zwischen Theoriegeleitetheit und Offenheit dadurch aufzuheben versucht, dass der Anwender seinen Erkenntnisgewinn als induktiv-deduktives Wechselspiel organisiert" (vgl. Witzel 2000, 1). InterviewerIn und Befragte/r befinden sich demnach in einer realistischen Gesprächssituation. Die Befragte ist Expertin in ihrem Bereich, sie berichtet über ihre Erfahrungen und wird durch Verständnisfragen oder Diskussionspunkte von der Interviewerin geleitet.
Die Konstruktionsprinzipien des PZI „ [...] zielen auf eine möglichst unvoreingenommene Erfassung individueller Handlungen sowie subjektiver Wahrnehmungen und Verarbeitungsweisen gesellschaftlicher Realität" (vgl. Witzel 2000, 1).
Das Vorwissen der Interviewerin, nach dem sie auch den Leitfaden des Gesprächs kreiert, dient nur zur Formulierung neuer Fragen und Ideen. Das Interview selbst findet auf einer realitätsnahen Basis statt, ohne Theorieelemente mit einzubeziehen. Hiermit werden Missverständnisse vermieden und gewährleistet, dass die Befragten sich wohl fühlen.
Für eine authentische und präzise Erfassung der Interviews werden beim PZI statt Gesprächsprotokollen Tonträgeraufzeichnungen empfohlen. Dies wurde so befolgt und von den meisten Interviewten auch akzeptiert. „Im Leitfaden sind die Forschungsthemen als Gedächtnisstütze und Orientierungsrahmen zur Sicherung der Vergleichbarkeit der Interviews festgehalten" (vgl. Witzel 2000, 1). Die Reihenfolge des Gesprächsleitfadens sollte nicht strikt eingehalten, sondern nur zur Erinnerung der abgehandelten Themen verwendet werden.
Bei der qualitativen Forschung gilt es hier besondere Vorsicht bei der Fragestellung walten zu lassen, um keine Ergebnisse bei den Befragten zu provozieren. Außerdem muss während der kompletten Durchführung des Interviews eine neutrale Haltung eingenommen werden (vgl. Pfister 1999, 28).
Im Anschluss an das Interview sollte von der Interviewerin ein „Postskript" erstellt werden, in dem noch vor Ort Auffälligkeiten oder Ideen zur Interpretation festgehalten werden (vgl. Witzel 2000, 1).
Zur Auswertung werden die Interviews transkribiert. Je nach Vorgehensweise werden die Themenbereiche des Interviews farblich unterschiedlich markiert und dann untereinander verglichen. Einzelne Fallanalysen und biografische Zusammenfassungen der Befragten helfen bei der Auswertung.
3.2 Vorstellung der Befragten
Nachdem ich mich für die qualitative Vorgehensweise anhand der Interviews entschieden hatte, folgte nun die Suche nach den geeigneten Interviewpartnerinnen.
Ich wollte neun aktive, lesbische Fußballspielerinnen aus unterschiedlichen Vereinen interviewen. Die Suche war, dank des Internets eine relativ leichte Angelegenheit. Über Facebook bat ich Freundinnen, mir Namen von Fußballspielerinnen zu vermitteln, die im Umkreis wohnten. Andere schrieb ich direkt an, weil sie Teil einer Fußball-Gruppe im Internet waren. Eine Befragte traf ich zufällig nach einer Kinovorstellung zum Thema „Frauenfußball-Weltmeisterschaft" in Frankfurt/Main und eine weitere traf ich in einer schwul-lesbischen Bar in Mainz. Dort kamen wir über das Thema Frauenfußball ins Gespräch. Die zehnte Befragte, Monika Koch-Emsermann, traf ich auf einer Podiumsdiskussion im Juni 2011 in der Zentralbibliothek in Frankfurt/Main. Sie war Diskussionsteilnehmerin zum Thema „Frauen am Ball: Erfolgsstory Frauenfußball". Nach der Diskussion kam ich mit Koch-Emsermann - Pionierin des Frauenfußballs, Spielerin und Managerin beim FSV Frankfurt - ins Gespräch.
Abgesehen von zwei Interviewpartnerinnen, waren mir keine der Befragten vorher bekannt. Obwohl dies im Vorhinein kein Kriterium war, war es gut, unvoreingenommen die Interviews durchführen zu können. Ich konnte voll und ganz auf die Perspektive der Befragten eingehen, ohne dass eventuelle Vorkenntnisse über ihr soziales Umfeld oder ihre Persönlichkeit meine objektive Betrachtung hätten beeinflussen können. Abgesehen von einem Ehepaar (den zwei mir bekannten Spielerinnen) wurden alle Interviews einzeln durchgeführt. Wir trafen uns entweder bei den Befragten zu Hause, in einer Bar oder an der Universität. Anhand des im nächsten Kapitel erläuterten Leitfadens kamen wir dann ins Gespräch.
Von großer Bedeutung war die Authentizität des Gesprächs. Ich war sehr bedacht darauf, eine persönliche Atmosphäre zu schaffen, um den Befragten nicht das Gefühl zu geben, bei einem Verhör zu sein. Sie sollten frei sprechen können und bereit sein, mit mir eine Diskussion einzugehen. Abgesehen von meinem ersten Interview, bei dem ich selbst noch lernen musste, das Gespräch seinen Gang gehen zu lassen, hat die Durchführung der Interviews sehr gut funktioniert. Ich war erstaunt, wie viel die Befragten zu berichten hatten und wie sehr sie, trotz der Tatsache, dass wir uns nicht kannten und der Ton aufgezeichnet wurde, viel Persönliches und Intimes erzählten.
Die Gespräche wurden in Mainz, Frankfurt/Main und Göcklingen/Pfalz im Frühjahr 2011 durchgeführt und dauerten im Durchschnitt zwischen 30 Minuten und einer Stunde. Die Interviewten spielten in der Stadt oder dem Dorf, in der oder dem sie interviewt wurden, auch aktiv Fußball. Sie selbst kamen jedoch ursprünglich nicht unbedingt aus diesem Ort. Heimat und Ort der ersten Fußballerfahrungen waren Mainz, Freiburg, Kandel/Pfalz, Leipzig, Mannheim, Berlin, und Bad Bergzabern. Hier war es mir wichtig, eine bunte Mischung von Fußballspielerinnen aus verschiedenen Städten zu finden. Es ist zu beachten, dass die Vereine in Mainz, Kandel und Bad Bergzabern, zwar in der Stadt liegen, jedoch Zulauf aus den Dörfern im Umkreis haben.
Die interviewten Fußballerinnen hatten alle eine langjährige Fußballkarriere hinter sich, die meisten spielten schon von klein auf und hatten viel Erfahrung in diesem Bereich. Auch wenn sich dies rein zufällig ergeben hat, kamen alle Befragten aus dem höherklassigen Bereich der Fußballwelt: Verbandsliga, Oberliga und auch Bundesliga.
Die Altersspanne der Befragten lag zwischen 23 und 53 Jahren. Vier Spielerinnen waren zwischen 23-24, zwei 27 und 29, weitere zwei 36 und 39 und eine Spielerin 53 Jahre alt. Es war leichter für mich, die jüngeren Spielerinnen zu „finden", da sie meiner Alterskategorie entsprechen und es in diesem Bereich auch die meisten aktiven Fußballerinnen gibt. Mit dem Alter gehen - nicht nur im Fußball - die Leistungsbereitschaft und damit das regelmäßige Training zurück. Trotz der Tendenz „jüngere" Spielerinnen auszuwählen, gibt die Verteilung einen Überblick über die verschiedenen Altersspannen.
Von den neun Befragten Spielerinnen spielten sechs noch aktiv in einem Verein Fußball, davon auch eine als Trainerin. Eine Befragte war schwanger und wusste nicht, ob sie eventuell wieder einem Verein beitreten wollen würde, eine andere war gerade erst umgezogen und auf der Suche nach einem neuen geeigneten Verein. Die dritte nicht mehr aktive Spielerin ist ihrem Verein als Physiotherapeutin treu geblieben.
Da es hauptsächlich um das Lesbisch-Sein im Frauenfußball gehen wird, ist es noch wichtig festzuhalten, dass alle neun befragten Spielerinnen schon in festen Beziehungen mit einer Frau gelebt haben. Drei der Befragten waren zum Zeitpunkt des Interviews mit einer Frau verheiratet, zwei lebten in einer festen Beziehung und vier waren Single.
Ich werde den Befragten fortan eine Nummer zuordnen und diese Nummer durch die Arbeit hinweg verwenden, sodass die Anonymität der Interviewten gewährleistet wird und trotzdem Rückschlüsse und Verbindungen innerhalb der Arbeit für den Leser und die Leserin möglich sind. Befragte 10, Koch-Emsermann, werde ich nach ihrem Namen benennen. Im Anhang befinden sich die Transkriptionen der Interviews. Beim Zitieren werde ich die Zeitenzahlen der Interviews im Anhang angeben. Einzelheiten über die Befragten werden im Laufe der Kapitel beschrieben.
3.3 Leitfaden
Der Leitfaden für die Interviews lässt sich in drei Abschnitte unterteilen.
Als Einleitung, um auf das Thema vorzubereiten, fragte ich die Interviewten, was sie von der Themenwahl meiner Arbeit hielten und wie relevant es für sie sei über Homosexualität im Frauenfußball zu sprechen. Hier kamen in den meisten Fällen schon interessante Ansätze, die direkt zu einem der beiden weiteren Abschnitte des Leitfadens hinführten.
Der zweite Teil handelte von den persönlichen Erlebnissen der Fußballspielerin und der dritte Teil erfragt ihre Meinung über Frauenfußball in der Gesellschaft. Die Befragte erzählte mir ihre „Fußballgeschichte“: Wie, wo, wann und durch wen sie zum Fußball kam und welche Rolle dieser Sport in ihrem Leben einnahm beziehungsweise einnimmt. Wichtig war hier zu erfahren, wie ihr familiäres und soziales Umfeld zum Fußball stand/steht und welchen Kommentaren oder auch Diskriminierungen sie als Fußballerin standhalten musste/muss.
Dadurch, dass die meisten Spielerinnen mit männlichen Altersgenossen anfingen Fußball zu spielen und der Fußball eine männerdominierte Sportart in Deutschland ist, kamen wir direkt auf das Thema der Geschlechterrollen zu sprechen. Hier galt es zu erfahren, wie sich die Spielerinnen damals in der Jungenmannschaft fühlten, wie sie sich fühlten, als sie von den Jungen zu den Mädchen und auch von den Mädchen zu den Damen wechselten. Weiterhin wurde erfragt, wie sie ihren Körper im Sport wahrnehmen und ob sie meinen, hierbei dem Bild von „Weiblichkeit" zu entsprechen. Ferner wollte ich wissen, wie sie meinen diesem Bild durch den Sport entfliehen zu können und ob sie im Sport Identitätskonflikten zwischen „männlich" und „weiblich" begegnen.
Der Austausch über Geschlechterrollen brachte uns auf das Thema der sexuellen Identität. Die Spielerinnen erzählten mir von ihrem Coming-Out und wie sie, in den meisten Fällen durch den Fußball, ihre Homosexualität entdeckten und lernten, damit umzugehen. Besonderes Augenmerk legte ich hier auf die Erfahrungen, die die Spielerinnen sammelten, als sie von der Mädchenmannschaft in die Frauenmannschaft wechselten.
Von Bedeutung war auch, wie die lesbische Identität von der sie mir berichteten, im Fußball gelebt werden konnte. Darüber hinaus, wie viele lesbische Spielerinnen es in ihren Vereinen gab/gibt und inwiefern dort Homosexualität tabuisiert wird, oder frei gelebt werden kann. Interessant war in diesem Kontext, ob die Spielerinnen ihre ersten lesbischen Partnerschaften mit einer Fußballerin eingegangen sind, ob diese aus demselben Verein waren und vielleicht einen größeren Reiz auf sie hatten als andere Frauen.
Nach den persönlichen Angaben der Befragten kamen wir zum allgemeinen, dritten Teil des Leitfadens. Hier ging es darum zu erfahren, ob die Befragten der Meinung sind, dass es viele lesbische Frauen im Fußball gibt und wenn ja, welche Erklärung sie dafür haben. Unter anderem behielten wir die Situation der momentanen Bundesliga und der Frauenfußball Weltmeisterschaft im Blick und redeten über die Nationalspielerinnen und deren Umgang mit Homosexualität.
Zum Abschluss wollte ich von den Befragten wissen, welche Bedeutung die Frauenfußball WM 2011 im eigenen Land für sie hat und welche Veränderungen sie sich dadurch im Bereich des Fußballs erhoffen.
4. Identitätsfindung und Geschlechterrollen
Wir kommen zu einem enorm großen Themenkomplex: Identität und Geschlecht. Obwohl beide Themengebiete einander bedingen, sind sie getrennt voneinander zu erklären und zu definieren. Die Identität einer Person hängt nicht unmittelbar mit ihrem biologischen oder sozialen Geschlecht zusammen, trotzdem können Geschlecht und Identität sich gegenseitig beeinflussen. Die Fragen, die sich uns hier stellen, sind zum einen, was Geschlechterrollen und Identität eigentlich sind, und zum anderen, in welchem Zusammenhang Geschlecht und Identität stehen. Bringen wir dann die Geschlechterrolle und sexuelle/persönliche Identität einer Person in Verbindung mit dem von ihr betriebenen Sport, so ließe sich eine Vermutung über die Verknüpfung zwischen Sportarten und sexueller-/persönlicher Identität und Geschlechterrollen ableiten.
Eine Geschlechterrolle hebt die für ein Geschlecht typischen Merkmale hervor, diese werden zu Geschlechterstereotypen und bilden die Basis für „Männlichkeit" und „Weiblichkeit". Die Geschlechterstereotypen unterscheiden sich demnach für das biologisch männliche und das biologisch weibliche Geschlecht. Sofern diese bei einer Person kongruent sind, ist das Konfliktpotenzial niedrig. Kann und will eine Person sich nicht nach den für ihr Geschlecht gesellschaftlich determinierten Stereotypen entwickeln, bildet sich ein Spagat zwischen erwarteten Rollenanforderungen und tatsächlicher Geschlechtsidentität. Von Land zu Land können diese Geschlechterstereotypen variieren.
Um ein paar Beispiele unserer Gesellschaft zu nennen, so sind positive maskuline Eigenschaften
[...] klug, kräftig, aktiv, unabhängig oder entschlossen und repräsentieren somit die männliche Rolle durch Kompetenz, Leistungsbereitschaft und Durchsetzungsfähigkeit [und] positive weibliche Eigenschaften sind zum Beispiel hilfsbereit, freundlich, einfühlsam oder herzlich. Sie entsprechen dem weiblichen Stereotyp von sozialer Fürsorge und Emotionalität.
(vgl. Haubenberger 2009, 8)
Eine Geschlechterrolle wird unter anderem durch soziale Beziehungen, Kleidung, kulturelle Interessen, Sprache, Gestik, Mimik und Bewegungsverhalten einer Person ausgedrückt.
Die von Palzkill interviewten lesbischen Leistungssporterlinnen formulierten zum Beispiel „ [...] einen deutlichen Widerspruch zwischen den Bewegungsstereotypen, die die weibliche Rolle erfordert, und dem Bewegungsverhalten, das sie als Kind entwickelt hatten und das ihnen eigen war, d. h. ihrer persönlichen und sexuellen Identität entsprach" (vgl. Palzkill 1995, 51).
Das Bewusstsein über Geschlechterdifferenzen erlangen die meisten Menschen schon in der Kindheit. Spielerisches Verhalten zeigt, dass Jungen und Mädchen schon in den ersten Sozialisationsprozessen unterschiedliche Formen des Spielens
entwickeln, welche in Verbindung zu der Erziehung durch die Eltern und den determinierten Geschlechterrollen stehen (vgl. Klein 1983, 9).
In einer zweigeschlechtlich strukturierten Gesellschaft muss man - oder glaubt zu müssen - sich einem Geschlecht zuordnen, um ernst genommen zu werden. Dies bedeutet, dass eine klar definierte Geschlechtsidentität Voraussetzung für die Teilhabe am sozialen Leben ist (vgl. Bilden 1991, 294 In: Kleindienst-Cachay 2003, 114). Um uns darzustellen, tragen wir also unsere Geschlechterrolle täglich offen vor uns her, schließlich wollen wir Mitmenschen zeigen wer wir sind. Auch mit viel Mühe kommen wir daran nicht vorbei; laut Gissrau besitzen Geschlechtsrollen „ [...] von allen sozialen Rollen die am genauesten festgelegten Verhaltenscodes“ (vgl. Gissrau1997, 35).
An diesem Punkt ist es nun wichtig den Begriff der Identität mit einzubeziehen und zu beachten, dass Identität nicht unabhängig vom Körper konstruiert wird: „In der Art, wie ein Individuum seinen Körper gestaltet, ihn zurechtmacht, ihn bekleidet, ihn einsetzt, mit ihm umgeht, sich seiner im Handeln bedient oder sich mit ihm ausdrückt, präsentiert es immer auch Aspekte seiner Identität“ (Kleindienst-Cachay 2003, 113). Nicht nur die Geschlechterrolle beeinflusst unsere Identität, sondern auch alle anderen Bereiche des sozialen Lebens mit denen sich Personen identifizieren können. Sei es die Familie, der Beruf, das Land, die Sprache, eine Gruppe, eine soziale Rolle, die Sexualität und - erwähnenswert in unserem Kontext - der Sport.
Identität ist immer als „ [...] soziales Konzept zu verstehen. Im Gegensatz zu weiter gefassten Begriffen wie Selbstkonzept, Selbstbewusstsein u.ä. bezieht sich der Identitätsbegriff auf jene Teile des Selbst, die in sozialen Situationen zum Tragen kommen“ (vgl. Reisbeck 1998, 56). Sie kommt nicht nur dort zum Tragen, Identität kann sich auch nur in Beziehung zu anderen Menschen bilden. Sie ist kein starres Selbstbild, sondern formt sich, den Umständen entsprechend, fortlaufend neu (vgl. Palzkill 1995, 24). Die Geschlechtsrolle und somit das komplette System der Zweigeschlechtlichkeit spielt in die Entwicklung der Identität hinein und ergibt das Bild, welches wir durch andere von uns bekommen.
Sport ist ein körperbezogenes Sozialsystem, durch das die Unterschiede der Geschlechter extrem sichtbar werden (vgl. Kleindienst-Cachay 2003, 115).
Da Geschlechterrollen Einfluss auf die sexuelle Identität einer Person haben können, beschäftigt sich das nächste Kapitel mit Geschlechterrollen im Frauenfußball. Hierin können Ansatzpunkte für den Zusammenhang zwischen weiblicher Homosexualität und Frauenfußball gefunden werden.
4.1 Geschlechterrollen im Frauenfußball
Fünf der neun Befragten fingen im Alter von sechs bis acht Jahren an, in einer Jungenmannschaft Fußball zu spielen. Zwei Spielerinnen wollten gerne Fußball spielen, bekamen aber nicht die Erlaubnis ihrer Eltern. Für Befragte 5 war es - in den 1960er Jahren - undenkbar gewesen bei den Jungen einzusteigen, sie hatte nie mit dem Gedanken gespielt.
Alle Befragten gaben an, schon früh in der Kindheit nur mit Jungen gespielt zu haben. Genannte Gründe waren, dass es einfach mehr Spaß gemacht habe, mehr Bewegung dabei gewesen wäre und mehr getobt werden konnte. Es gab keine weiblichen Vorbilder, die ihrem Bewegungsdrang und ihrer Spiellust entsprachen. Hätte es sie gegeben, so behauptet Kugelmann (1996), würden sportliche Frauen in unserer Gesellschaft sowieso nicht als geeignete Vorbilder betrachtet:
Ihre körperliche Erscheinung, ihr Bewegungsstil, ihre Motive und Gefühle erscheinen uns häufig als eher unweiblich. Sie sind nicht unbedingt Vorbilder, mit deren Hilfe sich Mädchen und Frauen Geschlechtsidentität versichern könnten. (Kugelmann 1996, 97)
Da es diese sportlichen Frauen, die nicht dem gängigen Bild von Weiblichkeit entsprechen, im Umfeld der Befragten nicht gab, identifizierten sich alle unbewusst mit der ihrem Sex gesellschaftlich nicht entsprechenden Geschlechtsrolle und sozialisierten sich im Rahmen des Fußballs, sei es privat oder im Verein, mit Jungen und Männern.
Welchen Einfluss dies auf ihre persönliche und sexuelle Identität hat/hatte, wird in Punkt 4.3 näher erläutert. Wenden wir uns nun gezielt der Geschlechterrolle zu.
4.1.1 Zwischen Sportlerin-Sein und Frau-Sein
Die Befragten konnten also im Fußball ihre Geschlechterrolle freier ausleben und entdecken. Nun stellen sich die folgenden Fragen: Ist das heute noch so? Hat sich die Geschlechterrollengrenze zwischen dem was als männlich/sportlich galt und heute auch weiblich/Frau sein kann, verschoben?
Vier der Befragten haben beobachtet, dass sich das Bild des Frauenfußballs in den letzten zehn bis zwanzig Jahren enorm verändert hat. Früher war der Anteil von burschikosen Frauen sehr hoch und ist heute eher die Ausnahme (vgl. Befragte 4, 124). Laut Befragte 5 sind die Fußballerinnen heute „viel mehr Frau". Auch die lesbischen Spielerinnen legen viel mehr Wert auf Weiblichkeit im Vergleich zu früher (vgl. Befragte 5, 124). Außerdem genießt der Frauenfußball in Deutschland heute eine viel größere Akzeptanz und Sichtbarkeit im Vergleich zu anderen Ländern. Wenige Fußballspielerinnen machen sich überhaupt Gedanken darüber, dass Fußball nicht weiblich sein könnte (vgl. Befragte 9, 162).
Auch Befragte 1, die heute 23 Jahre alt ist, beobachtete dies ähnlich: „Als ich jünger war, [...] da war ich immer das Mädchen, das Fußball gespielt hat, und andere Mädchen können das nicht, und als ich älter geworden bin, ist es nicht mehr so extrem gewesen" (Befragte 1, 86).
Auch Befragte 8 schildert, dass sie selbst zu frühen Zeiten den Drang verspürte kurze Haare zu haben, sogar fast eine Glatze. Ihr ganzes Aussehen gestaltete sie sehr viel maskuliner als heute. Es scheint, als ob sie früher ihre Sexualität viel mehr nach außen tragen musste. Heute geschieht das bei den jüngeren Spielerinnen weniger extrem, ob lesbisch oder heterosexuell (vgl. Befragte 8, 157).
Ich glaub, damals wurden die wenigsten unterstützt. Es gab einfach nicht so viele Frauen, die gespielt haben und diejenigen, die sich für den Fußball damals entschieden haben, waren dann wahrscheinlich auch Frauen, die eher maskuliner waren, ja. (Befragte 8, 157)
Palzkill (1992) unterscheidet bei ihrer Analyse zu Geschlechtsrollen in folgende Bereiche: „Die Trennung in Sportler-Sein und Frau-Sein, zwischen Sporthalle und Disco, Sport-Trikot und Kleid, Turnschuh und Stöckelschuh" (Palzkill 1992, 105).
Es scheint als müssten Sportlerinnen zwei verschiedene Geschlechtsrollen annehmen, um außerhalb und innerhalb des Sports gleichermaßen Anerkennung zu finden.
Auf die Frage, ob sie sich selbst eher als Frau oder als Sportlerin bezeichnen würden, antworteten fünf der Befragten, dass sie sich als Sportlerin sähen und vier fühlten sich sowohl als Sportlerin als auch als Frau.
Ich war ja Sportlerin, bevor ich überhaupt zu dem Punkt kam mir zu überlegen, ,bin ich Frau?‘, weil ich ja von klein auf immer schon nah am Leistungssport Sport betrieben habe, das heißt, ich hab mich eigentlich über den Sport identifiziert. (Befragte 4, 123)
Im Vergleich zu den Interviews die Palzkill 1992 mit neunzehn lesbischen Leistungssportlerinnen führte, fingen die Befragten 2011 alle schon im Kindesalter mit Fußball an, wuchsen damit auf und hinterfragten ihre Geschlechtsrolle weniger.
Aus diesem Grund sahen in der Kindheit und Jugend sich die meisten der Befragten nur als Sportlerin. Heute empfinden sie den Unterschied zwischen Sportlerin und Frau weniger groß. Befragte 1 antwortete auf die Frage, ob sie sich lieber als Fußballerin bezeichnet oder als Frau:
Ich meine, ich bin ja nie damit konfrontiert worden [...] ich kann da jetzt nicht hundert prozentig drauf antworten, jetzt würde ich sagen, nein, das macht mir keine Probleme, ich kann sowohl Fußballerin sein als auch Frau, das macht für mich keinen Unterschied, aber, ich glaube, damals, wäre es mir einfacher gefallen oder ist es mir einfach gefallen. (Befragte 1, 87)
Fußballerin, beziehungsweise generell Sportlerin zu sein, erklärt für die jungen Mädchen ihr sportliches, lässiges Auftreten. Sie müssen nicht rechtfertigen, dass sie keine typische Mädchenkleidung tragen, da sie Sportlerinnen sind. Obwohl die Befragten angeben, im Fußball mehr Freiheit in ihrer Geschlechterrolle zu verspüren, scheint die Zerrissenheit zwischen Männlichkeit und Weiblichkeit kein bewusstes Problem zu sein, da sie nur sehr wenig zu antworten wussten. Der Spagat zwischen „Turnschuh und Stöckelschuh", wie ihn die von Palzkill Befragten empfanden (vgl. Palzkill 1992, 105), wird weniger extrem wahrgenommen, da Frauen heutzutage auch außerhalb der Sporthallen ein sportlicher Stil zugestanden wird. Lediglich Befragte 5 berichtet, durch den Fußball und ihre Identifikation als Sportlerin auch im Alltag den Mut bekommen zu haben, zu ihrer Geschlechterrolle zu stehen:
Zu meiner Zeit war das noch ausgeprägter, dass Mädels Röcke anhatten und so und das ist mir ja völlig gegen den Strich gegangen, durch meinen Sport konnte ich natürlich auch sagen, gut, das ist jetzt für mich etwas anders, ich kann in Jeans gehen, ich kann in Hosen gehen.
(Befragte 5, 124)
4.1.2 Geschlechterrolle im Fußball versus Geschlechterrolle im Alltag
Um zu erfahren, inwiefern Frauenfußball die Geschlechtsrolle, und somit vielleicht auch die sexuelle Identität der Spielerinnen beeinflusst, müssen wir zwischen zwei Typen von Fußballerinnen unterschieden: Diejenigen die schon sehr früh (mit ungefähr sechs bis acht Jahren) mit dem Fußball spielen begonnen haben und Fußballerinnen, die erst während, oder nach der Pubertät aktiv einem Verein oder einer Mannschaft beigetreten sind. Haben die Spielerinnen also noch in der geschlechtsneutralen Phase die Entscheidung für den Fußball getroffen, oder haben sie den Fußball gewählt, weil er eher ihrer Geschlechterrolle entsprach als andere Bereiche des Alltags?
In unserem Fall sind es Befragte 5, 7 und 9, die erst nach der Pubertät in einem Fußballverein aktiv wurden. Für Befragte 5 und 7 war diese Entscheidung eine große
Erleichterung, beide lernten dort zum ersten Mal lesbische Frauen kennen. Dies führte unter anderem auch dazu, dass sie ihre Geschlechterrolle freier ausleben konnten. Für Befragte 5 war es vor allem auch eine Frage der Kleidung: „Zu meiner Zeit war das ja noch schlimmer, da gab es ja Jeans oder so etwas nicht, das kam damals erst" (Befragte 5, 124). Befragte 9 wurde erst mit 28 Jahren in einem Verein aktiv, sie hatte schon früh über das Internet Kontakt zu lesbischen Frauen hergestellt. Mit ihnen spielte sie auch manchmal hobbymäßig Fußball. Dennoch sagte sie, sie könne nicht behaupten, dass Fußball bewusst eine Flucht vor der weiblichen Rolle gewesen wäre; bei Befragte 5 und 7 war dies hingegen der Fall.
Von den Befragten, die schon in der Kindheit Fußball spielten, gaben zwei an, bewusst der weiblichen Geschlechtsrolle durch den Fußball zu entfliehen, weitere drei gaben an, nur in der Kindheit und Jugend so empfunden zu haben und eine der Befragten hatte sich noch keine Gedanken über dieses Thema gemacht.
Früher schon, weil ich früher ein ganz großes Problem damit hatte, eine Frau zu sein, mittlerweile gar nicht mehr, aber früher war das schon so ein Abtauchen irgendwo, in eine männlichere Rolle schon irgendwie. (Befragte 2, 97)
Auch in der Literatur wird berichtet, dass Fußball für Lesben einen Zufluchtsort darstellt, in dem sie so sein können, wie sie sind (vgl. Walther-Ahrens 2011, 39; vgl. Haubenberger 2009, 94).
Laut Klein (1983) bleiben Mädchen „ [...] gerade in der frühen Sozialisationsphase im Hinblick auf den Sport ohne konkretes Identifikationsobjekt - ihre Bindung an den Sport wird so schließlich auch sehr instabil" (vgl. Klein 1983, 17). Bei den Befragten trifft genau das Gegenteil zu. In der Kindheit spielte Fußball eine große Rolle, er war fester Bestandteil ihres Lebens. Ein Ort, an dem sie so sein konnten, wie sie wollten, auch wenn sie dies nicht bewusst erlebten. Dort hatten sie ihre Identifikationsobjekte, auch wenn es keine Frauen waren. Ohne den Sport wäre den Fußballerinnen die Kindheit und Jugend wohl weniger leicht gefallen. „Kraft haben, sich kraftvoll bewegen, wird zwar Leistungssportlerinnen zugestanden, nicht jedoch mit den allgemeinen Vorstellungen von Weiblichkeit in Zusammenhang gebracht" (Kugelmann 1996, 81). Aus diesem Grund blieben sie dem Fußball treu. Das SportlerinSein legitimierte ihr lässiges Auftreten und gleichzeitig bekamen sie die Möglichkeit zur Identifikation mit Jungen und später mit gleichgesinnten Mädchen, die ihnen den nötigen Halt in ihrer Geschlechterrolle gaben.
Palzkill fand heraus, dass lesbische Leistungssportlerinnen, die erst spät einen passenden Sport für sich entdecken, mehr Schwierigkeiten in der Entwicklung ihrer Geschlechtsrolle aufweisen: „So führt die Verweigerung der Anpassung an die weibliche Rolle mehr und mehr dazu, anders zu sein als die anderen Frauen, nicht dazuzugehören, Außenseiterin zu werden" (Palzkill 1995, 57). Im Fußball hingegen fühlten sie sich freier und hatten ihren festen Platz.
Sechs der Befragten berichten, innerhalb des Fußballs die Möglichkeit zu haben, „männlicher" und lässiger zu sein, als in anderen sozialen Bereichen. Zwei davon behaupten, konstant eine männliche Geschlechtsrolle inne zu haben, die sie lediglich im Fußball freier ausleben können. Dies bedeutet für die Befragten nicht, dass sie sich als Mann fühlen, es geht lediglich um ihr Verhalten beim Spiel und um ihre Kleidung. Weitere drei Befragte bemerken keinen Unterschied in ihrer Geschlechterrolle innerhalb und außerhalb des Fußballs.
Auch Gertrud Pfister (1999) beschäftigt sich mit Geschlechterrollen von Frauen im Sport. Sie befragte zu diesem Anlass ungefähr 60 Leistungssportlerinnen in Gruppendiskussionen. Was das Erscheinungsbild der Fußballerinnen betrifft, kam sie zu einem ähnlichen Ergebnis: „Alle Fußballspielerinnen bevorzugen lockere, lässig Kleidung, sie tragen Hosen und flache Schuhe. Kleider zu tragen oder sich zu schminken, lehnten mit einer Ausnahme alle interviewten Fußballspielerinnen ab" (Pfister 1999, 146).
Der Kleidungsstil im Fußball scheint sich also nicht nur von dem des Alltags zu unterscheiden, sondern auch von dem Kleidungsstil, der mit anderen Sportarten einhergeht. Die Kleidung steht in engem Zusammenhang zu unseren Bewegungen, aber auch unserem Empfinden anderen gegenüber. Heike Faller (2011) berichtet über eine langjährige Fußballerspielerin, die am Fußball viel mehr Aspekte liebte, als nur den Sport an sich: „Es war auch seine Männlichkeit, die Art zu gehen oder auf den Boden zu spucken oder sich die Hosenbändel über die Shorts hängen zu lassen" (vgl. Faller 2011, 14). Befragte 7 beschreibt ebenso einen deutlichen Unterschied im Kleidungsstil zwischen Fußball-Welt und Alltag, unabhängig davon ob es sich um hetero- oder homosexuelle Spielerinnen handelt.
Das sind alles halt Männertrikots, möglichst groß auch, also jeder versucht immer die größtmögliche Hose zu kriegen, weil das ist auch einfach total nervig, wenn man da so eine enge Hose hat oder so und da soll man da gescheit rennen. (Befragte 7, 147)
Alle Befragten erwähnen, wenn auch in manchen Fällen nicht explizit, im Fußball anders sein zu können, als in privaten Bereichen.
Im Fußball bin ich schon so bisschen jemand anderes, bisschen härter, bisschen robuster, bisschen niveauloser vielleicht auch, aber, wenn ich mich mit meinen Leuten treffe, dann bin ich wieder ich. (Befragte 2, 95)
Auch Befragte 3, die von sich behauptet, privat ein harmoniebedürftiger und offener
Mensch zu sein, verändert sich innerhalb des Fußballs:
Und im Fußball ist es so, ich bin auch schon oft mit Rot vom Platz geflogen und hab mir gelben Karten gesammelt, weil ich irgendjemandem gefoult hab oder den Schiri blöd angemacht hab, das ist einfach so die Seite von mir, die ich im Privatleben nicht raus lassen will, oder auch nicht muss. (Befragte 3, 104)
Wie es scheint, verfallen auch Spielerinnen mit einer im Alltag eher weiblichen Geschlechterrolle, im Fußball weniger den weiblichen Geschlechtsstereotypen.
Normalerweise, wenn die morgens aufstehen oder so, denken die: ,Frau, ich muss mich jetzt schminken‘, machen die das ja direkt, aber nach dem Sport allgemein, nach dem Fußball, ist das irgendwie so, die typische erwartete Rolle irgendwie aufgehoben. (Befragte 7, 148)
Die unbewusste feste Bindung zum Fußball konnte bei den Befragten vor allem während der Pubertät als Flucht vor der im Alltag herrschenden Zerrissenheit zwischen Männlichkeit und Weiblichkeit angesehen werden. Heute scheint die Diskrepanz der Geschlechterrolle zwischen Fußballerin-Sein und Alltag/Beruf weniger im Zentrum zu stehen und folglich auch weniger groß zu sein. Dadurch, dass sich die Fußballerin- nen wenig mit Fußballern vergleichen, auch wenig mit ihnen in Kontakt sind und vor allem unter Frauen bleiben, scheint eine Neutralisierung von Geschlecht (Undoing Gender) stattzufinden (vgl.Hirschauer 2001, 217 In: Hartmann-Tews 2003, 22).
4.1.3 Neutralisierung von Geschlecht im Frauenfußball
Die Befragten nahmen nicht nur im Fußballsport eine undefinierte, neutrale Rolle ein, allgemein scheint Geschlecht für sie in der Kindheit nicht von Bedeutung gewesen zu sein. Aus diesem Grund konnten sie auch problemlos den Fußballsport ausüben, ohne in Konflikte mit ihrer Geschlechtsidentität zu geraten.
Sie selbst waren wie ein kleiner Junge und wurden auch als solchen von den Jungen wahrgenommen. Das biologische Geschlecht wurde erfolgreich ausgeklammert. Erst in der Pubertät kam die Geschlechterdifferenz zum Vorschein. Die Mädchen fühlten, dass ihre Körper anders funktionierten als die der Männer. Viele wollten zu diesem
Zeitpunkt, auch wenn es ihnen schwerfiel, von selbst aufhören, bei den Jungen mitzuspielen.
Aufgrund der großen biologischen Unterschiede zwischen Männern und Frauen, hörten die Mädchen schon schnell nach dem Wechsel in die Mädchenmannschaft auf, sich mit den Jungen/Männern zu vergleichen. Vier der Befragten erwähnten, ohne direkt danach gefragt worden zu sein, dass für sie Frauenfußball und Männerfußball komplett unterschiedliche Sportarten seien.
Auch wenn man Fußball auf hohem Niveau sieht, die Frauen gegen die Männer, das ist völlig unterschiedlich, von den Bewegungen her, vom technischen Verständnis, von der Schnelligkeit her, das ist einfach eine komplett unterschiedliche Sportart. (Befragte 2, 98)
Auch Befragte 4 gibt an, dass sie sich gerade aufgrund der großen - vor allem körperlichen - Unterschiede nie als Mann im Fußball gefühlt hat (vgl. Befragte 4, 121). Befragte 7 auf die Frage, weshalb sie sich im Fußball besonders wohlfühlt:
Weil ich mehr losgelöst sein kann, find ich [...] als Frau ist das halt immer, man kriegt so viele Erwartungen an den Kopf geklatscht, wie man sein sollte, wie man sich benehmen sollte, was man tun sollte, was man nicht tun sollte [...] weil ich da einfach gar nicht drüber nachdenke, ob ich jetzt Frau bin oder nicht, also gar nicht [...] da zählt halt einfach alles andere und nicht das Geschlecht, also da wird das komplett außen vor gelassen. (Befragte 7, 148)
Befragte 7 beschreibt die Neutralisierung von Geschlecht sehr deutlich. Für sie ist Fußball ein Raum, in dem die geschlechtsneutrale Phase der Kindheit erhalten geblieben ist. Ein Raum, in dem es darum geht, Fußball zu spielen, ohne den Zwang der Geschlechtsrollenidentität.
Da denkt dann niemand: Eigentlich passt das ja jetzt nicht so‘, sondern da steht dann im Vordergrund : ,Geil, die hat reingehaun und hat das Tor verhindert, das hat sie gut gemacht‘, manchmal bin ich schon froh, das ist wie früher, wenn man im Matsch spielen konnte oder so, ohne, dass es jemanden gejuckt hat. (Befragte 7, 147)
Sie fühlt sich im Fußball losgelöst von ihrer Geschlechterrolle und wird dort sogar für das gelobt, was nicht dem weiblichen Geschlechtsstereotyp entspricht und wofür sie in anderen sozialen Bereichen belächelt werden könnte.
Auch Befragte 6 äußert sich ähnlich zu diesem Thema: „Ich weiß nicht, ich seh das überhaupt nicht sexuell. Ich seh mich auch nicht als Junge oder so, ich find’s einfach nur schön, wenn ich so sportlich bin" (Befragte 6, 137).
Das äußere Erscheinungsbild der Spielerinnen, in und außerhalb des Fußballs, scheint in den letzten zwanzig Jahren an männlichen Attributen verloren zu haben. Der Sport selbst ist jedoch der gleiche belieben. „Fußball ist ein körperbetontes Spiel, das ohne direkte Kontakte mit Gegnern und auch eigenen Teammitgliedern nicht zu spielen ist, in dem Härte, Wendigkeit, Schnelligkeit und bisweilen auch schmerzhafter
Körpereinsatz gefragt sind" (Eggeling 2010, 23). Somit bleibt es unvermeidlich als Sportlerin aufzutreten und dabei nah an die gesellschaftlich festgelegten Geschlechterrollengrenzen zu gelangen.
Also, ich meine, ich habe es ja selbst gemerkt, wie ich in dieses männliche Verhalten reinrutsche, aber ich würde mich ja jetzt auch nicht - also, ich meine, es gibt lesbische Frauen, die spielen Fußball, die sehen auch aus wie ein Mann, die geben sich wie ein Mann und die sprechen auch wie ein Mann- und so würde ich mich ja jetzt nicht bezeichnen. (Befragte 3, 106)
An diesem Punkt bleibt zu hinterfragen, ob der/die Betrachtern einen Unterschied zwischen der Selbstbeschreibung von Befragte 3 und den von ihr beschriebenen männlicheren Frauen wahrnimmt. Eventuell ist die Grenze zwischen Weiblichkeit und Männlichkeit für Fußballerinnen kleiner als für Außenstehende.
Wenn Fußballerinnen ein von tradierten Männlichkeitswerten geprägtes Spiel betreiben, werden sie zudem immer noch von vielen nicht als "echte" Frauen betrachtet, dazu sind sie ihnen zu kerlig, robust, roh und damit unattraktiv - Attribute, die gemeinhin Lesben zugeschrieben werden. (Eggeling 2010, 25)
Das sehen die Fußballerinnen anders. Für sie sind Training und Muskeln nicht gleichzusetzen mit Männlichkeit und Lesbisch-Sein. „Ich als Frau würde keinen richtigen Sixpack haben wollen, diese Bodybuilder, find ich jetzt nicht so, aber durchtrainiert ist gut. Das assoziiere ich auf keinen Fall mit Männern oder so" (Befragte 9, 5).Die von Pfister (1999) interviewten Leistungssportlerinnen empfanden die Veränderungen ihrer Körper durch Training zwar als männlich, trotzdem hielten manche Fußballerinnen „ [...] Muskeln und Attraktivität durchaus für vereinbar" (vgl. Pfister 1999, 151).
Angesichts der Zuschreibungen von der Vermännlichung‘ von Frauen im und durch den Fußballsport war es interessant, die Zufriedenheit der Spielerinnen mit ihrem Körper zu erheben. Dabei zeigte sich, dass trotz der generellen gesellschaftlich konstruierten strengen Schönheitsideale für Frauen und der 'Maskulinisierungsthese' die Zufriedenheit der Spielerinnen mit ihrem Äußeren relativ hoch war. (Marschik 2003, 357)
Unter anderem können auch gerade die körperlichen Veränderungen als Anreiz und Leistungsmotivation für die Spielerinnen gesehen werden: „Meine Waden, also ich hab ja schon immer relativ krasse Wadenmuskeln, aber die hab ich dann auch richtig gesehen, also dann auch richtig richtig gesehen und dann hab ich gedacht ,komisch, aber auch irgendwie cool"' (Befragte 7, 146).
Tanja Krone (2011) interviewte Sportwissenschaftlerin Kleindienst-Cachay zu dieser Thematik. Für Kleindienst-Cachay hängt der Umgang mit den körperlichen Veränderungen durch Sport mit den eigenen Weiblichkeitsstereotypen und der sexuellen Orientierung zusammen. Einer heterosexuellen Fußballerin wird sich womöglich mit folgender Frage mehr beschäftigen als eine lesbische Spielerin: „Bin ich als
[...]
[1] http://www.welt.de/sport/article1222310/Blond_und_heterosexuell_ist_ein_Gluecksfall.html
[2] http://diepresse.com/home/sport/mehrsport/488892/80-Prozent-der-FussbaNerinnen-sind-lesbisch
[3] http://www.masf.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1 .c.189464.de#2
[4] http://www.queer-travel.net/queer-travel-reisetipps/griechenland-lesbos-wo-alles-anfing.html
- Arbeit zitieren
- Aline Thomas (Autor:in), 2012, Identitätsfindung und Geschlechterrollen. Homosexualität im Frauenfußball, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/292878
Kostenlos Autor werden











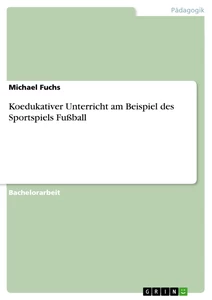


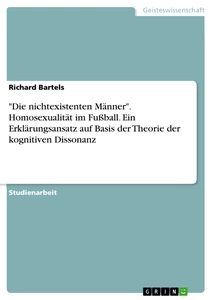







Kommentare