Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
1 Einleitung (Sabrina Mann)
2 Empirische Arbeitsschritte (Sebastian Selzer)
3 Diagnose Depression (Sabrina Mann)
3.1 Merkmale einer Depression (Sabrina Mann)
3.2 Affektive Störungen und Burn-out Syndrom (Sabrina Mann)
3.2.1 Rezidivierende depressive Episode (Sabrina Mann)
3.2.2 Depressive Episode (Sabrina Mann)
3.2.3 Anhaltende affektive Störungen (Sabrina Mann)
3.2.4 Sonstige affektive Störungen (Sabrina Mann)
3.2.5 Bipolare affektive Störungen (Sabrina Mann)
3.2.6 Manische Episode (Sabrina Mann)
3.2.7 Burn-out-Syndrom (Sabrina Mann)
3.3 Ursachen von Depressionen (Sabrina Mann)
3.3.1 Psychosoziale Faktoren (Sabrina Mann)
3.3.2 Genetische Faktoren (Sabrina Mann)
3.3.3 Neurobiologische Faktoren (Sabrina Mann)
3.4 Depression unter Einfluss der Komorbidität, des Alters und des Geschlechtes (Sabrina Mann)
3.4.1 Depression und Alter (Sabrina Mann)
3.4.2 Depression und Geschlecht (Sabrina Mann)
3.4.3 Komorbidität (Sabrina Mann)
3.5 Interventionsmöglichkeiten (Sabrina Mann)
4 Prävalenz von depressiven Erkrankungen in der bundesdeutschen Bevölkerung (Sebastian Selzer)
4.1 Depression im Zusammenhang mit dem Lebensalter (Sebastian Selzer)
4.1.1 Depressive Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen (Sebastian Selzer)
4.1.2 Depressive Erkrankungen im erwerbsfähigen Alter (Sebastian Selzer)
4.1.3 Depressive Erkrankungen ab dem regulären Renteneintrittsalter (Sebastian Selzer)
4.2 Depression und Geschlecht (Sebastian Selzer)
4.3 Depression im Zusammenhang mit beruflicher Tätigkeit und sozioökonomischem Status (Sebastian Selzer)
4.4 Depressionserkrankungen und Komorbidität (Sebastian Selzer)
4.5 Rentenzugänge aufgrund chronischer depressiver Erkrankungen in Deutschland (Sebastian Selzer)
4.6 Todesfälle durch Suizide aufgrund einer Depression in Thüringen und anderen Bundesländern (Sebastian Selzer)
5 Prävalenz und Fehlzeiten durch die Diagnose depressive Episode (F32), rezidivierende Depression (F33) und Burn-out-Syndrom in Thüringen (Sebastian Selzer)
5.1 Stationäre Verweil- und Behandlungsdauer aufgrund psychischer und depressiver Erkrankungen in Thüringer Kliniken (Sebastian Selzer)
5.1.1 Depressive Kinder und Jugendliche in stationärer Behandlung (Sebastian Selzer)
5.1.2 Depressive Erwachsene in stationärer Behandlung (Sebastian Selzer)
5.2 Krankschreibungen aufgrund diagnostizierter depressiver Erkrankungen (Sebastian Selzer)
5.2.1 Arbeitsunfähigkeiten aufgrund psychischer Störungen in Deutschland und Thüringen (Sebastian Selzer)
5.2.2 Arbeitsunfähigkeitsfälle aufgrund der Diagnosen F32 (Sebastian Selzer)
5.2.3 Arbeitsunfähigkeitstage aufgrund der Diagnosen F32 und F33 (Sebastian Selzer)
5.3 Regionale Verteilung von depressiven erkrankten Personen (Sebastian Selzer)
5.3.1 Regionale Verteilung aller Depressionsdiagnosen (Sebastian Selzer)
5.3.2 Regionale Verteilung spezifischere Depressionsdiagnosen Verteilung (Sebastian Selzer)
5.3.3 Diagnoserate bei schweren Depressionen (Sebastian Selzer)
5.3.4 Verteilung Diagnoserate chronischer Depressionsfälle (Sebastian Selzer)
5.3.5 Verteilung von Depressionen und psychischer Komorbidität (Sebastian Selzer)
5.4 Ambulant diagnostizierte Depressionfallzahlen nach Region Alter und Geschlecht (Sebastian Selzer)
5.5 Prävalenz der depressiven Störungen von Thüringer Studierenden (Sebastian Selzer)
5.6 Burn – out – Syndrom (Sebastian Selzer)
6 Versorgungsstruktur von depressiv erkrankten Menschen in Deutschland - speziell im Freistaat Thüringen, Psychiatrische und psychotherapeutische Versorgung von depressiv erkrankten Menschen in Thüringen (Sabrina Mann)
6.1 Allgemeine Daten zur Versorgungsstruktur in Deutschland (Sabrina Mann)
6.1.1 Stationäre Versorgung (Sabrina Mann)
6.1.2 Psychotherapeutische und fachärztliche Versorgung (Sabrina Mann)
6.1.3 Versorgung durch Hausärzte/Hausärztinnen (Sabrina Mann)
6.1.4 Regionale Unterschiede leitlinienorientierter Behandlung (Sabrina Mann)
6.2 Psychiatrische und psychotherapeutische Fachkrankenhäuser in den Kreisen und kreisfreien Städten Thüringens (Sabrina Mann)
6.2.1 Kliniken für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik (Sabrina Mann)
6.2.2 PIA – Psychiatrische Institutsambulanzen (Sabrina Mann)
6.2.3 Tageskliniken (Sabrina Mann)
6.3 Psychiatrische/ psychotherapeutische Fachkrankenhäuser, Fach-abteilungen, PIA´s und Tageskliniken für Kinder und Jugendliche in Thüringen (Sabrina Mann)
6.4 Niedergelassene Psychotherapeuten/ Psychotherapeutinnen und Fachärzte/ Fachärztinnen (Sabrina Mann)
6.5 Niedergelassene Kinder und Jugendpsychotherapeuten/ Psychotherapeutinnen und Fachärzte/Fachärztinnen für Kinder und Jugendliche (Sabrina Mann)
6.6 Arzneimittelverordnung von Antidepressiva (Sebastian Selzer)
6.7 Die Rolle der Sozialen Arbeit in der psychiatrischen Versorgungsstruktur (Sabrina Mann)
7 Vorsorge- und Präventionsmaßnahmen in Thüringen (Sabrina Mann)
7.1 Durchgeführte und bestehende Präventionsmaßnahmen (Sabrina Mann)
7.2 Selbsthilfegruppen (Sabrina Mann)
7.3 Bezug zur Sozialen Arbeit (Sabrina Mann)
8 Zusammenfassung und Fazit (Sebastian Selzer)
Literaturverzeichnis
Anhang
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1 Depression: Diagnosekriterien und Schweregrad
Abbildung 2 Prävalenz aller Depressionsdiagnosen nach Bundesland, 2011
Abbildung 3 Regionale Depressionsraten in Thüringen in %, 2011
Abbildung 4 Regionale Verteilung spezifizierter Depressionsdiagnosen in %, 2011
Abbildung 5 Regionale Verteilung chronischer Depressionen in %, 2011
Abbildung 6 Regionale Verteilung komorbider Angststörungen bei diagnostizierten Depressionen in %, 2011
Abbildung 7 Anzahl der Diagnosefallzahlen nach Region und Jahr
Abbildung 8 Verteilung der Depressionsfälle nach Lebensjahren in Thüringen
Abbildung 9 Geschlechterverhältnisse in Thüringer Regionen
Abbildung 10 Diagnostizierende Fachgruppen bei depressiven Erkrankungen
Abbildung 11 Verteilung leitlinienorientierter behandelten: mittelgradigen, schweren, Depressionen und Dysthymien
Abbildung 12 Regionale Anteile von Antidepressiva Verordnungen
Abbildung 13 Suizidrate nach Bundesland und Geschlecht, 2012
Abbildung 14 Regionale Verteilung aller Depressionsfälle in Deutschland 2011, Prävalenz in %
Abbildung 15 Prävalenz spezifizierter Depressionsdiagnosen nach Bundesland, 2011
Abbildung 16 Regionale Verteilung komorbider somatoformer Störungen bei spezifizierten Depressionsdiagnosen, 2011
Abbildung 17 Anteile der Antidepressiva-Verordnungen nach Bundesland, 2011
Abbildung 18 Versorgungsmöglichkeiten der Hilfen des Psychiatriewegweisers Thüringen
Abbildung 19 niedergelassene Fachärzte/Fachärztinnen und Psychotherapeuten/Psychotherapeutinnen in Erfurt, 2014
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1 Symptome einer Depression
Tabelle 2 Leitlinienorientierte Behandlung bei depressiven Erkrankungen
Tabelle 3 Sterbefälle durch Suizid in Thüringen 2010
Tabelle 4 Stationäre psychiatrische und psychotherapeutische Behandlungszahlen von Kindern und Jugendlichen
Tabelle 5 Vollstationär behandelte PatientenInnen nach Wohnort und Diagnose
Tabelle 6 Vollstationär behandelte PatientenInnen in Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen nach Wohnort, Geschlecht und Diagnose
Tabelle 7 Stationär behandelte PatientenInnen mit Wohnort in Thüringen nach Diagnose, Jahr und Einrichtung
Tabelle 8 In Kliniken stationär behandelte PatientenInnen mit Wohnort in Thüringen nach Diagnose, und Jahr
Tabelle 9 In Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen behandelte PatientenInnen mit Wohnort in Thüringen nach Diagnose und Jahr
Tabelle 10 Vollstationär behandelte PatientenInnen mit Wohnsitz in Thüringen nach Jahr, Geschlecht, Diagnose und Region
Tabelle 11 Durchgeführte Leistungen in Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen aufgrund einer F32 und F33 Diagnose nach Geschlecht, Region und Alter, 2013
Tabelle 12 Durchgeführte Leistungen in Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen aufgrund einer F32 und F33 Diagnose nach Geschlecht, Region und Alter, 2012
Tabelle 13 Durchgeführte Leistungen in Vorsorge und Rehabilitationseinrichtungen aufgrund einer F32 und F33 Diagnose nach Geschlecht, Region und Alter, 2011
Tabelle 14 Regionale Depressionsraten in Thüringen in %, 2011
Tabelle 15 Anzahl der Depressionsdiagnosen nach Region und Jahr
Tabelle 16 Anzahl der Depressionsdiagnosen nach Region und Geschlecht, 2013
Tabelle 17 Bettenzahl in den kreisfreien Städten und Landkreisen
Tabelle 18 Bettenzahl der jeweiligen Versorgungsregionen
Tabelle 19 Krankenhausbetten durch den Qualitätsbericht der jeweiligen Krankenhäuser/ Fachkrankenhäuser
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
1 Einleitung (Sabrina Mann)
„Naja, man geht ja auch nicht zum Arzt und sagt, mir geht’s heut nicht gut oder so. Man versucht dann erstmal selber sich zu erklären oder so. Und gut da heul ich heut halt mal, und da ist das eben so. Aber wenn man dann tagelang heult und man weiß eigentlich gar nicht warum, weil ein die Fliege so leid tut oder irgendwas“ (Interview 4, Zeile: 283-287).
Das Wort Depressionen leitet sich aus dem lateinischen Wort „depremire“ ab und bedeutet so viel wie „niederdrücken“ (Nickel, 30.07.2014). Weltweit wird vermutet, dass 350 Millionen Menschen von Depressionen betroffen sind. Die Weltgesundheitsorganisation -WHO- geht davon aus, dass im Jahr 2020 affektive Störungen zu der zweithäufigsten Krankheit weltweit zählen wird (www.bmg.bund.de, 25.07.2014). Zur weltweit häufigsten und folgereichsten Krankheit zählt sie bereits heute schon unter den psychischen Störungen (Busch u.a. 2011, 1). In Deutschland gibt es schätzungsweise drei Millionen Menschen die betroffen sind. Die Versorgungssituation bietet trotz der hohen Anzahl noch keine adäquate Behandlung. Die WHO schätzt, dass jeder Vierte eine leitlinienorientierte Behandlung erfährt (www.gesundheitsforschung-bmbf.de, 25.07.2014). Schaut man in die Medien, kann man immer wieder von Burn-out oder auch depressiven Berichten lesen. Auch das Internet bietet zahlreiche Aufklärungen und Hinweise zur Erkrankung. Immer wieder liest man, dass die Depressionen zugenommen haben und Geschäftsmänner/Geschäftsfrauen mit viel Arbeit unter dem „Ausgebranntsein“ leiden. In der vorliegenden Bachelor-Thesis wurde sich mit der Versorgung und Epidemiologie von depressiven Störungen in Deutschland beschäftigt. Jedoch wurde hauptsächlich der Freistaat Thüringen unter die Lupe genommen. „Wie sieht die Prävalenz bei depressiven Erkrankungen in der Bevölkerung des Freistaates Thüringen aus? Wie hoch ist die Depressionsrate und wie verteilt sich diese in den Landkreisen und kreisfreien Städten? Welche ambulanten und stationären Versorgungsstrukturen stehen in den einzelnen Regionen in Thüringen zur Verfügung und welche Maßnahmen zur Prävention finden statt?“ Genau mit diesen Fragen wurde sich ausführlich beschäftigt. Wie die empirische Vorgehensweise des Erarbeitens der vorliegenden Thesis stattfand, ist im folgenden Kapitel beschrieben.
Um den Einstieg in die Thematik zu ermöglichen, werden zu Beginn der Bachelor-Arbeit verschiedene Formen der Depression vorgestellt und erklärt. Was sind Depressionen eigentlich und wie werden diese diagnostiziert? Im Kapitel vier und fünf wird auf die epidemiologische Prävalenz der depressiven Erkrankungen eingegangen. Schwerpunkte bilden hierbei die Häufigkeitsverteilungen innerhalb Thüringens und der Vergleich mit anderen Bundesländern. Dabei wird der Bezug zum Geschlecht, Alter, sozioökonomischen Status, zur Differentialdiagnose und Region hergestellt. Das sechste Kapitel beschäftigt sich mit der psychotherapeutischen und psychiatrischen Versorgung von depressiv erkrankten Menschen im stationären und ambulanten Bereich für das Bundesland Thüringen. Im siebten Kapitel wird ein kurzer Einblick über die Präventionsmaßnahmen und –kampagnen dargestellt, die in Thüringen derzeit stattfinden oder bereits stattgefunden haben. Dabei wird ebenfalls auf die Rolle der Sozialen Arbeit/ Sozialpädagogik eingegangen.
Für die Quellenanalyse, Bearbeitung der Arbeit, für Kritiken und Hilfestellung und allen weiteren Unterstützungen möchten wir uns hiermit bei allen Firmen, Unternehmen, Institutionen, Professoren/Professorinnen und natürlich bei allen Bekannten, Freunden und unseren Familien herzlich bedanken.
2 Empirische Arbeitsschritte (Sebastian Selzer)
Thüringen besteht aus 4 Planungsregionen, 14 Landkreisen und 6 kreisfreien Städten (Sedlacek 2011, 27). Insgesamt hat das Bundesland 913 Gemeinden. In ihnen wohnen 2.227.072 Thüringerinnen und Thüringer (www.thueringen.de, 31.07.2014). In der Bachelor-Arbeit wird der Bezug zwischen depressiven Erkrankungen und dem Auftreten in den einzelnen Regionen des Bundeslandes hergestellt. Zugleich wird ein Vergleich mit anderen Bundesländern geschaffen.
Um an Daten und Hintergrundwissen zu gelangen, wurden insgesamt sechs Experteninterviews an unterschiedlichen Orten durchgeführt. Diese waren leitfadengestützt, um eine bessere Vergleichbarkeit und Auswertbarkeit herzustellen. Drei der sechs Interviews fanden mit Chefärzten und Chefärztinnen von psychiatrischen Kliniken in Nord-, Ost- und Südthüringen statt. Ein Weiteres wurde mit einem niedergelassenen psychologischen Psychotherapeuten in Erfurt geführt. Die Kontaktaufnahme einer Selbsthilfegruppe in Ostthüringen ermöglichte uns, eine Psychiatrieerfahrene zu interviewen, die aufgrund einer depressiven Erkrankung teilstationär in einem Krankenhaus behandelt worden ist und die noch aktuell erkrankt ist. Ein sehr interessantes Telefongespräch ergab sich mit einer leitenden Vertreterin einer relativ großen Krankenkasse / Krankenversicherung aus. Der Kontakt zu den Interviewten kam entweder durch E-Mail-Korrespondenz, Telefongespräche oder durch persönliches Ansprechen vor Ort zustande. Die InterviewpartnerInnen wurden in der Annahme gewählt, dass dieser Personenkreis bestens mit der Thematik vertraut ist und kompetente Aussagen darüber treffen kann. Von den sechs Interviews wurden vier digital aufgezeichnet und anschließend wortgemäß transkribiert. Die zwei anderen Gespräche durften nicht aufgezeichnet werden. Deren Inhalte und Äußerungen wurden in den Niederschriften sinngemäß wiedergegeben. Alle Transskriptionen nebst Interviewliste befinden sich im Anhang. Neben den geführten Interviews bestanden auch unterstützende Kontakte zu einigen Einrichtungen und Instituten. Zu nennen sind unter anderem das Robert Koch-Institut, das IGES - Institut, die Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland, die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen, die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau, das Thüringer Landesamt für Statistik, die Knappschaft, die medizinischen Fakultäten der Universitäten Leipzig und Jena sowie eine Vielzahl von Krankenkassen und Berufsgenossenschaften. Durch Anfragen konnten einige Quellen in Form von Berichten, Reporten, Statistiken und anderen Dokumenten zusammengetragen werden. Darüber hinaus wurden hilfreiche Informationen für die Recherchen u. a. durch persönliche Hinweise erworben. Ebenfalls sehr aufschlussreich war ein einstündiger Konsultationstermin mit zwei Mitarbeitern der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen in Weimar. Dort wurde für uns das Datenmaterial aufbereitet und anhand einer Präsentation vorgetragen. Die im Kapitel 5.4 gewonnenen Erkenntnisse und Beschreibungen sind das Resultat dieser Konsultation. Das gesamte statistische Datenmaterial wurde anschließend von der KV-Thüringen via E-Mail übermittelt.
Alle Daten und Informationen, die durch die Interviews und Dokumente gewonnen wurden, sind nach den Verfahren von Böhm, Legewie und Muhr ausgewertet. Während der Arbeit wurden die Gütekriterien von Steinke beachtet. Es kamen viele unterschiedliche empirische Methoden zum Einsatz, um eine bessere Überprüfbarkeit und Standardisierbarkeit zu erreichen und um mögliche methodische Verzerrungen zu kompensieren (Steinke 2007, 319 ff). In der Fachhochschule Erfurt gab es ein Lehrforschungsprojekt, in dem sich verschiedene ForscherInnen gegenseitig austauschen konnten und ihre Ergebnisse zum Diskurs vorstellten.
3 Diagnose Depression (Sabrina Mann)
Depressionen können in verschiedenen Formen auftreten. Ebenso können die Ursachen durch mehrere Faktoren begründet werden. Symptome gibt es viele unter denen depressiv Erkrankte leiden. All diese wichtigen Erkenntnisse werden im Kapitel drei genauer betrachtet und erläutert.
3.1 Merkmale einer Depression (Sabrina Mann)
Depressionen gehören nicht nur zu den komplexesten Störungen, da sie gleichzeitig mehrere Bereiche des Lebens beeinträchtigen können, sondern auch zu den folgereichsten Erkrankungen weltweit. National und auch international wird geschätzt, dass ein Mensch zu 16 – 20 % das Risiko hat, im Laufe seines Lebens an einer Depression zu erkranken. Pro Jahr erfüllen 8% der deutschen Bevölkerung die Kriterien einer Depressionsdiagnose (Melchior u.a. 2014, 11ff). Viele der Gefühlszustände und Beschwerden, die Depressionen verursachen, sind den Menschen allgemein bekannt.
Bringen diese Gefühle keine bestimmte Intensität und Dauer mit sich, dann sind diese ganz normale Erfahrungen und Reaktionen durch bestimmte Ereignisse wie Verlust, Misserfolg oder auch Erschöpfung. Typische Symptome für Depressionen sind Niedergeschlagenheit, Gefühllosigkeit, Angst, Hoffnungslosigkeit, Sinnlosigkeit, Appetitstörungen, Libidoverlust, Konzentrationsprobleme oder z.B. auch Schmerzen. Die Liste der Symptomatik ist lang. Die Depression als psychische Störung umfasst also kein einheitliches Krankheitsbild, sondern vereint verschiedene Sub-komplikationen. Der Begriff Depression wird in der Psychopathologie sowohl auf symptomatologischer als auch auf syndromaler Ebene verwendet. Bei der symptomatologischen Ebene geht es z.B. um Symptome wie Traurigkeit oder Niedergeschlagenheit. Auf der syndromalen Ebene werden zusammenhängende Merkmalskomplexe mit emotionalen, kognitiven, motorischen, motivationalen, psychologischen und endokrinologischen Komponenten besprochen. Symptome der Erkrankung lassen sich in fünf Kategorien einteilen. Die folgende Tabelle enthält nur einige Beispiele für die Symptome der jeweiligen Kategorie. Die farblich hervorgehobenen Anhaltspunkte sind die Hauptsymptome und die weiteren die sogenannten Zusatzsymptome einer Depression.
Tabelle 1 Symptome einer Depression
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Hautzinger 2010, 5
Um eine möglichst zielgenaue Diagnose stellen zu können, wurde ein internationaler Katalog erstellt, in dem sich Hauptsymptome von Zusatzsymptomen unterscheiden. Je nachdem, wie ausgeprägt die Symptome auftreten, erfolgt eine Einteilung des Krankheitszustandes in leicht, mittel oder schwer. Die Diagnosekriterien zur Einteilung des Schweregrades sehen folgendermaßen aus:
Abbildung 1 Depression: Diagnosekriterien und Schweregrad
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Bundesverband für Gesundheitsinformationen und Verbraucherschutz – Info Gesundheit e.V. 2013, 11
Die Diagnostik erfordert bei Depressionen eine sehr genaue Untersuchung, da keine der aufgeführten Symptomatik in Tabelle 1 vorkommen muss. Zugleich können die Merkmale häufig auch Begleiterscheinungen von anderen Erkrankungen sein (Hautzinger 2010, 4). In der Symptomatologie ist es von hoher Wichtigkeit, die Verbundenheit zwischen Depression und Suizidalität zu beachten. Es ist nicht selten, dass aufgrund von depressiver Erkrankung Suizidgedanken, Suizidversuche entstehen oder gar vollendete Suizide geschehen. Es wird geschätzt, dass 15% der Patienten mit schweren Depressionen durch einen Suizid versterben (Robert-Koch-Institut 2011, 93). Eine Studie der Bertelsmann Stiftung ergab, dass sich einer von sieben Menschen mit schwerer Depression suizidiert (Faktencheck 2014, 21). Bei Kindern und Jugendlichen ist die Gefahr noch höher. Die Hälfte aller Kinder und Jugendlichen mit psychischen Störungen haben einen Suizidversuch hinter sich, 80% davon probieren einen Zweiten. Unter den psychischen Störungen ist besonders Depression als Gefahr gekennzeichnet (Baierl 2011, 22). Weiterhin ist bei Depressionen zu erwähnen, dass die Erkrankung im Verlauf der Jahre von Patienten und Patientinnen wiederkehrend auftritt. So erleben 80% von den zu Behandelnden in den nachfolgenden Jahren weitere depressive Episoden. Bei 15% - 30% der Betroffenen wird davon ausgegangen, dass sich eine chronische Depression entwickeln wird (Wittchen u.a. 2010, 12). Depressionen werden unter affektiven Störungen subsumiert. Dies zeigt sich im ICD 10 und im DSM V.
Hier wurde versucht, Depressionen verschiedener Ausprägungen nach klar operationalisierbaren und deskriptiven Faktoren einzuordnen (Althaus 2010, 6).
3.2 Affektive Störungen und Burn-out Syndrom (Sabrina Mann)
Im folgenden Abschnitt werden die verschiedenen Arten der affektiven Erkrankungen kurz beschrieben. Hierzu wurde der Bezug hauptsächlich zu der internationalen statistischen Klassifikation der Krankheit und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD 10) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gewählt, da die vorliegende Arbeit die deutsche Bevölkerung, vor allem den Freistaat Thüringen betrifft und die deutschen Ärzte/Ärztinnen vorgeschrieben bekommen, die Diagnose nach dem ICD 10 zu stellen. Zusätzlich verwenden auch Krankenkassen bei Abrechnungen, Erhebungen und Auswertungen sämtlicher Daten die Klassifikationen nach dem ICD 10 (Melchior u.a. 2014, 14). An diesem Punkt ist zu erwähnen, dass der Diagnosekatalog Diagnostic and Statisctical Manual (DSM) von der amerikanischen psychiatrischen Gesellschaft als Vorreiter für das ICD zählt und auch einige Neuerungen für das ICD aus dem DSM übernommen wurden. In der fünften und aktuellsten Version des DSM V wurde die persistierende depressive Störung eingeführt, die eine Dysthymie und chronische depressive Störung (nach DSM Majore Depression) zusammenfasst, da die Unterscheidung der Symptome und Beschwerden sich kaum separieren lassen (Melchior u.a. 2014, 16). Affektive Störungen, wozu die depressiven Erkrankungen, manische Episoden sowie auch bipolare Störungen zählen, sind im ICD 10 unter F3, genauer F30 – F39 zu finden. Diese Gruppe enthält Störungen, deren Hauptsymptome zur Veränderung der Emotionalität des Menschen beitragen (siehe Tab.1). Die weiteren Symptome stehen im Zusammenhang mit dem Stimmungswechsel. Depressionen und Manien werden je nach Verlauf und Dauer sowie nach psychotischen Symptomen eingestuft. Dabei spielt bei Depressionen der Schweregrad des Krankheitsverlaufes eine Rolle; bei Manien hingegen hypomane und manische Episoden. (Melchior u.a. 2014, 11ff). Nicht selten treten Rückfälle im Bereich der affektiven Störungen auf. Der Anfang der einzelnen Episoden ist oftmals durch belastende Ereignisse oder Situationen gekennzeichnet (www.Icd-Code.de, 03.06.2014). Schaut man sich die Prävalenz der spezifischen Diagnosen bei den affektiven Störungen an, ist zu erkennen, dass der größte Teil der Betroffenen mit 42% unter einer mittelgradigen Episode leidet; gefolgt von den schweren Depressionen mit 30% und den leichten Depressionen mit 28% der deutschen Bevölkerung (Melchior u.a. 2014, 12).
Allgemein ist die Punktprävalenz für affektive Störungen bei 2% - 7% (Wittchen 2013, 10). Für die vorliegende Arbeit sind vor allem die Diagnosen F32 – F34 von großer Bedeutung. Da depressive Krankheitsbilder auch in weiteren affektiven Störungen erscheinen, werden weitere Diagnosen genannt bzw. in der vorliegenden Arbeit auftreten. Als nächstes werden Klassifikationsgruppen erläutert; und die ersten drei Gruppen angeordnet nach epidemiologischer Bedeutung. Dabei wird allein im Punkt 3.2.4 auf die letzten Einteilungen der jeweiligen Klassifikationsgruppen, der sonstigen und nicht näher bezeichneten Störungen eingegangen, die ebenfalls bei den anderen Diagnosegruppen der affektiven Störungen als die letzten zwei Punkte im ICD 10 vorkommen. Da das Schema gleich bleibt, wird es nur einmal erwähnt.
3.2.1 Rezidivierende depressive Episode (Sabrina Mann)
Im ICD 10 findet sich in der Anamnese unter F33 die rezidivierende depressive Episode, die sich durch eine leichte depressive Episode – F33.0, mittelgradig depressive Episode – F33.1, schwere depressive Phase ohne psychotische Symptome – F33.2 und einer schweren Episode mit psychotischen Symptomen – F33.3 unterscheiden lässt. Weiterhin gibt es noch die Einteilung F33.4 – gegenwärtig remittiert. Sie bedeutet, dass die rezidivierende depressive Störung erfüllt war. Weitere Diagnosen sind sonstige rezidivierende depressive Störung – F33.8 und die nicht näher bezeichnete rezidivierende depressive Störung, deren Merkmale mit einer kürzeren Dauer oder weniger bzw. leichteren Symptomen einhergeht (Dilling u.a. 2004, 110). Allgemein ist die wiederkehrende depressive Erkrankung mit 40% die häufigste affektive Störung der unipolaren Depressionen in der Bundesrepublik. Das Wiedererkrankungsrisiko einer depressiven Episode steigt vor allem mit dem Alter (Melchior u.a. 2014, 12 ff).
3.2.2 Depressive Episode (Sabrina Mann)
Die depressive Episode ist kodiert unter F32 im ICD 10. Das DSM benennt diese Störung „Major Depression“. Sie ist mit 36% die zweithäufigste Störung der unipolaren Depressionen (Melchior u.a. 2014, 16). Unterteilt wird diese Episode in leichte – F32.0, mittelgradige - F32.1 und schwere - F32.2 Episode. Auch in dieser Einteilung bekommt die depressive Episode mit psychotischen Symptomen wie Halluzinationen oder Stupor eine extra Kodierung mit F32.3. Depressionen allgemein gehören zu den wiederkehrenden Krankheiten, 80% der Patienten/Patientinnen bekommen in den folgenden Jahren eine weitere depressive Episode.
Geschätzt wird, dass Betroffene innerhalb von 20 Jahren im Durchschnitt fünf bis sechs depressive Episoden erleiden müssen (Wittchen u.a. 2010, 9ff).
3.2.3 Anhaltende affektive Störungen (Sabrina Mann)
Unter den anhaltenden affektiven Störungen, die im ICD 10 unter F34 verschlüsselt sind, befindet sich die Dysthymie mit dem Code F34.1. Mit 24% nimmt sie die dritthäufigste Störung der unipolaren Beeinträchtigung ein. Das Merkmal einer Dysthymie ist ein leichterer Ausprägungsgrad. Dafür ist die Dauer der Störungen über Jahre hinweg zu beobachten. Zusätzlich tritt zu 20% eine depressive Episode mit auf. Meistens beginnt sie im Jugendalter und wiederholt sich bei 10 – 25% mit voll ausgeprägten depressiven Episoden; oftmals bleibt ein chronischer Verlauf (Volz 2008, 121). Die Lebenszeitprävalenz der dysthymen Störungen ist bei 6%, wobei die Punktprävalenz bei 3% liegt (Saß, 2003 ,410). Das DSM teilt die Wiederholungsdiagnose in die sogenannte „double depression“ ein (Wittchen u.a. 2010, 10). Unter den anhaltenden affektiven Störungen gehört auch die Zyklothymia – F34.0, die zu den bipolaren Störungsbildern zählt. Wie auch bei der Dysthymie findet die Episode über mindestens zwei Jahre statt (Dilling u.a. 2004, 110). Die Lebenszeitprävalenz einer Zyklothymia beträgt 0,4% - 1,0%. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% - 75% beginnt die Erkrankung zwischen dem 15. – 25. Lebensjahr (Volz 2008, 121).
3.2.4 Sonstige affektive Störungen (Sabrina Mann)
Im letzten Teil der F3 Diagnosen befinden sich die sonstigen affektiven Störungen – F38, die eine Restkategorie für Stimmungsstörungen beinhalten. Unterteilt wird die Gruppe in sonstige einzelne affektive Störungen – F38.0 und sonstige rezidivierende affektive Störungen F38.1 sowie sonstige affektive Störungen F38.8 (Dilling u.a. 2004, 111). Sonstige affektive Störungen werden diagnostiziert, wenn ein schneller Wechsel oder die Mischung von hypomanischen, manischen und depressiven Symptomen auftritt. Der Wechsel kann innerhalb weniger Stunden auftreten. Die Mindestdauer dieser Episoden beträgt zwei Wochen (Dilling 2009, 4).
3.2.5 Bipolare affektive Störungen (Sabrina Mann)
Entwickelt sich eine Depression innerhalb kürzester Tage, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass eine bipolare Störung vorliegt. Die bipolaren Störungen – F31 haben die spezifischste Einteilung im ICD 10. Die gegenwärtige hypomanische Episode hat den Schlüssel F31.0, gefolgt von den gegenwärtig manischen Episoden mit psychotischen Symptomen – F31.1 und ohne F31.2. Danach folgen die Kriterien für eine gegenwärtig leichte oder mittelgradige Episode – F31.3, gefolgt von den gegenwärtig schweren Episoden mit psychiotischen Symptomen – F31.4 und ohne F31.5. Die nächsten Klassifikationen sind die gegenwärtige gemischte Episode F31.6 und die gegenwärtige remittierte – F31.7 (Dilling 2004, 101 ff). Für die klinische Diagnostik ist es hilfreich, bipolare Störungen nochmals nach Bipolar I und II zu unterscheiden, auch wenn es im ICD 10 nicht explizit aufgegliedert ist. So treten bei der bipolaren Störung I neben den depressiven Episoden ausschließlich vollständig ausgeprägte manische Episoden auf. Bei der bipolaren Störung II treten ausschließlich hypomanische Episoden auf. Bei der bipolaren Störung I beträgt die Lebenszeitprävalenz 1%, bei der bipolaren Störung II: 0,5 % (Volz 2008, 120). Die Störungen gehen mit manischen und depressiven Phasen einher, bei denen allerdings die letztere Phase bei der bipolaren Störung II überwiegt. Insgesamt entwickeln sie sich zu 4% - 7% im weiteren Verlauf bei Depressionen (Wittchen u.a. 2010, 12).
3.2.6 Manische Episode (Sabrina Mann)
Zu 60% - 70% tritt eine manische Episode unmittelbar vor oder nach einer depressiven Episode oder auch Major Depression auf (Saß 2003, 415). Die manische Episode wird unterteilt in Hypomanie – F30.0, Manie ohne psychotische Symptome- F30.1 und mit psychotischen Symptomen – F30.2 (Dilling 2004, 99 ff).
3.2.7 Burn-out-Syndrom (Sabrina Mann)
Im ICD 10 findet man Burn-out nicht unter den affektiven Störungen. Das Burn-out-Syndrom bzw. Ausgebranntsein wird unter der Verschlüsselung ICD 10- Z73.0– GM - Probleme mit Bezug auf Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung - klassifiziert. Die Zusatzkodierungen des Kapitels Z werden zur Dokumentation von Faktoren gewählt, die einen Gesundheitszustand zusätzlich zu einer Diagnose beeinflussen.
Burn-out tritt im ICD 10 zwischen Mangel an Entspannung und Freizeit und unspezifischen, körperlichen und psychischen Belastungen bei den Zusatzkodierungen auf (BPtK 2012, 3). Es zählt laut der WHO nicht als anerkannte psychische Erkrankung sondern wird eher als ein Prozess der zunehmenden emotionalen und körperlichen Erschöpfung eingestuft. Dies wird von Experten wie z.B. der DGPPN oder auch vom Bündnis gegen Depressionen kritisiert. Burn-out ist ein Modebegriff der deutschsprachigen Länder, der in der Gesellschaft mehr Akzeptanz als Depression findet. Es fällt allgemein leichter, unter diesem Namen professionelle Hilfe zu suchen. Die Gefahr dabei ist eine Unterschätzung der Krankheit. Ein Großteil der Menschen, die durch Burn-out längere Zeit ausfallen, leidet an einer depressiven Erkrankung. Bei einem Burn-out-Syndrom liegen die gleichen Krankheitszeichen wie bei einer Depression vor. Oftmals bringt man das Ausgebranntsein mit beruflicher Anstrengung in Verbindung. Das würde bedeuten, dass vor allem in Hochleistungsbereichen Burn-out öfter vorkommen müsste. Das Gegenteil ist der Fall, vermehrt tritt es bei Rentnern/Rentnerinnen, Studenten/ Studentinnen und nicht Berufstätigen auf (www.deutsche-depressionshilfe.de, 12.06.2014). Laut einer Statistik der AOK sind die meisten betroffenen Berufsgruppen HelferInnen in der Krankenpflege mit 262 Personen auf 1000 Versicherte, SozialarbeiterInnen und SozialpflegerInnen mit 272 auf 1000 Versicherte und bei den Sozialpädagogen/Sozialpädagoginnen und HeimleiterInnen kommen noch einmal 20 Betroffene hinzu. Mit 292 auf 1000 Versicherte sind die Letztgemeinten die am meisten betroffene Berufsgruppe (de.statista.com, 25.06.2014). Gesundheitsexperten und Krankenkassen schätzen, dass rund 13 Millionen Arbeitnehmer von Burn-out betroffen sind (www.muenchner-institut.de, 2014). In einer Studie zur Arbeitsunfähigkeit von der Bundespsychotherapeuten-kammer wird Burn-out in 85 % der Krankschreibungsfälle mit psychischen oder anderen Erkrankungen ergänzend diagnostiziert (BPtK 2012).
3.3 Ursachen von Depressionen (Sabrina Mann)
Wie eine depressive Erkrankung entsteht, hängt von vielen Faktoren ab. Bisher gibt es allerdings keine einheitliche, empirische Theorie zur Entstehung von depressiven Erkrankungen. Aktuell geht man von einem multifaktoriellen Modell aus. Psychische, soziale, genetische Faktoren und auch biologische Vorgänge im Zentralnerven-system können beim Zusammenwirken ausschlaggebend für eine depressive Erkrankung sein (Servier Deutschland GmbH 2012, 8).
3.3.1 Psychosoziale Faktoren (Sabrina Mann)
Das Entstehen von Depression wird anhand von lerntheoretischen und kognitiven psychologischen Modellen erklärt. Beispiel hierfür kann die Verstärker-Verlust- Theorie sein, die einen Mangel an positiver Verstärkung beschreibt. Weiterhin kann ein Verlust eines Sozialpartners durch Tod, Trennung oder Scheidung Auslöser sein. Depressive Patienten/Patientinnen haben in ihrer Kindheit zwei bis dreimal häufiger Bezugspersonen verloren. Bei Kindern und Jugendlichen kann eine Vernach-lässigung ein Indiz für die depressive Erkrankung sein (www.bptk.de, 15.06.2014). Die Prävalenz für geschiedene, getrennte oder verwitwete Menschen ohne enge Bezugspersonen ist deutlich höher als bei Verheirateten. Ein Vorhandensein von einer vertrauensvollen und persönlichen Beziehung kann ein protektiver Faktor gegen eine Entwicklung von depressiven Erkrankungen sein (Melchior u.a. 2014, 20). Nach dem Begründer der kognitiven Verhaltenstherapie, von Beck, wird die kognitive Triade als Risikofaktor für eine Depression gesehen. Diese besagt, dass durch pessimistische Ansichten zu sich selbst, zur Umwelt und zur Zukunft eine negative Überzeugung in Verbindung mit der negativen Lebenserfahrung steht und dies in Depressionen münden kann. Auch anhaltender Stress, Armut, Benachteiligung in der Arbeitswelt, Arbeitslosigkeit oder Rollenüberlastung kann zu depressiven Erkrankungen führen (Wittchen u.a. 2010, 16). Personen mit einem niedrigen sozioökonomischen Status sind ebenso häufiger betroffen als jene mit einem mittleren oder hohen Status (Melchior u.a. 2014, 20).
3.3.2 Genetische Faktoren (Sabrina Mann)
Als sicher gilt, dass eine depressive Veranlagung mit bedingt Auslöser sein kann. Es ist sehr gut belegt, dass in Familien, in denen häufiger Depressionen auftreten, ein erhöhtes Risiko vorliegt, zu erkranken. Genetiker haben außerdem bei Zwillingen erhoben, dass eine Erblichkeit zwischen 40% - 71% bestehen kann. Das bedeutet, wenn ein Zwilling erkrankt, liegt die Wahrscheinlichkeit zwischen 40% - 71%, dass auch der andere Zwilling unter einer Depression leidet. Diese Wahrscheinlichkeit ist bei eineiigen Zwillingen mit 44% um 22% höher als bei zweieiigen. Eine andere Zwillingsstudie brachte das Ergebnis, dass Faktoren in der psychosozialen Entwicklung (siehe Kapitel 3.3.1) die genetische Disposition ergänzen können.
Je früher die Ersterkrankung innerhalb der Familie auftritt, desto größer ist die Belastung familiärer Genetik. Innerfamiliär geschieht es außerdem, dass sich das Ersterkrankungsalter verjüngt. Die Folge ist, dass verstärkt eine Familienübertragung als Risiko der Erkrankung existiert. Ein weiterer anscheinender Faktor für die genetische Veranlagung von Depressionen wird durch ein Serotonin Transportgen vermutet. Träger eines kurzen Allel Gens, haben nur ein Drittel der Transkriptionsrate wie Träger eines langen Allel Gens. Dadurch werden weniger 5-HTTLPER synthetisiert und somit stehen weniger Transporter zum Abbau des Serotonins zur Verfügung. Das führt dazu, dass das Serotonin langsamer abgebaut wird. Dabei wird zusätzlich diskutiert, dass Träger eines kurzen Allel Gens negative Gefühle nicht ausreichend dämpfen können. Es existieren noch weitere Gene, die wichtige Funktionen des Serotoninstoffwechsels übernehmen. Bei ihnen liegt ebenfalls die Vermutung vor, dass diese mit Depression in Verbindung zu bringen sind (Wittchen u.a. 2010, 15f).
3.3.3 Neurobiologische Faktoren (Sabrina Mann)
Hauptsächlich werden neurobiologische Zusammenhänge mit Depressionen durch veränderte Funktionsabläufe im Gehirn diskutiert. Wie schon im Punkt 3.3.2 erwähnt, kann eine Veränderung an Botenstoffen z.B. Serotonin, Noradrenalin oder Hormonen wie Kortisol Ursache einer depressiven Erkrankung sein (Wittchen u.a. 2010, 16). Eine Veränderung der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenachse ist schon seit längerer Zeit von großer Bedeutung. Hier wurde beobachtet, dass bei akut depressiven Patienten/Patientinnen mehr Kortisol im Vergleich zu gesunden Menschen ausgeschüttet wird. Patienten/Patientinnen mit einer remittierten Depression dagegen wiesen keinen Unterschied der Kortisolvorgänge auf. Weiterhin konnte durch MRT - Ergebnisse festgestellt werden, dass im Hirnbereich bei Depressiven Hyperfunktionen stattfinden, die Folge von Banlancestörungen verschiedener Hirnbereiche sein können, die sich mit Verarbeitungsprozessen von Emotionen auseinandersetzen (Kasper 2014, 66f). Frauen sind in Zeiten der Hormonschwankungen wie z.B. vor der Menstruation oder nach einer Schwangerschaft anfälliger, an Depressionen zu erkranken. Eine postpartale Depression – F53 – ist oftmals nur von kurzer Dauer. Trotzdem besteht die Gefahr, dass sich eine ernsthafte depressive Erkrankung daraus entwickelt (Wittchen u.a. 2010, 16).
Laut einer Studie des Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen e.V. begehen 15% - 20% psychisch kranker Frauen einen Filizid (Süddeutsche Zeitung, 2010).
3.4 Depression unter Einfluss der Komorbidität, des Alters und des Geschlechtes (Sabrina Mann)
Neben den genannten Ursachen gibt es weitere Bedingungen, die affektive Störungen verursachen. So nimmt auch das Alter und Geschlecht eine entscheidende Position für die Erklärung des Vorkommens von Depressionen ein. Darüber wird auch der Einfluss von gleichzeitig weiteren vorliegenden Erkrankungen mit Depressionen beschrieben. In der vorliegenden Arbeit wird immer wieder zwischen Alter, Geschlecht und Komorbidität unterschieden; vorwiegend im Kapitel vier, in dem noch einmal speziell auf die regionale Verteilung der Einflussfaktoren von affektiven Störungen in Deutschland und Thüringen Bezug genommen wird.
3.4.1 Depression und Alter (Sabrina Mann)
Empirische Studien weisen darauf hin, dass die Epidemiologie von Depressionen häufiger bei Jüngeren und Menschen des frühen Erwachsenalters auftreten als bei Älteren. Schaut man sich hierbei den Altersverlauf der Subgruppen der spezifizierten Depressionsdiagnosen an, erkennt man, dass im fortgeschrittenen Alter die administrative Prävalenz höher ausfällt (Melchior u.a. 2014, 105). Bei einer Studie der Bertelsmann Stiftung hatten von sechs Millionen Menschen 13,4% eine Depression, bei der Folgendes festgestellt wurde: nach einem Alter von 55 – 60 Jahren steigt die Prävalenz zunächst zehn Jahre nicht mehr an und erreicht einen Maximalwert. Bis zum 70. Lebensjahr sinkt diese moderat. Ab dem 70. Lebensjahr steigt die Prävalenz erneut an und erreicht erneut einen Maximalwert (Melchior u.a. 2014, 47f). Ein ähnlicher Verlauf zeigt sich auch bei den spezifischen Diagnosen, bei denen der Maximalwert bei der Altersklasse 55 – 60 Jahre nach weiteren 10 Jahren um ein Drittel sinkt und ab dem 70. Lebensjahr stabil bleibt. Depressionen können in jedem Alter erstmalig auftreten. Sie haben immer den gleichen Verlauf und sollten dieselbe Therapieform bekommen (Stoppe 2010, 440). Nationale sowie auch internationale Studien deuten darauf hin, dass eine Zunahme des Erkrankungsrisikos innerhalb der vergangenen Jahrzehnte vorhanden ist. Insbesondere bei Jüngeren (Kohorteneffekt). Das bedeutet, dass Depressionen heute in einem jüngeren Alter als früher zu beobachten sind (Melchior u.a. 2014, 14).
Das belegt auch ein Interview in „Die Zeit“ mit einem Jugendpsychiater, der aussagt, dass er seit fünf Jahren eine neue Diagnose bei Jugendlichen diagnostiziere: Burn-out! Die Bella Studie des RKI ergab, dass mehr als fünf Prozent Jungen und Mädchen an Depressionen leiden. Mehr als zehn Prozent leiden an Ängsten. Bei 20% – 30 % dieser Betroffenen geht man von einer Erschöpfungsdepression aus. Hintergrund scheint der Leistungsdruck zu sein. Der Jugendpsychiater führte aus, dass die meisten Kinder/Jugendliche eine 50-60 Stundenwoche allein für die Schule haben (Ottenschläger 2014, 78). Als Ergebnis zahlreicher Studien mit Kindern und Jugendlichen (z.B. Lavigne, Lebailly, Hopkins, Gouze Binns,- 2009) konnte festgestellt werden, dass mit steigendem Alter die Wahrscheinlichkeit des Auftretens depressiver Störungen zunimmt. Obwohl sich schon im Vorschul- und Grundschulalter depressive Störungen beobachten lassen, treten diese vergleichsweise selten auf und sind weniger in ein umfassendes und systematisches depressives Störungsbild eingebettet. Bei Kindern und Jugendlichen in der frühen bis mittleren Jugendzeit (zwölf – 15 Jahren) ist jedoch eine steigende Wahrscheinlichkeit des Auftretens depressiver Störungen vorhanden. Der Beginn von Depressionen bei Kindern und Jugendlichen liegt oftmals zwischen dem frühen und mittleren Jugendalter. Ab dem zwölften Lebensjahr ist es eher noch seltener. Aber ab dem 13. Lebensjahr beginnt ein steiler und stabiler Anstieg bei der Häufigkeit von Depressionen. Nach der Bremer Jugendstudie tritt eine Depression meistens später bei Jugendlichen auf; im Durchschnitt im 13. Lebensjahr. Es existieren noch weitere Ergebnisse, die verschiedene Altersklassen aufweisen; ein Alter von elf bis 17 Jahren. Ein einheitliches Ergebnis mehrerer Studien ist es, dass bei Kindern und Jugendlichen mit steigendem Alter auch die Depressionswahrscheinlichkeit zunimmt. Nach einer Studie in Neuseeland (Dunedin Multidisciplinary Health and Developmental Study) zeigten sich für eine zwölf-Monats-Prävalenz von depressiven Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit dem Alter deutlich steigende Raten. Im Alter von elf, 15, 18 und 21 Jahren war die Prävalenz bei 1,8; 4,2; 18,0 und 18,6 (Groen, Petermann 2011, 36ff). Bei Kindern dagegen ist das Erkrankungsrisiko eher niedrig. Es liegt bei ca. zwei bis drei Prozent. Trotzdem ist es wichtig, die Diagnose auch bei Kindern und Jugendlichen genau zu stellen, denn bei Kindern und auch bei Jugendlichen ist der Suizidgedanke öfter vorhanden. Der Gedanke an Suizid sinkt eher mit dem Alter; statistisch betrachtet (Wittchen u.a. 2010, 19ff). In der zweiten – dritten Lebensdekade ist das Ersterkrankungsrisiko am höchsten.
Der chronische Verlauf stellt sich in der Regel ab der dritten Lebensdekade ein (Wittchen u.a. 2010, 20f). Angststörungen werden im jungen Erwachsenenalter am häufigsten diagnostiziert. Depressionen gehen damit, wie im Punkt 3.4.3 beschrieben, häufig einher. Die Wahrscheinlichkeit, an einer Angststörung zu erkranken, sinkt bis zum 60. Lebensjahr. Danach ist die Wahrscheinlichkeit kontinuierlich seltener unter Ängsten zu leiden (Melchior u.a. 2014, 48ff). Im Alter haben die Menschen immer mehr Konfrontationen. Nachlassende Attraktivität und Leistungsfähigkeit, scheinbar bedrohte Autonomie und Todesnähe beschäftigen alte Menschen. Das scheint oftmals eine Herausforderung zu sein. Diese Entwicklungs-aufgaben können eine vorübergehende Verstimmung oder auch Ängste auslösen. Der Verlauf von chronischen Depressionen tritt bei Menschen ab 60 Jahre häufiger auf. Das liegt unter anderem auch daran, dass oftmals Depressionen bei Älteren nicht erkannt und somit auch nicht therapiert werden. Dies ist sicher auch die Ursache, dass im Alter die Zahl der Suizide steigt. Weltweit gesehen ist bei 75 - Jährigen die Suizidrate am höchsten (Stoppe 2010, 440f). Im Kapitel 4.1 bis 4.6 wird noch einmal auf die nationale spezifischen Verteilungen eingegangen.
3.4.2 Depression und Geschlecht (Sabrina Mann)
In der Fachliteratur findet man Berichte, Studien oder Ergebnisse, dass Frauen häufiger von affektiven Störungen betroffen sind als Männer. Ein Chefarzt aus Südthüringen für Psychiatrie/Psychotherapie/Psychosomatische Medizin bestätigt, dass Frauen sehr viel häufiger von Depressionen betroffen sind. 2/3 aller Fälle sind Frauen, 1/3 sind Männer (Interview 1, Zeile: 112 - 115). Eine Chefärztin (Diplom Medizinerin für Psychiatrie/Psychotherapie und Suchterkrankungen aus Ost-thüringen) stellt fest, dass bipolare Störungen 1:1 auftreten und monopolare Störungen mehr Frauen als Männer betreffen; in einem Verhältnis von 2:1 (Interview 3, Zeile: 45 - 48). Ein Psychologe aus der Landeshauptstadt Thüringens stellte fest, dass 30% bis 40% seiner Depressionspatienten Männer sind (Interview 2, Zeile 53 - 58). Auch hier zeigt sich, dass Frauen häufiger in der Psychotherapie wegen Depressionen erscheinen. Dass Bipolare Störungen ziemlich gleich verteilt sind und Unipolare Störungen häufiger Frauen betreffen, bestätigt die Wissenschaft (Nuber 2012, 38). Allerdings ist die Zahl der stationären Behandlungen von Männern mit Depressionen von 2000 bis 2010 um 250% angestiegen (Reinhard u.a. 2014, 78).
Das würde bedeuten, dass entweder die Depressionen bei Männern häufiger diagnostiziert werden oder Männer häufiger betroffen sind als früher. Diese Unterschiede in der Häufigkeit der Depressionen zwischen Mann und Frau mit Bezug auf psychische Störungen beruhen auf vielen verschiedenen komplexen Theorien. Dabei sind vor allem die biologischen Ursachen sowie Artefakttheorien relevant. Bei Frauen sind biologische Ursachen wie die Hormonumstellungen, die sich auf die psychische Gesundheit auswirken können, Gründe für Depressionen. Es gibt das prämenstruelle Syndrom, die postpartale Depression oder die Depression der Menopause. Das sind aber häufiger nur kurze depressive Episoden, die nur wachsen, wenn andere Faktoren hinzu kommen (Nuber 2012, 50). Unter Artefakttheorien zählen z.B. die Rollenzuschreibungen, die zu einer Verzerrung von Depressionsdiagnosen führen können. Das geschieht durch sozialisierte vermittelte Geschlechterbilder, die zu verschiedenen Wahrnehmungen und Äußerungen vom jeweiligen Geschlecht führen und dadurch Diagnosen gestellt werden, die nicht unbedingt konkret stimmen. So können z.B. körperliche Beschwerden bei Frauen häufiger auf somatische Erkrankungen zurückgeführt werden als bei Männern. Daher diskutiert man auch, ob Symptomatik geschlechterdifferenziert auftritt. Eine Studie von stationär behandelten depressiven Betroffenen zeigte bei Männern häufiger Symptome von Irritabilität, Aggressionen oder antisozialem Verhalten. Frauen hingegen zeigten Unruhe, depressive Verstimmungen und Klagsamkeit. Auch das Hilfesuchverhalten bei Erkrankungen unterscheidet sich gegenüber der Frau, die häufiger Rat sucht als der Mann (Müters 2013, 1f). Männer neigen eher dazu, die Symptomatik zu bagatellisieren, zu verleugnen oder nicht wahrzunehmen. Das liegt an der Rollenerwartung/Rollenverpflichtung des Mannes und an dem gesellschaftlich vermittelten, subjektiven Gesundheitskonzept (Woltersdorf u.a. 2006, 7). Frauen hingegen reden eher über Ängste und Stimmungsschwankungen. Das bedeutet, dass sie auch eher Hilfe suchen (Nuber 2012, 40). Weitere Unterschiede bestehen in der sozioökonomischen und psychosozialen Lage zwischen den Geschlechtern Mann und Frau. Darunter zählen die soziale Lebensbedingung, die soziale Statusposition, Familie und Partnerschaft, soziale Netzwerke sowie Einflussfaktoren im Zusammenhang mit dem Erwerbsleben. Depressionserkrankungen finden sich häufiger in unteren sozialen Statusgruppen wieder. Das Familienleben mit den dazugehörigen Aufgaben wie Kindererziehung oder Haushalt pflegen, sind noch immer ungleich verteilt. Frauen sind mehr eingespannt als Männer.
Dazu kommt, dass die Erwerbsbeteiligung der Frauen mit Kindern immer noch weniger angesehen ist, als die Erwerbsbeteiligung der Männer mit Kindern. Eine höhere Anerkennung in der Gesellschaft erfährt man eher bei Erwerbstätigkeit als für das Erledigen von Familienaufgaben. Es gibt Hinweise, dass Arbeitslosigkeit zu Depressionen führen kann. Davon sind häufiger Männer als Frauen betroffen. Das Auftreten einer Depression bei Frauen ist auch davon abhängig, ob es bei ihnen eine soziale Unterstützung gibt. Diese ist dreifach höher als jene bei Männern. Bei Männern wiederum spielt der soziale Status eine entscheidendere Rolle. Männer im Erwerbsalter verbinden die Diagnose Depression eher mit niedrigem sozialen Status und Erwerbsstatus wie z. B. Arbeitslosigkeit als Frauen im Erwerbsalter. Bei beiden Geschlechtern ist das Risiko der psychischen Belastung gleich erhöht, wenn es um Alleinerziehende von Kindern geht oder aber um Ein-Personen-Haushalte. Generell sind Alleinerziehende häufiger von psychischen Störungen Betroffen, als in Partnerschaft lebende Menschen. Bei kleineren Kindern kann man bezüglich des Geschlechts keine bedeutsamen Unterschiede hinsichtlich des Auftretens von Depressionen feststellen. Bei Jugendlichen hingegen ist die Depressionsrate bei Mädchen zwei- bis dreimal höher. Auch der Schwierigkeitsgrad scheint anders geartet, denn Mädchen erleben häufiger schwerere depressive Episoden. Hingegen weist ein Drittel der Jungen eher mittelschwere Depressionen auf und keine schweren. Bei Mädchen sind es drei Viertel der mittelschweren und schweren depressiven Episoden (Essau 2007, 55f). Die Pubertät scheint beim weiblichen Geschlecht ein entscheidender Wendepunkt für die Gesundheit zu sein. Allgemein betrachtet sind Frauen oftmals belasteter mit der Kindererziehung, mit der Pflege der Eltern, der Haushaltsführung, der Pflege von Freundschaften, der Fürsorge in der eigenen Liebesbeziehung, der Erwerbstätigkeit und den intensiven Bemühungen, dem Schönheitsideal gerecht zu werden. Das beschreibt die Psychologin Ursula Nuber in ihrem Buch, das erklärt warum Frauen depressiv werden. All diese Aufgaben täglich zu meistern ist eine enorme Herausforderung, die schnell zur Überbelastung führen kann. Ungefähr 50% - 70% der Frauen, die an Depressionen erkranken, haben im Vorfeld der Erkrankung Beziehungsprobleme (Nuber 2012, 105ff). Obwohl Frauen häufiger betroffen sind, dürfen depressive Männer nicht vernachlässigt werden. Es existiert kaum Literatur über Depressionen bei Männern (Woltersdorf 2006, 6).
Ein Titel einer Professorin für Gender Research und Früherkennung in Basel, nannte in ihrem Bericht sehr passend: „Frauen sind depressiv und Männer bringen sich um“. Weitere spezifische Zahlen zu Depression und Geschlecht können im Kapitel 4.2 nachgelesen werden.
3.4.3 Komorbidität (Sabrina Mann)
Dass eine Komorbidität bei einer Depression besteht, ist ein sehr häufiges Phänomen. Innerhalb des psychischen Spektrums beschreibt die Komorbidität in Zusammenhang mit einer Depression eher die Regel als die Ausnahme. Aber auch somatische Erkrankungen gehen mit Depressionen einher. Die somatoformen Störungen, Angststörungen und Belastungsstörungen sind die häufigsten komorbiden Erkrankungen in Bezug auf depressive Erkrankungen. Vor allem werden diese in den neuen Bundesländern diagnostiziert; im Vergleich zu den alten Bundesländern. Dabei ist die Angststörung eher die Primärerkrankung und darauf folgt eine Depression. 70% von 774.554 Versicherten, die eine Depressionsdiagnose erhalten, weisen eine Komorbidität auf. 31% dieser Versichertenzahl weisen eine somatoforme Komorbidität auf. Mit steigendem Alter nehmen die Begleiterkrankungen bei Depressionen mit psychischen Störungen zu. Vor allem im Alter zwischen 55 bis 60 Jahren der Frauen und Männer ist die Komorbidität somatoformer Störungen am höchsten. Depressionen mit somatischer Erkrankung gehen häufiger mit Mortalität, Morbidität und höheren Versorgungskosten einher (Melchior u.a. 2014, 12 ff). 60% mit einer depressiven Episode und 80% mit einer Dysthymie haben mindestens eine weitere psychische Störung. Schmerzstörungen und Suchterkrankungen zeigen weitere bedeutsame Muster. Eine Alkoholabhängigkeit kann durch depressive Erkrankungen mit ausgelöst werden. Häufiger ist allerdings zuerst die Abhängigkeitserkrankung und als Folge eine Depression. Dass allerdings ein erhöhtes Zusammentreffen von depressiven Syndromen mit Alkoholismus auftritt, wurde bereits in mehreren Studien belegt. Primär depressive Symptome bei Alkoholkranken treten mit 2-12% auf. Dass die depressiven Syndrome sekundär auftreten, ist viel häufiger mit 12% – 51% der Fall. Eine Studie mit 82 Patienten/Patientinnen, die an einer Alkoholabhängigkeit erkrankten, zeigte, dass 62% vor einem Entzug Kriterien einer Major Depression erfüllten. Nach dem Entzug sanken diese Kriterien drastisch und nur noch 13% wiesen eine Major Depression auf (Soyka, Lieb 2004, 38ff).
Es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass Depressionen den Belastungscharakter körperlicher Erkrankungen verstärken können. So können Schmerzen durch Depressionen stärker auftreten, als wenn allein die körperliche Erkrankung vorhanden wäre. Weitere körperliche Erkrankungen wie Schilddrüsenfunktions-störungen, Herzinfarkt, Schlaganfall, Schädel-Hirn-Trauma, Pankreaskarzinom, AIDS, Hirntumor, Morbus Parkinson, Demenz, Diabetes Mellitus oder auch eine Niereninsuffizienz können mit Depressionen einhergehen. Das Erkennen von Depressionen bei den genannten Erkrankungen ist von wesentlicher Bedeutung für die Versorgung und Lebenszeitqualität (Wittchen 2010, 18ff). Weitere Daten und Informationen zu Komorbidität und Depression sind im Kapitel 4.4 beschrieben.
3.5 Interventionsmöglichkeiten (Sabrina Mann)
Der erste Schritt für die Behandlung ist die genaue Einteilung der Diagnose. Das ist von hoher Wichtigkeit für die weiteren Abläufe des Behandlungsprozesses. Eine ausführliche Aufklärung über das Krankheitsbild ist ebenfalls von großer Bedeutung. Eine erfolgreiche Behandlung zeichnet sich nicht nur durch die Beseitigung der Symptome, sondern auch durch die Ursachenbekämpfung aus (Dalton, Holton 2003, 157). Depressive Erkrankungen sind allgemein gut behandelbar, wenn man sie frühzeitig erkennt und die richtige Therapie erfolgt. Das gilt vor allem für die akuten Episoden und die Vorbeugung vor dem Rückfall einer Depression. Nur die Hälfte der Betroffenen mit affektiven Störungen wird diagnostiziert und nur ein Viertel davon wird gezielt behandelt (www.psychosoziale-gesundheit.net, 18.06.2014). Aus verschiedenen Gründen findet eine unspezifische Diagnostizierung bei den Hausärzten/Hausärztinnen statt, die zur Folge einer Chronifizierung haben kann (Melchior u.a. 2014, 26). Als Erstes suchen die meisten Betroffenen ihren Hausarzt auf. Hier zeigt sich das Problem, dass Betroffene meistens nur von somatischen Belastungen sprechen und psychische Probleme eher außer Acht lassen. Weiterhin intervenieren folgende Professionen bei depressiv erkrankten Menschen. In erster Linie sind psychologische und ärztliche Psychotherapeuten/Psychotherapeutinnen zu erwähnen. Sie sind wichtig für Erwachsene sowie für Kinder und Jugendliche, die betroffen sind.
Weiterhin intervenieren:
Hausärzte/Hausärztinnen für Psychosomatische Versorgung,
Fachärzte/Fachärztinnen für Psychosomatik und Psychotherapie,
Fachärzte/Fachärztinnen für Psychiatrie sowie für Neurologie,
Fachärzte/Fachärztinnen für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie,
Fachärzte/Fachärztinnen für Nervenheilkunde,
Kinder- und JugendpsychiaterInnen.
Außerdem gehören auch die psychosozialen Beratungsstellen, der sozial-psychiatrische Dienst, psychiatrische Institutsambulanzen, Krankenhäuser mit Fachabteilungen für Psychiatrie und Psychosomatik und Rehabilitationseinrichtungen dazu. Insgesamt umfasst dieser Versorgungssektor deutschlandweit 1.401 Einrichtungen im Jahre 2008. Unterschieden wird zwischen stationärer, teilstationärer und ambulanter Hilfe. Die Psychotherapeutenkammer schätzt, dass jedes Jahr 400.000 Patienten/Patientinnen stationär psychotherapeutisch in Deutschland behandelt werden. Häufiger werden depressive Erkrankungen ambulant behandelt; häufiger durch den Hausarzt/ die Hausärztin als durch eine/n fachspezifische/n Arzt/ Ärztin. Welches Therapiekonzept ausgewählt, wird hängt davon ab, welche depressive Störung auftritt und in welchem Maße diese auftritt. Zur Verfügung stehen medikamentöse, psychotherapeutische und unterstützende Maßnahmen. Als unterstützende Maßnahmen zählen z.B. die Lichttherapie, Schlafentzugstherapie, Elektrokonvulsionstherapie und körperliche Aktivitäten (Wittchen u.a. 2010, 26ff). Bei depressiven Störungen kommt häufig eine medikamentöse Behandlung mit Antidepressiva und gegebenenfalls die Kombination mit einer Psychotherapie in Frage. Beispiel hierfür ist die rezidivierende Störung. Bei ihr beruht die Behandlung vor allem auf medikamentöser Grundlage. Sie ist allerdings am erfolgreichsten, wenn man den Gesamtbehandlungsplan anwendet. Das heißt, eine Psychotherapie bzw. Soziotherapie und stärkende Maßnahmen sollten bei der Behandlung hinzu kommen. Bei einer Dysthymia ist die Pharmakotherapie die entscheidende Behandlungsform. Aber auch eine Psychotherapie ist unverzichtbar, denn sie verbessert den Antrieb und stärkt den körperlichen Zustand (www.psychosoziale-gesundheit.net, 18.06.2014).
Im Folgenden ist eine Tabelle dargestellt, die aufzeigt, wie eine Behandlung nach Schweregrad sowie bei einer Chronfizierung optimal aussehen sollte und wie die Indikatoren in Deutschland laut Bertelsmann Stiftung dafür sind.
Tabelle 2 Leitlinienorientierte Behandlung bei depressiven Erkrankungen
(Melchior u.a. 2014, 31)
Zu dieser Tabelle wird im Kapitel 6, Versorgungsstruktur von depressiv erkrankten Menschen in Deutschland - speziell im Freistaat Thüringen, im Punkt 6.1.4 noch einmal genauer zu den regionalen Unterschieden und Hinweisen Bezug genommen.
4 Prävalenz von depressiven Erkrankungen in der bundesdeutschen Bevölkerung (Sebastian Selzer)
Im Kapitel 4 wird der Zusammenhang zwischen Depression und Lebensalter, Geschlecht, sozioökonomischen Status, beruflicher Tätigkeit und Komorbidität beschrieben. Hierbei wird auf die einzelnen Lebensabschnitte der Betroffenen eingegangen. Einige Berufsfelder werden vorgestellt, bei denen möglicherweise ein Zusammenhang zwischen Depression und beruflicher Tätigkeit besteht. Zusätzlich wird dargestellt wie viele Erwerbstätige aufgrund einer depressiven Erkrankung frühberentet werden. Am Ende des Kapitels wird auf die Suizidalität in den einzelnen Bundesländern eingegangen.
4.1 Depression im Zusammenhang mit dem Lebensalter (Sebastian Selzer)
In Deutschland ist das Erkrankungsrisiko für Depressionen bei Kindern und Jugendlichen bis zum 14. Lebensjahr mit 2% bis 3% sehr niedrig. Bei Jugendlichen ab einem Alter von 15 bis 17 Jahren steigt die Querschnittsprävalenz an und erreicht das Niveau von jungen Erwachsenen (9,5%). Ab diesem Zeitpunkt erhöht sie sich moderat bis zum 49. Lebensjahr (12,4%). In der Lebensspanne von 50 bis 65 Jahren geht die 12 – Monatsprävalenz leicht zurück und beläuft sich auf 11,6% (Wittchen u.a. 2010, 19). Statistisch gesehen ist die Prävalenz von Depressionen bei den über 65 Jährigen mit 6,3% am niedrigsten. Jedoch geht man davon, aus das die Dunkelziffer in dieser Altersspanne sehr viel höher ist (DAK-Gesundheit 2013, 41).
4.1.1 Depressive Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen (Sebastian Selzer)
Kinder und Jugendliche, die an einer Depression erkrankt sind, weisen sowohl ähnliche als auch andere Symptome wie Erwachsene auf. Gleiche Symptome sind zum Beispiel Müdigkeit, Konzentrationsprobleme und Suizidgedanken. Unterschiede bestehen in einem aggressiven Verhalten, Gereiztheit, Schuldgefühle und einem höheren Anteil an Parasuiziden. Auf Grund dieser Verhaltensweisen ist es schwierig eine Depression bei Kindern und Jugendlichen zu diagnostizieren, denn die oben genannten Verhaltensauffälligkeiten treffen auch auf andere psychische Störungen (Angststörung, Hyperaktivität, Lernprobleme, Borderline-Störung, Essstörung, Verhaltensauffälligkeiten durch starken Alkoholkonsum) zu (Wittchen u.a. 2010, 22).
Die Prävalenz für depressive Episoden bei Kindern beträgt weltweit 3%. Bei Jugendlichen variieren die Zahlen sehr stark. Das Robert Koch Institut und das Statistische Bundesamt gaben, in der gemeinsam verfassten „Gesundheitsbericht-erstattung des Bundes“ Werte an, die zwischen 0,4% und 25% liegen. Die hohe Variation des Prävalenzanteils bei Jugendlichen liegt darin begründet, dass sich einige Symptome einer Depression mit Symptomen anderer Krankheitsbilder überschneiden. Erst mit dem Älterwerden ist eine genauere Diagnose möglich (Wittchen u.a. 2010, 22). In Deutschland ergab sich, dass 5% der Kinder und Jugendlichen Hinweise auf eine depressive Störung haben. Geschlechtsbezogene Unterschiede gibt es bis zum Eintreten der Pubertät kaum.
In der Studie „Early Development Stage of Psychopathologie Study“, die vom Max – Planck – Institut für Psychiatrie in Deutschland durchgeführt wurden ist, kam heraus, dass die 12–Monatsquerschnittsprävalenz für 14 bis 17 jährige Jugendliche bei 6% liegt. Weiterhin wurde festgestellt, dass bei Jugendlichen, bei denen eine depressive Episode festgestellt worden ist, ein erhöhtes Risiko besteht innerhalb der nächsten fünf Jahre an einer manischen oder hypomanischen Episode bzw. einer bipolaren Störung zu erkranken (Wittchen u.a. 2010, 22). Für Kinder und Jugendliche, die an einer Depression erkrankt sind, ist das Risiko eines Rückfalls sehr hoch. Ebenfalls ist die Wahrscheinlichkeit größer an weiteren psychischen Krankheiten zu erkranken (Wittchen u.a. 2010, 23).
4.1.2 Depressive Erkrankungen im erwerbsfähigen Alter (Sebastian Selzer)
Innerhalb eines Jahres leiden 12% der erwachsenen deutschen Bevölkerung (von 18 bis 65 Jahren) an einer affektiven Störung. Das sind in etwa fast sechs Millionen Menschen. Die Lebenszeitprävalenz liegt jedoch höher. Der Anteil der Menschen, die im Laufe ihres Lebens an einer Depression erkranken, beträgt 19%. Mit 25% ist die Lebenszeitprävalenz von Frauen doppelt so hoch als die der Männer mit 12%. Der Anteil derer, die in den letzten 12 Monaten (12 – Monatsquerschnittsprävalenz) an einer Depression erkrankt sind, beträgt 11%. Das bedeutet, dass in Deutschland rund fünf bis sechs Millionen Menschen im Alter von 18 bis 65 Jahren in den letzten zwölf Monaten an einer Depression erkrankt sind. Auch hier sind die Frauen mit 14% häufiger betroffen als Männer mit 8% (Wittchen u.a. 2010, 19).
Die Zeit zwischen der Adoleszenz und dem 30. Lebensjahr weist die höchste Dichte an Neuerkrankungsfällen auf. Die Inzidenz- und Prävalenzraten depressiver Störungen bei Kindern und Jugendlichen bis zum 16. Lebensjahr liegen deutlich niedriger als in allen anderen Altersstufen. Das mittlere Ersterkrankungsalter liegt zwischen dem 25. Und dem 30. Lebensjahr. Bei den bipolaren Störungen ist das Ersterkrankungsalter niedriger; zwischen dem 15. und 25. Lebensjahr. Für jüngere Alterskohorten ist das Risiko größer geworden, an einer Depression zu erkranken, als bei den älteren Alterskohorten. Ursachen hierfür könnten in einer veränderten Familienstruktur und darin liegen, dass die Jugendlichen eine andere Stressbewältigung entwickelt haben (Wittchen u.a. 2010, 21). Depressionen nehmen zum überwiegenden Teil einen rezidivierenden Verlauf an. Es ist davon auszugehen, dass bei 60% bis 75% der Erkrankten nach ihrer ersten depressiven Episode mindestens eine weitere Episode folgt. Im Durchschnitt werden bei rezidivierenden Depressionen sechs weitere Episoden erlebt. Die 12-Monatsprävalenz bei rezidivierenden Depressionen beträgt 6%. Die Episodendauer ist bei jedem Betroffenen sehr unterschiedlich. Bei der Hälfte der Betroffenen dauert die Erkrankung nicht länger als sechs Wochen an. Drei bis sechs Wochen dauert die Erkrankung bei 25% der Betroffenen an und bei 22% beträgt die Dauer länger als ein Jahr (Wittchen u.a. 2010, 20). Die 12 – Monatsprävalenz beträgt bei den chronischen Depressionen 2%. Je nach Person ist auch bei dieser Form der Erkrankung der Schweregrad sehr unterschiedlich. Zum überwiegenden Teil wird bei den betroffenen Personen eine mittelschwere bis schwere chronische Depression diagnostiziert. Das mittlere Ersterkrankungsalter liegt hier bei 31 Jahren (Wittchen u.a. 2010, 20).
4.1.3 Depressive Erkrankungen ab dem regulären Renteneintrittsalter (Sebastian Selzer)
Epidemiologische Studien zeigen, dass Depressionen im Alter seltener auftreten als bei jüngeren Menschen (Wittchen u.a. 2010, 23). Jedoch gehen Experten davon aus, dass die Depressionen im höheren Alter eine der häufigsten psychischen Krankheiten ist. Einige Krankenkassen berichten darüber, dass die Anzahl der diagnostizierten depressiven Störungen im Alter weiter zugenommen hat. Nach Schätzungen von Experten sind 8% bis 10% der älteren Menschen von einer Depression betroffen (Wittchen u.a. 2010, 23).
Der Grund, warum einige epidemiologische Studien die Altersdepressionen mit einer niedrigen Prävalenz beurteilen, ist darin zu sehen, dass die depressiven Symptome nicht immer erkannt bzw. erfasst werden und dass im fortgeschrittenen Alter untypische Symptome diesbezüglich auftreten. Gerade in den Alten- und Pflegeheimen ist die Dunkelziffer höher anzusetzen als sie bisher bekannt ist (Wittchen u.a. 2010, 23). In vielen psychiatrischen Kliniken und Fachabteilungen nimmt die Zahl der aufgenommenen älteren Patienten, bei denen eine behandlungs-bedürftige Depression festgestellt worden ist, zu. Die Wahrscheinlichkeit, von einer depressiven Erkrankung betroffen zu sein, steigt mit zunehmendem Alter (Interview 1, Zeile 248–253). Nach Schätzungen des Robert-Koch-Institutes sind ca. 50% der älteren Heimbewohner von einer depressiven Störung betroffen. Weiterhin geht man davon aus, dass die Prävalenz von schweren Depressionen zwischen 15% und 20% liegt. Oft werden diese Fälle nicht erkannt und nicht behandelt, denn von Seiten des Pflegepersonals und der Angehörigen werden die Symptome nicht als behandlungsbedürftig eingeschätzt bzw. werden depressive Symptome als alterstypisches Verhalten eingestuft (Wittchen u.a. 2010, 23). 2008 zeigt sich, dass die Behandlungsprävalenz aufgrund einer depressiven Episode mit 65 Jahren bei 8,9% und mit 89 Jahren bei 13% liegt und erst ab dem 90. Lebensalter mit 12,6% wieder gesunken ist. Ähnlich verhielt es sich mit der Behandlungsprävalenz bei der rezidivierenden depressiven Störung. Diese stieg von 2,6% (65. Lebensjahr) auf 3,2% (89. Lebensjahr) an und fiel danach wieder ab. Die Anzahl der erkannten depressiven Störungen bzw. die Behandlungsprävalenz nimmt bei den Rentnern also erst in der letzten Lebensdekade ab (Gerste 2012, 74).
4.2 Depression und Geschlecht (Sebastian Selzer)
Frauen sind von psychischen Krankheiten häufiger und länger betroffen als Männer (DAK-Gesundheit 2013, 100). Das bezieht sich vor allem auf die rezidivierende depressive Störung, die depressive Episode und die chronische Depression. Der Geschlechtsunterschied fällt bei den jüngeren Altersgruppen deutlich geringerer aus als bei höheren Altersgruppen. Bei den 40 bis 65 jährigen Frauen ist die 12 - Monatsprävalenz der depressiven Erkrankungen mit 15,6% bis 16,6% am höchsten. In dieser Altersspanne ist der Unterschied im Vergleich zu den Männern am größten, denn hier liegt die Prävalenz zwischen 7,4% und 8,3%.
Nach Angaben des Robert – Koch – Institutes sind Frauen mit insgesamt 14% im Durchschnitt doppelt so häufig betroffen als Männer mit 8%. Das bezieht sich auf alle affektiven Störungen (Melchior u.a. 2014, 19). Bei der stationären Behandlung von bipolaren Störungen ist das Verhältnis zwischen den beiden Geschlechtern in etwa gleich; bei den monopolaren Störungen ist es zwischen Frauen und Männern zwei zu eins. (Interview 3, Zeile 45-49). Die gleiche Verhältnismäßigkeit ist auch in der ambulanten Therapie wiederzufinden (Interview 2, Zeile 57-58). Auch bei der Verschreibung von Antidepressiva bekommen Frauen im Vergleich zu den Männern ungefähr doppelt so viele Medikamente verordnet (Wittchen u.a. 2010, 30). Die 12 – Monatsprävalenz von Depressionen bei Frauen ist im Saarland am weitesten über dem Bundesdurchschnitt. Bei den Männern ist diese Prävalenz in Sachsen – Anhalt und Thüringen am niedrigsten (Robert-Koch-Institut 2011, 76).
In der deutschen Bevölkerung wurde 2008 bei 5,6% aller deutschen Frauen und Männer die Diagnose F32 gestellt. Das sind 0,4% mehr als im Vorjahr. Diese Diagnose wurde im stationären und im ambulanten Bereich gestellt. Damit stand die depressive Episode deutschlandweit auf der 29. Rangposition von 100 der häufigsten Erkrankungen. Die Diagnose F32 war mit einer Prävalenz von 7,8% bei Frauen häufiger vertreten als bei den Männern mit 3,3% (Gerste u.a. 2012, 326). Von allen weiblichen Personen mit der Diagnose „depressive Episode“ waren im Jahr 2008 27,9% in stationärer Behandlung, unabhängig von der Art des Einweisungsgrundes. Die depressive Episode selbst stellte jedoch nur bei 1,9% der weiblichen Patientinnen den Behandlungsanlass in einem Krankenhaus dar, d. h. die Mehrheit der Patientinnen war aufgrund von anderen Erkrankungen in stationärer Behandlung. Unter den 100 häufigsten Erkrankungen nahm die depressive Episode unter den Frauen die 23. Rangposition ein (Gerste 2012, 330). Bei dem männlichen Teil der Bevölkerung lag 2008 die Jahresprävalenz aufgrund der depressiven Episode bei 3,3% und nahm unter den 100 häufigsten Erkrankungen bei Männern die 53. Rangposition ein. Von allen männlichen Patienten, die an einer depressiven Episode erkrankt waren, lag 2008 die Hospitalisierungsquote bei 31,0%. Die Depression war demnach ursprünglich nicht Anlass für eine stationäre Aufnahme in einem Krankenhaus und der Behandlungsgrund, sondern lediglich ein Nebenbefund.
Für eine stationäre Behandlung stellte die depressive Episode nur 3% der eigentlichen Behandlungsindikation dar (www.versorgings-report-online.de, 13.07.2014). 2012 belegte die depressive Episode hinsichtlich ihrer Dauer der Krankschreibungen bundesweit den ersten Rang mit insgesamt 117 AU – Tage je 100 VJ. Frauen sind mit 148 AU – Tagen je 100 VJ deutlich länger krank geschrieben als Männer mit 91 AU – Tagen je 100 VJ. Im Bundesland Thüringen nahm die depressive Episode mit insgesamt 102 AU – Tage je 100 VJ den zweiten Rang ein. Auch hier waren Frauen mit 143 AU – Tagen länger krank geschrieben als die Männer mit 67 AU – Tage je 100 VJ (Grobe u. a. 2013, 73). Somit ist festzustellen, dass der weibliche Teil der Bevölkerung häufiger, öfter und auch länger an einer depressiven Störung leidet, jedoch stellt die depressive Episode bei den männlichen Patienten eine größere Indikation für eine stationäre Behandlung als bei Frauen dar.
4.3 Depression im Zusammenhang mit beruflicher Tätigkeit und sozioökonomischem Status (Sebastian Selzer)
Zwischen den einzelnen Berufsfeldern zeigen sich unterschiedlich verteilte Depressionsraten. Arbeitslose Frauen und Männer sind mit einer Häufigkeit von jeweils 15,8% und 8,2% am meisten von einer Depression betroffen, (Grobe u. a. 2008, 42). Auch bei der Arzneimittelverschreibung gibt es Unterschiede. Arbeitslose Frauen bekommen mindestens doppelt so viele Antidepressiva verordnet als berufstätige Frauen. Zwischen arbeitslosen und berufstätigen Männern gibt es hinsichtlich der Antidepressiva – Verschreibungen keine großen Unterschiede, das Verhältnis ähnelt sich sehr (Grobe u. a. 2010, 54). Die Diagnosehäufigkeit liegt bei berufstätigen Frauen in allen Berufsbereichen deutlich über der Depressionsrate von Männern (Grobe u. a. 2008, 42). Nach der Gruppe der Arbeitslosen stehen Angehörige des Berufsfeldes „Sozial – und Erziehungsberufe, Seelsorger“ an zweiter Stelle. An dritter und vierter Position stehen die Angehörigen der Berufsgruppen „Verkehrs- und Lagerberufe“ und „Ordnungs- und Sicherheitsberufe“. Die niedrigsten Raten hatten Erwerbspersonen, die aus „technisch – naturwissenschaftlichen Berufen“ kommen (Grobe u.a. 2008, 42 f). Bei einer differenzierteren Betrachtung der einzelnen Berufe stellte man fest, dass bei SozialarbeiternInnen die Erkrankungsdauer aufgrund einer depressiven Episode mit 53,5 AU – Tagen und beim Krankenpflegepersonal mit 50,7 AU – Tagen deutlich länger ist als bei Bankfachleuten (44,3 AU - Tage) und bei Bürokräften (44,3 AU – Tage) (www.presse.barmer-gek.de, 17.03.2014). Jedoch muss hier ebenfalls der Fakt Betrachtung finden, dass Angestellte und Bürokräfte, die in der öffentlichen Verwaltung und in der Sozialversicherung arbeiten, hohe Fehltage aufgrund von depressiven Störungen aufweisen (Bungard u. a. 2013, 140).
Auswertungen hinsichtlich des Sozialstatus zeigen, dass bei Frauen ein Zusammenhang zwischen dem sozioökonomischen Status und der Prävalenz von Depressionen besteht. Hier sinkt die Wahrscheinlichkeit an einer Depression zu erkranken je höher der sozioökonomische Status der Frau ist. Die 12 – Monatsprävalenz und die Lebenszeitprävalenz gehen mit steigendem sozioökonomischen Status zurück. Frauen mit einem hohen sozioökonomischen Status haben eine 12 – Monatsprävalenz von 5,5%, bei einem Mittleren sind es 7% und bei einem niedrigen Status liegt die Prävalenz bei 12,9%. Die prozentualen Unterschiede zwischen den Prävalenzen und dem niedrigen und hohen sozioökonomischen Status sind teilweise doppelt so hoch. Bei den Männern ist kein eindeutiger Zusammenhang zwischen Erkrankungshäufigkeit und sozialem Gradient zu erkennen (Busch u. a. 2013, 736). Zwischen den einzelnen Bildungsstufen wie zum Beispiel Haupt-, Realschulabschluss, Abitur oder keinem Schulabschluss, bestehen bei allen Geschlechtern hinsichtlich der 12 - Monatsprävalenz keine großen Unterschiede (Robert – Koch – Institut 2011, 76).
4.4 Depressionserkrankungen und Komorbidität (Sebastian Selzer)
Depressive Störungen treten sehr häufig mit anderen psychischen Störungen und somatischen Krankheiten auf. 70% der Personen, die eine depressive Störung haben, erkranken mindestens noch an einer weiteren psychischen Störung (Melchior u.a. 2014, 59). Das Auftreten von komorbiden Störungen ist abhängig von dem Schweregrad der Depression. Von den PatientenInnen mit einer diagnostizierten leichten Depression haben 63% mindestens eine weitere F – Diagnose, bei der mittelgradigen Depression sind es ca. 75% und bei den schwergradigen Fällen sind es 80% (Melchior u.a. 2014, 60). Die häufigsten komorbiden psychischen Begleiterkrankungen bei Depressionen sind die somatoformen Störungen sowie die Belastungs- und Anpassungsstörungen; aber auch alle Formen der Angststörungen, wie zum Beispiel Panikstörungen, Agoraphobien, soziale Phobien, spezifische Phobien und die generalisierten Angststörungen (Melchior u.a. 2014, 60).
Diese Störungen treten in der Regel vor der Depression auf und werden als Primärerkrankung interpretiert. Die Wahrscheinlichkeit an einer Depression zu erkranken steigt stark an, wenn man eine solche Ersterkrankung aufweist (Wittchen u.a. 2010, 21). Auch die somatoformen Störungen spielen eine wesentliche Rolle. So können Schmerzstörungen, Abhängigkeitserkrankungen, insbesondere die Alkohol-abhängigkeit, als Folge oder als Mitursache einer Depression angesehen werden. Jedoch kommt die depressive Störung oft als Folge einer Abhängigkeitserkrankung hervor (Wittchen u.a. 2010, 21f). Mit den Diagnosen depressive Episode (F33 ICD-10) und rezidivierende depressive Störung (F33 ICD-10) waren 2010 Erwerbspersonen, die einen Hinweis auf ein Alkoholproblem (F10 ICD-10) hatten, durchschnittlich 7,6 Tage länger krankgeschrieben als Personen die keinen Hinweis auf ein Alkoholproblem hatten. Die Betroffenheitsquote von Menschen mit Depression in Verbindung mit einer Alkoholerkrankung ist sehr hoch (Grobe u. a. 2013, 109). Somatoforme Störungen mit dem gleichzeitigen Vorhandensein einer spezifizierten Depressionsdiagnose, kommen vor allem in den neuen Bunddesländern vor (Melchior u.a. 2014, 63). Der bundesweit höchste Anteil an somatoformen Störungen hatte im Jahr 2011 der Landkreis Ludwigslust – Parchim in Mecklenburg – Vorpommern mit insgesamt 64%. Den niedrigsten Anteil hatte der Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm in Bayern mit 21,1% (Melchior u.a. 2014, 64). Im Bundesland Thüringen haben der Saale – Holzland – Kreis, das Weimarer Land, der Kreis Saalfeld – Rudolstadt und die Stadt Weimar mit ca. 36% die höchsten Anteile an somatoformen Störungen. Dagegen weisen die Stadt Eisenach, der Kreis Sömmerda und der Kreis Nordhausen die niedrigsten Anteile an somatoformen Störungen auf. Bei den letzten beiden Landkreisen liegen die Anteile zwischen 24% und 26% (Melchior u.a. 2014, 63). Die Stadt Eisenach hat mit 23,3% nicht nur den geringsten Anteil in Thüringen, sondern hat bundesweit den dritt niedrigsten Wert zu verzeichnen (Melchior u.a. 2014, 63 f ).
Auch bei den komorbiden Angststörungen lässt sich erkennen, dass der Osten Deutschlands mehr Fälle aufweist als der Rest der Republik. Den bundesweit größten Anteil an komorbiden Angststörungen bei einer bestehenden Depression hat die Landeshauptstadt Magdeburg mit 31,9% dokumentiert, kurz gefolgt von Mansfeld – Südharz in Sachsen – Anhalt und vom Landkreis Wolfenbüttel in Niedersachsen mit je 30,8% Prävalenzanteil.
Den niedrigsten Anteil hatte der Landkreis Garmisch – Patenkirchen mit 16,1%. Auch in den vielen Thüringer Landkreisen und kreisfreien Städten ist ein sehr hoher Anteil von komorbiden Angststörungen zu erkennen. Ein hoher Anteil von mindesten 28% Prävalenz ist in den kreisfreien Städten Gera, Erfurt, Suhl, Jena und in den Landkreisen Hildburghausen, Sonneberg, Schmalkalden – Meiningen, Saalfeld – Rudolstadt, Wartburgkreis, Saale – Orla – Kreis, Unstrut – Hainisch – Kreis und dem Weimarer Land dokumentiert worden. Den kleinsten Wert hatte der Kreis Sömmerda mit einem Anteil in Höhe von ca. 21% (Melchior u.a. 2014, 66 f ).
Die Depressionsprävalenz ist bei einer Mehrzahl von psychischen und physischen Grunderkrankungen erhöht. So ist bekannt, dass Personen mit koronaren Herzerkrankungen oder mit einem Diabetes mellitus häufiger an einer depressiven Erkrankung leiden (Wittchen u.a. 2010, 22). Häufig wurde bei älteren Menschen beobachtet, dass sich nach einem Schlaganfall oder einem Myokardinfarkt gehäuft eine Depression einstellt. Diese beeinflusst den Verlauf der Grunderkrankung im negativen Sinne. Gleichzeitig gilt die Depression als Risikofaktor für die Entstehung von Herzerkrankungen und beeinflusst auch die Mortalität diesbezüglich. Neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer oder Parkinson stehen in einem hohen Zusammenhang mit dem Auftreten von depressiven Erkrankungen. Hier treten depressive Symptome in besonderem Maße auf. Ein erhöhtes Risiko für den chronischen Verlauf einer Depression besteht bei älteren Menschen darin, dass die Symptome der Erkrankung spät oder falsch erkannt und behandelt wird (Wittchen u.a. 2010, 24). Die Kausalität zwischen Pathopysiologie und psychischen Prozessen ist noch unbekannt. Deshalb ist noch nicht geklärt r, ob depressive Erkrankungen als Risikofaktoren für physische Krankheiten anzusehen sind oder als Folge einer körperlichen Krankheit, da hier beide Faktoren in gegenseitiger Wechselwirkung stehen. Sicher ist nur, dass der Verlauf und der Genesungsprozess der depressiven Erkrankung erschwert werden, wenn zusätzlich komorbide Krankheiten auftreten. (Wittchen u.a. 2010, 22).
4.5 Rentenzugänge aufgrund chronischer depressiver Erkrankungen in Deutschland (Sebastian Selzer)
Bei den Frühberentungen stehen psychische Erkrankungen an erster Stelle, gefolgt von den Krankheiten des Muskel– und Skelettsystems, Neubildungen und den Krankheiten des Kreislaufsystems. Die Bedeutung von depressiven Erkrankungen für die vorzeitige Berentung ist gestiegen. Insgesamt sind die Zahlen der Frühberentungen aufgrund anderer Krankheiten zwar rückläufig, jedoch nehmen die Rentenzugänge aufgrund psychischer Störungen seit Beginn der 1980er zu (Wittchen u.a. 2010, 24). Im Jahr 2008 belief sich die Gesamtzahl der Rentenzugänge für Frauen, die aufgrund einer depressiven Episode (F32) eine Erwerbsminderung aufwiesen, auf 5.575 Frühberentungen. Im gleichen Jahr gingen 3.248 Männer in Frührente. Für das Jahr 2008 sind also insgesamt 8.823 Bundesbürger wegen einer depressiven Episode in Frührente gegangen. Die rezidivierende depressive Störung (F33) verzeichnete für Frauen 6.104 und für Männer 2.864 Rentenzugänge. Bei den bipolaren Störungen (F31) sind die Fallzahlen niedriger. 2008 wurden diesbezüglich 773 Frauen und 517 Männer berentet. Das Renteneintrittsalter aufgrund von affektiven Störungen (F30 – F39 ICD-10) beginnt im Durchschnitt bei Frauen mit dem 50. Lebensjahr und bei Männern mit dem 51. Lebensjahr (Wittchen u.a. 2010, 26).
4.6 Todesfälle durch Suizide aufgrund einer Depression in Thüringen und anderen Bundesländern (Sebastian Selzer)
Zwischen einer psychischen Erkrankung und der Suizidalität besteht ein enger Zusammenhang. Etwa 65% bis 90% aller Suizide werden durch psychische Erkrankungen verursacht; darunter sind die depressiven Störungen am häufigsten vertreten. Von den Menschen, die von einer Depression betroffen sind, sterben 3% bis 4% durch einen Suizid. Im Jahr 2008 wurden insgesamt 9.411 Sterbefälle durch Suizid in der BRD erfasst. Das betrifft drei Mal so viele Männer wie Frauen (7.039 Männer und 2.412 Frauen). Die Suizidrate im Allgemeinen nimmt seit den 1990ern immer weiter ab (Wittchen u.a. 2010, 25). Bei depressiven Kindern und Jugendlichen besteht ein erhöhtes Risiko für Suizidgedanken und –versuche. Parasuizide werden zehn bis zwanzigfach häufiger durchgeführt als der eigentliche Suizid selbst. Bis zum 29. Lebensjahr gilt der Suizid als zweithäufigste Todesursache unter jungen Menschen. An erster Stelle steht der Unfalltod im Straßenverkehr.
2008 starben 17 Kinder und 210 Jugendliche durch Suizid. Suizidversuche und Suizidgedanken treten bei Mädchen häufiger auf als bei Jungen; jedoch verüben Jungen drei Mal häufiger einen erfolgreichen Suizid als Mädchen. Gerade bei Männern nimmt das Suizidrisiko – je älter sie werden – zu. Ab der Altersgruppe der über 75 Jährigen ist die Suizidrate am höchsten. Innerhalb Deutschlands bestehen in der Suizidhäufigkeit regionale Unterschiede. Die einzelnen Suizidraten variieren von Bundesland zu Bundesland (Wittchen u.a. 2010, 25). Die meisten Suizide gab es 2012 in Nordrhein-Westfalen. Dort starben 1.725 Menschen durch Suizid, kurz gefolgt von Bayern mit 1.713 Suizidfällen und Baden-Württemberg mit 1.317 Suiziden. Von den 16 Bundesländern liegt Thüringen auf dem 10. Platz. Hier starben im Jahr 2012 insgesamt 338 Menschen durch Suizid. Das waren 18 Menschen mehr als im Vorjahr (www.statistika.com, 04.06.2014). Unter den 338 Suizidanten waren 271 Männer und 76 Frauen zu verzeichnen (www.suizid-praevention.wordpress.com, 28.06.2014). An letzter Stelle lag Bremen mit 81 Fällen (www.statistika.com, 04.06.2014).
Setzt man die Suizidraten im Verhältnis zur Bevölkerung der einzelnen Bundesländer so ergibt sich, dass in Sachsen - Anhalt und in Thüringen die Suizidziffer von 2011 zu 2012 am stärksten zugenommen hat. In Sachsen – Anhalt ist die Zahl der Suizide um 1,9 je 100.000 Einwohner gestiegen und in Thüringen um 0,9 Suizide je 100.000 Einwohner. Im gesamten Bundesgebiet ist die Suizidrate von 2011 zu 2012 um 0,3 Suizide je 100.000 Einwohner gesunken. Im Jahr 2012 hatten Sachsen 15,6 Suizide je 100.000 Einwohner, Sachsen – Anhalt mit 15,5 Suiziden je 100.000 Einwohner und Thüringen mit 15,3 Suizide je 100.000 Einwohner zu verzeichnen. Innerhalb der 16 Bundesländer liegt Thüringen damit auf den dritten Platz. Im Freistaat selbst haben sich vier Mal so viele Männer (24,8 Suizide je 100.000 Einwohner) umgebracht als Frauen (6 Suizide je 100.000 Einwohner). Berlin hatte mit 9,4 Suiziden pro 100.000 Einwohner bundesweit die niedrigste Ziffer zu verbuchen (www.suizidpraevention.wordpress.com, 28.06.2014). Im Jahr 2010 nahmen sich in Thüringen 327 BürgerInnen das Leben. Das waren genauso viele Personen wie das Jahr zuvor. 79,2 % der Suizide wurden von Männern verübt. Das durchschnittliche Suizidalter lag 2010 in Thüringen bei 58,7 Jahren und ist im Vergleich zum Vorjahr um 2,7 Jahren gestiegen. Männer suizidierten sich durchschnittlich mit 57,7 Jahren und Frauen mit 62,8 Jahren.
Auffällig ist, dass das Sterbealter durch Suizid in der Stadt Weimar mit 42,6 Jahren sehr weit unter dem Thüringer Landesdurchschnitt lag. 51,1 % der Verstorbenen waren im Alter zwischen 40 und 70 Jahren, 11% waren im Alter zwischen 10 und 30 und 17,4% waren 70 bis 79 Jahre alt. Die meisten Suizide in Thüringen wurden im Mai mit 39 Fällen und die Wenigsten im Februar mit 21 Fällen durchgeführt. Der Großteil starb an einem Samstag (56 Fälle) und an einem Mittwoch (55 Fälle). Die Wenigsten wurden an einem Donnerstag und an einem Freitag mit jeweils 40 Suiziden durchgeführt. Die höchste Suizidrate in Thüringen wurde im Wartburgkreis mit 19,8 Suizide je 100.000 Personen ermittelt und die Niedrigste im Eichsfeld mit 4,7 Suizide je 100.000 Personen (www.statistik.thueringen.de, 28.06.2014).
Die Tabelle auf Seite 35 zeigt die Anzahl der Suizide in den Thüringer Regionen. Es werden die tatsächlichen Suizidzahlen, das durchschnittliche Sterbealter in den jeweiligen Regionen und die Suizidraten im Verhältnis zur Einwohnerzahl in absteigender Rangfolge angezeigt.
Tabelle 3 Sterbefälle durch Suizid in Thüringen 2010
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: www.statistik.thueringen.de, 28.06.2014
[...]
- Arbeit zitieren
- B. A. Sebastian Selzer (Autor:in)Sabrina Mann (Autor:in), 2014, Epidemiologie, Prävalenz, Versorgung und Prävention bei depressiven Erkrankungen in Thüringen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/288942
Kostenlos Autor werden




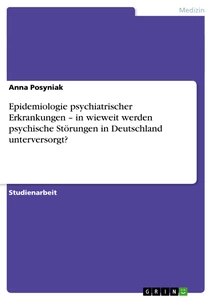
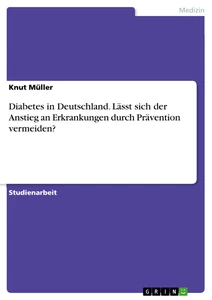



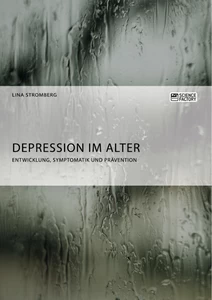





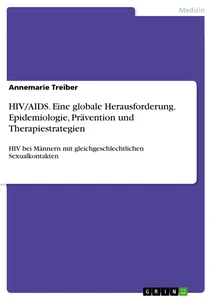
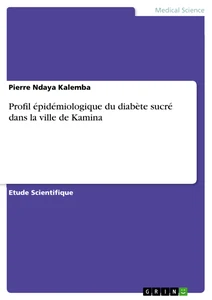
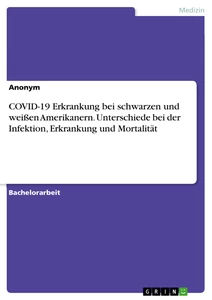


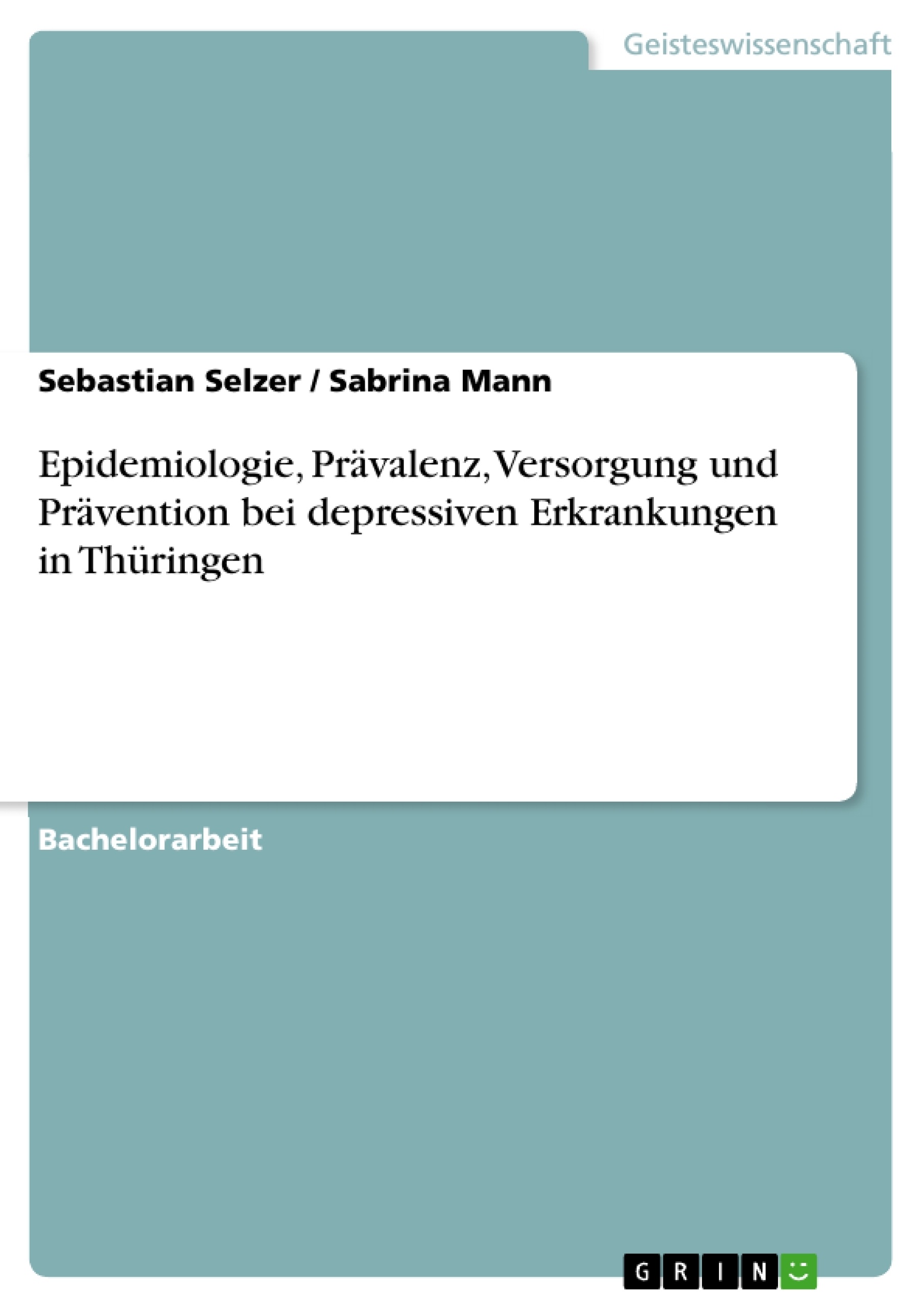

Kommentare