Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Danksagung
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Zusammenfassung
1. Einleitung
Theoretischer Teil
2. Die Entwicklung des gegliederten Schulsystem
2.1. Inklusion als Gegenentwurf des gegliederten Schulsystems
2.2. Fünf Standards für die Umsetzung einer inklusiven Schule
2.2.1. Ethnokulturelle Gerechtigkeit ausüben und Antirassismus stärken
2.2.2. Geschlechtergerechtigkeit herstellen und Sexismus ausschließen
2.2.3. Diversität in den sozialen Lebensformen zulassen und Diskriminierungen in den sexuellen Orientierungen verhindern
2.2.4. Sozio-ökonomische Chancengerechtigkeit erweitern
2.2.5. Chancengerechtigkeit von Menschen mit Behinderungen herstellen
3. Forschungsstand
4. Fragestellungen und Hypothesen
Empirischer Teil
5. Die Methode der schriftlichen Befragung
5.1. Untersuchungsdesign
5.2. Darstellung des Erhebungsinstruments
5.3. Aufbau des Fragebogens
5.4. Beschreibung der Stichprobe
5.5. Durchführung der Erhebung
6. Methode der Datenauswertung
7. Ergebnisse der Datenauswertung
8. Diskussion über die Ergebnisse der Datenauswertung
9. Fazit und Ausblick
Literaturverzeichnis
Anhangsverzeichnis
Anhang
Danksagung
Ich möchte mich an dieser Stelle bei meinem Gutachter Prof. Dr. Kersten Reich für die Betreuung meiner Bachelorarbeit bedanken, der mich bei meinem Forschungsvorhaben unterstützt hat.
Ebenso bedanke ich mich bei den Schulleiter/innen der Schulen, Katherina - Henoth Gesamtschule, Schule Zülpicher Straße und Heinrich – Schieffer Hauptschule, die mir die Möglichkeit für eine Kooperation gegeben haben.
Abschließend will ich mich bei allen Schülerinnen und Schülern bedanken, die sich die Zeit genommen haben den Fragebogen auszufüllen, sowie bei deren Lehrerinnen und Lehrern.
Die vorliegende Bachelorarbeit richtet sich nach den Richtlinien des Lehrstuhl für Erziehungshilfe und sozial-emotionale Entwicklungsförderung der Universität zu Köln (vgl. Universität zu Köln, 2014).
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Geschlecht der Befragten in Bezug auf die Schulform
Abbildung 2: Prozentwert der angestrebten Schulabschlüsse.
Abbildung 3: Anzahl der angestrebten Schulabschlüsse in Prozent.
Abbildung 4: Nachgehen von Interessen in der Schule.
Abbildung 5: Darstellung von Interessen-Verwirklichung in den Schulen.
Abbildung 6. Darstellung von Fächermangel in Schulen.
Abbildung 7: Zustimmung für die Inklusion in Prozent.
Abbildung 8: Zustimmung für die Inklusion je Schulform.
Abbildung 9: Wahrnehmung von Schüler/innen mit einer Lernbehinderung.
Abbildung 10: Darstellung vom Schwierigkeitsgrad des Unterrichtsstoffes.
Abbildung 11: Lautstärke-Empfinden in den Klassen.
Abbildung 12: Darstellung des Verständnis-Empfinden.
Abbildung 13: Verständnis-Empfinden - je Schulform.
Abbildung 14: Gerechtigkeits-Empfinden hinsichtlich fairer Benotung.
Abbildung 15: Darstellung von Freundschaften innerhalb der Schule.
Abbildung 16: Erreichbarkeit des Berufswunsches nach der Schule.
Abbildung 17: Grund für den Besuch dieser Schulform.
Abbildung 18: Darstellung der Wunsch-Schulform.
Abbildung 19: Darstellung der Wunsch-Schulform.
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Schüler/innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Gemeinsamen Unterricht (GU).
Tabelle 2: Alterszusammensetzung der befragten Schülerinnen und Schüler.
Tabelle 3: Grund für die Einschulung in die Förderschule.
Tabelle 4: Zehnstufige Ratingskala mit Standardabweichung, Mittel- und Medianwert.
Tabelle 5: Fünfstufige Ratingskala mit Standardabweichung, Mittel- und Medianwert.
Tabelle 6: Zehnstufige Ratingskala mit Standardabweichung, Mittel- und Medianwert.
Tabelle 7: Zehnstufige Ratingskala mit Standardabweichung, Mittel- und Medianwert.
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten.
Zusammenfassung
Die Bedeutung inklusiver Bildungsangebote in Deutschland wächst durch das Inkrafttreten des Übereinkommens der Vereinten Nationen am 26. März 2009 über das Recht aller Kinder auf Bildung. An internationalen Standards wie des Equity Foundation Statement des Toronto District School Board orientiert sich der Bildungsforscher Kersten Reich an bereits erfolgreiche Standards im Ausland für die Umsetzung inklusiver Bildungsgerechtigkeit.
Die vorliegende Bachelorarbeit beschäftigt sich mit der aktuellen Lage der Schüler/innen in den von der Inklusion (lat. inclusio, Einschließung) betroffenen Schulformen und versucht anhand eines Fragebogens das Wohlbefinden und die jetzige Schulsituation der Schüler/innen in Förder-, Haupt und Gesamtschulen zu verdeutlichen. Insgesamt wurden 75 Schüler/innen aus den jeweiligen Schulformen zu dem Thema Schüler/innen-Perspektive im Hinblick auf die Erwartungen und Voraussetzungen für die Inklusion befragt. Anhand der Fragen sollte erkennbar werden, ob Schüler/innen sich in ihrer Schulform als passend beschult fühlen. Fragen zur gemeinsamen Beschulung von Kindern mit und ohne Behinderung beziehungsweise die Qualität des Unterrichts sowie die Beziehung zwischen Lehrer/innen und Schüler/innen wurden gestellt. Positivere Ergebnisse konnten bei den Schülern/innen der Gesamtschule erzielt werden und deuten somit - bezogen auf das Wohlfühlen in der Schule - auf angemessene Schulsituationsverhältnisse. Im Hinblick dazu sieht die aktuelle Schulsituation nach dem eigenen Empfinden der Schüler/innen der Förder- und Hauptschule weniger angemessen und eher benachteiligend aus.
1. Einleitung
Seit der Unterschreibung der Salamanca-Erklärung 1994, die das Prinzip „Education for all“ beinhaltet, beschäftigen sich Eltern, Pädagogen/innen und Wissenschaftler/innen intensiv mit der Frage, welches Schulkonzept idealerweise Lehrangebote für junge Menschen mit und ohne Behinderung schaffen kann, damit Chancengleichheit im Bildungswesen gewährleistet wird (vgl. UNESCO, 1994, S. 1-18). Die Salamanca-Erklärung wurde unterschrieben, damit gemeinsames statt separierendes Lernen von Kindern mit und ohne Behinderung stattfinden kann. Das Recht auf gleiche Bildungsqualität ist ein Menschenrecht und muss deshalb jedem Menschen zugänglich gemacht werden (vgl. Johnson, 2013, S. 66). Das gegliederte Schulwesen in Deutschland ist stark leistungsorientiert und trennt Schüler/innen nach der vierten Klasse innerschulisch – je nach Leistung – in homogene Lerngruppen. Die frühe Segregation von Kindern in die verschiedenen, schulischen Institutionen, damit Kinder mit „Ihresgleichen“ gemeinsam lernen können, wird von Inklusionsbefürworter/innen für menschenunwürdig gehalten und kritisiert. Hingegen ermöglichen Inklusive Schulen den Abbau von Benachteiligungen und Diskriminierungen individueller Besonderheiten und zielen auf Teilhabe sowie Akzeptanz aller Schüler/innen. Inklusive Schulen sind Lebensräume für Heranwachsende, in denen Vielfalt als Normalität akzeptiert wird, in denen Schüler/innen vom wechselseitigen Lernen profitieren und Schule als einen Ort der Geborgen- und Vertrautheit erleben können (vgl. Reich, 2014, S. 67).
Doch, wie erleben Schüler/innen ihre jetzige Schulsituation? Wie sieht die Beziehungskultur der Schüler/innen in Förder-, Haupt- und Gesamtschulen aus? Wie zufrieden sind Schüler/innen mit der besuchten Schulform und nach welcher Schulform sehnen sie sich? Worin sehen sie den Grund für die Beschulung in eine Förderschule, und wie benachteiligend sieht ihre Schulsituation wirklich aus?
Die vorliegende Arbeit wird aus der Perspektive von Schüler/innen der Förder-, Haupt- und Gesamtschule der Frage nachgehen, ob Schüler/innen in den zunächst betroffenen Schulformen ihre Schulsituation als benachteiligend empfinden. Anhand der Ergebnisse werden die Erwartungen an selbige und Voraussetzungen für die Inklusion aufgezeigt. Inklusive Schulen ermöglichen den Abbau von Benachteiligungen und Diskriminierungen individueller Besonderheiten und zielen auf Teilhabe sowie Akzeptanz aller Schüler/innen.
Die vorliegende Arbeit gliedert sich in einen theoretischen und einen empirischen Teil. Der theoretische Teil beschäftigt sich im zweiten Kapitel mit der Entwicklung des gegliederten Schulsystems in Deutschland nach dem zweiten Weltkrieg. Hier ist es wichtig darzulegen, wie sich die jeweiligen Schulformen historisch entwickelt und begründet haben. Ferner wird die aktuelle Entwicklung der Schulformen in Deutschland diskutiert und die Inklusion als Gegenentwurf des gegliederten Schulsystems vorgestellt. Dazu werden die fünf notwendigen Standards für die Umsetzung einer Inklusiven Schule von Kersten Reich erläutert. Im dritten Kapitel wird kurz der aktuelle Forschungsstand zum Thema dieser Arbeit dargelegt. In das darauffolgende Kapitel werden Fragestellungen und Hypothesen zum Untersuchungsgegenstand aufgestellt, die im empirischen Teil untersucht und beantwortet werden. Im empirischen Teil, dem fünften Kapitel, wird zunächst auf die Methode der schriftlichen Befragung eingegangen. Danach werden das Untersuchungsdesign der Studie und die Darstellung des Datenerhebungsinstruments erläutert, der Aufbau des Fragebogens sowie die Stichprobe und die Durchführung der empirischen Studie beschrieben. Im sechsten Kapitel wird die Methode der Datenerhebung erläutert, während im siebten Kapitel die Ergebnisse der empirischen Studie zusammengestellt werden. Abschließend werden im achten Kapitel die Ergebnisse zusammengefasst und einer diskursiven Auseinandersetzung unterzogen.
Theoretischer Teil
2. Die Entwicklung des gegliederten Schulsystem
Im Jahr 1948 wurde über die Vereinheitlichung und Reform des deutschen Schulwesens im Sinne einer Integration der bislang getrennten Schularten diskutiert.
Der Beschluß zur Vereinheitlichung und Reform des deutschen Schulwesens war zustandegekommen unter dem Eindruck des totalen Zusammenbruchs des deutschen Staates und eines massiven Infragestellens deutscher Werte. Not und Elend sowie der Schrecken der Naziherrschaft hatten einen gewaltigen Akt der Solidarisierung mit den unteren Gesellschaftsschichten bewirkt und Chancengleichheit an die Stelle von Leistungsdenken gesetzt (Dresselhaus, 1997, S. 26).
Doch die Idee der Zusammenführung aller Schulformen wurde aufgegeben. Die Kultusminister der deutschen Länder, einschließlich der sowjetisch besetzten Zone, konnten sich nicht – begründet auch durch die Trennung zwischen Ost- und Westdeutschland – darauf einigen (vgl. Dresselhaus, 1997, S. 26f.). Während in Ostdeutschland die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED) eine Einheitsschule namens Polytechnische Oberschule (POS) für die Angehörigen aller sozialen Schichten zu gründen versuchte, versuchten CDU-Politiker in Westdeutschland sich für ein „leistungsfähiges“ Schulsystem einzusetzen (vgl. Dresselhaus, 1997, S. 27).
Das Ziel in Westdeutschland war es, das Land effektiv und schnell wieder aufzubauen. An dieses Ziel galt es auch die Bildungspolitik anzupassen. Um die Neuorganisationen der Gesellschaft und Wirtschaft zu ermöglichen, kam der Gedanke auf, eine gegliederte Leistungsschule zu etablieren (vgl. Northoff, 2012, S. 27). Um aus dem Elend herauszukommen, war die Mehrheit der Auffassung, „daß dies eher mit Leistung und weniger mit Chancengleichheit zu bewerkstelligen sei.“ (Dresselhaus, 1997, S. 27).
Daher wurde durch die Mehrheit der Stimmen ein radikales Durchsetzen des dreigliedrigen Schulsystems in Hauptschule, Realschule und Gymnasium vorgegeben. Dennoch versuchten SPD-Politiker eine Gesamtschule als Modell des gemeinsamen Lernens durchzusetzen, um die Chancengleichheit zu gewährleisten (vgl. Dresselhaus, 1997, S. 28).
Die Befürworter/innen der Gesamtschulen nahmen vor allem Bezug auf positive Erfahrungen im Ausland und verfolgten Ziele wie erhöhte Chancengleichheit, soziale Integration, Modernisierung des Unterrichts und Individualisierung des Lernens. 1969 beschlossen sämtliche Parteien, Bildungsrat und Kultusministerkonferenz (KMK) Versuche mit Gesamtschulen durchzuführen, sodass allein in Nordrhein-Westfalen zwischen 1969 und 1989 134 Gesamtschulen etabliert wurden (vgl. Dresselhaus, 1997, S. 28-32). Dennoch erwähnt der Historiker Günter Dresselhaus: „Das Neue hat das Alte nicht ersetzt. Die Gesamtschule existiert lediglich als Alternative neben den herkömmlichen Schulen.“ (vgl. Dresselhaus, 1997, S. 32).
Auch die sogenannte Hilfsschule, die vom nationalsozialistischem Regime für rassenpflegerische Maßnahmen bei Menschen mit Behinderung oder verhaltensauffälligen Kindern benutzt wurde, kam ab 1949 mit dem „Verband deutscher Hilfsschulen“ (VDH) erneut auf und wurden schließlich „Sonderschule“ umbenannt (vgl. Essen, 2012, S. 76-77). Der Verband deutscher Sonderschulen (VDS) dehnte sein Aufgabengebiet auf die gesamte Heilpädagogik aus und strebte die „gesetzliche Sanktionierung des Sonderschulwesens als ‚selbstständige Säule im Aufbau des Bildungswesens‘ an“ (Essen, 2012, S. 78). Sowohl in West- als auch in Ostdeutschland entwickelten sich aus unterschiedlichen Motiven Sonderschulen. In der DDR war zwar die Zahl der Sonderschulüberweisungen geringer als in der BRD, dennoch wurden Kinder, die der damaligen Norm nicht entsprachen, mit biologischen Defekten „etikettiert“ und ausgesondert (vgl. Reich, 2012, S. 33).
Mit dem weiteren Ausbau der Sonderschulen und den Richtlinien der KMK-Empfehlungen galten Kinder in den 1970er Jahren, die eine Sonderschule besuchten, als lernbehindert. Also definierte die KMK 1972 die Sonderschule als „eine Schule für Kinder mit geringer intellektueller Begabung, mit Schwächen in der Aufnahme, Konzentration, Verarbeitung und Gestaltung“ (Essen, 2012, S. 79). Dies begründet Hans Eberwein damit, dass „bei der Überweisung von Schüler/innen in Sonderschulen schon immer die Entlastung der allgemeinen Schule im Vordergrund und weniger das Erfordernis einer besseren Alternative für Schüler/innen mit Lernproblemen [stand]“ (Eberwein, 2002, S. 505).
Nach der Wende 1989 wurde über die Zukunft der Einheitsschule der DDR debattiert. Die politischen Parteien vertraten verschiedene Positionen bezüglich der Schulorganisation. Die Partei des Demokratischen Sozialismus (PDS) setzte sich bei der ersten freien Volkskammerwahl für den Fortbestand der Einheitsschulen ein. Je nach politischen Mehrheiten in den alten wie in den neuen Bundesländern, entschieden die Landesregierungen neben den Gesamtschulen auch Gymnasien und Realschulen zu gründen, wenn dies dem Elternwillen1 entsprach (vgl. Herrlitz, Hopf, Titze, & Cloer, 2005, S. 238).
Zudem stand in den 1990er Jahren auch wieder verstärkt die schulische Integration im Vordergrund. Die Forderung nach Integration von Kindern mit Behinderung in den Regelschulbetrieb wird nun immer stärker vertreten. Das Sonderschulsystem selbst wurde zwar nicht stark verändert, wohl aber immer stärker in Frage gestellt. Verschiedene Schulversuche zur Integration wurden durchgeführt (vgl. Essen, 2012, S. 80). Festzuhalten ist, dass es sich bis zum 21. Jahrhundert in Deutschland die Schulformen Förderschule2, Hauptschule, Realschule, Gesamtschule und Gymnasium entwickelt haben. „Jede dieser Schularten umfasste traditionell nur einen Bildungsgang, der auf den Erwerb eines bestimmten Abschlusses ausgerichtet war: den Hauptschulabschluss, den Realschulabschluss (Mittlerer Abschluss) oder das Abitur (Hochschulreife)“ (Bildungsberichterstattung, 2014, S. 68).
2.1. Inklusion als Gegenentwurf des gegliederten Schulsystems
Schon früh wurde auf internationaler Ebene die Pädagogik des Selektierens von Kindern, die der „Norm“ nicht entsprachen, und dessen Folgen untersucht und kritisch betrachtet. Deshalb entschieden sich 25 internationale Organisationen und 92 Regierungen 1994 die Salamanca-Erklärung in Spanien zu unterzeichnen. In dieser Erklärung wird die „Bildung für Alle“ (Education for all) als internationales Bildungsziel definiert, um eine inklusive Pädagogik zu unterstützen und Benachteiligungen von Kindern in Schulen entgegenzuwirken. (vgl. UNESCO, 1994, S. 1-18). In Deutschland ist die Diskussion über die Entwicklung des allgemeinbildenden Schulwesens, insbesondere im gegliederten Sekundarbereich I, im Rahmen der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderung und deren Ratifizierung seit dem Jahr 2009 entbrannt. Gemeinsam mit dem Bund und den Ländern steht Deutschland vor der Aufgabe, ein bisher hochselektives Bildungssystem inklusiv umzustrukturieren.
Die Ziele der Inklusion gehen über die damaligen Ziele der Integrationspädagogik durch Einheitsschulen beziehungsweise der Gesamtschulen hinaus. Zwischen den Begriffen der Integration und Inklusion wird strengsten unterschieden.
Inklusion ist umfassender als das, was man früher mit Integration zu erreichen meinte. Sie ist ein gesellschaftlicher Anspruch, der besagt, dass die Gesellschaft ihrerseits Leistungen erbringen muss, die geeignet sind, Diskriminierungen von Menschen jeder Art und auf allen Ebenen abzubauen, um eine möglichst chancengerechte Entwicklung aller Menschen zu ermöglichen (Reich, 2012, S. 39).
Während Integration als Prozess verstanden werden kann, der sich gegen bestehende selektierende Systeme wehrt und die Eingliederung von ausgesonderten Menschen fordert, meint Inklusion die Veränderungsnotwendigkeit von bestehenden Systemen und deren Rahmenbedingungen, um Diversitäten von Anfang an anzuerkennen (vgl. Ziemen, 2013, S. 47). Die Schule muss Rahmenbedingungen schaffen, um allen Schüler/innen mit oder ohne Behinderung gerecht zu werden. Folglich bedeutet dies, dass die Inklusion sich für Chancengerechtigkeit und Gleichbehandlung aller Menschen einsetzt, damit Ausgrenzungen und Marginalisierungen behinderter oder verhaltensauffälliger Kinder entgegen gewirkt werden können. Bezogen auf den schulischen Kontext soll Kindern und Jugendlichen unabhängig von ihrer sozialen Herkunft, ihrer Sprache, ihren Fähigkeiten, beziehungsweise Behinderungen, das gemeinsame Lernen ermöglicht werden. Zudem sollen den Schülern/innen individuelle Wege gezeigt werden ihre Fähigkeiten weiter auszubauen, damit sie ihre Ziele erreichen können.
In der UN-Behindertenrechtskonvention wird Inklusion damit begründet, dass die Bildung aller Kinder mit und ohne Behinderung ein Menschenrecht ist. Um die Situation von Menschen mit Behinderung zu verbessern und um deren Teilhabe in der Gesellschaft zu ermöglichen, ist unter anderem Artikel 24 Absatz 1 der UN-Behindertenrechtskonvention maßgebend.
Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderung auf Bildung. Um dieses Recht ohne Diskriminierung und auf der Grundlage der Chancengleichheit zu verwirklichen, gewährleisten die Vertragsstaaten ein integratives Bildungssystem auf allen Ebenen und lebenslanges Lernen (Art. 24 Abs. 1 VN-BRK).
Daraus resultiert, dass Kindern mit Behinderungen ein selbstbestimmtes und gemeinsames Leben auf der Grundlage von Bildung und Chancengleichheit ermöglicht werden sollen. Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass Kinder auf Förder- und Hauptschulen geringe Weiterbildungsmöglichkeiten haben, begründet mit ihrer schulischen Laufbahn und aufgrund ihres „Behinderungsstatus“. So konstatieren einige Studien dazu, „dass eine Sonderbeschulung entweder in die Arbeitslosigkeit oder [zu] sehr niedrige[n] Arbeiten führt“ (Reich, 2012, S. 38). Auch der Heilpädagoge Fabian van Essen folgert, dass die Selektionsfunktion Kinder mit Behinderungen frühzeitig stigmatisiert und sie dadurch Misserfolgserfahrungen hinsichtlich ihres „Etikettes“ machen. Erfolge der Lehre auf Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen konnten in verschiedenen empirischen Studien nicht verzeichnet werden. Somit kann nicht von einem Nutzen dieser Schulform, bezogen auf die eigentliche Aufgabe, gesprochen werden (vgl. Essen, 2012, S. 106).
Auch durch internationale Vergleichsstudien wie PISA (Programm for International Student Assesssment) oder IGLU (Internationale Grundschul-Leseuntersuchung) erfährt das deutsche Schulsystem aufgrund des schlechten Abschneidens der Schüler/innen – beispielsweise im Lesen – Kritik.
In der ersten PISA Studie 2001 wurde deutlich, dass das Kompetenzniveau der 15-Jährigen in Deutschland in allen Bereichen unter dem Mittelwert der OECD-Staaten lag, die Streuung war sehr hoch und der Rückstand schwächerer Schülerinnen und Schüler groß. Auch die herkunftsbedingten Unterschiede überraschten, Bildungserfolg hängt in Deutschland stärker als in Finnland vom Bildungsstand und vom ökonomischen Status der Eltern ab, auch der Migrationshintergrund spielt eine wichtige Rolle, Deutschlands Bildungssystem gewährt keine Chancengleichheit (Northoff, 2012, S. 35).
Die PISA-Vergleichsstudie deckt auf, dass der Heterogenität als natürliche Gegebenheit bisher nachteilig begegnet wurde. Kinder mit verschiedenen kulturellen, sprachlichen oder sozio-ökonomischem Hintergründen wurden vor allem deswegen aufgrund ihrer Unterschiede im Schulsystem selektiert, weil Anhänger der „homogenen Philosophie“ eher Bildung in „gleichartigen“ Lerngruppen als effektiver erachten (vgl. Wocken, 2010, S. 53). Die frühzeitige Selektion von Kindern kann zur Folge haben, dass sie in einer „wissensgeprägten Gesellschaft“ den Anschluss an den Arbeitsmarkt verlieren und ihnen somit die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben größtenteils verwehrt bleibt (vgl. Reich, 2012, S. 14).
Das inklusive Bildungssystem hat sich zur Aufgabe gemacht, die Unterschiedlichkeit und Verschiedenartigkeit von Kindern als Chance zu sehen beziehungsweise als Grundgegebenheit institutionalisierten Lernens (vgl. Bönsch, 2012, S. 79). Durch den kontinuierlichen Ausbau des gemeinsamen Unterrichts (GU) in NRW sind aktuell 29,6% der Lernenden der Primarstufe und der Sekundarstufe I (Schuljahr 2013/2014, öffentliche Schulen) Schüler/innen mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung (vgl. NRW, 2014).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten.
Tabelle 1: Schüler/innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Gemeinsamen Unterricht (GU).
2.2. Fünf Standards für die Umsetzung einer inklusiven Schule
Die inklusiven Schulen stehen vor der Aufgabe ein Konzept zu entwickeln, welches die bisherige pädagogische Schulkultur zu überwinden hilft, damit Kindern aus allen sozialen Schichten das Recht auf gleiche Bildung gewährt werden kann. Reich erarbeitete fünf notwendige Standards für die Umsetzung einer inklusiven Bildungsgerechtigkeit mit dem Ziel, Inklusion kontinuierlich zu verbessern (vgl. Reich, 2012, S. 52f.). Dabei stützt er sich auf international erfolgreiche Standards und Regeln, wie dem „Equity Foundation Statement“ des „Toronto District School Board (TDSB)“, das in Kanada entwickelt wurde und passt sie den deutschen Schulverhältnissen an (vgl. Reich, 2012, S. 47).
Das kanadische Schulsystem unterscheidet sich vom gegliederten Schulsystem in Deutschland. Es ist durch Gesamtschulen und Ganztagsstrukturen geprägt. Zudem gibt es in Kanada keine Sonderschulen oder Sonderklassen verschiedener Schultypen. Die Schüler/innen haben die Möglichkeit, sich in einer heterogenen und leistungsbezogenen Gemeinschaft zu entwickeln und verschiedene Bildungsabschlüsse zu erreichen (vgl. Reich, 2012, S. 44). Zudem hat sich auch das kanadische Erziehungs- und Bildungssytem in den PISA-Vergleichsstudien ausgezeichnet. Bezogen auf Toronto zeigt die Studie, dass sich keine Leistungsunterschiede zwischen Kindern aus Zuwanderungsfamilien und den Einheimischen aufzeigen lassen und „die Leistungen von Migrantenkindern [...] weit über dem Durchschnitt der OECD-Länder [liegen]“ (Bertelsmannstiftung, 2008, S. 2). Ebenso sehen kanadische Akteure kulturelle Vielfalt als selbstverständlich und als Chance und richten deswegen ihre Arbeit im TDSB gezielt auf Teilhabegerechtigkeit und Chancengleichheit aus (vgl. Bertelsmannstiftung, 2008, S. 4).
Im Folgenden werden die fünf Standards der Inklusion vorgestellt und ihre mögliche Umsetzung für das deutsche Schulsystem erläutert.
2.2.1. Ethnokulturelle Gerechtigkeit ausüben und Antirassismus stärken
Reich versteht unter Ethnizität kulturelle soziale Konstrukte über Natur und Kultur, die einer bestimmten Gemeinschaft zugeschrieben werden, um sich selbst von dieser abzuheben und gegebenenfalls höher einzuordnen. Solche Zuordnungen von Ethnien können schnell zur Diskriminierung von Fremdheit führen und Rassismus entstehen lassen. Beispielsweise waren Mischehen zwischen Afrikanern (damals bezeichnet als Wilde) und Deutschen in der Kaiserzeit 1890-1918 verboten, um die „Reinheit“ des deutschen Volkes zu gewährleisten. Problematisch wird der Begriff Ethnizität, wenn dieser in einer durch Migranten gemischten Gesellschaft erfasst werden muss. So schlussfolgert Reich, dass es sinnvoller erscheint in einer demokratisch orientierten Gesellschaft über Diversität - auch gleichzusetzen mit Pluralität und Heterogenität - zu sprechen. Diversität als passenderen Begriff für Ethnizität zu verstehen, heißt „Unterschiede in den kulturellen Orientierungen, in Beziehungen, Gewohnheiten, Haltungen, Lebensstilen etc.“, die auch widersprüchlich oder ambivalent sein können, in einer Demokratie aber toleriert werden müssen, zu akzeptieren (vgl. Reich, 2012, S. 56ff.). In diesem Sinne bedeutet ethnokulturelle Gerechtigkeit, dass das inklusive Schulsystem jedem Individuum in seiner Einzigartigkeit und unabhängig seiner ethnischen Herkunft Wege eröffnen muss, am Bildungssystem teilzuhaben. Oft wurden und werden Menschen mit Migrationshintergrund in bestimmte Schulformen beziehungsweise schulische Laufbahnen gedrängt. Die Gerechtigkeit bei diesem Phänomen von Segregation würde nun bedeuten, dieser Gruppe von Menschen die gleichen Chancen einzuräumen, wie denen, die nicht durch das bisherige Schulsystem selektiert werden. Ebenso bedeutet ethnokulturelle Gerechtigkeit die Sensibilisierung mit der eigenen rassistisch diskriminierenden Geschichte und Kultur. Daher sollte in den Schulen „die Wirkungen bis in die Gegenwart reflektier[t] [werden]“ um ethnische Minderheiten in ihrer Sündenbockrolle nachvollziehen zu können (vgl. Reich, 2012, S. 57). Demzufolge solle in den Lehrplänen die Umsetzung von „ethnokultureller Gerechtigkeit und Antirassismus [zu]stärken“, damit pädagogische Fachkräfte dieses Thema im Unterricht behandeln und gleichzeitig mit den Schülern/innen reflektieren können. Somit ist ein Ziel der Bildung, Rassismus frühzeitig zu bekämpfen beziehungsweise gar nicht erst entstehen zu lassen und dadurch die Irrelevanz ethnokultureller Herkunft in der Gesellschaft zu bewirken (vgl. ebd., S. 57).
2.2.2. Geschlechtergerechtigkeit herstellen und Sexismus ausschließen
Auch Geschlechterkonstruktionen werden von Menschen definiert, um bestimmte stereotypische Verhaltensmustern als „normal“ zu erachten und um sich von der umfassenden Breite an sexueller Orientierung abzugrenzen. Demzufolge werden den Kindern früh in der Erziehung geschlechtsspezifische Verhaltenskodizes auferlegt, um sie entweder in die männliche oder weibliche Geschlechterrolle einzuordnen (vgl. Reich, 2012, S. 58). Fest steht, dass es unter sexueller Identität vielfältige Orientierungen und Neigungen gibt und nicht nur die traditionelle Vorstellung von der heterogenen Gegengeschlechts-Liebe. Reich zählt vielfältige Geschlechterkonstruktionen, wie zum Beispiel Transgender, sexuell Uninteressierte, Homo-, Hetero-, Trans- und Bisexuelle dazu und fordert auch die Anerkennung für sexuelle Diversitäten in Schulen (vgl. Reich, 2012, S. 58-59).
In diesem Zusammenhang wird unter Geschlechtergerechtigkeit zum einen die gezielte Bekämpfung von Diskriminierungen. Das heißt, individuelle Wertigkeit steht in keinem Zusammenhang mit der sexuellen Orientierung. Demnach muss den Schülern/innen auch die Entfaltung der individuellen sexuellen Identitäten zugestanden bzw. ein Selbstverständnis für sexuelle Identitäten, egal welcher Art, vermittelt werden. Zum anderen muss Geschlechtergerechtigkeit auch in der Reichweite anerkannt werden, „dass alle Gesellschaftsmitglieder einen grundsätzlichen Respekt vor der möglichen Vielfalt aller anderen haben und [diese auch] kultivier[t] [werden] müssen“ (vgl. Reich, 2012, S. 61). Diese Grundhaltung der Gleichberechtigung sexueller Vielfalt ist, vor allem für das gemeinsame Lernen in den Schulen, von besonderer Bedeutung (vgl. Reich, 2012, S. 64). Die Aufgabe der Schulen bestehe darin, sexuelle Diskriminierung zu unterbinden, indem Geschlechtertrennungen sowie geschlechter-homogene Gruppierungen im Lernprozess aufgehoben werden. Es folgt daraus auch, dass die Lehrkräfte in einer geschlechtergerechten Sprache Konflikte offen ansprechen und sich damit auseinandersetzen. Auch falscher Sprachgebrauch zeugt von Diskriminierung, weswegen eine nicht sexistische Sprache ebenfalls eine Voraussetzung für die Herstellung von Gerechtigkeit im gemeinsamen, inklusiven Lernen ist (vgl. Reich, 2012, S. 66-67).
2.2.3. Diversität in den sozialen Lebensformen zulassen und Diskriminierungen in den sexuellen Orientierungen verhindern
Die Liste homophober Äußerungen ist lang und findet sich in verschiedenen Bereichen wie in der Religion, im Sport und in den Berufen etc. wieder. In bestimmten Berufen vor allem dann, wenn sie von einem Geschlecht dominiert werden und beispielsweise spezifische Vorstellungen von Männlichkeit an sie geknüpft sind. Beispielsweise finden sich homophobe Äußerungen im Herren-Fußball. Aussagen, wie das des früheren Spielers von Fortuna Düsseldorf, Michael Schütz in einem Interview: „Man würde gegen so einen nicht richtig rangehen, weil die gewisse Furcht vor Aids da wäre“ (vgl. Normal ist eben doch anders!, 2008) sind Beispiele für eine feindselige Gesinnung gegen sexuell anders orientierte.
Reich versteht unter:
„soziale Lebensform […] die Art und Weise, wie ein Mensch insbesondere in seinen Handlungen und seinem Sozialverhalten bezogen auf die Lebensumstände agiert, über die Zeit seinen Lebenslauf führt und einen persönlichen Lebensstil gestaltet“ (vgl. Reich, 2012, S. 68).
Bezogen auf das Beispiel Fußball meint dieses Zitat, dass homosexuelle Spieler/innen einen Lebensstil (Fußballspielen) gewählt haben, der sie glücklich macht. Soziale Lebensformen zulassen meint in diesem Kontext, Diversität in Lebensstil und Lebensverläufen zu akzeptieren (vgl. ebd., S. 68). Ein/e homosexuelle/r Fußballer/in darf aufgrund seiner/ihrer sexuellen Orientierung von der Gesellschaft nicht diffamiert werden. Unter Lebensstil kann jegliche Orientierung, sei es sexueller, spiritueller, politischer oder esoterischer Art, die auch im Widerspruch zu einander stehen können, verstanden werden.
Die Schulen haben die Aufgabe, homophobe Ängste aufzulösen. Dies kann nur geschehen, wenn individuelle Lebensstile gewürdigt werden und für diese ein Raum geschaffen wird, in dem sie sich entwickeln können. Gelebte Diversität kann nur dann realisiert werden, wenn Schüler/innen verschiedene Wahlmöglichkeiten und Freiheiten haben. Als Beispiel führt Reich auf:
Wenn z.B. ein Lehrer in seiner Familie die Risiken der Arbeitslosigkeit erfahren hatte und deshalb Lehrer wurde, um einen relativ krisenfest [sic!] Job zu erlangen, so darf er seine Sorgen oder Ängste nicht auf Schülerinnen und Schüler projizieren, die ihre ganz eigenen Wege gehen werden oder müssen (Reich, 2012, S. 73).
Es darf nicht aus den Augen verloren werden, dass die sexuelle Orientierung als „eine persönliche Angelegenheit“ betrachtet werden und daher vor Missbrauch und Mobbing in Schulen geschützt werden muss (vgl. ebd., S. 73).3
Schulen sollten von Grund auf Vielfalt zulassen. Mögliche sexuelle Entwicklungen von Schüler/innen sollten geschützt stattfinden können, ohne jedoch den Bildungsauftrag zu vernachlässigen. Feste Strukturen und Regeln, die das Miteinander vereinfachen beziehungsweise ermöglichen, sollten im Rahmen des inklusiven Lernens die Offenheit der Beteiligten fördern und diesen Schutz bieten.
[...]
1 1979 wurde das Elternrecht auf freie Schulformwahl eingeführt. Näheres dazu: (Dresselhaus, 1997, S. 30.)
2 Die Förderschule stellt eine vierte vertikale Säule des gegliederten Schulwesens dar. Näheres dazu: (Bleidick, 1980, S. 232)
3 Diese konkrete Darstellung von Problemen bezüglich der homosexuellen Orientierung ist nur ein Beispiel und soll keinesfalls so verstanden werden, dass diese Gruppe von Menschen alleine diskriminiert wird.
- Arbeit zitieren
- Gülseren Kaba (Autor:in), 2015, Erwartungen und Voraussetzungen der Inklusion, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/288570
Kostenlos Autor werden





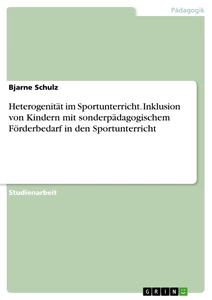




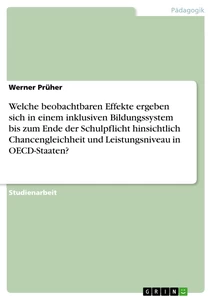




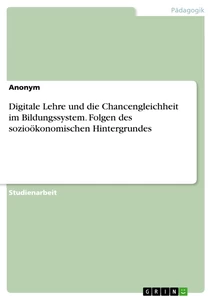




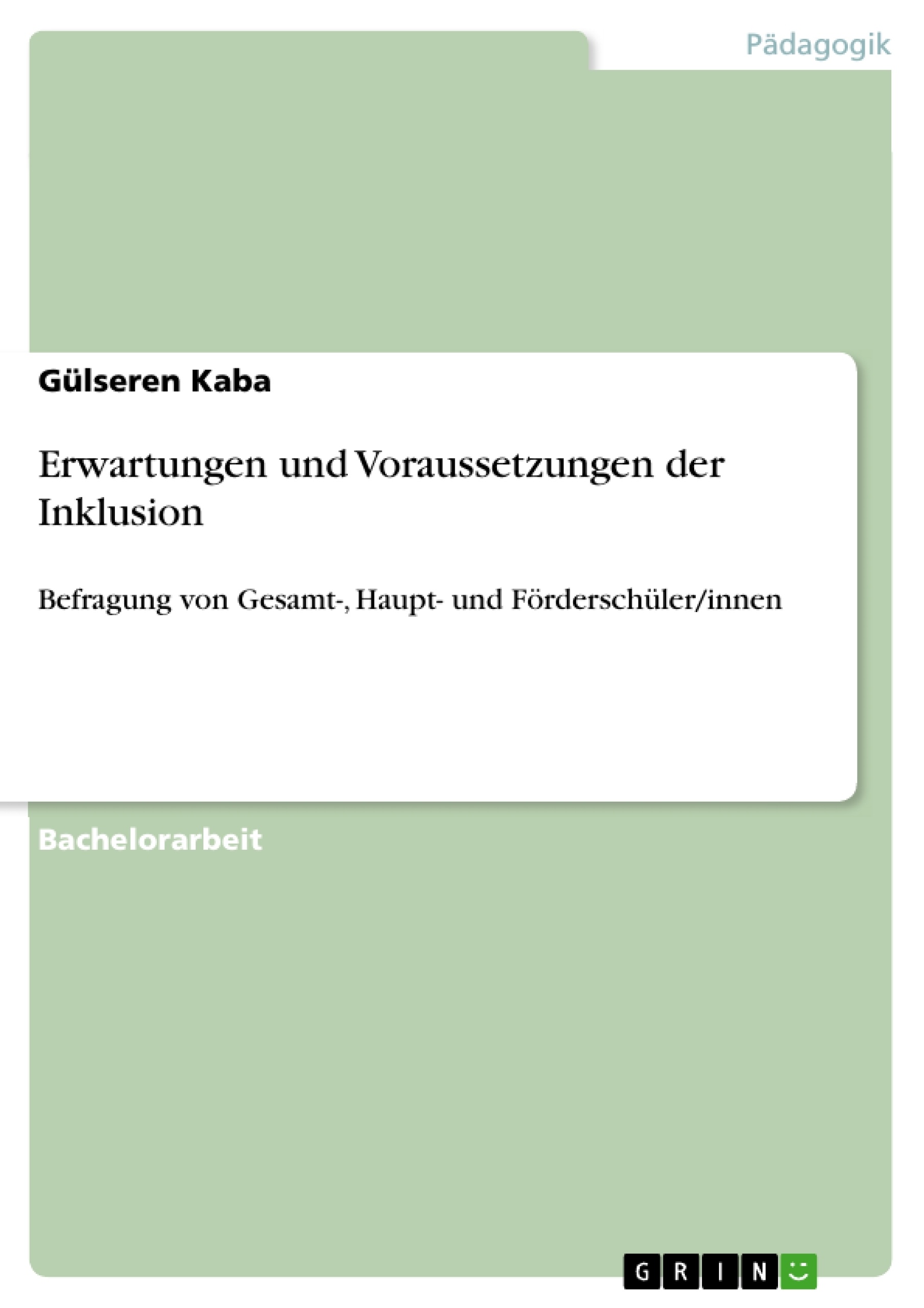

Kommentare