Leseprobe
Inhalt
1. Einleitung
2. Universitäten unter Reformdruck - Ursachen des Wandels der Universitätssteuerung
2.1 Neue Anforderungen und Opportunitäten für Hochschulen
2.1.1 Strukturwandel zur Wissensgesellschaft
2.1.2 Globalisierung und Internationalisierung der Wissenschaft
2.1.3 Wandel des Staats- und Steuerungsverständnisses
2.2 Mangelnde Anpassungsfähigkeit - Defizitdiagnosen zur traditionellen Hoch- schulorganisation
2.2.1 Unterfinanzierung
2.2.2 Strukturelle Bewegungsunfähigkeit
3. Die Reform der Hochschul-Governance in Deutschland
3.1 Staatliche Regulierung
3.2 Externe Steuerung
3.3 Akademische Selbstorganisation
3.4 Hierarchische Selbststeuerung
3.5 Wettbewerb
3.6 Unterschiede zwischen den Bundesländern
4. Konzeptioneller Hintergrund der Untersuchung
4.1 Organisationaler Wandel aus der Sicht verschiedener Organisationstheorien
4.1.1 Organisationsumwelt und organisationaler Wandel
4.1.2 Organisationsinterne Determinanten organisationalen Wandels
4.2 Strategie, Strukturen und Organisationskultur als zentrale Ordnungsmomente - das St. Galler Management-Modell und seine Übertragung auf den Hochschul- kontext
4.2.1 Strategie
4.2.2 Aufbau- und Ablaufstrukturen
4.2.3 Organisationskultur
4.3 Rahmenmodell für eine organisationssoziologische Analyse von Universitäten
5. Anlage und Methodik der Untersuchung
5.1 Fallstudiendesign und Auswahl der Untersuchungseinheiten
5.1.1 Das Fallstudiendesign
5.1.2 Auswahl und Gewinnung der Untersuchungseinheiten
5.2 Datenquellen und Erhebungsmethoden
5.2.1 Analysierte Dokumente
5.2.2 Problemzentrierte Experteninterviews
5.2.3 Input- und Output-Indikatoren
5.2.4 Feldnotizen/Forschertagebuch
5.3. Vorgehen bei der Auswertung
6. Empirische Ergebnisse
6.1 Strategie
6.1.1 Strategische Positionierung im Feld der Anspruchsgruppen
6.1.2 Implementationsinstrumente und Umsetzungsstrategien
6.1.3 Entscheidungsstrukturen und institutionelle Stellung der Steuerungsakteure
6.1.4 Mechanismen der organisationalen Selbstbeobachtung
6.1.5 Strategische Allianzen und institutionelle Kooperationen mit externen wissenschaftlichen und nicht-wissenschaftlichen Einrichtungen
6.2 Aufbau- und Ablaufstrukturen
6.2.1 Gliederung der Fachbereiche und der ihnen nachgeordneten Organisations- einheiten (Departments, Institute, Fächer)
6.2.2 Akademische Aufbaustrukturen jenseits von Fächern und Fachbereichen
6.2.3 Interne Mittelverteilung
6.2.4 Ausrichtung und Besetzung von Professuren
6.2.5 Koordination von Studiengängen und Lehrveranstaltungen
6.3 Organisationskultur
6.3.1 Kooperationskultur
6.3.2 Identifikation mit Universität und Fachbereich
6.3.3 Akademische Werte als Element der Organisationskultur
6.4 Fallgruppenvergleichende Analyse
6.4.1 Technisch-naturwissenschaftlich ausgerichtete Hochschulen und Fachbe- reiche gegenüber solchen mit sozial- und kulturwissenschaftlichem Schwerpunkt
6.4.2 Große gegenüber kleinen Universitäten
7. Fazit
Literaturverzeichnis
Anhang
Abbildungen
Abb. 2.1: Entwicklung der Studierendenzahlen an deutschen Hochschulen 1952 bis 2012
Abb. 3.1: Entwicklung der Hochschul-Governance im internationalen Vergleich - der Governance-Equalizer
Abb. 4.1: Das St. Galler Management-Modell im Hochschulkontext
Abb. 4.2: Schematische Darstellung der typischen Aufbaustrukturen von Universitäten nach Mintzberg (1983)
Abb. 4.3: Untersuchungsraster für eine organisationssoziologische Analyse von Universitäten
Abb. 5.1: Auswahlplan und Übersicht der Analyseeinheiten
Abb. 5.2: Auswahlplan der Befragten in den Hochschulen
Abb. 5.3: Auswertungsschritte der Studie und ihre Entsprechungen in der Methodenliteratur
Abb. 6.1: Betreuungsrelation (Studierende pro Professor) und Drittmittelanteil in den Hauptfächergruppen an verschiedenen Universitäten (2009)
Abb. 6.2: Die Fachbereiche im Vergleich - Drittmittelquote und Indikatoren der Kooperationskultur
Abb. 6.3: Die Fachbereiche im Vergleich - Merkmale der Strategiefähigkeit
1. Einleitung
„ Those that take account of the changes surrounding them, rather than denying their force, are more likely to sustain the values most important to them “ (Kogan et al. 2000, S. 209).
Der Bildungssektor in Deutschland ist unübersehbar in Bewegung geraten. Im Fokus von Re- formanstrengungen steht insbesondere der Hochschulbereich mit seinen mittlerweile ca. 2,4 Millionen Studierenden, mehr als 620.000 Beschäftigten und einem jährlichen Budget von mehr als 30 Milliarden Euro (Destatis 2012a und 2012b). Die Intensität der Reformen ist mindestens vergleichbar mit den Veränderungen gegen Ende der 1960er und Anfang der 1970er Jahre, wenn nicht gar mit den Humboldt’schen Hochschulreformen zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Neben der Neugestaltung der Studienstruktur im Zuge des Bologna-Prozesses erfolgt eine weitreichende Reform der Steuerungs- und Organisationsstrukturen. Das von den Prinzipien des New Public Management inspirierte „Neue Steuerungsmodell“ soll zusätzliche Leistungspotenziale heben und eine bessere Verbindung der hochschulischen Praxis mit ande- ren gesellschaftlichen Teilbereichen gewährleisten.
Über die Folgen der entsprechenden Reformen bestehen kontroverse Ansichten. So beklagt etwa Münch (2011) die Dominanz ökonomischer Verwertungsinteressen sowie die Bildung von Wissenschaftskartellen und -monopolen, die originär wissenschaftliche Koordinationsund Selektionsmechanismen überlagere: „Am Ende steht ein stratifiziertes Feld, in dem die innere akademische Freiheit und die balancierte Verflechtung der Wissenschaft mit der Außenwelt so weit in Mitleidenschaft gezogen werden, dass die Evolution des wissenschaftlichen Wissens eine erhebliche Engführung erfährt, so wie dessen Transfer in die Praxis und dessen Verbreitung in die Öffentlichkeit äußeren Interessen unterworfen werden“ (Münch 2011, S. 23). Kaube (2009) stellt fest: „Den Schaden der Reform und ihrer Illusionen haben die Studierenden so sehr wie die Wissenschaft“ (S. 13).
Diesen skeptischen Einschätzungen stehen die Visionen der Befürworter der aktuellen Re- formen entgegen. Neave und van Vught (1991) ziehen in ihren Erörterungen zum Verhältnis von Hochschulen und Staat Parallelen zur Situation des antiken Prometheus, der von Zeus an einen Felsen im Kaukasus gefesselt worden war1. Die aktuelle Reform der Universitätssteue- rung ist für sie ein Versuch, die Hochschule aus dieser prekären Lage zu befreien. Die Hoff- nungen auf eine „entfesselte Hochschule“ (Müller-Böling 2000) gründen ganz zentral auf einer Stärkung der Hochschulautonomie bei gleichzeitig ausgebauter organisationaler Selbststeuerung nach Managementprinzipien. Der Stifterverband für die deutsche Wissenschaft erwartet von einer deregulierten, autonomen Hochschule eine ganze Reihe von positiven Effekten wie wissenschaftsnahe, bedarfsgerechte und schnellere Entscheidungen und Prozesse, mehr Flexibilität, Kosteneffizienz und Marktberücksichtigung, eine stärkere Profilentwicklung und mehr Wettbewerb (Stifterverband 2008a, S. 11).
Insgesamt ist festzustellen, dass die Bewertungen der aktuellen Hochschulreformen bisher stark auf Hoffnungen und Befürchtungen beruhen und weniger auf systematisch gesammel- ten, empirisch belegten Fakten2. Kritik fußt im Wesentlichen auf zwei Ursachenkomplexen:
Erstens erfüllen Universitäten heute eine ganze Reihe von gesellschaftlichen Funktionen. Sie sollen Wissenschaft und Künste pflegen, sozialen Fortschritt und Wandel durch Wissenspro- duktion und -vermittlung begünstigen, zur Persönlichkeitsentfaltung der Lernenden beitragen und damit Lebenschancen zuteilen sowie nicht zuletzt weitere wirtschaftliche Prosperität er- möglichen. Diese verschiedenen gesellschaftlichen Funktionen unterliegen unterschiedlichen Logiken und sind mit unterschiedlichen Werthaltungen verbunden. Für deren Widersprüch- lichkeit lassen sich viele Beispiele finden. Prominent ist sicher der Gegensatz von ökonomi- scher Rationalität und Bildungsidealen. So konstatiert der damalige Bundespräsident Rau:
„ Manche sind versucht, erfolgreiche Antriebskräfte der Wirtschaft auf alle Lebensbereiche zuübertragen und sie zum einzigen Maßstab zu machen. Ich halte das für falsch. Die Gesell- schaft, in der nur noch die Gesetze von Konkurrenz, Wettbewerb und wirtschaftlichem Erfolg gelten, wäre nach meinerüberzeugung keine humane Gesellschaft. Bildung ist zuallererst ein Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung “ (Rau 1997, o. S.). Solche Widersprüche und die da- mit einhergehenden widerstreitenden Interessen gesellschaftlicher Akteure müssen in Univer- sitäten immer wieder neu gewichtet und ausbalanciert werden. Dies betrifft die tägliche Praxis der Forschung und Lehre gleichermaßen wie auch die Organisation und Steuerung von Hoch- schulen. Die derzeit stattfindende Reform kann vor diesem Hintergrund als Verschiebung von Prioritäten verstanden werden. Ob damit ein neues, tragfähiges Arrangement der für Universi- täten typischen Pluralität von Anforderungen erreicht wurde, ist umstritten.
Ein zweiter wesentlicher Ausgangspunkt für die Kritik an der Hochschulreform besteht in einem ausgeprägten Reform- und Steuerungspessimismus. Theoretische Erwägungen und eine Vielzahl von empirischen Belegen zeigen umfangreiche Beschränkungen rationaler Steuerung auf. In der Politikwissenschaft und der Soziologie sind in der Folge vermehrt Positionen kon- sensfähig geworden, die „in quasi axiomatischer Skepsis gegenüber der Möglichkeit tiefgrei- fender und umfassender Institutionenreformen konvergierten. Ihre unmissverständliche Bot- schaft erlaubt es, von einem Negativparadigma der Unmöglichkeit holistischer Reformen zu sprechen“ (Wiesenthal 2003, S. 31). So betont Luhmann (1987) auf Basis der Beschreibung unterschiedlicher Steuerungs- und Entwicklungslogiken die grundlegende Vergeblichkeit von Steuerungsbemühungen im Hinblick auf Forschung und Lehre: „Gerade weil man im organi- sierten Entscheidungsprozeß nicht an das tatsächliche Verhalten in Forschung und Lehre her- ankommt, entsteht eine Bürokratie, die ihre eigenen Formen pflegt, diversifiziert, kontrolliert und in immer neuen Weisen auf ihr Unvermögen reagiert, den Funktionsprozess selbst zu steuern. Dieses Unvermögen, das konkrete Verhalten wirklich nach erfolgreich/erfolglos zu sortieren, wirkt wie eine Barriere, vor der sich immer neue gutgemeinte Impulse aufstauen. Generation für Generation [...] lädt hier ihre Hoffnungen ab. So türmen sich an dieser Stelle Regelungen auf Regelungen, Verbesserungen auf Verbesserungen, und all das wirkt wie ein massiver undurchdringlicher Panzer, der Lehre und Forschung um so mehr der individuellen Praxis überlässt“ (Luhmann 1987, S. 213f.). Auch eine ganze Reihe anderer Wissenschaftler stellt die rationale Steuerbarkeit und damit die ebenfalls planvolle Reformierbarkeit des Wis- senschaftsbetriebs grundlegend in Frage. Beispielhaft seien an dieser Stelle Cohen, March und Olsen genannt, die Universitäten aus entscheidungstheoretischer Perspektive als Paradebei- spiel einer „organized anarchy“ beschreiben (Cohen et al. 1972).
Diesem grundlegenden Steuerungs- und Reformpessimismus gilt es entgegenzuhalten, dass es für den Organisationsforscher3 zu den Grunderfahrungen gehört, „dass man in Organisationen - trotz eines oft und gerne vermittelten Eindrucks der Wohlgeordnetheit und bürokratischer Routine - auf ein ‚ganz normales Chaos‘ trifft, das es zu erklären und eventuell zu bändigen gilt“ (Preisendörfer 2008, S. 12f.). Die Organisationsforschung geht wie die Soziologie und Ökonomie insgesamt davon aus, dass innerhalb dieses Chaos „die Menschen im Kern weitge- hend ähnlich ‚gestrickt‘ sind und dass es mithin entscheidend auf die jeweiligen Restriktionen und ‚Constraints‘ bzw. auf die Gelegenheiten und Opportunitäten ankommt, wenn man Ver- halten und Verhaltensabläufe erklären und/oder beeinflussen will“ (Preisendörfer 2008, S. 16f.). Steuerungsbemühungen sowie unterschiedliche organisationale Designs und die mit ihnen verbundenen handlungsbeeinflussenden Bedingungen können sehr wohl einen durchaus gewichtigen Unterschied machen. Den Steuerungs-Skeptikern lässt sich entgegenhalten, dass eine starke Fokussierung auf Defizite und Beschränkungen rationaler Steuerung mitunter zu einer Verengung der Perspektive und damit zu einer übertrieben pessimistischen Sicht führt. Entsprechende Extrempositionen werden nicht zuletzt durch die real schließlich doch stattfindende koordinierte Leistungserbringung und mitunter auch durch erfolgreiche Reform- und Restrukturierungsbemühungen widerlegt.
Angesichts der vorliegenden wissenschaftlichen Erkenntnisse und der Erfahrungen mit vielen gescheiterten Reform- und Restrukturierungsbemühungen sollten jedoch allzu hoffnungsfrohe Steuerungsoptimisten die Widerständigkeit von Individuen und sozialen Institutionen gegen- über ihrer zielgerichteten Beeinflussung nicht unterschätzen. Dies gilt, wie zu zeigen sein wird, in besonderem Maße für Universitäten und die darin beschäftigten Wissenschaftler. Der amerikanische Organisationsforscher und Hochschulpräsident Kerr schätzt, dass unter den 85 Institutionen der westlichen Welt, die seit 1520 in ähnlicher Form, mit ähnlichen Funktionen und mit ununterbrochener Geschichte existieren, neben der katholischen Kirche, dem engli- schen und isländischen Parlament und einigen Schweizer Kantonen auch 70 Universitäten zu finden sind (Kerr 1982, S. 152). Universitäten besaßen und besitzen eine erstaunliche Fähig- keit, ihre Existenz in unterschiedlichen gesellschaftlichen Zusammenhängen und Umständen zu legitimieren und zu erhalten. Zweifellos haben sich seit dem Beginn der Neuzeit einige wesentliche organisatorische Arrangements von Universitäten verändert, bspw. im Hinblick auf Größe und Fächerspektrum, das Anstellungsverhältnis von Wissenschaftlern oder die Freiheit der Wissenschaft. Ohne eine gewisse Wandlungsfähigkeit hätte die Universität wohl kaum zu einem solchen Erfolgsmodell werden können. Dennoch gilt: „One must be impressed with the endurance and the quiet power of the professoriate, and particularly the senior pro- fessors, to get their way in the long run - and that way at all times and in all places is mostly the preservation of the status quo in terms of governance and finance“ (Kerr 1987, S. 186)4.
Dieser Arbeit soll weder ein grundlegender Steuerungspessimismus noch eine naive Steue- rungseuphorie zu Grunde liegen. Die grundlegende Haltung - und um eine solche kommt trotz aller gebotenen Neutralität und Nüchternheit wohl kein Wissenschaftler bei der Wahl seiner Perspektive herum - könnte vielmehr als verhaltener oder informierter Steuerungsop- timismus beschrieben werden. Vorgehen, Fragen und Methodik der vorliegenden Arbeit be- ruhen auf der Annahme, dass die Steuerungsakteure in Hochschulen sehr wohl die Fähigkeit besitzen, den Handlungskontext der Wissenschaftler in gewissem Umfang zu prägen.
Die wissenschaftliche Analyse von Veränderungen in der Regulierung bzw. den Governance- Strukturen des Hochschulsektors umfasst Phänomene auf der gesellschaftlichen Makro- Ebene, auf der Meso-Ebene der Organisation sowie auf der Mikro-Ebene der einzelnen Ak- teure und ihrer Interaktionen (vgl. Luhmann 1991; Schimank 2007). Im Fokus der vorliegen- den Arbeit steht die Meso-Ebene, da hier der entscheidende Zugriffspunkt für politische Re- formen liegt. „Gestaltungsakteure aus der Politik oder aus anderen gesellschaftlichen Teilsys- temen haben weder auf der Makro- noch auf der Mikro-Ebene eine Chance, auf absehbare Zeit zielsicher auf die Leistungsproduktion (…) der Wissenschaft (…) einwirken zu können (…). Damit ist die intentionale Gestaltung von Governance-Strukturen eine ‚Kontextsteuerung‘ der Leistungsproduktion auf der Meso-Ebene“ (Schimank 2007, S. 237). Hochschulreformen sind im Wesentlichen Organisationsreformen (Enders 2008).
Die Kontrastierung mit vergangenen Reformen der Universitätsorganisation zeigt, welche Ansprüche und Logiken derzeit an Bedeutung gewinnen. Betrachtet man die letzte größere Reform in den 1960er und 1970er Jahren, so werden zunächst gewisse Gemeinsamkeiten deutlich. Damals wie heute war und ist der Wunsch nach einer Steigerung der Leistungsfä- higkeit des Bildungssystems zur Steigerung der gesamtwirtschaftlichen Leistung ein zentraler Hintergrund der Reformen im Bildungsbereich5. War die damalige Reform zusätzlich noch mit dem Impetus der Demokratisierung der Bildungsinstitutionen verbunden, so steht heute neben einer gesteigerten Effektivität insbesondere der Wunsch nach mehr Effizienz in For- schung und Lehre im Vordergrund (vgl. Amaral et al. 2003). Anstatt die Leistungsfähigkeit bzw. den Output des Bildungssektors, wie naheliegend, durch zusätzliche finanzielle Zuwei- sungen zu steigern, gerät insbesondere eine Reform der Steuerungs- und Organisationsstruk- turen von Bildungseinrichtungen in den Blick. Eine solche Reform ist durch das Versprechen von mehr Leistung auch bei gleichem oder sogar weniger Ressourcenaufwand aus politischer Sicht besonders interessant.
Ein weiteres Motiv der aktuellen Reformbemühungen liegt in einer verstärkten Einbindung der universitären Wissensproduktion und Vermittlung in wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusammenhänge. Bildlich gesprochen besteht die feste Absicht, den sogenannten „Elfenbein- turm“ mit zusätzlichen Türen zu versehen. Auch hier bieten Organisations- und Steuerungs- strukturen wesentliche Zugriffspunkte politischer Reformbemühungen. Die im Zuge der Ent- wicklung zur sogenannten Wissensgesellschaft stattfindende Verwissenschaftlichung von Ökonomie und Politik (vgl. Gibbons et al. 1994) bleibt, wie zu zeigen sein wird, nicht ohne Folgen für die Wissenschaft selbst.
Eine wichtige Zäsur auf dem Weg zu einem Neuen Steuerungsmodell im Hochschulsektor war die Deregulierung der zuvor bundeseinheitlich geregelten Steuerungs- und Organisations- strukturen durch die Novelle des Hochschulrahmengesetzes 1998. Seither wurden in den Bundesländern unterschiedliche Gesetzesvorhaben und Regulierungsmuster umgesetzt, die jedoch alle eine ähnliche Stoßrichtung aufweisen (vgl. Kehm und Lanzendorf 2007a).
Das Neue Steuerungsmodell wird wegen seiner Anlehnung an betriebswirtschaftliche Prakti- ken der Unternehmensführung und aufgrund des sich ändernden Aufgabenspektrums der Steuerungsakteure in den Hochschulen auch als „Managementmodell“ bezeichnet (Braun und Merrien 1999). Universitäten erhalten im Managementmodell eine größere Steuerungs- und Organisationsautonomie, die sie mit Hilfe neu geordneter Verantwortlichkeiten, Entschei- dungs-, Kontroll- und Anreiz-Strukturen zu einer rationaleren, d.h. effektiveren und effizien- teren Steuerung der Aktivitäten in Forschung und Lehre nutzen sollen. Gleichzeitig wird durch Zielvereinbarungen und externe Kontrollorgane ein Rahmen geschaffen, der die Quali- tät wissenschaftlicher Angebote und Leistungen kontrollieren und sichern soll. Darüber hin- aus werden Anreize für einen verstärkten Wettbewerb der Hochschulen untereinander sowie eine stärke Anbindung an wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedarfe gesetzt. Bei der Ver- wirklichung des Neuen Steuerungsmodells geht es ebenso um eine Änderung des Verhältnis- ses von Staat und Hochschulen wie auch um eine Reorganisation der universitätsinternen Steuerungs- und Organisationsstrukturen.
Die Erkenntnisse zu den Inhalten und zur Umsetzung der Hochschulreformen korrespondie- ren mit den Beobachtungen der neo-institutionalistischen Organisations- und Hochschulfor- schung bezüglich eines Wandels des organisationalen Charakters von Hochschulen. So stellen Brunsson und Sahlin-Andersson (2000) fest, dass sich die Universitäten aktuell weltweit hin zu „more complete organizations“ wandeln; Krücken und Meier (2006) diagnostizieren eine Transformation hin zu „organizational actors“. Entsprechende Leitbilder der Hochschulorga- nisation betonen eine Stärkung der zentralen Koordination auf Organisationsebene und stehen damit im klaren Kontrast zum klassischen Organisationsmodell der Universität als fragmen- tierte Organisation mit geringem Einfluss der zentralen Leitung. Krücken und Meier (2006) halten fest: „The ‚organizational turn‘ in higher education is by no means a trivial process as universities traditionally were not concieved as important decision-making entities in their own rights“ (S. 241). Die von politischer Seite erfolgte Stärkung der Hochschulautonomie einerseits und der von den Hochschulen erwartete Ausbau ihrer Fähigkeiten zur organisationalen Selbststeuerung andererseits sind eng miteinander verbunden und liegen im Zentrum des aktuellen institutionellen Wandels in Kontinentaleuropa und anderen vergleichbaren Ländern (vgl. Enders et al. 2007, S. 16f.). „University change in Europe at the end of the twentieth century and arguably elsewhere in the world, centers on the development of selfregulating universities, places that actively seek out stronger means to become and remain competent societal institutions“ (Clark 2003a, S. XVI).
Betrachtet man die Reformschritte im Zusammenhang, wird deutlich, dass ihre Wirkung in hohem Maße davon abhängt, inwieweit es den Universitäten gelingt, die neu gewonnenen, vormals staatlichen Regulierungskompetenzen in zielführende und effiziente Selbststeuerung umzusetzen. Die universitäre Selbststeuerung soll Effizienz- und Leistungspotenziale heben und kann somit als ein zentraler konzeptioneller Fluchtpunkt der aktuellen Reformen betrach- tet werden.
Gleichzeitig gilt, dass jenseits von Einzelbefunden zu bestimmten Reforminitiativen bisher relativ wenig systematisches Wissen bezüglich der konkreten Umsetzung der aktuellen Re- formen in deutschen Universitäten vorliegt. „Über den Stand der Implementation neuer Steue- rungsmodelle in Hochschulen und deren Auswirkungen besteht bisher (…) noch weitgehende Unklarheit“ (Bogumil et al. 2007, S. 5; ähnlich Hüther 2010, S. 449). Im Rahmen der Implementationsforschung ist seit langem bekannt, dass die Umsetzung politischer Reformen auf Organisationsebene keineswegs als lineare Weiterführung der politischen Intentionen ver- standen werden kann (grundlegend Pressman und Wildavsky 1974). Vielmehr besteht eine große Bandbreite an möglichen Entwicklungen bzw. Nicht-Entwicklungen.
Vor diesem Hintergrund werden im Rahmen der vorliegenden Untersuchung drei zentrale Forschungsfragen verfolgt:
I. Inwieweit findet in den deutschen Universitäten tatsächlich ein Ausbau der organisatio- nalen Selbststeuerung statt? Welche charakteristischen Veränderungen der sozialen Ordnung auf Organisationsebene lassen sich beobachten?
II. Welche internen und externen Faktoren prägen den organisationalen Wandel? Wie ist die spezifische Ausgestaltung der organisationalen Selbststeuerung in den unterschiedlichen Hochschulen zu erklären?
III. Welche Folgen des organisationalen Wandels sind zu beobachten und zu erwarten? Sind die Universitäten durch einen Ausbau der organisationalen Selbststeuerung besser in der Lage, aktuellen Umweltanforderungen zu genügen?
Empirisch umgesetzt wird die vorliegende Untersuchung im Rahmen einer vergleichenden Fallstudie an sechs deutschen Universitäten6. Die Wahl dieses Forschungszugangs hat drei wesentliche Gründe:
Erstens besteht der Vorteil eines qualitativen Forschungszugangs gegenüber stärker quantifizierenden Forschungsmethoden, bspw. standardisierten Umfragen, in der Flexibilität der Da tenerhebung sowie der Realitätsnähe und einem größeren Detailreichtum der Forschungser gebnisse. Fallstudien sind besonders geeignet, um eine detaillierte Beschreibung und daran anschließend eine gegenstandsangemessene Begriffsbildung in bisher wenig erforschten Sozialzusammenhängen zu ermöglichen.
Zweitens sind Fallstudien in besonderer Weise geeignet, um Ursache- und Wirkungsbezie- hungen zu verstehen. Ein entsprechendes methodisches Vorgehen erlaubt die Integration einer Mehrzahl von theoretischen Perspektiven, so dass sich ein holistisches und vertieftes Ver- ständnis des Phänomens der Hochschulsteuerung entwickeln lässt. Auch wenn Fallstudien eher dem interpretativen Paradigma der Sozialforschung zuzuordnen sind, d.h. tendenziell eine induktive Forschungsstrategie nahelegen, wird im Rahmen der vorliegenden Arbeit Wert darauf gelegt, Forschungsperspektive und Fragestellungen aus dem bisherigen Kenntnisstand der Hochschulforschung und der allgemeinen Organisationsforschung abzuleiten.
Den dargelegten Vorteilen der Fallstudienmethode steht unweigerlich der methodische Nachteil gegenüber, dass die vorliegende Studie keine Aussage über die statistische Repräsentativität der Befunde ermöglicht. Dieser Umstand wird jedoch in bewusst in Kauf genommen7. Fallstudien zielen nicht auf statistische Generalisierbarkeit sondern auf logisches Verständnis bzw. theoretische Generalisierbarkeit (Eisenhardt 1989, S. 535; Yin 2009, S. 15).
Ein dritter wesentlicher Vorteil der Fallstudienmethode liegt in der Möglichkeit, die aktuellen Reformen in ihrer Breite integrativ zu betrachten. Fallstudien bieten die Chance, die interes- sierenden Phänomene in ihrem Kontext zu beobachten (Yin 2003). Gerade für die Umsetzung der aktuellen Steuerungsreformen im Bildungswesen gilt, dass die einschlägigen Vorgänge und Maßnahmen trotz einer gemeinsamen Stoßrichtung durchaus vielschichtig sind und mit- einander in Wechselbeziehungen stehen. So weist etwa Bogumil (2007) im Anschluss an sei- ne Untersuchung von Hochschulräten darauf hin, dass ein erweitertes und vertieftes Ver- ständnis der aktuellen Reformen eine Zusammenschau der einzelnen Maßnahmen voraussetzt. „Hochschulräte stellen lediglich ein Element der Steuerung von Hochschulen dar. Will man die Wirkung dieser beurteilen, so sind sie in der Zusammenschau mit den anderen Elementen wie der Stärkung der Leitungsebene, dem zunehmenden Vordringen leistungsorientierter Mit- telverteilungen und der Stärkung von Wettbewerbselementen zwischen und in den Hochschu- len zu betrachten“ (Bogumil et al. 2007, S. 5). Das Untersuchungsdesign der vorliegenden Studie erlaubt die Betrachtung des Zusammenspiels der einzelnen Reformelemente. Eine sol- che integrative Sicht ist außerdem wertvoll, um die Bedeutung der einzelnen Entwicklungen angemessen einordnen, also Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden zu können (Aljets und Lettkemann 2012, S. 132).
Um den Wandel der Universitätsorganisation zu verstehen, ist es sinnvoll, sich die Ursachen zu vergegenwärtigen, die zu den aktuellen Reformen geführt haben. Wie in Kapitel 2 gezeigt wird, hat sich in den letzten Jahrzehnten eine wachsende Diskrepanz ergeben, zwischen sich verändernden Umweltanforderungen einerseits und einer mangelnden Anpassungsfähigkeit der Hochschulen andererseits. Die entsprechenden Betrachtungen nehmen im Rahmen des vorliegenden Textes relativ viel Raum ein, da, wie neuere Ansätze der Organisationsfor- schung betonen, die Analyse der Organisationsumwelt wichtige Erkenntnisse liefert, um die Ausgestaltung und den Wandel von Organisationen zu verstehen. Darüber hinaus bietet die Erörterung der Reformursachen eine Grundlage für die Bewertung der Effekte des organisa- tionalen Wandels. Ob organisationaler Wandel eine Verbesserung der Leistungsfähigkeit mit sich bringt, ist ohne Analyse der relevanten Umweltansprüche kaum abzuschätzen.
Kapitel 3 ist der Beschreibung der grundlegenden Trends der Hochschulreformen in Deutschland gewidmet. Wie zu zeigen sein wird, bestehen die aktuellen Reformen aus einer Reihe von Einzelmaßnahmen, die sich trotz zum Teil erheblicher bundeslandspezifischer Unterschiede im Ablauf der Reformen zu einem idealtypischen Gesamtbild des Neuen Steuerungsmodells verdichten lassen.
In Kapitel 4 wird der Begriff der organisationalen Selbststeuerung zunächst näher definiert und anschließend operationalisiert. Ausgangspunkt der Operationalisierung ist das St. Galler Management-Modell, ein Ansatz der systemischen Managementforschung, der es erlaubt, die vorhandenen wissenschaftlichen Erkenntnisse zu den organisationalen Besonderheiten von Hochschulen und zu den spezifischen Bedingungen einer organisationalen Steuerung zu in- tegrieren und in einen allgemein organisationswissenschaftlichen Kontext einzubetten. Auf- bauend auf den theoretischen Erörterungen wird ein Analyseraster vorgestellt, dessen Katego- rien den Aufbau der empirischen Untersuchung strukturieren. Weiterhin werden in Kapitel 4 die wesentlichen theoretischen Erkenntnisse zur Erklärung organisationalen Wandels disku- tiert. Diese Erörterungen bilden den Ausgangspunkt für ein vertieftes Verständnis der Ursa- chen des empirisch beobachtbaren organisationalen Wandels (Forschungsfrage 2). Dem von einigen Autoren (bspw. Huisman 2009) beklagten Theoriedefizit der Hochschulforschung steht im Bereich der allgemeinen Organisationsforschung ein großer Reichtum an theoreti- schen Ansätzen gegenüber, dessen Begrifflichkeiten und Einsichten im vorliegenden Zusam- menhang selektiv genutzt werden8.
Das methodische Vorgehen der empirischen Untersuchung wird in Kapitel 5 erläutert. Es wird zunächst ausführlicher begründet, warum die Methode der vergleichenden Fallstudie in be- sonderer Weise geeignet ist, um die vorliegenden Forschungsfragen zu bearbeiten und worin die spezifischen Vorteile, aber auch Einschränkungen und typische Probleme eines solchen Vorgehens liegen. Weiterhin werden die Einzelheiten des Untersuchungsdesigns, d.h. die Auswahl und Gewinnung der Hochschulen, die verwendeten Methoden der Datenerhebung sowie das Vorgehen bei Auswertung und Dokumentation der Ergebnisse erläutert.
In Kapitel 6 erfolgt die Darstellung der empirischen Ergebnisse. Diese Darstellung ist anhand der Kategorien des Analyserasters strukturiert und nimmt einen großen Teil des vorliegenden Textes ein. Dieser Umstand reflektiert die Tatsache, dass die empirische Untersuchung im Zentrum der vorliegenden Studie steht. Ziel der inhaltlich breit angelegten Untersuchung ist es, einen umfassenden Blick auf die stattfindenden Veränderungen zu werfen und dabei insbesondere auch die Erklärungsansätze der Feldakteure im Sinne einer realitätsnahen und lebendigen Beschreibung der organisationalen Praxis aufzugreifen.
Im Schlusskapitel werden die gewonnen Erkenntnisse zusammengeführt und im Hinblick auf die zentralen Forschungsfragen diskutiert. Anknüpfungspunkte für die gewonnenen Erkennt- nisse liegen sowohl im Bereich der wissenschaftlichen Organisations- und Hochschulfor- schung als auch in der Praxis von Hochschulpolitik und -administration. Die Hochschulfor- schung ist durch ihre Gegenstandsorientierung ein sehr praxisnaher und anwendungsbezoge- ner Wissenschaftsbereich. Mitunter wird dieser Anwendungsbezug in einem unzulässigen Schluss gegen die sogenannte Grundlagenforschung ausgespielt, um entweder die Wissen- schaftlichkeit oder den praktischen Wert von Forschungsarbeit zu diskreditieren. Dass ein solcher Gegensatz inhaltlich nicht haltbar ist, hat Stokes (1997) überzeugend dargelegt. Wis- senschaftliche Anknüpfungspunkte für die Erkenntnisse der vorliegenden Arbeit ergeben sich insbesondere hinsichtlich des aktuellen Diskurses um eine Veränderung des organisationalen Charakters von Hochschulen sowie zur Erforschung von Governance, Management und orga- nisationalem Wandel in Hochschulen.
2. Universitäten unter Reformdruck - Ursachen des Wandels der Universitätssteuerung
Der gesamte europäische Hochschulsektor ist zu Beginn des 21. Jahrhunderts durch eine wachsende Diskrepanz zwischen tatsächlicher Leistungsfähigkeit der Universitäten und den Erwartungen relevanter Anspruchsgruppen (Staat, Wirtschaft, Mitarbeiter, Studierende etc.) gekennzeichnet. Dieses Ungleichgewicht von Anforderungen und Opportunitäten der Organi- sationsumwelt einerseits und Handlungs- bzw. Reaktionsfähigkeit der Universitäten anderer- seits führt zur Notwendigkeit tiefgreifender Reformen (Clark 2003b). Im Folgenden wird dar- gelegt, welche mittel- und langfristigen gesellschaftlichen Entwicklungen zur wahrgenomme- nen Reformnotwendigkeit im Hochschulwesen geführt haben. Analog zum dargelegten Un- gleichgewicht wird hierbei zwischen Veränderungen in den Ansprüchen und Opportunitäten der Organisationsumwelt (Kap. 2.1) und Problemen im Hinblick auf die Anpassungsfähigkeit der herkömmlichen Hochschulorganisation und -steuerung (Kap. 2.2) unterschieden.
2.1 Neue Anforderungen und Opportunitäten für Hochschulen
„ Wenn wir verstehen wollen, was Organisationen tun, wie erfolgreich sie sind, welche Ent scheidungen sie treffen, welche Organisationsstruktur gewählt wird und welche organisatio nalen Praktiken und Routinen sie einsetzen, dann müssen wir die Einbettung einer Organisa tion in ihre Umwelt berücksichtigen “ (Preisendörfer 2008, S. 130).
Das o.a. Zitat beschreibt den Ausgangspunkt des „open systems view“ in der Organisations- forschung und verdeutlicht beispielhaft das Interesse neuerer organisationswissenschaftlicher Ansätze an der Umwelt von Organisationen (vgl. Scott und Gerald 2007). Allgemeingültige Regeln für die Auswahl der relevanten Umweltmerkmale bei der Betrachtung einer Organisa- tion oder eines Organisationstypus bestehen bisher nicht (vgl. Kieser 2002). Die Umwelt von Organisationen ist naturgemäß ein weites Feld, insbesondere wenn ganze Sektoren oder Or- ganisationstypen und nicht einzelne Organisationen betrachtet werden. Dies gilt in besonde- rem Maße für Universitäten. Sie stehen als zentrale Einrichtungen mit sehr vielen Bereichen der Gesellschaft in Kommunikations- und Austauschbeziehungen und spiegeln gerade auch als Ausgangs- und Austragungsort gesellschaftlicher Innovationen vielfältige gesellschaftliche und kulturelle Trends.
Dementsprechend kann sicher keine der vorliegenden Zusammenstellungen von für Universi- täten relevanten gesellschaftlichen Entwicklungen (bspw. Teichler 2004; Pasternack et al. 2006) beanspruchen, alle einschlägigen Faktoren abzubilden. Dies gilt auch für die folgenden Ausführungen zu den veränderten Anforderungen und Opportunitäten für Universitäten. Nä- her betrachtet werden eine Reihe von mittel- bis langfristigen Entwicklungen, die sich zu drei Themenkomplexen verdichten lassen: Wissensgesellschaft, Globalisierung und Internationali- sierung der Wissenschaft sowie ein Wandel des Staats- und Steuerungsverständnisses.
2.1.1 Strukturwandel zur Wissensgesellschaft
„Systematisches Wissen und die Methoden seiner Erzeugung gewinnen (…) eine zentrale Funktion in modernen Gesellschaften und rechtfertigen es, diese als Wissensgesellschaften zu bezeichnen“ (Weingart 2007a, S. 35). Kern und Ausgangspunkt des Konzepts der Wissensge- sellschaft ist der für moderne Gesellschaften typische wirtschaftliche Strukturwandel (vgl. Bell 1975)9. Die beschriebenen langanhaltenden Verschiebungen der Beschäftigung zwischen unterschiedlichen Wirtschaftssektoren bestehen seit dem 19. Jahrhundert und werden durch anhaltende Prozessinnovationen und Produktivitätssteigerungen vorangetrieben. Wie Bell bereits 1975 feststellte, gehen Arbeitsmarktexperten auch heute noch davon aus, dass sich insbesondere der Bereich der wissensintensiven Dienstleistungen weiter ausdifferenziert und als wesentlicher Beschäftigungssektor der Zukunft gesehen werden kann (vgl. Willke 1999, S. 47ff.). Wissenschaftliches Wissen wird zur „Achse, um die sich die neuen Technologien, das Wirtschaftswachstum und die Schichtung der Gesellschaft organisieren“ (Bell 1975, S. 112). Gemeinsam mit dem Wandel der Produktionsweise weg vom Fordismus hin zum sogenannten Postfordismus10 und der Auslagerung geringqualifizierter Tätigkeiten in Niedriglohnländer führt der sektorale Wandel in industrialisierten Gesellschaften zu einem deutlichen Anstieg der Beschäftigung von hochqualifizierten Arbeitnehmern bei gleichzeitiger Abnahme gering- qualifizierter Beschäftigung. So hat sich die Zahl der Arbeitskräfte mit Universitäts- und Fachhochschulabschluss zwischen 1978 und 1999 von etwa 2 Millionen auf ca. 4,7 Millionen mehr als verdoppelt (BLK 2002, S. 25ff.). Prognosen der Arbeitsmarktentwicklung bis 2020 gehen von einem weiterhin deutlich wachsenden Bedarf des deutschen Arbeitsmarktes an hochqualifizierten Arbeitskräften aus (BLK 2002; Meyer und Wolter 2005; Reinberg und Hummel 2002; Foders 2000).
Für die Universitäten ist die Entwicklung hin zur Wissensgesellschaft mit einer ganzen Reihe von neuen Herausforderungen verbunden. Die wichtigsten Entwicklungen lassen sich zu drei Kontexten zusammenfassen: erstens die Bildungsexpansion, zweitens ein Wandel der Wis- sensproduktion und drittens ein zunehmendes Wachstum und eine erhöhte Dynamik der Wis- sensbestände.
Die Bildungsexpansion führt dazu, dass die Hochschulen in Deutschland ein deutlich erweitertes und stärker differenziertes Ausbildungsangebot für eine enorm angewachsene Zahl von Studierenden bereitstellen müssen. Waren im Wintersemester 1952/53 an deutschen Hochschulen noch weniger als 90.000 Studierende eingeschrieben, so waren es im Wintersemester 2012/13 knapp 2,5 Millionen; davon nahezu 1,7 Millionen an Universitäten und gleichgestellten Hochschulen (siehe Abb. 2.1).
Abb. 2.1: Entwicklung der Studierendenzahlen an deutschen Hochschulen 1952 bis 201211
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
* Bis zum WS 1989/90 Westdeutschland, danach Gesamtdeutschland
Quelle: Destatis 2013.
Für die Entwicklung bis 2020 geht die Kultusministerkonferenz von einer weiterhin steigen- den Zahl an Studienanfängern aus (KMK 2005). Erwartet wird ein Zuwachs von ca. 20 Pro- zent gegenüber dem Jahr 200412. Zum Vergleich: Zu Humboldts Zeiten, Anfang des 19. Jahr- hunderts, als wesentliche Voraussetzungen für die institutionelle Gestaltung des heutigen Hochschulwesens gelegt wurden, gab es in Preußen 5000 Studierende (Engels 2001, S. 28).
Angesichts des großen Andrangs der Studierenden, der oftmals nur bedingt mit zusätzlichen Einnahmen verbunden ist, erhält man an vielen Universitäten den Eindruck, dass ein weiteres Ansteigen der Studierendenzahlen eher befürchtet als erhofft wird (vgl. Stifterverband 2008b, S. 13ff.). Wachsende Lehrbelastung, vielfach als unzureichend erfahrene Studienbedingungen sowie eine hohe Zahl zulassungsbeschränkter Studiengänge - 2006 mehr als 50% - sind sichtbares Ergebnis dieser Entwicklung (Bargel et al. 2008).
Neben der enorm gewachsenen Anzahl stellt auch die wachsende Heterogenität der Studierendenschaft im Hinblick auf Alter, Vorwissen, sozio-kulturellen Hintergrund und Bildungsziele die Universitäten vor Herausforderungen. Ursachen für diese Entwicklung sind die - trotz weiterhin herkunftsspezifisch stark unterschiedlicher Bildungschancen - wachsende soziale Heterogenität der klassischen Klientel der Abiturienten, der Ausbau der universitären Weiterbildung13, die wachsende Internationalisierung der Studierendenschaft, die Pluralisierung von Erwerbs- und Bildungsbiographien oder in jüngster Zeit auch die geplante stärkere Öffnung der Universitäten für Berufstätige ohne Abitur14.
Als zweiter wesentlicher Trend im Rahmen der Wissensgesellschaft wird ein Wandel der Wissensproduktion beschrieben. Dieser Trend führt vor allem zu veränderten Anforderungen an die universitäre Forschung. Die Kernthese lautet, dass die im Zuge der verstärkten Wissensbasierung von Ökonomie und Politik nachgefragte Wissensproduktion sich von klas- sischer universitärer Wissenschaft durch ihre starke Kontext- und Problembezogenheit unter- scheidet und dass die Universitäten bei der Produktion dieses Wissens mit einer ganzen Reihe weiterer Wissensproduzenten, bspw. in Fachhochschulen, Unternehmen und Think Tanks, konkurrieren. „By contrast with traditional knowledge, which we will call Mode 1, generated within a disciplinary, primarily cognitive, context, Mode 2 knowledge is created in broader transdisciplinary social and economic contexts“ (Gibbons et al. 1994, S. 1).
Die von Gibbons et al. aufgestellten Thesen sind im Hinblick auf ihre geringe empirische Ba- sis und die teilweise überzogenen Schlussfolgerungen vielfach kritisiert worden (vgl. Etzkowitz und Leydesdorf 2000; Rip 2002). Nichtsdestotrotz bleibt die Kernthese instruktiv im Hinblick die Anforderungen und Chancen, die sich für Universitäten im Rahmen der Wis- sensgesellschaft ergeben. Der steigende gesellschaftliche Bedarf an systematisch gesammel- tem Wissen ist für die Universitäten nicht uneingeschränkt und direkt von Vorteil. Wollen Universitäten entsprechende Potenziale nutzen, müssen sie sich gegen außeruniversitäre Kon- kurrenz durchsetzen und es werden ihnen gewisse Anpassungsleistungen im Hinblick auf Problemorientierung und Kontextspezifität der Forschung abverlangt. „The needed institu- tional experiments and transformations will make them [the universities] different institutions. However if they do not develop in that direction they will be passed by other knowledge pro- duction organisations“ (Gibbons et al. 1994, S. 88f.; ähnlich Scott 1998).
Die Verwissenschaftlichung von Politik und Ökonomie bleibt also nicht ohne Folgen für die Wissenschaft selbst. Gerät die Produktion wissenschaftlichen Wissens zunehmend unter den Einfluss wirtschaftlicher und politischer Interessen und Logiken, so droht eine Ökonomisierung und Politisierung der Wissenschaft. Eine solche Entwicklung ist nicht un- problematisch für das universitäre und akademische Selbstverständnis, insbesondere für die professionellen Gebote der wissenschaftlichen Unabhängigkeit und Redlichkeit (vgl. Weingart 2007b, S. 234ff.).
Als dritter bedeutsamer Trend im Rahmen der Wissensgesellschaft ist das zunehmende Wachstum bzw. die zunehmende Dynamik der Wissensbestände zu nennen. Waren bspw. an der Erstellung der ersten Ausgabe des Universalnachschlagewerkes „Enzyclopedia Britannica“ 1759 nur ein oder zwei Gelehrte beteiligt, „die noch imstande waren, das gesamte menschliche Wissen zu überschauen“ (Bell, 1975, S. 180), so wurde bei der dritten Auflage erstmals der Plan gefasst, Spezialisten hinzuzuziehen. An der Ausgabe von 1967 wirkten be- reits 10.000 anerkannte Experten mit (ebd.). Auch aktuell nimmt die Menge und Komplexität des verfügbaren Wissens stetig weiter zu. Heute arbeiten weltweit mehr Wissenschaftler als in allen vorangegangenen Generationen zusammengenommen (Rothschild 1994, S. 122). Mo- derne Kommunikationsmedien und die Internationalisierung der Wissenschaft tragen dazu bei, Wissensbestände aus aller Welt zu speichern und verfügbar zu machen. Die hinsichtlich des Wandels der Wissensproduktion beschriebene Pluralisierung von Wissensformen, Wis- sensakteuren und Orten der Wissensproduktion treibt das Anwachsen der Wissensbestände ebenfalls weiter voran (Wehling 2003, S. 119ff.).
Das rapide Anwachsen der Wissensbestände lässt den universitären Anspruch auf Universalität, d.h. ein möglichst vollständiges Fächerangebot, bereits seit einiger Zeit unrealistisch erscheinen. Die Dynamik der Wissenserzeugung fordert von Universitäten nicht nur wachsende Leistungsfähigkeit und Spezialisierung, sie ist auch mit einem hohen Maß an Unvorhersehbarkeit und Wandel verbunden, dem die Universitäten ihrerseits durch erhöhte organisationsstrukturelle und -kulturelle Wandelbarkeit und Flexibilität begegnen müssen.
2.1.2 Globalisierung und Internationalisierung der Wissenschaft
In der Hochschulforschung werden die Begriffe Globalisierung und Internationalisierung oftmals synonym verwendet (Engels 2006, S. 115f.). In der Verwendung beider Begrifflichkeiten gibt es jedoch gewisse Unterschiede. „Internationalisierung wird gewöhnlich in Zusammenhang mit physischer Mobilität, wissenschaftlicher Kooperation, wissenschaftlichen Traditionen des Wissenstransfers und internationalem Lernen angesprochen“ (Teichler 2007, S. 10). Auch die Europäisierung kann als ein Aspekt der Internationalisierung betrachtet werden. Das Konzept der Globalisierung als primär politischer Begriff (vgl. Scherrer 2000) umfasst hingegen vor allem die Zunahme des Wettbewerbs der Hochschulsysteme und Universitäten sowie die Diffusion neuer Leitbilder erfolgreicher Organisation.
Internationale Mobilität von Personen und Austausch von Inhalten gehören seit Jahrhunderten zu den Kennzeichen universitärer Wissenschaft. Bereits die mittelalterlichen Universitäten der westlichen Welt können aufgrund ihrer gemeinsamen Sprache (Latein) und den bereits in Tei- len international rekrutierten Studierenden und Professoren sowie großen gemeinsamen Wis- sensbeständen als „global institutions“ bezeichnet werden (Altbach 2004, S. 4). Kosmopoliti- sche Werte sind in der Wissenschaft seit langem verbreitet und viele Einrichtungen weisen eine lange Tradition der internationalen Vernetzung auf. Trotzdem kommen Hochschulfor- scher zu dem Schluss, dass seit etwa zwei Jahrzehnten „qualitative Sprünge“ in der Interna- tionalisierung der deutschen Hochschulen zu verzeichnen sind (Teichler 2007, S. 12). „Inter- nationalität ist für das Hochschulleben nicht mehr marginal, sondern sie betrifft alle Aufga- benbereiche“ (ebd., S. 9). Dementsprechend wird die Internationalisierung von Hochschulsys- temen und einzelnen Hochschulen in zunehmendem Maße strategisch betrieben (Kehm und Teichler 2007, S. 263f.). Hierbei fehlt allerdings den Universitäten, im Gegensatz zu den au- ßeruniversitären Forschungseinrichtungen, meist die Führungs- bzw. Managementebene, „die in der Lage ist, Strategien für das gesamte Institut zu entwickeln und durch entsprechende Anreize auch umzusetzen“ (Engels 2006, S. 127).
Transnationale Forschungskooperationen gelten als Hauptindikator der Internationalisierung der Forschung (Engels 2006, S. 118). Einschlägige Betrachtungen zeigen eine ausgesprochen große Varianz der Internationalisierung der Forschung zwischen Ländern und Disziplinen15. Bspw. weisen große Länder typischerweise einen geringeren Anteil internationaler Publikati- onen auf als kleine (Luukkonen et al. 1992). Gleichermaßen weist etwa die Biologie als Dis- ziplin einen wesentlich geringeren Anteil an internationalen Publikationen auf als das umfas- sende Forschungsgebiet der Erd- und Atmosphärenforschung (National Science Board 2004). In noch geringerem Maße internationalisiert sind Publikationen in vielen Bereichen der Geis- tes- und Sozialwissenschaften, da diese zum Teil sehr eng verknüpft sind mit nationalstaatlich umgrenzten Forschungsgegenständen oder nationalen Kulturräumen.
Im Bereich der Lehre kann die Mobilität von Studierenden als Hauptindikator der Internationalisierung gelten16. Auch wenn die Datenlage zur internationalen Studierendenmobilität insgesamt verbesserungswürdig ist, lassen sich gewisse grundlegende Trends zuverlässig erfassen. Seit den 1970er Jahren ist ein beachtliches Wachstum der Zahl ausländischer Studierender zu verzeichnen. Studierten 1975 noch ca. 0,6 Millionen Menschen im Ausland, so waren es Mitte der 1990er Jahre bereits mehr als 1,5 Millionen und 2006 ca. 2,9 Millionen17. Das Wachstum der Studierendenmobilität hat sich insbesondere seit Beginn des 21. Jahrhunderts deutlich beschleunigt (OECD 2008, S. 352).
Die wichtigsten Zielländer ausländischer Studierender 2006 waren die USA (mit 20% aller ausländischen Studierenden), das Vereinigte Königreich (11%), Deutschland (9%) und Frank- reich (8%)18. Betrachtet man allerdings den Anteil der ausländischen Studierenden an allen Studierenden in den Hauptzielländern, so zeigt sich ein deutlich anderes Bild. Während in Australien 18% und in Großbritannien 14% der Studierenden eine fremde Staatsbürgerschaft besitzen, sind es in den USA oder Japan nur ca. 3,5 bzw. 3% (OECD 2008, S. 348). In Deutschland besaßen 2005 ca. 12% aller Studierenden eine ausländische Staatsbürgerschaft19 (DAAD 2009).
Betrachtet man die Attraktivität einzelner Zielländer im Zeitverlauf, so zeigt sich eine deutlich abnehmende Dominanz der Internationalisierung der Hochschulen durch die USA. Neben den USA bilden sich offenbar insbesondere in Europa und Asien neue international attraktive Zentren heraus (OECD 2008, S. 348ff.). Die Attraktivität Deutschlands als Zielland ausländi- scher Studierender ist gemessen am Anteil aller ausländischen Studierenden seit den 1970er Jahren bis heute relativ stabil. Ausländische Studierende an deutschen Hochschulen stammen vor allem aus anderen europäischen Ländern (ca. 50%) und Asien (ca. 37%) (DAAD 2009).
Die Internationalisierung deutscher Universitäten ist im Hinblick auf die Studierenden bis hin zu Doktoranden und Postdoktoranden, gerade auch durch den innereuropäischen Austausch, recht ausgeprägt. Bei den etablierten Wissenschaftlern hingegen bestehen offenbar noch deutliche Mobilitätshindernisse. 2008 waren in Deutschland lediglich 3% der Lehrstühle mit ausländischen Wissenschaftlern besetzt (Winnacker 2009, S. 2).
Eng mit der Internationalisierung der deutschen Hochschulen verbunden ist die Europäisie- rung des deutschen Hochschulsektors. Als Ausgangspunkt der Schaffung eines europäischen Hochschulraumes kann die Sorbonne-Deklaration der Erziehungsminister von Deutschland, Italien, Frankreich und Großbritannien aus dem Jahr 1998 gelten. Bereits im Sommer 1999 unterzeichneten 30 europäische Staaten die „Bologna-Erklärung“, in der sie das Ziel der Schaffung eines gemeinsamen europäischen Hochschulraums bis zum Jahr 2010 festschrie- ben. Als wichtigste Inhalte aus einer ganzen Reihe von Maßnahmen des Bologna-Prozesses können die Einführung einer gestuften und besser vergleichbaren Studienstruktur (Bachelor und Master), Maßnahmen zur Steigerung der Vergleichbarkeit und Anerkennung von Studien- leistungen (Qualifikationsrahmen und ECTS-Punkte), der verstärkte Fokus auf Kompetenz- entwicklung und Beschäftigungsfähigkeit der Studierenden/Absolventen sowie der Ausbau der europäischen Zusammenarbeit im Bereich der Qualitätssicherung gelten (BMBF 2009).
Die Umsetzung des Bologna-Prozesses ist für die deutschen Hochschulen mit erheblichem Aufwand verbunden, der vielfach ohne zusätzlich Ressourcen bewältigt werden muss(te). „The Bologna process required universities to change their administrative and curricular structures fundamentally and to document these in thousands of papers, reports and module descriptions“ (Hoell et al. 2009, S. 9). Gleichzeitig wird die bisherige Ausgestaltung der neu- en Studienstrukturen vielfach kritisiert. Belastbare Fakten zur Fundierung der Kritik liegen allerdings bisher nur sehr bedingt vor. Ob es sich bei den kritisierten Missständen um lokale Implementationsschwierigkeiten oder flächendeckende und dauerhafte Fehlentwicklungen handelt, kann wohl erst im Laufe der kommenden Jahre analysiert werden. Eine Ausnahme bildet die gut belegte Tatsache, dass in Bachelorstudiengängen relativ hohe Abbruchquoten vorherrschen (Heublein et al. 2008, S. 38ff.).
Eine zunehmend bedeutsame Initiative hin zur Europäisierung der universitären Forschung ist die seit 1984 europaweit ausgeschriebene Forschungsförderung. Untersuchungen zur Beteiligung am 6. Forschungsrahmenprogramm zeigen, dass deutsche Antragsteller aus Hochschulen, außeruniversitären Einrichtungen und Unternehmen europaweit am erfolgreichsten agierten und etwa 18% der ausgeschütteten Mittel zugewiesen bekamen (ZEW 2009).
Die Vorstellung eines globalen Wettbewerbs ist ein zentrales Element des Globalisierungs- konzepts (Willke 1999, S. 187ff.). Dieser Wettbewerb wird auf der gesellschaftlichen Makro- Ebene als Wettbewerb der Wissenschaftsstandorte wirksam. Es besteht große Einigkeit darü- ber, dass Forschung und Entwicklung ausschlaggebend sind für die Positionierung der indus- trialisierten Staaten im globalen Wettbewerb (Europäischer Rat 2000, S. 2). Die günstigsten Voraussetzungen besitzen hier Staaten mit entsprechenden Traditionen, förderlichen staatli- chen Rahmenbedingungen und attraktiven Lebensbedingungen für Wissenschaftler (vgl. Pasternack et al. 2006, S. 24).
Gleichzeitig wirken globale Konkurrenzimperative jedoch bereits auch auf der organisationa- len Ebene. Weltweite Rankings wie etwa das „Shanghai Ranking“ oder das „Times World University Ranking“ verdeutlichen alljährlich, dass deutsche Universitäten zwar im internati- onalen Mittelfeld durchaus zahlreich vertreten sind, jedoch die Spitzenplätze in Europa und der Welt von anderen Wissenschaftseinrichtungen belegt werden. Zwar ist es durchaus mög- lich und berechtigt die Aussagekraft der angesprochenen Rankings zu kritisieren20. Allein angesichts fehlender Alternativen zur Befriedigung des politischen und institutionellen Be- dürfnisses nach Orientierung im weltweiten Wettbewerb schmälert das ihre Bedeutung nur unwesentlich. „Global rankings (…) have become a barometer of global competition measur- ing the knowledge-producing and talent-catching capacity of higher education institutions“ (Hazelkorn 2009, S. 1). Rankings werden im hochgradig an Reputation orientierten Wissen- schaftsbetrieb zur Grundlage strategischen Handelns und dies sowohl auf politischer als auch auf organisationaler Ebene (Salmi und Saroyan 2007, S. 3).
Eine neue Form der Konkurrenz zwischen Universitäten, die gerade für deutsche Universitä- ten erst sehr allmählich an Bedeutung gewinnt, ist der internationale Handel mit Bildungs- dienstleistungen. Für diese Dienstleitungen wird in den kommenden Jahren und Jahrzehnten ein beachtliches Wachstum erwartet (Böhm et al. 2002, Marginson und van der Wende 2007, S. 10). Bisher wird dieser Markt von australischen und englischen Universitäten dominiert, mittlerweile beginnen jedoch Universitäten aus aller Welt, darunter auch deutsche, Studien- angebote im Ausland zu etablieren (Hahn und Lanzendorf 2005, S. 7). Nutzen britische und australische Hochschulen den Aufbau von sogenannten „Offshore“-Angeboten vor allem da- zu, ihre Einnahmebasis zu verbreitern, so müssen sich deutsche Hochschulen i. d. R. zunächst noch darum bemühen, überhaupt die notwendigen Strukturen aufzubauen, „um als staatliche Hochschulen im Ausland Studiengebühren einnehmen und damit eine mittelfristige Eigenfi- nanzierung im Ausland angebotener Studienprogramme sicherstellen zu können“ (Hahn und Lanzendorf 2005, S. 9).
Eine zweite wichtige Entwicklung im Rahmen der Globalisierung ist die Verbreitung von Leitbildern erfolgreicher Organisationsgestaltung. Solche Organisationsprinzipien werden in den nationalen Hochschulsystemen keineswegs „eins zu eins“ übernommen, sondern vielmehr auf der Basis der bisherigen kulturellen, institutionellen und organisationalen Entwicklung adaptiert. Dennoch konstatieren soziologische Beobachter einige weltweit vorzufindende Gemeinsamkeiten (Torres und Morrow 2000, S. 44). Der Hochschulbereich bietet aus zwei Gründen besonders gute Bedingungen für die globale Diffusion und Imitation von organisa- tionalen Vorbildern. Zum einen weisen Wissenschaftler eine hohe berufliche Mobilität auf, relevante Steuerungsakteure sind international stark vernetzt und es existieren wirkungsvolle Trägerorganisationen wie etwa die OECD, die European University Association (EUA)21 oder die UNESCO, die organisationale Leitbilder glaubhaft und mit großer Reichweite verbreiten können. Zum anderen ist gerade im Hochschulbereich durch die vielfach begrenzte Möglich- keit der exakten Bestimmung von Effizienz- und Effektivitätskriterien und -zurechnungen sowie durch weithin unklare Zusammenhänge von Organisationsstruktur und Organisationser- folg der Boden bereitet, um kulturelle und kognitive Ausrichtungen zur Grundlage des Steue- rungshandelns zu machen. Ein Blick zurück in die Geschichte zeigt, dass die internationale Imitation erfolgreicher Organisationsmodelle bereits in der Vergangenheit stattfand. So waren es zunächst die mittelalterlichen europäischen Universitäten und später dann die von Hum- boldt reformierten deutschen Universitäten, die weltweit als Vorbild der Universitätsorganisa- tion wirkten (Altbach 2004). In unseren Tagen sind es unverkennbar die amerikanischen Spit- zenuniversitäten, deren Steuerungs- und Organisationsprinzipien als Vorbild und Schlüssel zu wissenschaftlichem Erfolg betrachtet werden. Vor diesem Hintergrund sind in Deutschland und Europa vor allem zwei Leitideen wirksam geworden: die Universität als organisationaler Akteur (Krücken und Meier 2006) und die unternehmerische Universität (Clark 2003a).
Krücken und Meier (2006) beschreiben vier Grundprinzipien des sogenannten „organizational turn“ im Hochschulbereich: Erweiterte Rechenschaftspflichten auf Organisationsebene, die Definition organisationsspezifischer Ziele, zunehmend elaborierte Organisationsstrukturen um diese Ziele herum sowie die Transformation des Hochschulmanagements in eine Profession (Krücken und Meier 2006, S. 242ff.). Den grundlegenden Auslöser dieser Entwicklung sehen die Autoren in Globalisierungsprozessen, d.h. insbesondere in der Wahrnehmung eines globa- len Horizonts für Vergleich und Wettbewerb, in dem sich die Universitäten als zu strategi- schem Handeln fähige Akteure positionieren (sollen). Im Rahmen dieser Entwicklung wird die organisationale Ebene der Universität erheblich aufgewertet und rückt zunehmend in das Zentrum der Universitätssteuerung. „Strong institutional management is now considered a key component of university governance“ (ebd., S. 243). Als Trendsetter bzw. organisationale Vorbilder werden die amerikanischen Forschungsuniversitäten identifiziert, wobei Krücken und Meier gleichzeitig herausstellen, dass deren Status als organisationale Akteure keines- wegs so ausgeprägt ist, wie das vielen ausländischen Beobachtern erscheinen mag22.
Eine andere interessante Diskussionslinie zu globalisierungsbedingten Veränderungen der Universitätssteuerung und -organisation lässt sich mit Publikationen wie „entrepreneurial universities“ (Clark 2003a); „universities in the market place“ (Bok 2003); „academic capitalism“ (Slaughter und Rhoades 2004) oder „University, Inc.“ (Washburn 2005) nach- zeichnen. In diesen Büchern wird aus mehr oder minder kritischer Perspektive beschrieben, wie Universitäten und Wissenschaftler in zunehmendem Maße unternehmerisch handeln. Clark (2003a) sieht diese Entwicklung durchaus positiv und weist darauf hin, dass durch un- ternehmerische Aktivitäten zusätzliche Ressourcen für originär akademische Aufgaben er- langt werden können. Andere Autoren sehen jedoch akademische Werte in großer Gefahr. Gemeinsam ist allerdings allen Diagnosen, dass sie die unternehmerische Universität als Aus- fluss der herrschenden Regulierungsbedingungen und Leitbilder der Universitätsorganisation betrachten. Vaira (2004) beschreibt vier zu Grunde liegende Organisations- und Steuerungs- prinzipien: Reduzierung staatlicher Zuwendungen, d.h. mehr Leistung mit weniger Ressourcen; mehr institutionelle Autonomie und mehr Steuerung aus der Distanz; wachsender Druck zur stetigen Verbesserung von Qualität, Effizienz und Effektivität in allen Bereichen der Hochschulentwicklung sowie eine systematische Stärkung der Anbindung universitärer Leistungserbringung an die Bedürfnisse von Wirtschaft und Arbeitsmarkt. In diesem Szenario, so Vaira, gilt das unternehmerische Modell der Universitätsorganisation als „basic and legitimated organizational principle, or archetype, deemed to be able to let higher education institutions to cope with the challenges in their new task environment and constitute the pathway to pursue restructuring processes“ (Vaira 2004, S. 490).
Die institutionellen Leitbilder von Universitäten als „organisationale Akteure“ oder „unter- nehmerische Universitäten“ machen globale Trends im aktuellen Wandel der Universitäts- steuerung anschaulich. Gleichzeitig gilt jedoch auch zu Beginn des 21. Jahrhunderts noch, dass nationale Institutionengefüge eine überragende Bedeutung für die Regulierung des Wis- senschaftssektors besitzen. Globale Konzepte werden in den spezifischen nationalen und or- ganisationalen Kontexten unterschiedlich aufgegriffen. Wesentliche Aspekte der aktuellen Hochschulreform in Deutschland waren bereits in nationalen Entwicklungen angelegt und wurden durch die Globalisierung lediglich beschleunigt (Teichler 2007, S. 9).
2.1.3 Wandel des Staats- und Steuerungsverständnisses
„ Das Verhältnis zwischen Staat und Universität ist nüchtern geworden. Es ist eine Beziehung des kalkulierten Gebens und Nehmens “ (Kern 2000, o. S.).
In einer international vergleichenden Studie beschrieb Geiger (1988) Deutschland ähnlich wie Schweden oder Ungarn als ein Land mit „comprehensive public and peripheral private sector“23. Nichtstaatliche Hochschulen besitzen in Deutschland trotz eines deutlichen Wachs- tums auch weiterhin eine marginale Position24. Im Wintersemester 2007/2008 studierten 95,1 Prozent der Studierenden an staatlichen Hochschulen. Unter den nichtstaatlichen Hochschulen nahmen kirchliche Hochschulen ca. 1,3% und private Hochschulen ca. 3,6% der Studierenden auf. Darüber hinaus gewährleistet die Regulierung des Hochschulsektors, insbesondere durch Anerkennungs- und Akkreditierungsverfahren für Hochschulen und Studienprogramme, eine institutionelle Anpassung privater Hochschulen an die normativen Leitlinien des staatlichen Wissenschaftsbetriebs und viele private Hochschulen können ihre Existenz nur durch staatli- che Zuschüsse aufrecht erhalten25. Insgesamt kann also von einem „faktischen Hochschulmonopol des Staates“ (Darraz et al. 2009, S. 36) in Deutschland gesprochen werden.
Gleichzeitig hat sich in den letzten Jahren ein klarer Wandel des Staats- und Steuerungsver- ständnisses vollzogen. In der traditionellen, durch die Humboldt’schen Ideen geprägten, deut- schen Hochschulregulierung wurde der Staat trotz des gesetzlichen Schutzes der Freiheit von Forschung und Lehre als „Anwalt und Träger einer Gesamtkultur“ verstanden (Kern 2000, o. S.), der durch gezielte Eingriffe und Impulse die Universität im Sinne ihrer Bestimmung, d.h. im Bezug auf die Prinzipien des Gemeinwohls steuern sollte. Eine solche Rolle des Staates für die Universitäten ist durch die Entwicklung hin zu einer pluralistischen Gesellschaft und durch wachsende Steuerungsprobleme des Staates zunehmend in Frage gestellt worden. Die Macht des Staates zur souveränen Gestaltung der Verhältnisse sinkt zum einen durch die mit der anhaltenden gesellschaftlichen Differenzierung verbundene stetig wachsende Komplexität und Eigenlogik der zu regulierenden Zusammenhänge und andererseits durch die zunehmende Bedeutung internationaler Einflussfaktoren. Für die Entwicklung der Hochschulsteuerung als stark nationalstaatlich kontrolliertem Steuerungsbereich ist insbesondere der erste Aspekt be- deutsam, d.h. die aus wachsender Komplexität der gesellschaftlichen Teilsysteme resultieren- de „Steuerungskrise der hoheitlichen Interventionsform“ (Kaufmann 2005, S. 8).
Seit Anfang der 1970er Jahre haben die Ergebnisse der Steuerungsforschung das bis dato gültige Leitkonzept der hierarchischen Steuerung deutlich in Frage gestellt. Hatte man zuvor noch angenommen, die Bedingung einer aktiven Reformpolitik läge darin, die staatliche Kapazität zur Informationsverarbeitung und Konfliktregelung zu steigern (vgl. Scharpf und Mayntz 1973), so zeigte sich anschließend, dass auch eine gut geplante und auf Wirksamkeit bedachte Reformpolitik ihre Ziele verfehlen kann.
Diese grundlegende Einsicht in die Fehlbarkeit und die Wirkungsumstände staatlicher Inter- ventionen in modernen Gesellschaften schlug sich in einem regelrechten Paradigmenwechsel der Verwaltungswissenschaften und Regierungslehre nieder, der oftmals mit der Formel „from government to governance“ beschrieben wird. „Das Interesse richtete sich auf eine ge- sellschaftliche Steuerungstheorie, bei der weniger Merkmale des Steuerungssubjekts ‚Staat‘, also Regierung und Verwaltung, sondern vielmehr Charakteristika der Steuerungsobjekte, also der gesellschaftlichen Teilsysteme und deren Selbstregulierung, sowie deren gegenseitige Verflechtung und Beeinflussung im Vordergrund standen“ (Jann 2005, S. 56f.). Aus diesem Blickwinkel konkurriert staatlich-bürokratische Steuerung mit anderen Strukturierungsme- chanismen und ist in ihrer Wirkung von diesen abhängig. Eine falsche Einschätzung oder Nichtbeachtung der Charakteristika der Steuerungsobjekte und der anderen im jeweiligen Feld gültigen Ordnungsprinzipien kann, ja muss, zu fundamentalen Fehlentwicklungen und nicht intendierten Handlungsfolgen führen. Eine staatliche Steuerung, die die im Feld wirken- den Kräfte, bspw. Interessenorganisationen einbindet oder situationsbezogene Entscheidungen auf organisationaler Ebene ermöglicht, kann, so die allgemeine Einsicht, wesentlich bessere Steuerungsergebnisse erzielen. „Steuerungserfolge werden durch Enthierarchisierung der Be- ziehungen zwischen Staat und Gesellschaft erkauft“ (Scharpf 1991, S. 622; ähnlich Heinelt 2005). Zwar bleibt die Funktion des Staates zur Herstellung und Durchsetzung allgemein ver- bindlicher Entscheidungen weiter notwendig. Doch jenseits dieser Notwendigkeit stellt sich die drängende Frage, für welche Aufgaben typisierende und generelle rechtliche Regeln ge- eigneter sind als die Ergebnisse von Aushandlungsprozessen oder situationsbezogenen orga- nisatorischen Entscheidungen und wie sich die Vorteile unterschiedlicher Steuerungsmodi miteinander verbinden lassen (Kaufmann 2005, S. 9).
Im Kern geht es bei moderner staatlicher Steuerung darum, gesellschaftliche Intelligenz und private Dynamik für öffentliche Interessen zu nutzen. Oder wie es der britische Soziologe und Erfinder des sogenannten „dritten Weges“ Giddens beschreibt: „Staat und Zivilgesellschaft sollten partnerschaftlich zusammenarbeiten, um sich gegenseitig zu fördern, aber auch, um sich gegenseitig zu kontrollieren“ (Giddens 1999, S. 95). Die Rolle des Staates besteht in ei- ner solchen Konstellation vor allem darin, Chancengleichheit zu verbessern und gegen Risi- ken abzusichern, dies jedoch nicht so umfassend zu tun, dass die private Initiative auf der Strecke bleibt (Giddens 1999, S. 117ff.).
Allgemeingültige und tragfähige Grundsätze zur Auflösung des staatlichen Steuerungsprob- lems sind bisher noch nicht in Sicht und sicher müssen solche Konzepte auch immer wieder situationsspezifisch erarbeitet werden. Eine Reformrichtung, die auf die Verbesserung staatli- cher Steuerungsergebnisse abzielt und seit einigen Jahren Reformen des öffentlichen Sektors in vielen Ländern der Welt inspiriert, ist das sogenannte New Public Management (NPM).
Im Hinblick auf die grundlegenden Inhalte und Leitmotive des NPM sind zwei Ebenen zu unterscheiden. Auf der Makro-Ebene wird auf Basis des Public Choice Ansatzes26 diskutiert, welche Leistungen vom Staat angeboten werden sollten. Die Notwendigkeit staatlicher Leis- tungserbringung im Bildungsbereich wird in Deutschland allerdings bisher nicht glaubhaft in Frage gestellt. Im Zusammenhang mit der Reform der Hochschulsteuerung und -organisation sind vor allem die Vorschläge des NPM zur Meso-Ebene, d.h. zur „Binnenreform“ der staatli- chen Leistungserbringung relevant. In seinem richtungsweisenden Aufsatz stellte Hood (1991) folgende Leitideen für die Gestaltung öffentlicher Einrichtungen heraus:
- eine stärkere Managementorientierung, d.h. aktive, sichtbare und mit Ermessens- und Handlungsspielräumen versehene Kontrolle der Einrichtungen des öffentlichen Sektors durch Manager bei klarer Zuordnung von Verantwortlichkeiten;
- explizite Leistungsstandards und -indikatoren inklusive klarer Zielsetzungen und messba- rer Erfolgsquoten;
- Stärkung der Output- bzw. Ergebniskontrolle inklusive leistungsorientierter Mittelvertei- lung und Besoldung;
- Dezentralisierung der Einrichtungen des öffentlichen Sektors im Hinblick auf „manageable units“ mit eigenem Budget;
- Stärkung des Wettbewerbs im öffentlichen Sektor durch befristete Verträge und öffentli- che Ausschreibungen;
- Anwendung bewährter privatwirtschaftlicher Managementtechniken (bspw. im Hinblick auf Personalentwicklung oder Public Relations);
- mehr Disziplin und Sparsamkeit im Umgang mit Ressourcen.
(vgl. Hood 1991, S. 4f.).
Viele dieser Prinzipien wurden und werden im Rahmen der aktuellen Hochschulreform umge- setzt (vgl. Kap. 3). Ihre Zusammenschau zeigt, dass New Public Management vor allem auf eine Steigerung der Effizienz und Effektivität staatlichen Handelns abzielt. „Keep it lean and purposeful“ (Hood 1991, S. 11). Die konzeptionellen Hintergründe der durch NPM inspirier- ten Reorganisation des öffentlichen Sektors stammen aus der neueren Institutionenökonomie und dem Managerialismus.
Unter den institutionenökonomischen Ansätzen27 ist insbesondere die Agency-Theorie zu nennen, die sich mit der Frage auseinandersetzt, wie ein Prinzipal, d.h. im Falle der Hoch- schulsteuerung der Staat, sicherstellen kann, dass die Ressourcen, die er einem oder mehreren tischen Prozess eingebracht werden können. Eine umfassende Darstellung des Public Choice-Ansatzes liefert Mueller (2008).
Agenten, d.h. den Hochschulen und individuellen Wissenschaftlern, zur Leistungserbringung zur Verfügung stellt, in seinem Sinne effizient und effektiv genutzt werden. Wie der Public Choice-Ansatz geht auch der Prinzipal Agenten-Ansatz davon aus, dass alle Akteure stets ihren eigenen Nutzen, d.h. das Verhältnis von Aufwand und Ertrag, maximieren wollen; wenn nötig auch auf Kosten des Prinzipals. Dem gilt es durch geeignete Maßnahmen entgegenzutre- ten. Dieses Problem ist natürlich nicht neu für das Verhältnis von Staat und öffentlichen Ein- richtungen. Versuchte man jedoch in der Vergangenheit, d.h. im bürokratischen Regime staat- licher Leistungserbringung, durch hierarchische Kontrollen und allgemeine Regulierungen zu steuern, so weisen Ergebnisse im Rahmen der Agency-Forschung darauf hin, dass eine effizi- ente und effektive Leistungserbringung eher mit Hilfe von ausgehandelten Kontrakten und angemessenen Anreizstrukturen möglich ist (Schröter und Wollmann 2005, S. 66f.).
Der Managerialismus als zweiter zentraler Ausgangspunkt des NPM ist ein eher praktisch orientierter Ansatz, in dessen Rahmen versucht wird, allgemein gültige Ratschläge für die Führung von Organisationen zu entwickeln. Den Führungskräften und entsprechenden Mana- gementkompetenzen wird große Bedeutung zugeschrieben, wobei erfolgreiche Management- methoden aus der Privatwirtschaft, insbesondere Methoden zur Kosten- und Leistungserfas- sung und zur dezentralen Unternehmensorganisation, für den öffentlichen Sektor nutzbar ge- macht werden sollen. Gerade im Bereich der Managementmethoden bestehen jedoch gewisse Schwierigkeiten zwischen sogenannten „management fads“, d.h. letztlich substanzlosen oder gar schädlichen Management-Moden, und tatsächlich ernstzunehmenden und effizienz- oder effektivitätssteigernden Ansätzen zu unterscheiden28. Der seriöse Kern der Übertragung der modernen Managementlehre auf den öffentlichen Sektor besteht „nicht notwendigerweise in einer Ökonomisierung der internen Strukturen des öffentlichen Sektors, sondern in Dezentra- lisierung und Transparenz, d.h. in der Abkehr von hierarchischer Integration und Steuerung sowie in dem Versuch, möglichst viele interne Beziehungen, Kosten und Ergebnisse transpa- rent zu machen. Nicht ‚mehr Markt‘ ist somit die normative Leitlinie, sondern ‚mehr Transpa- renz und mehr Eigenverantwortlichkeit‘“ (Jann 2005, S. 59).
Kritik am New Public Management wird aus unterschiedlichen Lagern geäußert. Zum einen wird die Gefahr gesehen, dass durch die Dominanz von Effizienz- und Output-Kriterien ande- re zentrale Ansprüche an staatliches Handeln wie Gleichbehandlung, demokratische Verant- wortlichkeit und Fairness leiden (bspw. Pelizzari 2001). Andere Kritiker stellen die effizienz- steigernde Wirkung von NPM-Reformen in Frage, indem sie die Übertragbarkeit entspre- chender Reformpakte auf Anwendungskontexte im öffentlichen Sektor anzweifeln (Edeling et al. 1998), paradoxe und nicht intendierte Wirkungen des NPM feststellen (Hood und Peters 2004) oder auf die gefährdete Koordination und Integration eines spezialisierten und fragmentierten öffentlichen Sektors hinweisen (Jann 2005, S. 58ff.).
2.2 Mangelnde Anpassungsfähigkeit - Defizitdiagnosen zur traditionellen Hochschulorganisation
Den genannten Herausforderungen stehen, so die weit verbreitete Überzeugung, zum Ende des 20. Jahrhunderts deutsche Universitäten gegenüber, die nur über eine unzureichende An- passungsfähigkeit verfügen. Diagnosen zur eingeschränkten Handlungs- und Wandlungsfä- higkeit von Universitäten existieren in großer Zahl. „Es ist chic geworden, den Standort Deutschland in Zweifel zu ziehen. Ein beliebtes Beispiel für die Rede vom Niedergang stellt mittlerweile die deutsche Universität dar. Auch wenn mir diese Krisendiagnose sowohl im Hinblick auf die behauptete Tiefe der Krise der deutschen Universität, wie auch im Hinblick auf die unterstellte prinzipielle Überlegenheit anderer Universitätssysteme, insbesondere des amerikanischen, überzogen erscheint, so ist trotzdem nicht von der Hand zu weisen, dass sich die Universität in einer Misere befindet“ (Kern 2000, o. S.). Wie dieses Zitat des ehemaligen Göttinger Rektors und Organisationssoziologen Kern herausstellt, wird dabei keineswegs immer sachlich und differenziert argumentiert. Seriöse Krisendiagnosen zur organisationalen Leistungsfähigkeit der Universitäten fokussieren vor allem auf zwei Umstände: Erstens auf die Begrenztheit der Mittel aus traditionellen staatlichen Finanzierungsquellen, die bei stetig steigenden Anforderungen seit geraumer Zeit zu einer Unterfinanzierung der Hochschulen führt, und zweitens auf Einschränkungen, die sich aus der traditionellen internen Organisation von Universitäten ergeben.
2.2.1 Unterfinanzierung
Die These von der Unterfinanzierung der deutschen Universitäten ist zu einem Allgemeinplatz geworden, der kaum in Frage gestellt wird. Überfüllte Hörsäle und baufällige Gebäude sind an Universitäten sicher keine Ausnahme und veranschaulichen die vorherrschenden finanziellen Defizite sehr plastisch. Sucht man nach belastbaren Fakten, um die Unterfinanzierung der deutschen Universitäten zu quantifizieren, so kann zum einen die Finanzierung der Hochschulen im Zeitverlauf betrachtet werden und zum anderen besteht die Möglichkeit des internationalen Vergleichs. Wichtigste Kennzahlen sind jeweils der Anteil der Hochschulausgaben am Bruttosozialprodukt und die Ausgaben pro Studierenden.
Betrachtet man die deutsche Hochschulfinanzierung im Zeitverlauf, so zeigt sich, dass der Anteil der Hochschulausgaben am Bruttoinlandsprodukt seit den siebziger Jahren deutlich gefallen ist. Im Jahr 1977 wurden noch mehr als 1,3% des BIP für die Hochschulbildung auf- gewendet, seit 1995 liegt der entsprechende Anteil relativ stabil bei ca. 1,1%. Entsprechend der bereits dargelegten staatlichen Dominanz des Hochschulsektors stammt der Löwenanteil der Universitätsfinanzierung in Deutschland aus staatlichen Quellen. So wurden 2006 etwa 85% der Ausgaben für Lehre und Forschung im Hochschulbereich staatlich finanziert (OECD 2009). Das dargestellte Absinken des Anteils der Hochschulausgaben am BIP seit den 1970er- Jahren bis etwa Mitte der 1990er Jahre ist besonders bemerkenswert vor dem Hintergrund, dass sich die Zahl der Studierenden, wie in Kapitel 2.1.1 erläutert, im selben Zeitraum mehr als verdoppelt hat. Ruft man sich weiterhin die Tatsache ins Gedächtnis, dass Bildung in den letzten Jahrzehenten eine zunehmende Anerkennung als wichtiger Faktor für die Entwicklung des nationalen Wohlstandes und zur Lösung gesellschaftlicher Probleme genießt, so fällt die erstaunliche Diskrepanz zwischen politischer und medialer Rhetorik einerseits und der tat- sächlichen Finanzierung der Hochschulen deutlich ins Auge. Gleichzeitig ist seit etwa 1995 eine Stabilisierung des BIP-Anteils der Hochschulausgaben zu beobachten. Ein Umstand, der seither, entgegen der landläufigen Wahrnehmung, aufgrund eines steigenden Bruttoinlands- produktes zu einer teilweise deutlich verbesserten finanziellen Nominalausstattung der Hoch- schulen geführt hat. Diese hat sich zwischen 1995 und 2004 in 14 Bundesländern verbessert, davon in acht Ländern erheblich (Lanzendorf und Pasternack 2008, S. 47).
Die zweite wichtige Kennzahl zur Universitätsfinanzierung im Zeitverlauf zeigt, dass die Ausgaben pro Studierenden zwischen 1980 und 2004 zwar nominell um 33% gestiegen, inflationsbereinigt jedoch um 15% gefallen sind (Leszczensky 2007). Dieser Indikator weist also auf eine beachtliche Verschlechterung der finanziellen Situation im Zeitverlauf hin.
Betrachtet man schließlich die Entwicklung der Studierendenzahlen im Vergleich zur Personalausstattung der Hochschulen29, so wird erkennbar, dass die Zahl der Absolventen zwischen 1977 und 1995 um 77% gestiegen ist, während gleichzeitig das wissenschaftliche Personal nur um 10% zunahm. Seit 1995 hat sich die Relation von wissenschaftlichem Personal und Studierenden allerdings nicht weiter verschlechtert sondern, insbesondere seit 2002 sogar wieder etwas verbessert (Destatis 2008 und 2009).
[...]
1 Bei Wikipedia heißt es zu Situation des Prometheus: „Ohne Speis, Trank und Schlaf musste Prometheus dort ausharren, und jeden Tag kam der Adler Ethon und fraß von Prometheus’ Leber, die sich zu dessen Qual immer wieder erneuerte, da er ein Unsterblicher war“ (http://de.wikipedia.org/wiki/Prometheus).
2 Dass auch die von Münch vorgelegten empirischen Belege einer kritischen Prüfung kaum standhalten konnten, wurde bspw. von Auspurg et al. (2008) überzeugend dargelegt.
3 Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird aus Gründen der Lesbarkeit auf die jeweilige Nennung der männlichen und weiblichen Form verzichtet und stets die männliche Form verwendet. Damit ist selbstverständlich keine herabwürdigende Bewertung des weiblichen Geschlechts verbunden.
4 Englische Originalzitate werden im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht übersetzt. Dieses Vorgehen reflek- tiert die Tatsache, dass sich Englisch als weltweite Wissenschaftssprache zunehmend durchsetzt. Dies gilt in besonderem Maße für die Organisationsforschung, die stark durch anglo-amerikanische Autoren und Publikati- onsmedien geprägt ist.
5 „Die europäische Diskussion der Bildungsexpansion in den sechziger Jahren begann nicht mit der These, dass Bildung Bürgerrecht ist, sondern mit dem postulierten Zusammenhang zwischen Bildungschancen und Wirt- schaftwachstum. In den Veröffentlichungen der OECD, die weite Publizität fanden, war von der Korrelation zwischen dem Wachstum des Bruttosozialprodukts und dem Anteil der Hochschulabsolventen die Rede“ (Dah- rendorf 1992, S. 66). Einschlägige Diskurse haben seit einigen Jahren wieder erhöhte Konjunktur.
6 Die vorliegende Untersuchung konzentriert sich auf Universitäten, da dieser Hochschultyp den tertiären Bil- dungssektor in Deutschland dominiert. 2012 wurden ca. zwei Drittel aller Studierenden an Universitäten ausge- bildet (Destatis 2012a). Überdies besitzen Universitäten durch ihre stärkere Forschungsausrichtung und das exklusive Promotionsrecht eine Leitbildfunktion gegenüber dem zweiten deutschen Hochschultyp, den Fach- hochschulen.
7 Zur der statistischen Generalisierbarkeit sei an dieser Stelle noch erwähnt, dass ein entsprechender Anspruch auch von vielen standardisierten Befragungen nur bedingt eingehalten werden kann und dass solche Untersuchungen mitunter deutliche Mängel im Hinblick auf die o.a. Vorteile von qualitativen Fallstudien aufweisen, also nicht differenziert genug operationalisiert werden (bspw. Krempkow 2012) oder zwar statistische Befunde liefern, diese jedoch inhaltlich nicht befriedigend erklären können (bspw. Schubert 2008)
8 Die Nutzung von Begrifflichkeiten aus der allgemeinen Organisationsforschung, bspw. des ManagementBegriffs, stößt im Diskurs zur Hochschulentwicklung immer wieder auf Befremden. Dies ist dort berechtigt, wo Konzepte aus dem Wirtschaftsbereich unreflektiert auf Hochschulen übertragen werden. Gleichzeitig wäre es jedoch unsinnig, Erkenntnisse aus der allgemeinen Organisationsforschung nicht für die Hochschulorganisation nutzbar zu machen (vgl. Wilkesmann und Schmid 2012, S. 9).
9 Während Bells Diagnose profunde Argumente und einen klaren Bezug zur Sozial- und Wirtschaftsstruktur aufweist, ist in der Diskussion um das Konzept der Wissensgesellschaft in der Folgezeit an vielen Stellen die Klarheit und Genauigkeit der Argumentation verloren gegangen. Mittlerweile ist der Begriff der Wissensgesellschaft dadurch sehr vielschichtig und umstritten (Heidenreich 2003, S. 25ff.). Weitere weithin rezipierte Beiträge zur Wissensgesellschaft stammen von Castells (1996, 1997, 1998) und Stehr (u.a. Stehr 1994).
10 Die Produktionsweise des Fordismus herrschte bis in die 1970er Jahre vor. „Unternehmen stellten am Fließband mit Hilfe von Maschinen standardisierte Massenprodukte her. Die Tätigkeiten der Bandarbeiter beschränkten sich auf wenige, hochspezialisierte Handgriffe. Arbeiter benötigten für solche Tätigkeiten keine lange Ausbildung. Firmen glichen Bürokratien, waren streng hierarchisch gegliedert und wurden von einer zentralen Unternehmensleitung geführt. Die Massenprodukte wurden auf geschützten nationalen Binnenmärkten abgesetzt“ (Baur 2001, S. 107). Der Postfordismus hingegen ist durch zunehmende Flexibilität, eine wachsende Bedeutung des Produktionsfaktors Wissen und eine stärkere Weltmarktorientierung. gekennzeichnet.
11 Eine separate Betrachtung der Studierendenzahlen an Universitäten ist aufgrund der Daten des Statistischen Bundesamtes erst ab dem Studienjahr 1980 möglich.
12 Angesichts der im Rahmen des demographischen Wandels zu verzeichnenden mittel- bis langfristig sinkenden Jahrgangsstärken bei gleichzeitig wachsendem Anteil von Kindern aus bildungsfernen Schichten erscheint eine solche Schätzung dem Autor tendenziell etwas zu hoch gegriffen (vgl. Rosenbusch 2008; Pasternack et al. 2006,
S. 32ff.).
13 Die zunehmende Bedeutung der Weiterbildung wird dadurch notwendig, dass neues Wissen stetig schneller produziert wird, während altes Wissen immer schneller seinen Wert verliert. Gleichzeitig fordert das Beschäftigungssystem immer mehr Flexibilität und Job-Mobilität (Teichler 2002, S. 26). Internationale Vergleichsstudien zeigen allerdings, dass die wissenschaftliche Weiterbildung in Deutschland bisher noch nicht das Niveau anderer industrialisierter Staaten erreicht hat (Schaeper et al. 2006; Hanft und Knust 2007).
14 Siehe das entsprechende Memorandum von Arbeitgeberorganisationen und Hochschulrektorenkonferenz (BDA; BDI; HRK 2008).
15 Gemessen wird gemeinhin die grenzüberschreitende Ko-Autorenschaft von Publikationen in Fachzeitschriften.
16 Operationalisiert wurde die Studierendenmobilität lange Zeit mit der ausländischen Staatsangehörigkeit von Studierenden. Dieser Indikator wird jedoch mit zunehmender Internationalisierung immer problematischer, da so nicht zwischen Bildungsinländern und -ausländern unterschieden werden kann (Teichler 2007, S. 73ff).
17 Teichler (2007) weist darauf hin, dass sich das Wachstum der Zahl der Auslandsstudierenden bis Mitte der 1990er ziemlich genau proportional zum Gesamtwachstum der weltweiten Studierendenpopulation vollzog (1970 und 1995 je ca. 2% aller Studierenden).
18 Neben diesen vier Ländern sind auch in Australien (6%), Kanada (5%) und Japan (4%) nennenswerte Anteile der mobilen Studierenden zu finden.
19 Das sind 250.000 Studierende, darunter knapp 60.000 Bildungsinländer, d.h. Studierende, die ihre Hochschulzugangsberechtigung in Deutschland erworben haben.
20 Die in den genannten Rankings verwendeten Indikatoren sind keineswegs unumstritten; die Datengrundlage der Berechnungen ist nicht immer solide (tw. Selbstauskünfte der Universitäten) und auch die verwendeten Be- rechnungs-/Gewichtungsformeln sind nicht immer transparent. Die Qualität der Lehre wird nur sehr bedingt bzw. indirekt erfasst (Salmi und Saroyan 2007). Weiterhin sind Rankings auf Ebene der Universitäten oftmals wenig aussagekräftig, da es für viele Hochschulen typisch ist, dass in einzelnen Bereichen exzellente Fächer und Institute existieren, während in anderen Bereichen nur wenig relevante Forschungsergebnisse erarbeitet werden.
21 Die EUA gilt als Dachverband europäischer Hochschulen, in dem eine Vielzahl europäischer Hochschulen und nationaler Hochschulrektorenkonferenzen organisiert sind.
22 „Indeed the American university as the embodiment of central features of organizational actorhood is best understood as a powerful myth in current higher education discourse worldwide“ (Krücken und Meier 2006, S. 242).
23 Der internationale Vergleich zeigt, dass dies keine Selbstverständlichkeit darstellt. So werden z.B. japanische Hochschulen zum größten Teil in privater Trägerschaft geführt.
24 Waren 1980 1,8 Prozent aller Studierenden an nichtstaatlichen Hochschulen eingeschrieben, so waren es 3,2 Prozent im Jahr 2003 und 4,9% im Jahr 2007/08.
25 2005 flossen ca. 107 Millionen Euro aus Landeshaushalten in private Hochschulen. Dies entspricht nahezu 35% der Ausgaben dieser Einrichtungen. Die finanzielle Unterstützung von privaten Hochschulen stellt dabei keine originäre Aufgabe der Länder dar, sondern wurde gewährt, um finanziell in Bedrängnis geratene private Hochschulen oder Neugründungen zu unterstützen (Destatis 2008, S. 43f.).
26 Der Public Choice-Ansatz versucht staatliche Entscheidungen auf der Basis der neoklassischen Wirtschafts- theorie zu erklären. Alle beteiligten Akteure (Wähler wie Politiker) werden als nutzenmaximierende Akteure verstanden. Dementsprechend gilt als Hauptziel der Politiker die Sicherung ihrer Macht bzw. Ämter (Wieder- wahl), während gesellschaftliche Interessen vor allem durch große Verbände und Interessengruppen in den poli-
27 Hierzu werden neben der Prinzipal Agenten-Theorie auch die Transaktionskostentheorie und der Property Rights-Ansatz gerechnet.
28 Eine lesenswerte Darstellung zur Verbreitung von Management-Fads im amerikanischen Hochschulwesen hat Birnbaum (2000) vorgelegt.
29 Ein relativ grober Indikator, da nicht zwischen Wissenschaftlern unterschieden wird, die in der Lehre eingesetzt sind und solchen, die keine Lehrverpflichtung wahrnehmen, sondern nur im Bereich der Forschung oder wissenschaftlichen Dienstleistung arbeiten.
- Arbeit zitieren
- Christoph Rosenbusch (Autor:in), 2013, Organisationale Selbststeuerung in deutschen Universitäten, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/285289
Kostenlos Autor werden






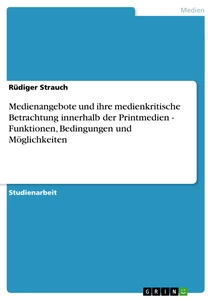








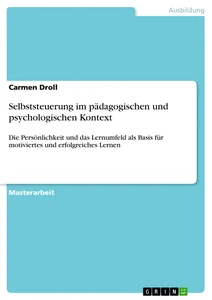
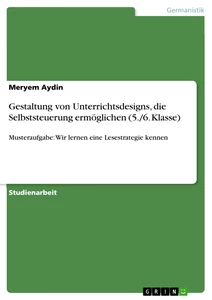





Kommentare