Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Epidemiologie, Prävalenz und transkultureller Vergleich
3. Inzidenz und Verlauf
4. Ätiologieforschung
4.1 Psychosoziale und soziokulturelle Faktoren
4.2 Zwangsspektrumsstörungen und Komorbiditäten
4.3 Ätiologiemodelle
4.3.1 Neurobiologische Erklärung
4.3.2 Lerntheoretische Erklärung
4.4 Die neobiologistische Wende in der Psychiatrie und ihre Folgen
Literaturverzeichnis (inklusive weiterführender Literatur)
Anlagen
1. Einleitung
Zwangserscheinungen als psychopathologische Phänomene wurden in der psychiatrischen Literatur seit dem 19. Jahrhundert vielfach beschrieben. Knölker setzt den Begriff lt;ungewöhnliche Faszination ein, wenn er schildert, in welcher Form diese Krankheitserscheinungen Ärzte, Psychologen und Philosophen beschäftigt hat.[1] Adams (1973) ist „vorwissenschaftlichen“ Beschreibungen von Zwangserscheinungen nachgegangen.[2] So hatte bereits Ignatius von Loyola (1533) einen zwangskranken Zögling beschrieben und mächtige Begierden, „obsessio“, animalischer Natur konstatiert; Richard Flecknoe (1658) in seinen „Enigmaticall characters“ eine Person vorgestellt, die mit dem Nachdenken nicht aufhören kann; Samuel Johnsson, (1759) selbst anankastisch, in seinem Roman „Rasselas“ einen Zwangskranken beschrieben; Immanuel Kant (1824) die Störung als „Grillenkrankheit“ bezeichnet, Jean Pierre Falret (1850), die Bezeichnung „Maladie du doute“ (=Krankheit des Zweifels) für sie geprägt und Novalis von einem „Wahnsinn nach Regeln und mit vollem Bewusstsein“ gesprochen.[3]
Pathologische Zwangsphänomene werden als Zwänge, Zwangsstörungen und Zwangsneurosen bezeichnet. Häufig wird der Begriff Zwangssyndrom oder anankastisches Syndrom eingesetzt und im Zusammenhang mit ich-strukturellen Störungen neuerdings die Bezeichnung lt;früher Anankasmus.
Zwangserkrankungen galten als schwer behandelbar. An dieser Einschätzung hat sich bis heute nichts geändert. Auffällig ist, dass Zwänge seit den achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts verstärkt in Erscheinung treten und stärker beachtet werden. Zohar/Insel vermuten in der Ich-Dystonie der Zwangsstörung die Ursache dafür, dass die Erkrankten erst spät eine Therapie aufsuchen.[4] Die als ich-dyston erlebten Zwangsvorstellungen und Zwangsimpulse haben antisoziale, (sexuelle oder aggressive) Inhalte, bekommen durch deren willentliche Unbeeinflussbarkeit einen unheimlichen und bedrohlichen Charakter und führen zu Scham- und Schuldgefühlen. Ärger, Unruhe und größtenteils erhebliche Ängste sind die Folge davon. Zwangshandlungen werden als unsinnig erlebt, müssen jedoch gleichfalls vollzogen werden. Als Ausnahme gelten Zwanghandlungen, die als Begleitsymptome von Ich-Strukturstörungen auftreten, weil sie von den Betroffenen eher als ich-synton erlebt werden. Die beschriebene Ausgangslage führt zwangsläufig in die Introversion. Die bestehende Ich-Dystonie bewirkt eine ausgeprägte Gemeinhaltung der Störung selbst den nächsten Angehörigen gegenüber. Von dem geheimnisvollen Tun der Zwangskranken hatte bereits Sigmund Freud berichtet:
„Merkwürdig ist, daß Zwang wie Verbote (das eine tun müssen, das andere nicht tun dürfen) anfänglich nur die einsamen Tätigkeiten der Menschen betreffen und deren soziales Verhalten lange Zeit unbeeinträchtigt lassen; daher können solche Kranke ihr Leiden durch viele Jahre als ihre Privatsache behandeln und verbergen. Auch leiden viel mehr Personen an solchen Formen der Zwangsneurose, als den Ärzten bekannt wird. Das Verbergen wird ferner vielen Kranken durch den Umstand erleichtert, daß sie sehr wohl imstande sind, über einen Teil des Tages ihre sozialen Pflichten zu erfüllen, nachdem sie eine Anzahl von Stunden in melusinenhafter Abgeschiedenheit ihrem geheimnisvollen Tun gewidmet haben.“[5]
Besteht die Störung über einen längeren Zeitraum, führt sie zu Partnerschaftsproblemen, wirkt sich negativ auf die Berufstätigkeit und Freizeitgestaltung aus und führt so direkt in die soziale Isolation. Von daher ist es nicht verwunderlich, dass die Zwangserkrankung oft sekundär mit einer Depression verbunden ist. Rohde-Dachser schließt einen dadurch bedingten Suizid als letztem Ausweg nicht aus.[6]
Eine mangelhafte Aufklärung in der Öffentlichkeit verhinderte, dass viele Betroffene die Störung als Krankheit erkennen konnten.[7] Rasmussen vermutet, dass die Folgen von Zwangshandlungen, beispielsweise durch Waschrituale hervorgerufene Hautläsionen, die Patienten in die dermatologische Ambulanz führte. Die psychischen Hintergründe wurden nicht erkannt, psychiatrische Diagnostik und Therapie nicht in Anspruch genommen und die Krankheit epidemiologisch nicht erfasst. Erst eine zunehmende Immobilisierung oder das zusätzliche Auftreten einer schweren Depression machte den Besuch bei einem Psychotherapeuten unumgänglich.[8] Rasmussen/Eisen zufolge wandten sich viele Erkrankte zuerst an ihren Hausarzt, an religiöse Führer oder an Verwandte. Die Verheimlichungstendenz beruht auf einer Eigeneinschätzung der Betroffenen, die ihre Symptome als skurril betrachten und Angst davor haben, von anderen für verrückt gehalten zu werden.[9]
2. Epidemiologie, Prävalenz und transkultureller Vergleich
Schmalbachs Ausführungen ist zu entnehmen, dass die Zwangsstörung als seltene Krankheit mit schlechter Prognose angesehen wurde. Vor 15 Jahren ging man von einer kleinen Minderheit von 1-4 % der gesamten Patientenpopulation aus. Lediglich im Zusammenhang mit anderen psychiatrischen Erkrankungen und nicht als eigenes Krankheitsbild wurde sie erfasst.[10] - Der Autor beachtet dabei nicht, dass Sigmund Freud sie als lt;eigenes Krankheitsbild bereits in den Jahren 1894-1895 isolierte und sie unter der Bezeichnung Zwangsneurose vorstellte. – Rasmussen/Eisen berichten, dass in den USA die Zwangsstörung ebenfalls als seltene Krankheit betrachtet worden ist. Ende der fünfziger/Anfang der sechziger Jahre wurde ihre Prävalenz auf 5:10 000 der Gesamtbevölkerung geschätzt. In den siebziger Jahren stellte sich durch einen Aufruf in amerikanischen Zeitungen zu Forschungszwecken eine weit höhere Prävalenz heraus. In den achtziger Jahren wurde ihre Zahl allein im Stadtbereich von Washington auf 50.000 geschätzt.[11] Fortschritte in den Forschungsmethoden führten zu breit angelegten epidemiologischen Studien, so zu der ECA-Studie (NIMH Epidemiological Catchment Area). Diese Studie ergab eine Sechs-Monats-Prävalenz von 1,6%[12] und eine Lebenszeitprävalenz von 2,5%[13] in der US-amerikanischen Bevölkerung mit dem Ergebnis, dass diese Erkrankung 50 bis 100-mal häufiger auftrat, als bislang angenommen worden war. Diesen Ergebnissen zufolge steht die Zwangsstörung jetzt „nach Phobien, Alkohol- und Drogenmissbrauch sowie der ‚Major Depression’ an vierter Stelle der häufigsten psychiatrischen Erkrankungen.“[14] Ein Vergleich mit der Schizophrenie ergab bei den Autoren unterschiedliche Ergebnisse. Während Reinecker (1991) noch davon ausgeht, dass die Zahlenangaben etwa mit denen von Schizophrenien übereinstimmen,[15] kommen Rasmussen/Eisen (1999) auf Grund der ECA-Studie zu der Einschätzung, dass sie als doppelt so häufig einzustufen ist.[16]
Die Ergebnisse dieser Studie führen jetzt auch zu der Feststellung, dass die Zwangsstörung doppelt so häufig vorkommt wie die Panikstörung.[17] Auf diese Ergebnisse stützt sich die Aussage Schwab/Humphreys, dass in den USA die „Panikstörung der achtziger Jahre“ durch die Zwangsstörung „in den neunziger Jahren“ als abgelöst betrachtet wurde und diese zur „Störung des Jahrzehnts“[18] avancierte.
Ciupka stellt Anhaltzahlen aus Deutschland vor. Danach wird von mindestens einer Million Zwangskranker ausgegangen. Die Zwangserkrankung gehört damit in Deutschland zur fünftgrößten Gruppe seelischer Störungen.[19]
Rasmussen/Eisen berichten (1999) von Studien, die in anderen Ländern mit ähnlichen Methoden wie in Amerika durchgeführt wurden. Alle Studien ergaben ähnliche Prävalenzraten wie in den USA. Die Studien wurden in verschiedenen Kulturbereichen durchgeführt, in Kanada, Europa, Taiwan und Afrika.[20] Reinecker hatte (1991) ebenfalls auf eine ähnliche Prävalenz in anderen Ländern hingewiesen.[21] Auf den kulturellen Aspekt eingehend geht er davon aus, dass dieser sowohl bei Zwangshandlungen als auch bei Zwangsgedanken in die Überlegungen einzubeziehen ist. Zwangssymptome können kulturell oder subkulturell eingebaut oder „überformt“ sein. In allen Kulturen gibt es Rituale mit einer mehr oder weniger großen Bedeutung. Sie haben einen gesellschaftlichen oder religiösen Hintergrund und können auch als Regeln im Zusammenhang mit der Sexualität bedeutungsvoll sein. Inhaltlich haben sie alle eine Beziehung zu Versündigungs- oder Schuldthematiken.[22] Dem Ritual wird eine Angst- und Unsicherheit kompensierende Funktion zugesprochen. Auf den autoprotektiven Sinn und die Funktion der Angstbindung durch Zwänge bei ich-strukturellen Störungen weist ausdrücklich die psychoanalytische Forschung hin.[23] Lang sieht diese Funktion gleichfalls beim Neurotiker und dem Gesunden.[24]
Ein transkultureller Vergleich wurde von Pfeiffer (1971) durchgeführt.
Pfeiffer hat sich mit der Prävalenz von Phobien und Zwangssyndromen in anderen Kulturen befasst. Verbreiteter Meinung nach sollen sie „in traditionelle Kulturen zumindest als individuelle Reaktionsform fehlen.“ [25] Laubscher (1937), habe in diesem Zusammenhang „auf die Oberflächlichkeit der Verdrängung“ hingewiesen und La Barre (1946), eine großzügige Reinlichkeitserziehung betont. [26] Nach Pfeiffers Ansicht werden Zwangssymptomen in Entwicklungsländer entweder keine Bedeutung zugemessen oder sie werden mit landesüblichen Heilmethoden behandelt und von daher psychiatrisch selten erfasst. [27] Der Autor betont, dass in traditionsbestimmten Bauernkulturen phobische und zwanghafte Züge als weitestgehend „zum Normbild der Kultur“ [28] zugehörig betrachtet werden. Strenges Einhalten der Sitte und der Regeln der Religion sind üblich. Eine Nichtbeachtung könnte eine Ausgrenzung bedeuten und somit Angst und Missbehagen auslösen.
Beobachtungen auf Java und Bali mit einer überwiegend muslimischen Bevölkerung ergaben, dass Phobie und Zwang mit den Regeln des Islam und seinen Vorstellungen von Reinheit und dem Meiden des Unreinen eng verbunden sind. Rituelle, im Islam vorgeschriebene, umständliche Reinigungszeremonien sind die Norm und werden in der Regel als nicht belastend erlebt. Allerdings berichtet der Autor von dem Auftreten eines Zwangssyndroms in einer streng islamischen Gegend auf Java, das waswas genannt wird. Eine Feldstudie (1966/67) hatte ergeben, dass dieses Zwangsyndrom bei der Bevölkerung allgemein bekannt ist und die Bedeutung von „Zaudern“ und „Unsichersein“ hat. Es ist ein Begriff mit einer spezifisch religiösen Tönung. Dieses, mit islamischen Reinigungsritualen in Beziehung stehende Syndrom wird von daher nicht als medizinisches sondern als religiöses Problem betrachtet. Ein von diesem Zwangssyndrom Befallener steigert die vorgeschriebene dreimalige rituelle Waschung über das geforderte Maß hinaus bis zum Beginn des gemeinsamen Gebets der Gläubigen. Er glaubt sich durch ein Gefühl von Unreinheit dazu gezwungen. Eine ähnliche Reaktion zeigt sich bei der Anrufung Gottes, die bei diesen lt;Befallenen ebenfalls des Öfteren wiederholt werden muss, weil Zweifel die korrekten Reihenfolge des Gebets infrage stellen. Den Ausführungen Pfeiffers ist zu entnehmen, dass die waswas genannte Störung unter gleicher Bezeichnung auch aus dem Iran bekannt ist. Es wird davon ausgegangen, dass es sich um eine im Islam verbreitete Störung handelt, die bereits von Ghazzali im 11. Jahrhundert erwähnt wurde, der sich auf noch ältere Schriften bezieht. Die Störung wird als Anfechtung betrachtet. Weil sie den Menschen von seinem Auftrag der Heiligung abhält, darf ihr keine übermäßige Beachtung geschenkt werden. Der Teufel gilt als Urheber, der positiven Bewegungen der Gedanken eine negative Gegenbewegung zu geben vermag. Die lt;religiöse Beachtung dieses Zwangssyndroms führt im Islam jedoch zu dessen gesellschaftlicher Einordnung und beugt trotz des Leidensdrucks des Betroffenen „einer Dekompensation ins sozial Trennende und Untragbare weitgehend“[29] vor. Ähnliche Zwangsphänomene sind im Zusammenhang mit religiösen Ritualen auch aus Nepal und Indien bekannt. Sie betreffen zwanghaftes Aufsagen von Mantras, zwanghaftes Baden und das zwanghafte Einhalten von Speisevorschriften. Derartige Verhaltensweisen werden von der Umgebung zwar als ungewöhnlich empfunden, jedoch entweder toleriert oder als Betonung einer ausgeprägten Religiosität geachtet. Wie im Islam sind sie gut in das soziale Umfeld eingebunden.[30] Devereux äußert in einem ähnlichen Zusammenhang:
„Kurz, bei gewissen affektiv gestörten Subjekten ist der unbewusste Sektor der ethnischen Persönlichkeit nicht in dem Maße gestört, daß er sie zu einer totalen Revolte gegen sämtliche sozialen Normen veranlasste. Obgleich wirklich krank, neigen diese Subjekte dazu, der Kultur die Mittel zu entlehnen, die es ihnen erlauben, ihre subjektive Störung in konventioneller Weise zu demonstrieren, wenn auch nur um zu vermeiden, mit Kriminellen oder Zauberern verwechselt zu werden.“[31]
Pfeiffer hebt die psychologischen Zusammenhänge der Zwangssyndrome hervor. Seiner Feststellung nach sind bei den unter westlichem Einfluss stehenden Bevölkerungsgruppen lt;alle bekannten Zwangssyndrome zu finden. Eine Studie aus China beweist, dass sie auch dort anzutreffen sind. So hatte Bingham Dai den Zwangssyndromen bei chinesischen Patienten eine psychoanalytische Studie gewidmet. Dieser Autor geht von einer Verbreitung anankastischer Eigenschaften in der klassischen chinesischen Kultur aus und bezieht sich damit auf zwanghafte Aufopferungstendenzen autoritären Figuren gegenüber. Im Mittelpunkt der Zwangssymptome sieht er eine ambivalente Haltung. „Die Symptome werden als Versuch gedeutet, angesichts widersprechender tabuierte Triebansprüche (Aggression gegen Vaterfiguren, Rivalität mit Geschwistern), den kulturellen Erwartungen und dem eigenen Leitbild gemäße Formen des Menschseins (ergebener Sohn, fürsorglicher Bruder) zu finden.“[32] Der aus den Spannungen der Ambivalenz resultierenden Angst wird mit einem Zwangszeremoniell begegnet. Von Interesse ist, dass die Analyse von Zwangssyndromen chinesischer Patienten keine Anhaltspunkte bezüglich einer rigiden Sauberkeitserziehung erkennen ließ. Die Beobachtungen dieses Autors koinzidieren mit Annahmen Devereuxs. Devereux ist davon überzeugt, dass nicht kulturtypische Frustrationen und Befriedigungen während der lt;präödipalen Entwicklungsphase, beispielsweise die Sauberkeitserziehung, den ethnischen Charakter prägt. Für ihn ist dies der lt;ödipale Konflikt, welcher eine spezielle kulturelle Ausformung zeigt. Diesen Konflikt sieht er nicht nur in Europa, sondern in allen Gesellschaften, auch den primitiven, als „ Motor der Charakterentwicklung.“[33]
Inzwischen wird davon ausgegangen, dass von der Zwangsstörung weltweit 1-2% der Gesamtbevölkerung betroffen sind.[34] Auf Grund dieser neuen Werte besitzt diese Krankheit keinen Seltenheitswert mehr und fordert Wissenschaftler und Kliniker heraus, diese Störung genauer zu erforschen und umfassende Therapien zu entwickeln. Die Annahme, dass viele Zwangsgestörte ihre Krankheit verheimlichten und sich nie um fachlich fundierte therapeutische Hilfe bemüht hatten, schien sich auf Grund der neuen Prävalenzwerte zu bestätigen.[35]
Die erhöhten Prävalenzwerte sind das Ergebnis neuer epidemiologischer Forschungsmethoden. Es stellt sich die Frage, weshalb die Prävalenz bis dahin als wesentlich niedriger eingeschätzt wurde.
Dies ist zum einen in der Forschung selbst begründet. Zwangserscheinungen wurden nicht erkannt, weil sie Ursache einer anderen Krankheit, beispielsweise einer Hautläsion,[36] waren und man sie als eigenständige Krankheit nicht erfasste. In der Psychiatrie wurden sie als Begleitsymptome einer psychiatrischen Grunderkrankung eingestuft. So traten sie als eigenes Krankheitsbild nicht in Erscheinung und konnten gleichfalls nicht registriert werden.[37] Ein anderer Gesichtspunkt für die Dunkelziffer ist die Verheimlichungstendenz Zwangsgestörter. Eine der Zwangsstörung zu Grunde liegende Ich-Dystonie wird von allen Autoren als kausal angenommen. Diese Verheimlichungstendenz konnte jetzt durch eine verstärkte Öffentlichmachung durchbrochen werden. Informationen über Ursachen der Störung, neue Therapien und neue Medikamente scheint Zwangsgestörte zur Therapie zu motivieren. Ein Nebeneffekt dieser Öffentlichmachung kann darin bestehen, dass, wie Schwab/Humphrey vermuten, nicht nur eine neue Therapieform sondern auch ein wirksames Medikament eine neue Krankheit provozieren kann.[38] Ein anderer Nebeneffekt ist ein möglicher Krankheitsgewinn, der sich dadurch einstellt, dass eine Störung gesellschaftlich einen Krankheitswert erhält. Das hatte Habermas im Zusammenhang mit der Bulimie festgestellt. Die Veröffentlichungen hätten „den Zwang zur Heimlichkeit abgemildert.“[39] Die Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Zwangsstörung hat ohne Frage die Annahme einer hohen Dunkelziffer bestätigt und kann auf den geschilderten Wegen zur Erhöhung der Prävalenz beigetragen haben.
Auch soziokulturelle Faktoren können als Ursache der erhöhten Prävalenz infrage kommen. So hatte James L. Haliday in seinem klassischen Werk Psychosocial Medicine: A Study of the Sick Society (1946) eine reale Häufigkeitszunahme vorausgesehen. Bezogen auf die Zeit zwischen 1870 und den vierziger Jahren des 20sten Jahrhunderts, sieht er zwischen dem Auftreten der anankastischen Persönlichkeit mit ihren Spannungen, Fehlfunktionen sowie ihren Zwangssymptomen und den Erziehungspraktiken in England einen Zusammenhang.[40]
Die erhöhte Prävalenzrate der Zwangserkrankung kann auch „als quantitativer Ausdruck eines qualitativen gesellschaftlichen Freisetzungs-Symptoms“[41] gewertet werden.
Überlegungen Reiches im Zusammenhang mit sog. lt;frühen Störungen führen in Verbindung mit der Zwangserkrankung zu einer Annahme, die als weitere Erklärung für deren erhöhte Prävalenz dienen kann:
[...]
[1] Knölker, U.: Zwangssyndrome im Kindes- und Jugendalter, (1987), S. 19.
[2] Adams, P. L.: Obsessive Children, Brunner/Mazel, New York, (1973), zit. n. Knölker, U.: Zwangssyndrome im Kindes- und Jugendalter, (1987), S. 19.
[3] Adams, P. L.: Obsessive Children, Brunner/Mazel, New York, (1971), zit. n. Knölker, U.: Zwangssyndrome im Kindes- und Jugendalter, (1987), S. 19-22.
[4] Zohar, J., Insel, T. R.: Diagnosis and treatment of obsessive-compulsive disorder, in Psychiatric Annals 18, (1988), 168-171, zit. n. Kapfhammer H. P.: Anankastische Syndrome in der Psychiatrie und ihre Therapie, in (Hg. Nissen. G.): Zwangserkrankungen, (1996), S. 31.
[5] Freud, S.: Zwangshandlungen und Religionsausübung, (1907b), GW 7, S. 131.
[6] Rohde-Dachser, Ch.: Klinik der Neurosen, in (Hg. Machleidt, W. et al): Psychiatrie, Psychosomatik, Psychotherapie (1999), S. 95.
[7] Zohar, J., Insel, T. R.: Diagnosis and treatment of obsessive-compulsive disorder, in Psychiatric Annals 18, (1988), S. 168-171, zit .n. Kapfhammer H. P.: Anankastische Syndrome in der Psychiatrie und ihre Therapie, in (Hg. Nissen. G.): Zwangserkrankungen (1996), S. 31.
[8] Rasmussen, St. A.: Obsessive-compulsive disorder in dermatologic pratice, in J. Am. Acad. Dermatol. 13, (1986), S. 965-967. zit. n. Kapfhammer, H. P.: Anankastische Syndrome in der Psychiatrie und ihre Therapie, in (Hg. Nissen G.): Zwangserkrankungen, (1996), S. 31.
[9] Rasmussen, St. A., Eisen, J. L.: Epidemiologie und Differentialdiagnosen von Zwangsstörungen, in (Hg. Hohagen, F., Ebert, D.): Neue Perspektiven in Grundlagenforschung und Behandlung von Zwangsstörungen, (1999), S. 14.
[10] Schmalbach, St.: Diagnostik, Epidemiologie und Verlauf der Zwangsstörungen, in (Hg. Ambühl, H.): Psychotherapie der Zwangsstörungen, (1998), S. 19.
[11] Rasmussen, St. A., Eisen, J. L.: Epidemiologie und Differentialdiagnosen von Zwangsstörungen, in (Hg. Hohagen, F., Ebert, D.): Neue Perspektiven in Grundlagenforschung und Behandlung von Zwangsstörungen, (1999), S. 10.
[12] Myers, JK, Weissmann, MM., Tischler, GL et al: Six month prevalence of psychiatric disorders in three communities 1980 to 1982, in Arch Gen Psychiatry (1984), 41, 949-958, zit. n. Rasmussen, St. A., Eisen, J. L.: Epidemiologie und Differentialdiagnosen von Zwangsstörungen in (Hg. Hohagen, F., Ebert, D.): Neue Perspektiven in Grundlagenforschung und Behandlung von Zwangsstörungen, (1999), S. 11
[13] Robins, LN, Helzer, JE, Weissmann MM et al: Lifetime prevalence of specific psychiatric disorders in three sites in Arch Gen Psychiatry (1984), 41, 958-967, zit. n. Rasmussen, St. A., Eisen, J. L.: Epidemiologie und Differentialdiagnosen von Zwangsstörungen, in (Hg. Hohagen, F., Ebert, D.): Neue Perspektiven in Grundlagenforschung und Behandlung von Zwangsstörungen, (1999), S. 11.
[14] Rasmussen, St. A., Eisen, J. L.: Epidemiologie und Differentialdiagnosen von Zwangsstörungen, in (Hg. Hohagen, F., Ebert, D.): Neue Perspektiven in Grundlagenforschung und Behandlung von Zwangsstörungen, (1999), S. 11.
[15] Reinecker, H. S.: Zwänge, (1991), S. 9.
[16] Rasmussen, St. A., Eisen, J. L.: Epidemiologie und Differentialdiagnosen von Zwangsstörungen, in (Hg. Hohagen, F., Ebert, D.): Neue Perspektiven in Grundlagenforschung und Behandlung von Zwangsstörungen, (1999), S. 11.
[17] Rasmussen, St., Eisen, J. L.: Epidemiologie und Differentialdiagnosen von Zwangsstörungen, in (Hg. Hohagen, F., Ebert, D.): Neue Perspektiven in Grundlagenforschung und Behandlung von Zwangsstörungen, (1999), S. 11.
[18] Schwab, J. J., Humphrey, L.: Zwangserkrankungen und Familie, in (Hg. Nissen, G.): Zwangserkrankungen, (1996), S. 155.
[19] Ciupka, B.: Selbsthilfegruppen Zwangskranker, in (Hg. Ecker, W.): Die Behandlung von Zwängen, (2002), S. 15.
[20] Rasmussen, St. A., Eisen, L.: Epidemiologie und Differentialdiagnosen von Zwangsstörungen, in (Hg. Hohagen, F., Ebert, D.): Neue Perspektiven in Grundlagenforschung und Behandlung von Zwangsstörungen, (1999), S. 13.
[21] Vgl. Reinecker, H. S.: Zwänge, (1991), S. 9.
[22] Reinecker, H. S.: Zwänge, (1991), S. 46.
[23] Vgl. Quint, H.: Die Zwangsneurose aus psychoanalytischer Sicht, (1988), S. 79, 80; Mentzos, St.: Neurotische Konfliktverarbeitung, (2000), S. 162, 163; Csef, H.: Psychodynamik und psychoanalytische Therapie der Zwangsstörung, in (Hg. Ecker, W.): Die Behandlung von Zwängen, (2002), S. 157.
[24] Lang, H.: Ätiologie und Aufrechterhaltung der Zwangsstörungen aus psychodynamischer Sicht, in (Hg. Ambühl, H.): Psychotherapie der Zwangsstörungen, (1998), S. 29.
[25] Pfeiffer, W., M.: Transkulturelle Psychiatrie, (1971), S. 59.
[26] Laubscher, J. F.: Sex, Custom and Psychopathology, A study of South African pagan Natives. Routledge amp; Sons, London (1937), zit. n. Pfeiffer, W. M.: Transkulturelle Psychiatrie, (1971);
La Barre, W.: Some observations on character structure in the orient. The Chinese. in Psychiatry 9, (1946), 215-237; 375-395, zit. n. Pfeiffer, W. M., Transkulturelle Psychiatrie, (1971), S. 59.
[27] Pfeiffer, W. M.: Transkulturelle Psychiatrie, (1971), S. 59.
[28] Pfeiffer, W. M.: Transkulturelle Psychiatrie, (1971), S. 60.
[29] Pfeiffer, W. M.: Transkulturelle Psychiatrie, (1971), S. 64.
[30] Pfeiffer, W. M.: Trauskulturelle Psychiatrie, (1971), S. 65.
[31] Devereux, G.: Normal und anormal, (1974), S. 74.
[32] Pfeiffer, W. M.: Transkulturelle Psychiatrie, (1971), S. 65.
[33] Devereux, G.: Normal und anormal, Wulff, E., Einleitung: Fragen an Devereux, (1974), S. 8.
[34] Rasmussen, St. A., Eisen, J. L.: Epidemiologie und Differentialdiagnosen von Zwangsstörungen, in (Hg. Hohagen, F., Ebert, D.): Neue Perspektiven in Grundlagenforschung und Behandlung von Zwangsstörungen, (1999), S. 11.
[35] Rasmussen, St. A., Eisen, J. L.: Epidemiologie und Differentialdiagnosen von Zwangsstörungen, in (Hg. Hohagen, F., Ebert, D.): Neue Perspektiven in Grundlagenforschung und Behandlung von Zwangsstörungen, (1999), S. 11.
[36] Rasmussen, S. A.: Obsessive-compulsive disorder in dermatologic pratice, J. Am. Acad. Dermatol. 13, (1986), S. 965-967. zit. n. Kapfhammer, H. P.: Anankastische Syndrome in der Psychiatrie und ihre Therapie, in (Hg. Nissen G.): Zwangserkrankungen, (1996), S. 31.
[37] Schmalbach, St.: Diagnostik, Epidemiologie und Verlauf der Zwangsstörungen, in (Hg. Ambühl, H.): Psychotherapie der Zwangsstörungen, (1998), S. 19.
[38] Schwab, J. J., Humphrey, L.: Zwangserkrankungen und Familie, in (Hg. Nissen, G.): Zwangserkrankungen, (1996), S. 156.
[39] Vgl. Habermas, T.: Zur Geschichte der Magersucht, eine medizinpsychologische Rekonstruktion, (1994). S. 194ff.
[40] Halliday, J. L.: Psychosocial Medicine, A Study of the Sick Society, (1946), zit. n. Schwab, J. J., Humphrey, L.: Zwangserkrankungen und Familie, in (Hg. Nissen, G.): Zwangserkrankungen, (1996), S. 157.
[41] Reiche, R.: Haben frühe Störungen zugenommen?, in Psyche, Nr. 7, 45. Jg, (1991), S. 1052.
- Arbeit zitieren
- Ortrud Neuhof (Autor:in), 2004, Psychischer Zwang. Ein pathologisches Phänomen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/284255
Kostenlos Autor werden
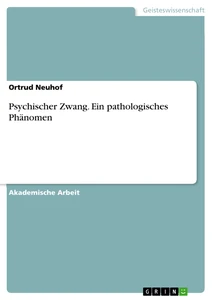
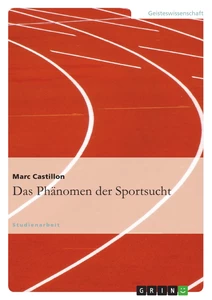

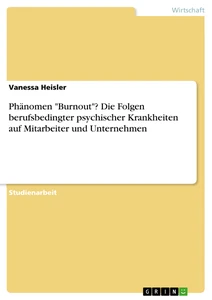
















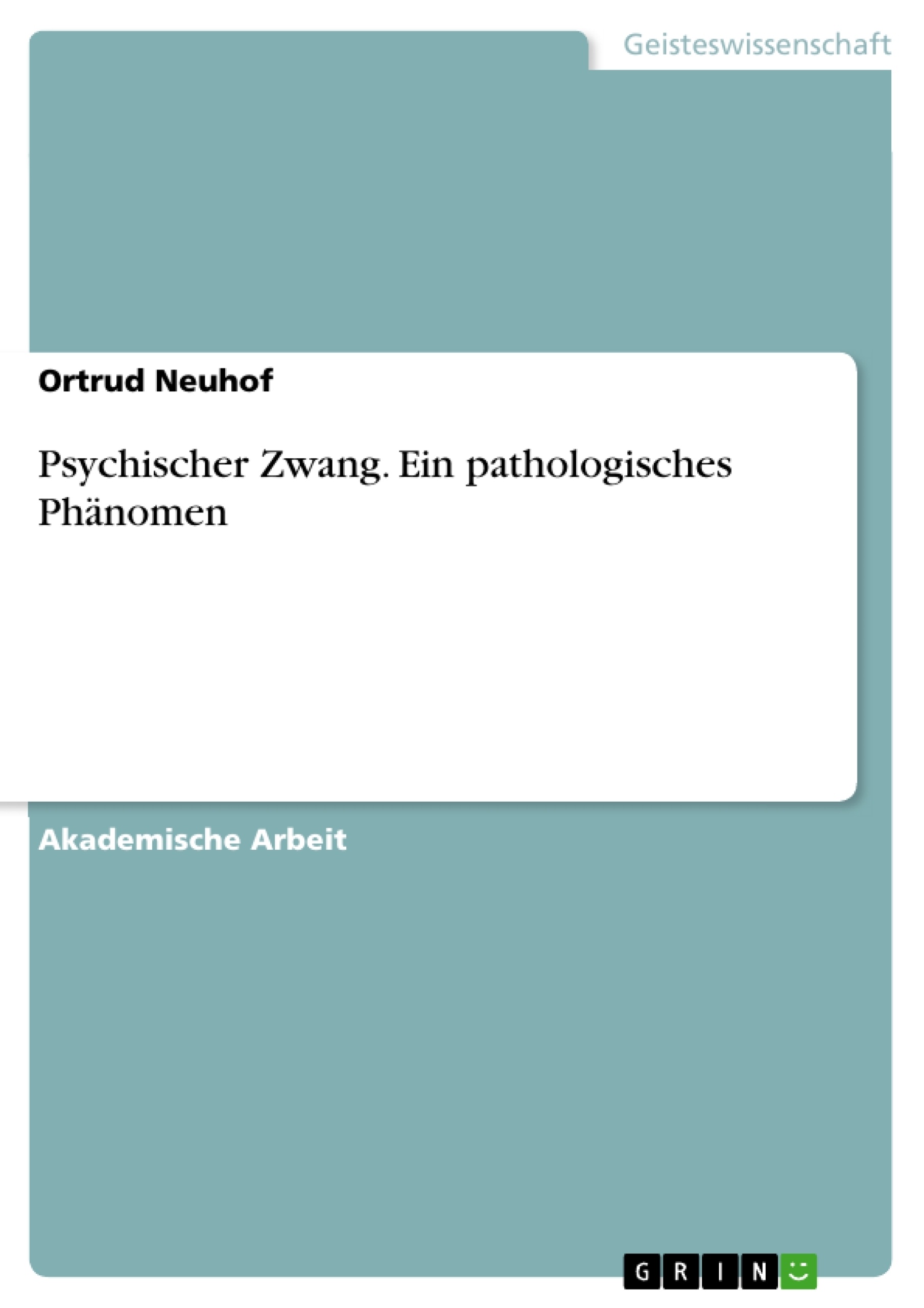

Kommentare