Excerpt
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
1 Einleitung
2 Entstehung des Sozialstaatsprinzips in Deutschland
2.1 Sozialgesetzgebung unter Bismarck
2.2 Weimarer Republik
2.3 Bundesrepublik Deutschland
3 Maßnahmen zur Unterstützungsleistung des „Aufbaus Ost“
3.1 Staatsvertrag vom 18. Mai 1990
3.1.1 Währungsunion
3.1.2 Wirtschaftsunion
3.1.3 Sozialunion
3.2 Fonds „Deutsche Einheit“
3.3 Bund-Länder-Finanzausgleich
4 Solidarpakt zwischen Bund und Ländern
4.1 Ausgangslage
4.2 Finanzielle Kennzahlen
4.3 Gesamtsituation der neuen Bundesländer
4.4 Perspektive nach 2019
5 Solidaritätszuschlag
5.1 Gesetzliche Grundlage und Begründung der Einführung
5.2 Entwicklung des Finanzvolumens seit Einführung des Solidaritätszuschlags
5.3 Finanzielle Defizite bei Beendigung des Solidaritätszuschlags
5.4 Zukunftsperspektive
6 Fazit
Literaturverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: Höhe der Zahlungen an die ostdeutschen Bundesländer im Rahmen des Solidarpakts II von 2005 bis 2019 (in Mrd. Euro)
Abb. 2: Mittelverausgabung im Rahmen des Solidarpakts II
Abb. 3: Zusammengefasste Verwendung der SoBEZ 2005 bis 2012
Abb. 4 Einnahmen Solidaritätszuschlag im Zeitraum 1991–2013 in Mrd. Euro
Abb. 5 Einnahmen Solidaritätszuschlag vs. Ausgaben Solidarpakt II in Mrd. Euro
Abb. 6: Mindereinnahmen Solidaritätszuschlag bei abgesenkten Zuschlagssätzen
Abb. 7: Mindereinnahmen Solidaritätszuschlag bei Erhöhung der Freigrenze
Tabellenverzeichnis
Tab. 1: Finanzierung des FDE in Mrd. DM
Tab. 2: Gemeinschaftssteuern (2014)
Tab. 3: Ausgleich der Finanzkraftunterschiede durch den Länderfinanzausgleich und die allgemeinen Bundesergänzungszuweisungen
Tab. 4: Vergleich von West- und Ostdeutschland vor der Wiedervereinigung im Jahr 1988 bzw. 1989
1 Einleitung
Die friedliche Revolution in der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) im Herbst 1989 und der anschließende Fall der Berliner Mauer waren der Anstoß für den folgenden Prozess zur Vereinigung mit der Bundesrepublik Deutschland (BRD) im Jahr 1990. Nach der anfänglichen Euphorie über die Wiedervereinigung wurde offensichtlich, dass der Angleichungsprozess länger andauern sollte als anfänglich antizipiert. Das Ausmaß der gescheiterten Planwirtschaft in der DDR wurde anfangs unterschätzt und die wirtschaftliche Situation führte dazu, dass immer mehr finanzielle Unterstützungsmittel für den ausgerufenen „Aufbau Ost“ zur Verfügung gestellt werden mussten.
Durch die Einführung eines befristeten Solidaritätszuschlags für die Jahre 1991 und 1992 sollte ein finanzieller Beitrag aller Bevölkerungsgruppen zu den Kosten der Einheit geleistet werden. Im Jahr 1995 wurde der Solidaritätszuschlag erneut eingeführt. Doch diesmal wurde der Erhebungszeitraum nicht mehr befristet. Daher wird der Solidaritätszuschlag auch knapp 20 Jahre nach seiner Wiedereinführung weiterhin als Ergänzungsabgabe erhoben.
Im Bezug auf die politische und finanzielle Unterstützungsleistung für den „Aufbau Ost“ konnte ein Kompromiss zwischen der Bundesregierung und den Bundesländern erzielt werden. Dabei sicherten die alten Bundesländer ihre finanzielle Beteiligung an den Unterstützungsleistungen für den Osten zu. Auf den Fonds „Deutsche Einheit“ im Zeitraum 1990 bis 1994 folgte ab dem Jahr 1995 ein Solidarpakt im Rahmen des Bund-Länder-Finanzausgleichs durch die Bereitstellung von Zuweisungen. Der Solidarpakt hatte ursprünglich eine Laufzeit bis einschließlich 2004 und wurde bereits 2001 bis zum 31. Dezember 2019 verlängert.
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit soll untersucht werden, inwieweit eine Fortführung von Solidaritätszuschlag und Solidarpakt nach 2019 weiterhin gerechtfertigt ist oder ob nach über 20 Jahren der deutschen Einheit diese Instrumente obsolet geworden sind. Um diese Frage zu beantworten, wird im Kapitel 2 der Weg Deutschlands zu einem sozialen Bundesstaat aufgezeigt. Darauf folgend werden im Kapitel 3 ausgewählte Maßnahmen zur Konsolidierung des vereinigten Deutschlands dargestellt und beschrieben. Beginnend mit dem Staatsvertrag vom 18. Mai 1990, der die Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion regelt, werden die ersten Umsetzungsmaßnahmen im Integrationsprozess diskutiert. Dabei werden die staatspolitischen Handlungen dargelegt, die eine Zusammenführung der bis dahin getrennten deutschen Staaten ermöglichten. In einem weiteren Schritt wird mit dem Fonds „Deutsche Einheit“ das Finanzpaket beschrieben, das eine erste finanzielle Unterstützungsleistung durch den Bund und die (alten) Länder zur Deckung der Finanzkraft im Osten sicherstellte. Der Fonds stellte die Alternative zur unmittelbaren Einbeziehung in den Bund-Länder-Finanzausgleich dar. Die Aufnahme der neuen Bundesländer in den genannten Finanzausgleich erfolgte ab dem Jahr 1995 und wird im Rahmen dieser Ausarbeitung mit den derzeit geltenden Regelungen aufgezeigt.
Unter Berücksichtigung der einschlägigen Literatur werden in Kapitel 4 und 5 die Kerninhalte des Solidarpakts und Solidaritätszuschlags eruiert. Darüber hinaus wird ein Ausblick darauf gegeben, inwieweit die Forderung der Politik und der betroffenen Gebietskörperschaften nach einer Beibehaltung bzw. Modifikation der laufenden Maßnahmen gerechtfertigt ist. Um eine angemessene Einschätzung der Gegebenheiten nachzuvollziehen, sollen themenorientierte Studien von führenden Wirtschaftsforschungsunternehmen einbezogen werden.
2 Entstehung des Sozialstaatsprinzips in Deutschland
2.1 Sozialgesetzgebung unter Bismarck
Ende des 19. Jahrhunderts verfestigte sich die Gestaltung einer staatlich sozialen Grundordnung. Das Deutsche Reich respektive das deutsche Kaiserreich wurde offiziell proklamiert.
Die Zusammenführung der bisher getrennten deutschen Gebiete zu einem Staatenbund wurde unter der Führung Preußens realisiert. Mit Otto von Bismarck als Reichskanzler begannen die ersten Ansätze eines föderativen Staatsaufbaus. Obwohl das Deutsche Reich in dieser Zeit endgültig zu einem Industriestaat avancierte, mehrten sich die Anzeichen von Unzufriedenheit innerhalb der Gesellschaft. Trotz der Industrialisierung und des damit verbundenen Konjunkturaufschwungs bestanden weiterhin soziale Missstände. Die vorhandenen Sicherungssysteme für Arbeitnehmer erfüllten nicht annähernd die notwendigsten sozialen Bedürfnisse der Gesellschaft. Die Gewerkschaften sowie die Vertreter der 1869 gegründeten Sozialdemokratischen Arbeiterpartei wurden als zentrale Botschafter in Fragen der sozialen Grundnorm gegenüber dem Staat wahrgenommen. Reichskanzler Otto von Bismarck sah die Proteste und Forderungen der Arbeiterparteien und Gewerkschaften als bedeutende Gefahr der inneren Grundordnung des noch neuen Reiches. Zwei gescheiterte Attentatsversuche auf Kaiser Wilhelm I. gaben Reichskanzler von Bismarck Anlass, das „Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie“, auch als Sozialistengesetz bezeichnet, einzuführen. Nach Inkrafttreten dieser Rechtsordnung wurden Vertreter der Parteien und Gewerkschaften zu Gefängnis- oder Zuchthausstrafen verurteilt. Eine endgültige Unterdrückung und damit die Verbannung linksgerichteter Strömungen aus der Gesellschaft gelangen jedoch nicht. Weiterhin konnten sozialistische Parteien an der Reichstagswahl teilnehmen und gewählt werden. Reichskanzler von Bismarck erkannte daraufhin die Notwendigkeit von Reformen. Mit der „Kaiserlichen Botschaft vom 17. November 1881“ wurden zukünftige Strukturänderungen im Sozialwesen definiert. Ziel war es, den Einfluss der Parteien und Gewerkschaften zu mindern und gleichzeitig die Arbeiter in Fragen der sozialen Absicherung in den Verantwortungsbereich des Staates zu integrieren.
Mit der Verabschiedung des Gesetzes zur Krankenversicherung durch den Reichstag im Jahr 1883 erfolgte ein weiterer Schritt in Richtung eines staatlich geregelten Sozialwesens. Inhaltliche Eckpunkte sahen vor, dass alle Arbeiter mit einem Jahreseinkommen von bis zu 2000 Reichsmark (RM) automatisch krankenversichert wurden. Die Versicherungsbeiträge setzten sich zu zwei Drittel aus der Eigenbeitragsleistung des Arbeitnehmers und zu einem Drittel aus dem Beitrag des Arbeitgebers zusammen. Der Zeitraum des maximalen Leistungsbezugs betrug im Krankheitsfall 13 Wochen. Die Inanspruchnahme ärztlicher Leistungen und Medikamente waren kostenlos und im Sterbefall erhielten die Hinterbliebenen Sterbegeld. Darüber hinaus wurde festgelegt, dass alle zugelassenen Krankenkassen unter staatlicher Kontrolle agierten.
Weitere Anpassungen konnten im Bereich der Unfallvorsorge umgesetzt werden. Mit dem Unfallversicherungsgesetz aus dem Jahr 1884 wurde das Haftpflichtgesetz von 1871 novelliert. Die tragenden Regelungen sahen vor, dass zukünftig allein die Arbeitgeber die anfallenden Versicherungsbeiträge einzahlten. Als Träger der Unfallversicherung wurden die Berufsgenossenschaften gegründet.
Für die Altersvorsorge stimmte der Reichstag 1889 dem „Gesetz betreffend die Invaliditäts- und Altersversicherung“ zu. Die Altersrente war prioritär als ergänzende Unterstützungsleistung zum Lebensunterhalt gedacht, da ein Ausscheiden aus dem Berufsleben nicht vorgesehen war. Anspruchsvoraussetzung war die Vollendung des 69. Lebensjahres. Die Finanzierung erfolgte über Beitragszahlungen der Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Von staatlicher Seite wurde die Altersvorsorge durch einen Reichszuschuss unterstützt.
Otto von Bismarck hatte mit der Einführung der Sozialgesetze den Grundstein für den deutschen Sozialstaat gelegt.1
2.2 Weimarer Republik
Nachdem der Erste Weltkrieg mit einer Kapitulation des deutschen Kaiserreichs endete und im Jahr 1918 eine Revolution ausbrach, wurde mit der Weimarer Republik die parlamentarische Demokratie eingeführt.2 Mithilfe des Dawes-Plans vom 1. September 1924 gelang es, die wirtschaftliche Leistung wieder zu erhöhen und bis 1929 einen Konjunkturaufschwung herbeizuführen. Mit der Aufnahme Deutschlands in den Völkerbund zum 10. September 1926 wurden weitere Weichen für die Reintegration des Deutschen Reiches in der internationalen Staatengemeinschaft gestellt.3 Neben der wirtschaftlichen Renaissance erlebte die deutsche Gesellschaft ebenso einen strukturellen Wandel. Mit dem Zuwachs um 2,8 Mio. Bürger zwischen 1925 und 1933 erreichte das Bevölkerungsniveau wieder den Vorkriegszustand. Dies führte dazu, dass der Zuzug in städtische Ballungsräume zunahm. Der Anteil der Bevölkerung, der in Großstädten mit über 100.000 Einwohnern lebte, stieg um 3,6 Prozent auf 30,4 Prozent. Dem gegenüber stand eine Abnahme der Erwerbspersonen in der Landwirtschaft von 30,5 Prozent auf 28,9 Prozent aller Erwerbstätigen. Einen Aufschwung erlebte der Dienstleistungsbereich. Hier war eine Steigerung von 3,3 Prozent in der Zahl der Erwerbstätigen zu verzeichnen. Ein signifikanter Wandel erfolgte ebenfalls in den politischen Strukturen. Es bestand nunmehr, unabhängig der sozialen Herkunft die Möglichkeit, politische Verantwortung zu übernehmen.4
Mit der Gründung der Weimarer Republik ergaben sich nicht nur politische und wirtschaftliche Neuausrichtungen. Mit dem Beschluss vom 31. Juli 1919 wurde die Weimarer Verfassung durch die Nationalversammlung beschlossen und trat am 14. August 1919 in Kraft.5 Das von Bismarck initiierte Sozialversicherungswesen wurde in Artikel 161 der Verfassung aufgenommen.6 Nicht nur die Aufnahme der staatlich verankerten Sicherungssysteme initiierte die Entstehung eines Sozialstaats. Durch die hohen Kosten des Staatsaufbaus und die Implementierung der Sozialpolitik erfolgte eine Modifizierung der Finanzverwaltung und des Steuersystems. Diese sah vor, dass zukünftig 39 Prozent des Steueraufkommens dem Reich zur Verfügung standen. Die Länder wurden mit 23 Prozent und die Gemeinden mit 38 Prozent am Gesamtsteueraufkommen beteiligt. Die Einführung der Erbschaftssteuer sowie mehrerer einmaliger Abgaben für Vermögende sollte ebenfalls als Finanzierungsinstrument dienen und somit mehr soziale Gerechtigkeit verwirklichen.7
Die Erfolge der noch jungen Republik endeten mit dem Börsencrash vom 24. Oktober 1929. In dessen Folge kam es zu erheblichen Unternehmensinsolvenzen. Die Arbeitslosenzahl stieg im Winter 1929/1930 auf mehr als drei Mio. Menschen an. Durch den Börsencrash und den damit verbundenen Beginn der Verarmung großer Teile der Bevölkerung entstand der Nährboden für den kommenden Nationalsozialismus.8
2.3 Bundesrepublik Deutschland
Nach dem Scheitern der Weimarer Republik und nach der Entstehung einer nationalsozialistischen Herrschaft begann am 1. September 1939 der Zweite Weltkrieg. Infolge der bedingungslosen Kapitulation zum 8. Mai 1945 wurde das Deutsche Reich in vier Besatzungszonen aufgeteilt. Die Siegermächte Sowjetunion, Großbritannien und die Vereinigten Staaten von Amerika regelten die Neugestaltung Deutschlands auf der Potsdamer Konferenz. Frankreich stimmte den Regelungen im Nachgang zu.9 Im Jahr 1947 erfolgte der Zusammenschluss des amerikanischen und britischen Sektors. Infolgedessen wurde ein Bizonen-Parlament einberufen, das unter Beteiligung der Alliierten die Grundlage einer neuen Wirtschaftsordnung vorbereiten sollte. Die Einführung der Sozialen Marktwirtschaft und die Währungsreform im Jahr 1948 ermöglichten einen ökonomischen Aufschwung. Hingegen wurde in der sowjetisch besetzten Zone eine sozialistische Planwirtschaft eingeführt. Die anschließende Währungsreform bedeutete das Ende der gesamtdeutschen Währung. Durch einen Beschluss der Westmächte und der Benelux-Staaten im Frühjahr 1948 wurde die Gründung eines westdeutschen Staates entschieden. Unter Beteiligung der westdeutschen Länder sollte eine verfassunggebende Versammlung einberufen und die Neugliederung der Länder umgesetzt werden. In den Verhandlungen mit den Alliierten konnten die westdeutschen Politiker durchsetzen, dass das Grundgesetz (GG) nur als Übergangsregelung gelten sollte, bis eine gesamtdeutsche Lösung gefunden werden konnte. Durch den Parlamentarischen Rat wurde das GG am 8. Mai 1949 verabschiedet und am 23. Mai 1949 verkündet. Die BRD war damit gegründet. Für die sowjetische Besatzungszone wurde die unter Mitwirkung der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED) erstellte Verfassung durch den Volksrat zugestimmt und diese trat am 7. Oktober 1949 in Kraft. Damit wurde die DDR als zweiter deutscher Staat gegründet.10 Die Soziale Marktwirtschaft als gesellschaftliches und wirtschaftliches Leitbild führte in der BRD den sukzessiven Ausbau des deutschen Sozialstaats herbei. Während in Westdeutschland die Sozialversicherung wieder aufgebaut und erneuert wurde, entstand in der DDR eine Einheitsversicherung. Die in der BRD geltenden Sozialstaatsprinzipien sahen vor, die soziale Gerechtigkeit in das Zentrum sozialstaatlichen Handelns zu stellen. Um der Bedeutung der Sozialstaatlichkeit besonderen Ausdruck zu verleihen, ist im Artikel 20 GG normiert, dass die BRD ein „demokratischer und sozialer Bundesstaat“ ist.11 Eine Änderung dieses Prinzips ist – wie auch eine Änderung von Artikel 1 GG – nach Artikel 79 Abs. 3 GG unzulässig. Die soziale Sicherheit beruht darauf, dass Bürger in einer existenziellen Notlage Unterstützungsleistungen durch die Solidargemeinschaft empfangen.12
3 Maßnahmen zur Unterstützungsleistung des „Aufbaus Ost“
3.1 Staatsvertrag vom 18. Mai 1990
Mit dem Fall der Berliner Mauer und dem anschließenden Zusammenbruch der DDR im Herbst 1989 stellte sich mittelfristig die Frage nach der deutschen Einheit. In der ersten freien demokratischen Wahl der DDR am 18. März 1990 wurde mit Lothar de Maizière ein Befürworter der deutschen Einheit zum Ministerpräsidenten gewählt. In den anschließenden Gesprächen zwischen der BRD und der DDR wurden die ersten Maßnahmen für die Vereinigung der beiden deutschen Staaten vereinbart. Mit dem Staatsvertrag vom 18. Mai 1990 erfolgte die Umsetzung der Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion (WWSU) zum 1. Juli 1990. Dieser Vertrag stellte eine Rechtsanpassung der DDR sicher. De facto wurde damit die Integration der DDR in den hoheitlichen Einflussbereich der BRD beschlossen. Die Regelungen sahen die Einführung der Deutschen Mark (DM) als neues Zahlungsmittel in der DDR vor. Die Unterzeichnung und Umsetzung des Staatsvertrags lösten einen ambivalenten Zustand aus. Zum einen sollte mit der Währungsumstellung auch die Abwanderung aus dem Osten minimiert werden. Auf der anderen Seite gab es Zweifel am Erfolg einer voreiligen Einführung der DM in der DDR. Grund für die Skepsis waren der angestrebte und schlussendlich durchgeführte Wechselkurs sowie der zeitlich anvisierte Rahmen der Umsetzung. So plädierte der damalige Bundesbankpräsident Karl Otto Pöhl in einem Spiegel-Interview auf ein geordnetes Vorgehen und gegen eine überstürzte Einführung der DM.13 Damit teilte Bundesbankpräsident Pöhl die Haltung des „Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung“. In einem Brief vom Vorsitzenden des Sachverständigenrates, Prof. Dr. Hans K. Schneider, an Bundeskanzler Helmut Kohl vom 9. Februar 1990 wurde vor einer eiligen Umsetzung der Währungsunion gewarnt. Schneider priorisierte vorrangig die Reform des Wirtschaftssystems und plädierte für eine verzögerte Einführung der Währungsunion. Notwendige Unternehmensreformen sollten zuerst die Wettbewerbsfähigkeit schärfen und so die Konkurrenzsituation auf dem Markt verbessern und wirtschaftliche Nachhaltigkeit gewährleisten.14 Trotz aller Bedenken wurde zum 1. Juli 1990 die WWSU umgesetzt. Neben der Einführung einer neuen Währungs- und Wirtschaftsordnung wurde das soziale Sicherungssystem der BRD adaptiert.15 Die Implementierung der Sozialen Marktwirtschaft als wirtschaftspolitisches Instrument war ein zentraler Impuls gesellschaftlicher Veränderungen in Ostdeutschland.
In einem weiteren Schritt wurde am 31. August 1990 der Einigungsvertrag zwischen der BRD und DDR geschlossen. Der endgültige Schlusspunkt des Vereinigungsprozesses erfolgte mit der Zustimmung der Siegermächte des Zweiten Weltkriegs im „Zwei-plus-Vier Vertrag“. Die BRD, nun als vereintes Land, erlangte damit die volle Souveränität zurück.16
Im Folgenden werden die währungspolitischen, wirtschaftlichen und sozialstaatlichen Aspekte der Vereinigung dargestellt.
3.1.1 Währungsunion
Mit der Einführung der DM in der DDR zum 1. Juli 1990 ergaben sich weitreichende Veränderungen und Herausforderungen für die Bundesrepublik. Die DM wurde alleiniges Zahlungsmittel. Die Bundesbank war federführend für den Wechsel der Geld- und Währungspolitik in der DDR verantwortlich. Weiterhin wurde mit dem Wechsel beschlossen, dass jeder DDR-Bürger bei der Ersteinreise in das alte Bundesgebiet ein Begrüßungsgeld in Höhe von 100 DM erhält. Um der hohen Nachfrage gerecht zu werden, wurden die Landeszentralbanken der Bundesbank mit dem notwendigen Kapital ausgestattet. Zur Vermeidung logistischer Komplikationen wurden grenznahe Bundesbankstellen, z. B. in Berlin, Lüneburg und Hof, auch am Wochenende geöffnet. Eine der größten Herausforderungen stellte die Reformierung des Bankensystems der DDR dar. Bis Ende März 1990 war das planwirtschaftliche Bankensystem Grundlage des öffentlichen Finanzwesens der DDR. So waren für die Steuerung und Verwaltung die Staatsbank der DDR, drei Institute mit Sonderaufgaben und rund 570 Sparkassen zuständig. Private Geschäftsbanken, wie sie in der BRD bestanden, waren auf Grund der ehemaligen politischen Ausrichtung nicht vorhanden. Die Staatsbank der DDR, welche Zentral- und Geschäftsbank zugleich war, wurde nach der Wiedervereinigung in die Staatsbank Berlin und im Jahr 1994 in die Kreditanstalt für Wiederaufbau integriert. Im Zuge der Reformen wurde eine vorläufige Verwaltungsstelle in Berlin gegründet. Zusätzliche Bundesbank-Filialen wurden ebenfalls in der DDR zur Unterstützung errichtet. Die rasche Umstellung des Währungssystems erlaubte nur eine kurze Vorbereitungszeit. Zur Unterstützung der organisatorischen, technischen und personellen Anforderungen schlossen die Landeszentralbanken der BRD eine Patenschaft mit den neuen Notenbank-Filialen in der DDR.
Der Bargeldumlauf in der DDR betrug nach dem Mauerfall ca. 16,7 Mrd. DDR-Mark. Das entsprach zu diesem Zeitpunkt 1.000 DM pro Kopf. Um den Währungswechsel angemessen abzuwickeln, wurden die Bundesbank-Filialen mit einem Gesamtwert von ca. 28 Mrd. DM ausgestattet. Dadurch erhöhte sich mittelfristig der Bargeldumlauf. Die entsorgten Banknoten in DDR-Mark umfassten ein Volumen von 29 Mrd. DDR-Mark.
Der Wechselkurs unterlag bis zur endgültigen Einführung zum 1. Juli 1990 mehreren Veränderungen. So startete dieser Anfang 1990 mit einem Verhältnis von 3 DDR-Mark zu 1 DM. Der endgültige Wechselkurs lag bei Einführung für folgende Personengruppen bei 1 zu 1:
- Personen bis 14 Jahre mit einem Kontoguthaben bis zu 2000 DDR-Mark,
- Personen bis 60 Jahre mit einem Kontoguthaben bis zu 4000 DDR-Mark und
- Personen ab 60 Jahre mit einem Kontoguthaben bis 6000 DDR-Mark.
Überschritt das Kontoguthaben die angesetzte Grenze, wurde in einem Verhältnis von 2 zu 1 umgetauscht. Ersparnisse, die erst ab dem 1. Januar1990 erzielt werden konnten, wurden im Verhältnis 3 zu 1 gewechselt.
Hingegen wurden Löhne, Gehälter, Renten, Mieten und Pachtkosten einheitlich 1 zu 1 umgestellt.17
3.1.2 Wirtschaftsunion
Die Wirtschaftsunion stellte den Transformationsprozess von der Plan- zur Sozialen Marktwirtschaft dar. Noch unter der DDR-Regierung von Hans Modrow wurde mit dem Beschluss des Ministerrats Anfang 1990 die „Anstalt zur treuhänderischen Verwaltung des Volkseigentums“, die Treuhandanstalt (THA), gegründet. Ziel war es, die Entflechtung der volkseigenen Betriebe in der DDR voranzutreiben, die Unternehmen zu verwalten und eine Privatisierung zu unterbinden. Mit der Wahl von Lothar de Maizière zum ersten und letzten demokratisch gewählten Ministerpräsidenten der DDR erfolgte in Zusammenarbeit mit der Bundesregierung der BRD eine Anpassung des Aufgabenbereichs der THA. Dieser wurde durch das Treuhandgesetz vom 17. Juni 1990 definiert und umfasste folgenden Auftrag:
- die unternehmerische Tätigkeit des Staates durch Privatisierung so rasch und so weit wie möglich zurückzuführen,
- die Wettbewerbsfähigkeit möglichst vieler Unternehmen herzustellen und somit bestehende Arbeitsplätze zu sichern und neue zu schaffen,
- Grund und Boden für wirtschaftliche Zwecke bereitzustellen.18
Die THA war damit Eigentümer von nahezu allen ostdeutschen Großunternehmen und einem Viertel aller Hotels, Gaststätten und Ladengeschäfte. Die Privatisierung durch die THA erfolgte durch die Zerlegung der Großunternehmen, sogenannter Kombinate, in insgesamt 14.000 kleinere Unternehmen. Diese wurden anschließend unter bestimmten Bedingungen veräußert.19
Die Wirtschaftstransformation sollte die Grundlage dafür bilden, das Produktionsniveau im Osten soweit zu erhöhen, dass es zur Angleichung des Einkommensniveaus und der Lebensqualität in Ostdeutschland an westdeutsche Verhältnisse kommt.20 Erschwert wurde dieses Vorhaben dadurch, dass mit der Einführung der DM eine Konkurrenzsituation geschaffen wurde, der die Wettbewerbsfähigkeit der ostdeutschen Betriebe nicht gewachsen war. So sank die industrielle ostdeutsche Nettoproduktion im Bereich des Maschinenbaus von 15,2 Prozent im Jahr 1990 auf 5,4 Prozent im Jahr 1994. Ebenso mussten Rückschläge im Bereich der Elektrotechnik, der Feinmechanik und anderer industrieller Branchen hingenommen werden. Nach der Privatisierung durch die THA konnten die relativ kleinen Betriebe, die bisher ihren Produktabsatz im lokalen Markt hatten, dem überregionalen und internationalen Konkurrenzkampf nicht entgegentreten. Zugleich brach das bis dahin wichtige Absatzgebiet nach Osteuropa ein. Der Exportumsatz betrug nach Osteuropa im Jahr 1994 nur noch sieben Prozent des gesamten Umsatzes der ostdeutschen Industrieunternehmen. Die übereiferte Privatisierung der Betriebslandschaft im Osten führte zu einer Zerschlagung der bis dahin arbeitsteiligen Industriestruktur. Anstelle deren entwickelten sich isolierte Einzel- bzw. Filialbetriebe, die ungenügend in industrielle Netzwerke eingebunden waren.21 Darüber hinaus entwickelte sich ein innerdeutscher Konkurrenzkampf, der die Verdrängung von leistungsfähigen Unternehmen im Osten nach sich zog und darauf abzielte, die bisherigen Wirtschaftsbeziehungen nach Osteuropa zu übernehmen, um den eigenen Absatzmarkt zu vergrößern.22 Darin lag auch das Dilemma der ostdeutschen Wirtschaft. Aufgrund der jahrzehntelangen Orientierung auf die sowjetischen bzw. osteuropäischen Märkte konnte kein Exportnetzwerk mit kapitalistischen Industrienationen aufgebaut werden. Dazu kam, dass die Produktivität im Osten nur ca. 40 bis 50 Prozent des Westniveaus erreichte. Grund dafür waren vor allem das niedrige technologische Niveau, die geringe Arbeitsintensität sowie unzureichende Leistungs- und Innovationsmöglichkeiten.23 Durch die konsequente Umsetzung der Privatisierung von Unternehmen wurden notwendige Sanierungen, Modernisierungen und Strukturanpassungen für die Treuhandbetriebe vernachlässigt. Insofern führten fehlende Investitionen im Bereich von Forschung und Entwicklung zu wirtschaftlicher Stagnation. So wurden 1991 im verarbeitenden Gewerbe von je 1.000 DM an Investitionen in den alten Bundesländern 450 DM an Aufwendungen für Forschung und Entwicklung eingesetzt. Im Osten betrug der Aufwand hingegen nur 90 DM. Im Jahr 1995 reduzierte sich die Verwendung auf nur noch 50 DM, während diese in den alten Bundesländern auf 640 DM anstieg. Auf Grund dieser Versäumnisse wurden Beschäftigungsmöglichkeiten und -attraktivität für qualifizierte Facharbeiter, Ingenieure und Wissenschaftler minimiert und die Abwanderung aus dem Osten forciert.24 Der Transformationsprozess durch die THA umfasste im Zeitraum von 1990 bis 1994 die Auflösung von 31 Prozent aller bestehenden ostdeutschen Wirtschaftseinheiten. 69 Prozent wurden dementsprechend privatisiert. Davon wurden 42 Prozent an westdeutsche oder ausländische Investoren verkauft. Im Schlussbericht der Enquete-Kommission zur „Überwindung der Folgen der SED-Diktatur im Prozeß der deutschen Einheit“ wird darauf hingewiesen, dass durch den damaligen Handlungsdruck ein geordnetes Ablaufverfahren für die Transformation der in der DDR geltenden Zentralverwaltungswirtschaft auf die Soziale Marktwirtschaft nur bedingt möglich war und somit nur pragmatische Lösungen umgesetzt werden konnten.25
3.1.3 Sozialunion
Neben der Angleichung auf dem Währungs- und Wirtschaftssektor stellt die Sozialunion die dritte Komponente in der Rechtsanpassung auf dem Gebiet der DDR dar. Mit den Regelungen gemäß Artikel 18 bis 25 des „Vertrags über die Schaffung einer Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik“ (WWSUVtr) wurden die Grundsätze des Sozialversicherungssystems der BRD auf die DDR übertragen. Die Übernahme der Sozialpolitik der BRD stand im unmittelbaren Zusammenhang mit der Ausgestaltung der Sozialen Marktwirtschaft. Die Sozialunion wurde daher als notwendiges Äquivalent zur Währungs- und Wirtschaftsunion angesehen. Die schnelle Umgestaltung des Sozialsystems nach westdeutschem Vorbild machte es jedoch unmöglich, funktionierende Ansätze des ostdeutschen Sozialsystems zu prüfen und gegebenenfalls in eine Gesamtreform des Sozialwesens einzubeziehen. Diese Art der Anpassung zwischen Ost und West wurde von der DDR-Regierung, Teilen der Sozialdemokraten und den Gewerkschaften präferiert. Von der BRD-Regierung wurde dieses Vorgehen jedoch abgelehnt. Es sollte die Vermischung beider Sozialsysteme verhindert werden, da als Folge ein Scheitern des gesamten Systems befürchtet wurde. Die rechtliche Ausgestaltung der Sozialunion auf dem Gebiet der DDR sowie die Übertragung von Normen, Institutionen etc. waren Leitgedanke der Sozialpolitik Anfang der 90er Jahre. Signifikant für die sozialistische Sozialpolitik in der DDR war die im Jahr 1976 ausgerufene „Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik“26. Diese Kombination, gesteuert und unterstützt vom Staat, sollte den Anstieg des Lebensstandards und die soziale Sicherheit mit dem Erfolg der Produktivität verknüpfen. Durch Erweiterung sozialer Leistungen sollte ein Anstieg der Arbeitsmotivation und des Arbeitseinsatzes erfolgen. Das Ausbleiben des wirtschaftlichen Erfolgs, bedingt durch Fehlplanungen und eine überdehnte Bürokratie, führte jedoch zu einer Enttäuschung. Durch das Zusammenspiel von Wirtschaft und Sozialpolitik wurde den DDR-Betrieben die Integration von Sozialmaßnahmen auferlegt. Anders als in der BRD wurden Betriebe „mit dem Aufbau eines betrieblichen Gesundheitswesens, der Finanzierung von Kuren, der Unterhaltung von betriebseigenen Kinderbetreuungsstätten (von Krippen über Kindergärten zu Horten), dem Bau und dem Unterhalt von Betriebswohnungen, Ferienheimen, Kulturhäusern und Sportstätten sowie der Betreuung der aus dem Betrieb ausgeschiedenen Rentner zusätzliche Belastungen aufgebürdet.“27 Hingegen wurden in der BRD die Bestandteile der sozialen Sicherung im Rahmen der Sozialversicherung externalisiert.28 Die Verpflichtung, das Arbeitsplatzrisiko zu übernehmen und ineffiziente Mitarbeiter aus sozialen Aspekten weiter zu beschäftigen, hemmte die DDR-Betriebe in ihrer Effizienzentwicklung und Investitionsmöglichkeit. Im Unterschied zur BRD bestimmte die Staatspartei der DDR die Sozial-, Lohn- und Preispolitik. Eine Beteiligung von autonomen Tarifparteien, sozialen Einrichtungen und Kirchen sowie das Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage am Markt spielten keine Rolle in der Ausgestaltung des wirtschaftlichen Handelns in der DDR. Der Mangel an unabhängigen Sozial- und Verwaltungsgerichten führte zusätzlich zu einem Defizit judikativer Kontrolle. Mit der Einführung des Sozialsystems nach westdeutschen Bestimmungen und einer anwachsenden Arbeitslosigkeit stieg der Finanzbedarf in den neuen Bundesländern.29 Die zunehmenden Sozialtransfers für die Sozialversicherungsträger erreichten im Zeitraum von 1991 bis 1994 eine Größenordnung von 362,4 Mrd. DM.30 Berücksichtigt wurde dabei der Bedarf der Bundesanstalt für Arbeit, der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte und anderer Rentenversicherungsträger. Zugleich wurden die Lohn- und Sozialausgaben sowie die Verlustgeschäfte der THA finanziert. Darüber hinaus sollten zusätzliche gemeinnützige Investitionen, wie für Kinder- und Wohngeld, BAföG und Wohnungsbau, die Implementierung der sozialen Sicherungssysteme in den neuen Bundesländern finanziell sicherstellen.31
3.2 Fonds „Deutsche Einheit“
Mit dem „Gesetz zum Staatsvertrag vom 18. Mai 1990 über die Schaffung einer Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik“ (WWSUG) vom 25. Juni 1990 sind weitere Maßnahmen für die Eingliederung der DDR in das Bundesgebiet der BRD geregelt. So wurde in Artikel 31 WWSUG aufgenommen, dass ein Fonds „Deutsche Einheit“ (FDE) eingerichtet wird.
Der Fonds war das Ergebnis zäher Verhandlungen zwischen Bund, Ländern und Gemeinden. Der Bund beabsichtigte, die Länder in den unmittelbaren Verhandlungen mit der DDR außen vor zu lassen. Dieses Vorgehen wurde seitens der Länder als sehr ambivalent kritisiert. Denn zum einen wurde den Ländern kein Mitspracherecht gewährleistet, Informationen erhielten sie kurzfristig oder wurden mit Maßnahmenplanungen aus dem Bundeskanzleramt überrascht. Zum anderen sollten sie aber einen Beitrag zur Finanzierung der neuen Länder leisten. Im April 1990 bekundeten die Finanzminister der alten Bundesländer ihre Bereitschaft, den neuen Bundesländern in einem solidarischen Akt finanziell zur Seite zu stehen. Offen war hingegen, wie eine finanzielle Unterstützungsleistung umgesetzt werden sollte. Einzelne Bundesländer wie Bayern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und Saarland präferierten die Einführung eines Fonds und mehr Mitspracherecht in der Verwendung der Finanzmittel für die neuen Bundesländer. In diesem Zusammenhang sollte auch die Klärung des Finanzausgleichs der Länder herbeigeführt werden. Denn eine direkte Aufnahme der neuen Länder in das bestehende Ausgleichssystem hätte die finanziellen Kapazitäten überschritten. Da eine Neuverhandlung des Finanzausgleichs zu diesem Zeitpunkt alle zeitlichen Rahmenpläne der Bundesregierung gesprengt hätte, musste eine kurzfristige Lösung gefunden werden. Die Finanzlasten der DDR über den Bundeshaushalt zu finanzieren und die Refinanzierung über die Abtretung von Umsatzsteueranteilen der Länder und Gemeinden an den Bund durchzuführen, wäre mit einem zu großen zeitlichen Aufwand verbunden gewesen. Dieses Vorgehen hätte einen Nachtragshaushalt für die alten Bundesländer im Jahr 1990 erfordert und konnte im zeitlichen Rahmen nicht realisiert werden. Die Alternative war der bereits von einigen Ländern vorgeschlagene FDE. Am 16. Mai 1990 gelangen entscheidende Regelungskompromisse zwischen Bundeskanzler Kohl und den Regierungschefs der Bundesländer in der Finanzierungsfrage. Der FDE sollte auf Grundlage des Artikels 110 Abs. 1 GG für den Zeitraum von 1990 bis 1994 eingerichtet werden. Darüber hinaus bestand Einvernehmen darüber, dass der Finanzausgleich unter Beteiligung der neuen Länder ab 1995 angepasst werden sollte.32 Da bisher kein vergleichbarer Transformationsprozess einer Planwirtschaft in die Soziale Marktwirtschaft stattgefunden hatte und als Vorbild dienen konnte, erwiesen sich die Kalkulationen als zu niedrig. Daher musste der Fonds bis zum Laufzeitende zweimal erhöht werden. Die anfängliche Gesamthöhe von 115 Mrd. DM erhöhte sich im Zeitraum 1990 bis 1994 auf insgesamt 160,7 Mrd. DM (siehe Tab. 1).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tab. 1: Finanzierung des FDE in Mrd. DM
Quelle: Entnommen aus Schaden/Schreiber (1997), S. 148.
Für die Finanzierung wurde der Bund ermächtigt, einen Kredit in Höhe von 95 Mrd. DM aufzunehmen. Der restliche finanzielle Bedarf konnte durch den Bundeshaushalt in Höhe von 49,6 Mrd. DM und unter Beteiligung der Länder in Höhe von 16,1 Mrd. DM gedeckt werden.33 Mit der Neuregelung des Finanzausgleichs ab dem 1. Januar 1995 wurde der FDE in einen Tilgungsfonds umgewandelt. Die jährliche Tilgungsrate sollte zehn Prozent des gesamten Kreditbetrags betragen (ca. 9,5 Mrd. DM). Die Schuldendienstleistungen wurden jeweils zur Hälfte vom Bund und den alten Ländern übernommen.34
Durch die Anpassung bei der Verteilung des Umsatzsteueraufkommens wurde der Anteil zugunsten der Länder von 37 Prozent auf 44 Prozent erhöht. Dieses stellte ein Einnahmeverlust des Bundes im Jahr 1995 in Höhe von ca. 16,5 Mrd. DM dar. Im Gegenzug übernahmen die Länder einen zusätzlichen Beitrag in Höhe von 2,1 Mrd. DM zur Tilgung des FDE. Damit entsprach die jährliche Gesamtbelastung 6,85 Mrd. DM für die alten Bundesländer. Die Annuität des Bundes minderte sich in diesem Zusammenhang um die zusätzliche Übernahme der Länder in Höhe von 2,1 Mrd. DM. Damit beteiligte sich der Bund in Höhe von 2,65 Mrd. DM an der Tilgung des FDE.35 Durch eine positive Zinsentwicklung gegen Ende der 90er Jahre konnte die Annuität von Bund und Ländern ab dem Jahr 1998 von zehn Prozent auf 6,8 Prozent herabgesenkt werden.36 Mit Beginn des Jahres 2005 erfolgte die Übernahme der Tilgung allein durch den Bund. Das Volumen belief sich dabei auf 38,3 Mrd. Euro. Zum Ausgleich dieser Restschulden wurde dem Bund ein Festbetrag an der Umsatzsteuer eingeräumt. Die Mehreinnahmen beliefen sich dabei auf ca. 1,3 Mrd. Euro. Ebenfalls wurden die Zuweisungen im Rahmen des Solidarpakts gesenkt. Mit Ablauf des Jahres 2019 wird der FDE aufgelöst.37
3.3 Bund-Länder-Finanzausgleich
Der Bund-Länder-Finanzausgleich findet seit Gründung der BRD Anwendung. Seine Grundlage bilden Artikel 106 GG und Artikel 107 GG. Eine grundlegende Novellierung des Finanzausgleichs erfolgte in den Jahren 1955, 1969 und 1993.38 Im Rahmen der Solidarpaktverhandlungen wurde mit dem „Gesetz zur Umsetzung des Föderalen Konsolidierungsprogramms“ (FKPG) vom 23. Juni 1993 die Neuregelung des Bund-Länder-Finanzausgleichs zum 1. Januar 1995 beschlossen. Durch die Integration der neuen Länder konnte erstmals ein gesamtdeutscher Finanzausgleich umgesetzt werden. Der bis dahin unterstützende FDE wurde damit abgelöst. Die Reform des Finanzausgleichs sah vor, für die neuen Länder eine erhöhte Pro-Kopf- und Sachinvestition zu ermöglichen, die über dem Niveau der alten Länder lag. Das Transfervolumen im Jahr 1995 betrug für die neuen Bundesländer über 50 Mrd. DM. Damit wurde die Gesamthöhe gegenüber 1994 (im Rahmen des FDE) nochmals erhöht (siehe Tab. 1).39 Die Fehlbetrags-Bundesergänzungszuweisungen sorgten dafür, dass die Finanzkraft eines Bundeslandes schlussendlich 99,5 Prozent des Länderdurchschnitts erreichte. Darüber hinaus sollten die neuen Bundesländer für den Zeitraum 1995 bis 2004 jährliche Transferzahlungen im Rahmen des Solidarpakts I (Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen [SoBEZ]) in Höhe von 20,6 Mrd. DM erhalten.40 Aufgrund der schwachen wirtschaftlichen Entwicklung in den neuen Bundesländern – das Wirtschaftswachstum sank im Osten von 5,1 Prozent (1995) auf 0,5 Prozent (1998) – wurde im Jahr 2001 eine Verlängerung der Unterstützungsmaßnahmen für die neuen Bundesländer über 2004 im Jahr 2001 beschlossen.41 Jedoch wurde die Ausgestaltung des Finanzausgleichs durch das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) vorgegeben. Bereits im Jahr 1999 urteilte das BVerfG zum Länderfinanzausgleich und beauftragte den Gesetzgeber bis zum 31. Dezember 2002 bindende Maßstäbe festzulegen, um die unbestimmten Begriffe im Steuerverteilungs- und Ausgleichssystem des GG zu konkretisieren und zu ergänzen. Das BVerfG stellte in diesem Zusammenhang die Abhängigkeit des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) mit dem umzusetzenden Maßstäbegesetz (MaßstG) her. Bei einer nicht fristgerechten Umsetzung bis zum 31. Dezember 2002 wäre das FAG ab dem 1. Januar 2003 für verfassungswidrig und nichtig erklärt worden. Darüber hinaus wurde der Gesetzgeber verpflichtet, auf Basis des MaßstG eine Neuaufstellung des FAG ab dem 1. Januar 2005 herbeizuführen. Im Zuge dieser Prämissen einigten sich Bund und Länder im Jahr 2001 auf eine zeitliche Begrenzung der getroffenen Regelungen im FAG und MaßstG bis zum 31. Dezember 2019.42
Die gegenwärtigen Regelungen sehen vor, dass beim vertikalen Finanzausgleich eine Verteilung der Gemeinschaftssteuern auf den Bund, die Länder und die Gemeinden vorgenommen wird. Dabei kommt es zu unterschiedlichen Verteilungsquoten (Tab. 2).
Angaben in Prozent:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tab. 2: Gemeinschaftssteuern (2014)
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an BMF (2014), S. 1 f.
Darüber hinaus stehen dem Bund weitere Steuereinnahmen zur Verfügung. Bei diesen handelt es sich um so genannte Bundessteuern, die z. B. über die Energie-, die Tabak- oder die Solidaritätssteuer eingenommen werden. Hingegen erhalten die Länder uneingeschränkt das Aufkommen aus der Erbschafts- und Grunderwerbssteuer sowie einige weitere Steuerarten mit geringem Aufkommen. Die Gemeindeeinnahmen setzen sich aus der Gewerbe- und Grundsteuer und weiteren den Gemeinden zugeteilten Steuerarten zusammen. Eine Beteiligung des Bundes und der Länder an der Gewerbesteuer wird zusätzlich sichergestellt.
Bei der horizontalen Steuerverteilung werden die Gesamteinnahmen der Bundesländer aus den Gemeinschaftssteuern auf die einzelnen Länder verteilt. Dabei stehen den Ländern bei der Einkommen- und der Körperschaftsteuer die Steuereinnahmen zu, die durch ihre Finanzbehörden im verantwortlichen Bereich eingenommen werden. Hierbei gilt das Prinzip des örtlichen Aufkommens. Für die Einkommensteuer bedeutet das, dass jedes Bundesland die Steuereinnahmen erhält, die durch das Einkommen seiner Einwohner, sei es innerhalb oder außerhalb der Ländergrenzen, erzeugt werden. Das Aufkommen der Körperschaftsteuer kommt den Ländern zu, in denen eine Betriebsstätte von Unternehmen angesiedelt ist.
Im Gegensatz dazu findet bei der Verteilung der Umsatzsteuer das Prinzip des örtlichen Aufkommens keine Anwendung. Zudem werden höchstens 25 Prozent der Umsatzsteuereinnahmen der Länder als Ergänzungsanteile an die Länder weitergegeben, die mit den Einnahmen aus der Einkommen-, der Körperschaft- und der Landessteuern unter dem allgemeinen Länderdurchschnitt liegen. Die Bedarfshöhe an dem Umsatzsteuer-Ergänzungsanteil hängt davon ab, wie weit die Pro-Kopf-Einnahmen eines Landes unterhalb der durchschnittlichen Steuereinnahmen je Einwohner aller Länder liegen. Die restlichen 75 Prozent des Umsatzsteueraufkommens der Bundesländer werden auf Grundlage der jeweiligen Einwohnerzahl verteilt.43
Der Länderfinanzausgleich im engeren Sinne stellt die dritte Stufe des Bund-Länder-Finanzausgleichs dar. Im Rahmen des Länderfinanzausgleichs stellen finanzstarke Bundesländer den finanzschwachen Bundesländern Ausgleichzuweisungen zur Verfügung. Angestrebt wird lediglich eine Angleichung der Einnahmeunterschiede und keinesfalls ein vollständiger Ausgleich. Grundlage für die Bemessung der Ausgleichshöhe ist die Pro-Kopf-Finanzkraft in den jeweiligen Ländern. Die Pro-Kopf-Finanzkraft eines Landes setzt sich aus der Gesamthöhe der Landessteuereinnahmen und zu 64 Prozent aus der Summe der Gemeindeeinnahmen zusammen.
Für die Berechnung des Länderfinanzausgleichs wird von einem gleichen Finanzbedarf je Einwohner in den Bundesländern ausgegangen. Besonderheiten ergeben sich jedoch bei den Stadtstaaten Berlin, Bremen und Hamburg. Hier wird eine fiktive Erhöhung der Einwohnerzahl um 35 Prozent vorgenommen. Zusätzlich wird den Ländern Mecklenburg-Vorpommern (fünf Prozent), Brandenburg (drei Prozent) und Sachsen-Anhalt (zwei Prozent) eine fiktive Erhöhung der Einwohnerzahl zugestanden. Die Höhe der Ausgleichzuweisungen für finanzschwache Länder ist abhängig von der Differenz der durchschnittlichen Pro-Kopf-Finanzkraft des Landes im Verhältnis zur durchschnittlichen Finanzkraft je Einwohner aller Länder. Entsprechend hängt die Höhe der Ausgleichsbeträge eines finanzstarken Landes davon ab, in welchem Maße seine Pro-Kopf-Finanzkraft über der durchschnittlichen Finanzkraft je Einwohner aller Länder liegt. Durch den Länderfinanzausgleich wird, wie bereits bei der Verteilung der Umsatzsteuer, eine Angleichung der Finanzkraft erzielt (siehe Tab. 3).44
Im Rahmen des Länderfinanzausgleichs im Jahr 2013 wurden ca. 8,5 Mrd. Euro für finanzschwache Länder zur Verfügung gestellt. Mit Bayern, Baden-Württemberg und Hessen konnten nur drei Bundesländer für die Ausgleichsbeträge aufkommen. Bereits 2013 klagten Bayern und Hessen gegen den geltenden Länderfinanzausgleich, wobei Bayern die Klage „als Akt der politischen Notwehr“45 bezeichnete.
Die vierte und letzte Stufe des Bund-Länder-Finanzausgleichs sind die Bundesergänzungszuweisungen. Dabei wird zwischen den allgemeinen Bundesergänzungszuweisungen (BEZ) und den SoBEZ unterschieden. Die BEZ führen zu einer Reduzierung des Fehlbetrags eines Bundeslandes, das nach dem Länderfinanzausgleich unter 99,5 Prozent der durchschnittlichen Finanzkraft je Einwohner liegt. Dabei werden 77,5 Prozent der Differenz ausgeglichen (siehe Tab. 3).46
Angaben in Prozent
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tab. 3: Ausgleich der Finanzkraftunterschiede durch den Länderfinanzausgleich und die allgemeinen Bundesergänzungszuweisungen
Quelle: Entnommen aus BMF (2014), S. 5.
Die Höhe der BEZ beliefen sich im Jahr 2013 auf ca. 11 Mrd. Euro.47
Die SoBEZ dienen zum Ausgleich spezieller Sonderlasten aufgrund hoher Kosten politischer Führung für einige leistungsschwache Bundesländer. Im Rahmen des Solidarpakts II werden den neuen Bundesländern für den Zeitraum 2005 bis 2019 SoBEZ zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus erhalten die neuen Länder SoBEZ, die zum Ausgleich der überproportionalen Lasten, bedingt durch die Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe für Erwerbstätige, verwendet werden. Eine rechtlich zweckgebundene Verwendung der Mittel ist dabei nicht vorgesehen. Die Höhe der Zuweisungen von SoBEZ ist im FAG bestimmt.48
4 Solidarpakt zwischen Bund und Ländern
4.1 Ausgangslage
„Durch eine gemeinsame Anstrengung wird es uns gelingen, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Sachsen und Thüringen schon bald wieder in blühende Landschaften zu verwandeln, in denen es sich zu leben und zu arbeiten lohnt.“49
Mit seiner Fernsehansprache am 1. Juli 1990 sprach Bundeskanzler Helmut Kohl anlässlich des Inkrafttretens der WWSU zum deutschen Volk. Das Ziel stand also fest: Blühende Landschaften sollten am Ende eines langen Prozesses entstehen. Dabei waren die Voraussetzungen für diesen ehrgeizigen Plan alles andere als optimal. So gab der ehemalige DDR-Wirtschaftslenker Günter Mittag im Jahr 1991 in einem Interview mit dem „Spiegel“ Aufschluss darüber, wie es um die Wirtschaft der DDR in den 80er Jahren wirklich stand. Durch den wirtschaftspolitischen Reformstau in der DDR, der auch auf das Diktat der Sowjetunion zurückzuführen war, entstand eine im Verhältnis zur BRD unterentwickelte Wirtschaftslage. Ein in den 60er Jahren eingeführtes Reformkonzept für die Wirtschaft der DDR, das „Neue Ökonomische System der Planung und Leitung“ (NÖS), wurde auf Anraten Breschnews an Erich Honecker sukzessive abgeändert und im Jahr 1970 eingestellt. Das hauptsächliche Hindernis für eine stärkere Wirtschaftsentwicklung in der DDR lag in der strikten Einhaltung politischer Vorgaben. Ein viel zu ineffizientes und zentralistisch aufgebautes Wirtschaftssystem war die Folge. Dadurch wurde die Konkurrenzfähigkeit auf dem Weltmarkt, z. B. in der Forschung und technologischen Entwicklung, konterkariert.50 Die Reduzierung der Erdöllieferungen durch die UdSSR Anfang der 80er Jahre führte dazu, dass das Wirtschaftswachstum und der Außenhandel weiter geschwächt wurden. Die Konsuminvestitionen wurden dadurch auf das auf Niveau der 60er Jahre heruntergedrosselt. Eine Verschlechterung der Produktionsanlagen und der Infrastruktur war Ergebnis dieses Prozesses.51 Um notwendige wirtschaftliche Impulse setzen zu können, einigten sich im Jahr 1983 die politische Spitze der DDR mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Franz-Josef-Strauß auf einen Milliarden-Kredit. Die drohende Zahlungsunfähigkeit der DDR wurde damit aber nur verschoben.52
Denn diese Maßnahme führte zu keiner dauerhaften signifikanten Steigerung der Wirtschaftskraft in der DDR. In einer Analyse des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) im Jahr 1987 wurde der Rückstand der Industrie in der DDR im Vergleich zur BRD (entspricht 100 Prozent) auf 50 Prozent geschätzt. Im Wendemonat Oktober 1989 kalkulierte die Planungskommission der DDR mit einem Leistungspotential in Höhe von 30 Prozent. Tatsächlich lag der Durchschnittswert der Produktivität der DDR Ende der 80er Jahre im Verhältnis zu dem der BRD sogar unter 30 Prozent.53
Mit dem Fall der Mauer und dem folgenden Einheitsprozess entstand die Transparenz, die notwendig war, um einen Überblick über beide deutschen Staaten zu gewinnen (Tab. 4):
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tab. 4: Vergleich von West- und Ostdeutschland vor der Wiedervereinigung im Jahr 1988 bzw. 1989
Quelle: Entnommen aus Statistisches Bundesamt (2014b).
[...]
1 Vgl. BMAS (2014), o. S.
2 Vgl. BpB (2011), S. 16.
3 Vgl. BpB (2011), S. 36 f.
4 Vgl. BpB (2011), S. 39 f.
5 Vgl. BpB (2011), S. 18.
6 Vgl. BpB (2011), S. 20.
7 Vgl. BpB (2011), S. 23.
8 Vgl. BpB (2011), S. 54.
9 Vgl. HDG (2014a), o. S.
10 Vgl. KAS (2010), o. S.; Deutscher Bundestag (2014), o. S.
11 Vgl. auch Pötzsch (2009), S. 32 f.
12 Vgl. auch Bundesregierung (2014), o. S.
13 Vgl. Der Spiegel (1990), S. 106 f.
14 Vgl. Jahresgutachten des Sachverständigenrates (1990), S. 306-308.
15 Vgl. Staatsvertrag (1990), Artikel 1, Nr. 1-4; HDG (2014b), o. S.
16 Vgl. AA (2014), o. S.
17 Vgl. Deutsche Bundesbank (2010), S. 1-4.
18 Vgl. Siegmund (2014), o. S.; Treuhandgesetz (1990), Eingangsformel.
19 Vgl. Siegmund (2014), o. S.
20 Vgl. Busch et al. (2006), S. 38.
21 Vgl. Busch et al. (2006), S. 40 f.
22 Vgl. Busch et al. (2006), S. 46.
23 Vgl. Busch et al. (2006), S. 48.
24 Vgl. Busch et al. (2006), S. 55.
25 Vgl. Bundesregierung (1998), S. 59.
26 Ritter (2006), S. 164.
27 Ritter (2006), S. 164 f.
28 Vgl. Ritter (2006), S. 164.
29 Vgl. Ritter (2006), S. 160-165.
30 Vgl. Busch (1999), S. 15, eigene Berechnung.
31 Vgl. Busch (1999), S. 15 f.
32 Vgl. Küsters/ Hofmann (1998), S. 150-153.
33 Vgl. Schaden/ Schreiber (1997), S. 147.
34 Vgl. Jahresgutachten des Sachverständigenrates (1990), S. 137 f.; §6 Abs. 2 DEFG.
35 Vgl. Jahresgutachten des Sachverständigenrates (1995), S. 142; Schaden/ Schreiber (1997), S. 150.
36 Vgl. Bundesrat (2000); §6 Abs. 2a DEFG.
37 Vgl. Jahresgutachten des Sachverständigenrates (2001), S. 136; Zinsmeister (2009), S. 149.
38 Vgl. Renzsch (2012), o. S.
39 Vgl. Bundesregierung (1995), S. 117.
40 Vgl. Zinsmeister (2009), S. 154.
41 Vgl. Zinsmeister (2009), S. 152, 157.
42 Vgl. BVerfG (1999); §15 MaßstG (2001).
43 Vgl. BMF (2014), S. 1 f.
44 Vgl. BMF (2014), S. 3 f.
45 Bayerische Staatsregierung (2013).
46 Vgl. BMF (2014), S. 4.
47 Vgl. Statistisches Bundesamt (2014a), o. S., vorläufiges Ergebnis.
48 Vgl. BMF (2014), S. 5.; §11 Abs. 4 FAG.
49 Helmut Kohl (1990), o. S.
50 Vgl. Der Spiegel (1991), S. 88-104.
51 Vgl. Zentrum für Zeithistorische Forschung (2014), o. S.
52 Vgl. BStU (2014), o. S.
53 Vgl. Ritter (2006), S. 106.
- Quote paper
- Eric Schuster (Author), 2014, Solidaritätszuschlag und Solidarpakt. Perspektive nach 2019, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/282823
Publish now - it's free

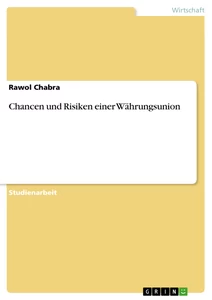
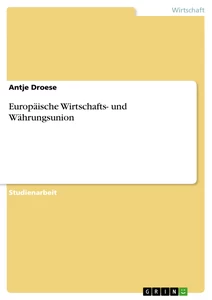











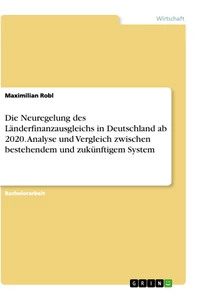
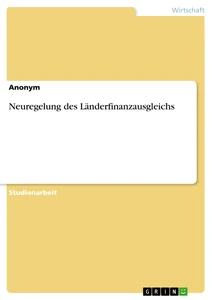






Comments