Leseprobe
INHALTSVERZEICHNIS
VORWORT
EINLEITUNG
1. AFFEKTIVE STÖRUNGEN
1.1 Definition
1.2 Klassifikation von affektiven Störungen
1.3 Störungstheorien und Erklärungsmodelle
1.4 Häufigkeiten affektiver Störungen
1.5 Ätiopathogenese bei affektiven Störungen
1.6 Psychogenese bei affektiven Störungen
2. ZUSAMMENHÄNGE VON AFFEKTIVEN STÖRUNGEN MIT
INDIVIDUELLEN UND SOZIALEN DEFIZITEN
2.1 Hohe Erwartungshaltungen und Perfektionismus
2.2 Macht und Kontrolle
2.3 Angst
2.3.1 Grundformen der Angst
2.3.2 Die Begriffsverschränkung von Dynamik und Angst
2.4 Übertriebenes Sicherheitsdenken
3. DAS DYNAMISCHE 12 EBENEN MODELL
3.1 Einführung in das dynamische 12 Ebenen Modell
3.2 Die psychologischen Bezüge zum dynamischen 12 Ebenen Modell
3.2.1 Harvard-Studie - ‚Entwicklung im Lebensalter‘
3.2.2 Das Inhaltsmodell der Motivation von Maslow
3.2.3 Petzolds 5 Säulen der Identität
3.3 Die Anwendung des dynamischen 12 Ebenen Modells in der Praxis
3.3.1 Die zentrale Bedeutung des Erstgespräches im 12 Ebenen Modell
3.3.2 Phase 1 - Das Erstgespräch und das kooperative Arbeitsbündnis
3.3.3 Phase 2 - Aktivitätsaufbau und Aufbau von sozialer Kompetenz
3.3.4 Phase 3 - Kognitive Umstrukturierung
3.3.5 Phase 4 - Stabilisierung der PatientInnen
4. EINFÜHRUNG IN DIE MUSIKTHERAPEUTISCHE KONZEPTION
4.1 Methodologie
4.1.1 Der Handlungsansatz
4.1.2 Das Handlungsprinzip
4.1.3 Die musiktherapeutischen Handlungsmittel
4.1.4 Das musiktherapeutische Handlungsziel
4.2 Methodik - Handlungsformen
4.2.1 Improvisation mit Musikinstrumenten
4.2.2 Regulative Musiktherapie (RMT)
4.2.3 Bewegungsimprovisation zur Musik
4.2.4 Gruppensingtherapie & Improvisation mit Stimme
4.2.5 Musikalisches Für-Spiel
5. UNTERSUCHUNGSANLAGE
5.1 Fragestellungen
5.2 Hypothesen
5.3 Beschreibung der Untersuchungsgruppen
5.4 Methoden der Untersuchung
5.4.1 Fragebogen A - Stundeneinschätzung bei Gruppenmusiktherapie
5.4.2 Fragebogen B - Selbsteinschätzung - Dynamisches 12 Ebenen Modell
6. DARSTELLUNG DER AUSWERTUNGEN
6.1 Auswertungen der Stundeneinschätzung - Fragebogen A
6.2 Auswertung der Fragebögen B
6.3 Bestätigung der Hypothesen
7. DISKUSSION
8. ZUSAMMENFASSUNG
9. ANHANG
9.1 Verläufe der 11 PatientInnen mit rückläufigen Werten - Frageb. A
9.2 Daten der 11 PatientInnen mit rückläufigen Werten - Frageb. B
10. LITERATUR
11. ABBILDUNGS- UND TABELLENVERZEICHNIS
12. ANSCHAUUNGSMATERIAL
DANKSAGUNG
ABSTRACT
Diese Arbeit beleuchtet die musiktherapeutische Arbeit bei PatientInnen mit affektiven Störungen. Die Fragen zur Untersuchung waren: Wie gelingt es durch musiktherapeutische Arbeit, dass PatientInnen mit affektiven Störungen ihre eigenen hohen Erwartungshaltungen erkennen können, um diese in Zukunft positiv für sich zu verändern? In welchen Stadien des Verlaufs der musiktherapeutischen Arbeit kann das entwickelte dynamische 12 Ebenen Modell sinnvoll angewandt werden?
Innerhalb von zwei Jahren wurden 90 PatientInnen mithilfe von speziell entwickelten Fragebögen zur Selbsteinschätzung ihres Verhaltens bei musiktherapeutischen Handlungen befragt. Die Einstellungen und Ansprüche der PatientInnen auf 12 verschiedenen Ebenen des Lebens wurden parallel dazu am Beginn und am Ende der Therapie erfasst.
Die PatientInnen bewerteten die Parameter der Fragebögen im Therapieverlauf zunehmend positiv. Individuelle und soziale Defizite reduzierten sich dabei deutlich. Einstellungen und Sichtweisen zur eigenen Person entwickelten sich ebenfalls zunehmend positiv. Das dynamische 12 Ebenen Modell fand in allen Stadien des musiktherapeutischen Geschehens sinnvolle und hilfreiche Anwendung.
KEYWORDS
Affektive Störungen - individuelle und soziale Defizite - Improvisation - Begriffsverschränkung von Dynamik und Angst - Kontrolle - Motivationsmodell von Maslow - Perfektionismus - Schwabe - regulative Musiktherapie - Petzolds 5 Säulen der Identität - Erstgespräch - Fragebögen zur Selbsteinschätzung - 12 Ebenen Modell
VORWORT
Erkenntnis führt zu Befreiung
und Erwachen führt zu Erlösung.
Wir alle haben das Staunen nicht verlernt,
das mit den Zungen jenes inneren Gottes spricht
und uns in unerklärlicher Weise den Weg in die Heimat weist.
(Ken Wilber, 2004, S.18)
Die Wissenschaft vertraut auf all das, was durch oftmaliges Überprüfen unbestreitbar erscheint. Dadurch erhofft man sich, Fehler in der Zukunft eher zu vermeiden. Gefühle zu erspüren und sie im musiktherapeutischen Prozess für ‚wahr‘ zu nehmen ist stets mit einem gewissen Risiko verbunden. Denn dabei glauben wir an das, was in uns selbst, auf welche Weise auch immer, spür- und erlebbar geworden ist. Dies auch dann, wenn die Vernunft, die Erfahrung und der bisherige Stand der Wissenschaft dagegen zu sprechen scheinen.
Neuere Erkenntnisse der Quantenphysik belegen, dass bereits der Akt, die Wirklichkeit zu beobachten, die Realität mit beeinflusst und formt; denn Beobachter und Beobachtete sind untrennbar miteinander verbunden. Das erkannte Heisenberg im Bereich der Mikrophysik bereits 1927 durch die ‚Unschärferelation‘.
Mit anderen Worten: Wir sind Teil der Wirklichkeit und nicht ihr objektiver Betrachter. Im ‚Gewahr-Sein‘ dieses Wissens versuchte ich diese Untersuchung behutsam durchzuführen und stieß dabei auch immer wieder an Grenzen: Wann und bei wem, kann, soll, darf ich ein Audiotape oder eventuell eine Kamera mitlaufen lassen? Wo platziere ich die Geräte? Welche Fragen sollte ich in die Reflexionen und Erstgespräche noch mit einflechten? Welche Fragebögen verwende ich und wie werte ich sie aus?
Musik, Musiker und Musiktherapeuten sollten sich aus meiner Perspektive im Sinne von Fubini (1997) zur Vermittlung von Menschlichkeit und Individualität verpflichtet fühlen. Deshalb bin ich so wie Faulstich (2010) davon überzeugt, dass sich, wenn es gelingt, Menschlichkeit und Individualität wieder zurück in die Heilbehandlung zu bringen, auch das medizinische Weltbild mit verändern wird.
Die häufig fehlende Menschlichkeit innerhalb der ‚Apparatemedizin‘, der Mangel an liebevoller Zuwendung und am Zuhören ist oft das, was PatientInnen in der Praxis am stärksten vermissen und sowohl in den Erstgesprächen als auch während der Therapie deutlich zum Ausdruck bringen.
Ein wesentlicher Bestandteil meiner musiktherapeutischen Arbeit besteht deshalb ganz im Sinne von Carl Rogers darin, ein von Achtung, Wertschätzung und Verstehen geprägtes Klima zu ermöglichen (Rogers, 1983). Dabei kann sich Starrheit zu Beweglichkeit, statisches Beharren zu Entwicklung, Abhängigkeit zu Autonomie und Abwehrhaltung zu Selbstannahme und Selbstverwirklichung hin entwickeln.
Musiktherapie als jahrtausendealte Methode der Heilbehandlung kehrte in Europa vor etwa fünfzig bis sechzig Jahren zurück in die medizinische Behandlung. Aus meinem Blickwinkel heraus auch deshalb, um die Muse und Ästhetik, die Stille und Ruhe, das Individuell-Kreative, die Vielfalt, die Freude, die Schönheit, das Herzliche, das nicht Messbare oder Fassbare, das Unbegreifliche wieder aufzuspüren und möglich zu machen und ‚Räume bereitzustellen‘, um so für die Zukunft langsam wieder eine Balance der Kräfte zu erwirken. „Dort aber, wo die Erinnerungen unserer archaischen Vorfahren liegen, als Teil unserer Gegenwart, schlummern geheimnisvolle Kräfte, mit denen neue und manchmal jahrtausendealte Methoden in Resonanz treten, um sie zum Nutzen der Patienten zu wecken“ (Faulstich, 2010, S. 13).
Im Alltag und musiktherapeutischen Tun, aber auch im Forschen denke ich dabei gerne an die Worte von Karl R. Popper, der meinte: „Alles Lebendige sucht nach einer besseren Welt“ (Popper, 1995, S. 5), und an Jean Gebser, der sinngemäß schrieb: Offen zu sein für die Strömungen des Geistes, aus denen fortschreitend eine veränderte Wahrnehmung von Wirklichkeit entsteht (Gebser, 1986).
EINLEITUNG
Wir denken selten an das, was wir haben, aber immer an das, was uns fehlt.
(Schopenhauer)
Wenn ich mit hohen Erwartungshaltungen, Perfektionismus, bewusster und unbewusster Ausübung von Macht und Kontrolle und dem Mangel an Zufriedenheit und Toleranz bei PatientInnen mit affektiven Störungen in Kontakt komme, so erklingt in mir oft das oben erwähnte Zitat Schopenhauers. Und ich frage mich dabei vor allem: Welche Ressourcen bringt meine Patientin oder mein Patient mit? Wie können wir diese in respektvoller, liebevoller und achtsamer Beziehungsgestaltung gemeinsam nutzen, um so vorerst eine Differenzierung der Wahrnehmung zu erreichen und um dann in der Folge positive Veränderungen im Verhalten und Erleben der PatientInnen zu ermöglichen?
Als Ressource kann nach Grawe & Gerber (1999) jeder Aspekt des seelischen Geschehens und darüber hinaus der gesamten Lebenssituation eines Menschen aufgefasst werden: motivierendes Bereitsein, Geschmack, Wissen, Bildung, Fähigkeiten, Gewohnheiten, Interaktionsstile, Aussehen, Kraft, Ausdauer, Finanzen, zwischenmenschliche Beziehungen, Werte, Moral.
Um Ressourcen und bewusste sowie unbewusste Erwartungshaltungen zu erfassen, kam das Modell der 12 dynamischen Ebenen, welches in Kapitel 3 näher beschrieben wird, bereits im Erstgespräch zur Anwendung. Es versteht sich einerseits als Modell für die Erfassung von Ressourcen, von bewussten und unbewussten Erwartungshaltungen und andererseits als Behandlungsmodell für den gesamten Verlauf des Therapiegeschehens. Grundsätzlich ist das dynamische 12 Ebenen Modell ein offenes, bio-psycho-sozial- transzendentes Modell, das sich laufend weiterentwickelt.
In der vorliegenden Arbeit befasse ich mich mit den in der klinischen Praxis beobachteten Zusammenhängen und Phänomenen von hohen Erwartungshaltungen, Perfektionismus, Macht, Kontrolle, übertriebenem Sicherheitsdenken und Angst bei PatientInnen mit affektiven Störungen. Im ersten Kapitel werden die Definition, Klassifikation und Störungstheorien, Epidemiologie, Ätiopathogenese und Psychopathogenese von PatientInnen mit affektiven Störungen beleuchtet. Das zweite Kapitel versucht die oben erwähnten Zusammenhänge, welche bei den untersuchten PatientInnen mit affektiven Störungen auftraten, zu beschreiben. Im dritten Kapitel folgt die Beschreibung und Einbindung des dynamischen 12 Ebenen Modells. Im Anschluss daran wird das musiktherapeutische Konzept, mit dem ich in der Praxis arbeite, beschrieben. Im fünften Kapitel folgen die Darstellung der Untersuchungsanlage, Fragestellungen und Hypothesen zu dieser Untersuchung. Die Ergebnisse der Auswertungen finden sich im Kapitel sechs und so mündet diese Arbeit in eine Diskussion und eine Zusammenfassung.
1. AFFEKTIVE STÖRUNGEN
Da es sich in dieser Untersuchung um PatientInnen mit affektiven Störungen handelt, befasst sich das erste Kapitel mit der Definition von affektiven Störungen. Daraufhin folgt die Klassifikation affektiver Störungen mit Detailverweisen zum ICD-10-Katalog (F.30-39) und DSM-IV-TR. Störungstheorien und Erklärungsmodelle dazu, vor allem die Aussagen von Aldenhoff (1997), finden sich im Abschnitt 1.3. Im Anschluss daran werden die Häufigkeiten affektiver Störungen beleuchtet. Am Ende des ersten Kapitels finden sich kurz gefasste Aussagen zur Ätiopathogenese und Psychopathogenese.
1.1 Definition
Affektive Störungen sind hauptsächlich durch eine krankhafte Veränderung der Stimmungslage (Affektivität) meist hin zur Depression oder gehobenen Stimmung (Manie) charakterisiert. Depressionen können ein vielgestaltiges Bild zeigen. Hauptsymptome sind eine gedrückte Stimmung, Hemmung von Denken und Antrieb sowie körperlich vegetative Störungen. Ein gesteigerter Affekt ist als Manie bekannt, bei der die Betroffenen eine so gehobene Stimmung an den Tag legen, dass sie der Situation unangemessen erscheint. Eine leichtere Ausprägung der Manie bezeichnet man als Hypomanie. Die Depression kann ebenso wie die Manie in unterschiedlichem Schweregrad auftreten. Es kann auch vorkommen, dass die beiden Extreme der gehobenen und der gedrückten Stimmungen sich gegenseitig abwechseln. Dies bezeichnet man als bipolare Störung. Oft sind affektive Störungen durch ein plötzliches Auftreten und ein ebenso plötzliches Verschwinden gekennzeichnet. Allerdings gibt es auch Fälle, in denen Personen mit einer affektiven Störung eine anhaltende Stimmungsstörung aufweisen. Bei der Zyklothymia handelt es sich um eine andauernde Instabilität der Stimmung, während bei der Dysthymia eine chronisch depressive Verstimmung kennzeichnend für die Krankheit ist (Möller, Laux & Deister, 2009). Das Risiko, im Laufe des Lebens an einer affektiven Störung zu erkranken, liegt bei 1-3 %. Depressive Erkrankungen sind dabei am häufigsten.
− Affektive Psychosen verlaufen zu 65 % unipolar (nur depressive Phasen)
− Bei ca. 30 % der Fälle: bipolarer Verlauf (depressive und manische Phasen) − Bei etwa 5 % der Fälle kommt es zu rein manischen Episoden (ebd., S. 80) 10
Frauen sind dabei deutlich häufiger von Depressionen betroffen als Männer. Bei bipolaren Störungen konnten keine Unterschiede zwischen den Geschlechtern gefunden werden. Nach Hochrechnungen der Weltgesundheitsorganisation nehmen Depressionen weltweit zu. Sie werden sich über die nächsten zwei Jahrzehnte zu jener Krankheitsgruppe entwickeln, die neben den Herz-Kreislauf-Krankheiten das meiste Leiden und die höchsten Kosten verursacht.
1.2 Klassifikation von affektiven Störungen
Grundsätzlich unterscheidet man affektive Störungen in:
− unipolare Erkrankungen
− bipolare Erkrankungen
Zu den unipolaren Erkrankungen zählen die Depression und die Manie. Diese Gruppe enthält Störungen, deren Hauptsymptome in einer Veränderung der Stimmung oder der Affektivität hin zur Depression - mit oder ohne begleitende Angst - oder auch zur gehobenen Stimmung bestehen. Dieser Stimmungswechsel wird meist von einer Veränderung des allgemeinen Aktivitätsniveaus begleitet. Die meisten anderen Symptome beruhen hierauf oder sind in Zusammenhang mit Stimmungs- und Aktivitätswechsel leicht zu verstehen. Die meisten dieser Störungen neigen zu Rückfällen. Der Beginn der einzelnen Episoden ist oft mit belastenden Ereignissen oder Situationen in Zusammenhang zu bringen. Im Detail sei hier an dieser Stelle auf den ICD-10-Katalog (F.30-39) und DSM-IV-TR verwiesen.
1.3 Störungstheorien und Erklärungsmodelle
Als Teil von Leitlinienempfehlungen zur Psychotherapie von affektiven Störungen sind Störungstheorien und Erklärungsmodelle nur als Hintergrundheuristiken von Bedeutung. Die folgende Kurzdarstellung soll die psychobiologische Orientierung aufzeigen, Behandlungsalternativen verdeutlichen und den gleichzeitigen oder konsekutiven Einsatz von pharmakologischen und psychotherapeutischen Strategien begründen. Erklärungshypothesen affektiver Störungen lassen sich zwar vereinfacht
bestimmten biologischen und psychologischen Modellvorstellungen zuordnen (Hautzinger, 1998a), doch keiner dieser Ansätze kann bislang für sich in Anspruch nehmen, eine überzeugende, monokausale Erklärung geliefert zu haben. Es ist angesichts der Heterogenität der affektiven Syndrome vermutlich auch unwahrscheinlich, dass ein Faktor allein für die Entstehung einer Depression oder Manie verantwortlich ist. Von der Mehrzahl der ExpertInnen werden ‚multifaktorielle Erklärungskonzepte‘ angenommen. Bereits in den 1970er Jahren hatten Akiskal & McKinney (1975) ein ‚Final Common Pathway‘-Modell der Depression vorgeschlagen. Dieses postuliert, dass dem Auftreten einer Depression eine gemeinsame Endstrecke neuronal gestörten Stoffwechsels vorausgeht. Das ‚Hineingleiten‘ in diese gemeinsame Endstrecke kann durch die unterschiedlichsten Bedingungen (physikalisch, genetisch, sozial, entwicklungspsychologisch, kognitiv, zwischenmenschlich u.a.) und deren multiple Interaktionen verursacht werden. Entsprechend besteht zwischen sozialen, psychologischen und biologischen ‚Ursachen‘ kein Gegensatz, sondern sie ergänzen einander.
Aldenhoff (1997) fasst neurobiologische und entwicklungspsychologische Befunde zu einem psychobiologischen Phasenmodell der Depressionsentwicklung zusammen. Er geht davon aus, dass bei den später affektiv erkrankten Menschen ein ‚frühes Trauma‘ vorliegt. Dabei soll dieser Begriff eine ausgesprochen heterogene Ausgangsbedingung darstellen, wie frühkindliche Deprivation, Vernachlässigung, Missbrauch, Veränderungen der Rezeptorenstruktur durch Virusinfektionen, genetische Aberrationen und noch bis dato unbekannte Mechanismen. Die Adaptation an diese ,Traumen‘ erfolgt im Sinne eines biologischen ‚Priming‘, welches neurobiologische Veränderungen bewirkt, die der Depression lange vorausgehen, persönlichkeitsbildend wirken und an Lebensbedingungen und Lebensereignissen Anteil haben. In diesem Anpassungszustand, der über Jahre unbemerkt bestehen kann (Latenzphase), ist der Mensch empfindlich für depressionsauslösende Bedingungen.
Durch entsprechende psychologische und/oder biologische Ereignisse kommt es zu einer Reaktivierung mit einer möglichen ersten affektiven Reaktion, die nach inadäquater Bewältigung in eine zweite Latenzphase mündet. Bereits geringfügige Ereignisse können nun zu depressiven Phasen und dem Krankheitsbild der affektiven Störung führen. Die Aussagen und Erkenntnisse Aldenhoffs sind plausibel, gut nachvollziehbar und fließen so in den musiktherapeutischen Handlungsansatz mit ein.
1.4 Häufigkeiten affektiver Störungen
Unter den affektiven Störungen kommt den depressiven Erkrankungen die größte Bedeutung zu. Sie gehören heute zu den häufigsten psychischen Erkrankungen. Exakte Zahlen hängen von Stichproben und Diagnosekriterien ab und sind in vielen Ländern und Kulturkreisen unterschiedlich. 5-10 % der deutschen Bevölkerung (ca. 4 Mio. Menschen) leiden an behandlungsnotwendigen Depressionen (Möller et al., 2009). Depressionen treten in allen Lebensaltern auf. Lag in früheren Untersuchungen der Ersterkrankungsgipfel zwischen dem 30. und 40. Lebensjahr, so zeigen neuere Studien, dass sich dieser Altersgipfel vorverlagert hat, nämlich zwischen das 18. und 25. Lebensjahr.
Depressive Störungen in der Kindheit und im Jugendalter sind ein weitverbreitetes Problem. So berichten nationale und internationale Studien über Prävalenzen von 15- 20 % bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres (Birmaher, 1996; Wittchen, 1998), wobei die Prävalenz in der Pubertät stark ansteigt. So konnten Hankin & Abramson (1998) in ihrer 10-Jahres-Längsschnittstudie im Alter zwischen 15 und 18 Jahren einen bedeutsamen Anstieg der an Major Depression erkrankten Jugendlichen nachweisen. Bei den Dysthymien kann über die Lebensspanne zunächst mit einer stetigen Zunahme, dann jedoch ab dem 30. Lebensjahr eine allmähliche Abnahme festgestellt werden. Frauen weisen in nahezu allen (Quer- und Längsschnitt-)Untersuchungen ein doppelt so hohes Erkrankungsrisiko für unipolare Depressionen wie Männer auf.
Neuere Studien, insbesondere unter Berücksichtigung jüngerer Stichproben und mehrerer Indikatoren (Punktprävalenz und Inzidenz), lassen vermuten, dass das Erkrankungsrisiko für Mädchen, Jugendliche und junge Frauen im frühen Erwachsenenalter steiler ansteigt als bei Jungen und jungen Männern. Frauen weisen zudem eine höhere Rückfallneigung für weitere depressive Phasen auf (Kühner, 2003). Unter den sozioökonomischen Faktoren sind der Familienstand und das Vorhandensein und Fehlen einer vertrauensvollen persönlichen Beziehung als Risiko- und Protektionsfaktoren bei unipolaren Depressionen gesichert. Getrennte und geschiedene Personen und Menschen ohne Bezugspersonen im Umfeld erkranken eher daran. Personen mit positiven Sozialbeziehungen, höherer Bildung und beruflicher (sicherer) Anstellung sowie mit einem Wohn- und Lebensraum in eher ländlich-kleinstädtischer Umgebung haben die niedrigsten Depressionsraten. Im Alter kann es durch plötzliche Veränderungen der Lebensumstände, durch den Verlust von geliebten Menschen, oder wenn die allgemeine körperliche Gesundheit nachlässt, zu depressiven Verstimmungen kommen. Depressionen sind heutzutage die häufigste psychische Erkrankung im Alter. Bei etwa 10-15 % der älteren Bevölkerung werden heute depressive Symptome festgestellt und der Bevölkerungsanteil älterer Menschen nimmt mehr und mehr zu (Möller et al., 2009). In der nachstehenden Tabelle wird die Prävalenz (die Kennzahl der Häufigkeit einer Erkrankung) von affektiven Störungen dargestellt. Die Punktprävalenz wird dabei definiert durch einen genauen Zeitpunkt, einen Stichtag.
Tabelle 1: Prävalenz von affektiven Erkrankungen (Hautzinger, 1998a; Jacobi, 2004)
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Bipolare Störungen 0,5-2 % 1-2 % ~ 3 %
1.5 Ätiopathogenese bei affektiven Störungen
Für die Entstehung affektiver Erkrankungen werden heute integrative bio-psycho- soziale Modellvorstellungen im Sinne eines Vulnerabilitäts-Stress-Konzeptes herangezogen, da vor allem Depressionen als multifaktoriell bedingt angesehen werden. Die depressive Wirksamkeit eines Lebensereignisses wird offenbar vor allem durch die individuelle Disposition des Einzelnen bestimmt. Weiteres dazu findet sich in dieser Arbeit im Kapitel 2.3.1 und bei Möller et al., 2009, S. 81ff.
1.6 Psychogenese bei affektiven Störungen
Die Verläufe affektiver Störungen weisen eine große interindividuelle Variabilität auf. Man kann davon ausgehen, dass über drei Viertel der depressiven PatientInnen nach sechs Monaten so weit gebessert sind, dass sie wieder ihre gewohnte Leistungsfähigkeit besitzen und das alte Selbst hervortritt, obwohl oft einzelne Beschwerden bestehen bleiben. Etwa die Hälfte aller affektiven Episoden weist sogar nur eine Länge von drei Monaten auf. Die Wahrscheinlichkeit, erneut an einer depressiven Episode zu erkranken, liegt Ende des ersten Jahres bei 30-40 % (Belsher & Costello, 1988). Innerhalb von zwei Jahren nach der Indexepisode muss mit einer Rückfallwahrscheinlichkeit von 40-50 % gerechnet werden (Evans, Hollon & DeRubeis, 1992; Hautzinger & de Jong-Meyer, 1996).
Eine Phase ohne Rückfälle fand sich über einen 5-Jahres-Nachkontrollzeitraum bei 42 % der unipolar depressiven, doch nur bei 30 % der bipolaren PatientInnen. Übereinstimmend wird für über 20 % der affektiv gestörten PatientInnen eine Chronifizierung mit einer Dauer der Beschwerden von über zwei Jahren gefunden (Meyer & Hautzinger, 2004).
Die Gefahr einer Selbstmordhandlung wird bei PatientInnen, welche aufgrund einer Depression behandelt werden oder wurden, auf 10-15 %, bei den bipolaren Störungen sogar auf etwa 20 % geschätzt. Sie liegt damit beträchtlich höher als innerhalb der Normalbevölkerung und konnte auch durch moderne Behandlungsformen nicht gesenkt werden. Darüber hinaus besteht auch eine gegenüber Nicht-Depressiven erhöhte Mortalität wegen körperlicher Störungen, im Besonderen parallel zur Altersdepression. Eine Schwächung des Immunsystems wurde für Trauernde nachgewiesen und könnte einen Teil der Verbindung von depressiven, körperlichen und psychosomatischen Erkrankungen erklären. Unerkannte und unbehandelte Depressionen ziehen ernsthafte gesundheitliche Risiken, körperliche Erkrankungen sowie eine erhöhte Mortalität nach sich und verursachen dadurch hohe Folgekosten (Katon, Lin, Russo & Unützer, 2003).
2. ZUSAMMENHÄNGE VON AFFEKTIVEN STÖRUNGEN
MIT INDIVIDUELLEN UND SOZIALEN DEFIZITEN
Vom Sommer 2009 bis zum Ende des Jahres 2011 untersuchte ich an der Klinik Sigmund Freud in Graz 90 MusiktherapiepatientInnen mit affektiven Störungen. Bereits zuvor und im Verlauf dieser Untersuchung stieß ich immer wieder auf sehr ähnliche, analoge Phänomene und Zusammenhänge, die in mir die Idee einer Untersuchung der beobachtbaren Phänomene reifen ließ. Dabei handelte es sich um: hohe Erwartungshaltungen, Perfektionismus, Egodominanz, Macht, Kontrolle, Angst und übermäßiges Sicherheitsdenken.
2.1 Hohe Erwartungshaltungen und Perfektionismus
Hohe Erwartungshaltungen, hohe Ansprüche an ,Etwas‘ und Perfektionismus gehen meist Hand in Hand und bergen die Gefahr in sich, die Gegenwart, das Hier und Jetzt zu übersehen, daran vorbei zu handeln, zu denken und zu fühlen. Erfüllen sich die hohen Erwartungen nicht, so ist man enttäuscht und wird parallel dazu von negativen Gefühlen begleitet. Die Verwirklichung von hohen Ansprüchen, von hohen Erwartungshaltungen und Perfektionismus benötigt viel Kraft, die uns dann zur Entfaltung unserer Vitalität und allem anderen fehlt (Zoebl, 2010). Und wann ist etwas perfekt? Wenn ich nichts mehr zu beanstanden habe?
Doch die ‚Perfekten‘ suchen weiter, bis sie etwas finden, das nicht passt - und letztlich findet man immer etwas, das nicht passt (Riemann, 1999; Zoebl, 2010). Perfektion hat somit auch stets einen Zwangscharakter, gedrängt von der Angst, nicht zu genügen.
Oft gehörte Sätze im Therapiegeschehen:
− „Ich will immer allen alles recht machen, so ist auch niemand böse auf mich“
− „Nur wenn ich alles perfekt gemacht habe, fühle ich mich gut“
− „Ich will so geliebt werden, wie ich bin“
− „Wenn ich etwas mache, will ich alles richtig machen“
− „Ich will, dass es immer allen gut geht“
− „Ich möchte ja niemandem durch mich selbst zur Last fallen“
− „Niemals will ich genauso werden wie mein Vater oder meine Mutter, niemals!“
− „Ich möchte niemanden in der Gruppe durch falsche Artikulation verletzen“
Stellt jemand an sich den Anspruch, stets fleißig zu sein, so wird oft nur noch wahrgenommen, wie träge und lethargisch man im Grunde genommen ist und was alles nötig wäre, um dieses unangenehme Gefühl wieder ‚loszuwerden‘. Durch das Erfüllen des ‚hohen Anspruches‘ wird versucht, jene Ganzheit zurückzubekommen, die wir durch diesen erst verloren haben und die wir zu dessen Erfüllung immer weiter und weiter verlieren (Zoebl, 2010). Stellen wir den Anspruch, ‚ein fröhlicher und lebenslustiger Mensch zu sein‘, so erkennen wir ‚zufälligerweise‘ nur noch Dinge, welche die Empfindung ‚traurig‘ in uns auslösen, und müssen ständig etwas tun, um dieses Gefühl auszugleichen (ebd.). Das ist der Grund, warum wir teilweise so negativ auf Traurigkeit und Niedergeschlagenheit reagieren: Unsere Erfahrung ist nicht nur die der Traurigkeit, sondern sie ist auch stark besetzt von wieder erweckten Gefühlen der Unzulänglichkeit und Fehlerhaftigkeit.
„Was diese reaktivierten Denkmuster so schädlich machen kann ist die Tatsache, dass wir oftmals gar nicht realisieren, dass es sich bei ihnen um bloße Erinnerungen handelt. Wir fühlen uns jetzt nicht gut genug, ohne zu merken, dass es ein Denkmuster aus der Vergangenheit ist, welches dieses Gefühl hervorruft“ (Williams, Teasdale, Segal & Kabat-Zinn, 2009, S. 57).
In „Gefühle lesen“ beschreibt Paul Ekman (2004) sehr anschaulich, wie ohne Entscheidung unsererseits und ohne unser unmittelbares ‚Gewahr-Werden‘ innerhalb von Bruchteilen von Sekunden eine ganze Kaskade von Ereignissen abläuft. Emotionssignale tauchen im Gesicht und in der Stimme auf, angeregte und erlernte Handlungen laufen ab und die Aktivität des autonomen Nervensystems reguliert dabei unseren Körper. Unterschiedliche Muster laufen ab, die unablässig unser Verhalten verändern, relevante Erinnerungen und Erwartungen werden wachgerufen und färben unsere Interpretationen dessen, was in uns und der Welt geschieht (vgl. Ekman 2004, S. 92f.). Die Evolution hat einige der Anweisungen in unseren offenen Affektprogrammen vorgegeben und damit Emotionssignale, emotionsabhängige Handlungsimpulse und initiale Veränderungen im autonomen Nervensystem angelegt, die uns die Welt in einer Weise sehen lassen, dass sie mit der von uns gefühlten Emotion in Einklang steht (ebd., S. 93). Neu erworbene emotionale Reaktionen werden rasch genauso unwillkürlich wie nicht erlernte Reaktionen (ebd., S. 101). Gefühle werden auch ausgelöst durch unsere automatischen Bewertungsmechanismen (ebd., S. 52).
2.2 Macht und Kontrolle
Die Ausübung von Macht und Kontrolle ist eng mit hohen Erwartungshaltungen und Perfektionismus, mit bewussten und unbewussten Zwängen gekoppelt, denn es gibt ‚immer‘ etwas zu beanstanden und zu kritisieren, immer etwas zu finden, was ‚nicht passt‘. Dabei geht es solchen Menschen vor allem darum, den eigenen Willen durchzusetzen und die oberste Instanz zu sein, welche bestimmt, was richtig oder falsch, gut oder böse ist (Zoebl, 2010). Vor allem zwanghafte Persönlichkeiten üben bewusst oder auch unbewusst Macht aus. Sie wollen, dass nichts Ungewolltes und Unvorhersehbares ausgelöst wird oder passiert. So kommen sie vor lauter Absicherung, Selbst- und Fremdkontrolle nicht mehr dazu, wirklich zu ‚leben‘ (Kast, 2001; Riemann, 1999).
Erinnerungsprotokoll - Herr K.:
Herr K. - depressiver Patient mit zusätzlich starkem Zwangscharakter - erst seit kurzer Zeit in Einzelmusiktherapie. Nach unserer freundlichen Begrüßung hatte ich ihn gebeten, dass er es sich auf der weichen Therapieliege so gemütlich wie möglich machen sollte, um sich dann seinen Einfällen, Ideen und Gedanken überlassen zu können. Darauf sagte er verärgert:
„Ja, aber dann muss ich doch an den gesamten, verdammten Mist denken, den ich ständig mit mir herumtrage, und alles läuft mir dabei aus dem Ufer und ich klinke mich nie mehr ganz ein.“
Er drückte damit wohl aus, wie vieles er im Laufe der Zeit durch seine ständige Selbstkontrolle schon verdrängt hatte.
Eine tragende Rolle bei zwanghaften Persönlichkeiten spielen Zeit, Pünktlichkeit, Geld und Sparsamkeit. An ihnen treten auch Machttrieb, Kontrolle, Starre und Pedanterie am deutlichsten hervor. Zeiten müssen genau eingehalten werden und das Geld wird stets nach klaren Regeln verteilt. Nötige Neuanschaffungen werden zu einer Tragödie und ihre Notwendigkeit wird immer wieder diskutiert. Bei schweren zwanghaften Zügen muss der/die PartnerIn einfach nur noch funktionieren, ohne dabei die eigenen Wünsche äußern zu können (Kast, 2001). Die Betroffenen sind außerordentlich gewissenhaft und spielen gerne den ‚Moralapostel‘. Sie nehmen sowohl bei sich als auch bei anderen alles sehr genau und zeigen nur selten offen ihre Gefühle. Da ihre alltäglichen Beziehungen konventionell, formal und ernst sind, vermitteln sie anderen Menschen häufig einen ‚steifen Eindruck‘. Auf soziale Kritik, vor allem von Vorgesetzten oder Autoritäten, reagieren sie ausgesprochen sensibel (vgl. Möller et al., 2009, S. 367f.).
2.3 Angst
Bei PatientInnen mit affektiven Störungen ist oftmals auch das komorbide Auftreten von Angst zu beobachten. Klinische wie auch epidemiologische Untersuchungen zeigen, dass depressive Störungen und Angststörungen hoch assoziiert sind, wobei ein Teil dieser Assoziationen durch die gegenwärtigen Klassifikationssysteme bedingt sein kann. Depressionen und Angststörungen teilen sich gemäß diesen Systemen einen Teil der Grundsymptome, was die Häufigkeit erhöht, dass ein Krankheitsbild die Kriterien zweier diagnostischer Kategorien erfüllt (Preisig, Merikangas & Angst, 2001).
Dieses Unterkapitel befasst sich im Folgenden eingangs mit allgemeinen Aussagen zur Angst. Daraufhin folgen die Betrachtung der depressiven und zwanghaften Persönlichkeiten nach Riemann, die Begriffsverschränkungen von Dynamik und Angst und am Schluss noch einige Betrachtungen zu übertriebenem Sicherheitsdenken.
Ursprünglich kommt das Wort Angst von der indogermanischen Wurzel ‚angh‘ und hat somit eine starke Verbindung zur Enge, zum Eingeschnürt-Sein. Angst ist eine Form der Erregung ohne genügend Sauerstoff: Während die Erregung den Atem hyperventiliert, hält Angst ihn zurück bis zum Entzug von Sauerstoff im Gehirn und den daraus folgenden Stufen der Bewusstlosigkeit und Ohnmacht (vgl. Hegi & Rüdisüli, 2011, S. 103). Wenn die Angstsituation vorüber ist, können wir im wahrsten Sinne des Wortes wieder aufatmen, durchatmen und unsere Gelassenheit wiederfinden. Angst gilt allgemein als die emotionale Reaktion auf die Antizipation persönlich bedeutsamer Verluste oder Misserfolge. Sie setzt genau dann ein, wenn etwas, das als wertvoll erachtet wird, in Gefahr zu sein scheint. Viele Menschen erkennen oft auch erst in Anbetracht der Angst, was ihnen als ‚wertvoll‘ erscheint. Es bleibt wahrscheinlich eine unserer Illusionen, daran zu glauben, ein Leben ohne Angst leben zu können. Sie gehört mit zu unserer Existenz und ist eine Spiegelung unserer Abhängigkeiten und auch des Wissens um unsere Sterblichkeit (Kast, 2001).
Um Angst binden zu können braucht es Möglichkeiten um Gegenkräfte zu entwickeln. Mut, Vertrauen, Erkenntnis, Hoffnung, Demut, Glaube, Vertrauen und Liebe sind solche Gegenkräfte. Innerhalb des dynamischen 12 Ebenen Modells spielen diese Gegenkräfte eine tragende Rolle, um Angst binden zu können (siehe Kapitel 3). Das Annehmen und Bewältigen der Angst bedeutet, einen Entwicklungsschritt zu machen. Es lässt uns dabei auch ein Stück weit reifen. „So wie die Menschen verschieden sind, haben sie Angst vor
Verschiedenem. Was den Einen ängstigt, fasziniert die Andere. Was die Eine erschreckt, zieht den Anderen an. Die Einen haben Angst vor dem Lauten, die Andern vor dem Leisen. Je nach aktueller Befindlichkeit und deren Hintergrund, je nach Organismus und Umwelt wechselt das erträgliche Maß an Ängsten“ (Hegi et al., 2011, S. 103). Angst verändert auch die Beziehung zu unseren Mitmenschen. Wir werden entweder zu Hilfesuchenden oder wir ziehen uns noch mehr zurück. Viele unserer Ängste stammen noch aus unserer Kindheit, aus unserem früheren Leben und aus Beziehungen, in denen die Kommunikation abgebrochen wurde. Die Bewältigung von Angst können wir jedoch erst wieder durch die Beziehung zu unseren Mitmenschen leisten und wenn wir das Gefühl haben, dabei ‚gestützt‘ zu werden (Kast, 2001).
2.3.1 Grundformen der Angst
Fritz Riemann beschreibt in seinem Buch „Grundformen der Angst“ vier Persönlichkeitsstrukturen: die depressive, die schizoide, die zwanghafte und die hysterische Persönlichkeitsstruktur. Im Hinblick auf die untersuchten PatientInnen mit affektiven Störungen war in der Praxis vor allem die depressive und zwanghafte Persönlichkeitsstruktur häufig zu beobachten. So beschränkt sich dieser Teil auf depressive und zwanghafte Persönlichkeitsstrukturen.
Riemann geht davon aus, dass wir in eine Welt hineingeboren werden, die vier mächtigen Grundimpulsen gehorcht. Die Erde umkreist die Sonne in einem bestimmten Rhythmus und bewegt sich so um das Zentralgestirn unseres engeren Weltsystems, die er als Revolution oder auch Umwälzung bezeichnet. Gleichzeitig dreht sich jedoch die Erde um ihre eigene Achse und führt eine Eigendrehung aus. Damit sind zwei weitere gegensätzliche und sich ergänzende Impulse gesetzt, die unser Weltsystem einerseits in Bewegung halten und andererseits diese Bewegung in bestimmte Bahnen zwingen: die Schwerkraft und die Fliehkraft. Die Schwerkraft zieht nach innen und hält die Welt zusammen. Das hat etwas von einer soghaften Wirkung. Die Fliehkraft hingegen strebt nach außen, drängt in die Weite und wirkt dabei auflösend.
Nur die Ausgewogenheit dieser vier Impulse garantiert die lebendige Ordnung, in der wir in diesem Kosmos miteinander leben. Der Mensch ist auf unserer Erde den Triebkräften und Gravitationen des Sonnensystems unterworfen. Riemann zeigt auf psychologischer Ebene die seelischen Entsprechungen von Flucht-, Schwere-, Umwälzungs- und Eigendrehungskräften. Die Grundformen der Angst entstehen laut Riemann durch die Dynamik der Antinomien, denen unser Weltendasein ausgesetzt ist (vgl. Riemann, 1999, S. 23f.).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: Drehung der Erde um die Sonne; Grafik: Gliese Die Abbildung wurde aus urheberrechtlichen Gr ü nden f ü r die Ver ö ffentlichung entfernt
Nach Riemann wird die depressive Persönlichkeit als ‚Angst vor der Nichtgeborgenheit‘ erlebt. Die zentralen Probleme depressiver Persönlichkeiten sind:
− Sie sind mehr als andere auf den/die PartnerIn angewiesen; die Verlustangst dominiert.
− Die trennende Kluft zwischen ICH und DU quält; man will dem DU so nahe wie möglich bleiben und jede Trennung vom geliebten Gegenüber wird mit Angst erlebt.
− Ferne bedeutet für sie verlassen werden, allein sein und das kann bis zur Verzweiflung führen. Depressive machen sich deshalb gerne kindlich-hilflos abhängig von ihren PartnerInnen oder bringen sie in die kindlich-hilflose Abhängigkeit; diese scheint dem depressiven Charakter vorerst Sicherheit zu geben.
Nähe bedeutet für den depressiven Menschen Sicherheit und Geborgenheit. Er verzichtet auf den Ich-Werdungsprozess und gesteht es oft auch dem/der PartnerIn nicht zu. Er lebt ein echomäßiges, zurückspiegelndes Leben oder drängt es dem/der anderen auf (Kast, 2001; Riemann, 1999). Bewusst ist ihm dabei höchstens die Verlustangst. Der depressive Mensch will nichts Erschreckendes oder Beunruhigendes am Gegenüber wahrnehmen. Er idealisiert die Menschen eher, vermeidet Auseinandersetzungen um des Friedens willen und glaubt der Mensch sei ‚nur gut‘. So bedient er sich altruistischer Tugenden wie Bescheidenheit, Mitleid, Verzichtsbereitschaft, Friedfertigkeit, Mitgefühl oder Selbstlosigkeit. Wenn ihm diese Verhaltensweisen zur Ideologie werden, kann er sich anderen gegenüber moralisch überlegen fühlen und meint, damit etwas hinzugeben oder gar zu opfern, was er selbst noch gar nicht entwickelt hat oder besitzt: sein ICH (vgl. Riemann 1999, S. 80ff.)
Daraus entstehen auch die ‚passiven hohen Erwartungshaltungen‘ Depressiver, die sich
- wie die Ergebnisse dieser Untersuchung zeigen - in der Praxis folgendermaßen äußern: Depressive sehen zwar die Früchte, doch sie lernten nicht, sie zu pflücken! So zeigt sich unter anderem im musikalisch improvisatorischen Spiel, dass vorwiegend eher unauffällige und kleine Instrumente ausgewählt werden. Depressive PatientInnen nehmen sich gerne zurück und machen anderen die Bühne frei, bringen kaum bis wenig Eigenes ein und spielen wenig dynamisch. Für sich selbst finden sie kaum eine eigene Melodie oder eine eigene Stimme. Depressive Menschen sind häufig verstärkt religiös, denn in der Religion gibt es - unter anderem - die Erlösungsidee und auch die Vergebung der Schuld. Ihre Sehnsucht geht oft auf mystische Erlebnisse der Allverbundenheit und Einheit zurück. In kindlicher Form glauben sie an ein besseres Leben im Jenseits und daran, dass jene, welche sich ‚hier‘ erniedrigt haben oder erniedrigt wurden, ‚dort‘ erhöht werden. Der tief angestaute Neid, der Hass, den sie nie zu äußern wagten, muss in fortlaufenden Selbstanklagen und Selbstbestrafungen abgebüßt werden (Kast, 2001).
Das zentrale Problem depressiver Charaktere liegt zusammenfassend in der nicht geglückten ‚ICH-Werdung‘. Sie kommen aus ICH-Schwäche weder dazu, eigene Impulse oder Wünsche zu entwickeln, noch gelingt es ihnen aus Verlustangst, bei realer Überforderung Nein zu sagen. Was hier helfen kann, ‚ist der Weg hin zum eigenständigen Menschen‘ (Kast, 2001; Riemann, 1999).
Nach Riemann wird die eigene zwanghafte Persönlichkeit als ‚Angst vor der
Vergänglichkeit‘ erlebt. Sehr treffend illustriert das Verhalten zwanghafter Persönlichkeiten wohl dieser folgende Witz aus Riemanns Buch „Grundformen der Angst“:
Ein Mann kommt in den Himmel, sieht dort zwei Türen mit den Aufschriften: Tor ins Himmelreich und Tor zu Vorträgen ins Himmelreich - und er geht durch das zweite Tor.
Menschen mit zwanghafter Persönlichkeit zweifeln stark, zögern und zaudern, denn gefasste Entschlüsse müssen ja ‚absolut richtig‘ sein. Stets müssen sie dabei die richtige Lösung finden oder es setzt sofort die Angst ein. Die Zwangsstörung ist somit eine Angststörung und unter diesen die Kontrollkrankheit par excellence. Kast nimmt an, dass die Prägesituation für Zwänge von Eltern ausgegangen ist, welche sehr harten Gehorsam forderten, die das Kindliche deutlich unterdrückten und denen Kontrolle äußerst wichtig war. Bei diesen Menschen wurde in der Kindheit die Erfahrung gemacht, dass vieles in dieser Welt nur in einer ganz bestimmten Art und Weise getan werden durfte und vieles verboten wurde, das jedoch so gerne getan worden wäre. Es entstand der Eindruck, dass es so etwas wie das absolut ‚Richtige‘, das ‚Perfekte‘ geben müsse, und dies wurde dann zum Lebensprinzip erhoben. Für Menschen mit einer Zwangsstörung ist es deshalb nicht möglich, sich abwechselnd einmal mit dem Kind, dann wieder mit dem Erwachsenen zu identifizieren; was für sie bedeutet, das Kind in ihnen stets unter ‚Kontrolle‘ zu halten. Das hat zur Folge, dass ein Zuviel an Struktur entsteht. Bei einem Menschen mit Zwangsstörung ist sein Lebendigsein, seine Fähigkeit, sich zu wandeln, kreativ zu sein, sich hinzugeben, und eventuell auch das Affektiv-Emotionale in Gefahr. Diese Menschen haben eine große Härte gegenüber sich selbst und oftmals auch eine große Härte gegenüber anderen. Nicht selten haben sie asketische oder auch fanatische Züge und einen tiefgehenden Hass oder zumindest eine Verachtung gegenüber allem, das nicht perfekt für sie ist (vgl. Kast, 2001, S. 90ff.).
Erich Fromm (1993) schrieb über zwanghafte Charaktere, sie wären ‚nekrophil‘. Im Sinne von Fromm bedeutet nekrophil, dass ihr Sozialcharakter eine zunehmende Tendenz zur Zerstörung zeige. Nekrophilie und Destruktivität sind nach Fromm die Folge eines nicht gelebten Lebens (und - im Gegensatz zu Freud - nicht Ausdruck eines biologisch fixierten Destruktions- oder Todestriebes). Kennzeichen von Nekrophilie im sozialen Sinne ist nach Fromm ‚die Vergötterung der Technik‘.
Symbole des Nekrophilen sind Fassaden aus Beton und Stahl, die Vergeudung von
Ressourcen durch überbordenden Konsum und die Art, wie Bürokratismus die Menschen als Dinge behandelt. Treue ist zwanghaften Persönlichkeiten eher nur aus ökonomischen Gründen wichtig (Kast, 1996) und Sexualität verläuft nach Plan. Sie werden leicht zu FanatikerInnen auf allen möglichen Gebieten, kompromisslos und rücksichtslos immer ‚gegen irgendetwas kämpfend‘ (Riemann, 1999).
Protokoll - Herr M. - stark ausgeprägte Zwangsstörung - 56 Jahre alt - erzählt während eines Erstgespräches von vermehrten Schwierigkeiten in seinem Beruf als Tischler:
„Wissen Sie, ich musste einfach noch einmal über die Kante des Holzes schleifen und noch einmal und noch einmal. Es wurde bereits Abend, alle, auch der Chef, waren schon lange nach Hause gegangen. Noch immer hatte ich das Gefühl, die Kante sei noch nicht fein, nicht weich genug. Meine Gedanken kreisten nur darum, wie ich es noch perfekter machen könnte. Ich war nervös, fing an stark zu schwitzen, denn meine Frau hatte bereits mehrmals angerufen und fragte nach, wo ich denn blieb. Ich belog sie und sagte ihr, ich hätte einen weiteren Auftrag annehmen müssen. Bis 22 Uhr schliff ich die Kante, bis es völlig ‚perfekt‘ war. Ich vernachlässigte dabei alle anderen Aufträge, meine Familie, log alle an und fühlte mich nur schlecht dabei, wie so oft schon zuvor. Ich belog auch meinen Chef und sagte, ich hätte bis 22 Uhr an anderen Werkstücken gearbeitet. Doch er sah wieder einmal, dass ich nichts anderes getan hatte. Das ging sehr lange so, nicht nur in der Arbeit, auch daheim und wenn ich etwas beim Haus zu tun hatte. Ich war wie in Trance dabei, immer diese Gedankenschleifen und das Lügen. Aber warum erzähle ich Ihnen das eigentlich? … Ich spüre irgendwie … Sie kommen mir einfach so vertraut vor. Ja und vor einer Woche sagte mein Chef: ‚Hol Dir Hilfe und komm wieder, wenn Du Dich gesund fühlst!‘ Da brach ich in Tränen aus und hatte einen Nervenzusammenbruch. Von da an weiß ich nichts mehr … Erst in der Klinik bin ich wieder aufgewacht.“
Die Einbindung der dynamischen 12 Ebenen im Spiel, im Gespräch, in der Reflexion, das Achtsame in den Blick nehmen, dass das Leben sich immer im Fluss, in Bewegung und Wandlung befindet, bietet sich dazu passend als lebensnahes Modell an. Zum Beispiel im kreativen, improvisatorischen Spiel mit den polaren Kräften auf derjenigen dynamischen Ebene, die - so wie im obigen Fall - dem Patienten Schwierigkeiten bereitet. Verändert sich während einer Gruppentherapie etwas im Spiel, so wird von zwanghaften Persönlichkeiten oftmals sofort der Versuch unternommen, es aufzuhalten, es einzuschränken, zu verhindern oder zu bekämpfen. Hier liegt es am Therapeuten, die Verantwortung für weitere Impulse zu übernehmen und das Spiel mit polaren Kräften anzureichern sowie die folgerichtigen Handlungsanweisungen an die Gruppe zu geben.
Bei zwanghaften Persönlichkeiten kann sich dabei auch langsam die Geduld für das
Unvollkommene und für Neues entwickeln. Sie erscheinen im Spiel oft sehr ernst, pedantisch und alles sollte möglichst ‚genau so‘ und nach ihren Vorstellungen ablaufen. Hier sind musiktherapeutische Angebote vonnöten, die das Chaotische, das Nichtperfekte, das Freie zulassen können, und die PatientInnen durch Wiederholung lernen lassen, ihr Verhalten langsam zu verändern und zu festigen.
2.3.2 Die Begriffsverschränkung von Dynamik und Angst
Fritz Riemanns tiefenpsychologische Studien treffen in erstaunlicher Ähnlichkeit auf die Überlegungen von Hegi & Rüdisüli (2011) zu grundsätzlichen und elementaren Gegen-Kräften im Leben. Sie beschreiben dies sehr anschaulich in ihrem Buch: Der Wirkung von Musik auf der Spur (ebd., S. 94ff.).
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 3: Dynamik-Diagramm von Hegi & Rüdisüli (2011, S. 100)
„Die verblüffenden Übereinstimmungen zwischen dem Konzept der Komponente Dynamik mit seinen vier musikalischen Kraftfeldern und der ,Riemannschen‘ Studie über die vier Lebens-Ängste lassen die Annahme zu, dass die Wirkungskomponente Dynamik tiefenpsychologisch sowohl verborgene Forderungen und Ängste berührt und provoziert, als auch solche Ängste zu bewegen und in Faszination zu verwandeln vermag. Darin liegt ein wichtiger musiktherapeutischer Ansatz mit der Komponente Dynamik“ (ebd., S. 98).
[...]
- Arbeit zitieren
- MAS Erich Neuwirther (Autor:in), 2012, Musiktherapie bei affektiven Störungen. Die Anwendung des dynamischen 12 Ebenen Modells, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/282576
Kostenlos Autor werden




















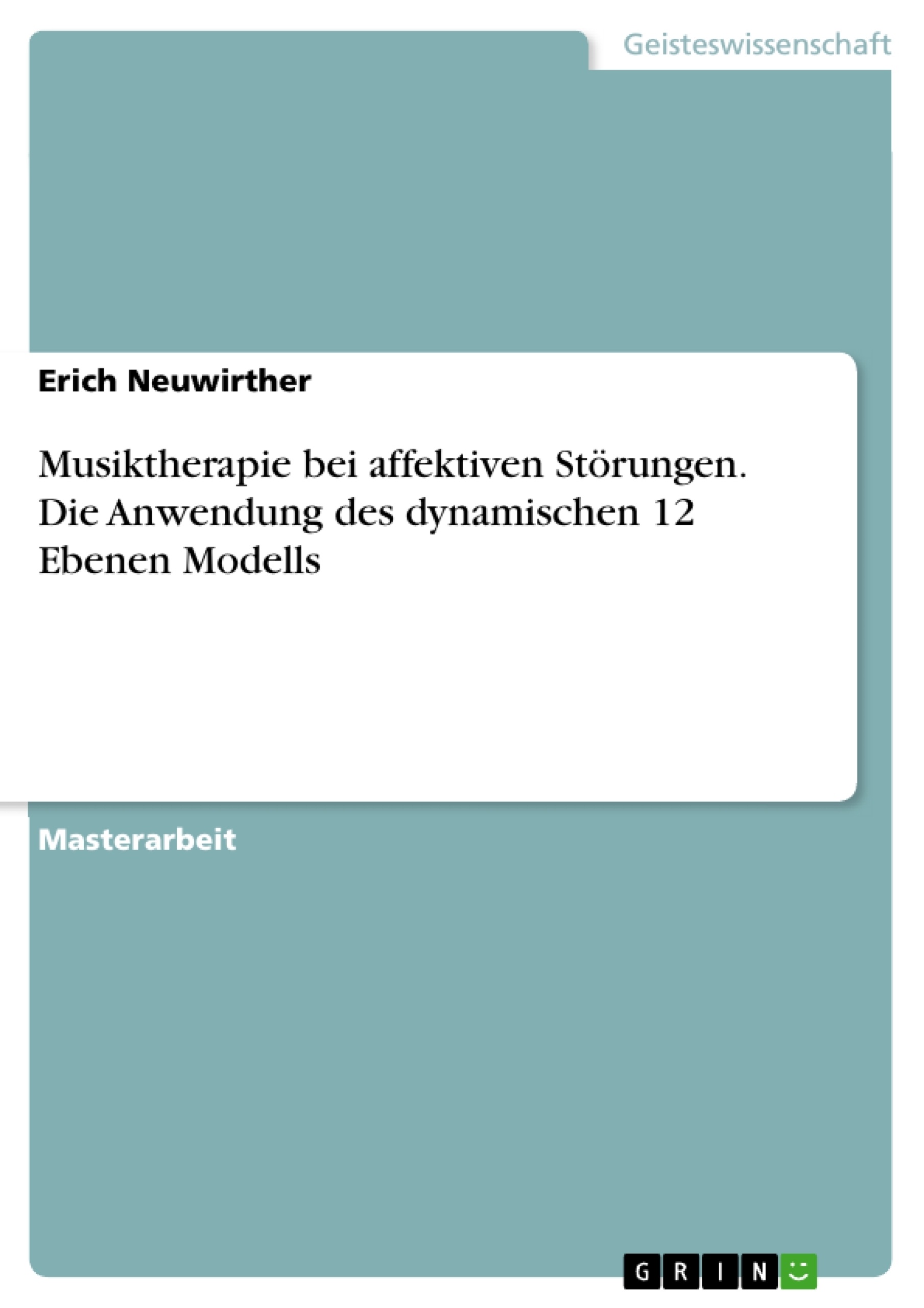

Kommentare