Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Abstract
Kurzreferat
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Umschrifttabelle
Erläuterung zur gewählten Umschrift
Einleitung
A. Problembestimmung
I. Vorüberlegungen
II. Stimmen zu Schiedsgerichtsbarkeit und islamisch geprägter
Rechtsfindung
1. Anhaltspunkte zur Ermittlung des Bedarfs an islamisch geprägter Rechtsfindung
2. Bedenken gegenüber islamisch geprägten Rechtsentscheidungen
3. Religiöse Schiedsverfahren und »Paralleljustiz«
4. »Islamisches Recht« im deutschen Schiedsgerichtsverfahren . .
III. Schlussfolgerungen
B. Allgemeine Betrachtung der Schiedsvereinbarung, Rechtswahl und Anerkennungsfähigkeit
I. Überblick
II. Schiedsvereinbarung
1. Wesen
2. Spezielle Formvorgaben
3. Subjektive Schiedsfähigkeit und Gültigkeitskontrolle
4. Objektive Schiedsfähigkeit
a) Nicht den Regelungen des schiedsrichterlichen Verfahrens unterworfene Arbeitssachen
b) Vergleichsbefugnis der Schiedsparteien
aa) Schiedsrichterliches Verfahren als außergerichtliche Konfliktbeilegung
bb) Familienrechtlicher Rahmen
cc) Erbrechtlicher Rahmen
dd) Strafrechtlicher Rahmen
c) Bewertung
III. Rechtswahl
1. Rechtsnatur
a) Hauptvertrag mit Rechtswahl
b) Rechtswahl ohne Hauptvertrag
c) Ergebnis
2. Form
3. Bestimmung des Sonderkollisionsrechts
a) »Einheitsthese«
b) »Trennungsthese«
aa) Verweisungsvertrag
bb) Auslegungsregeln und Billigkeitsentscheidung
(1) Auslegung des Hauptvertrags unter Berücksichtigung bestehender Handelsbräuche
(2) Ermächtigung zum Billigkeitsentscheid
c) Ergebnis
IV. Rechtsbehelfe
1. Aufhebungsgründe
a) Nicht von Amts wegen zu prüfende Gründe
aa) Verfahrensfehler: Fehlende Schiedsvereinbarung
bb) Verfahrensfehler: Überschreitung der Schiedsvereinbarung . .
cc) Verfahrensfehler: Gehörsmangel
dd) Verfahrensfehler: Sonstige Prozessmängel
b) Von Amts wegen zu prüfende Aufhebungsgründe
aa) Objektive Schiedsfähigkeit
bb) Staatsvorbehalt (ordre public)
(1) Ordre public international oder interne
(2) Anerkennungsrechtlicher ordre public
(3) Kollisionsrechtlicher ordre public
(4) Ergebnis
2. Aufhebungsverfahren
V. Zwischenergebnis
C. Qualifizierung der Billigkeit und der Wirkung des »islamischen Rechts«
I. Entwicklung eines rechtsdogmatisch anschlussfähigen, systemtheoretisch begründeten Rechtsbegriffs
1. Grundbegriffe
a) Begriffe der Normenlogik
b) Begriffe der Systemtheorie luhmannscher Prägung
2. Kants Rechtslehre
3. Verbindungs- und Trennungsthese
a) Kant
b) Radbruch
c) Alexy
d) Kelsen
4. Zwischenergebnis
5. Vereinnahmung durch die Systemtheorie
a) Alexy
b) Kelsen
c) Kant
6. Schlussfolgerungen
II. Billigkeit
1. Billigkeit als Recht
2. Billigkeit im Schiedsverfahren
III. Rechtsimport aus dem Islam
1. Ratio des Islam
a) Methodik
b) Erkenntnisquellen
c) Erkenntnisziel
2. Ergebnis
D. Islamisches Recht im schiedsrichterlichen Verfahren
I. Ausschluss der Rechtswahl gemäß § 1051 Abs. 1 ZPO
II. Ausschluss der Inhaltsprüfung gemäß § 1059 Abs. 2 Nr. 2 lit. b
ZPO
1. Gegenargument: §§ 1055 und 1060 ZPO
2. Gegenargument: Inkonsistenz
3. Lösungsvorschlag: Ignoranz
4. Lösungsvorschlag: Sondervorbehalt
III. Ergebnis
E. Ausblick
Anhang
Literatur
Stichwortverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildungsverzeichnis
1 »Explosionszeichnung« der Beobachtungsebenen
2 Recht als Teil einer absoluten Ethik
3 Recht als teilweise von der Ethik verselbständigtes Phänomen
4 Recht als getrennte Entitäten
5 Recht in der Systemtheorie (Zwischenschritt)
6 Querschnitt Gesellschaftssystem mit Referenz Rechtssystem
Umschrifttabelle
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
a Deutsche Morgenländische Gesellschaft
b Internationales phonetisches Alphabet
c K.E. = Keine Entsprechung (im Deutschen)
d Süddt. = mit der Zungenspitze gerolltes ’r’
e Norddt. = mit dem Zäpfchen gerolltes ’r’
Abstract
The influence of »Islamic Law« in secular societies is the subject of controversial public discussion. The contribution of this thesis is to consider the issue objectively. For this purpose, we examine the possibility to apply Islamic rules in legal disputes in the context of German arbitration, as well as the legal character of these provisions. The first section of this thesis places the analysis in the appropriate literature, whereas the second identifies factors of salience for the juridical analysis of the arbitral procedure. The remaining questions are discussed in the third chapter against the backdrop of the theoretical approach developed by Luhmann (system theory) as a topic of legal theory. The juridical and the theoretical perspective are combined in the fourth chapter to arrive at a conclusion regarding the agreement on the application of »Islamic Law« and its validation. Accordingly, Islamic rules are qualified as »Proto-Law«, based on which the parties to the arbitration may agree to constrain their arbitrators’ decisions. Arbitral awards based on such settlements may potentially be rational judgements recognisable by a properly implemented Ijtihad. After being validated by court they become enforceable at law. Consequently, this particular German rule then becomes Islamic Law. The thesis concludes by considering the prospect for a development of Islamic legal concepts in accordance with the German Constitution and an open question addressed at the social sciences as to whether a corresponding demand can be determined among Germans and other inhabitants of Germany with Islamic denomination.
Kurzreferat
Der Einfluss »islamischen Rechts« in säkularen Gesellschaften ist Gegenstand einer breiten gesellschaftlichen Kontroverse. Ziel dieser Arbeit ist es, einen Beitrag zur Versachlichung der Debatte zu leisten. Dazu wird der Teilbereich des deutschen schiedsrichterlichen Verfahrens herausgegriffen, um in ihm die Wahlmöglichkeit islamischer Vorschriften zur Lösung von Rechtsstreitigkeiten und ihre Qualifikation als Recht zu untersuchen. Nach Verortung des Themas in einschlägiger Literatur im ersten Teil der Arbeit werden in ihrem zweiten die daraus folgenden Anknüpfungspunkte für das Schiedsverfahren aus rechtsdogmatischer Perspektive erörtert. Die darin offen gebliebenen Fragen werden im dritten Teil, unter Rückgriff auf den systemtheoretischen Ansatz Luhmanns, einer rechtstheoretischen Betrachtung zugeführt. Beide Perspektiven laufen im vierten Teil wieder zusammen. Mit ihrer Verknüpfung wird eine Entscheidung über die Wählbarkeit und Anerkennungsfähigkeit »islamischen Rechts« gefällt. Nach dieser sind islamische Vorschriften als »Proto-Recht« zu qualifizieren, das allein zur Bindung und Beschränkung schiedsrichterlicher Billigkeitsentscheidungen von den Schiedspar- teien gewählt werden kann. Auf solcher Grundlage erlassene Schiedssprüche, als Ergebnis eines wiedereröffneten, zeit- und ortsgemäßen Ijtihad, können potentiell rationale und auch anerkennungsfähige Entscheidungen sein. Durch Vollstreckbarerklärung erwachsen sie zu staatlich durchsetzbarem Recht, sodass dieses deutsche Recht in der Konsequenz islamisches Recht würde. Die Arbeit beschließt mit einem Ausblick auf Chancen für die Entwicklung grundrechtskonformer islamischer Rechtsauffassungen und der Anfrage an die Sozialwissenschaften, ob ein entsprechender Bedarf in der deutschen Bevölkerung muslimischen Bekenntnisses festgestellt werden kann.
Erläuterung zur gewählten Umschrift
Da die Schreibrichtung im Arabischen unserer entgegengesetzt ist und die Form der arabischen Zeichen je nach ihrer Position im Wort variiert, sind die Varianten der Zeichen in den ersten vier Spalten der Umschrifttabelle je nach Position in einer Zeichenfolge angegeben (initial = am Anfang; medial = zwischen zwei Zeichen; final = am Ende). Die in den ersten drei Spalten gewählten Zeichenfolgen verweisen in der Regel auf kein Wort. Sie dienen allein dem Zweck, Leserin und Leser die Identifikation des jeweiligen Zeichens an initialer, medialer und finaler Position in einer einfachen Kombination zu erleichtern.
Die letzte Spalte enthält die für diese Arbeit gewählte Umschrift, die zu einem Teil der Version der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft (DMG) entspricht und im Übrigen an jene angelehnt ist, die Samir Matar für sein Lehrbuch „Arabisch. Die Sprache des Dhad“ (MatarVerlag, Berlin 2005) entwickelt hat.
Dem Gegenstand dieser Arbeit gerecht zu werden bedeutet auch, sprachliche als kulturelle Besonderheiten wenigstens in Ansätzen zu berücksichtigen. Die Leitsprache des Islam ist Arabisch. Es erscheint daher geboten, die Begriffe des islamischen Rechts bzw. der islamischen Rechtswissenschaft auch in der Originalsprache zu belassen. Da jedoch elf Laute dieser Sprache zumindest im Standarddeutschen nicht gebildet werden und immerhin noch sieben davon auch nicht in den bei uns gebräuchlichen Sprachen Englisch und Französisch, fällt es schwer, die Begriffe für deutsche Leserinnen und Leser im lateinischen Alphabet phonetisch präzise darzustellen. Eine Möglichkeit wäre, die dem lateinischen Alphabet entlehnten DMG-Sonderzeichen zu verwenden, welche exakt je einem arabischen Zeichen entsprechen. Dadurch lässt sich das arabische Alphabet zwar typographisch elegant eins zu eins für Europäer nachvollziehbar übertragen. Die Lautwerte bleiben deutschsprachigen Leserinnen und Lesern zunächst dennoch verborgen. Der von mir gewählte Ansatz stellt einen Versuch dar, deutschsprachige Lesegewohnheiten stärker zu berücksichtigen und so hoffentlich eine intuitivere Annäherung an die arabische Aussprache zu ermöglichen:
Überwiegend wird einem arabischen Zeichen ein einzelnes dem lateinischen Alphabet entlehntes Zeichen zugeordnet. Vokale werden daher nicht, wie im Schriftdeutschen üblich, durch ein weiteres Zeichen verlängert (etwa uh oder ie) sondern durch eigene Zeichen dargestellt: a, l, U. Die Vokale a, i, u werden kurz gesprochen, wie im Deutschen vor einem Doppelkonsonanten. Für deutschsprachige Leserinnen und Leser ungewohnt, kommt so jedem im Wort aufgeführten Zeichen ein eigener klanglicher Stellenwert zu. Auch das h wird zusätzlich gehaucht. Im Deutschen übliche Diphtonge (au und ai) bleiben hingegen als solche erhalten. In unklaren Fällen wird als Hilfestellung die Silbentrennung mit einem Apostroph gekennzeichnet (so würde Koexistenz nach dieser Regel zu Ko’existenz).
Einige Laute, die sich im Deutschen und im Englischen als Di- bzw. Trigraphen darstellen lassen (ch, sch, th), werden mit Unterstrichen bzw. Überstrichen jeweils als ein einziger Laut gekennzeichnet. Dabei ist zu beachten, dass das palatale ch wie im deutschen ich im arabischen Alphabet standardmäßig keine Entsprechung findet. Wird hier ch geschrieben, gleichgültig an welcher Stelle im Wort, so ist dies stets ein Verweis auf das velare ch wie in ach. Der Unterstrich signalisiert zudem, das w nicht „standarddeutsch“ ( Wasser) sondern „englisch“ (water) auszusprechen. Im Weiteren soll der Unterstrich der klanglichen Abgrenzung dienen:
Das stimmhafte s wie in Sonne wird so vom stimmlosen wie in Wasser abgegrenzt (Sonne = Sonne aber Wasser = Waser). Der englische Digraph th in seiner stimmhaften, wie stimmlosen Variante ist deutschsprachigen Leserinnen und Lesern in aller Regel nicht fremd. Die beiden Klangvarianten werden daher, als Digraph gekennzeichnet, folgendermaßen dargestellt: that = that und think = think.
Da das r im Arabischen in zwei möglichen Klangvarianten gebildet wird (hinten unter Beteiligung des Zäpfchens [uvular] und vorne am Zahndamm [alveolar]), differenziert der Unterstrich zwischen diesen beiden Lautbildungen. Dabei wird das im Standarddeutschen unübliche, wie in süddeutschen Dialekten alveolar geformte r mit dem Unterstrich versehen.
Das nach der DMG-Umschrift übliche y für j wie in Jaguar wird hier vermieden, da es nach deutscher Lesart in manchen Kombinationen intuitiv auch als ü gelesen werden könnte. Zur Abgrenzung dieses j (wie in Jaguar) von dem ebenfalls auftretenden „englischen“ j (wie in Jet) bzw. „französischen“ j (wie in Journal) eignet sich der Unterstrich nicht, da er nur schwer erkennbar ist (j). Es wird ferner angenommen, dass das DMG-Zeichen g Leserinnen und Leser aus dem deutschen Sprachraum eher dazu verleitet, intuitiv den Klang des deutschen g im Lesefluss zu übernehmen. Daher wird auf die „englisch“-„französische“ Abweichung mit dem Sonderzeichen j hingewiesen.
Die mit Punkten unter der Grundlinie versehenen Konsonanten sind zwar der standarddeutschen Aussprache fremd. Das h sollte etwas „schärfer“ gehaucht werden. Die übrigen Konsonsanten werden an ungewohnter Stelle im Gaumen gebildet. Aber auch bei üblicher Aussprache des jeweiligen Buchstabens kann ein ungefährer Eindruck vom Klang der damit zusammengesetzten Wörter gewonnen werden. - Hingegen lässt sich die Aussprache des Zeichens das Ain bzw. Ajn, kaum schriftlich andeuten, weshalb es als eigenständiges Zeichen entsprechend der DMG- Umschrift wiedergegeben wird, als kleiner, rechtsseitig geöffneter Bogen, ohne Leserin und Leser einen ähnlich klingenden Laut anzubieten.
Die arabische Schrift ist wie die hebräische eine Konsonsantenschrift. Das bedeutet, die (kurzen) Vokale werden üblicher Weise nicht geschrieben (aus Wasser wird wssr, bzw. wsr nach der hier gewählten Umschrift, aber Hahn bleibt hahn bzw. han). Auf einen Konsonanten folgt gesprochen jedoch (in der Regel) ein (kurzer) Vokal, der im arabischen Schriftbild selten als Hilfszeichen über oder unter den ihm vorangehenden Konsonanten angezeigt wird. (Langgezogene Vokale zählen dort als Konsonanten.) In der hier gewählten Umschrift werden diese kurzen Vokale angegeben, um die Aussprache nachvollziehbar zu halten. Da sie regional sehr unterschiedlich ausgesprochen werden, deuten die hier vorgeschlagenen kurzen Vokale a, i, u auf eine sehr sterile, möglicherweise in dieser Form überwiegend gar nicht gebräuchliche Aussprache hin. Tatsächlich kann sich das a (lang, wie kurz) in Richtung des ä oder offenen e verschieben, ebenso wie das kurz gesprochene i und das kurze u auch wie ein offenes o klingen können.
Zudem können die Vokale in den verschiedenen arabischen Dialekten vertauscht sein. So lautet die in anderen Werken teils übliche Umschrift von qiyas (nach der hier gewählten: qijas). Der kurze Vokal i fehlt häufig im arabischen Schriftbild. In Teilen des Sprachraums kann sich alternativ etwa auch die Aussprache qujas eingebürgert haben. Aus Gründen der Vereinfachung, werden jedoch die in anderen deutschsprachigen Werken üblichen Vokalisierungen hier übernommen.
Gedoppelte Zeichen führen zu einer rythmischen Zäsur im Wort. Das umgangssprachlich als Ausdruck des Erstaunens im Deutschen verwendete Wort „Hammer!“ könnte hier möglicherweise als verdeutlichendes Beispiel dienen.
Arabische Begriffe werden in dieser Arbeit zunächst stets in der originalen Schrift eingeführt und im Folgenden in der hier gewählten Umschrift. Hauptwörtern geht häufig der Artikel J! (al) voraus. Dieser wird hier übersetzt, sodass im Original geschrieben wird. Dies wird jedoch nicht vollständig als Al-Schart ‘a, sondern als die Schart ‘a übertragen wird. Zum Einen soll dadurch das arabische Hauptwort herausgestellt und sein Wiedererkennungswert gesteigert und zum Anderen die Fehleranfälligkeit der Transkription verringert werden. Zusätzlich wäre dies eine zeichenweise zwar zutreffende, sprachlich jedoch inkorrekte Übertragung. Nach einer grundlegenden Ausspracheregel im Arabischen wird das l im Artikel al von bestimmten Anlauten des Hauptwortes konsumiert. So wird etwa ! asch-schart 'a ausgesprochen. Leserin und Leser könnte diese Fassung zu unsinnigen Fehlschlüssen verleiten: „Ist asch-schart'a eine Art der Gattung Schart‘a?“ Zudem könnte diese Differenzierung der Aussprache aus Unaufmerksamkeit gelegentlich im Schreibfluss untergehen.
Einleitung
Der Themenkomplex Islam und Recht, Islam in deutschem Recht, »islamisches Recht« löst mit großer Verlässlichkeit kontroverse Debatten aus, an denen sich ablesen lässt, wie intensiv die Herausforderung unseres Gesellschaftssystems durch Fremdeinflüsse empfunden wird.1
Im Recht kommt besonders deutlich das Selbstverständnis einer Gesellschaft zum Ausdruck. Es speichert die gemeinsamen Wertvorstellungen ihrer Mitglieder als Rechtsvorstellung und hält die Mechanismen vor, mit denen sie sich dieser Werte im Konfliktfall versichern. Dem Kollisionsrecht kommt dabei die Aufgabe zu, Überschneidungen von heimischem und Fremdrecht in geordnete Bahnen zu lenken. Dadurch ist dieser Bereich besonders empfindlich für den Austausch der Wertvorstellungen unterschiedlicher Gesellschaften. Soweit islamischen Wertvorstellungen misstraut wird, sie als unvereinbar mit den heimischen betrachtet werden, müssen potentielle Kollisionen von Rechtsvorstellungen Unbehagen hervorrufen. Dieser Schluss lässt sich ebenso im umgekehrten Sinne ziehen. Wer weltlichem Recht einer nicht-islamischen Gesellschaft misstraut, wird nach Möglichkeiten Ausschau halten, aus seiner Sicht islamkonforme Wege der Rechtsfindung zu beschreiten.
Das deutsche schiedsrichterliche Verfahren stellt in diesem Zusammenhang möglicherweise eine potentielle Anknüpfung für islamische Vorschriften bereit, die außerhalb eines staatlichen Gerichtsverfahrens zur Lösung eines rechtlich relevanten streitigen Sachverhalts herangezogen werden.2 Dabei kann, der Vorbehalte eingedenk, als besonders problematisch erscheinen, inwieweit die privatautonome Rechtswahl der Parteien eines Rechtsverhältnisses weitgehend der staatlichen Kontrolle entzogen wird, wenn diese eine Schiedsvereinbarung im Sinne des § 1029 Absatz 1 der Zivilprozessordnung3 (künftig: ZPO) treffen und damit im Konfliktfall potentiell nach § 1031 Absatz 1 ZPO den ordentlichen Rechtsweg ausschließen. Die auf diese Weise potentiell geförderte Entstehung „[autonomer] Privatregimes“4 kann die Befürchtung schüren, dass durch sie die Konkurrenzlosigkeit staatlich legitimierter Rechtserzeugung ausgehebelt wird.5
In dieser Arbeit soll die mögliche Vereinbarkeit islamischer Vorschriften, ihr Rechtscharakter und die Überprüfbarkeit auf ihrer Grundlage getroffener rechtlicher Entscheidungen untersucht werden. Dazu werden im folgenden Kapitel einige Thesen als Vorüberlegungen formuliert, denen ausgewählte Auffassungen in der Literatur folgen, um das Thema für die Weiterbearbeitung einzugrenzen. Im Anschluss werden die eingegrenzten Fragen in einer systematischen rechtsdogmatischen Analyse des Schiedsverfahrens soweit möglich auf einfachgesetzlicher Ebene geklärt. Sodann erfolgt eine Anfrage an die Rechtstheorie zu jenen Punkten, für welche die Rechtsdogmatik die Anwort schuldig bleibt. Zu diesem Zweck wird dort der Versuch unternommen, die Systemtheorie Luhmanns in Einklang mit den Konzepten Kants, Kelsens, Radbruchs und Alexys zu bringen, um einen Begriff des Rechts jenseits positivistischer und nichtpositivistischer Auffassungen zu rekonstruieren, der dennoch für eine anwendungsorientierte rechtswissenschaftliche Diskussion anschlussfähig bleibt. An diesem wird die Qualifizierung »islamischen Rechts« anhand der Grundstruktur ihrer Erzeugung und gesellschaftlichen Anbindung vorgenommen. Die in beiden Teildisziplinen gewonnenen Erkenntnisse sollen im unmittelbaren Anschluss gemeinsam auf die Ausgangsfrage zurückgeführt werden, um diese abschließend beantworten zu können. Schließlich wird ein Ausblick auf mögliche Konsequenzen geboten, die sich aus dieser Antwort ergeben.
Ziel der Auseinandersetzung ist es, eine theoretische Basis zur sachlichen Bearbeitung des eingangs genannten empfindlichen Themenkomplexes zu erarbeiten, um möglicherweise Anknüpfungspunkte für beide betroffenen Seiten im gesellschaftlichen Diskurs aufzuzeigen. Sie ist als solche auch ein Test für die Anwendbarkeit der in den Sozialwissenschaften entwickelten Systemtheorie in der Rechtswissenschaft. Unter der Annahme, dass die so geprägte, anwendungsorientierte rechtstheoretische Meta-Ebene den Blick für Gemeinsamkeiten öffnen kann, den der Fokus auf das Detail versperrt, werden daher weder verfassungsrechtli- che Argumente für und wider die Anwendung islamischer Vorschriften im Schiedsverfahren bearbeitet, noch erfolgt ein Blick in die Kasuistik anerkennungsrechtlicher Streitfragen und islamischer Rechtsfindung. Ebenso findet kein Vergleich zwischen »jüdisch-christlichem« und womöglich abweichendem »islamischem« Wertehorizont statt.
A. Problembestimmung
I. Vorüberlegungen
Die Vorbehalte gegenüber islamisch geprägter Rechtsanwendung stellen sich möglicherweise zum Teil noch als historisches Hintergrundrauschen des kollektiven europäischen Bewusstseins dar. Zurückgeführt auf die Säkularisierung Europas als Quintessenz des verheerenden, religiös motivierten 30-jährigen Krieges und des daraus hervorgegangenen westfälischen Systems6 souveräner, untereinander gleichberechtigter Staaten, das unserer heutigen internationalen Ordnung zugrunde liegt,7 muss eine Verbindung von Religion und Recht als Bruch mit der seitdem tradierten Trennung von Religion und Staat erscheinen. In der „Gemeinschaft der Vereinten Nationen [wurden] [. . . ] christlich-religiöse Werte [. . . ] durch säkulare universale Menschenrechte ersetzt [welche] [. . . ] die Grundlage der internationalen Rechtsbeziehungen [bilden]"8 Möglicherweise lassen sich ebenso einige der Vorbehalte gegenüber dem Islam auf die jahrhundertealte Konkurrenz der beiden großen Glaubensgemeinschaften um die Vorherrschaft in Europa zurückführen. Auch „Globalisierungsphänomene“9 des ausgehenden 20. und beginnenden 21. Jahrhunderts dürften mit hineinstrahlen, wie etwa die Schwächung nationaler Demokratien und die Verwischung ihrer Grenzen,10 die sich unter anderem kulturell auch in „religiöser Pluralisierung“11 zeigen und Ängste vor einem schleichenden Identitätsverlust durch eine gewissermaßen mehrdimensionale Unterwanderung schürt. Eine davon wäre die „Islamisierung des deutschen Rechts.“12 Sicherlich kommt auch der Streit um positives und überpositives Recht, Dominanz der Trennungs- oder der Verbindungsthese13 mit ihren politischen, rechtlichen und wissenschaftlichen Implikationen zum Tragen. Dabei steht der zur Rechtsetzung allein berufene demokratisierte Nationalstaat14 möglicherweise unberufenen Akteuren15 gegenüber, welche potentiell mit einer entstehenden „Gegenrechtsordnung“16 dem heimischen Recht, das die Gesellschaft zusammenhält,17 Schaden zufügen, da die positivierten Wertentscheidungen umgangen werden, wenn diesen widersprechende Rechtsüberzeugungen realisiert werden können.18
Innerhalb der Grenzen des in den §§ 1025 ff. ZPO geregelten schiedsrichterlichen Verfahren können die Parteien eines Privatrechtsverhältnisses vertraglicher und nichtvertraglicher Art jedoch nicht-staatliche Akteure, eine private Gerichtsbarkeit, zulässig zur Rechtsetzung berufen. Dabei wirken die Regelungen in den §§ 1051 Abs. 1, 1059 Abs. 2 Nr. 2 lit. b ZPO als autonomes Kollisionsrecht, also vom Nationalstaat gesetzte Vorschriften zur Bestimmung des von mehreren in Betracht kommenden konkret anzuwendenden Rechts19 und von dessen großzügigen Anwendungsgrenzen im ordre public.20 Als solches könnten diese Regelungen dem internationalen Privatrecht (künftig: IPR) zuzuordnen sein, der Bestimmung des anzuwendenden materiellen Privatrechts bei grenzüberschreitenden Sachverhalten.21
Soweit jedoch in § 1025 Abs. 1 ZPO lediglich der räumliche Anwendungsbereich des deutschen Schiedsverfahrens bestimmt ist und ansonsten gemäß § 1051 Abs. 1 ZPO den Schiedsparteien die Wahl des auf den Inhalt ihres Rechtsstreits anzuwendenden Rechts überlassen wird, ist zunächst auch ein Ausschluss deutschen Rechts in einem Sachverhalt denkbar, der die nationalen Grenzen nicht überschreitet. Die Zugehörigkeit zum IPR ließe sich danach infrage stellen. Zudem bietet der Wortlaut des Absatzes Interpretationsspielraum. § 1051 Abs. 1 S. 1 ZPO ermächtigt die Schiedsparteien zur Rechtswahl. In § 1051 Abs. 1 S. 2 ZPO ist klargestellt, dass mit der Bezeichnung des Rechts oder der Rechtsordnung eines bestimmten Staates nur auf dessen Sachrecht verwiesen werden kann. Bilden beide Sätze eine Einheit, so ist nicht daran zu zweifeln, dass nach dieser Norm nur staatliches Recht gewählt werden kann. Die Grenzen des eigenen Kollisionsrechts werden nicht umgangen, die Sorge vor der gesetzlichen Legitimation der Anwendung zumindest nicht staatlich inkorporierten »islamischen Rechts« wäre danach unbegründet. Ist der erste Satz jedoch isoliert zu lesen, so können mit ihm alle Vorschriften zur Klärung eines Sachverhalts vereinbart werden, die sich als Recht qualifizieren lassen. Der Folgesatz kommt dann nur zur Anwendung, wenn das gewählte Recht dasjenige eines Staates ist. Kann das für islamische Vorschriften bestätigt werden, wäre diese Sorge berechtigt, unabhängig davon, ob islamisches und deutsches Recht sich nun zwingend widersprechen oder nicht. Die Zuordnung zum IPR würde gleichsam entfallen, da keine inter-nationale Kollision gefordert wäre.
Die Auslegung des § 1051 Abs. 1 ZPO scheint daher an dieser Stelle für die zu klärende Frage, ob «islamisches Recht»im deutschen Schiedsverfahren zur Anwendung kommen kann, von besonderer Bedeutung zu sein. Lässt sich die Vermutung bestätigen, wonach der erste Satz eine isolierte Norm beinhaltet, schließt sich die Erörterung des Rechtsbegriffs an, um die Wählbarkeit »islamischen Rechts« zu ermitteln. Ist auch das einzuräumen, bleibt die Frage zu klären, wie sich der ordre-public-Vorbehalt im § 1059 Abs. 2 Nr. 2 lit. b ZPO dann auswirkt.
Zunächst soll diese Ausgangshypothese jedoch anhand einiger Stimmen zu Schiedsgerichtsbarkeit und islamisch geprägter Rechtsfindung konkretisiert und möglicherweise angepasst werden. Dabei soll auch berücksichtigt werden, wie die praktische Bedeutung dieser Rechtsfragen bezogen auf »islamisches Recht «einzuschätzen ist. Der genannte Begriff soll bis zu einer später erfolgenden genaueren Bestimmung des Rechtsbegriffs zunächst nur als ,nicht-staatliches Recht islamischer Prä- gung‘ verstanden werden.
II. Stimmen zu Schiedsgerichtsbarkeit und islamisch geprägter Rechtsfindung
Mit der über die Grenzen Kanadas hinaus schwerpunktmäßig in den Jahren 2003 bis 2006 geführten „Scharia-Debatte“ erhielten Probleme der Rechtswahlmöglichkeiten in Schiedsgerichtsverfahren internationale Auf- merksamkeit.22 Ausgelöst wurde sie durch die Offensive einer islamischen Organisation, die im Jahr 2003 in der Provinz Ontario eine islamische Schiedsgerichtsbarkeit nicht nur institutionalisieren, sondern den Anwendungsbereich der „Scharia“ ausdehnen wollte, womit sie die scharfe Kritik der „Mehrheitsbevölkerung“23 erregte.24 Die Debatte strahlte aus auf das Nachbarland, das ansonsten in rechtlicher Hinsicht einen „unaufgeregten Umgang mit religiösen Schiedsgerichten“25 pflegt.26 Sie wurde auch in Großbritannien aufgegriffen, in dem sich seit Beginn der 1980er-Jahre sogenannte „Sharia Courts“ bilden, auch „Sharia Councils“ tätig werden27 und wo im Jahr 2007 ein islamisches Schiedsgericht als „Muslim Arbitration Tribunal“ institutionalisiert wurde.28
Sorge um die Anwendbarkeit islamisch geprägter Rechtsfindung in säkularen Rechtsordnungen kommen vor allem für den Bereich des Familienrechts und Strafrechts zum Ausdruck.29 Dabei steht ebenso zur Debatte, ob überhaupt ein Bedarf an einem möglichen Rechtspluralismus bei den Bevölkerungsteilen mit muslimischem Bekenntnis besteht.30 Dieser wird in Deutschland zumindest bezweifelt.
1. Anhaltspunkte zur Ermittlung des Bedarfs an islamisch geprägter Rechtsfindung
Rohe zufolge stellen die größte Gruppe der deutschen muslimischen Bevölkerung jene ohne Interesse an der Anwendung islamisch geprägter Rechtsregeln.31 Zu diesen wird der Großteil deutscher Einwohner türkischer Herkunft gezählt, mit dem Hinweis, dass die Rechtsordnung der türkischen Republik bereits zu Beginn der 1920er-Jahre nach europäischem Vorbild umgestaltet und die strikte Trennung von Religion und Staat verwirklicht wurde; sie haben daher gleichsam eine säkulare, ja laizistische Sozialisation genossen.32 Dennoch wird vor dem Entstehen einer islamischen »Paralleljustiz« gewarnt.33
Einer britischen Erhebung aus dem Jahr 2007 zufolge bevorzugten beinahe 2/3 der Befragten die Anwendung säkularen Rechts, hochgerechnet 59 % der rund 1,6 Millionen mehr oder weniger Gläubigen in Großbritannien, und weniger als ein Drittel (28 %) die Dominanz des islamischen. Die Befürworter präferierten in der Breite allerdings dessen moderne Auslegung. Junge Muslime scheinen sich indes zu traditionelleren Interpretationen hingezogen zu fühlen.34 Im gleichen Jahr ergab eine Umfrage in den USA, in denen wohl zwischen 2,35 und 6 Millionen Muslime leben, dass 48 % der Befragten den us-amerikanischen Bräuchen aufgeschlossen gegenüberstehen, wenn sie auch ihre kulturellen Eigenheiten bewahren wollen.35
Für Deutschland wurde 2012 ein Bevölkerungsanteil von 4,6 bis 5,2 % (3,8 bis 4,3 Millionen) mit muslimischem Bekenntnis angegeben, wovon rund 55 % über eine ausländische Nationalität verfügen. Vom Gesamtanteil der Muslime haben rund 63 % türkische Wurzeln, rund 14 % entstammen südosteuropäischen Ländern, rund 15 % arabischsprachigen; die Herkunft der verbleibenden rund 8 % kann übrigen Regionen mit muslimischer Bevölkerung zugeordnet werden. Die Verteilung auf die Konfessionen stellt sich nach der zitierten, von der Deutschen Islam Konferenz in Auftrag gegebenen Studie wie folgt dar: Sunniten 74 %, Aleviten 13 %, die sich trotz ihrer besonders säkularen Ausrichtung36 wohl selbst mehrheitlich als Muslime betrachten, Schiiten 7 %. Die verbleibenden 6 % der Befragten verteilen sich auf andere muslimische Strömungen. Von allen Befragten haben rund 36 % angegeben ,stark‘ und 50 % ,eher ‘ gläubig zu sein. Die Befragungsergebnisse legen zudem nahe, dass der Glaube bei Frauen stärker ausgeprägt ist, als bei Männern.37 Soweit als objektiver Indikator praktizierten Glaubens die Vornahme ritueller Handlungen gesehen werden kann,38 deckt sich die Verteilung ,stark‘ und ,eher‘ gläubiger in etwa mit den Antworten zur Gebetshäufigkeit. Danach gaben 41,5 % der befragten Sunnitinnen und Sunniten an, täglich das Gebet zu verrichten; 11,4 % beten demzufolge nie; dazwischen liegen die Abstufungen mehrmals in der Woche, einmal in der Woche, ein paar Mal im Monat, höchstens einmal im Monat, ein paar Mal im Jahr. Bei Schiitinnen und Schiiten steht etwa ein Drittel täglich betender Muslime einem weiteren Drittel nie betender gegenüber. Für sonstige Konfessionen wird eine Verteilung von 30,3 % zu 21,7 % verzeichnet. Nur bei den Alevitinnen und Aleviten übertrifft der Anteil nicht betender Muslime die anderen deutlich.39 Das mag angesichts ihrer säkularen Ausrichtung auch nicht verwundern.40 Insoweit mag das objektive Kriterium für praktizierten Glauben in Frage gestellt werden können. Der Anteil rund 36 % ,stark‘ gläubiger Muslime scheint dennoch mit dem im Durchschnitt 29,2 % täglich betender in Zusammenhang gebracht werden zu können. Bleiben auch durchschnittlich rund 40 % in unterschiedlicher Intensität unregelmäßig betender etwas hinter den befragten 50 % ,eher‘ gläubigen Muslimen zurück, so weichen die Verhältniswerte nicht so stark voneinander ab, dass per se keine Verbindung angenommen werden könnte. Die Bereitschaft zum rituellen Fasten,41 zur Einhaltung islamischer Speise- und Getränkevorschriften42 sowie zur Begehung religiöser Feste und Fei- ertage43 ist zumindest konfessionsübergreifend sehr stark ausgeprägt, in etwa bis zur Marke der rund 86 % gläubigen, überwiegend sunnitischen Muslime türkischer Herkunft. Diese Ergebnisse legen immerhin nahe, dass der überwiegenden Anteil der Befragten sich tatsächlich zum Islam bekennt und auch das Bedürfnis hat, nach den Regeln ihrer Religion zu handeln. Die Frage stellt sich, welche Bedeutung dabei der rechtlich relevanten Anwendung islamischer Vorschriften, ob traditionell oder modern interpretiert, zukommt.
Rohe differenziert zwischen fünf Grundhaltungen zur geltenden Rechtsordnung. Er benennt „<Alltagspragmatiker>“ als größte Gruppe der europäischen Muslime, welche ohne strenggläubige Sozialisation ihre Religiösität mit der säkularen Gesellschaft in Einklang zu bringen verstehen, also mühelos weltliche Strukturen billigen können.44 Wohl mit be- sonderer Überzeugung anerkannt wird der Säkularismus nach Wahrnehmung Rohes von muslimisch sozialisierten „<Islamgegnern>“, die teilweise sogar streng laizisitische Positionen vertreten.45 Als besondere Form der Billigung des lokal geltenden Rechts benennt er ferner „<Traditionalisten>“, welche ihre nicht-muslimische Umgebung als Fremde betrachten, deren zwingendes »Fremdrecht« sie weit überwiegend als das herrschende anerkennen; eine wohl auf dem Prinzip (die Darura = Not, Bedrängnis, Zwangslage, „zwingende Notwendigkeit“46 gründende Konstruktion.47 Diesen stehen „<einheimische Muslime>“ gegenüber, die sich selbst als Teil der Gesellschaft in der sie leben begreifen und versuchen, Rechtsverständnis sowie religiöse Überzeugungen mit dem Recht ihrer Umwelt in Einklang zu bringen.48 Letztlich vertreten somit alle bis hier genannten Gruppen mindestens billigende Positionen unterschiedlicher Reichweite, von der Anerkennung des Anwendungsvorrangs staatlichen bis hin zum kategorischen Ausschluss nicht staatlich gesetzten Rechts. Die Billigung mag auch mit der Uminterpretation und damit Verein- nahmung des lokalen Rechts einher gehen, um Reibungsverluste zu minimieren. Als einzige, nach Rohe nicht signifikante, Gruppe verbleiben die „<Islamisten>“ mit deutlichen Tendenzen, nicht islamisch geprägten Rechtsregeln ihrer Lesart die Anerkennung zu verweigern.49
Sofern die letzte Gruppe in der gesamten muslimischen Bevölkerung Deutschlands nicht ins Gewicht fällt, wird hier vermutet, dass »Traditionalisten« aber auch »einheimische Muslime« den größten Teil der 36 % stark gläubigen Muslime ausmachen. Rohes Darstellung lässt zumindest die Annahme zu, dass beide Gruppen nicht unreflektiert säkularem Recht den Anwendungsvorrang gegenüber rechtlich relevanten Vorgaben ihrer Religion zugestehen wollen. Die Konstruktion nach dem Prinzip der Darura, also die notwendige Anerkennung dieses Anwendungsvorrangs in der Fremde, erscheint als eine Ausprägung der Vereinnahmung dieses Rechts im islamischen Rechtsempfinden. Denn die Legitimation durch einen islamischen Rechtsgrundsatz stellt zumindest eine Anbin- dung her. Weiter geht in Großbritannien das sogenannte, zweifellos nicht unumstrittene angrezi shariat, ein Konglomerat mit den Grundsätzen des britischen Common Law konform gehender Rechtsvorschriften islamisch geprägter staatlicher Rechtsordnungen.50 Dort wird gewissermaßen aus der Not eine Tugend gemacht, indem der Ansatz eines in das Umweltrecht sich einfügenden Rechtskorpus geschaffen wird, um einen Kompromiss aus religiös-rechtlichen Befindlichkeiten und Rechtssicherheit zu schaffen. Das lässt sich möglicherweise auch als Ansatz »einheimischer Muslime« sehen, denen aber gleichsam offen steht, die rein religiöse Bestätigung des säkularen Recht zu entwickeln, in dem sie sich bewegen. Zu derart komplexen rechtlichen und theologischen Überlegungen wird sich niemand genötigt fühlen, der keinen tiefen Bezug zu diesen Aspekten seiner Religion hat. Soweit in den 50 % ,eher‘gläubigen Muslimen die »Alltagspragmatiker« aufgehen, könnte angenommen werden, dass bis zu 36 % der in Deutschland lebenden Muslime sich mit der Vereinbarung staatlichen Rechts und ihrer praktizierten Religion auseinandersetzen. Diese Vermutungen können nur ein Anfangsverdacht sein, der hier nicht empirisch überprüft werden kann. Gegen die vorgenommene, möglicherweise unzulässige Verknüpfung der oben zitierten Umfrageergebnisse mit den Kategorien Rohes spricht immerhin, dass »Glaube« und »Regeltreue« nicht zwangsläufig zusammengehen.51 Gemeinsam mit der britischen Umfrage erscheint es jedoch zumindest nicht abwegig, bei rund einem Drittel der muslimischen Bevölkerung ein Interesse auch an den juridischen Aspekten ihrer Religion zu vermuten. Die Ergebnisse einer weiteren deutschen Studie aus dem Jahr 2007 deuten ebenfalls in diese Richtung.52 Bei rund vier Millionen in Deutschland lebenden Muslimen wären das potentiell etwa 1,3 Millionen Gläubige, die sich mit solchen Fragestellungen auseinandersetzen müssen. Es liegt zumindest nicht fern, angesichts dieser (möglichen) Anzahl, einen potentiellen, durchaus signifikanten Bedarf an alternativen Streitbeilegunsformen die religiöse Befindlichkeiten berückichtigen, nicht auszuschließen.53
2. Bedenken gegenüber islamisch geprägten Rechtsentscheidungen
Noch vor der „Scharia-Debatte“ äußerte etwa Nagel seine erheblichen Zweifel hinsichtlich der mit der gesellschaftlichen Entwicklung korrespondierenden Wandlungsfähigkeit des Islam. Er leitet die Bedeutung des Wortes 'Islam' aus dessen Verwendung im Koran ab und kommt zu dem Schluss, in ihm komme die ihm eigentümliche scharfe Abgrenzung zu den Religionen jüdischer und christlicher Prägung zum Ausdruck. Das Wort stehe sinngemäß für die ausschließliche Hinwendung zu Gott, was aus Sicht des Islam in anderen Religionen nicht sichergestellt sei. Mit einer weiteren grammatischen Erläuterung wird das Wort 'Muslim' als Bezeichnung der Gläubigen erkannt, welche sich dieser Hinwendung bedingungslos ergeben haben. Die Zugehörigkeit zur Gemeinschaft der Muslime bringe göttliches Gesetz, „die Scharia“ unmittelbar zur Geltung.54 In der Re-Islamisierung säkularer Strukturen in islamisch geprägten Staaten sieht Nagel ein Zeichen für den ungebrochenen Alleingeltungsanspruch des Islam und der Bereitschaft, solche zu integrieren, um sie als originär islamisch zu qualifizieren. In diesem Sinne vermutet er, dass islamische Gemeinschaften in Deutschland gleichsam das Grundgesetz vereinnahmen und ummünzen wollen, um schließlich vor Ort islamische Herrschaft und ihr Recht zu installieren, anstatt sich in die bestehende Gesellschaft zu integrieren.55 Da nach islamischer Überzeugung islamische Herrschaft in „unübertrefflicher Weise“ - damit die Wahrung des göttlichen Gesetzes - nur zu Lebzeiten des Prophets „Mohammeds“ möglich gewesen sei, könne der Islam nur in einem rückwärtsgewandten Sinne praktiziert wer- den.56 Ziel sei stets die (Wieder-)Herstellung der „besten [religiös geprägten] Gemeinschaft“ gewesen.57 Der Ausschluss beziehungsweise NichtEinschluss Andersgläubiger führe zwangsläufig zu Diskriminierung und Oppostion gegenüber westlichen Werten.58
Als Gegenstimme kann exemplarisch Scholz insoweit angeführt werden, als dass er im darauffolgenden Jahr durchaus eine grundsätzliche Vereinbarkeit „[des] ,Islam‘ [... ] mit der abendländischen Menschenrechtsidee und ihren Ausprägungen in der westlichen Welt“ annahm.59 Gleichwohl gesteht er, bezogen auf die Entwicklungen im Familien- und Erbrecht islamisch geprägter Staaten, die Reformresistenz einflussreicher traditionalistischer Gelehrter ein.60 Dabei komme der Benachteiligung der Frau eine bedeutende Rolle zu, mit der nach traditionell patriarchalischem Modell die Selbstbestimmungsrechte der Ehefrau auf einem absoluten Minimum gehalten werden. Er verweist auf Reformbestrebungen zahlreicher Länder des „Vorderen Orients“, in denen „die Scharia“ erst durch spätere Verfassungsänderungen zur Grundlage der Gesetzgebung erklärt wurde.61 Dies geht wieder mit der Einschätzung Nagels zusammen, ehemalige Säkularisierungsbestrebungen würden durch rückwärtsgerichtete Re-Islamisierung korrumpiert.
Dies spiegelt in etwa die Bandbreite der Grundpositionen gegenüber dem Islam und den aus ihm fließenden Rechtsauffassungen wieder, welche seitdem die Debatten bestimmen: erhebliche Zweifel an der Reformbereitschaft der Gläubigen bei entweder ebenso großen Zweifeln an der Re- formierbarkeit der Religion oder dem Anerkennen eines grundsätzlichen Reformpotentials. 'Reform' in diesem Sinne zielt im Weiteren auf die Kompatibilität mit europäisch geprägtem Säkularismus.62 Im Speziellen dürfte die deutsche Debatte sich auf die Kompatibilität und das Schritthalten mit der gesellschaftlichen Entwicklung in der Bundesrepublik be- ziehen,63 insbesondere mit den jüngeren Entwicklungen der vergangenen knapp 40 Jahre, sofern man etwa die Familienrechtsreform 1976, die Abschaffung des Straftatbestandes der homosexuellen Handlungen im Jahr 1994 und die Umsetzung der europäischen Antidiskriminierungsrichtlinie aus dem Jahr 2000 durch das Antidiskriminierungsgesetz von 2006 als deren Meilensteine betrachtet.64
Die Sorge vor einer Unterwanderung der deutschen Rechtsordnung durch eine islamische, anti-säkulare Opposition lässt sich indes zumindest für das Familienrecht nicht bestätigen. Rohe spricht insoweit von „Alarmismus“.65 In einer Auswertung aus dem Jahre 2012 der familiengericht- lichen Entscheidungspraxis in Fällen mit islamischem Bezug über einen Zeitraum von etwa zehn Jahren kommt Bock zu dem Schluss, dass sich insgesamt eine sehr differenzierte und leistungsfähige Rechtsprechung auf Grundlage des ordre-public-Vorbehalts herausgebildet habe, die konservativen islamischen Rechtsauffassungen weit überwiegend im deutschen Recht wirksam die Basis entziehe und dennoch Entscheidungen zulasse, die den religiös-kulturell geprägten Wertvorstellungen im zulässigen Maße Rechnung trägt.66 Bock steht zudem der Wandelbarkeit islamischer Rechtsauffassungen grundsätzlich positiv gegenüber, zu der er in erster Linie die Gläubigen berufen sieht.67 Mit Blick auf die Anknüpfung an die kollisionsrechtlich zu ermittelnden einschlägigen Rechtsvorschriften teilt auch Trips-Hebert diese Einschätzung.68
Sorgen dürften jedoch Entwicklungen bereiten, wie sie aus Großbritannien gemeldet werden. Dort kommt wohl den „Sharia Councils“ eine nach Hötte wichtige, wenn auch problematische Rolle gerade in familienrechtlichem Kontext zu, die dort vor allem die Debatte um eine islamische Unterwanderung säkularen Rechts zu bestimmen scheinen.69 Diese Räte werden als „Schattengerichte“ ohne Rechtsgrundlage tätig.70 Ihnen wird eine besonders krass der Werteordnung der britischen Mehrheitsgesellschaft widersprechende, illegale Entscheidungspraxis nachgesagt.71 Ihre Hauptaufgabe liegt jedoch wohl im außerrechtlichen Bereich, gewissermaßen als Schlichtungsstelle bei der islamkonformen Auflösung der Ehe, auch zur Unterstützung der Frau, zur Bewahrung ihrer Möglichkeit der religiösen Wiederheirat.72
Solche nicht staatlich geregelten, für Außenstehende intransparente Verfahren sind auch Gegenstand der Kritik in Deutschland.73 Sofern sie tatsächlich vorkommen spricht das im Übrigen gleichsam für einen Bedarf in signifikanter Intensität. Soweit dieser eine »Paralleljustiz« hervorbringt, wird darin allerdings ein Integrationshemmnis gesehen.74
3. Religiöse Schiedsverfahren und »Paralleljustiz«
Nach Einschätzung Höttes bietet „das religiöse Schiedsverfahren“, als nicht-staatliches Gericht „in welchem religiöses Recht dem Schiedsspruch zugrunde gelegt wird“,75 die Möglichkeit, „[religiöse] und kulturelle Einflüsse [... ] bestmöglich in die Streitentscheidung“ einzubeziehen; Voraussetzung sei freilich eine Eingliederung in den rechtlich gesteckten Rahmen im Umweltrecht.76
Sie kommt zu dieser Einschätzung nach Untersuchung entsprechender Schiedsverfahren in Common-Law-Systemen. In den USA haben diese eine lange Tradition,77 auch als religiös geprägte schiedsgerichtliche Streitschlichtung, letztere mit der ausdrücklichen Funktion, Kultur, Religion und Zusammenhalt der Gruppe zu bewahren.78 Jüdischer und christlicher Schiedsgerichtsbarkeit79 wird dabei ein großer gesellschaftlicher Vertrauensvorschuss entgegengebracht. In ersterer kommt originär jüdisches Recht zur Anwendung,80 in letzterer werden christlich geprägte Auslegungsregeln US-amerikanischen Rechts vereinbart.81 Die Rechtswahl wird in US-amerikanischen Schiedsgerichten frei gestellt bis hin zum vollständigen Auschluss jeglichen Rechts, da dort Schiedsrichter grundsätzlich nicht an Rechtsregeln gebunden sein sollen; die Grenze ihrer Entscheidungsfreiheit ziehe somit die US-amerikanische öffentliche Ordnung.82 Der Verlässlichkeit »islamischen Rechts« scheint dennoch grundsätzlich misstraut zu werden,83 wobei eine Aussage zur Bereitschaft staatlicher Gerichte, islamische Schiedsgerichte konstituierende Schieds- vereinbarungen anzuerkennen, angesichts der wohl nur geringen Anzahl entsprechender Verfahren nicht möglich ist..84 Hötte kommt allgemein immerhin zu dem Ergebnis, dass in den USA religiöse Schiedsverfahren weithin anerkannt sind und für verfassungsrechtlich unbedenklich gehalten werden.85 Die Wirksamkeit von Schiedsvereinbarungen wird nach der Durchsetzbarkeit ihrer säkularen Anteile durch Prüfung ihrer Rechtmäßigkeit anhand „neutraler Prinzipien des Vertragsrechts“ beurteilt.86 Entscheidungen der Schiedsgerichte werden gerichtlich nach den gleichen Prinzipien überprüft, die bei säkularen Schiedssprüche Anwendung finden.87 Dabei kommen auch die in der Rechtspechung entwickelten, trennscharfen Kategorien schiedsfähiger Streitgegenstände zum Tra- gen.88 Dem „unaufgeregten Umgang mit religiösen Schiedsgerichten“ sei anzumerken, dass diese zur Rechtstradition der USA gehören, weshalb die staatlichen Gerichte zur Überprüfung der Entscheidungen auf reichhaltige, detaillierte Entscheidungssammlungen zurückgreifen können.89
Diese Erkenntnis führt zu keiner Aussage über die gesellschaftliche Wirkung dieser tradierten religiösen Schiedsgerichte. Durch sie wird aus hiesiger Sicht zumindest eine Heteronomie in den in der Fläche verhältnismäßig dünn besiedelten Vereinigten Staaten erhalten, zu deren höchsten Gütern wohl »Freiheit« gehört. Eine starke integrative Kraft innerhalb der Gruppe vor Ort könnte so zumindest einhergehen mit der integrativen Kraft innerhalb der abstrakten Gemeinschaft ,Staat‘, welche diese »Freiheit« der parteiautonomen Rechtswahl gewährt.
Für die kanadische Provinz Ontario zeichnet Hötte die zwischen den Jahren 2003 und 2006 über die Landesgrenzen hinaus geführte „SchariaDebatte“ nach. Dieser lag eine allgemeingehaltene Formulierung im Arbitration Act zugrunde. Danach war die Rechtswahl ausdrücklich freigestellt und nicht vom Begriff staatlichen Rechts beschränkt.90 Im Zuge der Debatte wurde schließlich im Bereich des Familienrechts die Rechtswahl im Schiedsgerichtsverfahren gesetzlich ausgeschlossen.91 Dies war auch Schwerpunkt der Kontroverse, zumal das Familienrecht als häufigster Anwendungsfall für ein Ausweichen auf nicht-staatliche Gerichtsverfahren gesehen wurde. Dabei spielte auf gegnerischer Seite letztlich das gleiche Misstrauen gegenüber dem »islamischen Recht« und seiner Re- formierbarkeit im Bezug auf die Gleichstellung von Mann und Frau die entscheidende Rolle, wie es in US-amerikanischen Debatten und oben exemplarisch bei Nagel zum Ausdruck gekommen ist.92 Auf Seiten der Befürworter wurden „individuelle Religionsfreiheit“ und „kollektive Religionsausübungsfreiheit“ geltend gemacht,93 aber auch der kanadische Verfassungsgrundsatz der Multikulturalität, welcher an den oben erwähnten Aspekt der US-amerikanischen »Freiheit« erinnert, wurde eingefordert.94 Zudem wurde die Möglichkeit der islamischen Rechtsfortbildung gerade im Sinne einer Modernisierung und Integration in die säkulare kanadische Werteordnung gesehen, wenn nicht die Rechtswahl ausgeschlossen, sondern stattdessen die Transparenz des Verfahrens gesteigert werde.95 Hötte sieht allerdings gerade diese Möglichkeit auch nach der Gesetzesnovelle erhalten, da im allein anwendbaren kanadischen familienrechtlichen Common Law dennoch islamische Prinzipien im Schiedsverfahren Berücksichtigung finden können.96 Indes misst sie dieser wenig Bedeutung bei, da sie den Schwerpunkt von Rechtstreitigkeiten, für welche die Anwendung »islamischen Rechts« begehrt wird, in der nach staatlichem Recht ohnehin nicht schiedsfähigen Ehescheidung sieht.97 Im Ergebnis zieht sie aus dem kanadischen Konflikt die Erkenntnis, dass vor allem familienrechtliche Streitigkeiten für religiöse, insbesondere islamische Schiedsverfahren in Betracht gezogen werden müssen, welche aber gerade dafür am wenigsten geeignet seien.98
Ähnlich konfliktreich stellt sich für Hötte die Situation in Großbritannien dar.99 Auch hier entzündete sich die Debatte wohl wieder über die vornehmlich erwarteten familien- und auch erbrechtlichen Bezüge dieser nicht-staatlichen Gerichte.100 Der mit sharia courts, sharia councils, dem Muslim Arbitration Tribunal und der angrezi shariat zu befürchtende Fremdeinfluss auf das britische Common Law führte auch zu Anfragen an die Rechtstheorie, soweit zur Reflektion „über Formen des Rechtspluralismus und der Integration religiösen Rechts“ eingeladen wurde.101 Das trifft letztlich die Grundfragen nach dem Wesen des Rechts, seiner Fähigkeit, mehrere Rechtsordnungen in sich koexistieren zu lassen sowie die Qualifikation von Regelungssystemen als Recht. Die vornehmlich politisch geführte Debatte eröffnete jedoch auch in Großbritannien wieder das bekannte Misstrauen gegenüber religiös geprägtem Recht im Allgemeinem und islamischem im Besonderen. Zwar wurde gerade wieder die Flexibilität des Common Law betont, in welchem der Begriff vom Recht leichter mit einem größeren Umfang bestimmt werden kann, als in kontinentaleuropäisch-napoleonisch geprägten Systemen; diese Flexibilität löst aber scheinbar auch dort Befürchtungen aus, die das Bedürfnis nach einer stärkeren Eingrenzung des Begriffs vermuten lassen.102 So sei auch „law“ in § 46 Abs. 1 lit. a des Arbitration Act 1996, der Rechtswahl im britischen Schiedsverfahren, als staatliches Recht zu verstehen, in einer früheren Fassung der Norm: „fixed and settled system of law“.103 Hingegen eröffne § 46 Abs. 1 lit. b Arbitration Act 1996 die Vereinbarung anderer Vorschriften, auch etwa religiöser Normen, die vormals als „legal traditions“ ausgeschlossen waren.104 Somit gelten sie zwar nicht als ,law‘, werden jedoch vom Begriff der „other considerations“ erfasst. Staatliches Recht müsste danach wohl eine von mehreren möglichen Grundlagen streitentscheidender Erwägungen eines Schiedsgerichts sein. Zurückgeführt auf rechtspraktische Probleme wird im Ergebnis deutlich, dass nach den im britischen Common Law wohl zaghafter als in den USA bestimmten Grenzen der schiedsfähigen Streitigkeiten, unter anderem im Familienrecht keine bindenden schiedsrichterlichen Entscheidungen möglich sein sollen.105
Nach Auswertung der Debatten um die religiöse Schiedsgerichtsbarkeit in den drei genannten Common-Law-Systemen kommt Hötte zu dem Schluss, dass besonders in eng verbundenen, streng religiösen Gemeinschaften der Einzelne dem Risiko des erschwerten Zugangs zur ordentlichen Gerichtsbarkeit ausgesetzt ist.106 Auch könne durch solche Verfahren der Segregation Vorschub geleistet werden. Gerade kürzlich immigrierten Personen hätten dadurch potentiell größere Schwierigkeiten, aus ihrer unmittelbaren Bezugsgruppe auszubrechen und ihre staatlichen Rechte, insbesondere die aus dem Gleichbehandlungsgrundsatz folgenden, wahrzunehmen.107 Dabei liegt das Augenmerk auf besonders archaischen Vorschriften, deren Durchsetzung befürchtet wird.108 Das Beispiel jüdischer Schiedsgerichtsbarkeit in den USA weise zwar auf dessen Geeig- netheit als Integrationsinstrument hin. Es sei jedoch zu berücksichtigen, dass dieses auch gerade die gegenteilige Wirkung haben kann.109
4. »Islamisches Recht« im deutschen Schiedsgerichtsverfahren
Adolphsen und Schmalenberg verneinen im Ergebnis die Anwendbarkeit »islamischen Rechts« in der deutschen Schiedsgerichtsbarkeit, dem sie die Rechtseigenschaft absprechen. Erkennen sie es auch grundsätzlich als auf den „Koran“ gestütztes, dem Common Law ähnliches Juristenrecht an, so sei es doch als »klassisches islamisches Recht«, „fiqh-Recht“, nicht Bestandteil gegenwärtiger Rechtsordnungen und mithin schon kein staatliches Recht.110 Vertreten sie auch die Auffassung, die Rechtswahl im deutschen schiedsrichterlichen Verfahren nach § 1051 Abs. 1 ZPO lasse die Vereinbarung nicht-staatlichen Rechts zu,111 so kommen sie doch nach einer funktionalen Betrachtung zu dem Schluss, das »klassische islamische Recht« sei „weder in der (Rechts-)Wissenschaft noch im Bewußtsein der Teilnehmer des Wirtschaftsverkehrs verbreitet“ und durch das Recht arabischer Staaten vollständig ersetzt; mithin sei es auch kein „anationales“ Recht.112 Ihm stellen sie „modernes, anerkanntes islamisches Recht“ gegenüber, als welches sie unter anderem die angrezi shariat betrachten; dieses sei wie staatliches Recht unproblematisch als Entscheidungsgrundlage wählbar.113 »Klassischem islamischem Recht« könne insofern nur als Schiedsvereinbarungsstatut Geltung verschafft werden, dann aber wohl auch in familiären Angelegenheiten, was einer Ermächtigung zur Billigkeitsentscheidung gleich komme, welche die Entscheidungsfindung der Willkür des Schiedsrichters überlassen würde.114
Rohe, der die Einheit der Rechtsordnung und die Trennung von Religion und Recht betont,115 sieht zwar Spielräume für die Anwendung islamischer Normen im dispositiven Recht.116 Er spricht sich jedoch bei der Anerkennung privater Rechtssetzung im Inland oder mit starkem Bezug dorthin für eine strikte Orientierung am zwingenden Inlandsrecht aus; im sensiblen Familienrecht sieht er allein staatliche Gerichte berufen, über den Umfang des darin liegenden Dispositionsspielraums zu entscheiden.117 Insoweit wären zumindest solche Fälle auch nicht schiedsfähig. Für Inlandsfälle sieht Rohe ferner keine Möglichkeit zur Wahl eines religiösen Rechts,118 was sich in der Konsequenz auch auf die Rechtswahl im innerdeutschen schiedsrichterlichen Verfahren negativ auswirken müsste.
Hötte sieht hingegen mit Adolphsen und Schmalenberg anationales Recht von der Rechtswahl aus § 1051 Abs. 1 ZPO erfasst.119 Weitergehend hält sie allerdings auch religiöses Recht über diese Norm für wähl- bar.120 Bezogen auf das Familienrecht seien bereits zahlreiche Streitigkeiten als nicht schiedsfähig allgemein ausgeschlossen,121 sodass sich dort die Frage nach der zulässigen Rechtswahl häufig nicht stelle.122 In den verbleibenden Fällen kommt sie jedoch in Auseinandersetzung mit Rohe zu dem Schluss, dass eine schiedsrichterliche Klärung vermögensrechtlicher Streitigkeiten zwischen Eheleuten uneingeschränkt auf Grundlage religiösen Rechts möglich sei und die gerichtliche Überprüfung des in einem solchen Verfahren ergangenen Schiedsspruchs differenziert erfolgen muss; keinesfalls könne die Wahl religiösen Rechts a priori sittenwidrig sein.123 Hötte begegnet den berechtigten Zweifeln an der Entscheidungsfreiheit einzelner bei Vereinbarung eines religiösen Schiedsgerichts124 mit dem Hinweis auf die allgemeinen Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbu- ches125 (künftig: BGB) und sieht die Wirksamkeit der Schiedsvereinba- rung gewahrt, wenn keine Drohung im Sinne des § 123 Abs. 1 BGB nachgewiesen werden kann.126 In Auswertung ihrer Untersuchung der Praxis in den USA, der kanadischen Provinz Ontario und Großbritannien greift sie im Weiteren Vorschläge zur Novellierung des deutschen Schiedsverfahrensrechts im Hinblick auf familienrechtliche Streitigkeiten auf. So sieht sie die Notwendigkeit obligatorischer anwaltlicher Beratung zur Gewährleistung eines geordneten Schiedsverfahrens. Ferner sollten die Formvorschriften in solchen Fällen verschärft und die notarielle Beurkundung der Schiedsvereinbarung vorgeschrieben sein. Das anzuwendende religiöse Recht sollte präzise konkretisiert sein. Ein ,>Right to exit<“soll die Wirksamkeit der Schiedsvereinbarung von der erneuten Zustimmung der Parteien abhängig machen, wenn ein von ihr erfasster Streitfall eintritt. Die fachliche Qualifikation von Familienschiedsrichtern sollte staatlich vorgegeben werden und eine unabdingbare Begründungspflicht für familienrechtliche Schiedssprüche sollte eingeführt werden. Kritisch steht sie einer obligatorischen nachträglichen schiedsrichterlichen Kontrolle gegenüber, die dem Wesen des Schiedsverfahrens widerspreche. Auch sieht sie die Einschränkung der Rechtswahl in familienrechtlichen Streitigkeiten, wie in Ontario umgesetzt problematisch, da sich die Bildung rechtlich nicht kontrollierter religiöser »Gerichte« so nicht verhindern lasse. Es sei aber wünschenswert, die objektive Schiedsfähigkeit in familienrechtlichen Streitigkeiten ausdrücklich vom Gesetzgeber klarstellen zu lassen.127
III. Schlussfolgerungen
Wie gesehen ist die rechtsdogmatisch relevante Frage nach der Anwendbarkeit islamisch geprägten Rechts im deutschen Schiedsverfahren geknüpft an weitere allgemeine Fragen, die aus anderen gesellschaftlichen Bereichen heraus in die öffentlichen Diskussion hineinwirken. Noch vor den Bedenken bezüglich der Konformität auf Grundlage islamisch geprägten Rechts ergangener Entscheidungen mit der säkularen Rechtsordnung, also vor den Rechtsfolgen ihrer großzügigen Anerkennung, kommt die Skepsis am Bedarf islamischer Schiedsgerichte, am Nutzen einer solchen staatlichen Legitimation.
Zudem zeigt sich, dass schon die Umsetzbarkeit im Hinblick auf die Schiedsfähigkeit fraglich ist, nicht nur der Bedarf an sich. Sollte ein solcher immer noch bestehen, so wird dieser in erster Linie auf dem Gebiet des Familien- und Erbrechts vermutet. Nicht ausdrücklich angesprochen wurden bisher strafrechtlich relevante Sachverhalte. Diese seien ebenfalls Gegenstand von religiös geprägten Schlichtungsversuchen gewesen.128 Sind entsprechende Streitigkeiten jedoch nicht schiedsfähig, so mag ein Bedarf bestehen, er kann lediglich in den Grenzen deutschen Rechts nicht befriedigt werden.
Wird säkulares staatliches Recht von dem weit überwiegenden Teil der muslimischen Bevölkerung Deutschlands bevorzugt und sind bereits durch das Kriterium der objektiven Schiedsfähigkeit die ernsthaft in Betracht kommenden Streitigkeiten für die verbleibende Minderheit ausgeschlossen, so ist die Klärung der auf die Rechtswahl bezogenen Ausgangsfrage rein akademisch. Damit sinkt nicht zwangsläufig das Interesse an einer Antwort. Sie erlangt lediglich keine praktische Bedeutung im Schiedsverfahrensrecht. Allenfalls können weitere Anhaltspunkte für oder wider den Rechtscharakter islamischer Vorschriften herausgearbeitet werden.
Schließt die objektive Schiedsfähigkeit hingegen einen größeren Bestand an Streitigkeiten ein, so ist die Anzahl potentieller Schiedsparteien belanglos. Die Frage nach dem Nutzen stellt sich dann nicht. Denn für diesen Fall sollte die zulässige Rechtswahl zunächst unabhängig von den Rechtsfolgen ihr zugrunde liegender Schiedssprüche zu klären sein. Dabei will hier die grundsätzlich zweifellos in Betracht zu ziehende Religionsfreiheit weniger maßgeblich erscheinen, als der Gleichbehandlungsgrundsatz. Sollten sich islamische Vorschriften doch als Recht qualifizieren lassen und anationales Recht im Schiedsverfahren wählbar sein, so muss das auch für »islamisches Recht« gelten.
Der sachliche Grund für eine Ungleichbehandlung mag zwar in vermuteten krassen Widersprüchen zur deutschen Rechtsordnung liegen. Es soll jedoch dahin gestellt bleiben, ob eine solche Pauschalbewertung als eine Diskriminierung rechtfertigender, sachlicher Grund anzuerkennen wäre. Ebenso wird nicht vertieft, ob die Wahl religiöser Vorschriften gemäß § 1051 ZPO sowie die Anerkennung gemäß § 1059 Abs. 2 Nr. 2 lit. b ZPO auch vor dem Hintergrund des Art. 4 Abs. 1, 2 des Grundgesetzes129 (künftig: GG) zu beurteilen wäre, wie unter anderem von Hätte geprüft.130
Für die weitere Bearbeitung folgt aus alledem die Notwendigkeit, vor der Auslegung des § 1051 Abs. 1 ZPO die Schiedsfähigkeit von Streitigkeiten in den relevant erscheinenden Bereichen zu prüfen. Im Anschluss wird dann die Wahl anationalen Rechts über § 1051 Abs. 1 ZPO und damit auch der Hinweis von Adolphsen und Schmalenberg zu klären sein, wonach »islamisches Recht« nur im Wege der Ermächtigung zum Billigkeitsentscheid aus § 1051 Abs. 3 ZPO zu vereinbaren sei. Schließlich muss das staatliche Anerkennungsverfahren der in beiden Fällen ergangenen Schiedssprüche untersucht werden, um der Thematik dieser Arbeit gerecht zu werden. Um die in der Anfangshypothese aus I isolierten Aspekte sinnvoll erfassen zu können, muss somit im folgenden Kapitel B die gesamte Systematik des Schiedsverfahrens in den Blick genommen werden.
B. Allgemeine Betrachtung der Schiedsvereinbarung, Rechtswahl und Anerkennungsfähigkeit
Das im Zehnten Buch, den §§ 1025-1066 der ZPO geregelte deutsche schiedsrichterliche Verfahren ist mit dem Gesetz zur Neuregelung des Schiedsverfahrensrechts131 internationalen Empfehlungen angeglichen worden. Der Gesetzgeber orientierte sich dazu vorwiegend am Modellgesetz der Kommission der Vereinten Nationen für Internationales Handelsrecht (United Nations Commission on International Trade Law = UNCITRAL).132 Er sah ein „einheitliches Gesetz für nationale und internationale Schiedsverfahren“ vor und wollte darin auch keine Unterscheidung zwischen Schiedsverfahren von Privatleuten und Verfahren der Handelsschiedsgerichtsbarkeit treffen.133 Diese Entscheidung führt in gewissem Rahmen zu einer systematischen Eigendynamik des im Folgenden darzustellenden deutschen schiedsrichterlichen Verfahrens, welche in III besonders gewürdigt wird.
Zunächst wird in I jedoch das Verfahren überblicksartig skizziert, um in II die dasselbe konstituierende Vereinbarung detaillierter zu behandeln. Darüber soll die Schiedsfähigkeit von Streitigkeiten ermittelt werden, welche im vorangegangenen Kapitel als relevant für potentiell islamische Schiedsverfahren erkannt wurden. Dieser Darstellung dient bereits § 1059 ZPO als Referenz. Sodann wird in III der § 1051 ZPO differenziert untersucht. Schließlich folgt in IV eine tiefere Erörterung der Aufhebungsgründe des § 1059 Abs. 2 ZPO, um die Reichweite des ordre-public-Vorbehalts im Schiedsverfahren zu ermitteln.
I. Überblick
Parteien von Rechtsverhältnissen vertraglicher wie nicht-vertraglicher Art (§ 1029 Abs. 1 ZPO) wird durch das schiedsrichterliche Verfahren die Möglichkeit eröffnet, ihre aus diesen Beziehungen potentiell erwachsenen Konflikte vor einem privaten an Stelle eines staatlichen Gerichts zu klären.
Auf dem ordentlichen Rechtsweg angerufene Gerichte müssen Klagen als unzulässig abweisen, wenn ein Schiedsgericht zuständig ist (§ 1032 Abs. 1 ZPO). Das setzt den wirksamen Abschluss einer Schiedsvereinba- rung voraus, entweder in Form einer Schiedsklausel im schriftlichen Vertragswerk, oder als selbständige Schiedsabrede (§ 1029 Abs. 2 ZPO). Ferner kann die Streitbeilegung vor einem Schiedsgericht außervertraglich, etwa in einem Testament oder einer Satzung,134 verfügt werden (künftig: Schiedsanordnung). Auf Schiedsanordnungen werden gemäß § 1066 ZPO die Regelungen für vereinbarte Schiedsgerichte entsprechend angewendet. Diese letztwillig oder ansonsten satzungsmäßig angeordneten „echte[n] Schiedsgerichte“135 sind abzugrenzen von anderen nichtvertraglichen „unechten“, für welche in der Regel die Vorschriften des Buches 10 der ZPO nicht anzuwenden sind. Solche sind vom Gesetzoder Verordnungsgeber beziehungsweise durch öffentlich-rechtliche Satzung eingesetzte Schiedsgerichte.136 Aber auch die autonome Schiedsgerichtsbarkeit zur Klärung interner Selbstverwaltungsangelegenheiten unter Ausschluss des Staates ist kein schiedsrichterliches Verfahren im Sinne der ZPO; sie ist legitimiert durch das Selbstbestimmungsrecht aus Art. 140 GG in Verbindung mit Art. 137 Abs. 3 der Weimarer Reichsverfassung (im Folgenden: WRV) der nach Art. 137 Abs. 5 oder 7 WRV anerkannten Religions- oder Weltanschauungsgesellschaften.137 Diskussionen um Für und Wider religiösen Sonderrechts, die sich auf eben jenes Selbstbestimmungsrecht beziehen,138 139 sind für diese Arbeit daher ohne Belang.
Kommt ein Schiedsgericht zustande und ergeht ein Schiedsspruch, so kann dieser auf Antrag einer der Schiedsparteien vom gemäß § 1062 Abs. 1 ZPO jeweils örtlich zuständigen Oberlandesgericht (künftig: OLG) überprüft und gegebenenfalls aufgehoben werden. Die staatliche Kontrolle ist also nicht vollständig ausgeschlossen. Von Amts wegen prüft dieses staatliche Gericht dann, ob der Streitgegenstand nach deutschem Recht schiedsfähig ist und ob die Anerkennung des Schiedsspruchs beziehungsweise seine Vollstreckung zu einem in Deutschland ordre-public-widrigen Ergebnis führen würde (§ 1059 Abs. 2 Nr. 2 ZPO).139 Ferner hebt das OLG den Schiedsspruch auf, wenn der Antragsteller einen der Gründe des § 1059 Abs. 2 Nr. 1 ZPO begründet geltend macht. Das OLG ist somit zur Erkenntnis dieser Mängel auf die rechtliche Vorarbeit des Antragstellers angewiesen.
II. Schiedsvereinbarung
Wie bereits ausgeführt, konstituiert die Schiedsvereinbarung das Schiedsgericht. Ist sie unwirksam, fehlt es also an einer wirksamen Vereinbarung, ist kein Privatrechtsweg eröffnet und das angerufene staatliche Gericht zuständig, wie am Ende von § 1032 Abs. 1 ZPO noch einmal betont. Um ausschließen zu können, dass eine möglicherweise zulässige Rechtswahl nur deswegen unmöglich wird, weil bereits keine wirksame Schieds- vereinbarung geschlossen werden kann ist es notwendig, diese näher zu betrachten. Andernfalls wird dem Thema dieser Arbeit bereits dadurch die Grundlage entzogen.
1. Wesen
Die Schiedsvereinbarung, sowohl als Schiedsklausel wie als Schiedsabre- de, gilt als eigenständiger privatrechtlicher Vertrag der auf die Eröffnung eines privaten Rechtswegs gerichtet ist.140 So geht es auch aus § 1040 Abs. 1 S. 2 ZPO hervor.141 Als solcher wird sie als Unterfall des Prozessvertrags gesehen.142 Auch wenn sie als Klausel in der Urkunde eines anderen „Hauptvertrags“ enthalten ist,143 bleibt sie folglich von diesem abstrakt.
2. Spezielle Formvorgaben
Schiedsvereinbarungen müssen grundsätzlich wenigstens in Textform des § 126 b BGB geschlossen werden (§ 1031 Abs. 1, 2 ZPO). Eine Ausnahme ist die Vereinbarung zwischen Verbraucher und Unternehmer. Hier muss die Schrift- oder die elektronische Form der §§ 126 oder 126 a BGB eingehalten werden (§ 1031 Abs. 5 ZPO). Formmängel der Vereinbarungen bleiben jedoch grundsätzlich unbeachtlich, wenn sich die Parteien auf die Verhandlung vor dem Schiedsgericht einlassen (§ 1031 Abs. 6 ZPO). Insoweit die Schiedsvereinbarung, auch als -klausel, vom Hauptvertrag unabhängig ist, kann die für letzteren geltende Form grundsätzlich keine Berücksichtigung finden.144
Hingegen hängt die Wirksamkeit einer außervertraglichen Anordnung von den Formvorgaben des jeweiligen Grundwerks, das sie enthält, ab. Das folgt aus der Einschränkung in § 1066 ZPO, wonach Schiedsan- ordnungen nur in gesetzlich zulässiger Weise verfügt werden dürfen. Sie sind also nicht abstrakt und auch nicht der Formvorschrift des § 1031 ZPO unterworfen, sondern den jeweils einschlägigen Vorschriften etwa im Erbrecht, im Vereinsrecht oder Gesellschaftsrecht.145 So wäre ein durch Testament angeordnetes Schiedsgericht von der Wirksamkeit dieser letztwilligen Verfügung als Ganzem abhängig.146
3. Subjektive Schiedsfähigkeit und Gültigkeitskontrolle
Die Wirksamkeit der Schiedsvereinbarung hängt maßgeblich von der sogenannten subjektiven Schiedsfähigkeit der Schiedsparteien im Sinne des § 1059 Abs. 2 Nr. 1 lit. a Var. 1 ZPO ab. Die Beteiligten mussten demnach selbst rechtlich fähig gewesen sein, diese Vereinbarung zu schließen.147
Im Allgemeinen muss die Schiedsvereinbarung der „,Gültigkeitskon- trolle“‘148 des § 1059 Abs. 2 Nr. 1 lit. a Var. 2 ZPO standhalten. Sie muss also den für sie maßgeblichen allgemeinen Regeln zum Vertragsschluss standhalten. Bei einer auf deutschem Recht gründenden Vereinbarung richtet sich die Wirksamkeit folglich nach den allgemeinen bürgerlichrechtlichen Vorschriften, auch dem Stellvertretungsrecht.149
Als isoliertes Rechtsgeschäft, das in Bezug auf potentielle Streitigkeiten in einem anderen Rechtsverhältnis abgeschlossen wurde, wäre grundsätzlich davon auszugehen, dass die Unwirksamkeit der Schiedsvereinba- rung keine Auswirkungen auf das in Bezug genommene Rechtsverhältnis haben kann. Bezogen auf einen Hauptvertrag soll jedoch § 139 BGB einschlägig sein.150 Ist die zusätzliche Schiedsvereinbarung, der Ausschluss des ordentlichen Rechtswegs, also wesentlich für die Erfüllung des letzteren, würde der gesamte Vertrag mit dieser nichtig. Dass dessen Auslegung nach den §§ 133, 157 BGB zu dem Ergebnis führen kann, der Privatrechtsweg sei wesentliches Element des Rechtsgeschäfts, will hier nicht so recht überzeugen. Es erscheint zumindest ebenso sachgerecht, vom schlichten Wegfall des Privatrechtswegs auszugehen, bei im Übrigen fortgeltenden Bestimmungen. Denn eine gültige Schiedsabrede kann immer noch geschlossen werden und der ordentliche Rechtsweg verhindert nicht die hauptvertragliche Erfüllung. - Hingegen kann § 139 BGB fraglos im Fall des unwirksamen Hauptvertrags bei der Schiedsverein- barung nur ins Leere gehen. Es fehlt am Rechtsverhältnis, welches den potentiellen Streitgegenstand hervorbringt, auf den sich die Vereinbarung richten soll.
Im Allgemeinen hängen Fragen der Wirksamkeit von Schiedsvereinba- rungen demnach insbesondere von der Geschäftsfähigkeit ihrer Parteien ab und davon ob die Vereinbarungen hinreichend bestimmt151 und innerhalb der Grenzen des gesetzlich zulässigen und sittengemäßen abgeschlossen wurden.152 Musterverträge zwischen Unternehmern und Verbrauchern müssen auch der AGB-Kontrolle standhalten können.153
4. Objektive Schiedsfähigkeit
Mit objektiver Schiedsfähigkeit ist diejenige des § 1030 ZPO gemeint, welche das zuständige OLG von Amts wegen gemäß § 1059 Abs. 2 Nr. 2 lit. a ZPO überprüft.154
Gemäß § 1030 Abs. 1 S. 1 ZPO sind vermögensrechtliche Ansprüche ohne weiteres schiedsfähig. Soweit diese Gegenstand einer Schiedsverein- barung und damit auch einer Schiedsanordnung sein können, erstrecken sich die zu betrachtenden Streitigkeiten über ein sehr weites Feld.155 Eingrenzen lässt es sich immerhin durch den Ausschluss von gewöhnlichen Wohnraummietverhältnissen nach § 1030 Abs. 2 ZPO.
Auch die gemäß § 1030 Abs. 3 ZPO unberührt bleibenden gesetzlichen Vorschriften, nach denen bestimmte Streitigkeiten nicht oder nur unter bestimmten Voraussetzungen den Regelungen des schiedsrichterlichen Verfahrens unterworfen werden dürfen, beschränken die Schiedsfähigkeit. Exemplarisch soll dazu kurz auf arbeitsrechtliche Streitigkeiten eingegangen werden.
a) Nicht den Regelungen des schiedsrichterlichen Verfahrens unterworfene Arbeitssachen
Gemäß § 101 Abs. 3 des Arbeitsgerichtsgesetzes156 (künftig: ArbGG) finden die Regelungen der § § 1025 ff. ZPO in Arbeitssachen keine Anwendung.157 Das Schiedsgerichtsverfahren ist in den §§ 101 bis 110 ArbGG eigenständig geregelt, kann nur von Tarifvertragsparteien im Sinne von § 2 des Tarifvertragsgesetzes158 für bürgerliche Rechtsstreitigkeiten zwischen ihnen (§ 101 Abs. 1 ArbGG) oder aus einem Arbeitsverhältnis bestimmter Berufsgruppen (§ 101 Abs. 2 ArbGG) vereinbart werden.
b) Vergleichsbefugnis der Schiedsparteien
Eine weitere Grenze der Schiedsfähigkeit stellt § 1030 Abs. 1 S. 2 ZPO dar. Die Parteien müssen sich über Ansprüche nicht vermögensrechtlicher Art vergleichen können. Dazu ist zum Einen die Vergleichsbefugnis nach § 779 BGB erforderlich: Die Parteien dürfen über das Rechtsverhältnis verfügen.159 Des Weiteren müssen sie darüber auch als Streitgegenstand verfahrensrechtlich verfügen können.160
Familien- und erbrechtliche sowie strafrechtliche Ansprüche sollen hier im Hinblick auf die Verfügungsbefugnis der Beteiligten im Vordergrund stehen. Wie gesehen scheinen diese Aspekte von besonderem Interesse zu sein, bei der Auseinandersetzung mit potentiellen Schnittstellen und darin zutage tretenden Konflikten zwischen deutschem Recht und islamisch geprägten Überzeugungen.161
Zunächst wird in aa die Legitimation des schiedsrichterlichen Verfahrens als alternative außergerichtliche Konflikbeilegung dargestellt, um die Verknüpfung zu den in Betracht kommenden Rechtsstreitigkeiten herzustellen. In bb bis dd wird sodann die materiell- wie auch die verfahrensrechtliche Komponente der Verfügungsbefugnis erörtert.
aa) Schiedsrichterliches Verfahren als außergerichtliche Konfliktbeilegung Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Förderung der Mediation und anderer Verfahren der außergerichtlichen Konfliktbeilegung162 wurden mit dessen Artt. 4 und 5 die §§ 253 Abs. 3 ZPO und 23 Abs. 1 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit163 (künftig: FamFG) mit der Maßgabe geändert, vor Klageerhebung oder auch danach den Versuch einer außergerichtlichen Konfliktbeilegung nahezulegen. Zum Zwecke der Prozesswirtschaftlichkeit sollen der Rechtsgemeinschaft unnötige Kosten erspart bleiben.164 Daher sollen auch nach Verfahrenseröffnung die staatlichen
Gerichte auf eine gütliche Einigung der Streitparteien hinwirken.165 Die neu eingefügten §§ 278 a ZPO und 36 a FamFG führen jeweils zum Ruhen des Verfahrens im Sinne des § 251 ZPO beziehungsweise zu dessen Aussetzen im Sinne des § 249 ZPO bis zur Beilegung des Konflikts im gerichtlich vorgeschlagenen außergerichtlichen Streitbeilegungsverfahren. 166
Als weiteres Verfahren zur Konfliktbeilegung gilt auch das Schiedsge- richt.167 Dies mag problematisch erscheinen. Der Vorschlag des staatlichen Gerichts an die Streitparteien gemäß § 278 a Abs. 1 ZPO beziehungsweise § 36 a Abs. 1 S. 1 FamFG, nach Verfahrenseröffnung im Endeffekt eine Schiedsabrede gemäß § 1029 Abs. 2 ZPO abzuschließen, könnte einer Überbetonung der Prozesswirtschaftlichkeit gleichkommen. Dies jedenfalls dann, wenn damit der endgültige Ausschluss des ordentlichen Rechtswegs beabsichtigt ist.
Mit einer wirksamen Schiedsvereinbarung oder -anordnung geht, wie eingangs erwähnt, gemäß § 1032 Abs. 1 ZPO auch in Verbindung mit § 1066 ZPO die Möglichkeit der prozesshindernden Einrede einher,168 wenn darauf nicht verzichtet wird. Das Vorhandensein der Vereinbarung oder Anordnung muss zweifellos rechtzeitig gerügt werden, da das Gericht sie nicht von Amts wegen beachtet.169 Insoweit fügt sich die Vorschrift des § 1032 Abs. 1 ZPO immerhin in das Erfordernis der Prozesswirtschaftlichkeit ein, der die Parteiherrschaft zugute kommen kann; sie dient aber auch der Rechtssicherheit der Beteiligten.170 Denn von Amts wegen prüft das staatliche Gericht nach erhobener Einrede die Zulässigkeit, Wirksamkeit und Durchführbarkeit der Schiedsvereinbarung; im positiven Fall werden so die Ressourcen des Gerichts geschont, indem es die Klage abweist, ansonsten erklärt es sich für zuständig.171
Soweit eine Schiedsvereinbarung die Verpflichtung der Vertragspartner darstellt, im Streitfall nicht den ordentlichen Rechtsweg zu beschrei- ten,172 so wird aus ihrem Abschluss nach Klageerhebung vor einem staatlichen Gericht die Verpflichtung folgen, diesen Rechtsweg in einem von den Parteien bestimmten Umfang wieder zu verlassen. Mit dieser modifizierten Sicht bleibt die Systematik des schiedsrichterlichen Verfahrens ungebrochen. Durch den Vorschlag gemäß § 278 a Abs. 1 ZPO oder § 36 a Abs. 1 FamFG werden zwischen den Parteien einvernehmlich bestimmte Streitpunkte aus dem Gerichtsverfahren herausgelöst. Das Ergebnis des schiedsrichterlichen Verfahrens wird im dann wieder aufgerufenen staatlichen akzeptiert und nicht nachgeprüft. So kann eine zulässige Schied- sabrede vereinbart werden.173
Ergeht ein Schiedsspruch, in Form und Inhalt § 1054 ZPO entsprechend, so hat dieser zwischen den Parteien bereits gemäß § 1055 ZPO die Wirkung eines nach § 322 ZPO rechtskräftigen gerichtlichen Urteils.174 Mit diesem wird entweder auf Antrag ein Vergleich der Schiedsparteien nach Maßgabe des § 1053 Abs. 1 S. 2 ZPO als Schiedsspruch mit vereinbartem Wortlaut protokolliert oder der Spruch ergeht nach § 1052 ZPO als Mehrheitsentscheidung des Schiedsrichterkollegiums beziehungsweise als Entscheidung eines einzelnen Schiedsrichters. Insoweit ist er von dem staatlichen Gericht, welches das vor ihm geführte Verfahren ausgesetzt hat, zu akzeptieren sobald seine Rechtskraft eintritt. Seine formelle und materielle Überprüfung und die Erklärung seiner Vollstreckbarkeit obliegt allein dem gemäß § 1062 Abs. 1 ZPO zuständigen OLG.
Können sich die Schiedsparteien nicht in der Sache einigen, wird das schiedsrichterliche Verfahren gemäß § 1056 Abs. 1 in Verbindung mit einem der Beendigungsgründe des Absatzes 2 vom Schiedsrichterkollegium per Beschluss beendet. Das staatliche Gericht muss sich nach Wiederaufruf des Verfahrens sodann selbst mit den ehemals herausgelösten Streitpunkten befassen.
Legt folglich das staatliche Gericht von sich aus den Streitparteien die Klärung ihres Konflikts vor einem Schiedsgericht nahe, so wird dadurch nicht der ordentliche Rechtsweg verbaut, sondern wie auch durch die Mediation oder andere Schlichtungsverfahren eine außergerichtliche Alternative zur einvernehmlichen Wahl gestellt. Die Klärung dort kann wie in den anderen nicht-staatlichen Verfahren ergebnislos verlaufen, woraufhin die rechtliche Entscheidung vollständig an das angerufene Gericht zurückfällt. Zudem kann sich das Gericht bereits im Vorfeld einen Eindruck machen von der Qualität in Betracht kommender institutionalisierter Schiedsgerichte, ihrer fachlichen Kompetenz und ihrer Umsetzung der Mindeststandards in den §§ 1034 ff. ZPO. Die eingangs geäußerten Vorbehalte lassen sich insoweit entkräften.
bb) Familienrechtlicher Rahmen Sowohl §§ 278 f. ZPO als auch §§ 36 f. FamFG zielen auf die vergleichsweise Beendigung eines Konflikts. Auch hier kommt es auf die Vergleichsbefugnis an. Nach sachlichem Recht nicht disponibel sind etwa Statusverhältnisse wie Ehe und Abstammung und nicht abtretbare Ansprüche.175176 Verfahrensrechtlich sind Verfügungen über Verfahrensgegenstände ausgeschlossen, die vor staatlichen Gerichten zu klären sind.175 176 177
Eine Ehe kann in Deutschland nach § 1310 des BGB allein unter Mitwirkung eines Standesbeamten wirksam geschlossen und nur gerichtlich aufgehoben oder geschieden werden (§§ 1313, 1564 BGB).178 Zuständig für Ehegatten mit deutscher Staatsbürgerschaft und solchen mit gewöhnlichem Aufenthalt im Inland sind deutsche Familiengerichte. Gemäß § 98 FamFG sind sie es auch dann, wenn nur ein Ehegatte eine dieser Voraussetzungen erfüllt; in den übrigen Familiensachen bemisst sich die Zuständigkeit deutscher Gerichte gleichsam nach Staatsangehörigkeit oder gewöhnlichem Aufenthalt der Beteiligten (§§ 99 ff. FamFG).179
Die Beteiligten können also offensichtlich nicht über den möglichen Streitgegenstand „Bestand“ der Ehe verfahrensrechtlich verfügen. Daraus folgt jedoch kein kategorischer Ausschluss der Vergleichsbefugnis in familienrechtlichen Streitigkeiten.
Diese sind gemäß § 111 FamFG Ehesachen, Kindschaftssachen, Abstammungssachen, Adoptionssachen, Ehewohnungs- und Haushaltssachen, Gewaltschutz-, Versorgungsausgleichs-, Unterhalts-, Güterrechts-, sonstige Familien- und Lebenspartnerschaftssachen.
Ehesachen sind gemäß § 121 FamFG Scheidungssachen, Verfahren auf Aufhebung der Ehe und auf Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens einer Ehe. Sie erfassen demnach wie Verfahren zu Abstammungsund Adoptionssachen nach §§ 169 und 186 FamFG nicht disponible Statusangelegenheiten.
Kindschaftssachen betreffen gemäß § 151 FamFG insbesondere Verfahren über die elterliche Sorge, das Umgangsrecht, die Kindesherausgabe und die Vormundschaft. Ehewohnungssachen erfassen gemäß § 200 Abs. 1 FamFG Verfahren nach § 1361 b oder 1568 a BGB auf Überlassung der gemeinsamen Ehewohnung an einen der getrennt lebenden beziehungsweise geschiedenen Ehegatten. Im Ergebnis damit identisch sind insoweit Gewaltschutzsachen, die gemäß §§ 1, 2 des Gewaltschutzgesetzes180 auf Überlassung der gemeinsamen Wohnung in Fällen häuslicher Gewalt zielen. Haushaltssachen erfassen gemäß § 200 Abs. 2 FamFG die Verfahren nach § 1361 a BGB beziehungsweise § 1568 b BGB über die Aufteilung der ehemals gemeinsamen Haushaltsgegenstände von getrennt lebenden oder geschiedenen Ehegatten. Die Familiensachen der Nummern 2 bis 7 des § 111 FamFG, also Kindschafts- bis Versorgungsausgleichsachen sind Familiensachen der freiwilligen Gerichtsbarkeit.181
Unterhaltssachen erfassen gemäß § 231 Abs. 1 FamFG vor allem den Kindes- und Ehegattenunterhalt. Diese sind gemäß § 112 FamFG Familienstreitsachen, mit den Güterrechtssachen nach den §§ 1363 ff., 1408 ff. BGB und den sonstigen Familiensachen im Sinne des § 266 Abs. 1 FamFG.
Die Unterscheidung zwischen Ehesache, Familienstreitsache und Familiensache der freiwilligen Gerichtsbarkeit verweist zum Einen auf den Umfang der Amtsermittlung. Für erstere gilt die nach Maßgabe des § 127 FamFG eingeschränkte Amtsermittlung.182 Für Familienstreitsachen gilt der Beibringungsgrundsatz.183 Die „Herrschaft über das Verfahren“184 liegt demnach bei den streitenden Parteien, die eigenverantwortlich darüber entscheiden, welche Tatsachen sie dem Gericht zur Kenntnis bringen.185 Familiensachen der freiwilligen Gerichtsbarkeit wiederum unterliegen überwiegend der uneingeschränkten Amtsermittlung.186
Zudem gelten nur für die letztgenannten Verfahren ausnahmslos die allgemeinen Vorschriften des FamFG, welche hingegen für Ehe- und Familienstreitsachen nach Maßgabe des § 113 FamFG ausgeschlossen sind beziehungsweise nur vereinzelt zur Modifikation von im Übrigen anzuwendenden Vorschriften der ZPO herangezogen werden.187
Gemäß § 135 S. 1 FamFG kann das in Scheidungssachen zuständige Familiengericht für anhängige Folgesachen im Sinne des § 137 Abs. 2 und 3 FamFG, also aus der Scheidung folgende weitere familienrechtliche Streitigkeiten, beiden Ehegatten die Teilnahme an einem kostenfreien Informationsgespräch über Möglichkeiten der außergerichtlichen Konfliktbeilegung anordnen. Ferner gilt gemäß § § 124, 113 Abs. 1 FamFG für den Scheidungsantrag § 253 Abs. 3 Nr. 1 ZPO. Bereits vor Einreichen des Antrags ist danach ein Versuch alternativer Konfliktbeilegung möglich. Nach Verfahrenseröffnung kann gemäß § 113 Abs. 1 S. 2 FamFG in Verbindung mit § 278 a Abs. 1 ZPO ebenfalls eine außergerichtliche Klärung angeregt werden. In Folgesachen scheinen somit grundsätzlich auch Schiedsgerichtsverfahren möglich, neben Versorgungsausgleichssachen188 auch in den Familienstreitsachen über Unterhalt und güterrechtliche Konflikte sowie in Ehewohnungs- und Haushaltssachen.189
Selbst Kindschaftssachen, also die Klärung der elterlichen Sorge, des Umgangsrechts und der Kindesherausgabe können unter den Voraussetzungen des § 137 Abs. 3 FamFG auf Antrag Folgesache sein.190 Auch wenn sie nicht im „Entscheidungsverbund“ als „isolierte“ Verfahren im Sinne des § 151 Nr. 1 bis 3 FamFG geführt werden,191 eröffnet § 36 a Abs. 1 und 2 in Verbindung mit § 155 Abs. 4 FamFG die Möglichkeit der alternativen Konfliktbeilegung.192 Die außergerichtliche Einigung wird insbesondere im Kindeswohl liegend betrachtet, da sie zu einer Beschleunigung des Verfahrens beitragen193 und somit den Ausnahmezustand der Trennung frühzeitiger beenden kann.
Zu konstatieren, familienrechtliche Streitigkeiten seien grundsätzlich nicht schiedsfähig, greift daher zu kurz.194 Die Vergleichsbefugnis scheint in zahlreichen potentiellen Streitgegenständen gegeben über die auch verfahrensrechtliche Verfügungen möglich sind.195 An dieser Stelle mag dahingestellt bleiben, ob im Entscheidungsverbund nach § 137 Abs. 2 FamFG erst nach rechtskräftigem Scheidungsbeschluss die isolierten Folgesachen schiedsfähig werden,196 oder der Verbund eine Schiedsvereinbarung nicht verhindert.197 Über die grundsätzliche Vereinbarkeit eines schiedsrichterlichen Verfahrens in Familiensachen erwächst daraus kein Zweifel.
Gerade dem ehelichen Güterrecht entspringen bereits vermögensrechtliche Ansprüche. Eine Schiedsklausel im Ehevertrag, welche entsprechende Streitigkeiten erfasst, lässt sich ebenso vereinbaren wie eine eigenständige Schiedsabrede. Zwar kann der Güterstand gemäß § 1409 BGB nicht durch Verweisung auf außer Kraft getretenes oder ausländisches Recht außerhalb der Vorgaben des Art. 15 Abs. 2 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche198 (künftig: EGBGB) bestimmt werden.199 Vertraglich vereinbart werden kann also lediglich als gesetzlicher Güterstand die Zugewinngemeinschaft (§ 1363 Abs. 1 BGB), die Gütertrennung (§ 1414 BGB) und die Gütergemeinschaft (§§ 1415 f. BGB). Diese Beschränkung der Vertragsfreiheit wirktsich jedoch nicht unmittelbar auf die Rechtswahl im Schiedsgerichtsverfahren aus, in dem über vertragliche Streitigkeiten bei in Deutschland zulässigem Güterstand auf Grundlage der für anwendbar erklärten Rechtsvorschriften entschieden wird.
Ferner ist denkbar, die Schiedsvereinbarung auf die vergleichsweise Klärung von Streitigkeiten über Ehewohnungs- und Haushaltssachen zu erstrecken, um gerade in Trennungsphasen vor der eigentlichen Scheidung die Möglichkeit auf eine verhältnismäßig kurzfristige Streitbeilegung offenzuhalten. Auch Schiedssprüchen mit vereinbartem Wortlaut, welche Vergleiche über Sorge- und Umgangsrechts- sowie Unterhaltsstreitigkeiten protokollieren und damit die gerichtliehe Klärung beschleunigen können, sollte - unter dem Primat des Kindswohls200 - grundsätzlich nichts entgegenstehen.201 cc) Erbrechtlicher Rahmen Unmittelbar aus § 1066 ZPO ergibt sich, dass durch letztwillige Verfügungen schiedsrichterliche Verfahren angeordnet werden können. Für Streitigkeiten der Erben und anderer durch eine letztwillige Verfügung gemäß § 1937 BGB Begünstigten, ist dies unproblematisch zu bejahen.202 Ein anderes Ergebnis würde auch überraschen, sind doch solche Verfügungen die Grundlage vermögensrechtlicher, also stets schiedsfähiger Ansprüche.
Auch die Parteien eines Erbvertrags nach §§ 1941, 2247 ff. BGB können ein schiedsrichterliches Verfahren einsetzen, dann allerdings durch Schiedsvereinbarung.203
dd) Strafrechtlicher Rahmen Grundsätzlich sind bei Antragsdelikten Vergleiche „zur Abwendung eines Strafverfahrens“ möglich.204 Innerhalb der Grenzen der Sittenwidrigkeit sind die Geschädigten folglich materiellrechtlich dispositionsbefugt, deren höchtspersönliches Recht der Strafantrag ist.205 Grundsätzlich können sie somit über die Strafverfolgung verfügen etwa beim sexuellen Missbrauch gemäß § 182 Abs. 3 des Strafgesetzbuches206 (künftig: StGB), der Beleidigung nach § 194 Abs. 1 S. 1 StGB, der Körperverletzung nach § § 223 und 229 StGB, der Kindesentführung im Sinne des § 235 Abs. 1 bis 3 StGB, der Nachstellung in den Fällen des § 238 Abs. 1 StGB, dem Diebstahl, der Unterschlagung und Veruntreuung geringwertiger Sachen in den Fällen der §§ 242, 246 und 266 StGB, der Begünstigung im Sinne des § 257 Abs. 1 StGB, des Betrugs gemäß § 263 Abs. 1 StGB sowie der Sachbeschädigung nach § 303 StGB.207 Die Dispositionsbefugnis entfällt dort jeweils, wenn ein besonderes öffentliches Interesse an der Strafverfolgung besteht, wodurch letztere von Amts wegen eingeleitet wird. So kann etwa bei der vorsätzlichen Körperverletzung ein besonders rohes oder leichtfertiges Handeln ein besonderes öffentliches Interesse nahelegen, wobei Verletzungen im Familienkreis häufig das Interesse entfallen lassen, wenn nicht die Wahrung des Kindeswohls es wieder aufleben lässt.208
Gemäß § 374 Abs. 1 der Strafprozessordnung209 (im Folgenden: StPO) können einige dieser Antragsdelikte im Wege der Privatklage von den Geschädigten selbst gerichtlich verfolgt werden. Unterfällt ein Delikt § 380 Abs. 1 StPO, so muss der Klage ein Schlichtungsversuch in einem Sühneverfahren vor einer Vergleichsbehörde vorausgehen, das noch vor Strafantragstellung durchgeführt werden kann.210 Die Existenz einer zuständigen Vergleichsbehörde etwa als Schiedsamt oder Sühnebeamte211 schließt jedoch nicht den Vergleich in einem anderen Verfahren außergerichtlicher Konfliktlösung aus.212 Der Sühneversuch vor der Behörde ist lediglich Voraussetzung für die Privatklage.213 Er ist nicht die einzige gesetzlich vorgeschriebene alternative Streitbeilegungsform.
Soweit demnach eine Strafverfolgung im öffentlichen Interesse nicht unbedingt geboten erscheint, dürfte die außergerichtliche Klärung von Antragsdelikten vor einem echten Schiedsgericht zur privatrechtlichen Vereinbarung eines Täter-Opfer-Ausgleichs bei Verzicht auf die Strafverfolgung nicht von vornherein ausgeschlossen sein.
c) Bewertung
Wie gesehen steht der Privatrechtsweg im Konfliktfall potentiell dann offen, wenn sich die Parteien außergerichtlich einigen können. Dabei stehen auch in besonders empfindlichen Bereichen wie dem Familien- und sogar Strafrecht prinzipiell Ansprüche und Rechte sowohl materiell- als auch verfahrensrechtlich zur Disposition der Beteiligten. Zur Ermittlung der Reichweite dieser Befugnis zeigte sich die Auseinandersetzung mit den auf Vorschlag des angerufenen staatlichen Gerichts wählbaren alternativen Konfliktbeilegungsverfahren als hilfreich.
In der Konsequenz wird der Blick frei auf jene nichtvermögensrechtlichen Ansprüche, die im blinden Fleck des öffentlichen Interesses auch in den Bereichen zu finden sind, denen im Übrigen die volle öffentliche Aufmerksamkeit gilt.
Es dürfte auch zu begrüßen sein, dass ein Restbestand an Dispositionsbefugnis selbst in diesen Bereichen in privater Hand verbleibt, nicht zuletzt im Lichte des Art. 2 Abs. 1 und auch des Art. 1 Abs. 1 GG. Denn ein letztes Quäntchen Eigenverantwortung und Gestaltungsfreiheit sollte mit Rücksicht auf die Verfassungsgüter der allgemeinen Handlungsfreiheit, der Menschenwürde, also der Wertschätzung des Subjekts und zusammengenommen des allgemeinen Persönlichkeitsrechts in seinen unterschiedlichen Ausprägungen bei den Betroffenen verbleiben.
Soweit in Privatrechtsverhältnissen nicht handelsrechtlicher Art zumindest, gerade auch in Zusammenhang mit islamisch geprägten Rechtsauffasungen, vor allem familien- und strafrechtlich relevante Konflikte eine Rolle spielen,214 sollen die hier aufgeworfenen Verdachtsmomente ausreichen, um deren zumindest teilweise objektive Schiedsfähigkeit nicht von vornherein ausschließen zu können. Insofern ist nicht davon auszugehen, dass sich die Frage nach der Anwendbarkeit »islamischen Rechts«, in deutschen Schiedsgerichtsverfahren schon deshalb erübrige, weil für einen Großteil infrage kommender Streitigkeiten keine wirksame Schiedsvereinbarung geschlossen werden könnte.
III. Rechtswahl
Bezeichnen die Schiedsparteien eines inländischen Verfahrens das Recht oder die Rechtsordnung eines bestimmten Staates für anwendbar, so ist durch § 1051 Abs. 1 S. 2 ZPO der »renvoi«, die Gesamtverweisung nicht nur auf dessen materielles Recht sondern auch auf sein Kollisionsrecht, ausgeschlossen. Diese Norm wird gemeinhin dem Bestand eines schiedsgerichtlichen Sonderkollisionsrechts zugeschlagen.215 Sie entspricht inhaltlich Art. 20 der Verordnung (EG) Nr. 593/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Juni 2008 über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht216 (künftig: Rom-I-VO). Freilich führt § 1051 Abs. 2 ZPO wieder zurück zu objektiven Anknüpfungskriterien, wenn von den Parteien ausdrücklich nichts vereinbart wurde.217 Dann ist zwar das Schiedsgericht berufen diese Entscheidung zu fällen, es muss seine Entscheidung jedoch an dem am ehesten in Betracht kommenden staatlichen Recht ausrichten. Ist bereits § 1051 Abs. 1 ZPO als Sonderkollisionsrecht zu betrachten, die Rechtswahl im deutschen Schiedsverfahren vollständig im Sinne des ihm zugrunde liegenden UNCITRAL- Modellgesetzes, so folgt daraus die Wahlmöglichkeit selbst von nichtstaatlichen Stellen erlassenen Rechts auf Grundlage dieser Norm. Damit einher ginge die in der Ausgangshypothese in AI geäußerten Einschätzung, § 1051 Abs. 1 Satz 1 ZPO isoliert betrachten zu können. Die Wortwahl des Gesetzgebers in Satz 1, der die Wahl der Rechtsvorschriften, freistellt, eröffnet dann jedoch ein Problem. Zunächst bietet sich an, die Anwendbarkeit nichtstaatlicher Vorschriften als erfolgreichen oder -losen Subsumtionsversuch unter dieses Tatbestandsmerkmal zu ermitteln, wie von Adolphsen und Schmalenberg vorgeführt.218 Ist aber ohnehin stets die Anwendbarkeit jeglichen Regelwerks gemeint, scheint das Merkmal zur Worthülse zu degenerieren. Dem Problem entwächst mithin die Herausforderung, den Rechtsbegriff zu ermitteln, welcher dann dieser Norm zugrunde liegen muss, um den Inhalt wieder herzustellen. Möglicherweise greift ein Begriffsverständnis ohnehin zu kurz, das nur staatlich gesetzte Vorschriften erfasst. Bevor dies zum Ausschluss rein normativer Definitionen mit Rückgriff auf die Rechtstheorie erörtert werden kann, muss allerdings ausgeschlossen werden, dass die Qualifizierung des § 1051 Abs. 1 ZPO als Sonderkollisionsrecht auf keine unzulässige Verallgemeinerung zurückgeht und somit die Erörterung in eine falsche Richtung weist. Dies soll im Folgenden geklärt werden.
1. Rechtsnatur
Der Streit um den möglichen Sonderstatus der Rechtswahl bringt bereits Uneinigkeit über die Rechtsnatur der Bestimmung anwendbaren Rechts nach § 1051 Abs. 1 S. 1 ZPO zum Vorschein. - Nach einer Auffassung entstammt dieses Bestimmungsrecht, wie bereits angeklungen, allein dem deutschen Schiedsverfahrensrecht und wird weder durch die Rom-I-VO, heteronomes, nicht vom deutschen Gesetzgeber erlassenes IPR,219 noch durch das EGBGB, autonomes IPR, begrenzt.220 Insoweit müsste die Rechtswahl Bestandteil der Schiedsvereinbarung sein, welche den Privatrechtsweg erst eröffnet und damit deutsches Schiedsverfahrensrecht zur Anwendung bringt. Trifft diese Einschätzung zu, so wäre die Rechtswahl als Aspekt der Schiedsvereinbarung bereits durch Art. 1 Abs. 2 lit. e Rom-I-VO221 222 von einer Beurteilung nach dem heteronomen, also nicht vom deutschen Gesetzgeber erlassenen, europäischen IPR ausgeschlos- 222 sen.
Vor dem Hintergrund des Schiedsvereinbarungsstatuts aus § 1059 Abs. 2 Nr. 1 lit. a Var. 2 ZPO wäre das auch unnötig. Dort ist die Gültigkeitskontrolle der Schiedsvereinbarung eigenständig geregelt, wie in II 3 angesprochen, und wird subsidiär auf deutsches Recht Bezug genommen,223 ansonsten auf das von den Parteien bestimmte Recht. Demnach könnte keine ungültige Rechtswahl vorgenommen, sondern nur eine insgesamt ungültige Schiedsvereinbarung abgeschlossen werden, deren rechtlicher Kontrollmaßstab wiederum durch die Wahl der Parteien inzident festgelegt wird.224 Wohl mehrheitlich unbestritten wird dort jedoch gar das autonome deutsche IPR für anwendbar gehalten.225 Art. 1 Abs. 2 lit. e Rom-I-VO führt also aus den IPR-Begrenzungen heraus, damit § 1059 Abs. 2 Nr. 1 lit. a ZPO den Anschluss wieder herstellt. Eine erste auffällige Inkonsistenz.
Zudem lässt der Wortlaut des § 1029 Abs. 1 ZPO an der genannten Auffassung zweifeln. Nach diesem ist die Schiedsvereinbarung allein auf die Eröffnung des Privatrechtswegs für bestimmte oder alle Streitigkei- ten gerichtet, die sich aus der Durchführung eines Hauptvertrages oder eines nichtvertraglichen Rechtsverhältnisses ergeben, wie in II 1 ausgeführt. Indes legt weder eine Norm aus § 1051 ZPO selbst, noch eine andere Verfahrensvorschrift nahe, die Schiedsrechtswahl im Zusammenhang mit § 1029 Abs. 1 ZPO zu lesen. Im Gegenteil ist die Bezeichnung der anwendbaren Rechtsvorschriften durch die Parteien auf den Inhalt des Rechtsstreits, nicht auf die Schiedsvereinbarung gerichtet. Mithin ist auch das Schiedsvereinbarungsstatut aus § 1059 Abs. 2 Nr. 1 lit. a Var. 2 ZPO nicht gemeinsam mit § 1051 ZPO zu lesen.226 Dieses muss vielmehr vollkommen eigenständig ausgelegt werden.227 - Darauf mag es nur dann nicht ankommen, wenn angenommen wird, die Rechtswahl sei Bestandteil des Hauptvertrags der insgesamt als „Gesichtspunkt“im Hinblick auf die Schiedsvereinbarung“228 aus dem Anwendungsbereich der Rom-I-VO beziehungsweise dem Übereinkommen von Rom über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht von 1980 (Europäisches Schuldvertragsübereinkommen - künftig: EVÜ) herausfalle.229
Mit Rücksicht auf den Giuiliano/Lagarde-Bericht zum EVÜ wird jedoch anerkannt, dass ein Hauptvertrag nicht vom europäischen IPR ausgeschlossen ist. Vielmehr sei in ihm nach dem EVÜ und damit auch der Rom-I-VO eine „dépeçage“ möglich,230 die „Aufspaltung [... ] eines einheitlichen Rechtsverhältnis in mehrere Teile, die verschiedenen Rechtsordnungen unterstellt sind“231. Art. 1 Abs. 2 lit. d EVÜ (= Art. 1 Abs. 2 lit. e Rom-I-VO) schließe den Hauptvertrag gerade nicht aus.232 Als Resultat wirke IPR auf diesen und nationales Schiedsverfahrensrecht auf die Schiedsklausel. Gerade einen aus diesem Bericht abgeleiteten, anders lautenden „gemeinsame[n] Willen der [EG]-Vertragsschöpfer“ für wahrscheinlich zu halten, erscheint inkonsequent.233
Irreführend ist insoweit auch die Begründung zum deutschen Gesetzesentwurf, worin das IPR in erster Linie auf § 1051 Abs. 2 ZPO Anwendung finden soll, wenn also die Parteien keine Rechtswahl getroffen haben.234 Ansosten wird auch dort die Unabhängigkeit von Schiedsklausel und Hauptvertrag bestätigt.235 Insbesondere wird die Einschränkung der Parteiautonomie bei der Rechtswahl in Einklang mit Art. 27 Abs. 1 S. 1 EGBGB gebracht, welcher in Art. 1 Abs. 1 Rom-I-VO aufgegangen ist, aber die Anwendbarkeit nicht-staatlicher Vorschriften dennoch für möglich und erwünscht gehalten.236
Die geringe Belastbarkeit der Begründungen, welche zumindest die Rechtswahl nach § 1051 Abs. 1 ZPO außerhalb autonomem oder europäischem IPR sehen wollen, sollte offensichtlich geworden sein.237
Überzeugt danach immer noch am stärksten, den Hauptvertrag als vom Anwendungsbereich der Rom-I-VO erfasst zu betrachten, und ebenso, die Vereinbarung der Parteien über das anzuwendende Recht nicht in Zusammenhang mit der Schiedsvereinbarung,238 so muss diese Rechtswahl entweder Bestandteil des Hauptvertrages sein auf den sie sich bezieht, oder sie ist, gleich der Schiedsklausel gemäß § 1040 Abs. 1 S. 2 ZPO, von diesem unabhängig. Darüber soll das Folgende Aufschluss geben.
a) Hauptvertrag mit Rechtswahl
Besteht ein vertragliches Schuldverhältnis239 zwischen Schiedsparteien aus einem EU-Mitgliedsstaat, das keine Schiedsvereinbarung ist, so ist gemäß Art. 1 Abs. 1 Rom-I-VO der Anwendungsbereich des europäischen IPR eröffnet, wenn ihr Rechtsverhältnis eine Verbindung zum Recht verschiedener Staaten aufweist. Das Vorliegen eines grenzüberscheitenden Sachverhalts eröffnet demnach nicht zwingend den räumlichen Anwendungsbereich der Verordnung, sondern die Rechtswahl der Parteien.240
Das ist gemäß Art. 2 Rom-I-VO auch dann der Fall, wenn sie das Recht eines Drittstaates vereinbaren. Aus Art. 3 Abs. 3 Rom- I-VO folgt lediglich die Einschränkung, dass die Rechtswahl in einem inländischen Vertrag über ein Rechtsverhältnis ohne tatsächlichen Auslandsbezug keine kollisionsrechtliche Wirkung entfaltet; das gewählte Recht kann in diesem Fall zwingende nationale Rechtsvorschriften nicht überlagern.241 Vereinbaren die Schiedsparteien demnach gemäß § 1051 Abs. 1 ZPO die Anwendung des Sachrechts eines anderen Staates auf ihr vertragliches Schuldverhältnis, so eröffnen sie in jedem Fall den Anwendungsbereich der Rom-I-VO.
Im Weiteren ist daher die Auffassung abzulehnen, nach welcher die Schiedsvereinbarung alles übrige vereinnahme, was daher nicht nach europäischem IPR zu beurteilen sei. Zuzustimmen ist jener, nach der die Eigenständigkeit der Rechtswahlvereinbarung des § 1051 Abs. 1 S. 1 ZPO aus Art. 3 Rom-I-VO erkennbar wird.242 Sie ist in der Folge wie die Schiedsvereinbarung vom Hauptvertrag unabhängig, als abstrakter Verweisungsvertrag zu werten,243 den die Schiedsparteien in Ausübung ihrer Parteiautonomie schließen (Art. 3 Abs. 1 S. 1 Rom-I-VO).244 Diese Auslegung muss sich an Art. 3 Rom-I-VO nicht nur „orientieren“.245 Vielmehr ist der Verweisungsvertrag nach § 1051 Abs. 1 S. 1 ZPO identisch mit dem der Rom- I-VO. Schon Art. 3 Abs. 2 S. 1 Rom-I-VO weist auf dessen Autonomie: Die Rechtswahl kann jederzeit unabhängig vom Hauptvertrag geändert werden.246
In Art. 3 Abs. 5 Rom-I-VO wird noch einmal ihre Rekursivität deutlich, wie zuvor bei der inzidenten Rechtswahl in der Schiedsvereinba- rung angeklungen.247. Diese Vorschrift qualifiziert jedoch in erster Linie die Verweisungsentscheidung der Vertragsparteien als eigenständige Ei- nigung,248 nach der für ihr Zustandekommen und ihre Wirksamkeit die gleichen Voraussetzungen wie für den Hauptvertrag nach den Artt. 10, 11 und 13 Rom-I-VO gelten. Daraus folgt ein Zirkelschluss:249
Nach Art. 3 Abs. 1 Rom-I-VO ist das in der gültigen Rechtswahlvereinbarung bezeichnete Recht anzuwenden. Ihre Wirksamkeit richtet sich, aus Art. 3 Abs. 5 in Verbindung mit Art. 10 Abs. 1 Rom-I-VO folgend, jedoch nach dem durch sie bestimmten Recht, welches auf den Hauptvertrag angewendet wird.250 Dieser „Vorgriff auf das gewählte Recht“ wird kritisch gesehen,251 hält allerdings wohl in der Regel einer Billigkeitsprüfung nach Art. 10 Abs. 2 Rom-I-VO stand,252 wonach eine Partei sich auf das Recht des Staates ihres gewöhnlichen Aufenthalts, ihr „Umweltrecht“,253 zurückziehen kann, wenn ein Festhalten am Vertragsstatut aus den Umständen heraus ungerechtfertigt erscheint.254 Gleichwohl mag es problematisch sein, die Wirksamkeitsvoraussetzung beider Verträge gewissermaßen ineinandergreifen zu lassen. Wie unschwer zu erkennen, stellt sich dasselbe Problem beim Schiedsvereinbarungsstatut. Dort bestimmen die Parteien gemäß § 1059 Abs. 2 Nr. 1 lit. a ZPO das Recht, nach dem die Wirksamkeit der Schiedsvereinbarung zu beurteilen ist. So wird zum Einen die Notwendigkeit offensichtlich, ihrerseits die Schiedsvereinbarung nach IPR- Grundsätzen zu beurteilen, wegen des Ausschlusses in Art. 1 Abs. 2 lit. e Rom-I-VO notwendig nach autonomem deutschen IPR. Zum Anderen wird jedoch vor allem deutlich, dass sich diese Rechtswahl von derjenigen aus § 1051 Abs. 1 ZPO unterscheidet. Sie richten sich auf zwei unterschiedliche Verträge.
Nach dieser Erörterung scheinen zumindest triftige Gründe dafür zu sprechen, von unterschiedlichen Rechtswahlvereinbarungen auszugehen. Argumente gegen die Anwendung des Art. 3 Abs. 1 S. 1 Rom-I-VO gehen daher ins Leere, soweit ihnen auch nur tendenziell eine Auslegung des § 1051 Abs. 1 S. 1 vor dem Hintergrund des § 1029 Abs. 1 ZPO zugrunde liegt. Auch der Ansatz, eine Einschränkung der Rechtswahl im deutschen schiedsrichterlichen Verfahren nach IPR-Gesichtspunkten widerspreche dessen Sinn und Zweck, will nicht überzeugen.255 Wie noch zu sehen sein wird, greift das pragmatische Argument nicht durch, wonach diese vermutete Rechtswahlerleichterung internationale Akteure motiviere, ihr Schiedsgericht in Deutschland zu verorten.
Im Weiteren wird daher angenommen, dass die Rechtswahl nach § 1051 Abs. 1 S. 1 ZPO ein eigenständiger Verweisungsvertrag ist, auf welchen Art. 3 Rom-I-VO unmittelbar Anwendung findet, der letztlich ähnlich der Schiedsklausel, aber parallel zu ihr, akzessorisch am Hauptvertrag anknüpft.256
b) Rechtswahl ohne Hauptvertrag
Das vorgebrachte Argument wurde vor dem Hintergrund vertraglicher Schuldverhältnisse im Sinne des Art. 3 Abs. 1 S. 1 Rom-I-VO entwickelt. Durch eine Schiedsvereinbarung gemäß § 1029 Abs. 1 ZPO können allerdings auch Streitigkeiten aus Rechtsverhältnissen nichtvertraglicher Art einem Privatgericht unterworfen werden.
Zweifel über die Eigenständigkeit der dann nur möglichen Schiedsab- rede im Sinne des § 1029 Abs. 2 ZPO können daraus nicht folgen. Ihre Unabhängigkeit ist bereits im Begriff enthalten. Über diejenige der Rechtswahl aus § 1051 Abs. 1 S. 1 ZPO ist dem deutschen Schiedsverfahrensrecht indes keine eindeutige Aussage zu entnehmen.
Die gleichen Gründe, welche zur oben ausgeführten Anwendbarkeit der Rom-I-VO führen, sollten jedoch sowohl zur Eröffnung des räumlichen Anwendungsbereichs der Verordnung (EG) Nr. 864/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates über das auf außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht257 (künftig: Rom-II-VO) und der Verordnung (EU) Nr. 1259/2010 zur Durchführung einer verstärkten Zusammenarbeit im Bereich des auf die Ehescheidung und Trennung ohne Auflösung des Ehebandes anzuwendenden Rechts258 (künftig: Rom-III-VO) herangezogen werden können.259 Diese schließen gemäß Art. 3 Abs. 1 lit. b und d EGBGB die Anwendung des autonomen deutschen IPR aus.
Bei außervertraglichen Schuldverhältnisse im räumlichen und sachlichen Anwendungsbereich nach Art. 1 Rom-II-VO steht den Parteien die Rechtswahl gemäß Art. 14 Abs. 1 Rom-II-VO zu. Deren kollisionsrechtliche Wirkung wird ähnlich Art. 3 Abs. 3 Rom-I-VO von Art. 14 Abs. 2, 3 Rom-II-VO eingeschränkt. Gleiches gilt gemäß Art. 5 Abs. 1 Rom-III-VO aus dessen Abs. 2 auch die Eigenständigkeit der Rechtswahlvereinbarung deutlich wird. Freilich ist die Parteiautonomie hier stärker eingeschränkt. Die Rechtsnatur der Rechtswahlvereinbarung stellt das jedoch nicht infrage.
c) Ergebnis
Die Rechtswahl aus § 1051 Abs. 1 S. 1 ZPO lässt sich nach alledem als eigenständiger Verweisungsvertrag im Sinne von Art. 3 Abs. 1 S. 1 Rom-I-VO klassifizieren, welcher parallel zur Schiedsvereinbarung mit Hinblick auf ein Rechtsverhältnis vertraglicher oder nichtvertraglicher Art geschlossen werden kann. Da mit diesem der Anwendungsbereich des heteronomen europäischen IPR eröffnet wird, muss sich seine rechtliche Beurteilung jeweils nach der einschlägigen Rechtswahl, abhängig von dem Rechtsverhältnis auf das er sich bezieht, richten. Vertragliche Rechtsverhältnisse, auf welche die Rom-I-VO anwendbar ist, führen so zur Rechtswahl gemäß Art. 3 Abs. 1 S. 1 Rom-I-VO. Nichtvertragliche Rechtsverhältnisse schränken die Möglichkeiten der Rechtswahl gemäß der Rom-II- beziehungsweise Rom-III-VO ein.
2. Form
Sind die europäischen kollisionsrechtlichen Verordnungen unmittelbar anwendbar, so ist die Geltung des Art. 3 Abs. 1 S. 2 Rom-I-VO unproblematisch zu bejahen. Die Rechtswahl für Streitigkeiten vor einem Schiedsgericht, welcher die Bezeichnung des Rechts dem der Vertrag unterliegt gleichkommt,260 muss demnach ausdrücklich erfolgen oder eindeutig im Hauptvertrag <beziehungsweise eindeutig konkludent vereinbart worden sein.261 Die Parteien können sodann ihre Rechtswahl auf den gesamten Vertrag oder nur auf einen Teil desselben ausdehnen (Art. 3 Abs. 1 S. 3 Rom-I-VO), die in letzterem Fall jedoch sicherlich schriftlich erfolgen sollte, zur Vermeidung von Auslegungsproblemen.262
Ferner richten sich die Formvorschriften gemäß Art. 3 Abs. 5 in Verbindung mit Art. 11 Abs. 1 Rom-I-VO nach dem im Verweisungsvertrag bezeichneten, auf den Hauptvertrag wirkenden Sachrecht, subsidiär nach dem Recht des Vertragsschlussstaates. Gemäß Art. 11 Abs. 2 Rom-I-VO haben die Vertragsparteien die Wahl zwischen dem Recht eines der Staaten, in dem sie zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. Eine sinngemäße Vorschrift enthält Art. 11 Abs. 3 Rom-I-VO für einseitige Rechtsgeschäfte. Keine Rechtswahl steht aus Art. 11 Abs. 4 Rom-I-VO folgend für Verbraucherverträge offen. Ferner ist sie gemäß Art. 11 Abs. 5 Rom-I-VO bei dinglichen Verträgen sowie Miet- und Pachtverträgen nur möglich, wenn im Staat, in dem die betreffende Sache belegen ist, das Belegenheitsstatut abdingbar ist. Bis auf die Formerfordernisse für Verbraucherverträge steht das Formprivileg aus Art. 11 Rom-I-VO auch in Verbindung mit Art. 3 Abs. 5 Rom-I-VO demnach grundsätzlich zur Disposition der Vertragsparteien.263
Kommt bei Vertragssschluss das Recht mehrerer Staaten in Betracht und kann sich daraus eine asymmetrische Rechts-, Geschäfts- und Handlungsfähigkeit eines Vertragspartners oder seines Vertreters264 ergeben, so wirkt auf die Vereinbarung des Vertragsstatuts nach Art. 3 Abs. 5 auch Art. 13 Rom-I-VO. Danach kann sich ein Vertragsteil nur auf diese Unwirksamkeitsgründe nach dem in Betracht kommenden Recht eines anderen Staates berufen, wenn der andere Teil sie kannte oder kennen musste.
Insofern eine Rechtswahlvereinbarung geschlossen wird, die dem Bestimmtheitsgebot entspricht und deren Parteien nach dem jeweils verordnungsgemäß anwendbaren Recht rechts-, geschäfts- und handlungsfähig sind, dürfte sie daher den Formerfordernissen genügen und somit als eigenständiger Verweisungsvertrag wirksam sein. Dabei sollte es gerade wegen ihrer ständigen Abänderbarkeit unerheblich sein, ob sie innerhalb einer gesonderten Schiedsabrede, innerhalb einer Schiedsklausel, als gesonderte Klausel des Hauptvertrags oder als selbständige Vereinbarung formuliert wird. Solange sie sich eindeutig, und wenn auch nur eindeutig konkludent, auf den Inhalt des Rechtsverhältnisses bezieht, dessen Konflikte schiedsrichterlich entschieden werden sollen, ist sie nicht Bestandteil der Schiedsvereinbarung. Kommt es zu einer Beurteilung nach § 1059 Abs. 2 Nr. 1 lit. a Var. 2 ZPO, so spricht vielmehr noch, die Ausführungen in 1c ergänzend, vieles für eine Doppelnatur der Rechtswahlklausel. In diesem Zusammenhang stellt sie zusätzlich eine konkludente Rechtswahl zur Gültigkeitskontrolle der Schiedsvereinbarung dar, welche wie bereits festgestellt, im übrigen zumindest nach dem autonomen IPR zu beurteilen sein sollte.265
3. Bestimmung des Sonderkollisionsrechts
Die Qualifikation des § 1051 Abs. 1 ZPO als Sonderkollisionsrecht oder als Bestandteil des IPR bestimmt die Schranken der Befugnis zur freien Bestimmung des anzuwendenden Rechts. Trifft ersteres zu, so mag die Reichweite nach internationalen schiedsgerichtlichen Standards zu bewerten und im Ergebnis nahezu unbeschränkt sein. Überzeugt hingegen die zuvor entwickelte Auffassung, letztlich die Vorschrift gewissermaßen als nicht ausdrückliche Rechtsgrundverweisung266 auf die europarechtliche Verweisungsnorm zu betrachten, also die Inbezugnahme der Tatbestandsvoraussetzung und Rechtsfolgen des Art. 3 Abs. 1 Rom-I-VO,267 so werden die Wahlmöglichkeiten erheblich, nämlich nur auf staatliches Recht, eingegrenzt.
Beides soll im Folgenden nacheinander in Betracht gezogen werden, um im Ergebnis eine Entscheidung fällen zu können, über den Umfang des Sonderkollisionsrechts im schiedsrichterlichen Verfahren.
a) »Einheitsthese«
Nach den Auffassungen, welche eine Anwendbarkeit des heteronomen und autonomen IPR kategorisch verneinen, wird als einzige Grenze der Rechtswahlfreiheit aus § 1051 Abs. 1 S. 1 ZPO der deutsche ordre public gesehen.268 Dieser wird, wie bereits in I angemerkt, in Verfahren über die Vollstreckbarerklärung und die Aufhebung von Schiedssprüchen durch das zuständige OLG von Amts wegen überprüft. Die Überprüfung soll aus dieser Sicht wohl sehr zuverlässig erfolgen.269 Insoweit kann die Rechtswahl den Schiedsparteien vollständig zur Disposition stehen. Eine umfassende nachträgliche Kontrolle ist möglich, soweit sie von einer Schiedspartei begehrt wird.
Schier grenzenlos soll die Rechtswahl schließlich nach der in § 1051 Abs. 3 ZPO gebotenen Möglichkeit der Schiedsparteien sein, die Schiedsrichter ausdrücklich zu Billigkeitsentscheidungen zu ermächtigen. Soweit bereits die Rechtswahl als Bestandteil des vom IPR unabhängigen Sonderkollisionsrechts betrachtet wird, ist es folgerichtig, die Rechtswahl mitsamt der Ermächtigung der Schiedsrichter zur freien Urteilsfindung als einheitliche Bestimmung des Entscheidungsmaßstabs zu betrachten.270
Wird diese Ermächtigung zulässig erteilt, so ist sie selbst Bestandteil der öffenlichen Ordnung. Ein der freien Urteilsfindung der Schiedsrichter überlassener Schiedsspruch kann somit nicht von vornherein gegen den deutschen ordre public verstoßen. Bekräftigend wirkt zudem die Auslegungsvorschrift des § 1051 Abs. 4 ZPO (welche unten in b bb tiefergehend diskutiert wird).271
Es bleibt dann nur noch ein Rückgriff auf Radbruch, welcher im Dilemma von Billigkeit und Gerechtigkeit,272 die mit Zweckmäßigkeit273 und Sicherheit274 des Rechts ausgesöhnt werden müssen, der Gerechtigkeit als letztem Abgrenzungskriterium von Recht und Unrecht den höchsten Wert beigemessen hat.275 Die Bestimmung der Gerechtigkeit mit all ihren Problemen freilich obliegt dann dem angerufenen staatlichen Gericht, das den Schiedsspruch aufhebt, wenn dieser in einem „[untragbaren] Widerspruch zu deutschen Gerechtigkeitsvorstellungen steht“.276 Das nach deutschen Gerechtigkeitsvorstellungen Tragbare soll mithin die Grenze der Bestimmung des Entscheidungsmaßstabs sein, der von den Schiedsparteien festgelegt werden kann.
Sonderkollisionsrecht findet sich nach der in diesem Abschnitt dargestellten Auffassung in § 1051 Abs. 1 ZPO und Absatz 3 in Verbindung mit Absatz 4. § 1051 Abs. 2 ZPO kann hinzugezählt werden: Führt diese Norm auch zur Anknüpfung an das anwendbare Recht nach herkömmlichen Grundsätzen des IPR, so trifft doch das private Schiedsgericht und keine staatlich berufene Stelle diese Entscheidung. In der Konsequenz enthält der gesamte subsubsection das originäre Kollisionsrecht des deutschen schiedsrichterlichen Verfahrens. Diese Ansicht wird an dieser Stelle daher als »Einheitsthese«, bezeichnet.
b) »Trennungsthese«
Wird hingegen das IPR, insbesondere Art. 3 Rom-I-VO, als anwendbar betrachtet, so bestimmt sich die Grenze der Rechtswahl nach den dann einschlägigen kollisionsrechtlichen Grundsätzen. Daraus lässt sich eine »Trennungsthese« ableiten: Die systematischen Unterscheidung von Verweisungsvertrag gemäß § 1051 Abs. 1 ZPO einerseits und der Berücksichtigung besonderer Auslegungsregeln für sich genommen und in Verbindung mit der Ermächtigung zum Billigkeitscheid gemäß § 1051 Abs. 4 in Verbindung mit Abs. 3 ZPO andererseits, wie sie sich im Folgenden darstellt.
aa) Verweisungsvertrag Ist die Rechtswahl als eigenständiger Verweisungsvertrag im Sinne des heteronomen IPR zu qualifizieren, so wäre zunächst jede gegenwärtig geltende staatliche Rechtsordnung wähl- bar.277 Einzelne in- oder ausländische Rechtsnormen dürfen ^inkorporiert““ oder „,rezipiert“‘ werden.278 Insoweit bringt § 1051 Abs. 1 S. 1 ZPO diesen Grundsatz zum Ausdruck, indem die Parteien auch auf einzelne Rechtsvorschriften verweisen können und nicht eine Gesamtrechtsordnung in Bezug nehmen müssen.279 1051 Abs. 1 S. 2 ZPO wiederum, der Ausschluss des Kollisionsrechts der gewählten staatlichen Rechtsordnung, gibt Art. 20 Rom-I-VO sinngemäß wieder.
Der ausdrückliche vollständige Ausschluss einer staatliche Rechtsor- dung soll sich damit nicht vereinbaren lassen.280 281 282 Es kann demnach im Einklang mit dem Wortlaut des Art. 1 Abs. 1 und Art. 2 Rom-I-VO kein nichtstaatliches Recht mit kollisionsrechtlicher, also das zwingende Recht anderer Staaten auschließender Wirkung vereinbart werden. Als materiellrechtliche Verweisung sei die Inbezugnahme „internationaler Klauselwerke“283 zu verstehen, in denen sich „allgemeine Rechtsgrundsätze (general principles of law)“284 wiederfinden. Diese werden nach allgemeinen kollisionsrechtlichen Regeln angeknüpft,285 sodass die Verweisung lediglich die dispositiven Regeln der als einschlägig ermittelten Rechtsordnung modifiziert.286 Gleiches soll für die sogenannte „Lex mercatoria“, das „transnationale Handelsgewohnheitsrecht“287 gelten.288 Diese lässt sich mit anderen von nicht staatlichen Akteuren verbindlich gesetzten Regeln wie der „lex sportiva“und „lex technica“ zusammenfassen als der „legal lag“ des staatlich gesetzten Rechts,289 die „private Rechtsetzung“290 Auch auf religiöses Recht als solchem soll folgerichtig nicht kollisionsrechtlich verwiesen werden können.291 Insbesondere wird nicht anerkannt, dass zwei Rechtsordnungen in einem Stufenverhältnis vollständig auf einen Vertrag wirken sollen.292 Eine materiellrechtliche Wirkung wird indes nicht ausgeschlossen.293
Als stillschweigende Rechtswahl schließlich kann somit nur eine kollisionsrechtliche Verweisung angenommen werden.294 So wird etwa der Abschluss einer Schiedsvereinbarung ohne ausdrückliche Rechtswahl wohl häufig als konkludente Wahl des staatlichen Rechts am Ort des benannten Schiedsgerichts ausgelegt.295
Wie bereits in 1a ausgeführt, kann für einen Vertrag ohne faktischen Auslandsbezug ein fremdes Recht vereinbart werden, welches sodann hinter die zwingenden nationalen Vorschriften zurücktreten muss. Entspricht die Rechtswahl nach § 1051 Abs. 1 S. 1 ZPO der des Art. 3 Abs. 1 S. 1 Rom-I-VO und sind nach letzterem nur Vorschriften staatlichen Rechts wählbar, so lässt sich die Benennung etwa »islamischen Rechts« als konkludente Vereinbarung deutschen Sachrechts im deutschen schiedsrichterlichen Verfahren auslegen, welches, bei ausreichender
Bestimmtheit, die dispositiven Vorschriften deutschen Rechts zulässig ausfüllen soll.
Die materiellrechtliche Wirkung des gewählten religiösen Rechts ergibt sich indes nicht gemäß Art. 3 Abs. 1 S. 3 in Verbindung mit S. 2 Var. 3 in Verbindung mit S. 1 Rom-I-VO aus einer Teilrechtswahl.296 Diese Vorschrift ist nach dem bisherigen Erkenntnisstand blind für etwas anderes als staatliches Recht.
Es bleibt bei der kollisionsrechtlichen Bestimmung des Vertragstatuts, die gewissermaßen an die lex fori bezogen auf den Sitz des Schiedsgerichts anknüpft, also nach §§ 1025 Abs. 1, 1043 Abs. 1 ZPO wie gehabt ausschließlich ins deutsche Recht führt. Insoweit bleibt das Vertragsstatut Hauptanknüpfungskriterium und steht § 1051 Abs. 2 ZPO im selben subsidiären Verhältnis zu Absatz 1 wie Art. 4 Abs. 4 Rom-I-VO zu Art. 4 Abs. 1, 2 und Art. 3 Abs. 1 Rom-I-VO.297 Das Kriterium der „engsten Verbindungen“ kommt also erst am Ende der „Anknüpfungsleiter“298 zum Tragen, wenn die Auslegung der Vereinbarung zu keinem Ergebnis führt.
Die ausdrückliche Vereinbarung des religiösen Rechts wird nach ihrer Umdeutung unselbständiger Bestandteil des Hauptvertrags. Als solche erlangt sie nur materiellrechtliche Bedeutung.299 Ihre Auslegung muss sich dann folgerichtig nach den allgemeinen Regeln der §§ 133, 157 BGB richten. Die Grenzen bestimmen sich nach §§ 134 ff. BGB.300
Der ordre-public-Vorbehalt geht in Bezug auf die Wahl »islamischen Rechts« folglich ins Leere, sei es nach Art. 21 oder auch 9 Rom-I-VO oder Art. 6 EGBGB. § 1059 Abs. 2 Nr. 2 lit. b ZPO bleibt bereits außer Betracht, weil er sich weder auf die Rechtswahl noch den Hauptvertrag, sondern auf die Zulässigkeit des abschließend gefällten Schiedsspruches richtet.
Wird indes ein wirksamer ausdrücklicher Verweisungsvertrag auf das Recht eines anderen Staates geschlossen, so beschränken diesen Artt. 9 Abs. 3, 1 beziehungsweise 21 Rom-I-VO, da die Verordnung anwendbar bleibt. Solche zwingenden Vorschriften, denen von dem Staat in welchem sich der Erfüllungsort befindet ein entscheidendes öffentliches Interesse beigemessen wird, können nicht vertraglich ausgeschlossen werden.
Die Rechtswahl der Parteien gemäß § 1051 Abs. 1 ZPO zielt demnach als eigenständige Vereinbarung notwendig allein auf staatliches Recht. Wird ausdrücklich etwas anderes vereinbart, so begeben sich die Vertragsparteien wie gesehen in die Hand des nach allgemeinen Anknüpfungskriterien einschlägigen staatlichen Rechts. Dessen zwingende Vorschriften sind dann von ihnen zu beachten. Insoweit haftet dieser Norm nichts eigenständiges an, das sie als Sonderkollisionsrecht ausweisen könnte. Etwas anderes kann sich indes für die nun zu behandelnden Vorschriften ergeben.
bb) Auslegungsregeln und Billigkeitsentscheidung Der Entwurfsbegründung des Gesetzes zur Neuregelung des Schiedsverfahrensrechts ist die Auffassung zu entnehmen, dass die Absätze 4 und 3 des § 1051 ZPO originäres Schiedsverfahrensrecht enthalten, welches von der Ausschlussklausel des Art. 1 Abs. 2 lit. e Rom-I-VO und Art. 1 Abs. 2 lit. d EVÜ erfasst sei.301 Als solche wären sie demnach „Gesichtspunkte im Hinblick auf die Schiedsvereinbarung“302 und ließen sich somit nicht mehr dem heteronomen IPR zurechnen. Ist jedoch auf die Rechtswahl mit kollisionsrechtlicher Wirkung den Ausführungen in aa folgend europäisches Kollisionsrecht anzuwenden, ist Absatz 1 aus dieser Sonderqualifizierung herausgelöst.
Isoliert betrachtet stellt sich das möglicherweise verbleibende Sonderrecht wie folgt dar.
(1) Auslegung des Hauptvertrags unter Berücksichtigung bestehender Handelsbräuche Nach der bereits in a aufgegriffenen Ansicht soll § 1051 Abs. 4 ZPO gegenüber § 1051 Abs. 1 ZPO subsidiär wirken. Die Norm trete erst dann aus dem Schatten der Wahl (staatlichen!) Rechts heraus, wenn die Parteien in ihren Verfahren Billigkeitsentscheidungen zulassen oder einzelne Rechtsvorschriften zur Anwendung kommen sollen.303
Nach anderer Auffassung erfasst der Wortlaut jegliches Schiedsverfahren, weshalb die Norm zunächst weit über ihren vermeintlichen Sonder- status hinaus wirke.304 Im Ergebnis wird jedoch auch hier die Notwendigkeit „beherzter teleologischer Korrektur“305 gesehen. Der Gesetzgeber habe Art. 28 Abs. 3, 4 des UNCITRAL-Modellgesetzes unreflektiert übernommen,306 deren Regelungen sich auf internationale Handelschiedsverfahren beziehen. Das deutsche schiedsrichterliche Verfahren kann indes auch von Privatpersonen genutzt werden.307 Daher müsse die Berücksichtigung bestehender Handelsbräuche zum Einen erweitert als „Berücksichtigung der Verkehrssitte“ ausgelegt werden; zum Anderen soll diese nur dann zum Tragen kommen, wenn sie in der nach § 1051 Abs. 1 ZPO gewählten Rechtsordnung vorgesehen ist, soweit keine Billigkeitsentscheidung vereinbart ist.308
Diese differenziertere Betrachtung überzeugt. Sie orientiert sich stärker am Wortlaut und lässt eine dynamische und zugleich trennscharfe Auslegung der Norm zu, sodass sie sowohl im Handels- als auch in einem sonstigen Kontext anwendbar bleibt. Der Anweisung „in allen Fällen“ kann so entsprochen werden. Über die Grenzen der staatlich anerkannten Verkehrssitte hinaus kann auch etwa internationaler Handelsbrauch ganz wortgetreu relevant werden, wenn die Parteien zur inhaltlichen Präzisierung der Billigkeit, nach welcher das Schiedsgericht entscheiden soll, die „lex mercatoria“ bestimmen.309
Einig sind sich die Vertreter beider Auffassungen darin, zwei Varianten in § 1051 Abs. 4 ZPO hineinzulesen:310
In allen Fällen hat das Schiedsgericht
Var. 1 : in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Vertrags
zu entscheiden
und
Var. 2 : dabei bestehende Handelsbräuche zu berücksichtigen.
Dieser Auslegung ist indes schwer zu folgen, wenn sie auch weithin akzeptiert zu sein scheint. Es sei dahin gestellt, ob sie in ihrer ursprünglichen Fassung entsprechend gemeint war. Der Satz liest sich dennoch anders. Verträge konkretisieren das dispositive Recht und grenzen insoweit - freilich selbstverständlich311 - die Entscheidungsgrundlage des Schiedsgerichts ein, das im übrigen nach den kollisionsrechtlich angeknüpften Rechtsvorschriften zu entscheiden hat, insbesondere den zwingenden. Dies ist jedoch keine vom Teilsatz nach dem »und« unabhängige Anweisung. Gemeinsam ergeben sie, mit obiger teleologischer Auslegung kombiniert, in Ganzes:
Muss eine vertragliche Bestimmung im Konfliktfall gedeutet werden, so („dabei“) stets („in allen Fällen“) im Hinblick auf die »maßgebliche« Verkehrssitte.
Hier steht nun nicht mehr zur Debatte, ob der wirkliche Wille zu erforschen ist oder doch am buchstäblichen Sinne des Ausdrucks zu haften; das bestimmt die jeweils »maßgebliche Verkehrssitte«, auf die sich auch gesetzliche Auslegungsregeln beziehen.312 Die Relativität kommt eindeutig zum Ausdruck und auch die angemahnte Zielsetzung des Schiedsverfahrensrechts bleibt gewahrt, Deutschland als Schiedsort internationaler Schiedsverfahren zu stärken, durch eine möglichst einfache und für die Parteien überschaubare Regelung.313
Die Norm ist isoliert betrachtet immer noch abhängig vom zwingend anzuwendenden Recht, innerhalb dessen sie zunächst klarstellende Funktion hat. Ist dieses Recht aufgeschlossen gegenüber „privater Rechtsetzung“, wird diese als Verkehrssitte anerkannt, so kann auch der „legal lag“, können möglicherweise auch religiös geprägte Rechtsauffassungen zur Entscheidungsfindung herangezogen werden. Deren rechtmäßige Berücksichtigung als Auslegungshilfe findet jedoch immer noch innerhalb der geordneten Bahnen des staatlichen Rechts statt.
(2) Ermächtigung zum Billigkeitsentscheid Die ausdrückliche Ermächtigung zum Billigkeitsentscheid gemäß § 1051 Abs. 3 ZPO könnte als die eigentliche sonderrechtliche Verweisung betrachtet werden. Durch sie wird sowohl die Rechtswahl als auch die Anknüpfung jeweils nach Absatz 1 beziehungsweise Absatz 2 aufgehoben314 und stattdessen die schöpferische Kraft der Schiedsrichter zur Entscheidungsgrundlage bestimmt.315 Soweit dieser misstraut wird ist mindestens entgegenzuhalten, dass auch die Billigkeitsentscheidung nicht vollkommen willkürlich erfolgen darf.316 Als Einzelfallgerechtigkeit317 legt sie die Auslegung der für den zu entscheidenden Sachverhalt einschlägigen Normen nahe, welche den zur Entscheidung berufenen am gerechtesten erscheint.
Insoweit stellt auch für eine auf Absatz 3 gründende Entscheidung der stets anzuwendende Absatz 4 zunächst wieder die Klarstellung der Begrenzung schiedsrichterlicher Entscheidungsfreiheit durch die Normen des Hauptvertrages dar.
Diese sind wie gesehen jedoch unter Berücksichtigung der jeweils maßgeblichen Verkehrssitte auszulegen.318 Und unter diesem Aspekt gehen beide Absätze eine Verbindung besonderer Art ein. Die Verkehrssitte ist Maßstab der Einzelfallgerechtigkeit, an welchem die Schiedsrichter ihre Entscheidung auszurichten haben, welcher die Auslegung der relevanten Normen leitet.319 Die Ermächtigung zur Billigkeitsentscheidung, aus § 1051 Abs. 3 S. 2 ZPO folgend wieder eine parteiautonome eigenständige Vereinbarung, ermöglicht von der Rechtsprechung staatlicher Gerichte abweichende Schiedssprüche. Die Bestimmung der Verkehrssitte reduziert dabei gemäß § 1051 Abs. 4 ZPO wiederum die Auslegungsergebnisse im von den Parteien mit der Ermächtigung festgelegten Bezugs- rahmen.320 Dieser muss nicht auf staatlich gesetztes Recht zurückgehen. Denn die Maßgeblichkeit der Verkehrssitte wird nun nicht mehr durch § 1051 Abs. 1 ZPO bestimmt, sondern durch § 1051 Abs. 3 ZPO.
Der ordre-public-Vorbehalt321 und damit auch die Prüfung des Rechts- missbrauchs322 kommt wie gehabt erst dann zum Tragen, wenn der kraft § 1055 ZPO zwischen den Parteien Recht gewordene und gemäß § 1051 Abs. 3 ZPO billig entschiedene Schiedsspruch auf Antrag überprüft wird. Faktisch sollte dieser somit die letzte Grenze billiger schiedsrichterlicher
Entscheidungsfreiheit ziehen, soweit er verfängt. Somit bleibt auch die Bindung an zwingendes nationales materielles Recht erhalten,323 allerdings mit weiter unten noch zu klärender Intensität.
Dennoch ist zunächst durch das Zusammenspiel dieser beiden Normen die materiellrechtliche Verweisung auf jegliches von den Parteien bestimmte Regelwerk zulässig. Entsprechende Streitpunkte aus dem europäischen IPR sind im schiedsrichterlichen Verfahren dann hinfällig. Soweit die Rechtskraft des Schiedsspruchs nicht durchbrochen wird, sind potentiell auch verbindliche Entscheidungen denkbar, die selbst von vermeintlich zwingenden Vorschriften des national einschlägigen Rechts abweichen. Insoweit könnte der Billigkeitsentscheidung auf Grundlage des parteiautonom bestimmten Bezugsrahmens in gewissem Maße kollisionsrechtliche Wirkung zugeschrieben werden. Die Qualifikation als Sonderkollisionsrecht trifft in diesem Fall dann zu.
c) Ergebnis
Die Einordnung des gesamten § 1051 ZPO als Sonderkollisionsrecht,324 »Einheitsthese«, kann nicht aufrecht erhalten werden. Bessere Gründe sprechen nach hiesiger Auffassung für die »Trennungsthese«. Sind die einschlägigen europarechtlichen Verordnungen auf die Rechtswahl und die konventionelle Anknüpfung durch das Schiedsgericht unmittelbar anwendbar, folgt die Entkopplung erst aus der Ermächtigung zur Billigkeitsentscheidung bei gleichzeitiger Festlegung des Ermessensspielraums durch die Schiedsparteien. Letzteres ist allein das Sonderkollisionsrecht. Es auf sämtliche Normen des § 1051 ZPO ausdehnen zu wollen erscheint somit als unzulässige Verallgemeinerung.
Ist die Wahl nicht-staatlichen Rechts gemäß § 1051 Abs. 1 ZPO jedoch nicht möglich, scheint der erste Teil des Themas dieser Arbeit bereits erschöpfend behandelt. Als Entscheidungsgrundlage im Schiedsgerichtsverfahren kann es auf dieser Ebene nicht herhalten. Insoweit ist exemplarisch Adolphsen und Schmalenberg sowie Hötte zu widersprechen, die das Gegenteil annehmen.
Ist allerdings seine Vereinbarung im Rahmen der Billigkeitsentscheidung möglich, bleibt zum Einen zu klären, was die Parteien durch die Wahl »islamischen Rechts« vereinbaren würden. Sind sie ursprünglich von einer eigenständigen, kollisionsrechtlichen Wirkung ihrer Rechtswahl ausgegangen, wird diese zunächst zur unselbständigen Klausel ihres Hauptvertrages. Jene ist nach den Regeln des anzuwendenden staatlichen Rechts mit Rücksicht auf die dann maßgebliche Verkehrssitte auszulegen. War die Absicht der Parteien, den zwingenden Vorschriften nationalen Rechts zu entkommen, so erscheint als naheliegendes Ergebnis, die nach § 1051 Abs. 1 ZPO unwirksame Verweisung auf nicht-staatliches Recht in eine nach § 1051 Abs. 3 ZPO wirksam gebundenen Ermächtigung zu einer Billigkeitsentscheidung umzudeuten, welche sich zudem gemäß § 1051 Abs. 4 ZPO nach den Auslegungsregeln des ausdrücklich gewählten Regelwerks zu richten hat. Zum Anderen bleibt die Frage nach der Anerkennungsfähigkeit entsprechend erlassener Schiedssprüche unbeantwortet. Dieser soll im Folgende nachgegangen werden.
IV. Rechtsbehelfe
In II und III wurde bereits einige Aspekte der Verfahren zur Aufhebung beziehungsweise Vollstreckbarerklärung von Schiedssprüchen angesprochen. Diese sollen nun in diesem Abschnitt vervollständigt werden. Da hier nur inländische Schiedsverfahren von Interesse sind, wird auch nur auf inländische Schiedssprüche Bezug genommen, der § 1061 ZPO zur Anerkennung ausländischer Verfahren daher ausgeklammert.
Entfaltet ein inländischer Schiedsspruch gemäß § 1055 ZPO zwischen den Parteien auch materielle Rechtskraft, so kann er doch gemäß § 1060 Abs. 1 ZPO erst mit staatlichen Zwangsmitteln durchgesetzt werden, wenn durch „staatlichen besonderen (Kontroll-)Akt“ aus ihm ein vollstreckbarer Titel erschaffen wird.325 In dem diesem Akt vorgeschalteten Verfahren wird zur Kontrolle des zu bestätigenden Schiedsspruchs gemäß § 1060 Abs. 2 ZPO auf die Aufhebungsgründe des § 1059 Abs. 2 ZPO zurückgegriffen. Bevor das Schiedsgericht seine Tätigkeit aufnimmt, kann gemäß § 1032 Abs. 2 ZPO der Antrag auf Feststellung der Zulässigkeit eines schiedsrichterlichen Verfahrens gestellt werden.326 Ebenso können die Parteien vor Beginn der mündlichen Verhandlung in einem staatlichen Klageverfahren die in II 4 b aa angesprochene Schiedsein- rede aus § 1032 Abs. 1 ZPO erheben. Es geht in beiden vorgreiflichen Verfahren um die Prüfung der potentiellen Nichtigkeit, Unwirksamkeit oder Undurchführbarkeit der Schiedsvereinbarung.327 Letztlich erfolgt die Prüfung der ersten beiden Merkmale zwar auf Grundlage von § 1029 ZPO dennoch in gleicher Weise, wie die nachträgliche Prüfung der in § 1059 Abs. 2 Nr. 1 lit. a, Nr. 2 lit. a ZPO erfassten Aufhebungsgründe.328 Selbstverständlich prüft die Schiedseinrede das jeweils angerufene Gericht. Im Übrigen sind alle genannten Anträge gemäß § 1062 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 4 ZPO beim zuständigen OLG zu stellen.
Schwerpunktmäßig wird im Folgenden daher die Systematik des § 1059 Abs. 2 ZPO dargestellt, eine Zusammenfassung der antragsgebundenen und der von Amts wegen zu prüfenden Aufhebungsgründe. Sodann wird das in § 1059 ZPO geregelte Aufhebungsverfahren grob skizziert um die Darstellung abzuschließen.
Zwar ist ferner die Durchbrechung der materiellen Rechtskraft eines Schiedsspruchs auf Grundlage des § 826 BGB möglich und wohl häufig das Mittel der Wahl.329 Wird durch die Entscheidung des Schiedsgerichts der Unterlegene also vorsätzlich und sittenwidrig geschädigt, so mag das „Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden [... ] der konkret betroffenen Verkehrskreise“330 gegen deren Wirksamkeit sprechen. Ebenso mag sich die Sittenwidrigkeit, empirisch belastbarer dennoch außerhalb des Deliktsrechts, aus ordre-public-Gesichtspunkten ergeben.331 Die Prüfung kann sich dogmatisch sauberer auch innerhalb desselben vollziehen.332 Schließlich können staatliche Gerichte zur Lösung des theoretischen Streits berufen werden, wiederum ganz praktisch die Sittenwidrigkeit des Schiedsspruches (nach Billigkeitsgesichtspunkten) und damit seine Nichtigkeit festzustellen.333
Das vom Gesetzgeber speziell vorgesehene und zahlreiche dogmatische Problemfelder am Wegesrand zurück lassende Instrument ist jedoch das Aufhebungsverfahren gemäß § 1062 Abs. 1 Nr. 4 in Verbindung mit § 1059 Abs. 1 ZPO, bei dem auch keine verfahrensrechtlichen Fragen der Zuständigkeit offen bleiben.334 Daher wird hier der deliktische Rechtsbehelf nicht weiter erörtert, sondern allein auf den schiedsverfahrensrechtlichen Bezug genommen.
1. Aufhebungsgründe
Die in § 1059 Abs. 2 ZPO abschließend aufgezählten Aufhebungsgrün- de335 sind entweder begründet geltend zu machen oder vom OLG amts- wegig zu prüfen.
a) Nicht von Amts wegen zu prüfende Gründe
Aufhebungsgründe die nur auf begründeten Antrag vom staatlichen Gericht in Betracht gezogen werden, sind insgesamt Verfahrensmängel.
aa) Verfahrensfehler: Fehlende Schiedsvereinbarung In Zusammenhang mit Schiedseinrede und Antrag auf Feststellung der Zulässigkeit oder Unzulässigkeit des Verfahrens, ist die bereits in II 3 aufgegriffene und in § 1059 Abs. 2 Nr. 1 lit. a ZPO formulierte Gültigkeitskontrolle von zentraler Bedeutung. Dies soll nun etwas differenzierter erläutert werden.
In kollisionsrechtlicher Terminologie beinhaltet § 1059 Abs. 2 Nr. 1 lit. a ZPO das Schiedsvereinbarungsstatut.336 Seine Variante 1 bestimmt die Vorgaben zur Prüfung der subjektiven Schiedsfähigkeit, des subjektiven Schiedsfähigkeitsstatuts.337 Dieses soll zwingend dem Personalstatut aus Art. 7 Abs. 1 EGBGB gleichkommen, es gilt also zu Fragen der Rechts- und Geschäftsfähigkeit das Heimatrecht der Schiedsparteien, jeweils angeknüpft an Staatsangehörigkeit, Sitz oder hilfsweise gewöhnlichem Aufenthalt.338 Folgt man den Auffassungen, die es im Schiedsvereinbarungsstatut aufgehen lassen,339 so ist auch in ihm potentiell eine dépeçage möglich. Durch sie wird die Rechts- und Geschäftsfähigkeit zwingend an unterschiedlichem Heimatrecht gemessen. Materielle Hindernisse, auch die Auslegungsmethoden, wiederum davon unabhängig gegebenenfalls an einem parteiautonom vereinbarten dritten Recht.340 Dies mag der Partei, welche die Unwirksamkeit oder Ungültigkeit der Schiedsvereinbarung begründen muss, besondere Schwierigkeiten bereiten, welche hier jedoch dahingestellt bleiben.
Überzeugt die jeweils angebotene Begründung zumindest das angerufene OLG, so wird pauschal die Unzulässigkeit des schiedsrichterlichen Verfahren und somit eine mangelnde Schiedsbindung der Parteien festgestellt.
Ein weiterer zu beantragender Aufhebungsgrund, der auf die Schieds- bindung zielt, ist die Reichweitenkontrolle.
bb) Verfahrensfehler: Überschreitung der Schiedsvereinbarung Ander Schiedsbindung mangelt es ebenfalls, wenn das Schiedsgericht außerhalb seiner Zuständigkeit tätig wird; insofern ist § 1059 Abs. 2 Nr. 1 lit. c ZPO als „Reichweitenkontrolle“ ein ausdrücklich geregelter Sonderfall der allgemeinen Gültigkeitskontrolle.341 Überschreitet das Schiedsgericht die ihm durch an sich wirksamen Vertrag verliehene Kompetenz, befasst es sich folglich mit Verfahrensgegenständen, die von der Schiedsverein- barung nicht erfasst sind,342 so handelt es ohne Rechtsgrundlage. Für diesen Fall existiert dann keine gültige Vereinbarung.
Wird dem Antrag stattgegeben, so wird gemäß § 1059 Abs. 2 Nr. 1 lit. c Hs. 2 ZPO nur der ungültige Teil des Schiedsspruches aufgehoben, sofern der gültige abtrennbar ist.343
Verfehlt wäre es, die Aufhebung eines Schiedsspruchs gestützt auf Buchstabe c zu beantragen, wenn das Schiedsgericht auf Grundlage einer verfristeten Schiedsvereinbarung entschieden hat: Es existiert nichts mehr, dessen Reichweite überschritten werden könnte. Dies unterfällt wieder der allgemeinen Gültigkeitskontrolle.344
Auch wenn das Schiedsgericht über gestellte Anträge hinausgeht oder gar eine Entscheidung ohne korrespondierenden Antrag trifft,345 fällt das aus diesem Tatbestand heraus.
cc) Verfahrensfehler: Gehörsmangel Gemäß § 1059 Abs. 2 Nr. 1 lit. b
ZPO kann ein Schiedsspruch aufgehoben werden, wenn eine Schiedspar- tei nicht rechtzeitig über die Einleitung des schiedsrichterlichen Verfahrens informiert worden ist sowie bei der Besetzung des Schiedsgerichts nicht mitwirken konnte,346 oder ihr im laufenden Verfahren nicht die Geltendmachung der aus § § 1046 f. ZPO folgenden Angriffs- und Verteidigungsmittel ausreichend ermöglicht worden ist.347
dd) Verfahrensfehler: Sonstige Prozessmängel Was nicht von den bis
hier genannten Verfahrensrügen erfasst und nicht von Amts wegen zu prüfen ist, unterfällt schließlich den sonstigen Prozessmängeln,348 so etwa die in bb genannten, über die Anträge der Parteien hinausgehenden Schiedssprüche.349 Als Auffangtatbestand, der sonstige Mängel bei der Bildung des Schiedsgerichts und der Durchführung des Verfahrens aufnimmt, wird gewissermaßen eine »Relevanzschwelle« vorausgesetzt. Daher muss gemäß § 1059 Abs. 2 Nr. 1 lit. d ZPO gleichsam begründet geltend gemacht werden, dass sich diese Mängel auch auf den Schiedsspruch ausgewirkt haben, bevor letzterer aufgehoben werden kann.350
b) Von Amts wegen zu prüfende Aufhebungsgründe
Ohne weitere Begründung der Antragsteller prüft das OLG die in II 4 erörterte objektive Schiedsfähigkeit den „[globalen] Staatsvorbehalt“,351 welcher nach überwiegender Auffassung sowohl die verfahrensrechtliche als auch die materiellrechtliche Komponente des ordre public erfassen soll.352
aa) Objektive Schiedsfähigkeit Soll etwa ein Schiedsspruch mit vereinbartem Wortlaut, durch den eine familienrechtliche oder gar strafrechtliche Streitigkeit entschieden worden ist, im Verfahren gemäß § 1060 Abs. 2 Satz 2 in Verbindung mit § 1059 Abs. 2 Nr. 2 lit. a und § 1030 ZPO für vollstreckbar erklärt werden, so wird der Antragsteller versuchen das OLG zu bewegen, die Schiedsfähigkeit anzuerkennen. Oben sind Argumente für die Eingrenzung möglicher schiedsfähiger Felder entwickelt worden. An dieser Stelle werden diese nicht weiter diskutiert.
bb) Staatsvorbehalt (ordre public) Der Staat behält sich vor, gemäß § 1059 Abs. 2 Nr. 2 lit. b ZPO die Wahrung der öffentlichen Ordnung gerichtlich sicherstellen zu lassen. Soweit einem Schiedsspruch zunächst unbesehen materielle Rechtskraft nach § 1055 ZPO zugestanden wird, darf durch diesen Vertrauensvorschuss doch nicht mit Billigung des Staates Recht werden, was den in „Deutschland vorherrschenden Vorstellungen von den Erfordernissen der öffentlichen Ordnung“353 und dadurch „der gezielten Absicherung spezieller Interessen mit einem ausgeprägten öffentlichen Bezug“ widerspricht.354
Die Begriffsbestimmung der öffentlichen Ordnung im Sinne dieser gesetzlichen Norm erweist sich indes als nicht unproblematisch. Ihre Legaldefinition, also letztlich Nominaldefinition355 als ordre public schließt zumindest offensichtlich einen Rückgriff auf Polizei- und Ordnungsrecht aus, wonach die öffentliche Ordnung eine äußerst restriktiv anzuwendende polizeiliche Eingriffsermächtigung darstellt, die im Merkmal der öffentlichen Sicherheit mit ihren drei Schutzgütern „Unverletzlichkeit der Rechtsordnung“, „Unverletzlichkeit der subjektiven Rechte und Rechtsgüter des einzelnen“ und „Bestand des Staates und der Einrichtungen und Veranstaltungen des Staates und sonstiger Träger der Hoheitsge- walt“356 aufgeht.357
Offen bleibt jedoch zunächst, ob es auf die Unterscheidug zwischen ordre public international oder interne ankommt358 und ob der Auffassung recht zu geben ist, wonach § 1059 Abs. 2 Nr. 2 lit. b ZPO dem § 328 Abs. 1 Nr. 4 ZPO entspricht359 oder allein der ordre public des Art. 6 EGBGB gemeint ist.360 (1) Ordre public international oder interne Nach der Terminologie des Europäischen Gerichtshofs (künftig: EuGH) meint ordre public international die Ländergrenzen übergreifenden Wertentscheidungen und Grundsätze, deren Einhaltung im nationalen wie im internationalen Rechtsverkehr aus deutscher Sicht essentiell erscheinen.361 Dies sei in Art. 6 EGBGB als der inländische, „international durchzusetzende“ ordre public umschrieben.362 So wird die zurückhaltende, negative Funktion desselben deutlich, wonach erst ein krasser Widerspruch gegen deutsches Recht zur Nicht-Anwendbarkeit einer fremden Rechtsnorm und eventuell ihrem Ersatz durch eine inländische führen soll.363 Denn bloße Wertentscheidungen und Grundsätze lassen einen wesentlich größeren Spielraum für die gegenseitige Anerkennung ihrer konkreten positivrechtlichen Ausgestaltung zu. Es wird daher, bei hinreichendem Inlandsbezug, allein das Ergebnis der konkreten rechtmäßigen Anwendung einer geltenden ausländischen Rechtsnorm darauf hin geprüft, ob dadurch im deutschen Recht eklatant, in der Qualität einer Grundrechtsverletzung gegen den Zweck zwingenden deutschen Sachrechts verstoßen würde.364
Dem steht nach der Terminologie des EuGH der ordre public interne gegenüber, das ausdrückliche nationale zwingende Recht an sich.365 Ein hierauf gründender Vorbehalt ist wesentlich anerkennungsfeindlicher. Zielte Art. 6 EGBGB auf diesen, so würde ein größerer Bestand ausländischer Normen mit deutschem ius cogens in unauflösbaren Konflikt geraten,366 da letzteres voll zur Geltung käme. Mithin würde das inländische Recht erheblich privilegiert. Soll jedoch dem Wesen des Kollisionsrechts die Annahme zugrunde liegen, dass die gesellschaftliche Wertentscheidungen überwiegend vergleichbar sind,367 so kann der ordre public nur ein restriktiv anzuwendender sein.
Als kollisionsrechtlicher Terminus wird in seiner deutschen Verwendung daher ordre public international hier als Pleonasmus betrachtet. Im französischen Recht haben die Begriffspaare ordre public international und interne sowie ordre public national und communitaire ihre Bedeutung. Unreflektiert ins Deutsche übernommen kommt es indes zu Begriffsverwirrungen,368 so etwa zwischen interne und national, die ähnlich verfehlt sind, wie es die Gleichsetzung des kollisions- und des polizeirechtlichen Begriffsverständnisses der öffentlichen Ordnung wäre.
Die Anwendung eines ordre public interne nach § 1059 Abs. 2 Nr. 2 lit. b ZPO kann mithin von vornherein ausgeschlossen werden.
(2) Anerkennungsrechtlicher ordre public Kann als Begriff deutschen Rechts der ordre public nur eine Bedeutung haben, so hat er doch unzweifelhaft zwei Ausprägungen, eine anerkennungsrechtliche und eine kollisionsrechtliche. Erstere wird gemeinhin für die in Frage stehende Vorschrift angenommen.
Dafür spricht der Gesetzeswortlaut, welcher sinngemäß § 328 Abs. 1 Nr. 4 ZPO wiedergibt. Der dort umschriebene ordre public zielt speziell auf „das konkrete Ergebnis“ der Anerkennung ausländischer Gerichtsentscheidungen durch deutsche Gerichte.369 Auch im Schiedsverfahrensrecht zielt die Vorbehaltsklausel auf das konkrete Ergebnis der gerichtlichen Anerkennung eines Schiedsspruchs.
Dieser verfahrensrechtliche ordre public370 oder genauer, der anerkennungsrechtliche mit verfahrensrechtlicher und materiellrechtlicher Komponente,371 stellt die Ausnahme zur révision au fond dar:372 Wider spricht eine rechtskräftig ergangene ausländische Gerichtsentscheidung den im »ordre public international « zum Ausdruck kommenden inländischen Wertvorstellungen, kann das im Anerkennungsverfahren dennoch gerügt und gegebenenfalls korrigiert werden.373 Primär ist das „der Entscheidung [des erkennenden ausländischen Gerichts] vorausgegangene Verfahren“ aber besonders restriktiv daraufhin zu prüfen, ob die verfahrensrechtlichen Verstöße dennoch akzeptabel sind,374 also vom ausländischen Gericht keine ins Gewicht fallenden „fundamentalen“ Verfah rensfehler begangenen wurden.375 Die materiellrechtliche Komponente entspricht dann dem Prüfungsmaßstab des Art. 6 EGBGB.376
Verweist § 1059 Abs. 2 Nr. 2 lit. b ZPO auf diese Ausprägung des ordre public, so müsste eben das für die Anerkennung von Schiedssprüchen gelten. Im Ergebnis wäre dann zum Aufhebungsantrag, oder Antrag auf Vollstreckbarerklärung von Amts wegen zunächst die Tragbarkeit der Durchführung des dem Schiedsspruchs vorausgegangenen, von den Parteien gegebenenfalls gemäß § 1042 Abs. 3 ZPO modifizierten Verfahrens zu prüfen. Daran würde sich die inhaltliche Prüfung des Schiedsspruchs anschließen.
(3) Kollisionsrechtlicher ordre public Gegen die zuvor dargestellte Auffassung spricht die Entscheidung des Gesetzgebers, gemäß § 1059 Abs. 3 und 2 Nr. 1 ZPO beziehungsweise §§ 1060 Abs. 2 S. 3, 1059 Abs. 3, 2 Nr. 1 ZPO die Prüfung von Verfahrensfehlern von der begründeten Geltendmachung durch die unterlegene Partei im fristgemäß gestellten Aufhebungsantrag abhängig zu machen.
Der Entwurfsbegründung zur Novellierung des Schiedsverfahrensrechts ist zu entnehmen, dass die „öffentliche Ordnung [... ] auch den ,ordre public international· [umfassen]“ soll.377 Die Vorgängervorschrift § 1041 Abs. 1 Nr. 6 ZPO a.F.,378 nach der das Vorliegen des § 580 Nr. 1 bis 6 ZPO entsprechender Restitutionsgründe statthafte Aufhebungsgründe darstellten, gehe in dieser ebenso auf wie § 1041 Abs. 1 Nr. 3 und 4 ZPO a.F.379 Danach würden der amtswegigen ordre-public- Prüfung diverse strafbare Handlungen unterliegen, welche das Schiedsverfahren untragbar beeinflusst haben. Ferner soll das OLG verpflichtet sein, die ordnungsgemäße Vertretung und Gehörsgewährung der unterlegenen Partei zu prüfen.
Dem stehen die eigenständigen Aufhebungsanträge gemäß § 1059 Abs. 2 Nr. 1 lit. b und d ZPO gegenüber, in denen diese speziellen Verfahrensfehler ebenfalls aufgehen. Insoweit erscheint es inkonsequent, einerseits begangene Verfahrensfehler der eigenverantwortlichen Geltend-
machung durch die Schiedsparteien zu überlassen, andererseits jedoch wieder Teile davon herauszulösen und dem staatlichen Gericht die Prüfung aufzugeben. Dieser Eindruck wird verschärft, wenn der Schiedsspruch zwar der Inhaltskontrolle entzogen sein soll,380 das Gericht der obsiegenden Schiedspartei und dem Schiedsgericht dennoch so viel Misstrauen entgegenzubringen habe, dass es vorsorglich die Aussagen, die eingebrachten Angriffs- und Verteidigungsmittel, die Zeugenaussagen, die sonstigen Prozesshandlungen der Beteiligten und die Tätigkeit der Schiedsrichter im Hinblick auf mögliche verübte Straftaten hin überprüfen möge.
Insoweit will nicht überzeugen, dass § 1059 Abs. 2 Nr. 2 lit. b ZPO überhaupt eine prozessuale Komponente enthalten soll. Bessere Gründe sprechen dafür, allein die materielle Komponente des anerkennungsrechtlichen ordre public und damit den kollisionsrechtlichen des Art. 6 EGBGB von dieser Vorschrift erfasst zu sehen.
Dieser richtet sich, wie bereits in (1) ausgeführt auf die Anwendung ausländischer Rechtsnormen im Herrschaftsbereich deutschen Rechts.381 Rechtsnormen in dieser Hinsicht sind Sachnormen eines anderen Staates, die den dort anerkannten Rechtsquellen entstammen.382 Das „Ergebnis ihrer Anwendung im konkreten Fall“ wird im Rahmen des Art. 6 EGBGB überprüft.383 Bei der Erkenntnis materieller Rechtsverstöße prüft das deutsche Gericht, auf Grundlage der Tatsachenfeststellungen des ausländischen Gerichts, das zur Anwendung gekommene Recht.384 (4) Ergebnis Die antragsgebundene Prüfung von Verfahrensfehlern legt nahe, die verfahrensrechtliche Komponente des dem Wortlaut nach anerkennungsrechtlichen ordre public in § 1059 Abs. 2 Nr. 2 lit. b ZPO dieser Vorschrift zu entziehen und ihr ausschließlich die materielle Komponente zu belassen. Insoweit ist dieser Staatsvorbehalt außerordentlich „anerkennungsfreundlich“,385 muss sich das staatliche Gericht von Amts wegen doch lediglich mit der „negativen Funktion“ der Vorbehaltsklausel, wenn auch auf inhaltlicher Ebene auseinandersetzen. In der Konsequenz ist somit nicht für den Schiedsspruch die Inhaltskontrolle, sondern für das Schiedsverfahren die obligatorische Überprüfung ausgeschlossen, selbst wenn in letzterer Hinsicht strafbare Handlungen verübt worden sind, die in der Regel ordre-public-widrig sein dürften. Es liegt dann in der Verantwortung der Betroffenen, diese sowohl geltend zu machen als gegebenenfalls auch zur Anzeige zu bringen. Der Aufteilung in antragsgebundene und amtswegige Vorbehaltsklausel kann mit Prüfung der objektiven Schiedsfähigkeit, die ausführlich in II 4 und ergänzend in IV 1 b aa behandelt wurde, ein weiteres Element des Staatsvorbehalts identifiziert werden. Zwingendes, nationales Recht, der irreführend so benannte ordre public interne oder national wird gemäß § 1059 Abs. 2 Nr. 2 lit. a ZPO überprüft, dem in religiös geprägten Schiedsgerichten wohl gerade im Familien- und im Strafrecht große Bedeutung zukommen dürfte.386
2. Aufhebungsverfahren
Ein Schiedsspruch wird gemäß § 1059 Abs. 1 ZPO nur auf Antrag aufgehoben. Im Übrigen muss ihn der Unterlegene gegen sich wirken lassen.387 Der Aufhebungsantrag muss fristgemäß erfolgen, ohne nähere Vereinbarung gemäß § 1059 Abs. 3 S. 1, 2 ZPO innerhalb von drei Monaten seit Empfang des Schiedsspruchs. Sofern ein Antrag beim Schiedsgericht auf Berichtigung, Auslegung oder Ergänzung nach § 1058 ZPO gestellt worden ist, verlängert sich die Frist für den Aufhebungsantrag beim OLG gemäß § 1059 Abs. 3 Satz 3 ZPO um längstens einen Monat nach Empfang der Entscheidung des Schiedsgerichts über den Berichtigungs-, Auslegungs- oder Ergänzungsantrag.
Das zuständige OLG hat die Möglichkeit, den Schiedsspruch aufzuheben, wodurch im Zweifel die Schiedsvereinbarung wieder auflebt (§ 1059 Abs. 5 ZPO).388 Die Schiedsparteien können daher zudem einen Zurückverweisungsantrag nach § 1059 Abs. 4 ZPO an das ursprünglich konstituierte Schiedsgericht stellen. Gibt das OLG in geeigneten Fällen dem Antrag statt, so bleibt das Schiedsgericht entgegen § 1056 Abs. 3 ZPO im Amt.389 Kommt in der Regel die Schiedsgerichtsbarkeit ohne Instanzenzüge aus, wenn solches nicht zusätzlich vereinbart ist,390, so könnte das
OLG in solchen Fällen gewissermaßen als »staatliche Revisionsinstanz« bezeichnet werden. Eine révision au fond ist dann im engerem Sinne gemäß § 1059 Abs. 3 S. 4 und § 1060 Abs. 2 S. 2 ZPO ausgeschlossen.391 Wurde also ein Schiedsspruch vom staatlichen Gericht für vollstreckbar erklärt, so ist kein Aufhebungsantrag mehr möglich. Umgekehrt können auch im Verfahren zur Vollstreckbarerklärung keine Aufhebungsgründe mehr geltend gemacht werden, wenn ein vorangegangener Aufhebungsantrag bereits rechtskräftig abgewiesen worden ist.392
V. Zwischenergebnis
Den bisherigen Ausführungen sind Anhaltspunkt zu entnehmen, welche für die objektive Schiedsfähigkeit von Streitigkeiten auch aus den empfindlichen Bereichen des weitgehend zwingend ausgestalteten Familien- und Strafrechts sprechen. Sollte also auch nur potentiell Bedarf an islamischer Schiedsgerichtsbarkeit in diesen Bereichen bestehen, wäre die hier bearbeitete Problematik nicht rein akademischer Natur. Kann das Sonderkollisionsrecht in § 1051 ZPO auf dessen Absatz 3 in Verbindung mit Absatz 4 eingeschränkt werden, so erübrigt sich allerdings die Frage nach der Anwendbarkeit islamischer Vorschriften über Absatz 1.
Ist »islamisches Recht« jedoch als Bindung und Begrenzung der Billigkeitsermächtigung wählbar, so führt die erfolgte Analyse des Staatsvorbehalts auf ein unerwartetes Problemfeld. Zielt § 1059 Abs. 2 Nr. 2 lit. b ZPO allein auf die Inhaltskontrolle des Schiedsspruchs entsprechend dem ordre public des Art. 6 EGBGB, so erfasst er nicht im Inland geltendes Recht. Denn Tatbestandsmerkmal dieser Vorschrift ist die »Rechtsnorm eines anderen Staates «. - Erlangt ein inländischer Schiedsspruch gemäß der deutschen Verfahrensnorm § 1055 ZPO materielle Rechtskraft, wird er jedoch selbst zur inländischen Rechtsnorm und würde somit aus dem Anwendungsbereich der amtswegigen ordre-public-Prüfung herausfallen. Ferner stellt die Ermächtigung zur Billigkeitsentscheidung keinen Verfahrensfehler dar, der im Aufhebungsantrag geltend gemacht werden könnte. Ein mit Willen der Parteien ergangener Schiedsspruch wäre also auch in dieser Hinsicht nicht zu beanstanden. Der Vorbehalt zwingenden deutschen Rechts in der objektiven Schiedsfähigkeit greift bereits vor der Bildung des Schiedsgerichts ein und richtet sich auf den Streitgegenstand, nicht die Entscheidungsgrundlage. Stellt das OLG gemäß § 1059 Abs. 2 Nr. 2 lit. a ZPO auch nachträglich einen Verstoß gegen den »ordre public interne« als Schiedsunfähigkeit fest, kommt das doch stets der Nichtigkeitserklärung einer Schiedsvereinbarung ex tunc gleich und betrifft nicht das Ergebnis des Schiedsverfahrens. Die Vereinbarkeit des Schiedsspruches mit höherrangigem Recht wäre somit schwer zu überprüfen.
Eine Lösung des Problems wäre, den Staatsvorbehalt vor der Rechtskraftwirkung des § 1055 ZPO anzusetzen. Dafür spricht, dass die Aufhebung letztlich zum Entzug der Rechtskraft führt, also einer Nichtigkeitserklärung des Schiedsspruchs von Anfang an gleichkommt, seiner Dequalifikation als Recht. Zieht der ordre public jedoch weiterhin die äußerste Grenze jeglichen inländischen Schiedsspruches, so darf auch die Billigkeit nur in geordneten rechtlichen Bahnen ablaufen, um von diesem allein kollisionsrechtlichen Vorbehalt bereits potentiell überhaupt erfasst werden zu können. Stellt man das Merkmal »ausländisch« zurück, müsste die Billigkeitsentscheidung selbst zumindest schon einmal Recht sein.
Wird »islamisches Recht« als Bindung und Begrenzung des Ermessenspielraums zur Billigkeitsentscheidung ermächtigter deutscher Schiedsgerichte vereinbart, so stellt sich zudem das in der Schlussfolgerung Adolphsens und Schmalenbergs liegende Problem, ob sich die Schieds- parteien damit letztlich doch ganz der Willkür ihrer Richter unterwer- fen.393 Unter Berücksichtigung des Ergebnisses unter III 3 c, wonach die Schiedsrichter dem gewählten Bezugsrahmen der Parteien verpflichtet sind, wäre diese Frage grundsätzlich zu verneinen. Letzteren würde jedoch bei ausgeschlossener ordre-public-Prüfung ein Rechtsmittel gegen eine möglicherweise willkürlich-unbillige Entscheidung verloren gehen, zumal ein Überschreiten der Billigkeitsermächtigung schwer nachzuweisen sein wird. Die Wirkung dieser Wahl steht demnach ebenfalls noch zur Klärung an.
Die Qualifizierung der Billigkeit und die Bindungswirkung des hiesigen Bezugsrahmens soll daher in C vertieft werden, um in D eine Entscheidung über die Reichweite des Staatsvorbehalts treffen und damit den Einfluss »islamischen Rechts« auf das schiedsrichterliche Verfahren abschließend klären zu können.
C. Qualifizierung der Billigkeit und der Wirkung des »islamischen Rechts«
Meinst Du? Dann nimm das Universum und mal es, bis es zu einem ganz feinen Pulver wird, und dann filtere es durch das feinste Sieb, und dann zeig mir auch nur ein Atom Gerechtigkeit, ein Molekül Gnade. Und doch ... Tod winkte mit einer Hand. Und doch verhalten sich die Menschen so, als gäbe es eine ideale Ordnung in der Welt, eine ... Richtigkeit im Universum, die als Massstab der Dinge gelten könnte.394
Die rechtsdogmatische Analyse im vorangegangenen Kapitel hat zwei Problemkreise nicht vollständig klären können: 1) Wie ist die Billigkeitsentscheidung und an sie gekoppeltes »islamisches Recht« zu qualifizieren? 2) Kann der Staatsvorbehalt in § 1059 Abs. 2 Nr. 2 lit b ZPO bei Billigkeitsentscheidungen greifen?
Das erste Problem stellt sich als Frage des zweiten und führt wieder zu der Frage zurück, ob islamische Vorschriften ohne staatliche Bindung Recht sind. Dies lässt sich normativ beantworten, indem als Recht gilt, was in einem Staat zur Anwendung kommt. So kann jedoch nur die Vereinbarkeit nach § 1051 Abs. 1 ZPO ausgeschlossen werden. Damit löst sich noch nicht das zweite Problem, die Inhaltsprüfung des Schiedsspruchs. Auch dieses lässt sich zwar pragmatisch aus der Welt schaffen, indem entweder die Inhaltsprüfung ausgeschlossen wird. Dann läuft, wie gesehen, die Norm ins Leere. Wird indes die amtswegige Prüfung auf Bereiche des § 1059 Abs. 2 Nr. 1 ZPO willkürlich ausgedehnt, sind die gesetzlich vorgesehenen Rechtsbehelfe nicht mehr eindeutig voneinander abzugrenzen.
Die rechtstheoretische Entwicklung eines nicht normativen Rechtsbegriffs kann an dieser Stelle womöglich weiterhelfen. Mit ihm umgeht man den Vorwurf, schon die Begriffsbestimmung von Recht an sich, nicht lediglich seine normative Ausgestaltung, liege allein im Auge des die Definitionshoheit inne habenden Betrachters.
Problematisch ist dann jedoch die Wahl der Perspektive. Das Phänomen »Recht« wird in unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen von verschiedenen Seiten beleuchtet und erscheint daher, abhängig vom jeweils erkenntnisleitenden Interesse, stets in einem anderen Licht und somit auch in unterschiedlicher Gestalt. Was jeweils als unwesentlich erachtet wird, tritt hinter die in Betracht gezogenen Details zurück. Es kann seine Funktion in der Gesellschaft beschrieben und somit eine distanzierte soziologische Sicht auf das Recht bevorzugt werden. Aus politikwissenschaftlicher Warte mag das Spannungsverhältnis zwischen dynamischer Politik und ihrem als „geronnene Politik“ erscheinenden statischen Gegenstück im Vordergrund stehen.395 Wird dem Wesen des Rechts auch in der (Rechts-)Philosophie oder Rechtstheorie nachgespürt,396 so dominiert in der Rechtswissenschaft doch vor allem die rechtsdogmatische Perspektive. Aus dieser Warte nimmt die Rechtswissenschaft für sich in Anspruch, die wahre Expertise zur Erkenntnis der inneren Gestalt des geltenden Rechts zu besitzen, welche die theoretische Ergründung des Rechts hinter dessen praktischer Anwendung zurücktreten lässt.397 Ein Außenstandpunkt kann der Rechtsdogmatik nicht geeignet erscheinen, um einen für sie handhabbaren Begriff hervorzubringen.
Dass dem nicht so sein muss, soll die folgende Auseinandersetzung in I zutage fördern. Darin soll erneut gezeigt werden, dass der Ansatz des zum Soziologen gewandelten Rechtswissenschaftlers und Juristen Luhmann vom »Recht der Gesellschaft« eine objektive Begriffsbestimmung ermöglicht, die selbst rechtswissenschaftliche Rechtstheorie ist, weil andere, sich widersprechende Ansätze aus der Rechtsphilosophie in ihr vollständig aufgehen und dennoch ein eigenständiger Erkenntniswert zurück- bleibt.398 In II und III soll dessen praktische Anwendbarkeit für die Frage nach der Qualifikation von Billigkeit und islamischer Vorschriften erprobt werden. Im darauf folgenden Kapitel wird sodann der Anschluss an die Rechtsdogmatik hergestellt, indem die zweite Frage aufgegriffen und geklärt wird.
I. Entwicklung eines rechtsdogmatisch anschlussfähigen, systemtheoretisch begründeten Rechtsbegriff
Im Folgenden wird nach Einführung einiger Grundbegriffe zunächst Kants vernunftrechtliche Position dargestellt. Im Anschluss werden nicht-positivistische und positivistische Rechtsbegriffe weiterer exemplarischer Vertreter der deutschen Rechtswissenschaft beleuchtet. Sodann wird der Versuch unternommen, diese Positionen durch die Systemtheorie zu vereinnahmen. Ziel ist es, einen für die Rechtsdogmatik anschlussfähigen Rechtsbegriff herauszuarbeiten, der sich zugleich nicht der interdisziplinären Falsifikation durch die Wissenschaft entzieht.
1. Grundbegriffe
Dem begrenzten Umfang dieser Arbeit ist es geschuldet, die unten ab dem Gliederungspunkt 5 vorausgesetzten Begriffe vorab lediglich einzuführen, ohne an ihnen das Theoriekonzept selbst zu erläutern. Das soll mittels der unten vorgenommenen Konsumtion der rechtsphilosophischen Konzepte Kants, Kelsens, Radbruchs und Alexys durch das Modell Luhmanns geleistet werden. So wird in diesem Gliederungspunkt einiges an Bereitschaft abverlangt, die eingeführten Begriffe zunächst hinzunehmen. Um aufkeimenden Klärungsbedarf dennoch zu befriedigen, sei auf den Exkurs im Anhang verwiesen,399 mit dem zu Beginn der Bearbeitungszeit dieser Thesis ausgehend von zunächst formallogischen Erwägungen, hauptsächlich auf Grundlage einer transkribierten Einführungsvorlesungsreihe Luhmanns,400 das Begriffsmodell sozusagen als »Protokoll des Denkversuchs« skizziert worden ist. Die Skizze selbst wurde bei der Entscheidung für ihre Auslagerung im Entwurfsstadium belassen, ist aber dennoch inhaltlich abgeschlossen. Auf einzelne ihrer Punkte wird im Laufe dieses Teils zur Vertiefung in den Fußnoten verwiesen.
a) Begriffe der Normenlogik
Ist Rechtswissenschaft als Normwissenschaft zu begreifen,401 so muss sich ihre Methodik an der deontischen, der Normenlogik ausrichten, die auf Aussagen- und Prädikatenlogik aufsetzt. In dieser werden auf der formalen Ebene Normen als Normsätze analysiert und zur Auflösung von Normwidersprüchen in Beziehung zueinander gesetzt.402 Dabei setzt sich ein Normsatz zusammen aus einem Operator, der den normativen Anteil (geboten, erlaubt, verboten) symbolisiert, sowie der durch ihn normierten Handlung und den Normadressaten, auf welche sich die Norm richtet: normativer Operator[Handlung(Normadressat)]. 403 Der Operator und der Inhalt der eckigen Klammern können unabhängig voneinander negiert werden, sodass mit einem, etwa dem Gebotenheitsoperator O (obliged) alle konträr, subkonträr, subaltern und kontradiktorisch entgegengesetzte Normen dargestellt werden können. Fasst man den Klammerinhalt zur Variable a zusammen, und symbolisiert '—' die Negation, so wäre etwa eine gebotene Handlung O(a) und eine verbotene Handlung O(—a).404
Der Normsatz ist als solcher Aussage über die Existenz einer Norm in einem Normensystem. Danach gilt eine Norm, wenn der Normsatz 'wahr' ist.405 Die Norm selbst ist in diesem absoluten Sinne weder 'wahr' noch 'unwahr', sondern geht auf einen Wertungsvorgang zurück, dem nur in der Welt, in der sie existiert, eine interne Logik beigemessen werden kann.406 Logisch lässt sich jedoch weder begründen, warum eine Norm in einer Welt gilt und in einer anderen nicht, noch lässt sich der Inhalt des Satzes vom zureichenden Grund durch ein Aufsteigen zur ersten Norm, aus der alle weiteren folgen, sicher bestimmen.407 Diese Lücke scheint, durchaus mit den in der Logik stattfindenden Erwägungen vereinbar, von der Systemtheorie geschlossen werden zu können. Ohnehin erscheint es sinnvoll, soweit von Normensystemen gesprochen wird, eine Theorie zu befragen, deren Erkenntnisgegenstand Gesellschaftssysteme sind.
b) Begriffe der Systemtheorie luhmannscher Prägung
Wie angekündigt sollen hier nur die weiter unten verwendeten Begriffe definiert werden, auch wenn die komplexe Terminologie der Systemtheorie Luhmanns so gedrungen schwer verdaulich ist.408 Wie in ihrer Anwendung zu sehen sein wird, ermöglicht sie jedoch die Formulierung von Argumenten, wo die einfache Logik sprachlos bleibt.
In ihr werden Systeme409 als sich strikt von ihrer Umwelt unterscheidende Phänomene betrachtet, die diese Unterscheidung selbst vornehmen, die Bedingung für ihre Existenz also selbst setzen. In ihnen können sich in dieser Weise weitere Systeme ausdifferenzieren. Umwelt wird dadurch ein relativer Begriff, der alles übrige, auch die abgegrenzten Subsysteme des Gesamtsystems im Verhältnis zum jeweils betrachteten umfasst.
Die Besonderheit des Begriffsmodells dieser Theorie zeichnet sich durch die Differenzierung von Raum und Zeit aus. Ein System ist daher identisch mit seiner Operation, die räumlich wahrnehmbare Strukturen erzeugt, welche durch ihre fortlaufende Vervielfältigung auch in der Zeit wahrnehmbar sind. Auch die beiden zuletzt eingeführten Begriffe sind wesensgleich. 'Struktur' zielt auf die in der Vergangenheit abgelaufenen Operationen. Letztere ist der Gegenwartszustand des Systems, der für seine eigene Vergangenheit und eine mögliche Zukunft blind verläuft. Diese zeitliche Komponente wird mit 'Autopoiesis' bezeichnet.410
Die Operation nimmt eine Unterscheidung nach dem immer gleichen Schema vor: 'System/Umwelt'. Die in den Subsystemen eines Gesamtsystems ablaufenden Unterscheidungen differenzieren die Grundunterscheidung aus, sodass ihr Schema als 'Subsystem/Gesamtsystem' erscheint. Die Subsysteme erfüllen so die Funktion der Selbstorganisation des Systems.
Systeme werden als strukturell geschlossen beschrieben. Damit ist gemeint, dass ihre strikte Abgrenzung keine Überschneidungen zulässt, es kann also keine Operation eines Systems in das des anderen importiert werden. Dennoch sind sie untereinander durch strukturelle Kopplungen vernetzt, über die ein STRUKTURimport verläuft.411 Strukturen anderer Systeme treten als Information ein, deren Verarbeitung auf der Zeitebene stattfindet, worin der als SYSTEMintern wahrgenommene Anteil erkannt und zur Struktur verarbeitet wird. Der übrige iNFORMATiONsgehalt wird ignoriert.
Da die Operation blind verläuft, findet die iNFORMATiONsaufnahme und -Verarbeitung auf einer anderen Ebene statt, auf der das System in der Zeit wahrgenommen werden kann, die Beobachtung. Diese kann sowohl selbstreferenziell, als auch von außen stattfinden. Die Beobachtung erster Ordnung412 ist das sich selbst beobachtende System. Auch sie ist eine Operation des beobachteten Systems. Tritt diese nicht nur für den Augenblick der Gegenwart als einmaliges Ereignis auf, sondern vervielfältigt sich selbst in der Zeit, konstituiert sie sich als System, das die Gegenwart von der Vergangenheit unterscheidet. Seine eigene Autopoiesis nimmt es nicht wahr, sie ist sein »blinder Fleck«. Zu seiner SelbstBEOBACHTUNG differenziert es ein weiteres Subsystem aus. Im Verhältnis zum in erster Ordnung beobachteten System ist dies die Beobachtung zweiter Ordnung, die »Beobachtung des Beobachters«. Subsysteme sind also stets Beobachter, die, wie bereits angesprochen, im GesamtSYSTEM die Funktion der Selbstorganisation erfüllen. Ihrer Funktion kommen sie durch ihren Wiedereintritt in das beobachtete System nach, an das sie einen, hier so genannten, Rückgabewert liefern, der sich dort auf die weiterlaufenden Operationen auswirkt. Die Einheit und Unterscheidung der genannten Systeme soll an folgendem Schaubild im Ansatz skizziert werden:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die Fremdbeobachtung erfolgt in dieser Darstellung aus einem anderen Subsystem des GesamtSYSTEMS heraus. Die Vielzahl der Ebenen soll nicht eine ins unendliche gesteigerte Rekursion symbolisieren, sondern auf die Relativität der Bezeichnung hindeuten. Die Beobachtung des beobachtenden Beobachters erfolgt in dritter Ordnung, wenn das hier bezeichnete Subsystem referenziert ist. In einem anderen Zusammenhang ist das hier in dritter Ordnung beobachtende System wiederum selbst BEOBACHTUNGSgegenstand.
Die SYSTEMbildende Unterscheidung ist der Code der Operation. Die Bedingungen, nach denen differenziert wird, ist dessen Programm, das in zweiter Ordnung beschrieben wird und ein Subsystem vom anderen abgrenzt.
Fügt man Raum- und Zeitdimension wieder zusammen, lösen sich die begrifflichen Unterscheidungen der Systemtheorie wieder auf, und das GesamtSYSTEM kann nur noch als Einheit wahrgenommen werden. Struktur ist also strukturelle Geschlossenheit, ist Selbstorganisation, ist Operation, ist Code, ist Programm, ist System.
Luhmann sieht als SYSTEMbildende Unterscheidung des GesellschaftsSYSTEMS die Kommunikation. Sie ist sowohl wesensverschieden von biologischen als auch von psychischen Systemen. Erstere folgen blind ihrem Code und sind nicht zur Selbstreflektion fähig. Letztere sind es, ihre Strukturen bilden sich jedoch in ihrer individuellen Wahrnehmung, nach der Unterscheidung 'Ich/Nicht-Ich' heraus. Die Kommunikation über das Medium 'Sprache' und weiterer Medien unterscheidet sich davon, dass sie ein System außerhalb des Individuums konstituiert. Insoweit sind Teilnehmer des sozialen GesamtSYSTEMS nur miteinander kommunizierende Menschen; als Individuum hingegen mit diesem gekoppelte, wesensfremde Umwelt (unter Angabe der Systemreferenz 'Gesellschaft').
2. Kants Rechtslehre
Kants Rechtslehre stützt sich auf den Begriff der »Freiheit«, deren Gesetze er denen der Natur gegenüberstellt.413 Er nennt diese Freiheitsgesetze „moralisch“.414 Sie gehen für ihn auf den einen »kategorischen Imperativ«, das unbedingte verpflichtende „[Gebot] der Sittlichkeit“415 zurück, der das Verhalten eines jeden notwendig leite, weshalb sämtliche weiteren allgemeingültigen moralischen Gesetzen aus diesem deduziert werden können.416
Moralische Erkenntnis sei gerade nicht kontingent, sondern gründe auf dem Grundprinzip der Pflicht an sich, anderen und sich selbst gegenüber Gutes zu tun, ohne Eigennutz oder persönliche Freude daran.417 Durch solche Handlungen werde die Existenz eines jeden vernünftigen Wesens als „Zweck an sich“418 anerkannt, sodass die Möglichkeiten individueller Handlungen, auch sich selbst gegenüber, auf das notwendige Maß eingeschränkt werden, in welchem diese Pflicht an sich von jedem verwirklicht werden kann.419 Werde die Pflicht in dieser Form erfüllt, so beruhe die Entscheidung für dieses Maß auf der autonomen Willensbildung des Individuums, welches sich von wesensfremden Erwägungen frei macht.420 In einer der Fassungen seiner Formel subsumiert Kant dies alles unter: „[H andle] so, als ob die Maxime [Anm.: das persönliche Leitprinzip] deiner Handlung durch deinen Willen zum allgemeinen Naturgesetze werden sollte.“421
Er will folglich den Nachweis erbringen, dass die allein der Vernunft entspringenden Freiheitsgesetze,422 sich mit dem gleichen Universalitätsanspruch erkennen lassen, wie die Naturgesetze in der physischen Welt. Dieser Erkenntnisvorgang führt ihn zum genannten Grundprinzip, das in theologischer Hinsicht im Gottesbegriff aufgehe, dem „Urbild des Guten“.423 Indem Kant seine Moralphilosophie aus dem Kontext von Theologie und Physik herauslöst424 und allein im menschlichen Verstand ver- ortet, emanzipiert er sie in zweifachem Sinne. Einerseits ist sie säkularisiert, der Bindung an die Kirche entledigt.425 Andererseite verliert sie auch ihre weltlichen Bindungen insoweit, als dass er sie eben nicht der Natur zuordnet. Freiheitsgesetze erheben für Kant im Geiste eines jeden vernünftigen Wesens den gleichen Anspruch auf Allgemeingültigkeit, wie die Naturgesetze. Letztere wirken jedoch außerhalb des Geistes, erstere darin. Der Begriff »Freiheit« im kantischen Sinne erscheint demnach als autonome Selbstbeschränkung des Einzelnen auf das Maß der moralisch notwendig gebotenen Handlungen, oder zirkulär formuliert: Freiheit ist die Freiheit des Einzelnen das Richtige zu tun, welches er nur durch seine Freiheit erkennen kann.
Ein „negatives“ Prinzip der Freiheit erfasst nach Kant zunächst ihre transzendente Idee, welche erst in ihrer praktischen Anwendung, der Umsetzung dieser Idee, als Willensfreiheit bestimmbar wird. Als solche bringt sie die Handlungsfreiheit als „positiven Begriffe“ hervor, uneigennützig und auch ansonsten neigungslos den persönlich als universell erkannten Pflichten unbedingt Folge zu leisten.426 Die Mehrdeutigkeit des Ausdrucks lässt sich also in der zuvor genannten paradoxen Begriffsbestimmung wie folgt auflösen: Freiheit ist die positive Freiheit des Einzelnen (d.i. die Handlungsfreiheit, sich selbst Pflichten zu setzen), deren Voraussetzung die negative Freiheit ist (d.i. die Willensfreiheit, diese Pflichten zu erkennen).
Die Notwendigkeit eines jeden zur freien Handlung gemäß den Freiheitsgesetzen definiert Kant als „Verbindlichkeit“.427 Sei eine Handlung unverbindlich, so sei sie „erlaubt“; diese konkret nicht beschränkte Handlungsfreiheit sei „Befugnis“. Eine verbindliche Handlung ist im kantischen Sinne „Pflicht“, und „Tat“, wenn sie vollzogen wird; diese sei dem Handelnden „zurechenbar“, wenn er vorher seine Pflicht kannte. „Person“ sei der Handelnde, soweit ihm seine Tat zurechenbar ist, welchem die „Sache“ gegenüberstehe; letztere sei keiner Zurechnung fähig, daher „Objekt der freien Willkür, welches selbst der Freiheit ermangelt“. Eine Tat sei „Recht“, wenn sie pflichtgemäß, folglich „Unrecht“, wenn sie pflichtwidrig ist; letztere sei eine „Übertretung“.
In dieser allgemeinen Definition verläuft also die Grenze zwischen Person und Sache bei der Zurechenbarkeit und damit der Fähigkeit, freie Entscheidungen für pflichtgemäße Taten zu fällen. Ferner folgt aus dem kategorischen Imperativ zwingend, dass allein die im Verstand der Personen individuell deduzierten Freiheitsgesetze jeweils für sie verbindlich sind.428 Streng genommen ist insoweit Recht bei Kant zunächst vom Individuum selbst gesetzt, es kann daher nur seine eigenen Gesetze übertreten. Gelten diese individuellen Gesetze jedoch universell in dem Verstand eines jeden vernunftbegabten Wesens, so werden sich im kantischen Modell die individuellen Pflichten gleichen und so die Kollision individueller Willkür auflösen.
Aus diesem Grund sieht Kant das Recht als den „Inbegriff der Bedingungen, unter denen die Willkür des einen mit der Willkür des andern nach einem allgemeinen Gesetze der Freiheit zusammen vereinigt werden kann"429 Daraus folge die Kehrseite des Rechts, die wechselseitige Befugnis, pflichtgemäße Handlungen zu erzwingen; dieses Zwangselement ermögliche erst die Konstruktion des Rechtsbegriffes.430
Dem zwingenden Recht stellt er „Recht ohne Zwang" sowie „Zwang ohne Recht“ gegenüber, „die Billigkeit und das Notrecht“.431 Ersterem fehlt Kant der Rechtscharakter, da eine unbestimmte Gerechtigkeit nicht von Dritten, den Gerichten, erwogen werden dürfe, die ihre Entscheidungen stattdessen auf das strikte, zwischen den Beteiligten eindeutig bestimmbar wirkende Recht stützen müssen und somit der Einzelfallgerechtigkeit nicht zur Durchsetzung verhelfen können.432 In Bezug auf letzteres verdeutlicht er am Dilemma der zwei Schiffbrüchigen auf dem für beide nicht ausreichend Platz bietenden »Brett des Karneades«433 die Unrechtsqualität des Notrechts.434 Die Tat des Einen, sein eigenes Leben um den Preis des Anderen Ertrinkens zu retten, ist somit eine pflichtwidrige Handlung. Der Konflikt der Pflichten, sowohl das Leben des anderen, als auch das eigene zu bewahren, löst das Dilemma allein durch Straflosigkeit. In moderner strafrechtlicher Terminologie ist die Tat ungerechtfertigte Erfüllung des einschlägigen Straftatbestands, der hiesige Konflikt jedoch ein Entschuldigungsgrund.435 Billigkeit sei folglich lediglich subjektiv empfundenes Recht sowie, aus Sicht des Leidtragenden, das Notrecht subjektiv empfundenes Unrecht, die nach den objektiven „Gründen der Rechtsausübung“ zu jeweils entgegengesetzten Entscheidungen führen müssen.436
Recht im engeren Sinne ist nach Kant demnach allein das objektiv erkennbare. Es ist dies (1) die wechselseitige Beziehung ihre gegensei- tige Willkür um des anderen Willen beschränkender Personen, die (2) auf universellen Gesetzen beruht, die jede Person sich selbst erschlossen hat und (3) durch diese äußerlich wirkende Beziehung wahrnehmbar und damit bestimmbar wird, weshalb es (4) mit Zwang durchsetzbar ist. Das persönlich empfundene, nur innerlich wirkende Recht sei von diesem wesensverschieden, weshalb die vermeintliche Paradoxie aus der Mehrdeutigkeit des Ausdrucks „Recht“ resultiere,437 welche anders als der doppeldeutige Freiheitsbegriff nicht aufgelöst werden kann.
Weitere Inhaltsbestimmungen des Rechtsbegriffs führt er in seiner „Allgemeinen Einteilung der Rechte“ ein; Recht im Sinne einer Gesamtheit, „[systematische] Lehren“, sei „das Naturrecht [...] und das positive Recht“; ersteres beruhe auf den Freiheitsgesetzen, letzteres auf dem Willen eines Gesetzgebers.438 Das zu Kants Zeiten bereits mit einem festen Begriff besetzte Naturrecht dürfte der Wortwahl wohl zugrunde liegen, auch wenn dieses Recht wie gesehen nicht der Natur entspringen kann, in der Naturgesetze wirken. Sie gehören allenfalls der Natur des Geistes an, in welchem sie im Kalkül natürlichen Schließens deduziert wurden. Unmissverständlicher ist daher die Bezeichnung 'Vernunftrecht'.439
Ferner spricht Kant von dem individuellen Recht, ein Tun oder Unterlassen von einem Gegenüber fordern zu können, dem Anspruch also,440 welcher sich bereits oben im Inbegriff der wechselseitig die Willkür des jeweils anderen einschränkenden Bedingungen widerspiegelt.
Für ihn ist schließlich jegliche Gesetzgebung, also im Vernunft- und im positiven Recht, „ethisch“ zu nennen, die Pflichten bestimmt, welche aus sich heraus zu erfüllen sind; jene Gesetze, die Pflichten mit anderer „Triebfeder“ bestimmen, nennt Kant „juridisch“.441 In diesem Sinne bringt die Befolgung juridischer Gesetze legale Handlungen hervor, die Befolgung ethischer Gesetze darüber hinaus sittliche Taten.442
Das Modell verspricht die sichere Erkenntnis von Recht und Unrecht anhand universeller Wahrheiten, die von jedem der Vernunft abgerungen werden können. Seine Strahlkraft lässt sich etwa an der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ablesen,443 ebenso am bereits angeklungenen § 35 Abs. 1 Satz 1 StGB, dem entschuldigenden Notstand sowie im Allgemeinen letztlich an der objektiven Zurechnung des Handlungserfolgs im Strafrecht.444
3. Verbindungs- und Trennungsthese
Ist auch die Rechtslehre der Philosophie Kants ein prägender Einfluss nicht nur des deutschen Rechts und seiner Wissenschaft, so ist sie doch nur eine Marke in einem vorher und nachher geführten Diskurs über das Zusammenspiel von Recht und Moral: Diese beiden können nur entweder ein Ganzes bilden oder wesentlich verschieden voneinander sein.445
a) Kant
Wie gesehen vertrat Kant eine Verbindungsthese: Recht in seinem objektiven, engeren Sinne enthält Vernunftrecht und positives Recht. Soweit das Vernunftrecht keine Billigkeit, kein als subjektiv empfundenes Recht beinhaltet, weil diesem das Zwangselement fehle, so kann infrage stehen, ob das moralische Vernunftrecht dann gerecht ist.446 In seinem Beispiel ist einem Gesellschafter der höhere Verlust nicht von seinen Partnern auszugleichen, was im Einzelfall billig wäre, sondern von ihm allein zu tragen, was im Beispiel Recht sei, weil keine Regelung zum Verlustausgleich für Dritte erkennbar wird; ein Richter hat keinen Ermessensspielraum zur Bestimmung eines nach seiner Empfindung gerechten Maßes.447 Ist aber das von den Gesellschaftern selbst gesetzte Recht Vernunftrecht Ergebnis von Schlussfolgerungen, die diese unter Anerkennung des jeweils anderen als Zweck an sich nachvollzogen haben, so müssten sie auch die Pflicht erkannt haben, die im Einzelfall unbillige, weil ungleiche Verlustverteilung ausgleichen zu müssen. Fällt die Billigkeit allein wegen mangelnder Durchsetzungsfähigkeit aus dem Rechtsbegriff heraus, obwohl ihre Missachtung im zwischen den Personen unmittelbar wirkenden Vernunftrecht eine Übertretung darstellt, so reduziert Kant den Umfang seines Begriffs um dieses Element subjektiv empfundener ausgleichender Gerechtigkeit. Aus mangelnder Bestimmtheit folgende Zwanglosigkeit grenzt bei ihm mithin den Teil der Vernunftgesetze vom Recht ab, welche die Parteien moralisch, aber nicht rechtlich verpflichten. Die „äußere Gesetzgebung“, zu der jedes vernunftbegabte Wesen berufen ist, stellt das Recht dar, welches Teil der inneren ist; Kant beim Wort genommen ist Recht demnach ausschließlich positivierte Ethik.448 Soweit Gerechtigkeit, welcher Ausprägung auch immer,449 von berufenen Gesetzgebern nicht konkret sprachlich, also äußerlich wahrnehmbar fixiert wurde, kann sie in diesem Modell kein Recht sein. Insoweit lässt sich Kants Ansatz auch der „Inkorporationsthese“ zuordnen, wonach sich aus Sicht der Befürworter einer strikten Trennung von Recht und Moral gerade kein notwendiger Zusammenhang dieser beiden ergibt.450
b) Radbruch
Greift man zeitlich zur Verbindungsthese Radbruchs vor, so wird deutlich, welche Schwierigkeiten dieser Ausschluss bereitet, wenn die staatliche Gesetzgebung und Rechtspflege so katastrophal versagt wie im Dritten Reich und das Vernunftrecht weit überwiegend der äußeren Gesetzgebung entzogen wird. Unter diesem Eindruck definiert er Recht als „Wille zur Gerechtigkeit“ deren Begriff er wiederum als das Gleichbehandlungsprinzip bestimmt, welches für ihn gerade als nicht positivierter Rechtsgrundsatz im Vernunftrecht aufgeht.451 Dieses stehe als Korrektiv über den staatlich erlassenen Gesetzen.452 Das folglich über-gesetzliche Recht bestimme die Rechtsnatur der positiven Gesetze.453 Radbruch stellt somit die kantisch ethische, innere Gesetzgebung des freien Individuums über die juridisch, äußere des Staates und macht erstere zum notwendigen Bestandteil der letzteren. Das Problem der Bestimmtheit und Durch- setzbarkeit des nicht-positivierten Rechts sieht er in der Formel eines „ein [...] unerträgliches Maß“ erreichenden Widerspruchs des „positiven
Gesetzes zur Gerechtigkeit“ gelöst; hinter letztere trete dann die Rechtssicherheit zurück.454 Bei ihm bestimmt folglich das Vernunftrecht an sich Umfang und Inhalt des Rechtsbegriffs. Positive Gesetze müssen sich daran messen lassen, um Rechtsnatur zu erlangen.455
c) Alexy
Alexy nimmt dieses für ihn abgeschwächte „Unrechtsargument“ aus der Radbruchschen Formel in seine Definition von Recht auf:456
Das Recht ist ein Normensystem, das (1) einen Anspruch auf Richtigkeit erhebt, (2) aus der Gesamtheit der Normen besteht, die zu einer im großen und ganzen sozial wirksamen Verfassung gehören und nicht extrem ungerecht sind, sowie aus der Gesamtheit der Normen, die gemäß dieser Verfassung gesetzt sind, ein Minimum an sozialer Wirksamkeit oder Wirksamkeitschance aufweisen und nicht extrem ungerecht sind, und zu dem (3) die Prinzipien und die sonstigen normativen Argumente gehören, auf die sich die Prozedur der Rechtsanwendung stützt und/oder stützen muß, um den Anspruch auf Richtigkeit zu erfüllen.457
Er versucht hier die Argumente für eine Trennung von Recht und Moral mit jenen der Vertreter einer Verbindungsthese zu vereinen. Ihm kommt es darauf an, eine juristische Definition aus der „Teilnehmerperspektive“, der Innenansicht des Rechts in der Wahrnehmung eines entscheidenden Richters,458 zu formulieren. Anders als in der Außensicht aus der „Beobachterperspektive“459 erscheine dort die Verbindung von Recht und Moral zutreffend.460
In seiner Begriffsbestimmung trennt er sich vom Ausdruck „Gesetz“ und stellt stattdessen die Norm in den Mittelpunkt. Auf diese Weise tritt der Begriff der Positivität in den Hintergrund, welcher allzu leicht die Vorstellung von Recht auf das „statutarische“461 einschränkt.462 Da454 455 456 457 458 459 460 461 462 im Recht jedoch sämtliche Normen zusammengefasst sind, die sich wechselseitig bedingen, muss es als gesamtes Normensystem betrachtet werden.463 Der Radbruchsche Ansatz, ordnungsgemäß gesetzten Normen unter vernunftrechtlichen, also moralischen Gesichtspunkten die Rechtsnatur abzusprechen, diene aus der Teilnehmerperspektive dem Konsistenzerhalt des Normensystems 'Recht'.464 Ein Normensystem und die in ihm enthaltenen einzelnen Normen seien nur dann als Recht zu klassifizieren, wenn sie einen Anspruch auf Richtigkeit erheben.465 Alexy will den Beweis dafür erbringen, indem er die Wirkung „performativer Widersprüche“ also logischer Paradoxien466 nachvollzieht. Implizieren die Begriffe 'Verfassung' und 'Rechtsnorm' den Anspruch auf Richtigkeit, so würde eine Retorsion467 der Form, 'diese Verfassung, diese Rechtsnorm, diese Entscheidung ist unrichtig' den „begrifflichen Fehler“ im „Sprechakt“ offensichtlich werden lassen.468 Ein Ausdruck ist semantischer Unsinn der lautet: »Dieser Satz ist falsch.« Syntaktisch zwar sinnvoll, kann ihm doch für sich genommen kein Wahrheitswert zugewiesen werden, der mit seinem Inhalt übereinstimmt.469 Das gleiche sieht Alexy in folgendem Eingeständnis eines Gerichts verwirklicht:
Der Angeklagte wird, was eine falsche Interpretation des geltenden Rechts ist, zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt.470
Im Recht kann eine Folge nur eintreten, wenn ihre Bedingungen erfüllt sind. Wird eine Strafe verhängt, ohne die Voraussetzungen zu erfüllen, kann die Entscheidung von vornherein nicht richtig, also auch kein Recht sein; daraus folgt die weitere Tautologie: Wird der Richtigkeitsanspruch schlicht nicht beachtet, ohne ihn ausdrücklich paradox auszuschließen, entsteht fehlerhaftes Recht.471
Sodann folgt der eigentliche Versuch, in seiner Definition Trennungsund Verbindungsthese zu vereinnahmen, indem Alexy auf zwei Ebenen die soziale und rechtliche Wirksamkeit oder Geltung des Rechts mit der463 464 465 466 467 468 469 470 471 inhaltlichen Richtigkeit, der Konsistenzprüfung im Radbruchschen Sinne koppelt. Er rekurriert auf „entwickelte [stufenförmige] Rechtssysteme“ deren soziale Wirksamkeit diejenige der ihnen zugrunde liegenden Verfassung bedingt.472 473 474 Das Soziale in diesem Kontext liege im überwiegend normgerechten Verhalten der Rechtsunterworfenen, seien sie durch staatlich organisierten Zwang genötigt oder aus anderen Gründen rechtstreu. Der „Begriff der rechtlichen Geltung im engeren Sinne“ beziehe sich auf die ordnungs- also verfassungsgemäße Setzung der Normen und damit ihre Zugehörigkeit zum jeweiligen Rechtssystem.475 Hier gesteht Alexy die Notwendigkeit der Konstruktion einer Grundnorm ein, da die Verfassung zwar rechtliche Geltung begründet, ihr originärer Geltungsgrund jedoch ansonsten unklar bleibt. Soweit bewegt er sich noch im Terrain der Trennungstheoretiker.
Den Übergang bildet seine Auseinandersetzung mit Kelsen (zu diesem sogleich) und Kant. Er kritisiert den analytischen Grundnormansatz des Ersten in Teilen. Im Ergebnis erklärt sich Alexy mit der These einer „gedachten Norm“476 einverstanden, sieht aber gerade „moralische Elemente“ in ihr enthalten und betrachtet sie daher, anders als Kelsen notwendig für begründungsbedürftig.477 Dazu erörtert er die „normative Grundnorm“ bei Kant, dessen positivistischen Überlegungen er zwar sehr skeptisch gegenüber steht, diese jedoch, von „zeitbedingten obrigkeitsstaatlichen Vorstellungen“ befreit,478 für sehr gut modifizierbar im Sinne der Radbruchschen Formel hält.479 In dieser geht für ihn schließlich die „Richtigkeitsthese“ auf, die er aus seinem Richtigkeitsund „Prinzipienargument“ entwickelt.480 Letzteres folge aus dem „Offenheitsbereich“ des Rechts, für den auch Positivisten anerkennen, dass in ihm keine positivrechtlich begründete Entscheidung möglich sei.481 Dort wirken Prinzipien als „Optimierungsgebote“482, ungeschriebene Normen, die durch Abwägung der tatsächlichen und rechtlichen Möglichkeiten in diesem Offenheitsbereich angewendet werden:483 Findet sich zur rechtlichen Lösung eines realen Konflikts keine positive Norm, so kann ein Prinzip herangezogen werden, dass eine vor der Verfassung als Recht erkennbare Entscheidung nahe legt, selbst wenn der staatliche Gesetzgeber diese nicht bereit hält.484 Da solche Prinzipien nicht notwendig an der Sittlichkeit ausgerichtet sein müssen, impliziert es das Richtigkeitsargument, als Begründbarkeit auf Grundlage des oben ausgeführten kantischen Vernunftrechts, „richtigen Moral“.485
Diese Verbindung von Kant und Kelsen fügt Radbruch letztlich nichts neues hinzu, sondern vollzieht die Argumentationsführung des letzteren nach, um beim gleichen Ergebnis anzukommen. Alexys Definition fasst jedoch die einzelnen Merkmale besonders differenziert zusammen, so auch abschließend insbesondere das prozedurale Element des Rechts. Äußerlich erscheine ein Rechtssystem als das System von Normen, wie es das umfassende zweite Argument seiner Definition zum Ausdruck bringt. Die innere Seite stellt sich als System von Normerzeugungsprozeduren dar.486 Auch diese richten sich nach der Richtigkeitsthese und beziehen die Recht Schaffenden als Definitionselement ein, die Teilnehmer des Rechtssystems, welche gerade im Offenheitsbereich Recht erzeugen.487 Dieses letzte Element zeichnet Alexys Ansatz als Bestimmung des Gegenstands der Rechtsanwendung aus.
d) Kelsen
Kelsen, als exemplarischen Vertreter der kategorischen Rechtspositivis- ten und damit Trennungstheoretiker, ging es nicht um eine anwendungsorientierte Definition, sondern um die analytische Bestimmung des Gegenstands der Rechtswissenschaft und die Abgrenzung letzterer von allen übrigen Wissenschaften.488 In der Terminologie Alexys verfolgte er demnach eine Begriffsbestimmung aus einer originären, weder soziologischen, noch naturwissenschaftlichen Beobachterperspektive. Dazu unterscheidet er den äußerlich als menschliche Handlung wahrnehmbaren Aspekt des Rechts und den diesem Akt innewohnenden subjektiven und objek tiven Sinn; ersterer betrifft die Beweggründe des handelnden Subjekts, letzterer die von diesen unabhängige Bedeutung des Aktes.489
Den juristischen Anteil des objektiven Sinns verleihe ihm eine „durch einen [Anm: gleichsam mit juristischen Sinn besetzten] Rechtsakt [erzeugte]“ Norm die als sein „Deutungsschema“ fungiert.490 Diese Normen, welche äußerlich wahrnehmbare Akte als Recht charakterisieren, bilden für Kelsen den Erkenntnisgegenstand der Rechtswissenschaft, die er deshalb in Abgrenzung zu Natur- und Sozial- als „Normenwissenschaft“ in der Geisteswissenschaft verortet,491 die anders als die Ethik und Theologie, als „normative Erkenntnisarten“,492 keine moralischen Normen rational ergründen könne,493 494 aus denen die Rechtsnormen hervorgegangen seien.
Der Rechtsbegriff ist demnach bei ihm mit der durch Rechtsakt erzeugten Norm, also der Rechtsnorm, identisch. Sie ist ebenso Ausgangspunkt wie Ergebnis des Rechtserkenntnisaktes. Ein erkennender Richter etwa, der auf Grundlage eines allgemeinen normativen Deutungsschemas den spezifisch rechtlichen Sinn eines Sachverhalts ermittelt, erzeugt eine individuelle Norm, die Ausdruck des einzigartigen Rechts der konkreten Situation ist.495 Rechtserkenntnis und Rechtserzeugung stimmen insoweit gleichsam überein.
Formallogisch gilt eine Norm, wenn sie existiert, als solche außerhalb von Raum und Zeit. Rechtliche Geltung erlangt sie zum Einen durch die inhaltliche Bestimmung, an welchem Ort und zu welcher Zeit sie zur rechtlichen Sinnzuschreibung also zur Rechtserzeugung angewendet werden kann. Zum Anderen gilt sie in dieser Weise sachlich für spezifizierte Lebenssachverhalte und persönlich für bestimmte Menschen.496
Ist die Geltung Kelsen zufolge abhängig vom Inhalt der Rechtsnorm, welcher möglich und nicht zwingend ist, impliziert das die Kontingenz der Rechtsnorm an sich. Die damit ebenfalls zufällige Bestimmung des »Unrechts« findet nach seiner Rechtslehre jedoch nicht durch „Negation des Rechts“ statt; es sei vielmehr sein immanenter Bestandteil.497
Entgegen der kantischen Prämisse des kategorischen Imperativ, aus dem sich letztlich alles Recht logisch zwingend ableiten lasse, sieht Kelsen die Rechtsnorm als hypothetisches Urteil in Form des Rechtssatzes: In ihm wird, nur analog und nicht entsprechend dem Naturgesetz, allgemein eine Bedingung einer Folge »zugerechnet«. So wird aus logischer Sicht das zwingende »Müssen« der naturgesetzlichen Kausalität zum gebietenden »Sollen«.498 Ist diese Folge eine staatliche Straf- oder Zwangsvollstreckungsmaßnahme, so ist sie als Unrechtsfolge zu qualifizieren, ihre erfüllte Bedingung folglich als Unrecht; der äußere, staatliche Zwang ist das Kriterium, welches eine Rechtsnorm von anderen Normen und damit den Rechtssatz von allgemeinen Normsätzen unterscheidet.499
Ist Recht nach Kelsen identisch mit der Rechtsnorm, die wiederum im Rechtssatz aufgeht, und werden durch diesen die Bedingungen definiert, welche staatlichen Zwang legitimieren, so ist geltendes Recht selbst die Legitimation dieses Zwangs dessen erfüllte Rechtsbedingung das verübte Unrecht ist.500
Diese negative Funktion des Rechts, Unrecht zu sanktionieren, stellt sich im Umkehrschluss als Anspruch dar. Von einem Anderen ein Tun oder Unterlassen fordern zu können ist jedoch kein Recht, sondern beschreibt eine Handlungsmöglichkeit. Es kommt auch kein Recht zur Geltung, wenn sich der Andere aus innerem, pflichtgemäßem Antrieb heraus diesem Anspruch entsprechend verhält. Recht wirkt erst, wenn er es nicht tut, da er so die Rechtsbedingung erfüllt, welche die Unrechtsfolge eintreten lassen kann - sofern sich der Anspruchsinhaber des staatlichen Zwangsapparates bedienen möchte. Ob die Bedingung erfüllt ist und somit staatlicher Zwang legitim, ist Gegenstand des Erkenntnisprozesses vor der staatlich berufenen Stelle, dem Gericht, das sodann eine auf diesen Sachverhalt konkretisierte individuelle Rechtsnorm erzeugt. Ihr Inhalt kann sein: Die Unrechtsbedingung wurde vom Anspruchsgegner erfüllt, weshalb die Unrechtsfolge einzutreten hat. Diese Norm ist Deutungsschema für das anschließende Verhalten des Gegners. Erfüllt er daraufhin den Anspruch, wurde er unter Androhung von Zwangsmaßnahmen dazu genötigt, die individualisierte Norm zu entkräften. Andernfalls tritt das konkrete Recht, aus dem sich der Anspruch ableitet, in Kraft.501
Kommt das Gericht zu einer gegenteiligen Feststellung, so entkräftet es selbst dieses Recht. Die dann erzeugte Rechtsnorm würde etwa abstrakt lauten: Die Anordnung einer staatliche Zwangsmaßnahme wäre Rechtsbedingung für eine Zwangsmaßnahme, die der Staat gegen sich selbst richten müsste - aus der unrechtmäßigen Zwangsvollstreckung würde ein Anspruch des unrechtmäßig genötigten gegen den Staat erwachsen. Auch sie ist in diesem Fall rein hypothetisches Deutungsschema für ein nicht zu erwartendes, die entsprechende Rechtsbedingung setzendes Verhalten des Gerichts.
Die Definition von Rechtsbedingungen mitsamt der Zurechnung einer Unrechtsfolge als Deutungsschema menschlicher Handlungen ist nach Kelsen Rechtserzeugung, zu der wiederum eine Rechtsnorm berechtigen muss. Um Privatpersonen die Teilnahme an der Rechtserzeugung zu ermöglichen, muss in einem Rechtssatz als allgemeine Rechtsbedingung die jeweils spiegelbildliche Interessenverletzung in einer mindestens zweiseitigen Beziehung bestimmt sein; Unrechtsfolge ist stets die Durchsetzung der Interessen mit staatlicher Unterstützung, wie im vorangegangenen Absatz nachgezeichnet. Da bei Kelsen Recht und Staat notwendig zusammengehen, kann diese allgemeine Ermächtigungsnorm nicht von den Privatpersonen selbst erzeugt werden, sondern auf einer über ihnen liegenden Stufe, dem durch seine Organe Recht setzenden Staat. Dieser erzeuge Subjekte des Rechts als Zuordnung von Pflichten und Berechtigungen. Dabei richten sich die Begriffe 'Person' und 'Rechtssubjekt' nicht auf 'Mensch' als biologisch-psychologischer Begriff, sondern nur auf menschliche Akte, die rechtlich gedeutet werden können. Ob als für sich selbst handelnde »natürliche« Personen oder in Vertretung für andere, auch »juristische« Personen, können Rechtsverhältnisse begründet werden, in denen von den Handelnden Recht gesetzt wird. Der Unterschied zwischen »natürlichen« und »juristischen« Personen liegt in der Verfügungsmacht des Einzelnen. Erstere können individuell rechtlich handeln. Letztere nur als menschliches Kollektiv. Ein solches bilden auch die staatlichen Organe, die im Gegensatz zu Personen des Privatrechts solche des öffentlichen Rechts sind. Als notwendig kontingente Rechtsnormen ist auch die Zuordnung von Pflichten und Berechtigungen von der staatlichen Entscheidung für oder wider ihre Geltung abhängig.502
Der offenkundige Zusammenhang zwischen den von Personen des privaten und solchen des öffentlichen Rechts erzeugten Rechtsnormen konstituiert für Kelsen die „Vielheit“ miteinander verknüpfter Normen als „eine Einheit, ein System, eine Ordnung“; diese ist der Rechtserzeugungszusammenhang.503 Als gestufte Rechtsordnung bringt sie auf höchster Stufe, der Verfassung, generellste Normen hervor, bis schließlich auf der niedrigsten Stufe konkretisierte Individualnormen in Rechtsgeschäften und Vollstreckungsakten erzeugt werden.504 Den Übergang von einer Stufe zur nächsten stellt die Befugnisnorm dar, welche die Berechtigung zur Rechtsetzung auf der nächstniedrigeren Stufe enthält. Beim Aufstieg von der konkreten Individualnorm bis zur Verfassung gerät Kelsen an eine Grenze, die er logisch durch die Konstruktion der „Grundnorm“ überwinden will,505 welche etwa wie Kants kategorischer Imperativ, als Ausgangspunkt der Sittlichkeit, „die Grundregel [ist], nach der die Normen der Rechtsordnung erzeugt werden“.506 Er stößt dabei auf das gleiche Problem, das er Kant bescheinigt: die potentielle Inhaltsleere.507 Die kelsensche Grundnorm steht über der Verfassung, also außerhalb der Rechtssetzungsbefugnis staatlicher Organe. Ist sie ein Rechtssatz, der Rechtsbedingung und Unrechtsfolge enthält, so könnte sie etwa lauten: Setzt ein anderer, als der berufene Verfassungsgeber eine Rechtsordnung in Kraft, so kommt diese Rechtsordnung nicht zur Geltung.
Weder lässt sich bestimmen, woran der berufene Verfassungsgeber erkannt werden kann, noch kann die Nicht-Geltung der unrechtmäßigen Rechtsordnung mit staatlichem Zwang durchgesetzt werden. Der Staat entsteht erst durch die Verfassung. Die Grundnorm kann somit kein Recht im Sinne Kelsens sein. Richtet sich ihr Inhalt „nach dem Tatbestand, in dem jene Ordnung erzeugt wird, der das tatsächliche Verhalten der Menschen, auf die sich die Ordnung bezieht, bis zu einem gewissen Grad entspricht“,508 so scheint die Berufung des Verfassungsgebers in der Kompetenz der zu ordnenden Gesellschaft zu liegen.509 Der gewisse Entsprechungsgrad von Ordnung und tatsächlichem Verhalten erscheint indes reichlich unverbindlich. Ein Rückschluss „zu der die Geltung aller Normen begründenden ersten Verfassung“510 führt nicht aus der bestehenden Rechtsordnung heraus. Werde er auf die Bestimmung der Grundnorm zielen, so wäre dies eben so unbestimmt, wie ein spekulativer gesellschaftlicher Urzustand gleich welcher Prägung. Kelsen bleibt letztlich »nur«, die Eigentümlichkeit des Rechts festzustellen: „Das Recht regelt seine eigene Erzeugung; und zwar in der Weise, daß die eine Rechtsnorm das Verfahren, in dem eine andere Rechtsnorm erzeugt wird, und - in verschiedenem Grade - auch den Inhalt der zu erzeugenden Norm regelt“; die Rechtsnormen sind ihr wechselseitiger Geltungsgrund.511
Das seine eigene Erzeugung selbst regelnde Recht ist nach der Begriffsbestimmung Kelsens zumindest (1) von Gerechtigkeit und Moral verschieden, also auch von einer diese Begriffe bestimmenden Ideologie unabhängig,512 ist (2) die Rechtsnorm, welche Rechtsbedingungen einer Unrechtsfolge zuordnet, die (3) in einem „irgendwie geschlossenen System“513 mit anderen Rechtsnormen in einem Zusammenhang steht das (4) in einem Stufenaufbau die Rechtssubjekte der jeweils nächstfolgenden Stufe zu rechtlichen Handlungen berechtigt und verpflichtet.
4. Zwischenergebnis
Der trennungstheoretische Ansatz Kelsens stellt sich als der formalen Normenlogik am strengsten verpflichtete heraus. In ihm wird der notwendige Unterschied zwischen Normerzeugung und Wertungsvorgang herausgearbeitet.514 Die notwendigen Bestandteile des rechtlichen Normsatzes können mit Kelsens Lehre vom Rechtssatz eindeutig bestimmt werden. Daraus lassen sich schlüssige Konzepte ableiten, welche die logisch zwingend erscheinende Abgrenzung von Recht und Moral schärfen lassen. Er stellt vor allem das notwendige Zwangselement von Recht klar. Damit wird deutlich, dass eine Rechtsnorm das Sollen konkretisiert, was andere Normen nicht leisten können. Der allgemeine Normsatz verweist lediglich auf die kontingente Geltung einer Anweisung mit dem Inhalt: x soll H tun, was in sich logisch, zumindest nachvollziehbar sein mag. Universell ist es dennoch nicht begründbar. Der Rechtssatz hingegen ist darüber hinaus wahrheitsfähig. Die Zurechnung von Unrechtsfolge und Rechtsbedingung fasst das Sollen in eine andere sprachliche Fassung, indem der Norm ein drittes Element hinzugefügt wird: Wenn x H nicht tut, so folgt Z. Dabei ist Z stets gleichbedeutend mit potentieller staatlich organisierter Nötigung von x zur Handlung H. Der Rechtssatz lässt sich also in die Aussage umformen: Alle x, die im Geltungsbereich der Rechtsnorm H unterlassen, müssen mit der Folge Z rechnen. Hingegen lässt der allgemeine Normsatz nur die Aussage zu: Wenn ein x im Geltungsbereich der Norm H unterlässt, übertritt er die Norm. Als »Moralsatz« könnte er wieder differenziert werden in der Form: Wenn x H nicht tut, so folgt A. Dabei könnte A »gesellschaftliche Ablehnung« bedeuten. Es könnte jedoch auch ein schlechtes Gewissen sein, oder eine Bestrafung im Jenseits, jedoch nie eine staatliche Zwangsmaßnahme. Der »Moralsatz« lässt sich also nur in die Aussage umformen: Alle x, die im Geltungsbereich die Moralnorm H unterlassen, können mit einer unbestimmten Folge A rechnen.
Seiner Qualifikation der Rechtsnorm als hypothetisches Urteil ist zuzustimmen, da nur so die Beliebigkeit von Normen, die in einem Rechtssystem gelten und in einem anderen nicht, logisch ausgedrückt werden kann. Kelsens Grundnorm folgt aus dem Satz vom zureichenden Grund, die Regel aus der alles weitere folgt.515 Sein Problem ist die Transzendenz dieser Grundregel, die sie von den empirisch erfassbaren Normen unterscheidet. Mit einfachen logischen Begriffsmodellen scheint sich dieses Problem nicht auflösen zu lassen, dennoch ist es zwingend zu lösen, will man nicht die Notwendigkeit des Axioms infrage stellen.
Soweit überzeugt sein Ansatz aus logischer Perspektive weitestgehend. Was Kelsen allerdings in seiner Rechtslehre vernachlässigt, ist die Konsistenzprüfung des Rechts. Zwar geht es ihm um die Rechtsnormanalyse im systematischen Zusammenhang des Rechtsganzen in objektivistischuniversalistischer Haltung.516 Dass die Auflösung von Normwidersprüchen aus rein positivistischer Sicht möglich sein soll, wird hier jedoch bezweifelt. Für Kelsen sind nur Konflikte zwischen den Rechtsnormen unterschiedlicher Stufen denkbar.517 Die Grundnorm außer Acht gelassen bleiben die Verfassungsnormen als letzte Instanz der Schlüssigkeit, in welcher grundlegende, allgemeine Wertvorstellungen der geordneten Gesellschaft inkorporiert sind. Wird aber seine Grundnormthese mit einbezogen, wonach die Rechtsordnung legal erzeugt wird, die dem tatsächlichen Verhalten der von ihr betroffenen Menschen bis zu einem gewissen Grade entspricht, so ist diese Schwelle des gewissen Grades ausgesprochen unscharf. Diese Unschärfe weist auf den von Alexy angesprochen Offenheitsbereich hin, der positivrechtlich nicht geregelt ist. Dort wird die positivrechtliche Erkenntnis des Geltungsvorrangs konfligieren- der Rechtsnormen problematisch, was freilich Kelsen 1934 noch nicht so deutlich erkennen konnte, wie nach 1945 publizierende Rechtstheoretiker.
Es spricht danach in der Tat einiges für eine Verbindungsthese. Steht Kant wie gesehen in einigen Punkten zwar dem reinen Positivisten Kelsen näher, als dem geläuterten Radbruch, so ist sein Konzept doch eine Grundlage aller Verbindungstheoretiker. Sein kategorischer Imperativ erscheint auch entgegen Kelsen durchaus inhaltsvoll. Die Selbstverpflichtung zur umfassenden, auch selbstbezogenen Rücksichtnahme, verweist auf ein soziales Element, ein „Reich der Zwecke“,518 in welchem der differenzierte, vernunftbezogene, selbstbeschränkende Freiheitsbegriff durchaus eine trennscharfe Bestimmung handlungsleitender Prämissen ermöglicht. Darin wird die interne Logik des der Normerzeugung vorausgehenden Wertungsvorgangs deutlich.519 Auch das Element inneren, persönlichen Zwangs, der aus dem Pflichtbewusstsein erwächst, lässt den Begriff 'Vernunftrecht' schlüssig erscheinen. Es ist das Recht, dass der individuelle Gesetzgeber sich selbst gibt und somit gegen sich selbst durchsetzt. Soweit jedoch bei Kant Vernunftrecht verbindlich nach außen treten können soll, Billigkeit jedoch nicht, erscheint dies paradox. Was im Einzelfall billig ist, muss sich auch vernunftrechtlich erschließen lassen können. Wenn Billigkeit die subjektiv empfundene Einzelfallgerechtigkeit ist, so muss sie sich von einer objektiven Gerechtigkeit wohl unterscheiden. Letztere muss in der Vernunft eines jeden entsprechend begabten Wesens in gleicher Weise erkannt werden können, erstere nur autonom empfunden. Sei mit Kelsen die objektive Gerechtigkeit gesellschaftliches Glück,520 so ist sie gleichsam eine Empfindung. Lässt sich dieses Glück als Zustand beschreiben, welcher erreicht ist, wenn sich die empfundene Zufriedenheit aller Beteiligten einer wie auch immer gearteten Austauschbeziehung in einem Gleichgewicht befindet, so wirkt sie doch stets auf das Individuum zurück. Subjektive und objektive Gerechtigkeit unterscheiden sich augenscheinlich nicht. Ist aber die eigene Glückseligkeit zu sichern ebenso Pflicht521 wie die des anderen, so muss sich auch aus der Gerechtigkeit ein allgemeines Prinzip im Vernunftrecht deduzieren lassen. Mithin muss entweder das Billigkeitsgefühl des Einzelnen mit dem Vernunftrecht nach außen treten können, oder aber beides bildet eine verinnerlichte Einheit. Die bloße Unbestimmtheit eines monetären Anspruchs als Grund für die ausgeschlossene Entscheidung durch einen Dritten anzuführen, überzeugt zumindest nicht. Vielmehr liegt die Verpflichtung nahe, gerade einem unparteiischen Dritten die Billigkeitsentscheidung zu übertragen, um den eigenen Geist frei von der Nötigung des Eigennutzes zu halten. Diese weitere Inkonsistenz lässt vermuten, dass Kant selbst die Mehrdeutigkeit von 'Recht' unterschätzt hat und sein Vernunftrecht in der Billigkeit aufgehen lassen muss. Soweit Radbruch mit seiner knappen Definition von Recht eine Entscheidung für eine Gleichsetzung mit dem Willen zur Gerechtigkeit fällt, könnte er damit diesen Schritt vollzogen und das Paradoxon im Sinne einer Zuordnung zum staatlich durchsetzbaren Recht aufgelöst haben. Gerechtigkeit als Gleichbehandlung lässt sich zumindest mit einem gleichen Maß an empfundener Zufriedenheit vereinbaren. Als ehemaliger Rechtspositivist hat er die Hürde zum Rückzug auf Gerechtigkeitserwägungen jedoch sehr hoch gesteckt. Da seine Auffassung vollständig in Alexys Begriffsbestimmung aufgeht, die sich zu einem gewissen Grad auch mit der bereits bewerteten positivistischen Rechtslehre Kelsens verträgt, soll sie an dieser Stelle nicht, sondern erst im folgenden Gliederungspunkt beurteilt werden.
5. Vereinnahmung durch die Systemtheorie
Jestaedt sieht im kelsenschen Konzept eine Frühform der luhmannschen Systemtheorie.522 Und in der Tat lässt sich die Reine Rechtslehre lückenlos in die systemtheoretische Terminologie Luhmanns übersetzen. Selbst das Grundnormproblem lässt sich damit lösen. Auch Alexys Definition findet in der Systemtheorie eine Heimat, die sogleich behandelt wird.
a) Alexy
Stellt aus systemtheoretischer Sicht das Recht ein Subsystem der Gesellschaft dar, dessen Operation somit die autopoietische Produktion sinnhafter Kommunikation mit spezifisch rechtlichem Inhalt ist, welche 'Norm' heißt,523 so geht darin die Qualifikation des Normensystems und auch dessen Anspruch auf Richtigkeit, als erstes Element von Alexys Definition vollständig auf. Der Richtigkeitsanspruch ist dann trivial, denn er ist ein Aspekt der SYSTEMbildenden Unterscheidung, die das operativ geschlossene (Sub-)System 'Recht' konstituiert. Eine systemfremde Operation kann nicht importiert werden. Im Recht erzeugte Strukturen, also Normen, können nichts anderes als Recht, mithin 'richtig' sein.524 Es ist dies die Unterscheidung, der Code, Recht/Un-Recht.525
Diese Unterscheidung wird im zweiten Element seiner Begriffsbestimmung weiter spezifiziert. Darin wird, in der Terminologie Luhmanns, auf die Beobachtung zweiter Ordnung der Rechtsent- oder besser -unterscheider verwiesen, die im Blick haben, wie sich das System in erster Ordnung selbst beobachtet; ihnen stehen die „Handelnden und ihre Opfer“ als Beobachter erster Ordnung gegenüber,526 die im RechtsSYSTEM operieren, ohne die Unterscheidung 'Recht/Un-Recht' selbst vornehmen zu können.
Aus dieser Sicht werden Alexys Begriffe der 'Beobachter-' und 'Teilnehmerperspektive' unscharf. In der Systemtheorie beobachten alle bei ihm genannten »Teilnehmer« in unterschiedlicher Ordnung selbst- oder fremdreferenziell.527 Alexys 'Beobachterperspektive' bezeichnet die externe, die Fremdbeobachtung, wohingegen seine 'Teilnehmerperspektive' nur die interne Beobachtung zweiter Ordnung meint, da »der idealtypische Richter« für ihn die Referenz aller übrigen Teilnehmer darstellt.528 Dem lassen sich die genannten Rechtsanwälte insoweit zuordnen, wie sie als Organe der Rechtspflege das sich in erster OrdNUNGselbst beobachtende Rechtssystem gleichsam im Blick haben. Als Rechtswissenschaftler haben Juristen indes eine Zwischenstellung. In dieser Funktion findet ihre Beobachtung des RechtsSYSTEMS not wendig extern in dritter Ordnung, aus einem anderen, dem WissenschaftsSYSTEM heraus statt.529 Hingegen sind „am Rechtssystem interessierte Bürger“, wie auch Betroffene, ausschließlich als externe Beobachter Alexys „Beobachterperspektive“ zuzuordnen.530 Es mag angesichts dieser Entfaltung infrage gestellt werden dürfen, ob ein einheitlicher interner Blick möglich ist, der zwingend eine andere Definition von 'Recht' hervorbringen muss, als ein externer.
Die „soziale Wirksamkeit“, als Definitionsmerkmal 'breite gesellschaftlichen Akzeptanz', stellt aus hiesiger Sicht einen weiteren Bezug zur Zeitdimension, also zur Autopoiesis her. Die sinnhafte Kommunikation orientiert sich an Erwartungen und bringt diese zum Ausdruck; sie kann nur Sinn ergeben, wenn gegenwärtige Kommunikationsakte auf vergangenen aufbauen und den künftigen Verlauf der Kommunikation absehbar machen.531 Kommunikation im RechtsSYSTEM ist darauf gerichtet, die Möglichkeiten einzuschränken, nach denen die CODEwerte 'Recht' und ' Un-Recht' zugewiesen werden.532 Die Teilnehmer als Beobachter erster Ordnung greifen auf die Erinnerung an ehemalige Operationen zurück, die ihnen als Struktur Referenz für künftige sind. Die Autopoiesis schränkt somit die Möglichkeiten dieser Zuweisungen ein. Die Verfassung bildet die dauerhafte „normative Zeitbindung“533 jener Normen, welche die allgemeinsten Bedingungen dieser Kontingenzeinschränkungen enthalten. Halten sich in der „Sozialdimension“ die aus dieser extensiven Zeitbindung folgenden „Anlässe für Konsens/Dissens“ in einem Rahmen, an dem sich keine signifikanten sozialen Spannungen entzünden,534 so bleiben die Erwartungen an kommende Rechts-OPERATIONEN weitestgehend homogen und werden überwiegend konform befriedigt. Dies lässt sich als „soziale Wirksamkeit“ bezeichnen. Werden Normen erzeugt, die den Erwartungen, die durch die Verfassung geweckt werden, widersprechen, so verweisen sie auf irritierende künftige Möglichkeiten, erzeugen mithin eine unsicherere Zukunft als vorher gesehen. Je weitreichender die Wirkung solcher Normen, um so stärker irritieren sie das gesamte System. Können die unerwarteten Möglichkeiten toleriert werden, so steigt auch ihre „soziale Wirksamkeitschance“. Beide Ebenen des zweiten Definitionselements von Alexy finden demnach ihre systemtheoretische Entsprechung. Diese findet sich auch in seiner Ausrichtung auf den »idealtypischen Richter« wieder, die Erwartung „wie ein Richter zu entscheiden hätte“.
Das Merkmal „extreme Ungerechtigkeit“, welche die Zuweisung des CODEwerts 'Un-Recht' zur Folge haben soll, findet ihren systemtheoretischen Niederschlag in Luhmanns „ Kontingenzformel des Rechtssystems“.535 Der Begriff ist danach kein Strukturimport aus einem andern System; »Gerechtigkeit« wird intern „kanonisiert“,536 in das Programm integriert.537 Auf diese Formel wird näher in der folgenden Bewertung des kelsenschen Ansatzes eingegangen. Hier kann es zunächst bei der Feststellung bleiben, dass »Gerechtigkeit« auch in einer systemtheoretisch geprägten Definition von Recht zu berücksichtigen ist und damit Alexys Begriffsbestimmung nicht widerspricht. Die Berücksichtigung von Verfassungs- und diesen untergeordneten Einzelnormen fällt indes schwerer. Auch diese Frage wird jedoch vorerst zurückgestellt. Nur so viel sei vorab bemerkt: Der Verfassungsbegriff ist verhältnismäßig unproblematisch zu integrieren für Rechtsordnungen, die sich auf ein zentrales, schriftliches Dokument stützen, auch im Hinblick auf das wesentliche Medium 'Schriftsprache' im RechtsSYSTEM.538
Mit den Richtigkeitsanspruch von Rechtsanwendungsprozeduren bestätigenden „Prinzipien und [... ] sonstigen normativen Argumenten“, welche Gegenstand des dritten Elements von Alexys Definition sind, wird zum Einen erneut auf das Programm verwiesen. Es zielt auf den „Offenheitsbereich“, ungeschriebene Rechtsgrundsätze, welche zuerst die Rechtsfortbildung der Gerichte leiten. Die Priorisierung der Gerichte folgt aus der Annahme des idealtypischen Richters als Referenz der Teilnehmerperspektive.539 Dieses Definitionselement erscheint jedoch redundant: Wie gesehen ist der Richtigkeitsanspruch die RechtsSYSTEMbildende Unterscheidung 'Recht/Un-Recht'. Diese CüDEwerte sind Ausgabe des Programms das auch die Kontingenzformel 'Gerechtigkeit' enthält. Insoweit wird dem zweiten Definitionselement noch nichts neues hinzugefügt. Alexy erkennt an, dass durch Prozeduren nicht nur Rechtsnormen angewendet, sondern auch erzeugt werden.540 Sind Normen rechtmäßig erzeugt, dann auch PRüGRAMMgemäß. Der „Offenheitsbereich“ geht in der systemtheoretischen Betrachtung vollständig in dem vorher definierten auf.
Das prozedurale Merkmal ist es, welches unmittelbar den Kern der Systemtheorie des Rechts erfasst: Hier nun spürt Alexy die Operation auf und zwar jene als Beobachtung zweiter Ordnung; dort kommt das Programm zur Anwendung, nach dem die Wertzuweisung 'Recht/Un-Recht' erfolgt wodurch die Struktur 'Rechtsnorm' erzeugt wird, die im autopoietischen System in einen Kontext mit auf der Zeitebene früher erzeugten Rechtsnormen gesetzt wird, was dessen operationale Geschlossenheit herstellt.541 Das System beschreibt sich selbst durch die kontinuierliche interne Beobachtung, die als Subsystem ihre Produkte unmittelbar im RechtsSYSTEM aufgehen lässt.
An dieser Stelle wird folgende systemtheoretische Übersetzung der Definition Alexys vorgeschlagen:
Das Recht ist (1) ein gesellschaftliches Subsystem, dessen au- topoietische binäre Unterscheidung (2) nur geringen Anlass für Konsens/Dissens bietet und mit der Kontingenzformel 'Gerechtigkeit' programmiert ist; ferner bezeichnet es (3) die SYSTEMbildende Operation als Beobachtung zweiter Ordnung, welche die Strukturen des SuBSYSTEMSerzeugt.
Luhmann lehnt eine sachliche Definition des Rechts ab; an ihre Stelle trete „die Systemreferenz »Rechtssystem«“.542. Das wird an dieser Umformulierung verständlich, sind doch System, Operation und Auto- poiesis, letztlich auch Programm, Code und Struktur wesensgleich. Im SYSTEMbegriff ist alles übrige enthalten und so müssen die Elemente (1) bis (3) als »weißer Schimmel« erscheinen.543
Soll jedoch dem Anspruch genügt werden, das RechtsSYSTEM so zu beschreiben, „wie die Juristen es verstehen“,544 ist eine Auseinandersetzung mit ihren Definitionen geboten. Zudem hilft diese Begriffsbestimmung, die Redundanzen herauszufiltern und das programmatische Element zu isolieren.
Alexy, als anerkannter Vertreter der „Juristen“, hat einen differenzierten Einblick in das rechtswissenschaftliche Verständnis der Verbindungsthese geboten, die aus systemtheoretischer Perspektive als Programmbestandteil ' Kontingenzformel' bestätigt werden kann. Beim Wort genommen kann er umgekehrt nicht der Normerzeugung als Operation widersprechen.
b) Kelsen
Die Vereinbarkeit der Reinen Rechtslehre mit der Systemtheorie Luh- manns sind offenkundig. Kelsens analytischer Ansatz, in welchem er erkennt, dass Recht seine eigene Erzeugung selbst in einem „irgendwie geschlossenen System“ regelt, nimmt Luhmanns Konzept der Selbstorganisation und operationalen Geschlossenheit vorweg.
Die Beschreibung der Rechtsnorm als Deutungsschema, durch das einem in Raum und Zeit wahrnehmbaren menschlichen Akt ein rechtlicher Sinn zugewiesen wird, lässt sich in Einklang bringen mit Luhmanns Definition als „Gefüge symbolisch generalisierter Erwartungen“:545 Die Rechtsnorm wird nach Kelsen durch einen Rechtsakt erzeugt, dem wiederum eine Rechts-Norm zugrunde liegt, die dem Akt seinen Sinn als Rechts-Akt erst zuweisen muss. Die so verbundenen Normen ergeben ein Gefüge. Die Zuschreibung eines rechtlichen Sinns ist systemtheoretisch Symbol für die dieser Zuschreibung zugrunde liegenden im Gedächtnis der Gesellschaft gespeicherten Erwartung, wonach ein Akt nach den Prämissen behandelt, gedeutet wird, die schon in der Vergangenheit zur Anwendung gekommen sind, wodurch die ungewisse Zukunft vorhersehbarer wird.546 Mit der Norm wird also Sinn für wiederholten Gebrauch auf der Zeitebene fixiert.547
Sieht Kelsen Geltung zunächst als Ausdruck der Existenz einer Norm und rechtliche Geltung als gleichsam normative, also wieder auf einen Rechtsakt zurückgehende Bestimmung der räumlichen und zeitlichen sowie sachlichen und personalen Geltung, so sieht Luhmann darin ein Symbol für den Anschluss von Operation zu Operation im Rechts- SYSTEM,548 demnach als Element der Autopoiesis. Sie stellt nicht allein den Zeitbezug her,549 ist aber für die blind, also unabhängig vom Beobachter ablaufende Vervielfältigung des RechtsSYSTEMS unentbehrlich. Der normativen Qualität der Rechtsgeltung widerspricht Luhmann indes,550 das Symbol 'Rechtsgeltung' ist demnach ein anderes als das Symbol 'Rechtsnorm', welches zugleich Struktur des RechtsSYSTEMS ist. 'Rechtsgeltung' symbolisiert die „Einheit des Rechts“. Was als Recht erzeugt wird gilt, ist also bereits durch seine Erzeugung legitimiert.551 Das wirft den Geltungsbegriff letztlich auf die logische Geltung zurück. Dieses statische Verständnis nimmt in der Systemtheorie des Rechts jedoch andere Gestalt an. Was in der Gegenwart als Recht erzeugt wird, bezieht das Geltungssymbol aus der vorangegangenen Operation und gibt es weiter, an die unmittelbar folgende. Geltung ist also, wie auch die Kontingenzformel 'Gerechtigkeit', Teil des Programms, an dem der Code 'Recht/Un-Recht' ausgerichtet ist.552
Am Beispiel des vertraglich begründeten Rechtsverhältnisses soll das konkretisiert werden: Der Grundsatz pacta sunt servanda ist das Geltungssymbol für die Operation 'Vertragsschluss' aus der die Struktur 'Vertrag' als konkrete Einzelnorm hervorgeht. Die Parteien wirken demnach als Beobachter zweiter Ebene, auf der sie die Unterscheidung treffen, was in ihrem Verhältnis 'Recht' ist und was nicht. Erst im Konfliktfall legen sie ihre Unterscheidung einer befugten dritten Stelle zur Prüfung vor, die entscheidet, ob dem Vertrag als Ganzem oder einzelnen seiner Bestandteile das Geltungssymbol zu entziehen ist. Er wird nichtig oder teilnichtig. Im Übrigen wird der Vertrag anerkannt, als Norm herangezogen und der zu klärende Sachverhalt auf seiner Geltungsgrundlage beurteilt.
Mit diesen Differenzierungen lassen sich überzeugend die Grundnorm- und Gerechtigkeitsproblematik in den Griff bekommen. Kelsen fehlte ein Begriffsmodell, mit dem er sich vom Wortlaut der Rechtstexte lö- sen konnte, um den in einzelnen Vorschriften verschriftlichten Geltungsbegriff auf einer anderen als der normativen Ebene zu analysieren. Mit seiner Lehre vom Rechtssatz und seiner daraus folgenden Modifikation des Un-Rechtsbegriffs, hat er bereits in Ansätzen angedeutet, was sich systemtheoretisch als die Unterscheidung Subsystem/System darstellt. Bei ihm gehört das Un-Recht zum Recht, weil es Bedingung für die staatliche Zwangsmaßnahme setzt, vom Rechtssatz also geboten wird. Das ist die logisch zwingende Folge.
Geht man den Schritt von der normativen Ebene, also jener der Struktur, auf diejenige der Operation, von der die Unterscheidung 'Recht/Un-Recht' vollzogen wird, so lässt sich mit Luhmann erschließen, dass die Unterscheidung auf beiden Seiten innerhalb des Systems 'Gesellschaft' liegt. Sie grenzt nicht wesensfremdes voneinander ab, denn beides ist Kommunikation, sodass Un-Recht gerade nicht ignoriert, sondern verarbeitet wird.553 Diese Verarbeitung übernimmt, wie von Kelsen gesehen, das RechtsSYSTEM. Wenn Luhmann dessen Funktion als „Stabilisierung normativer Erwartungen durch Regulierung ihrer zeitlichen, sachlichen und sozialen Generalisierung“ beschreibt,554 so geht es dabei um die Verarbeitung enttäuschter Erwartungen. Enttäuschte Erwartungen sind Irritationen des Systems, die als Information über strukturelle Kopplungen eintreten.555 Das mit anderen gesellschaftlichen Subsystemen strukturell gekoppelte System 'Recht' ermöglicht erst die Erkenntnis von Abweichungen durch Zuweisung des CODE-Werts 'Un-Recht'. Damit wird die Information zur Struktur im Recht verarbeitet. Als Rückkopplung durch den Wiedereintritt ins System 'Gesellschaft' findet die Un-Rechtsfolge Anwendung. Das verträgt sich mit Luhmanns Hinweis, Sanktionsandrohung und -verhängung können kein Definitionsmerkmal des Normbegriffes sein.556 Die Rechtsbedingung im kelsenschen Rechtssatz bezeichnet also die SYSTEMbildende Unterscheidung, die Un-Rechtsfolge den Wiedereintritt, das Recht wirkt sich aus. Wird hingegen der Wert 'Recht' zugewiesen, liefert der Wiedereintritt keinen Rückgabewert an das GesellschaftsSYSTEM, das Recht schweigt.557
An diesem Zwischenschritt wird das RechtsSYSTEM als internes Be- Obachtungssystem der Gesellschaft deutlich erkennbar, wie auch die Rechtserzeugung als dessen Selbst Beobachtung zweiter Ordnung verständlich wird. Soweit kann also der von Kelsen als Grundnorm angenommene Geltungsgrund als Operation identifiziert werden, die zur Ausdifferenzierung des Rechts als einheitliches Subsystem führt.558
Wäre es möglich, die Zeit anzuhalten und einen Augenblick des Rechtssystems zu visualisieren, so könnte man es als komplexe Struktur erkennbar machen, die sich aus der Wurzel des Geltungssymbols im Raum entfaltet. Es wäre auch eine umgekehrte, dem gestuften Über/Unterordnungsschema näher kommende Darstellung denkbar. Sämtliche Rechtsnormen wären darin zu einer einzigen verbunden, als deren Ausgangspunkt wahlweise die Wurzel oder die höchste Stufe erscheint. Die Wesensgleichheit von Struktur und Operation im Augenblick, legt so die Vorstellung einer alles, möglicherweise auch transzendental legitimierenden Grundnorm nahe. Wird das Rad der Zeit jedoch wieder angestoßen, muss offensichtlich werden, dass die Struktur fortlaufend neu begründet wird, ohne das ein Anfang abzusehen wäre, und auch kein Ende in der unsichtbaren Zukunft. Das Geltungssymbol bestimmt dabei lediglich „den Systembezug, ohne das System inhaltlich zu charakterisieren.“559 Durch die systemtheoretische Terminologie, mit der beide Ebenen, die Gegenwart im Raum, die Vergangenheit und erwartete Zukunft in der Zeit, beschrieben werden können, lassen sich wie gesehen die verschiedenen Aspekte des Begriffes von Recht als Vielheit der Normen, die ein Rechtssystem bilden, schärfer voneinander abgrenzen, wodurch neue Schlussfolgerungen möglich werden.
Dies kommt letztlich der Verbindungsthese zugute. Für Kelsen kann Recht nicht mit dem absoluten Wert 'Gerechtigkeit' zusammengehen. Die Eigengesetzlichkeit des ersteren gäbe eine Berücksichtigung des irrationalen zweiten nicht her.560 Insoweit geht diese Auffassung auch bei Luhmann auf: Ein Wert als Medium ist nicht Gegenstand der SYSTEMbildenden Unterscheidung, sondern es sind die CODE-Werte 'Recht/Unrecht'.561 Hat das RechtsSYSTEM aber die Funktion, normative Erwartungen zu stabilisieren, so muss es konsistente Unterscheidungen treffen, wie schon von Alexy mit Radbruch gesehen. Dies verwirklicht sich darin, „gleiche Fälle von ungleichen Fällen [Anm. autopoietisch] unterscheiden“ zu können. 562
Konsistenz ist die Einschränkung von Kontingenz, von Möglichkeiten also, sich in diesem Fall für Gleichheit oder Ungleichheit zu entscheiden. Wäre diese Entscheidung eine Frage der Moral, so würde letztere im RechtsSYSTEM aufgehen. Dass es in der Moral jedoch nicht darum geht, Recht von Unrecht zu unterscheiden, sondern 'gut' von 'schlecht' zeigt sich bereits daran, dass nicht für alle menschliche Handlungen, die als 'schlecht' bezeichnet werden können, Un-Rechtsfolgen vorgesehen sind. Soweit findet die Auffassung Kelsens Bestätigung, wonach Rechtsnormen zwar aus Moralnormen hervorgegangen sind, sich aber auch vollständig von ihnen gelöst haben. Rechts- und EthikSYSTEM sind offenbar notwendig verschieden. Eine Verwischung ihrer Grenzen würde den Zusammenbruch von beiden zur Folge haben,563 da der Wiedereintritt in das von ihnen beobachtete System 'Gesellschaft' dann unklare Rückgabewerte liefert. So könnten etwa staatliche Sanktionen der Willkür des Staatsapparates überlassen bleiben, weil zwar eine negative CODEwertzuweisung erfolgte, aber Uneinigkeit über die notwendige Konsequenz in der Gesellschaft besteht. Beide Subsysteme versagen so in ihrer Funktion, Irritationen in der Gesellschaft zu verarbeiten, und würden mithin obsolet. Die von Luhmann vorgeschlagene Lösung ist, Gerechtigkeitserwägungen als Kontingenzformel im Recht selbst zu ver- orten.564
Ausgangspunkt dieser Überlegung ist die Annahme, dass Rechtsentscheidungen stets im Kontext mit anderen Entscheidungen zu fällen sind. Dies verwirkliche sich in der Beobachtung anderer Beobachter des RechtsSYSTEMS, wodurch wieder strukturelle Kopplungen hergestellt werden, die eine interne iNFORMATiONSverarbeitung ermöglichen. Diese können sowohl von internen als auch von externen Beobachtern stammen. Das mündet konkret in die Ausrichtung von Rechtsentscheidungen an Vorentscheidungen, wie etwa eine Gerichtsentscheidung höherer Instanz, ein erlassenes Gesetz, ein geschlossener Vertrag. Verändern diese eingebundenen Entscheidungen die Geltungsgrundlage für künftige Unterscheidungen in 'Recht/Un-Recht', so erhöhen sie die Ungewissheit kommender Rechtsentscheidungen in konkreten Fällen, die auf der geänderten Grundlage unerwartete Konsequenzen nach sich ziehen können. Die Kontingenz wird erhöht. Um diese in einem weiteren Schritt wieder einzugrenzen, findet der Vergleich mit vergangenen Rechtsentscheidungen nach dem „Schema gleich/ungleich“ als „Auffangkorrektur“ statt.565 Das erhöht die Konsistenz des RechtsSYSTEMS. Soweit jedoch die mit den eingebundenen Entscheidungen geweckten Erwartungen dann nur eingeschränkt oder überhaupt nicht befriedigt werden können, steigert das aus dieser Perspektive wieder die Unvorhersehbarkeit.
Der Begriff der Kontingenzformel wird dadurch eingängig. Auch wird ihre interne, programmatische Funktion deutlich. »Gerechtigkeit« ist Teil des Programms und damit, wie auch das Geltungssymbol, Teil der Operation, die Rechtsnormen als die Unterscheidungen lenkende Strukturen erzeugt, was wiederum die Identität dieser reflexiven Begriffe ausmacht. Mit Kelsen ist also Recht und Rechtsnorm identisch, mit Luhmann werden die einzelnen Aspekte und Implikationen dieser Gleichsetzung anschaulich. Dadurch lässt sich schließlich Gerechtigkeit als Bestandteil des Rechts begreifen, ohne die Trennung von der Ethik aufgeben zu müssen. Die Kontingenzformel entwickelt sich eigenständig in einem durch Rückkopplung mit anderen Systemen autopoietisch fortschreitenden Lernprozess weiter, behält dennoch ihre eigenständige, rechtliche Qualität und spezifiziert somit die »Inkorporationsthese«.566 Das wiederum lässt sich schließlich mit Kelsen in Einklang bringen, wenn er konstatiert: „Als >ungerecht< erscheint dann, daß eine generelle Norm in dem einen Fall angewendet wird, in dem anderen aber, obgleich er gleich gelagert ist, nicht [...] Diesem Sprachgebrauch nach drückt das Urteil der Gerechtigkeit nur den relativen Wert der Normgemäßheit aus. >Gerecht< ist hier nur ein anderes Wort für >recht<.“567
So lässt sich auch sein Ansatz systemtheoretisch übersetzen.
Recht ist ein autopoietisches Subystem desSYSTEMS 'Gesellschaft', dessen Operationen (1) auf der BEOBACHTUNGsebene zweiter Ordnung durch strukturelle Kopplung mit anderen Systemen die Impulse erhalten, mit denen die Kontingenzformel 'Gerechtigkeit' unabhängig weiterentwickelt wird, welche die Strukturerzeugung beeinflusst die (2) Rechtsnormen hervorbringt, welche die SYSTEMbildende Unterscheidung 'Recht/UnRecht ' lenken, um beim Wiedereintritt des Subsystems in die Gesellschaft einen Rückgabewert als rechtlich geprägte Handlungsanweisung zu liefern, die (3) im strukturell geschlosen System ein Ganzes ergeben, das (4) in dessen Vervielfältigungsprozess das Rechtsgeltungssymbol von einer zur nächsten Operation weitergibt.
c) Kant
Eine Übertragung des Vernunftrechtkonzepts von Kant könnte zunächst vermeintlich Schwierigkeiten bereiten, insoweit in ihm ein Absolutheitsanspruch formuliert ist, der in der Systemtheorie nicht erfüllt werden kann. Als prägender Einfluss ihm nachfolgender rechtstheoretischer Konzepte, auch jener von Radbruch und Alexy, die ihre Bestätigung in der Rechtsdogmatik gefunden haben, darf er jedoch nicht übergangen werden, sondern muss im Gegenteil auch im luhmannschen Modell originär aufgehen. Andernfalls könnte letzterem stets entgegen gehalten werden, dass es einen bedeutenden Aspekt bei der Beschreibung des RechtsSYSTEMS vernachlässige.
Sozusagen auf der »Haben-Seite«, der Übereinstimmung von Kant mit der systemtheoretisch geprägten »Inkorporationsthese«, steht hingegen dessen von Alexy kritisierte positivistische Priorisierung von erzwingbarem, nach außen tretendem, positiv gesetztem Recht. Diese liest sich als Anweisung an die weltlichen Gesetz-, oder besser Normgeber, ihre Normerzeugung an dem auszurichten, was in der kollektiven Vernunft, frei denkender und sich wechselseitig verpflichtender Individuen, übereinstimmend und daher zwingend als 'richtig' erscheint.
Sein historischer Adressat war der aufgeklärte, monarchische Souverän an sich, als den sich Friedrich II. von Preußen betrachtete. Dieser ließ etwa auf den Grundsätzen seines, von Voltaire beeinflussten Vernunftrechtsdenkens das Allgemeine Preußische Landrecht erarbeiten, um in seiner Interpretation willkürliche, also kontingente Rechtsentscheidungen auf ein absoulutes Minimum zu reduzieren.568 Trat dieses auch nicht mehr zu Lebzeiten des „roi philosophe“569 in Kraft, so doch drei Jahre vor Veröffentlichung von Kants ’Metaphysik der Sitten’ im Jahr 1797.570 Und sicherlich war es mitsamt des royalen Rechtsverständnisses schon im Jahr 1785 Gegenstand wissenschaftlicher Auseinandersetzungen, als ein Jahr vor dem Tod Friedrichs II. Kants ’Grundlegung zur Metaphysik der Sitten’ erschien. Dabei muss sein säkularisiertes Konzept in einer Gesellschaftsordnung, die sich als göttlich legitimiert versteht, Anstoß erregt haben, weshalb die vernunftrechtliche Bestätigung des Souveräns in dieser Deutlichkeit aus berufsbedingtem Selbstschutz formuliert worden sein mag.571 Andererseits mögen für Kant auch Vernunftgründe für die Vorhersehbarkeit des Rechts in einer Monarchie gesprochen haben, gerade angesichts einer ihre eigenen Kinder verschlingenden Revolution in nicht weit entfernter Nachbarschaft.
Losgelöst von diesen historischen Rahmenbedingungen kann seine letztlich positivistisch geprägte Verbindungsthese jedoch unmittelbar in der Systemtheorie des Rechts aufgehen. Die in der Vernunft deduzierten allgemeingültigen Prinzipien wecken jene Erwartungen, die oben in der Übersetzung der Definition Alexys die Anlässe für Konsens/Dissens reduzieren, wenn die im RechtsSYSTEM erzeugten Strukturen reibungslos in den mit diesem gekoppelten Subsystemen verarbeitet werden können. Gemeint ist die »soziale Wirksamkeit« der Rechtsnormen. In der Beobachtung zweiter Ordnung findet sich seine Verbindung von Ethik und Recht als Kontingenzformel ’Gerechtigkeit’ wieder, die er letztlich durch seinen positivistischen Ansatz selbst bestätigt; der Absolutheitsanspruch im Vernunftrecht steht dem nicht entgegen: Als Subsystem der Gesellschaft findet die Weiterentwicklung der Kontingenzformel, finden die Lernprozesse im Recht in Rückkopplung mit der Gesellschaft statt, sodass der dortige die »soziale Wirksamkeit« stärkende Konsens innerhalb dieser allgemeingültig ist.
6. Schlussfolgerungen
Soweit im Vorangegangenen gezeigt werden konnte, wie die Systemtheorie rechtstheoretische Konzepte bruchlos vereinnahmt, mag das zu der Schlussfolgerung verführen, diese Theorie füge jenen nichts neues hinzu und liefere keinen eigenständigen Erkenntniswert, sondern im Gegenteil ein äußerst synthetisches, in seiner Komplexität potentiell verwirrendes Vokabular.
Durch sie lassen sich jedoch vermeintliche Widersprüche in den vorgestellten Modellen offensichtlich auflösen. Aus systemtheoretischer Perspektive ergeben sich zwischen Kant, Kelsen, Radbruch und Alexy keine wesentlichen Unterschiede, eine bereits nicht unbeachtliche Erkenntnis.
Dies mag die Vermutung nahe legen, in der Systemtheorie würden Unterschiede nivelliert, die als möglicherweise unzulässige, zumindest unpräzise Verallgemeinerung zu einer der Falsifizierung nicht mehr offen stehenden Theorie mit zu hoher Reichweite führen. Die Auflösung der Widersprüche ergibt sich jedoch aus einer wesentlich präziseren Begriffsbestimmung, als in den vereinnahmten Konzepten geleistet. Die Theorie setzt sich gerade dadurch dem Test in vollem Umfang aus.
Aus dieser Schlussfolgerung mögen wiederum Zweifel an ihrer praktischen Verwertbarkeit für die rechtsdogmatische Rechtswissenschaft und die Praxis der „juristischen Experten“572 erwachsen. Sie erscheint dann in ihrer Komplexität zu abgehoben, einzig für den Gebrauch im WissenschaftsSYSTEM bestimmt. Der Anspruch an eine rechtsdogmatische Theorie, „die Handhabbarkeit, aber auch die Widerspruchsfreiheit des geltenden Rechts [als Abgrenzungsversuche] zu gewährleisten“,573 kann von ihr möglicherweise nicht erfüllt werden. Dies Argument widerlegt sich insoweit selbst, als die Widerspruchsfreiheit gerade durch die Präzision der Abgrenzung in der Systemtheorie erhöht werden kann. Wenn, wie in der vorliegenden Arbeit, die Frage nach dem Wesen des Rechts in der Rechtsdogmatik aufgeworfen und zum praktischen Expertenproblem wird, dürfte dann auch durch sie handhabbarer beantwortet werden, als durch die widerstreitenden Verbindungs- und Trennungsversuche.
Die nunmehr mögliche Visualisierung der zuvor in 5 erarbeiteten Erkenntnisse soll das eingängig verdeutlichen.
Vor-systemtheoretische Auffassungen von Recht lassen sich in etwa folgendermaßen versinnbildlichen.574
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 2: Recht als Teil einer absoluten Ethik (Eigene Darstellung)
In Abbildung 2 sind Recht und Ethik eins. Der Absolutheitsanspruch der Ethik soll durch die geschlossene Kontur der äußeren Blase versinnbildlicht werden. Das Bild kann sowohl die Einheit von Ethik und Recht nahelegen, als auch den Ausgangspunkt ’Genese der Verselbständigung von Recht aus ethischen Normen’ andeuten. Die oben genannten Abgrenzungsprobleme werden offensichtlich, welche sich aus dieser vermuteten Einheit ergeben. Zwar können so etwa ethische Normen von solchen mit einer Rechtsfolge unterschieden werden. Inwieweit diese Unterscheidung jedoch zwingend, also logisch begründbar ist, erschließt sich daraus nicht. Der vernunftrechtliche Ansatz Kants etwa lässt keine Aussage darüber zu, wie konkret deduktiv ermittelt werden kann, welche konkreten Normen mit staatlichem Zwang durchgesetzt werden müssen. Es stellt sich hier auch die Frage nach der gesellschaftlichen Wandlungsfähigkeit dieser Unterscheidungen. Erscheint zum Beispiel die Bestrafung von Homosexualität in einem Jahrhundert als ethisch geboten, so kann das im Verlauf des folgenden in Zweifel gezogen werden, bis schließlich die Straflosigkeit folgt. Damit wird das Problem zurückgegeben in die Ethik ohne Rechtsfolge, wo der Dissens über die moralische Verwerflichkeit fortgesetzt, aber nicht abschließend geklärt werden kann.
Das Problem bleibt das gleiche, wenn das Recht als teilweise verselbständigt angenommen wird, wie von Radbruch und Alexy angenommen und in der folgenden Abbildung 3 dargestellt. Im außerhalb der Ethik lie- genden Bestand des Phänomens Rechts wird zwar Rechtssicherheit, als Unabhängigkeit vom ethischen Diskurs, hervorgebracht. Es mag auch dort die Rechtsfolge verortet werden, die eben nicht mehr Teil der Ethik ist. Die Deutungshoheit über die Zuweisung ethischer Normen zum Recht bleibt jedoch auch Schwachpunkt dieses Denkmodells. Soweit angenommen wird, dass die Gesellschaft im kantischen Sinne vernünftig ist und gleichberechtigten demokratischen Zugriff auf die Ethik und die Zuweisung zum Recht hat, mag der Grundgedanke noch überzeugen. Wenn jedoch die vernünftige, demokratische Gesellschaft allein in der Lage sein soll, Recht hervorzubringen, sie also notwendiges Definitionsmerkmal ist, müssen funktionell vergleichbare Phänomene anderer Gesellschaftsformen als etwas anderes erfasst werden. Danach wäre Recht zum ersten Mal 1788 mit Ratifikation der US-amerikanischen Verfassung in die Welt getreten und hätte sich, ausgehend von der französischen Revolution, in Europa mit der Herausbildung demokratischer Staaten etabliert, sofern sich in diesen vernünftige Gesellschaften konstituiert haben. Alles andere wurde und wird zwar ebenfalls als 'Recht', 'ius', 'law', auch ’ Jj»' (haqa) bezeichnet, es kann in dieser Tradition jedoch nicht als solches akzeptiert werden. Das führt zum Einen praktische Probleme für das jeweils nationale Kollisionsrecht herbei. Zum Anderen könnte das auch die supranationale europäische Rechtssetzung infrage stellen. Inwieweit ist dort die vernunftrechtliche Rechtssetzung nach diesem Ideal sichergestellt und wenn, seit wann? Der Begriff vom Recht wird in jedem Fall nicht geschärft, sondern verbleibt unbestimmt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 3: Recht als teilweise von der Ethik verselbständigtes Phänomen (Eigene Darstellung)
Trennt man ihn mit Kelsen analytisch, so löst man begriffliche Probleme, in dem man ihn von ethischen Erwägungen entkoppelt, wie in Abbildung 4 zu sehen. Dies ermöglicht die Analyse der dem Recht inne- wohnenden Gesetzmäßigkeiten, um sich der Gemeinsamkeiten vergleichbarer Phänomene sämtlicher Gesellschaften vergewissern zu können. Auf dieser Ebene lässt sich der Begriffsumfang bestimmen, da die Ethik seine Grenzen nicht mehr verwischen kann. Dadurch lässt sich auch der Begriffsinhalt wie eben bei Kelsen gesehen, sehr präzise beschreiben. Es ist jedoch nur eine statische Begriffsbestimmung möglich, die dem Bild gleichkommt, das oben als Momentaufnahme einer im (gedachten, nicht physischen) Raum wahrnehmbaren Struktur beschrieben wurde. Aussagen über die Entstehung von Recht und seiner fortgesetzten Wirkung sind gerade nicht möglich. Auch mit Kelsen, und wie gesehen letztlich auch Kant, ist dadurch nur wieder der Rückgriff auf die Ethik, oder bei ersterem auf die Ideologie möglich, welche durch die Politik ins Recht implantiert wird. Das führt demnach zu keiner erschöpfenden Inhaltsbestimmung, sondern wieder zurück auf Abbildung 3 mit ihren Abgrenzungs- und Begründungsproblemen. Der Begriff in seinen
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 4: Recht als getrennte Entitäten (Eigene Darstellung)
Bestandteilen bleibt unscharf und seine Definition den eine Gesellschaft jeweils bestimmenden normativen Kräften überlassen.
Gerade in Bezug auf (sonder-)kollisionsrechtliche Fragestellungen, ist dieses Ergebnis unbefriedigend, wenn auch der ordre-public-Vorbehalt letztlich als pragmatische Umsetzung beider, des analytisch trennenden und des dogmatisch verbindenden Ansatzes interpretiert werden kann. Danach wird zunächst den Entscheidungen, die als Rechtsentscheidungen eines anderen Staates äußerlich erkennbar sind, die rechtliche Qualität unbesehen zuerkannt. In einem weiteren Schritt werden die im eigenen Staat geltenden ethischen Erwägungen in unterschiedlichem Ausmaß, aber generell verhältnismäßig oberflächlich auf Übereinstimmung geprüft und gegebenfalls die rechtliche Geltung im Inland wieder aberkannt.
Grenzfälle, die etwa durch das in B III 3 herausgearbeitete Sonderkollisionsrecht des inländischen Schiedsverfahrens auftreten können, mit der in B IV 1 b identifizierten Anerkennungsproblematik, können in so pauschaler Hinsicht nur zu arbiträren Entscheidungen führen.575 Denn danach erscheinen Entscheidungen für oder wider die Wirksamkeit der Rechtswahl in sehr hohem Maße kontingent. Das zeigt sich unter anderem an den oben angedeuteten Diskussionen zum »legal lag«, die Vereinbarkeit der lex mercatoria, sportiva, technica und eben auch islamischer Vorschriften in Schiedsverfahren. Diese Unwägbarkeiten können eingeschränkt werden, wenn der Rechtsbegriff über normative Definitionen als Legalfiktion hinaus schärfer eingegrenzt wird. Das kann die Systemtheorie leisten.
Als gedanklicher Zwischenschritt bietet sich zur Visualisierung zunächst die Anlehnung an den grundätzlich obsoleten Begriff der das System speisenden 'Rechtsquelle' an,576 um das Konzept der strukturellen Kopplung darzustellen.
Blasen umgebende gepunktete Konturen in Abbildung 5 sollen die operative Geschlossenheit der angegebenen Systeme symbolisieren. Die gestrichelte Umrandung der in Anführungsstrichen benannten „Lebenssachverhalte“ soll eine vereinfachende Sammeldarstellung andeuten für Fälle, die aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Subsystemen an das RechtsSYSTEM herangetragen werden. Ebenso ist „Metaphysik“ als Frei- stelle, nicht für die rationale kantische, sondern für den gesellschaftlichen Wertekanon bestimmende Ideologien, auch Religionen,577 platziert. Sie speist hier ihrerseits die Politik und die sie rationalisierende Ethik. Die Verbinder symbolisieren die strukturellen Kopplungen, durch welche der Strukturimport als iNFORMATiONSverarbeitung vonstatten geht. Gestrichelte und gepunktete Linien stehen dabei für hier nicht näher zu benennende Kopplungen am RechtsSYSTEM vorbei. Die durchgängigen Linien verweisen auf bestimmte Verfahren, wie etwa das Gesetzgebungsverfahren, den Vertragsschluss oder spezifisches Verwaltungshandeln.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 5: Recht in der Systemtheorie (Zwischenschritt) (Eigene Darstellung)
Die antiquierten lateinischen Bezeichnungen sollen die systemische Darstellung ansatzweise aus dem zeitgenössischen Kontext herauslösen und andeuten, dass auch vergangene gesellschaftliche Zustände, etwa zu Lebzeiten Kants, möglicherweise auch bereits im ausdifferenzierten römischen RechtsSYSTEM, potentiell entsprechend beschrieben werden können. Die tote Sprache Latein soll insoweit auf die Zeitlosigkeit, mithin eine abstrakte Gegenwart verweisen. Ius scriptum / non scriptum weist zudem auch in die Richtung des »legal lag« im Bereich der Privatautonomie und der Beziehung von 'Rechtsnorm' und 'Rechtsverhältnis'.578 Die Bezeichnung 'ius aequum' steht hier für die Kontingenzformel 'Gerechtigkeit'. Die Billigkeit wird gesondert nachfolgend in II erörtert, sodass die Bezeichnung an dieser Stelle nicht infrage gestellt werden muss.
Die Darstellung zeigt einen statischen Eindruck vom Recht und seiner Einbettung in die anderen gesellschaftlichen Subsysteme, wie er einem externen Beobachter skizzenhaft erscheinen könnte. Die „Metaphysik“ wie auch die Ethik sind aus dem Recht herausgelöst und finden ihren Eingang über den Umweg der Vorfilterung in 'Politik', 'Verwaltung' und den mit diesen verkoppelten „Lebenssachverhalten“. Das Recht liegt hier im Zentrum der Aufmerksamkeit, ist also nur relativer Bezugspunkt, nicht absolut zentrales Bindeglied zwischen den übrigen Systemen.
Das zur Kenntlichmachung als Beobachtungssystem zweiter Ordnung aus dem Recht herausragende Gerichtswesen bezieht hier aus dem RechtsSYSTEM die Normen, die dort als Informationsverarbeitung aus den übrigen Systemen bezogen wurden, um sie auf den als Fakt übermittelten Lebenssachverhalt (da mihi factum) an das jeweils rechtssuchende System als konkretisierte Einzelnorm zurückzugeben (dabo tibi ius). Es ist dem VerwaltungsSYSTEM und dem jeweils betroffenen System in der Gesellschaft zwischengeschaltet, da es die Rechtmäßigkeitprüfung der Verwaltungsentscheidungen übernimmt. Die Überschneidung soll jedoch gleichsam die Verbindung durch das Recht, etwa zwischen Bürgern und Behörden andeuten, wenn letztere Verwaltungsakte erlassen, die aber auch als „ius honorarium“ im Bild berücksichtigt werden.
Die dem Programm immanente Kontingenzformel wird hier als interne Kopplung zwischen der zweiten Beobachtungsebene und dem RechtsSYSTEM versinnbildlicht. (Diese Ungenauigkeit der vermeintlichen Gleichsetzung mit Kopplungen zu den übrigen Subsystemen ist den Schwächen der zweidimensionalen Darstellung geschuldet.)
Die in den strukturell gekoppelten Systemen geweckten Erwartungen werden über die Verfahren 'Gesetzgebung' (ius scriptum), (spezielles) 'Verwaltungshandeln' („ius honorarium“) und 'Vertragsschluss' (ius non scriptum) als die Operation 'Strukturimport' in Rechtsnormen symbolisch generalisiert und so ins RechtsSYSTEM integriert.
Diese statische Skizze stellt, gewissermaßen aus der Vogelperspektive, den Aspekt des RechtsSYSTEMS als der Summe seiner Teile in Form ihres Erzeugnisses, den Strukturen 'Rechtsnorm' in den Vordergrund. Damit stellt sie eine Möglichkeit dar, die Lösungsvorschläge der Systemtheorie für die in einfacheren, zuvor genannten Modellen nicht darstellbaren Probleme sichtbar zu machen: Die Verortung und Einbindung des Rechts im GesamtSYSTEM. Dadurch wird aber der Rechtsbegriff nicht eindeutiger bestimmt als zuvor.
Das dynamische Element des RechtsSYSTEMS, die autopoietische Operation, erscheint hier als bloße Mehrzahl von Verknüpfungen. Tatsächlich ist der Rechtsbegriff indes genau darauf zurückzuführen. Die Darstellung muss also folgendermaßen, gewissermaßen als Querschnitt durch das System 'Gesellschaft', überarbeitet werden (siehe Abbildung 6).
Jedes normerzeugende Verfahren stellt eine Operation dar. Auch das operierende System selbst ist 'Recht', das 'Recht' hervorbringt und in seinen Strukturen als Erwartung und Erinnerung speichert. Wie ausgeführt, geht es in allen seinen Bestandteilen auf. Werden diese jedoch einzeln analysiert, so kondensiert der Begriff auf der Operation, weil in ihr alle Verknüpfungsleistung, Reflektion und Unterscheidung geleistet wird, die Recht ausmacht. Das Gerichtsverfahren erkennt Recht nicht als die Existenz einer bestehenden Norm, sondern, rechtsdogmatisch gesprochen, als Subsumtion eines Sachverhalts unter - nun mit Kelsen - ein bestehendes Deutungsschema, das - nun mit Luhmann - die Kontingenz der Entscheidung nach dem Schema 'Recht/Unrecht' entsprechend den generalisierten Erwartungen der Gesellschaft einschränkt. Als Ergebnis im RechtsSYSTEM wird eine neue Norm erzeugt, welche die Kontingenz späterer Entscheidungen weiter einschränkt, oder auch erweitert, je nachdem zu welchem Ergebnis die Auffangkorrektur durch die Kontingenzformel führt. Das lässt sich ebenso auf die genannten übrigen Verfahren übertragen, die in gleicher Weise als Recht Rechtsnormen unterschiedlicher Reichweite produzieren. Von diesen ist dann die Rechtsfolge zu trennen, die als Strukturimport in das Subsystem eintritt, in dem sie sich auswirken soll und damit allein etwas artverschiedenes, wenn auch nicht wesensfremdes wird, da dieses wie jenes Kommunikation ist.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 6: Querschnitt Gesellschaftssystem mit Referenz Rechtssystem (Eigene Darstellung)
Dass diese Erkenntnis keineswegs trivial ist, wenn sie auch zweifellos so anmutet, zeigt sich in Kelsens Lehre vom Rechtssatz. Dort erscheint die Unrechtsfolge als differentia specifica der Rechtsnorm zu anderen. In seiner statischen Sicht liegt dieser Schluss nahe. In differenzierter dynamischer Sicht ist sie kein Begriffsbestandteil mehr.
Somit lässt sich feststellen: 1) Die Systemtheorie des Rechts ermöglicht eine nachprüfbare, differenzierte und schlüssige Begriffsbestimmung ihres Gegenstands. Sie festigt seinen Verfahrensaspekt und macht den Begriff dadurch belastbar und handhabbar. 2) Steht infrage, ob Normen als Rechtsnormen zu qualifizieren sind, muss zunächst geprüft werden, ob sie einem RechtsSYSTEM entstammen, nicht welche Folgen sie bedingen.
3) Ein RechtsSYSTEM setzt ein GesellschaftsSYSTEM voraus, an welches es das Ergebnis seiner Unterscheidung übergeben kann. Das erfordert wiederum ein operierendes System, in dem die Operation 'Recht' das Rechtsgeltungssymbol fortlaufend weitergibt.
Insoweit erfährt die normative Bindung an staatliches Recht in § 1051 Abs. 1 ZPO auch eine objektivierte Begründung. Implikationen, die sich daraus für die Billigkeit ergeben, sind Gegenstand der folgenden Erörterungen, um schließlich in D wieder den Anschluss an die Rechtsdogmatik zu suchen.
II. Billigkeit
Im Zwischenergebnis unter I 4 wurde Kants, aus vor-systemtheoretischer Sicht inkonsistent anmutende, Trennung von Recht und Billigkeit kritisiert. Der kategorische Imperativ kann das Prinzip nahe legen, dass niemand übervorteilt werden darf. Lässt sich auf positiver Grundlage das Ausmaß der Übervorteilung nicht bestimmen, weil etwa, wie in seinem Beispiel aus dem Gesellschaftsrecht, keine vertragliche oder gesetzliche Regelung für die unvorhergesehen ungleiche Verlustverteilung vorgesehen ist, wodurch ein Ausgleichsanspruch weder dem Grunde noch der Höhe nach bestimmt werden kann, so besteht im kantischen Sinne die sittliche Pflicht, dennoch eine Lösung zu finden. Diese bleibt im Recht verwehrt, wenn die Entscheidung nicht auf einen Dritten übertragen werden kann.
Kants theoriegeleiteter Optimismus, wonach die pflichtbewussten, also von Eigennutz und Neigung freien, ihr Gegenüber um seiner Selbst willen wie sich selber schätzenden und dementsprechend handelnden Individuen dennoch untereinander zu einer sachgerechten Lösung finden können, ist aus zwei Gründen mit Vorsicht zu betrachten. Empirisch wird bereits unbestreitbar ein signifikanter Anteil auf dieser Ebene ungelöster, verhärteter Konflikte zu erfassen sein. Doch auch a priori ist das Dilemma schwer zu überwinden. Denn das Individuum, dass seinen eigenen Bedürfnissen ebenso verpflichtet ist wie den fremden, wird zwar keine Schwierigkeiten damit haben, den gegnerischen Anspruch dem Grunde nach anzuerkennen. Die Bestimmung der Höhe kann indes nur erfolgen, wenn einer sich selbst als Mittel zum Zweck des anderen oder um des Friedens willen aufgibt, also wieder im kantischen Sinne gegen Vernunftrecht verstößt, unsittlich handelt.579
Der kategorische Imperativ lässt sich danach eher aus der alttestamentarischen Ausgleichende Gerechtigkeit kann so in der Sittlichkeit nicht gefunden werden, wenn das überhaupt möglich ist. Insoweit muss das oben angeführte Argument, Billigkeit und Gerechtigkeit seien identische Begriffe, noch einmal ausdrücklich zurückgenommen werden, wenn es sich auch nach den vorangegangenen systemtheoretischen Erwägungen erübrigt hat. Was die Billigkeit allein zu leisten vermag, ist eine konfliktlösende Entscheidung herbeizuführen. Ob dies willkürlich, gewissermaßen »mit der Brechstange«, oder doch rational begründbar zu erfolgen hat, wird sogleich erörtert.
1. Billigkeit als Recht
Der historische Begriff des ius aequitas wurde, nach Luhmann, als „Ausgleichsbegriff“ eingeführt, mit dem einem „»souveränen«“ Entschei- der die „Sonderkompetenzen“ zugewiesen wurden, Rechtsentscheidungen nach seinen Gerechtigkeitsvorstellungen hin abzuändern.*580 In England hat sich in diesem Sinne eine Billigkeitskontrolle der Rechtsprechung (equity) herausgebildet, die vom Stellvertreter des Königs vorgenommen wurde.581 An diesen wurden Bittgesuche herangetragen, Fälle zu entscheiden, für welche die Gerichte nach den Grundsätzen des Common Law keine zufriedenstellende Lösung anbieten konnten.582 In Preußen war diese Kontrolle wohl als vom König selbst ausgeführte Überwachung der Gerichte für einige Zeit gar verbindlich.583 Letztere wird verhältnismäßig unsystematisch, ausschließlich am Einzelfall orientiert erfolgt und aus Misstrauen des »obersten Staatsdieners« gegenüber der Qualität des Rechtsfindung im Gericht geboren worden sein. Erstere hingegen wurde über mehrere Jahrhunderte hinweg offensichtlich als Notbehelf institutionalisiert, wodurch sich ein geordnetes Verfahren und Regeln als Grundsätze zur Anwendung von Billigkeit herausgebildet haben.584 Nach Gerichtsverfassungsreformen ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde das Rechtsmittel der Billigkeitsprüfung der Exekutive aus der Hand genommen und dem Höchsten Berufungsgerichtshof zugeordnet, vor dem seither einheitlich law und equity zur Anwendung kommen.585
Dieses Rechtsmittel des englischen RechtsSYSTEMS kann als ein diesem eigenes Verfahren erkannt werden. Nach der soeben vollzogenen Eingrenzung des Rechtsbegriffs ist die Billigkeit folglich Operation und damit Recht, wie auch ihre Struktur, die Billigkeitsnorm. Auch eine obligatorische »preußisch-königliche« richterliche Entscheidungen stellt ein Verfahren dar. Soweit diese aber unabhängig vom Parteiwillen erfolgt, und ihr letztgültiges Ergebnis vom Gutdünken des Monarchen abhängig ist, sinkt die Verlässlichkeit des Rechts. Zur Klärung der dadurch aufgeworfenen Frage nach der Rechtsqualität einer solchen Prozedur, soll Luh- manns oben eingeführter Begriff der Kontingenzformel als Programmund damit OPERATiONSbestandteil erneut herangezogen werden.
Als erzwungene Auffangkorrektur im Sinne des Gleichbehandlungsgrundsatzes, ausgleichender Gerechtigkeit, erhöht auch sie wie bereits ausgeführt die Kontingenz zu fällender Entscheidungen. Soweit sie jedoch im RechtsSYSTEM weiterentwickelt wird, geschieht dies im Kontext vorangegangener Korrekturen, sodass sie selbst wieder vorhersehbar wird, gerade also konsistenzsteigernd wirkt.
Ist das Gegenteil der Fall, weil eine Institution, wie hier der Monarch, diese Auffangkorrektur an sich ziehen kann, mögen ihre Handlungen als systeminternes Verfahren also Operation und damit Recht erscheinen, selbst wenn es vollkommen unvorhersehbare Entscheidungen hervorbringt. Der »König als Staat« ist dann auch »König als Recht«. Wird jedoch der Zeitpunkt bedacht, an dem er diese Kontrolle vornimmt, ändert sich der Eindruck. Die Unterscheidung 'Recht/UnRecht' wurde bereits abgeschlossen, Erwartungen bestätigt oder auch enttäuscht und der Wiedereintritt steht an, um die Un-Rechtsfolge ans GesamtSYSTEM auszuliefern. Diesen verzögert der »Souverän«, um den Rückgabewert nach seiner persönlichen Vorstellungen von 'richtig/falsch', die gerade nicht im RechtsSYSTEM entwickelt wurden, beliebig abzuändern. Er wirkt somit außerhalb. Sein Verfahren ist außerrechtlich.
Konnte soweit die von außen erzwungene Auffangkorrektur dequali- fiziert werden, so lässt sich doch nicht die Billigkeitsprüfung mit der intern zwingenden Kontingenzformel 'Gerechtigkeit' unmittelbar vereinbaren. Mit dieser operiert das System auch ohne Zutun der Parteien. Ist der Billigkeitsprüfung wesentlich, nach dem Willen einer betroffenen Partei berufen zu werden, indem sie das entsprechende Rechtsmittel einlegt, so könnte das Verfahren als Korrektur der Auffangkorrektur erneut mit 'Gerechtigkeit' in Verbindung gebracht werden. Dann müsste sie auf den erneuten Vergleich mit bisher getroffenen Auffangkorrekturen zielen. Unter Berücksichtigung von Kants Beispiel, lässt sich das jedoch nur zum Teil bestätigen.
Die Billigkeitsprüfung soll Entscheidungen herbeiführen, die gerade nicht im Kontext vergangener Fälle zu beurteilen sind. Sie verlangt »Rechtsinnovation« und damit eine Steigerung der Kontingenz. Technisch gesprochen wird eine Information importiert, deren Verarbeitung zur Struktur das System stärker belastet, als der Normalfall, da ihm die Vergleichsmaßstäbe fehlen. In zeitökonomischer Hinsicht dürfte die Belastung nur reduziert werden können, wenn das Maß an Willkür des Entscheiders steigt. Wird in dieser Weise eine Rechtsnorm innoviert, durchläuft sie automatisch wieder die Auffangkorrektur. Da weniger Anhaltspunkte zum Vergleich zur Verfügung stehen, kann diese nur oberflächlich erfolgen. Eine Vielzahl von Billigkeitsentscheidungen im Zeitverlauf steigert indes wieder die Unterscheidungskompetenz, da mit ihnen auch die Anzahl ähnlich gelagerter Fälle steigt.
Der durch Billigkeitsentscheid zu lösende Konflikt besteht zwischen Beobachtern erster Ordnung des RechtsSYSTEMS, die Unterstützung der zweiten BEOBACHTUNGSebene in Anspruch nehmen. Wie in I 5 a gesehen, operieren die Teilnehmer auf der ersten. Es erscheint demnach zulässig, den Billigkeitsentscheid allein im Privatrecht zu ver- orten und die herausgebildeten Strukturen als Kontext Verkehrssitte, auch Treu und Glauben zu identifizieren. Insoweit die Vertragspartner sich vertraglich auf eine untereinander gefällte Billigkeitsentscheidung einigen können, wie Kant es sich wünscht, operieren sie als ihre eigenen Beobachter zweiter Ordnung und erweitern so eigenständig den empirischen Bestand der Verkehrssitte. Dieser wird in der Auffangkorrektur berücksichtigt, ist also Anknüpfungspunkt der Kontingenzformel 'Gerechtigkeit'. So modifizieren Billigkeitsentscheidungen über einen längeren Zeitraum die Programmierung des Systems wirken mithin auf die operative Ebene zurück. Das Maß von außen nicht vorhersehbarer Willkür in der Entscheidungsfindung schmilzt daher auf jene Punkte zusammen, für die es keinen Vergleichsmaßstab im RechtsSYSTEM gibt. Diese kann als die strukturelle Kopplung zum psychischen System der Entscheider beschrieben werden.
Berücksichtigt man die Eigentümlichkeit der Systemtheorie, reflexive Begriffe einzuführen, die aus der Beobachtung von Systemen in Raum und Zeit resultieren, lässt sich Billigkeit im Raum als die Gesamtheit der durch Billigkeitsentscheidungen erzeugten Rechtsnormen beschreiben. Ebenso kann der Begriff auf das Verfahren rekurrieren, das diese Normen hervorbringt. Als solche ist sie wesensgleiche Operation, in der 'Gerechtigkeit' Berücksichtigung findet, und daher nach hiesiger Definition Recht.
2. Billigkeit im Schiedsverfahren
In diesem Gliederungspunkt soll bereits ansatzweise an die Rechtsdogmatik angeknüpft werden. Wie in B III 3 gesehen, wirken § 1051 Abs. 3 und 4 ZPO im Zusammenhang als Sonderkollisionsrecht. Diese Rechtswahl hat sich dort insoweit als Ausschluss staatlichen Rechts erwiesen, als bis zur Grenze des ordre public die Anwendung staatlichen Rechts ausgeschlossen werden kann. Das Ergebnis aus B IV legt nahe, an der Wirksamkeit des Staatsvorbehalts bei Billigkeitsentscheidungen zu zweifeln.
Die in der Hand der Schiedsparteien liegende Entscheidung über den Umfang der Billigkeitsermächtigung zeigt das Maß ihrer Bereitschaft, einen ungewissen Ausgang des Schiedsverfahrens bewusst in Kauf zu nehmen. Die vernunftbegabten Gesellschafter bei Kant würden allein die Entscheidung über die Höhe des Ausgleichsanspruchs an den Schiedsrichter delegieren, den sie dem Grunde nach anerkannt hatten. Konnten sie auch in diesem Punkt vorher keine Einigung erzielen, würden sie sich wohl kaum vollkommen in die Willkür des Schiedsrichters ergeben, sondern dessen Entscheidungsspielraum so klar definieren, dass die Kontingenzen in einem überschaubaren Rahmen bleiben, der potentiell allen Seiten gerecht wird.
Ihre Rechtswahl als Vertrag ist ein Verfahren, mithin Operation 'Recht'. Die von ihnen gewählten Beschränkungen der Schiedsrichter werden zur Rechtsnorm, auf welche die zur Entscheidungen Berufenen ihre Rechtserzeugung als Operation 'Recht' ausrichten müssen. Auch der Hauptvertrag, aus dem sich die Streitigkeiten ergeben ist Recht. Die auf ihn dispositiv für anwendbar erklärte Verkehrssitte bindet die Entscheidung der Privatrichter ebenfalls. Sie wird in das Programm des Schiedsverfahrens importiert. Das Schiedsverfahren und die dasselbe in Geltung bringenden Operationen (Hauptvertrag, Schiedsvereinbarung und Rechtswahl als Ermächtigung zur Billigkeitsentscheidung) stellen einen Anschluss zum RechtsSYSTEM ’Deutsches Recht’ her, wodurch die vereinbarten Normen deutsche Rechtsnormen werden. Das Schiedsverfahren kann insoweit als Verfahren zum Rechtsimport betrachtet werden.
Die im Zwischenergebnis unter B V angesprochenen Probleme bei der materiellen ordre-public-Prüfung bleiben bis hier scheinbar bestehen. Das Schiedsverfahren deutet seinen normativen Input in deutsche Rechtsnormen um und bringt eben solche hervor. Der Wiedereintritt wird über § 1055 ZPO vorgenommen, wodurch der Anschluss ans GesamtSYSTEM hergestellt wird. Eine zurückhaltende révision au fond als Auffangkorrektur wäre demnach nur in den Grenzen der verfahrensrechtlichen Ebene möglich. Materiell sind deutsche Rechtsnormen nicht zu prüfen. Dieses Argument wird ein drittes und letztes Mal in D aufgegriffen, um es für diese Arbeit abschließend zu klären.
Soweit es dort aber auch in der hier entwickelten Interpretation der Systemtheorie Luhmanns Bestätigung findet, sollten Schiedsparteien inländischer Schiedsverfahren die gewünschten Beschränkungen der Billigkeitsentscheidung mit Bedacht danach auswählen, inwieweit rationale, für sie also vorhersehbare Entscheidungen in diesen möglich sind. Inwieweit das auf islamisch geprägte Rechtsfindung zutrifft, soll im Folgenden untersucht werden. Dabei verweist der Artunterschied ’islamisch’ lediglich auf den Kontext ’Islam’ als Kulturphänomen, ohne schon eine notwendige Begriffsverengung auf nicht-säkulare Aspekte vorwegzunehmen. Als Kultur wird im alltagssprachlichen Sinn die „Gesamtheit der geistigen [und] künstlerischen Lebensäußerungen einer Gemeinschaft“586 verstanden, als ein Teil dieser Gesamtheit, das Kulturphänomen.
III. Rechtsimport aus dem Islam
Rechtsimport im hier verstandenen Sinne bezieht sich zunächst auf das Strukturen importierende System. Wird im Folgenden untersucht, inwieweit die Bindung an islamische Rechtsfindung die Willkür der Ent- scheider begrenzt, so soll aber auch bereits geprüft werden, wie die angebotenen Strukturen selbst zu charakterisieren sind.
1. Ratio des Islam
Den komplexen Implikationen einer Religion kann man zweifellos nicht mit wenigen Worten gerecht werden. Dieser Anspruch wird hier auch nicht verfolgt, geht es doch an dieser Stelle »nur« um Grundlinien der Entscheidungsfindung im Islam, um Indizien für Möglichkeiten rationalen Ermessens, welche die Kontingenz der Billigkeitserwägungen von Schiedsrichtern einschränken, also von den Schiedsparteien sinnvoll vereinbart werden können, um sich gegen all zu freie Rechtsschöpfung abzusichern.
a) Methodik
Zum zuvor genannten Zweck erscheint hier der Begriff ’^l£=d' (Ijtihad), das ernsthafte Bemühen um die Erkenntnis der zutreffenden islamischen Beurteilung eines Sachverhalts, das „Rechtsraisonnement“,587 als der vielversprechendste Ausgangspunkt.588 Der idealtypische Rechtsgelehrte oder Jurist, <uliß (der Faqah, Pl. ^l$äi - Fuqaha‘), sei weder notwendig männlich, noch zwingend im rechtlichen Sinne frei,589 wisse „um den durch den Verstand gewonnenen Hinweis“, JJaH (der Dalal), habe ausreichende sprachliche Fähigkeiten, sich mit den Erkenntnisquellen der islamischen Urteilsfindung angemessen auseinandersetzen zu können und sei ausreichend dogmatisch vorgebildet.590 Im zeitlichen Kontext der historischen Quelle,591 welcher diese Definition entnommen wurde, erschließe sich die Dogmatik aus den Arbeiten der „führenden Gelehrten“ in ausreichendem Maße. Zu jener Zeit war ein RechtSYSTEM aktiv, in dem islamische Rechtsfindung betrieben wurde, weshalb aus der damals gegenwärtigen Literatur die Systematisierung des geltenden Rechts hervorging.592 Die Konzentration auf die Rechtsanwendung ließ Kenntnisse der „spekulativen Theologie“ für die Rechtsfindung für ebenso zu vernachlässigen erscheinen, wie ethische Gerechtigkeitserwägungen.593 Nach der oben herausgearbeiteten Kontingenzformel, als Gerechtigkeit im Recht, soll hier »ethische« Gerechtigkeitserwägungen auf die Diskurse deuten, die außerhalb des RechtsSYSTEMS stattfinden. Das deutet auf ein positivistisches Rechtsverständnis hin, wie auch die Berufsbeschreibung »des Juristen« sich mit derzeitigem säkularen Verständnis in Einklang bringen lassen dürfte. Soweit spekulative, also hypothetisch-theoretische Theologie ausgeschlossen ist, könnte die islamische Rechtsfindung als angewandte, praktische Theologie zu verstehen sein, wofür spricht, dass ihre Erkenntnisse aus den beiden primären Quellen, (der Qur'an, künftig jedoch 'Koran') und (die Sunna), erschlossen werden.594
Lohlker ist demnach zuzustimmen, der dies als religiös geprägte Säkula- rität beschreibt,595 was vielleicht auch als säkular geprägte Religiösität bezeichnet werden könnte.
Die Priorisierung führender Gelehrtenmeinungen kann als Arbeitsteilung gesehen werden. Sie leisten die dogmatische Vorarbeit, die Grundlage des Ijtihad der Lebenssachverhalte zu beurteilenden Juristen wird. Dieser stellt sich als Diskurs darüber heraus, was in einem konkreten Anwendungsfall Recht sei. Die ihm zugrunde liegende Methodik erfasst diverse Schlussverfahren der klassischen Urteilslehre beziehungsweise „die gesamte Palette juristischer Argumentationskunst“,596 ^LïH (der Qijas), von denen einzelne, wie etwa die Analogiebildung, in der islamischen Rechtsliteratur umstritten sind.597 Ferner gehört gewissermaßen eine, gleichsam viel diskutierte Auffangkorrektur nach Billigkeitsgesichtspunkten, das „Für-Besser-Halten“,598 zum Instrumentarium: (Istihsan). Auch das Korrektiv der „Berücksichtigung allgemeinen Nutzens“,599 (Istislah)600 sowie des „[Versper- rens] der Mittel“,601 £^?? ?^ (Sad ath-thara’i‘) gehören dazu. Der allgemeine Nutzen im islamischen Sinne umfasst die fünf Schutzgüter „Religion, Person, Verstand, Nachwuchs und Vermögen“, welche bei der Rechtsanwendung zu berücksichtigen sind.602 Bei der Betrachtung einzelner Rechtsvorschriften geht es hier um die Frage nach ihrem Sinn und Zweck. Die Reichweite einer Auslegung in diesem Sinne ist ebenfalls strittig.603 Sie eignet sich zur Lösung von Normwidersprüchen, 604 erhöht jedoch freilich die Kontingenz islamischer Rechtsentscheidungen bei besonders extensiver Anwendung des Istihsan, wie etwa der großzügigen Anwendung des Notrechts.605 Auch Sad ath-thara’i‘ dient der Erzeugung widerspruchsfreier Entscheidungen. Hier geht es um das Erkennen von »Gestaltungsmissbrauch«, also von Handlungen, die den Anschein rechtmäßigen Handelns setzen, jedoch mit dem Ziel, das Recht zu umgehen, „[was] zu Verbotenem führt, [ist] selbst verboten“.606 Auch über die Ausprägung dieses Instruments scheint sich im Diskurs der Rechtsgelehrten keine herrschende Meinung ihrer Autoritäten herausgebildet zu haben. Schließlich ist das Prinzip (Istishab),
„Fortbestand“ oder „<Beibehaltung>“ zu nennen.607 Danach werden einmal begründete Rechtsverhältnisse als fortbestehend betrachtet, solange keine Aufhebungsgründe ersichtlich sind.608 Diese aufgezählten Methoden finden ihre Anwendung bei der Ermittlung des »räumlichen« und zeitlichen Zusammenhangs islamischer Rechtsnormen. So gilt der Grundsatz des Anwendungsvorrangs der spezielleren,(al-Chass) gegenüber der allgemeineren, »l*Jl (al-A mm ), sowie der späteren gegenüber der den gleichen Sachverhalt regelnden früheren, die „Verdrängung oder Abrogation“, ^^j (nasch).609 Die zeitlich verdrängende, abrogierende Norm ist (nasich), die verdrängte (mansuch).
Die Methoden des Ijtihad und die Diskussion ihrer Zulässigkeit und Reichweite lassen zum Einen den Schluss zu, dass sie sich im Grunde nicht wesentlich vom gängigen Instrumentarium der Rechtslehren anderer Kulturkreise unterscheiden. Zum Anderen deuten sie auf die als notwendigerachtete pluralistische Auseinandersetzung, (Ichtilaf ), hin.610 Insoweit liegt die Vermutung nahe, dass auf methodischer Ebene grundsätzlich die Ratio islamischer Rechtsfindung mit anderen, insbesondere derjenigen säkularer Staaten in Einklang zu bringen ist.
Ihre Anwendung findet sie in der Unterscheidung menschlichen Verhaltens in JM^ (halal)611, erlaubt, sowie » (haram)612, verboten. Dieses Begriffspaar ist indes nicht kontradiktorisch entgegengesetzt. Halal beinhaltet im weiteren Sinne das gesamte Spektrum von gebotenen bis immer noch erlaubten, aber verpönten Handlungen:613 (1) / j*j9 (wajib/fard: geboten, verpflichtend, notwendig, unabdingbar), (2) / ^*1^« (mandub/mustahabb: empfohlen, erwünscht, lobenswert), (3) ^L« (mubah: neutral, indifferent) und (4) cj^C« (makruh: ablehnenswert, missbilligt, verpönt). Unüberbrückbar ist der Gegensatz folglich zwischen Kategorie (1) und (5), haram, dieses quinären Bewertungsschemas.614 Eine binäre Unterscheidung betrifft die Wirksamkeit einer Handlung: (sahth), gültig, und seine Negation J^l (butil) oder auch (fasid).615
b) Erkenntnisquellen
Erkenntnisquellen616 des Ijtihad zur Vornahme dieser Bewertungen sind unter anderem die nicht abrogierten Normen der ??? (Tora) und des Neuen Testaments, auf welchen der Islam aufsetzt, der für sich in Anspruch nimmt, als Reform seiner beiden Vorgängerreligionen deren Fehlentwicklungen endgültig zu korrigieren.617 Auch (der -Urf ) und S^Lt (Ada), lokales Brauchtum und Gewohnheiten, werden in die Klärung konkreter Rechtsfragen einbezogen, sofern sie nicht aus islamischer Sicht als haräm zu beurteilen sind, also gegen zwingende islamische Normen verstoßen.618 Darin lässt sich gewissermaßen eine Kollisionsregelung sehen, die angesichts des Spielraums von haläl potentiell die Anpassungsfähigkeit islamischen Rechtsdenkens an die regionalen Begebenheiten erhöht. Insoweit ist Lohlker nicht zuzustimmen, der einzig wäjib und haräm als im eindeutigen Sinne rechtliche Kategorien anerkennen will.619 Ausdrücklich verboten ist, was nicht geboten ist. Die Erkenntnis, dass etwas nicht verboten ist, daher keine Rechtsfolge nach sich zieht und somit auf jeden Fall erlaubt, gleichgültig ob erwünscht, indifferent oder verpönt, also halal, ist gerade die Unterscheidung, die in einem RechtsSYSTEM vorgenommen wird.
Auf originär islamischer Ebene fand auch eine Auseinandersetzung mit den Weggefährten des Propheten (Muhammad) als Argumentati onshilfe statt, die zu ihren Lebzeiten für den Diskurs je nach späterer Auffassung mehr oder minder relevante Entscheidungen getroffen haben.620 Sie erscheinen so als früheste Quelle einer sich herausbildenden herrschenden Lehre. Diese hat sich prinzipiell in £05· I (Ijmä ‘), dem „Konsens der Rechtsgelehrten“,621 verfestigt, der sich allerdings nach den einzelnen Konfessionen teilweise unterscheidet, in denen widerstreitende Lehrmeinungstendenzen zu verschiedenen »^aaIUI (die Mathahib)622, (Rechts-) Schulen, zusammengeschlossen wurden.623 So unterscheidet sich etwa der Ijmä‘ im ïl^Jl Ja! (Ahl as-sunna, Volk der Tradition = Sunniten) und (der [die] Schä‘a, Partei = Schiiten).624 Insoweit kann von einem wirklichen, auch konfessionsübergreifenden Konsens aller relevanter Gelehrten wohl kaum oder doch nur für einen sehr begrenzten Bereich des Islam gesprochen werden, zumal darin stets auch die Frage nach der Bedeutung einzelner Gelehrter zu beantworten ist.625 Ob das überhaupt ein realistisches Ziel ist, kann gleichsam infrage gestellt werden. Bedenkt man die Schwierigkeiten des europäischen Rechtsangleichungsprozesses, erscheint die Erwartung unredlich, von Gelehrten einer Religion eine kulturraumübergreifende Einigung zu erzielen. Dies mag zur Doktrin „vom <Schließen des Tors zum [Ijtihäd]>“626 geführt haben, die bereits zwischen dem 8. und 9. Jahrhundert christlicher Zeitrechnung vom Rechtsgelehrten asch-Schafiä (gest. 820) erklärt wurde, der damit wohl auch seine eigenen Erkenntnisse und den Stand der islamischen Rechtswissenschaft fixieren627 und möglicherweise den innerkonfessionellen Diskurs eindämmen wollte, welcher wohl gerade die mit der wirklichen Rechtsanwendung betrauten Juristen überforderte.628 Daran macht sich nicht zuletzt auch das spannungsreiche Verhältnis von weltlicher Rechtsanwendung und Gelehrsamkeit bemerkbar, wenn islamische GesellschaftsSYSTEME errichtet sind, die auf die Expertise letzterer zurückgreifen, aber gleichsam das Bedürfnis nach Rechtssicherheit haben, nach konsistenten Entscheidungen, die Erwartungen befriedigen können.629 Dies macht die Figur oJlüIH (der Taqäd), die Nachahmung, Imitation oder Tradition, verständlich, welche die kritiklose Übernahme von Lehrmeinungen fordert,630 jedoch wohl nur für jene, die nicht kompetent genug sind, sich ihre eigene Rechtsmeinung zu bilden; islamische Juristen im Sinne der obigen Definition sind danach gerade nicht zur unkritischen Nachahmung befugt.631 Die rechtlich ungeschulten seien daran gebunden, ein Rechtsgutachten, jjlüJI (der Fatwa632, Pl. jjlls - Fatawa), bei dem „gelehrtesten der Leute [ihrer] Zeit“633 einzuholen. Die Wirksamkeit eines Fatwas ist danach einzelfallbezogen und von der Qualifikation des Rechtsgelehrten abhängig. Ist diesen kompetesten der Gelehrten selbst nicht der Taqläd gestattet, so müssen sie den Ijtihäd fortsetzen. Auch über diesen Punkt herrscht Dissens, auch kann erste- rer als Teil des letzteren aufgefasst werden.634 Zumindest aber sprechen gute Gründe dafür, nicht von einem »verschlossenen Tor« auszugehen. Die Lehrmeinungen vergangener Jahrhunderte sind eingebettet in ihren historischen Kontext. Mit dem Fortschreiten der gesellschaftlichen Entwicklung, müssen ihre Erkenntnisse überprüft und an die Gegenwart angepasst, womöglich auch abrogiert werden, so wie die Gelehrten es auch zu Lebzeiten getan haben.635 Ob das als Taqlid im Ijtihad zu verstehen ist, oder als Berufung islamischer Juristen zur lebendigen, ortsund zeitangemessenen Rechtslehre, mag dahingestellt bleiben. Sie sind zumindest daran gebunden, nicht leichtfertig, auf sich gestellt Lösungen zu entwickeln, sondern in Auseinandersetzung mit den Erkenntnisquellen islamischen Rechts. Das »Mühsal« der Entscheidungsfindung bleibt ihnen daher nicht erspart. Es führt dann jedoch in beide Richtungen: Die vertretbare Trennung des zeitlosen Bestands der Erkenntnisquellen vom überholten und die Berücksichtigung der Notwendigkeiten von Raum und Zeit. Auch das könnte sie zu Entscheidungen befähigen, die Erwartungen von Rechtssuchenden bestätigen können, welche darauf vertrauen, ihren eigenständigen nicht regelbaren Konflikt von qualifizierter dritter Stelle in Einklang mit ihren religiösen Bedürfnissen, aber auch in der realen Welt durchsetzbar, lösen lassen zu können.
Der Prophet Muhammad gilt den Gläubigen notwendig als höchste Autorität in allen den Islam betreffenden Fragen. Zahlreiche ihm zugeschriebene Schilderungen seiner Äußerungen und Taten sind als kurze Erzählungen überliefert,[Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten] (der Hadith, Pl.[Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten] - Ahidith), die in Sammlungen zusammengetragen worden sind. Diese wurden in der islamischen Hadith-Kritik als sahih für 'gesund' oder 'authentisch', (hasan) für 'schön' oder 'gut' und[Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten] (daif) für 'schwach' klassifi ziert.636 Sie haben sich mit weiteren, in den jeweiligen Konfessionen teilweise abweichenden Überlieferungen überwiegend als Quellenbestand der Sunna (des Propheten) behauptet637 und wurden, nicht unumstritten, auch als Erkenntnisquelle für rechtliche Entscheidungen bestätigt.638 So sind Ahädäth zu Fragestellungen des Privatrechts, des Öffentlichen und Strafrechts sowie des Prozessrechts hinterlassen worden.639 Als „[erste] und vornehmste“ Erkenntnisquelle gilt unbestritten der Koran.640 Er ist die gesicherte Grundlage der Deduktion und ebenso deren Referenz.641
c) Erkenntnisziel
Die aufgezeigten Erkenntnisquellen sollen den Fuqaka‘ den Weg zur islamkonformen Beurteilung menschlicher Handlungen weisen, damit diese den Nicht-Gelehrten Sicherheit bieten können, ihr Verhalten entsprechend auszurichten. Die aus den Quellen gewonnenen Erkenntnisse und die Quellen selbst, auch der Koran, sind dadurch jedoch noch nicht das, was den Begriff [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten](die Scharä‘a) ausmacht, wenn auch die in A II zu Wort gekommenen Stimmen nahe legen, sie als islamische Bezeichnung für 'Recht' zu betrachten.
Rohe definiert sie als „die Gesamtheit aller religiösen und rechtlichen Normen, Mechanismen zur Normfindung und Interpretationsvorschriften des Islam“.642 Das führt zweifellos aus dem Rechtsbegriff im engeren Verständnis des Wortes, das hier angestrebt wird, heraus. Es bleibt jedoch im empirisch erfassbaren Bestand stecken. Loklker erarbeitet eine Begriffsbestimmung, die den Weg zu einer zutreffenderen Charakterisierung weist, durch welche der religiösen Prägung auf einer anderen Ebene Rechnung getragen wird. Nach ihm ist die Scharä‘ a „die Gesamtheit der göttlichen Beurteilungen menschlicher Handlungen“.643 Indem er sich vom menschlichen Element löst, kommt er dem Begriffsverständnis näher, das nicht der Mensch, sondern »Gott« nach islamischem, wie auch jüdischem und christlichem Verständnis eine Beurteilung in 'gut' und 'schlecht' vornimmt. Khorchide sieht in der Übersetzung des arabischen Wortlauts für den »Weg zur Quelle«, gleichbedeutend mit »Weg zu Gott«, den Ausgangspunkt des individuellen Begriffsverständnisses. Abhängig von der persönlichen Gottesvorstellung sei eine eher streng juristische Anschauung der Scharä‘ a geprägt von dem Bild eines belohnenden und bestrafenden Gottes; in einer eher nach innen gerichteten, ethischen und spirituellen Auffassung dieses Weges komme hingegen das Verständnis eines Gottes zum Ausdruck, der die einzelnen zum kontemplativen, eigenverantwortlichen Dialog einlädt.644
Ein Blick auf die Systematik islamischer Rechtsfindung kann die beiden zuletzt genannten Ansichten untermauern. Die in a aufgeführte Methodik gehört zum Bestand des[Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten] (Usui al-Fiqh), des »Ur sprungs« oder der »Wurzeln« des »Fiqh«645.646 Die durch sie gewonnenen normativen Erkenntnisse gehen im [Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten] (Furu al-Fiqh), sei nem »Geäst« oder seinen »Zweigen« auf. Der Fiqh als Ganzes entspricht demnach der Defintion Rohes, da in ihm sowohl religiöse, als auch im engeren Sinne rechtliche Normen sowie deren Normfindungs- und Interpretationsinstrumente empirisch erfassbar sind. Seine Bestandteile kennzeichnen ihn als Baum. Unter Berücksichtigung des ihm innewohnenden lebhaften Diskurses beschreibt ihn Lohlker auch als „Rhizom“.647 Er ist jedoch noch kein Recht, weder im systemtheoretischen noch im säkular rechtswissenschaftlichen Sinne. Die in ihm gesetzten Normen sind zunächst keine Strukturen eines RechtsSYSTEMS, da ihre Rückkopplung ans GesellschaftsSYSTEM keinen eindeutigen Rechtsfolgewert zurück gibt. Ihr Unterscheidungsschema ist 'haram/halal', also 'von Gott verboten/nicht-verboten'. Der Rückgabewert kann einerseits die Anweisung an das GesamtSYSTEM sein, im Subsystem 'Staat' eine angemessene Rechtsfolge 'Zwang' oder 'kein Zwang' vorzusehen, welche dieser alternativ an dessen Systeme 'Recht' und 'Politik' weiterreicht. Läuft diese strukturelle Kopplung jedoch ins Leere, so gibt der Fiqh allein die Rückgabewerte 'läutern' oder 'nicht läutern' an das ReligionsSYSTEM zurück, das mit den in ihm ausgebildeten und vom staatlichen System eingeschränkten Zwangsmitteln auf das psychische System seiner Teilnehmer zurückwirken kann, wenn die Kopplung des letzteren diese nicht ausfiltert. Der Fiqh gibt sich demnach originär als Beobachtung zweiter Ordnung des ReligionsSYSTEMS zu erkennen, was seine Klassifizierung als praktische Theologie bestätigt. Er deutet somit in Zeiten der beginnenden Ausdifferenzierung von RechtsSYSTEMEN und operiert daher bereits in vergleichbarer Weise. In der Konsequenz wird ihm hier die Bezeichnung '»Proto-Recht«' zugewiesen.
Gehen die bisher aufgeführten Erkenntnisquellen im »Proto-Recht« auf, verbleibt die Schart 'a¡( als einzige Quelle des Fiqh. Unabhängig von der persönlichen, relativen Begriffsbestimmung von 'Gott' dürften sich alle gläubigen Anhänger jeder auf diesen Begriff ausgerichteten Religion darin einig sein, dass Gott im Diesseits nicht vollständig zu erfassen ist, »seine Wege sind unergründlich«. Ist die Schart'a einer dieser Wege, oder der Weg an sich, so kann sie „‘in ihrer Gesamtheit dem Menschen nicht zugänglich [sein], schon gar nicht mit einem hohen Grad an Gewiss- heit.'“648 Vielmehr kann nur ein Teil von ihr durch die Usul entschlüsselt werden, durch welche sich die Rhizome als Furu ‘ verästeln.649 Die Schart ‘a ist demnach Bezugspunkt und Ziel menschlicher Deduktionen, zur Erkenntnis des Handelns in Gottes Sinne.650 Insoweit erscheint es zulässig, ihr Wesen in die Nähe von Vernunft im Sinne Kantszu bringen,651 dessen kategorischer Imperativ die Säkularisierung ebenfalls christlichreligiös begründeter Ethik darstellt.652 In der Konsequenz ist die Schart -a allein 'die islamische Ethik' zu nennen.
2. Ergebnis
Soweit im Fiqh als »Proto-Recht« methodisch auf vergleichbar rationaler Grundlage wie im Recht vor dem Hintergrund der islamischen Ethik Entscheidungen hervorgebracht werden, die im weltlichen Recht relevante Bereiche betreffen, so ist es grundsätzlich geeignet, auch die Billigkeitsentscheidungen eines Schiedsrichters an den Ijtihad zu binden, um die Kontingenz des zu erwartenden Schiedsspruchs einzuschränken. Die Erwartungen von Schiedsparteien, eine Entscheidung die sich im Bereich der Schart'a wiederfindet zu erhalten, wären somit prinzipiell zu befriedigen.
Die Erörterung hat auch gezeigt, dass Ijtihad den FurU‘ al-Fiqh zwar durch den lebhaften Diskurs innerhalb der Gelehrtengemeinschaft zu einem sehr komplexen Geflecht formt, aber dadurch auch, mit Lohlker gesprochen, Rhizome ausbildet, die potentiell eine Anpassung der erkannten göttlichen Beurteilungen an die Zeit und den Raum, in denen Handlungen im Sinne der Schart ‘a zu beurteilen sind, ermöglicht. Mithin könnten grundsätzlich auch zeit- und ortsangemessene Erwartungen, welche die Schiedsparteien ebenso mitbringen, befriedigt werden.
Ins Auge springt ferner die notwendig hohen Anforderungen an die fachliche Qualifikation, welche an Schiedsrichter zu stellen ist, deren Billigkeitsentscheidung an den Fiqh gebunden wird. Andernfalls ist eben die erste Erwartung, die Befriedigung des Sicherheitsbedürfnisses, islamkonform zu handeln, wohl eher zu enttäuschen. Adolphsen und Schmalenberg muss also widersprochen werden, die, nicht ohne Sarkasmus, die bloße Möglichkeit rationaler Entscheidungsfindung im Fiqh von vornherein ausschließen.653
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
D. Islamisches Recht im schiedsrichterlichen Verfahren
Die Erkenntnisse aus B und C sollen an dieser Stelle zusammengeführt werden.
I. Ausschluss der Rechtswahl gemäß § 1051 Abs. 1 ZPO
In Kapitel B wurde das Sonderkollisionsrecht allein § 1051 Abs. 3, 4 ZPO zugeordnet und somit die Wahl nicht-staatlich gebundenen Rechts gemäß § 1051 Abs. 1 ZPO ausgeschlossen. Aus C III ging die Dequalifizierung des Fiqh zum »Proto-Recht« hervor, auf das sich Bezeichnungen wie ’islamisches Recht’ oder ’Schar:!'a’ letztlich beziehen. Daraus ergibt sich bereits seine Nichtanwendbarkeit auf Grundlage der zuletzt genannten Norm, wodurch die mit dieser Arbeit zu bearbeitende Frage in dieser Hinsicht eindeutig und abschlägig beantwortet werden kann. Den entsprechenden Auffassungen in der Literatur ist insoweit zuzustimmen.
II. Ausschluss der Inhaltsprüfung gemäß § 1059 Abs. 2 Nr. 2 lit. b ZPO
Die Bestätigung aus I befriedigt jedoch nicht, solange das weitere Ergebnis aus B IV 1 b bb (4) die Begrenzung des ordre-public-Vorbehalts aus § 1059 Abs. 2 Nr. 2 lit. b ZPO auf die materielle Prüfung als Inhaltskontrolle im Sinne des Art. 6 EGBGB, im Raum stehen bleibt und auch in CI keine unmittelbare Lösung angeboten werden konnte. Er kann sich dann nur auf Schiedssprüche richten, die auf einer Rechtswahl nach § 1051 Abs. 1 ZPO gründen, die für den Fiqh ausgeschlossen ist.
Bleibt es dabei, so führt die Billigkeitsentscheidung an der Inhaltsprüfung durch die staatlichen Gerichte vollständig vorbei, die dann allein die Schiedsfähigkeit von Amts wegen prüfen und die Verfahrensfehler nur auf begründeten Antrag der unterlegenen Partei hin untersuchen können. Zwar mag das dem Grundsatz der Parteiautonomie entsprechen. Wer sich durch die Schiedsvereinbarung frei gegen den staatlichen Rechtsweg entscheidet und auch staatliches Recht ausschließt, indem vom Sonderkollisionsrecht in § 1051 Abs. 3, 4 ZPO Gebrauch gemacht wird, will offensichtlich keinen Schutz durch das staatliche Rechtssystem. Dieses Argument krankt jedoch bereits an § 1055 und § 1061 ZPO.
1. Gegenargument: §§ 1055 und 1060 ZPO
Erlangt ein auf Billigkeitsentscheid gestützter Schiedsspruch materielle Rechtskraft und wird er mit seiner nachträglichen Bestätigung durch Vollstreckbarerklärung auch durchsetzbar, so folgt daraus die staatliche Privilegierung privater Rechtsschöpfung, wenn die auf ihrer Grundlage erlassenen Schiedssprüche überhaupt keiner Inhaltskontrolle unterliegen. Der vorgesehene Rechtsbehelf des Aufhebungsantrags geht dann in schiedsfähigen Streitigkeiten, die ohne erkennbare Verfahrensfehler entschieden wurden, ins Leere. Damit kann jedoch potentiell auch Recht werden, was sich bei durchgeführter Inhaltskontrolle als ordre-public- widrig erwiesen hätte. Diese Entscheidungen werden ins Rechtssystem aufgenommen, obwohl sie bereits nach der Radbruchschen Formel und Alexys Definition nicht richtig gewesen wären. Die Beurteilung der Billigkeitsentscheidung aus systemtheoretischer Sicht in C II 1 hat zudem gezeigt, dass diese sich potentiell auf das RechtsSYSTEM auswirken können, wenn sie einen signifikanten Normbestand erreichen, der zu Abweichungen in der Kontingenzformel 'Gerechtigkeit' führt und somit die Programmierung, die Bedingungen der Unterscheidung in 'Recht/UnRecht' beeinflussen kann. Das kann nicht im Sinne des Gesetzgebers gewesen sein, als er § 1059 Abs. 2 Nr. 2 lit. b ZPO in das deutsche Schiedsverfahrensrecht übernahm.
2. Gegenargument: Inkonsistenz
Die Wahl staatlichen Fremdrechts im Schiedsverfahren würde notwendig zu einer Inhaltskontrolle führen, wohingegen Sonderkollisionsrecht aus dieser herausführt, obwohl in beiden Fällen ein deutsches schiedsrichterliches Verfahren durchgeführt wurde. Aus Sicht der Schiedsparteien, die sich aus diesem Grund benachteiligt fühlen, wäre dies eine Frage der Ungleichbehandlung. Aus kollisionsrechtlicher Sicht würde dem Privatregime ein größeres Vertrauen entgegengebracht als der Rechtsetzung anderer Staaten. Aus deontischer Sicht wäre es ein normativer Widerspruch, welcher die Inkonsistenz des Staatsvorbehalts im Schiedsverfah ren offensichtlich macht und der Auflösung bedarf. Dem Gericht wäre geboten, Schiedssprüche von Amts wegen zu prüfen und auch wieder nicht. Das alles irritiert. Bleibt die Irritation unverarbeitet, hat das aus systemtheoretischer Sicht die zuvor genannte Konsequenz.
3. Lösungsvorschlag: Ignoranz
Wird den Gegenargumenten beigepflichtet und aus diesem Grund die ordre-public-Prüfung unreflektiert ausgeweitet, ohne der Stellung des Staatsvorbehalts Rechnung zu tragen, zieht also ein entscheidendes OLG die Prüfung an sich, weil es das angesichts der genannten Irritationen für richtig hält, ohne diese Entscheidung systematisch zu begründen, tauscht es die eine Inkonsistenz gegen die andere ein. Kann das Gericht frei über die Reichweite des § 1059 Abs. 2 Nr. 2 lit. b ZPO entscheiden, sind die Betroffenen einer neuen Willkür ausgesetzt. Es hängt dann vom Gutdünken des Gerichts ab, ob und wie es die inhaltliche Prüfung auf sich nehmen will und ob es auch noch prozessuale Fragen dabei von Amts wegen gleich mit zu klären gedenkt. Auch diese Lösung wird den Ansprüchen an einen Rechtsstaat nicht gerecht.
4. Lösungsvorschlag: Sondervorbehalt
Richtig erscheint hier allein, den Staatsvorbehalt im Schiedsverfahren als ordre public sui generis und daher spiegelbildlich zum Sonderkollisionsrecht als Sondervorbehaltsklausel zu betrachten. Danach erfasst er sowohl die mit § 1051 Abs. 1 ZPO korrespondierende Inhaltskontrolle gemäß Art. 6 EGBGB, als auch dessen sinngemäße Anwendung auf die Rechtswahl gemäß § 1051 Abs. 3, 4 ZPO. Dieser Schluss lässt sich wiederum systemtheoretisch als nicht nur pragmatisches sondern auch dogmatisches, also innerhalb des mit den §§ 1051, 1055, 1061 und 1059 ZPO programmierten Systems zwingendes Argument transparent machen.
Ein RechtsSYSTEM ist die selbstreferentielle Beobachtung der Gesellschaft. Die Operation 'Schiedsverfahren' ist wie das Gerichtsverfahren dessen Beobachtung zweiter Ordnung. Auf Grundlage des § 1051 Abs. 1, 2 ZPO ist BEOBACHTUNGSgegenstand des Schiedsverfahrens ein RechtsSYSTEM, das durch die Parteien oder die Schiedsrichter bestimmt wurde. Ergibt sich die Anwendung deutschen Rechts, liegt dieses System im Zentrum der Aufmerksamkeit. Werden einzelne Vorschriften einer anderen Rechtsordnung in Bezug genommen, so werden die Pro-
GRAMMbestandteile verschiedener Systeme durch dieBEOBACHTUNG zusammengeführt. Kommt es zur vollständigen Verweisung in fremdes Recht, so gerät das deutsche außer Sicht. Das Verfahren selbst bleibt dennoch Operation des auf der materiellrechtlichen Ebene außer Sicht geratenen Systems. Wird ein Schiedsspruch erlassen, folgt wie angesprochen dessen Übergang in das deutsche RechtsSYSTEM über § 1055 ZPO. Die aus § 1061 ZPO folgende Vollstreckbarerklärung ermöglicht den Wiedereintritt ins GesamtSYSTEM, welches den Eintritt der Rechtsfolge sichert. Die amtswegige Prüfung gemäß § 1059 Abs. 2 Nr. 2 ZPO ist die dem Wiedereintritt vorausgehende Auffangkorrektur, mit der sichergestellt wird, dass die potentiell im Schiedsverfahren außer Sicht geratene Kontingenzformel zur Anwendung kommt, bevor die Einzelnorm als Struktur dem GesamtSYSTEM als Rückgabewert ausgeliefert wird. Das stellt für den intoleranten Bereich der »ordre public interne«, die Schieds- fähigkeit, sicher. Im Weiteren muss sich der Schiedsspruch in der Toleranzbreite des ordre public wiederfinden. Diese Toleranzbreite, als Negativfunktion, bestimmt bei staatlichem Fremdrecht die grundsätzliche Anerkennung der in einem anderen RechtsSYSTEM vorgenommenen Programmierung. Findet die Auffangkorrektur daher als Ergebniskontrolle statt, als Frage, ob der Eintritt der auf den Einzelfall konkretisierten Rechtsfolge der Kontingenzformel zuwiderläuft, kann nur der staatlichrechtlich relevante Anteil des Schiedsspruches Gegenstand dieser Prüfung sein.
Ermächtigen die Schiedsparteien ihr Schiedsgericht zur Entscheidung nach Billigkeitsgesichtspunkten so gerade deshalb, weil ihr Konflikt nach staatlich-rechtlichen Gesichtspunkten anders zu lösen wäre. Sie lenken somit den Fokus des Schiedsverfahrens aus staatlichem Recht heraus. Auf dieser Ebene sind beide Varianten identisch, was notwendig die Auffangkorrektur durch das OLG erforderlich macht. Die Ermächtigung durch die Schiedsparteien ist ebenfalls voll anzuerkennen, sodass der ordre public in gleicher Funktion wie bei staatlichem Recht zum Tragen kommt. Ist das Schiedsgericht vollkommen frei in seiner Urteilsfindung, und werden keine Verfahrensfehler geltend gemacht, muss vom Willen der Parteien ausgegangen werden, die Entscheidung über Streitigkeiten aus ihrem Rechtsverhältnis einem Dritten zu übertragen. Es stellt sich dann nur die Frage, inwieweit sie dazu berechtigt waren. Haben sie jedoch das Schiedsgericht an von ihnen gewählte Erwägungsgründe gebunden, so werden diese, wie auch das fremde staatliche Recht nicht infrage gestellt, sondern allein die vom Schiedsgericht vorgenommene Entscheidung wie eine fremdrechtliche Entscheidung am Toleranzbereich der Kontingenzformel gemessen.
Es wird offensichtlich, dass der Staatsvorbehalt in § 1059 Abs. 2 Nr. 2 lit. b ZPO auf den gesamten § 1051 ZPO Anwendung findet. Da ersterer nur die materiellrechtliche Prüfung umfasst, durch letzteren jedoch auch etwas anderes als Recht im Sinne einer Operation im RechtsSYSTEM vereinbart werden kann, kann der ordre public im Schiedsverfahren nicht Art. 6 EGBGB vollkommen entsprechen, der sich allein auf staatliches Recht bezieht, sondern geht über diesen hinaus. Konsistent lässt er sich also 'Sondervorbehaltsklausel' des inländischen schiedsrichterlichen Verfahrens bezeichnen.
III. Ergebnis
Es hat sich gezeigt, dass Schiedsrichter im inländischen Verfahren an den Fiqh gebunden werden können, wenn dieser auch von § 1051 Abs. 1 ZPO nicht erfasst wird. Ferner hat sich gezeigt, das auf seiner Grundlage getroffene Entscheidungen der materiellrechtlichen ordre-public-Prüfung unterliegen. Sie können also an deutschen Standards gemessen und bei Unbedenklichkeit auch für vollstreckbar erklärt werden. Erst durch diese Prägung werden sie zu deutschem und damit, da dem anerkannten Schiedsspruch die islamische Rechtsfindung zugrunde liegt, echtem islamischem Recht.
E. Ausblick
Die Schwierigkeiten der Vereinbarkeit des Fiqh, also der systematischen, islamischen Rechtsfindung mit deutschen Recht, liegen ganz offensichtlich nicht im Verfahrensrecht. Sie müssen auch nicht in der Vielfalt des Fiqh liegen, durch die zum Ausdruck kommt, wie unterschiedlich die Rechtsfindung in einem ganzen Kulturkreis sein kann.
Sie liegt zum Einen in der Qualifikation potentieller Schiedsrichter. Diese müssen Experten der islamischen Rechtsfindung sein und sie den Anforderungen von Raum und Zeit des gegenwärtigen Deutschland anpassen können, den Ijtihad hierzulande auf sich nehmen und eine modernen Ansprüchen genügende islamische Rechtsauffassung entwickeln. Das setzt eine strukturierte juristische Auseinandersetzung mit dem gegenwärtigen und vergangenen Diskussionsstand im Fiqh und seine Harmonisierung mit dem deutschen ordre public voraus. Soweit ihre Tätigkeit im Umkehrschluss aus § 2 Abs. 3 Nr. 4 des Rechtsdienstleistungsgesetzes654 (im Folgenden: RDG) im Sinne des § 2 Abs. 1 RDG als Rechtsdienstleistung zu werten ist, müssen sie derzeit auch die Befähigung zum Richteramt besitzen. Alternativ müssten islamische Schiedsvereine als Rechtsdienstleister im Sinne des § 7 Abs. 1 RDG zugelassen sein, welche die gesetzmäßige personelle Ausstattung sicherstellen können. Ob das gegenwärtig geleistet werden kann, wird von hiesiger Seite vorsichtig in Zweifel gezogen. Auch müsste der islamisch-rechtswissenschaftliche Diskurs intensiviert werden, um wiederum die im Fiqh geforderte Arbeitsteilung theoretischer und praktischer Erkenntnisverfahren zu institutionalisieren. Dieser Diskurs wäre sinnvoll in den juristischen Ausbildungsstätten zu führen, sodass der vergleichende Austausch zwischen staatlichem Recht und Fiqh aufgenommen wird, um letzteren zu einem in hohem Maße anerkennungsfähigen und konsistenten »Proto-Recht«-SYSTEM zu formen. Diese könnten dann auch Fatawa als Schiedsgutachten im Sinne des § 1049 ZPO erbringen und ins Schiedsverfahren eingebunden werden. Als praktische Theologie wäre gleichsam eine interdisziplinäre Anbindung an islamisch-theologische Fakultäten angebracht. Diese Aufbauarbeit wäre sicherlich möglich. Sie könnte auch dem Islam in Deutschland wichtige Impulse liefern, für gerade empfindliche Bereiche wie Gleichberechtigungsfragen harmonische, wiederum aus islamischer Sicht anerkennungsfähige Lösungen anzubieten.
Zum Anderen bleibt sie aber eine Frage des Bedarfs. Sollte die Annahme aus A II über den potentiellen Anteil der rund 4 Mio. in Deutschland lebenden Muslime, die möglicherweise ein Interesse an der Institutionalisierung einer (deutsch-)islamischen Schiedsgerichtsbarkeit haben könnten, belastbar sein, so wären dies, gemessen am Prozentsatz der im Höchstfall absolut etwa 1,4 Mio. Wieviele davon im Einzelfall eine Klärung ihrer Streitigkeiten außerhalb des Familienverbands gelöst wissen wollen, kann an dieser Stelle nicht einmal vermutet werden. Das gilt auch für Rechtsverhältnisse die im Schuldrecht angesiedelt sind oder als Täter-Opfer-Ausgleich das Strafrecht berühren. Dies wäre möglicherweise eine Fragestellung, die in den Sozialwissenschaften auf Interesse stoßen könnte und dort bearbeitet werden müsste, bevor Ressourcen zur zuvor genannten Aufbauarbeit zur Verfügung gestellt werden.
Eine Chance des Auflebens eines deutschen, oder gar europäischen Ijtihad in einer institutionalisierten Schiedsgerichtsbarkeit könnte darin liegen, dass gläubigen Muslimen, die sich über die Konformität des weltlichen Rechts mit ihrer Religion unsicher sind und daher zögern, die staatliche Gerichtsbarkeit anzurufen, durch das hier rekonstruierte Privatregime der Zugang zur säkularisierten Gesellschaft erleichtert wird. Ein sorgfältig aufgesetztes Schiedsverfahren, das praktisch-theologisch begründbare und zugleich dem Staatsvorbehalt genügende Entscheidungen hervorbringt, kann diesen im Umkehrschluss dann die Islamkonformität des Grundgesetzes belegen. Das erleichtert zwar nicht die Integration im Alltag, soweit umgekehrt die Vorbehalte gegen den Islam als vermeintlich notwendig rückständig und nicht reformierbar aufrecht erhalten bleiben. Die Widerlegung dieser Vorbehalte würde jedoch erleichtert, sofern empirisch belegbar wird, dass sich ein in Deutschland auch rechtlich praktizierter Islam bruchlos in das GesamtSYSTEM einfügen lässt. Sodann müsste ein entsprechend institutionalisiertes Schiedsverfahren allein den ihm allgemein zugeschriebenen Vorteil belegen, kostengünstiger als die staatliche Rechtsfindung zu sein, da es in kürzerer Zeit mit einem für beide Parteien akzeptablen Ergebnis ende.
Anhang
Inhalt
Exkurs Von der Norm in der Logik zur Norm im Systemzusammenhang S.
I. Logische Perspektive
1. Aussagen
2. Normen
a) Wahrheitsfähigkeit der Norm
b) Erzeugung der Norm
aa) Weltbegriff im Zusammenhang mit 'Normensystem'
bb) Willensakt
(1) Berührte Bereiche der Logik
(2) Subjektive Wertung
(3) Von der Wertung zur Norm
c) Normwiderspruch
d) Zusammenfassung
3. Normsätze
a) Normgegensätze
b) Regeln der Normenlogik
c) Zusammenfassung
II. Systemtheoretische Perspektive
1. Grundbegriff der Systemtheorie Lumannscher Prägung
a) Operativ geschlossene Systeme
b) Autopoiesis
c) Selbstorganisation
d) Strukturen und Operationen
e) Beobachter
f) Kommunikation als Operation sozialer Systeme
g) Strukturelle Kopplung
h) Kausalität und Wiedereintritt
i) Medium und Form, Code und Programm
j) Bewertung
2. Anwendung systemtheoretischer Begriffe
III. Ergebnis
Exkurs: Von der Norm in der Logik zur Norm im Systemzusammenhang
Normen sind nicht nur Bestandteil des Rechts. Sie finden sich letztlich in allen Bereichen menschlichen Zusammenlebens. Erkenntnisse deontischer Logik lassen daher ebenso interessante Rückschlüsse auf das Rechtssystem zu, wie der Systemtheorie Luhmannscher Prägung, die Gesellschaftssysteme, als Bereiche menschlichen Zusammenlebens, zum Gegenstand hat und damit letztlich auch die Wahrheiten deontischer Logik als Informationen weiterverarbeitet in einem weiteren Erkenntnissystem. Im Folgenden soll daher neben Aufbau, Erzeugung und Zusammenspiel von Normen gezeigt werden, wie die Begriffe der Logik in jenen der Systemtheorie aufgehen.
I. Logische Perspektive
Vor der Analyse von Normen steht deren Abgrenzung von Aussagen, um ihre Wahrheitsfähigkeit und Gültigkeit ins logisch rechte Licht zu rücken.
1. Aussagen
Aussagen sind Gegenstand der Aussagenlogik. In ihr werden die äußere Struktur, die Form beweisbarer Sätze und ihre Verknüpfungen ana- lysiert.1 Beweisbar meint, ein eindeutiger Wahrheitswert 'wahr' oder 'falsch' kann diesen Sätzen zugeschrieben werden.
Die einen Sachverhalt objektiv beschreibende, also deskriptive Aussage »wer geschlagen wird, weint« kann eindeutig wahr oder falsch sein, ist somit allgemein ein wahrheitsdefiniter, ein assertorischer Satz und im Speziellen eine Implikation, deren Glieder isoliert und deren Wahrheitswert ermittelt werden kann. Die Aussage kann also in logischen Schlussverfahren verifiziert oder falsifiziert werden.
Zwar kann es sein, dass der eine weint, wenn er geschlagen wird und die andere nicht. Ob der Satz jedoch wahr oder falsch ist, hängt weder vom Sprecher ab, noch von den »Testpersonen«. In binärer, also zweiwertiger Logik kann diese allgemeingültige Aussage (äquivalent zu: »Alle Geschlagenen weinen.«) subjektunabhängig bestätigt oder widerlegt werden. Entweder alle geschlagenen weinen, oder eben nicht. Das gilt dann auch absolut. Eine objektive Wertung ist möglich. Selbst wenn die Aussage dahingehend eingeschränkt wird, dass an einem bestimmten Ort alle Mitglieder einer bestimmten Menschengruppe weinen wenn sie geschlagen werden, so gilt die Aussage »diese weinen, wenn sie geschlagen werden«, ob wahr oder falsch, auch außerhalb der Gruppe. Entweder diese weinen oder sie weinen nicht, wenn sie geschlagen werden.2
Ein zentraler Grundsatz der Aussagenlogik ist der ausgeschlossene Widerspruch: Eine Aussage p kann formal nicht 'wahr' und 'falsch' zugleich sein.3 Ansonsten kann keiner der beiden zur Auswahl stehenden Wahrheitswerte ermittelt werden. Der Satz von dem ausgeschlossenen Dritten ist dazu äquivalent, da jeweils das eine aus dem anderen folgt: Wenn nur die zwei Wahrheitswerte 'wahr' und 'falsch' zur Verfügung stehen, so kann eine Aussage p nur 'wahr' oder 'falsch' sein.4 Wenn dem so ist, kann folglich p nicht zugleich 'wahr' und 'falsch' sein.
Wäre der Widerspruch zulässig, so könnte aus einer beliebigen widersprüchlichen Aussage jede weitere beliebige Aussage folgen. Da in 2 darauf zurückgegriffen wird, soll an dieser Stelle der formale Beweis des vorhergehenden Satzes erbracht werden,5 um verbleibende Zweifel auszuräumen, wenn die Wahrheit des Widerspruchsprinzip inhaltlich auch unmittelbar einleuchtet:
Die durch die Konjunktion verknüpften Teilaussagen in einem Satz lassen sich durch die Schlussfigur 'Konjunktionsbeseitigung' (KB) isolieren.6 Das isolierte Konjunktionsglied kann nun mit einem anderen wahrheitsdefiniten Satz disjunktiv verknüpft werden, die Schlussfigur 'Disjunktionseinführung' (DE).7 Die Disjunktion wiederum ist eine Prämisse, aus der, in Verbindung mit einem ausgeschlossenen Disjunktionsglied als zweiter Prämisse, die Wahrheit des anderen folgt. Übliche Bezeichnungen dieser Schlussfigur sind ’disjunktiver Syllogismus’, ’adjunktiver Syllogismus’ und ’modus bollendo ponens’ (DS).8
Wenn die Konklusion in 5. sich tatsächlich nicht bestätigen lässt, so kann durch ein schlichtes Umknicken einer Ecke dieser Seite zufällig Wahrheit hergestellt werden, ohne zwingende Folgen für die verknüpfte Aussage. Die Teilaussage steht also in keinem notwendigen Zusammenhang mit dem ersten Glied der Disjunktion, sie ist beliebig. Beide Konjunktionsglieder der widersprüchlichen Aussage werden in diesem Schlussverfahren mit dieser verknüpft. Der Wahrheitsgehalt der Schlussfolgerung »Wenn alle Geschlagenen weinen und nicht weinen, oder diese Seite ein Eselsohr hat, ist die letzte Teilaussage ’wahr’« ist mit »Wenn ’p und nicht-p’, oder ich morgen einkaufen gehe, dann gehe ich morgen einkaufen.« der Form nach identisch. Beide Sätze sind immer 'wahr', weil der darin enthaltene Widerspruch keine Falsifikation zulässt, das zweite Disjunktionsglied also formal notwendig ’wahr’ ist. Inhaltlich springt jedoch ins Auge, dass die Konjunktion nichts enthält, woraus überhaupt etwas folgen könnte.
2. Normen
Normen sind Gegenstand der Normenlogik.9 In dieser werden sie analysiert und verarbeitet. Dadurch sind sie dem unmittelbaren Zugriff der Aussagenlogik entzogen.
Aussagen und Normen erscheinen als entgegengesetzte Kategorien: Normen schreiben etwas vor, sind also präskriptiv; sie sind „weder wahr noch falsch“, lassen sich folglich weder verifizieren noch falsifizieren; sie werden „von einem Subjekt durch einen Willensakt erzeugt“, gelten daher relativ „in einem Normensystem“ und können in Widerspruch zueinander stehen.10 Wird jedes dieser Merkmale verneint, so wird die
Aussage beschrieben. So betrachtet sind sie kontradiktorisch, also unüberbrückbar entgegengesetzt. Diese Feststellung soll nachfolgend durch Rekonstruktion des Normbegriffes überprüft werden.
a) Wahrheitsfähigkeit der Norm
Eine Norm wäre etwa: »Man soll nicht schlagen!« Dieser Satz beschreibt kein Verhalten oder allgemein: keinen Sachverhalt dessen Existenz und damit Wahrheit entweder bestätigt oder widerlegt werden kann, ist also nicht deskriptiv.11 Ist eine Norm nicht beschreibend, so schreibt sie etwas vor, ist präskriptiv, gleichbedeutend mit 'Vorschrift'. Sie selbst ist der Sachverhalt, der im positiven als auch im negativen Sinne festgestellt werden kann: »Der Satz 'man soll nicht schlagen' existiert oder er existiert nicht.« Hier kann nur die erste der verknüpften Aussagen wahr sein. Die formale Wahrheit des beschriebenen Satzes selbst kann jedoch nicht erschlossen werden. Die Norm ist also nicht deskriptiv, folglich präskrip- tiv, und nicht wahrheitsfähig, damit auch nicht beweisbar im Sinne der in 1 zu Beginn eingeführten Definition.
b) Erzeugung der Norm
Ist eine Norm präskriptiv, so kann sie nur in die Welt treten und damit ihre Existenz beschrieben werden, wenn sie vorher erschaffen worden ist. Der Zustand der Welt wird folglich durch die Erzeugung einer Norm bereits insoweit verändert, dass eine Welt ohne sie und eine mit ihr beschrieben werden kann. Inhalt und Reichweite des Begriffs auf den das Wort 'Welt' verweist sind jedoch zunächst unklar. Damit hängt hier jedoch die Prüfung des Merkmals »Gültigkeit in einem Normensystem« zusammen. Daher soll zunächst die Verwendung des Begriffes 'Welt' geklärt werden.
aa) Der Weltbegriff in Zusammenhang mit 'Normensystem' Ein Begriff beschreibt einen Gegenstand. „Gegenstand ist [... ] alles, worauf sich das Bewusstsein richten kann.“12 Auf einen körperlich und gedanklich greifbaren Stuhl kann sich das Bewusstsein ebenso richten, wie auf eine nur gedanklich greifbare Welt. Gegenstände oder Dinge werden beschrieben, indem diesen all jene Merkmale, Eigenschaften zugewiesen werden, die nur ihm eigen sind. Je mehr Eigenschaften ihm zukommen, um so schärfer, um so konkreter wird das Einzelne von andern abgegrenzt. Der Begriff enthält dann viele Merkmale, hat einen großen Inhalt. Umgekehrt wird die Abgrenzung unschärfer, wenn das Ding nur wenige Eigenschaften besitzt. Er reicht dann über den konkret begriffenen Gegenstand hinaus, umfasst also mehrere konkret begreifbare Dinge. Ein solcher Sammelbegriff hat einen größeren Umfang, eine höhere Reichweite.13
Auf Begriffe verweisen Worte, mit denen die Summe der Eigenschaften begriffener Gegenstände sprachlich zusammengefasst werden. ’Sein Schuh’ verweist auf einen konkreten Schuh am Fuß eines konkreten Eigentümers und Besitzers. ’Schuh’ bezeichnet die Gesamtheit aller Gegenstände, welche die gleichen Eigenschaften besitzen wie der konkrete, bis auf die Eigenschaft in Besitz und Eigentum der Person x, auf die das Wort ’Sein’ in der konkreten Sprechsituation verweist. Worte als Bezeichner sind Gegenstände der „Objektsprache“; Worte, mit denen Worte der Objektsprache beschrieben werden, sind Gegenstände der „Metasprache.“14
Irritationen treten auf, wenn Wechsel zwischen Objekt- und Metasprache undeutlich bleiben - man weiß nicht wovon man spricht - und Inhalt und Reichweite eines Begriffes unbestimmt bleiben - man weiß nicht worüber man spricht.
Wenn etwas »in die Welt« tritt, so bezeichnet ’die Welt’ möglicherweise eine bestimmte Welt von vielen.15 Dann muss der Begriff hinter ’die’ geklärt werden. Oder aber ’Welt’ ist die Verweisung auf einen ganz konkreten Begriff, der alle Sprechenden stets unwidersprochen gedanklich folgen. Dann wird ’die’ allein grammatisch verwendet und ist kein Abgrenzungsmerkmal. Nun ist es jedoch so, dass die Objektsprache ’bekannte’ und ’unbekannte Welten’ enthält, dass eine physikalische Beschreibung der ’Welt’ eine andere ist als die der ’westlichen’ oder der ’orientalischen’ Welt. Der Ausdruck „das ist nicht meine Welt“ deutet auf subjektives Unverständnis hin. Der Weltbegriff umfasst offensichtlich verschiedene konkretere Begriffe. Er ist demnach inhaltsarm und mit hoher Reichweite, also abstrakt. Das bedeutet, all diese verschiedenen Welten müssen Eigenschaften teilen, welche nahe legen, sie als etwas verwandtes zu begreifen, wenn auch unter Hinzufügung weiterer Merkmale der Sammelbegriff wieder in unterschiedliche 'Welten' zerfällt.
Als das Gemeinsame erscheint 'die Regel' zutreffend, „der Satz vom zureichenden Grund“,16 also die vorgegebene Implikation, nach der alles was existiert, also 'wahr' ist, darauf beruhe, dass eine bestimmte Wirkung auf eine bestimmte Ursache folgt.17 'Existenz' meint hier alles was beobachtbar, allgemeiner: feststellbar ist. In der physikalisch beschreibbaren Welt kann die Schwerkraft als Ursache angenommen werden: Körper mit größerer Masse ziehen solche mit kleinerer an. Es lässt sich feststellen: »Das Buch liegt auf dem Tisch. Wenn ich ihm einen Schubs gebe, fällt es herunter.« Die Ursache für die zweite Wirkung, den Sturz, ist die Schwerkraft. - Die Vermutung liegt nahe, dass in der westlichen Welt der Indiviualismus als eine Ursache angenommen wird etwa für psychische Erkrankungen, die auf die Unterordnung der Bedürfnisse des Einzelnen unter die Bedürfnisse anderer zurückgeht.18 'Orientalische Welt' kann als Abgrenzung zu 'westliche Welt' erscheinen, durch die ein kontradiktorischer Gegensatz beschrieben werden soll, die Gültigkeit unvereinbarer Ursache-Wirkung-Verhältnisse.19 Die persönliche Welt wiederum ist ein Unterfall von Begriffen auf die Worte wie 'westliche' oder 'orientalische Welt' verweisen. Wer in den Regeln solcher Welten aufgewachsen ist, wird auf ihrer Grundlage die Implikationen erkennen, die auf ihn zutreffen.20 Das Wort 'Welt' verweist danach auf einen Begriff, der auch als 'eine bestimmte Regel, aus der alles weitere folgt', oder auch 'eine Gesamtheit bestimmter, miteinander verknüpfter Regeln' bestimmt werden könnte. Der Begriff selbst beschreibt damit nichts körperliches, hat selbst keinen Inhalt sondern ist nur eine Form, deren Inhalt vom Sprecher jeweils klargestellt werden muss, will er von anderen verstanden werden.21
Wenn eine Regel beschrieben werden kann, so existiert sie. Wenn es unterschiedliche Welten gibt, so kann die Regel entweder allein in einer oder übergreifend in mehreren dieser Welten existieren, also beschrieben werden. Trifft letzteres auf alle existierenden Welten zu, so ist sie allgemeingültig, die Feststellung ihrer Existenz ist stets wahr. Im Übrigen ist sie relativ zu der oder den Welten, in der sie existiert, gültig. Die Fest Stellung ihrer Existenz ist nur in den entsprechenden Welten möglich.
Wenn man die Möglichkeit hat, eigene Regeln aufzustellen oder aufzuheben, die in anderen Welten nicht oder weiter existieren, so kann man seine eigene Welt erschaffen. Sind die eigenen Regeln mit Regeln anderer Welten vereinbar, so kann eine gemeinsame Welt entstehen. Diese Entwicklung stößt an ihre Grenzen, wenn die Möglichkeit Regeln zu vereinbaren nicht mehr besteht und in der großen gemeinsamen Welt, die Schnittmenge der verbundenen Regeln unwidersprochen bestehen bleiben. Soweit die Notwendigkeit besteht, dennoch mit einer Welt, auf deren Regelwerk man keinen gestalterischen Zugriff hat, in Verbindung zu treten, so ist man gezwungen, dieses Regelwerk zu akzeptieren, solange man sich in der Schnittmenge mit ihr aufhält. Ausnahmslos für jeden Menschen gilt dies, wenn er mit der physikalischen Welt, wie sie sich ihm darstellt, in Kontakt bleiben will. Der Aufenthalt in dieser Welt ist zwingend, da die physische Existenz die Voraussetzung für die Erschaffung aller übrigen Welten ist. Ihre Regeln werden daher in Abgrenzung zu denen anderer Welten als feststehende 'Naturgesetze' bezeichnet. Von dort hinabsteigend erreicht man einen Punkt der Weltenüberschneidungen, an dem zwar nicht der Einzelne allein, aber in einer Gruppe Regeln wieder gestalten kann. Das ist der Punkt, an dem die Gruppenexistenz oder soziale Existenz zwingend wird für die Erschaffung der persönlichen Welt. Die Gruppenregeln werden daher in Abgrenzung zu denen anderer Welten als 'Norm' bezeichnet. Normen sind also Regeln, auf welche eine Gruppe gestalterischen Zugriff hat, der Einzelne jedoch nicht. Abschließend findet der Einzelne seine absolute Gestaltungsfreiheit beim vollständigen Rückzug in die eigene Welt, die notwendig nur mit der physischen gekoppelt ist. Diese Welt wird hier mit 'Einsamkeit' bezeichnet.
Normen können in der Tat nur in der Welt oder den Weltüberschneidungen gelten, ihre Existenz kann nur zutreffend beschrieben werden, in denen sie erschaffen wurden. Die jeweilige Welt könnte als 'Gruppenwelt' bezeichnet werden. Ist eine Welt aber die Gesamtheit bestimmter, miteinander verknüpfter Regeln so liegt auch die Assoziation mit dem Wort 'Normensystem' nahe. Das Merkmal »Gültigkeit in einem Normensystem« lässt sich also deduktiv bestätigen, gleichsam das Merkmal »von einem Subjekt erzeugt«. Denn als normerzeugendes Subjekt kann die Gruppe erkannt werden.
bb) Der Willensakt Ein weiteres zu prüfendes Merkmal ist: »durch einen Willensakt erzeugt«. Unterliegen Normen der Gestaltungsfreiheit einer Gruppe und sind sie konstituierender Bestandteil der Gruppenwelt, so verändert das Erzeugen, die Modifikation und der Widerruf jeder Norm eben diese Welt.
'Wille' bezeichnet »zielgerichtetes Denken«.22 Wer ein Ziel erreichen will, muss entsprechend handeln. Akt und Handlung sind synonym. Wer seine Gruppenwelt verändern will, gestaltet ihre Normen. Der Umstand, dass sie von einem Subjekt erzeugt werden, kann also notwendig nur auf einen Willensakt desselben zurückgehen.
Diese triviale Feststellung erklärt nur das und nicht wie eine Norm gesetzt wird. Sie ist eine formale Schlussfolgerung ohne konkreten Inhalt. Als deduktiver Schluss bestätigt sie jedoch auch dieses Merkmal dieser Kategorie von sprachlichen Ausdrücken, zu denen sowohl Aussagen, als auch Normen, veränderliche Regeln, gehören.
Betrachtet man den Inhalt des Willensaktes, so gibt sich dieser als Prozess logischer Operationen zu erkennen, mit dem eine Brücke geschlagen wird zwischen dem kontradiktorischen Begriffspaar Aussage und Norm. Der Willenakt ist demnach nicht notwendige weil selbstverständliche Eigenschaft der Norm, sondern vielmehr das zentrale Merkmal mit dem ihr Entstehungsprozess beschrieben werden muss.
(1) Berührte Bereiche der Logik Bevor die Operationen im Einzelnen aufgezeigt werden, soll ein Überblick über die berührten Bereiche der Logik vorangestellt werden, um einem inhaltlichen Widerspruch vorzubeugen und bestimmte Begriffe ins Gedächtnis zu rufen.
Der Widerspruch, welcher sich aufdrängen kann, wenn von der Überbrückung eines kontradiktorischen Gegensatzes, als A und Non-A, aufdrängt ist: Diese beiden können nicht nebeneinander existieren. Das ist ein Argument aus der Aussagenlogik, womit 'logisch' gleichgesetzt wird mit 'aussagenlogisch'. Es ist jedoch unmittelbar einleuchtend: Wenn Logik mehrere Bereiche umfasst, ist logisch, was in einen dieser Bereiche passt. Das Weltenargument aus aaaufgegriffen lassen sich alle als Welten verstehen, die in der Welt 'Logik' existieren und sich durchaus überschneiden. So gelten etwa die basalen Regeln der Aussagenlogik in allen übrigen Bereichen. Sie ist - wie die physische Welt - zwingende Voraussetzung für die Erschaffung weiterer Welten und begrenzt diese. Ihre
Axiome, ihre feststehenden Regeln, sind wie die Naturgesetze die Grenze der übrigen mit ihr vereinbarten Welten. Umgekehrt können in letzteren sprachliche Elemente untersucht werden, die in der Aussagenlogik unmöglich sind.
Wie bekannt, wird mit Hilfe der Aussagenlogik die Form, die äußere Struktur von Aussagen analysiert, welche unterschiedlich verknüpft sein können. Zwei verknüpfte Aussagen bilden wieder eine neue Aussage. Sowohl die Wahrheitswerte der beiden Teilaussagen, als auch ihres Zusammenspiels als neue Aussage werden durch unterschiedliche Schlussverfahren ermittelt.
Die innere Struktur von Aussagen wird in der Prädikatenlogik er- fasst.23 Die Grundbestandteile jeder Aussage werden mit 'Subjekt' (S) und 'Objekt' (O) benannt. „Subjekt ist dasjenige, worüber etwas ausgesagt wird, Prädikat ist dasjenige, was über das Subjekt ausgesagt wird.“24 Ihr Verbindungswort wird als 'Kopula' bezeichnet, die entweder bejahend oder verneinend sein kann: 'ist' / 'ist nicht'. Die Prädikatenlo- gik liegt also der Begriffsbestimmung, vom Inhalt und auch vom Umfang her, sowie ihrer logischen Weiterverarbeitung zugrunde. Ein beliebiger Begriff kann in ihr mit einem anderen nach den Regeln der Aussagenlogik verknüpft, der formale Wahrheitswert der so entstehenden Aussage ermittelt und damit die Begriffsbestimmung, also die Abgrenzung eines Gegenstandes von einem anderen, überprüft werden. Damit geht die Prädikatenlogik über in die Urteilslehre.
Die Urteilslehre ist es, durch die Begriffe nach ihrer Quantität ('al- le'/'einige') und ihrer Qualität ('alle S sind P', 'einige S sind nicht P, 'einige S sind P', 'kein S ist P') zueinander in Beziehung gesetzt werden,25 gleichsam mit aus der Aussagenlogik abgeleiteten Schlussfiguren.
Die Modallogik kennt neben den Wahrheitswerten 'wahr' und 'falsch' weitere, die unterschiedlich benannt werden. Sie rekurrieren auf das oben entwickelte Weltenargument und verknüpfen die Aussagenlogik mit der Prädikatenlogik und Urteilslehre. Es wird unterschieden in 'notwendig wahr' und 'wahr' sowie 'falsch' und 'notwendig falsch'. Dabei ist 'notwendig wahr' das, was in allen Welten und 'notwendig falsch', was in keiner gilt - die umbenannten Kategorien der Aussagenlogik. Was kontingent, also zufällig in bestimmten Welten gilt, erhält den Wert 'wahr' beziehungsweise 'falsch' - Hier ist also die Definition des Weltbegriffs von besonderer Bedeutung, etwa die Abgrenzung möglicher physischer Welten.26 Nach oben entwickeltem Weltbegriff steht auch die Frage nach einem zulässigen Vergleichsmaßstab im Raum. Existieren mehrere Gruppenwelten und wird ein auf sie bezogenes Urteil auf seine Allgemeingültigkeit hin überprüft, macht es keinen Sinn, zu fragen, welchen Wahrheitswert es etwa in unserer und allen weiteren möglichen physischen Welten wohl annimmt, da es keine physische Wahrheit betrifft.
Die Normenlogik ermöglicht die logische Verarbeitung von Normen. Und die temporale Logik schließlich versucht Aussagen, die sich auf die Zukunft beziehen, den aussagenlogischen Wahrheitswerten zuzuführen.
Aus diesem Überblick kann der Schluss gezogen werden: Unlogisch bedeutet nicht „außerhalb der Logik“, also mit den Regeln der Logik nicht zu erfassen. Es ist vielmehr die kritische Bewertung einer oder mehrerer Schlussfolgerungen, mit denen (möglicherweise vermeintlich) gegen logische Regeln verstoßen wurde, von denen das Widerspruchsprinzip die offensichtlichste ist. Die Feststellung, eine Äußerung sei unlogisch, ist selbst wieder ein wahrheitsdefiniter Satz. Sie lässt sich dann widerlegen, wenn nach den erweiterten Regeln der Logik Schlussfolgerungen möglich sind, die nach den basalen Regeln der Aussagenlogik unmöglich wären. Im Gegenzug lässt sie sich bestätigen, wenn nicht sorgfältig geschlossen wurde. Dann wurden die Bahnen der Logik jedoch erst gerade nicht verlassen. Denn eine regelgerechte Folgerung hätte zu einem logisch zulässigen Ergebnis geführt. Die Äußerung: „Das ist doch unlogisch.“ beschreibt also zunächst den Verdacht einer unzulässigen Schlussfolgerung, deren Wahrheitswert durch kritische Prüfung der verdächtigten Konklusion ermittelt werden muss.
(2) Die subjektive Wertung Ist ein Willensakt eine zielgerichtete Handlung, so fragt sich, auf welches Ziel der Wille, aus dem die Handlung folgt, sich richtet. Verändert die Norm die Welt, in der sie erzeugt wurde, so wird der Wille aus der Einschätzung geboren sein, dass der gegebene Ist-Zustand nicht einem gewünschten Soll-Zustand entspricht - eine Einschätzung des normerzeugenden Subjekts. Diese subjektive Wertung findet in der Prädikatenlogik statt.
Innerhalb einer Gruppe führt die Normgestaltungsfreiheit zur Definitionshoheit. Es kann sich in ihr also ein Konsens bilden, Gegenständen welche Eigenschaften zugeschrieben werden und welche Worte die so gebildeten Begriffe bezeichnen sollen. Wortpaare wie 'gut' und 'schlecht', 'schön' und 'hässlich', 'richtig' und 'falsch', äquivok auch: 'wahr' und 'falsch', sind Worthülsen, die letztlich mit den abstrakten, also inhaltsarmen Begriffen von 'positiv' und 'negativ' beziehungsweise 'ja' und 'nein' assoziiert sind. Hinter 'Positiv' kann Existenz stehen, hinter 'Negativ' das Gegenteil; 'Ja' bestätigt und 'Nein' widerspricht. Dem Begriff des Guten etwa, als gleichsam abstrakten Gegenstand kann so alles zugewiesen werden, worauf sich die Gruppe einigt. Im Sinne von 'Existenz' und 'Bestätigung' kann 'Gut' etwa definiert sein als der Zustand, dessen Existenz in der Welt als notwendig bestätigt wird, also erstrebenswert ist. Der Zustand der Abwesenheit des Guten, die Negation ist dann 'Schlecht'. Den Begriffen des Guten und des Schlechten als Kategorie müssen sodann weitere Begriffe zugeordnet werden, um das Gute auch erkennen zu können. Ihre Inhaltsleere führt jedoch dazu, dass die Definition der Unterbegriffe ebenfalls unscharf bleibt: 'Die Gegenstände gi, g2, g3, ... gn sind gut und nicht schlecht.' Gleichwohl ist sie formal logisch. Auf diese Weise werden sie widerspruchsfrei der Wertung zugänglich und die Gruppe kann als »Wertungsgemeinschaft« ihre Wertungsvorgänge wieder in die Welt der Aussagenlogik zurückführen.
Hinter der konkreten Vorschrift »man soll nicht schlagen« kann sich etwa eine subjektive Wertung der Aussage »wer geschlagen wird, weint« verbergen. Gleichgültig ob sich diese als allgemein- oder nur eingeschränkt gültig erweist, so legt sie doch die Annahme nahe: »Zumindest potentiell verursachen Schlagen Schmerzen und Schmerzen werden als unangenehm empfunden.« - ein wahrheitsfähiger Satz. Diese Annahme kann Ergebnis deduktiver Verfahren sein, denen wiederum induktive, also Erfahrungsschlüsse vorausgegangen sind.
'Das Unangenehme' kann innerhalb der »Wertungsgemeinschaft« als 'schlecht' definiert sein. Nun lässt sich etwa aus einem Kettenschluss folgern: Wenn Schmerzen unangenehm sind und unangenehmes schlecht ist, dann sind Schmerzen schlecht. Wenn Schlagen Schmerzen verursacht und Schmerzen schlecht sind, dann ist Schlagen schlecht.
Die Konklusion kann sogar einen absoluten Wahrheitswert annehmen. Werden die Hypothesen bestätigt, so sind die Konsequenzen wahr, andernfalls sind sie falsch. In Anlehnung an die modale Logik sind sie innerhalb einer oder mehrerer Welten, in der die erste Prämisse gilt, wahr. Sie ist jedoch nicht zwingend notwendig wahr, soweit sie in allen übrigen Welten nicht existiert. Nur innerhalb des Begriffshorizontes einer »Wertungsgemeinschaft« ist sie »in sich« logisch wahr. Im Folgenden wird auf eine in sich logisch wahre, wertende Schlussfolgerung mit ’stimmiges Wert-Urteil’ verwiesen.
Wird die Übereinkunft, also die Konvention getroffen, es existiere nur eine Welt, so wird damit dem Dilemma begegnet, dass allgemeingültige Aussagen zwar möglich aber nicht zwingend erschlossen werden können. So zeigt es sich etwa in den Naturwissenschaften: Die Worte ’allgemeingültig’ und ’universal’ werden mit dem Begriff der physischen Welt verknüpft: »Was in der physischen Welt ’wahr’ ist, ist allgemeingültig.« So wird die Artdifferenz ’physisch’ vermeintlich überflüssig und weitere Bezeichner können synonym abgeleitet werden: ’All’ sowie ’Universum’. Diese Gleichsetzung kann leicht zu Fall gebracht werden, wenn man nach den Existenzvoraussetzungen der physischen Welt fragt, damit in das Dilemma zurückführt und das »Universum« partikulär werden lässt.27
Die gleiche Problematik findet sich in der Gruppenkonvention, durch welche der aussagenlogische Wahrheitsbegriff (nach modallogischen Gesichtspunkten ’notwendig wahr’ und ’notwendig falsch’) mit den Wertbegriffen der Gruppe assoziiert werden. Die Gruppe gerät auf logische Abwege und kommt zu dem unzulässigen Schluss, ihre Wert-Urteile wären allgemeingültig. Hingegen bleiben die nach interner Logik erzeugten Ergebnisse in der Gruppenwelt verhaftet, ihr Stimmigkeit von der Gruppe als Subjekt abhängig. Die Wertung bleibt also notwendig subjektiv.
(3) Von der Wertung zur Norm Trotz des vorstehend aufgeführten Risikos intransparenter Begriffsverschiebungen, die in der Begriffsdeutungshoheit liegen und unzulässige Verallgemeinerungen hervorbringen können, sind die beschriebenen Wertungsvorgänge der Kernbestand von Normen. Ohne sie ist die Bestimmung des Ziels nicht möglich, auf das sich der Wille zur Normsetzung und damit zur Veränderung der Gruppenwelt richtet. Dieses Risiko erscheint gerade deshalb unvermeidbar, da die Überzeugung, allgemeingültige Wahrheit erkennen zu können, den Willen zur Normsetzung und damit zur Gestaltung der Gruppenwelt stärkt und die Wertungsentscheidungen legitim erscheinen lässt. Sie begünstigt auch die Ausdehnung der Gruppenwelt, die Verdrängung widerstreitender Ansichten in den Schnittmengen mit anderen.
Der Wertungsvorgang und die Normerzeugung sind jedoch nicht Gegenstand eines gemeinsamen Verfahrens. Wenn sich innerhalb des in (2) nachgezeichneten Wertungsvorgangs Anhaltspunkte für eine Abweichung des innerhalb der Gruppenwelt beobachtbaren Ist- vom Sollzustand ergeben, folgt eine korrespondierende Normerzeugung. Ein aus der Vereinbarung innerhalb der „Wertungsgemeinschaft“ über konkrete Zuordnungen der Prädikate 'gut' und 'schlecht' gebildetes Wert-Urteil wird an das Verfahren zur Normerzeugung übergeben. Dieses erfolgt dann erneut in streng logischen Bahnen, ausgehend von einem Syllogismus der das »Programm« bestimmt, anhand dessen die weiteren Subsumtionsschritte bis zur Norm vorgezeichnet werden.
Dieser Syllogismus kann etwa folgendermaßen nachgezeichnet werden:
(1) Das Schlechte ist die Abwesenheit des Guten.
(2) Wir wollen, dass das Gute ist.
(3) Also folgt: Das Schlechte soll nicht sein.
Dies ist äußerlich ein Schluss im Modus Barbara, also von zwei universellen Urteilen auf ein ebenso allgemeingültiges drittes.28 Bringt man ihn auf seine Grundform, so leuchtet das unmittelbar ein:
(1) Alles, was wir mit 'nicht gut' bezeichnen, klassifizieren wir als 'schlecht'.
(2) Der Wille aller Mitglieder unserer Gruppe ist gerichtet auf die Abwesenheit von allem, was wir als 'nicht gut' bezeichnen.
(3) Unser aller Wille ist gerichtet auf die Abwesenheit von allem, was wir als 'schlecht' klassifizieren.
Wenn in allen existierenden Sprachwelten die Äquivalente zu 'nicht gut' gleichbedeutend sind mit dem Äquivalent zu 'schlecht', so gilt das für alle Gegenstände, die entsprechend bezeichnet sind. Das lässt sich auf die zweite Prämisse übertragen, sodass sich der Schlusssatz folgerichtig ergibt. Das Subjekt »der Wille aller Mitglieder unserer Gruppe« verweist in die jeweilige Gruppenwelt, die „Wertungsgemeinschaft“, und ist daher gleichsam universell, sowohl intern, als auch extern, da die Aussage »in Gruppe x gilt A« aus jeder Perspektive wahr ist.
Die Verkürzung der Formulierungen durch den Wechsel in die reine Objektsprache lässt nun die Normerzeugung als Verknüpfung des WertUrteils und weiterer Aussagen mit diesem »programmatischen Syllogismus« als zulässigen Deduktionsvorgang erscheinen:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Die letzte Konklusion schließlich ist gleichbedeutend mit »Man soll nicht schlagen.«
Mit den Verben »wollen« und »sollen« werden nun keine neuen Verknüpfungen im Sinne der Aussagenlogik eingeführt und keine alternative Kopula im Sinne der Prädikatenlogik. Sie sind Begriffe, die lediglich die assertorischen Urteile, welche auf den jeweiligen Gruppenwillen verweisen, sprachlich verdichten. Denn ein Wille richtet sich auf einen künftigen Zustand. Ersterer kann notwendig nur verwirklicht werden, wenn letzterer herbeigeführt wird.
c) Der Normwiderspruch
Je höher die Anzahl der Normen und je komplexer ihr Zusammenspiel, desto wahrscheinlicher wird die Erzeugung von Vorschriften, die dasselbe zugleich vorschreiben und verbieten. Denn der subjektiveWertungen aufnehmende Normerzeugungssyllogismus ist für Widersprüche durchlässig.
Er grenzt absolut unbegründbares 'gutes' von 'schlechtem' ab. Je größer der Umfang dieser Begriffe, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass sie jeweils widersprüchliche Unterbegriffe enthalten, die ein Verhalten aus unterschiedlichen Perspektiven beurteilen, was im Ergebnis zur Setzung von widersprüchlichen Vorschriften führen kann (dazu sogleich mehr in 3 b)..
d) Zusammenfassung
Nach dieser Analyse der Normentstehung, erweist sich die eingangs wiedergegebene Behauptung als wahr: Aussagen sind Vorschriften kontradiktorisch entgegengesetzt. Erstere gelten absolut, sind deskriptiv, subjektunabhängig, wahr oder falsch, können also nicht zugleich wahr und falsch sein und sind somit verifizier- oder falsifizierbar. Letztere gelten relativ im Subjekt »Wertungsgemeinschaft«, welche die Normen nach ihrem Willen setzt, von der diese somit abhängen und sind präskriptiv. Da sie aus subjektiven Wertzuschreibungen folgen, sind sie weder im objektiven Sinne wahr noch falsch, sie können widersprüchlich sein und lassen sich nicht außerhalb der »Wertungsgemeinschaft« begründen.
3. Normsätze
Normsätze beschreiben Normen, sind dahingehend Aussagen über die Gültigkeit einer Norm; zur deskriptiven und präskriptiven Komponente einer Norm beinhalten sie demnach auch die Angabe über deren Adres- saten.29
Das Verhältnis der einzelnen Bestandteile wird formal wie folgt dargestellt: normativer Operator[Handlung(Normadressat)]30
Ein Normadressat wird also in Relation zu einer bestimmten Handlung gesetzt, welche wiederum mit einer Anweisung an die entsprechend handelnden verknüpft wird. Soweit davon auszugehen ist, dass Normen eine Handlung gebieten, erlauben oder verbieten, sind drei Operatoren denkbar, die mit den Symbolen O (obliged) für 'geboten', P (permitted) für 'erlaubt' und F (forbidden) für 'verboten' dargestellt werden.31 'Handlung' wird symbolisiert durch H. Die mit Großbuchstaben gekennzeichneten Bestandteile des Normsatzes sind Konstanten. Die Normadressaten sind variabel. Für ihre Kennzeichnung bieten sich daher beliebige Kleinbuchstaben, etwa das x an. Der formalisierte Ausdruck lautet somit: O[H(x)] beziehungsweise P[H(x)] oder F[H(x)].
Der reine Normbestand wäre demnach jeweils: O[H()] beziehungsweise p[h( )] oder F[H( )]. Eine bestimmte Handlung wird einem normativen Operator untergeordnet. Ohne Normadressaten, ohne Handelnde, geht jedoch sowohl ein Gebot, eine Erlaubnis als auch ein Verbot ins Leere, wie durch die Symbolschreibweise offensichtlich wird. Normadressaten sind demnach bereits wesentlicher Bestandteil der Norm selbst. Es kommt somit auf den Zusammenhang an in dem O[H(x)] verwendet wird, ob es als Norm oder als Normsatz zu betrachten ist.
Soll die Existenz einer Norm bestimmter Ausprägung nachgewiesen werden, so ist der Normsatz gemeint. Wird die Norm angewendet, so kann ihrer Beschreibung, dem Normsatz, entnommen werden, auf welche Weise das zu geschehen hat.32
Ohne All- oder Existenzquantoren (V / 3) bleibt der nombeschreibende Satz als Ganzes jedoch unvollständig, eine freie, also ungebundene Aussagenvariable.33 Als Beschreibung einer Verbotsnorm sagt er etwa aus: »Ein beliebiges x darf H nicht tun.« Um einen Normsatz vollständig wiederzugeben, muss deutlich werden, für welche x die Norm O[H( )] gilt. Ansonsten lebt das zuvor angesprochene Problem wieder auf, dass eine Norm ohne Adressat in die Leere transzendiert.
Das Weltenargument aus 2 b aa aufgreifend kann dargestellt werden, dass eine Verbotsnorm in allen Gruppenwelten existiert, die für alle x gilt, formal: Vx F[H(x)]. Würde Bezugspunkt für alle potentiellen Normadressaten x ein physischer Weltenbegriff sein, so würde die Norm nur für einige von ihnen gelten, nämlich jene, die ihrerseits nur in einer oder mehreren der in der physische Welt entstandenen Gruppenwelten existiert: 3x F[H(x)]. Würden schließlich die Normadressaten einer bestimmten Gruppenwelt Gj von denen einer anderen abgegrenzt, für alle oder auch nur einige x dieser bestimmten Welt eine Norm F[H( x)] gelten, so ergäbe sich folgende Darstellung: Vx^Gj: F[H(x)] bzw. 3x£Gj: F[H(x)]. Erst als konkrete Aussage über die Geltung einer Norm für ein konkretes x wird der Normsatz entscheidbar, kann für ihn als Aussage ein eindeutiger Wahrheitswert festgestellt werden,34 sei dieser nun aus globaler oder nur aus interner Perspektive 'notwendig', oder bei externer Betrachtung lediglich zufällig möglich, also 'kontingent'.
Zur Analyse der Relationen, Grundwahrheiten und Schlussregeln, mit welchen sich gegebene Normen intern, aber in jedem beliebigen Normensystem gleichartig verarbeiten lassen, ist allerdings nur F[H(x)] ohne Quantoren wesentlich.
a) Normgegensätze
Die deskriptive Komponente der Norm im Normsatz H(x) kann zur Aussagenvariable, hier a, zusammengefasst werden, da die normative Operation stets auf dieselbe Handlung eines Adressaten x angewendet wird. Ein Unterlassen, ein Nicht-Handeln des x kann so übersichtlich als Nicht- a (Symbol: —a) dargestellt werden. Dadurch wird etwa der Ausdruck F[H(x)] vereinfacht zu F(a).35
Auf diese Weise lassen sich zunächst die Regeln zur Umwandlung der drei Operatoren O, P, F ermitteln:
(1) Wenn geboten, also vorgeschrieben ist, a zu unterlassen, also O(—a) gilt, so ist a nicht erlaubt, also gilt —P(a). Das ist gleichbedeutend mit dem Verbot von a, F(a). Diese Ausdrücke sind äquivalent.
(2) Wenn a nicht verboten ist, —F(a), so ist a zumindest erlaubt, P(a) und seine Unterlassung nicht geboten, also nicht vorgeschrieben, —O(—a).
(3) Wenn es erlaubt ist, a zu unterlassen, P(—a), dann ist a nicht geboten, —O(a). Äquivalent ist die Unterlassung von a auch nicht verboten, -F(-a).
(4) Ist a schließlich geboten, O(a), so ist seine Unterlassung verboten, F(—a) und auch nicht erlaubt, —P(—a).
Ein einziger Operator kann demnach sämtliche möglichen Normanweisungen darstellen.36 Daraus wird leichter erkennbar, in welcher Weise sie sich gegenüberstehen.
Gegenstände können konträr, subaltern, subkonträr und kontradiktorisch entgegengesetzt sein. Konträr ist ihr Gegensatz, wenn sie nicht gemeinsam gelten, aber durchaus gemeinsam nicht gelten können, wenn sie also verschieden sind. Ihre Brücke sind die ihnen jeweils subaltern entgegengesetzten Gegenstände. Ist etwas geboten, so ist es gleichzeitig erlaubt. Die untergeordneten Gegenstände wiederum stehen einander subkonträr gegenüber. Fehlt es an beiden, so wird die logische Brücke zu einem der übergeordneten geschlagen. Kontradiktorische Gegensätze hingegen sind unüberbrückbar, da sich hier Existenz oder Gültigkeit und Nicht-Existenz oder Ungültigkeit gegenseitig aufheben. So kann etwa eine Erlaubnisnorm kein Verhalten zulassen dessen Unterlassung gleichzeitig eine Verbotsnorm bestimmt.3735 36 37
Im logischen Quadrat der Gegensätze kann das folgendermaßen dargestellt werden, die äquivalenten Ausdrücke jeweils in einer Zeile:
Logisches Quadrat der Gegensätze (Normen)
b) Regeln der Normenlogik
Der Darstellung in a sind einige Implikationen leicht zu entnehmen. So folgt etwa, wie bereits erwähnt, aus dem Gebot einer Handlung ihre Erlaubnis: O(a) ^ P(a),38 ihr subalterner Gegensatz.
Eine Erlaubnis kann gelten, selbst wenn, ihr subkonträr gegenüberstehend, die Handlung auf die sie sich richtet, nicht geboten, also nicht ausdrücklich vorgeschrieben ist. Ebenso kann formal nur eines von beiden zutreffen. Das entspricht der Wahrheitswertentwicklung der Disjunktion: P(a) V O(a). Gilt beides, so existiert keine Gebots- oder Verbotsnorm. (Letztere ist ihrerseits ein Gebot, welches die Unterlassung einer bestimmten Handlung fordert: F(a) ? O(—a).) Ist eine Handlung erlaubt, so kann vom Fehlen des subkonträren Gegensatzes stets auf die subalterne Norm geschlossen werden. Denn die subalterne Norm ist die Kontradiktion des subkonträren Gegensatzes. Am Beispiel veranschaulicht leuchtet das unmittelbar ein: Ist eine Handlung nicht geboten, aber auch nicht erlaubt, so muss sie verboten sein. Ist sie hingegen einzig erlaubt, wird also der konträre Gegensatz verneint, so besteht notwendig eine Gebotsnorm. Daher gilt sowohl O(a) ^ P(a) ? O(a) ^ —O(—a) -O(-a) V —O(a).
Für den Fall, dass —O(—a) ? —O(a) gilt, eine Handlung demnach sowohl erlaubt als auch nicht geboten ist - weder geboten, noch verboten38 39 - wird diese Handlung als indifferent bezeichnet, was durch den Indifferenzoperator I ausgedrückt wird: I(a) = —0(—a) ? —0(a).40
Der konträre Gegensatz und damit eine Widerspruchsregel der Normenlogik, der ausgeschlossene sogenannte „deontische Widerspruch“ ergibt sich aus der Disjunktion —0(—a) V —0(a). Wird a negiert, durch —a ersetzt, vertauschen sich die Glieder des Ausdrucks: —O(a) V —O(—a). Klammert man den Junktor — aus, erhält man die Regel -(O(a) ? O(—a)).41 (Ohne den Austausch von a und —a würde durch sofortiges Ausklammern das gleiche Ergebnis erzielt, da die Konjunktion wie auch die Disjunktion kommutativ ist.)
Die deduzierte Regel besagt: Es kann nicht eine Handlung a zugleich geboten und verboten sein. Das wäre ein Widerspruch auf der Handlungsebene, der jegliches normgerechte Agieren verhindert. Wo dies möglich ist, wird ein Normensystem inkonsistent. Seine einzelnen Normen müssen daher aufeinander abgestimmt und (Meta-)Regeln zum Ausgleich auftretender deontischer Widersprüche müssen vorhanden sein, um Konsistenz zu erhalten.42
Als weitere mögliche Irritation erweist sich der sogenannte „normative Widerspruch“. Er ist ein vermeintlicher kontradiktorischer Gegensatz, der bezogen auf den Operator O an einen aussagenlogischen Widerspruch erinnert: O(a) ? —O(a). Hier wäre durch zwei unterschiedliche Normen eine Handlung zugleich geboten und nicht geboten, also ihre Unterlassung erlaubt (äquivalenter Ausdruck: 0(a) ? P(—a)). Dies ist ein Widerspruch auf der Normenebene, der dem Normadressaten immer noch die Wahl lässt, nach der Gebots- oder der Erlaubnisnorm zu handeln.43 Er stellt demnach die Konsistenz des Normensystems nicht infrage, sein Ausschluss ist „,keine logische Notwendigkeit““,44 sondern lediglich eine praktikable auf Ebene der normerzeugenden Gruppe.
Ein echter kontradiktorischer, also logischer Widerspruch liegt vor, wenn durch eine einzige Norm sowohl eine Handlung als auch deren Unterlassung geboten wird, schematisch 0(a ? —a). Hier besteht der Konflikt im deskriptiven Teil der Norm, der nicht aufgelöst werden kann.4540 41 42 43 44 45
c) Zusammenfassung
Die Bezeichnung 'Normsatz' und 'Norm' erfasst denselben regulativen Baustein des in 2 b aa entwickelten Gedankenmodells der 'Gruppenwelt' aus unterschiedlichem Blickwinkel. Wird ein individueller Baustein beschrieben, betrachtet man die sinnvolle Wortkombination als Aussage, eben als Normsatz. Wird die Anweisung befolgt, so betrachtet man die Norm.
Auf einer abstrakten, von individuellen Normsätzen losgelösten, Betrachtungsweise lassen sich durch das Konstrukt des Normsatzes die in der Norm integrierten Bestandteile beschreiben. Insoweit hat dieser Satz die Doppelfunktion zum Einen Aussage über die Existenz konkreter Normen zu sein, zum Anderen auf abstrakter Ebene mit diesen logisch operieren zu können. Die dadurch gewonnenen Erkenntnisse über mögliche Inkonsistenzen im Zusammenspiel auf identische Handlungen und identische Adressatenkreise gerichteter Normen, lassen sich dann auf existentente Normen anwenden, um die in der Natur der Sache liegenden möglichen Widersprüche auflösen zu können.
II. Systemtheoretische Perspektive
Hinter der Bezeichnung 'Systemtheorie' verbergen sich Denkmodelle, die in einem in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts begonnenen wissenschaftlichen Diskurs über die Erforschung bestimmter Phänomene entwickelt werden, um mehr oder weniger abgeschlossene Daseinsformen zu beschreiben, welche scheinbar durch innere Gesetzmäßigkeiten zusammengehalten werden. Kürzer gesagt: Im 20. Jahrhundert wurden in unterschiedlichen Disziplinen unterschiedliche Theorien über Systeme entwickelt. Die Modelle weichen teilweise stark voneinander ab, sodass von einer 'allgemeinen Systemtheorie' nicht gesprochen werden kann, welche dem Anspruch standhalten könnte, für jegliche der vielfältigen, eingangs mühsam definierten Phänomene einheitliche Erklärungsansätze zu liefern.46
Von Theorien zur Erforschung von Systemen, welche auf klaren Unterscheidungen beruhen, kann man sich jedoch allgemein zumindest Terminologien erhoffen, mit welchen entsprechende Phänomene differenzierter, vielleicht sogar zutreffender beschrieben werden können, indem das Begriffsvokabular des allgemeinen Sprachgebrauchs geschärft und erweitert wird, auf welches in I 2 zurückgegriffen wurde. Möglicherweise befähigen solche Theorien dadurch zu einer Reflektion, sowohl von innen eines Systems als auch von außen.
Soweit in dieser Arbeit ganze Normensysteme betrachtet werden und in diesem Teil deren kleinster Bestandteil, die Norm, erscheint es fahrlässig, diese potentielle Erkenntnisquelle zu übergehen.
Der Rückgriff auf soziologische Systemtheorien liegt nahe, da Normen von Menschen kollektiv erzeugte Verhaltensregeln sind, wie in I 2 b rekonstruiert, und die sich daraus bildenden Systeme damit auch Gegenstand der Soziologie sein müssen. Das von Luhmann erarbeitete Konzept zur systemtheoretischen Analyse der Gesellschaft erscheint dabei besonders geeignet. Er hat den Versuch unternommen, in verschiedenen Disziplinen entwickelte Ansätze in einer allgemeinen Theorie der Gesellschaft zu vereinen,47 Religion, Moral, Politik und Recht als gesellschaftliche Systeme begriffen48 und sich daher notwendig auch mit diesen intensiv systemtheoretisch auseinandergesetzt. Die genannten werden als für diese Arbeit relevante, miteinander in Beziehung stehende, normerzeugende Systeme verstanden. Daher wird das Konzept Luhmanns als solide Grundlage für belastbare Aussagen über Normen betrachtet, welche die in I 2 und I 3 begonnenen Deduktionsvorgänge weiterführen und den Begriff der Norm weiter zu schärfen helfen.
1. Grundbegriffe der Systemtheorie Luhmannscher Prägung
Es wäre vermessen zu glauben, irgendeine Systemtheorie in wenigen Sätzen zusammenfassen und erläutern zu können. Jede Verkürzung, gerade eines so komplexen Konzepts wie des hier in Bezug genommenen, ist in hohem Maße fehleranfällig. Dennoch ist erforderlich, in nur begrenzt zur Verfügung stehenden Raum die wesentlichen Punkte herauszuarbeiten, welche für diese Erörterung relevant erscheinen.
Der Rückgriff auf Luhmann führt unmittelbar zu einer Auseinandersetzung mit der von ihm verwendeten Terminologie, anhand derer die Grundzüge seines Konzepts erschließbar scheinen, welche am Ende dieser Erörterung zusammengefasst werden. Die erläuterten Begriffe werden durch Kapitälchen gekennzeichnet, um sie besser vom übrigen Text und gleich bezeichneten Begriffen mit gegebenenfalls anderem Umfang und Inhalt abzugrenzen.
a) Operativ geschlossene Systeme
Im systemtheoretischen Diskurs sind die Begriffe offener und geschlossener Systeme diskutiert worden. Sind Systeme offen, stehen sie in irgendeiner Form mit ihrer Umwelt in einem Austauschverhältnis; geschlossene Systeme sind ihr Gegenbegriff.49 Dabei legt die Analogiebildung von Gesetzmäßigkeiten physikalischer Systeme gerade bei Gesellschaften nahe, von offenen Systemen auszugehen.50 51 52 Luhmann präferiert einen modifizierten Begriff von Offenheit, den der operativen Geschlossenheit.51 Diese grenzt ein System von seiner Umwelt deutlich ab, welches durch strukturelle Kopplungen52 jedoch mit letzterer verbunden, also in einem beschränkten Maße für externe Einflüsse offen bleibt.53
Das Herausarbeiten von Unterscheidungen ist demnach der Ausgangspunkt der Theorie. Ein System wird durch Unterscheidung von anderen Systemen identifiziert, welche ihrerseits dessen relative Umwelt bilden.54 55 Unterteilt sich etwa ein System S in die Subsysteme a, ß, ? und d, so ist a eingebettet in seine Umwelt aus ß bis d und alles weitere was über S als Ganzem hinausgeht.
Das System selbst ist „die Differenz zwischen [System] und [Umwelt].“55 Diese Paradoxie löse sich auf, wenn man es unter Rückgriff auf das operative Kalkül Spencer Browns, den Laws of Form, als zweiseitige Form betrachte,56 welche durch die Unterscheidung entsteht und den Blick auf ihre Innenseite lenkt.57 Die Unterscheidung finde dabei als initiale Operation des Systems selbst statt, ihr Schöpfungsakt, an welche sich im Fortgang der Zeit stets eine typgleiche Operation folgenreich anschließt und so das System durch die Abgrenzung „vom Rest“ entstehen lässt.58 Mit dem Beispiel der Operation 'Leben' wird dieser Gedanke greifbar. Sie grenzt lebende Daseinsformen von solchen ab, die nicht auf ihr gründen - lebendes von nicht lebendem, das System 'Leben' von allem Übrigen. Innerhalb des Systems setzt sich die Operation fort, „vervielfältigt [sich]“, um das System zu erhalten,59 was sowohl im Sinne von »generieren« als auch »stabilisieren« verstanden werden kann. Die (fortwährende) Unterscheidung ist somit selbst das System. Kommt der Vervielfältigungsprozess zum Stillstand, bricht das System zusammen. Ein lebendiges Wesen das stirbt, gehört dann unmittelbar zur Umwelt des Lebens, in der alles zusammengefasst ist, was eben nicht 'Leben' ist. Die Operation schließt das klar umrissene Leben vom diffusen Nicht-Leben, dem unmarkierten Raum,60 ab - das System ist operational geschlossen.
b) Autopoiesis
Für den Vervielfältigungsprozess, die Reproduktion der Unterscheidung, hat Luhmann den Begriff der Autopoiesis übernommen, welcher in der theoretischen Biologie geprägt wurde.61 Die Wortschöpfung der Biologen Maturana und Varela gehe zurück auf Schwierigkeiten bei der Begriffsbildung, die sich aus der Annahme zweckgerichteter Operationen zur SYSTEM-Erhaltung ergeben, welche gleichzeitig wieder das System selbst sind, sich auf sich selber richten. Eine Tätigkeit, die ihren Sinn selbst in sich trägt, eine Handlung um des Handelns Willen, sei im aristoteleschen Sinne mit dem altgriechischen Wort 'p?a???' (praxis) gemeint. Dieser Begriff beinhaltet die Selbstreferenz. Operationen sind jedoch nur Praxis, soweit man zwischen ihnen und dem System, in welchem sie ablaufen, begrifflich unterscheidet. Dann ist letzteres die externe Beschreibung einer Summe der typgleichen erstgenannten, die zufällig und allein zur eigenen Selbstbestätigung ablaufen. Der Gegenbegriff, eine Handlung, welche nicht Selbstzweck ist sondern auf einem außerhalb von ihr liegenden Zweck gerichtet ist, werde mit 'p???s??' (poïesis) bezeichnet. Auf Grundlage der Annahme, dass Operationen ein „>Werk<“, ein System erschaffen und dessen Existenz fortlaufend bestätigen, welches sie nun wieder selbst sind, wurde die Bezeichnung 'Autopoiesis' konstruiert für 'Selbsterschaffung': das System ist sein eigenes Werk, die „[Operation] ist die Bedingung für die Produktion von [Operationen].“62 63 64
c) Selbstorganisation
Von diesem grenzt er den Begriff der Selbstorganisation ab.63 Ein operational geschlossenes System bildet Strukturen aus, die allein Ergebnis seiner immanenten Operationen sind. Ein (unmittelbarer) »Strukturimport« aus der Umwelt findet nicht statt:64 das System organisiert seine Strukturen autonom. Selbstorganisation ist demnach die „Erzeugung [von] Struktur[en] durch eigene Operationen“.65 66 67
Demgegenüber fixiert die Autopoiesis eines operational geschlossenen Systems, die fortwährende systembildende Vervielfältigung der typgleichen Unterscheidung, dessen gegenwärtigen Zustand.66
Dies sind keine Gegenbegriffe, sondern sie erfassen zwei Aspekte eines Systems und greifen somit ineinander. Ist 'System' hier in Kapitälchen gesetzt, soll stets die Eigenschaft 'operational geschlossen' mitgedacht werden, sodass beide Aspekte darin enthalten sind. Sie wird gelegentlich nur zur Klarstellung als Pleonasmus beigefügt, um die Eigenschaft ins Gedächtnis zu rufen.
d) Strukturen und Operationen
Sind Strukturen abhängig von Operationen, so sind sie gleichzeitg abhängig von der Existenz des Systems, deren Voraussetzung die Autopoiesis ist. Letztere ermöglicht also nur die Strukturentwicklung, sie lenkt diese jedoch nicht.67 Strukturen existieren also nur dann, wenn das System operiert. Es lässt sich folglich nur die Erinnerung ehemals gegenwärtiger Strukturen rekonstruieren und, unter der Voraussetzung typgleicher Vervielfältigung, die Erwartung ausdrücken: Künftig werden diese den vergangenen grundsätzlich gleichen, da sie identisch erzeugt 68 werden.
Als naheliegende Metapher für 'System' im Sinne der bis hier anhand ihrer Begriffe vorgestellten Theorie bietet sich die Bildröhre früherer Fernseher an: Die Operation ist der Elektronenstrahl, welcher einen Punkt auf die Mattscheibe zeichnet, sie dort wo der Strahl auftritt in einem minimalen gegenwärtigen Moment zum Leuchten bringt, sogleich zeilenweise weiterwandert und, am unteren Ende der Scheibe angekommen, in der gegenüberliegend oberen Ecke beginnend das Bild wiederholt. Das Nachleuchten der Mattscheibe ist die Erinnerung an die ehemals erzeugten Strukturen. Sie ergeben ein Bild, das vom Betrachter interpretiert wird und die Erwartung weckt, das Folgebild werde in gleicher Weise erzeugt und dem vorherigen ähnlich sein. Die Bilderzeugung erscheint dem Betrachter als System, das Gesamtbild als Struktur. Indes ist System die autopoietische und selbstorganisierte Punkterzeugung und allein der Punkt die Struktur. Dennoch ist letztere vom gleichen Wesen oder Material wie die Operation, der Elektronenstrahl.68 69 Alles, was nicht unmittelbar zur Punkterzeugung gehört, ist dessen Umwelt, also (in dieser Analogie) auch der Betrachter, welcher den aufleuchtenden Punkt und dessen Nachwirkungen zu einer Erwartung für die Zukunft verknüpft.
e) Beobachter
Dem Betrachter als Beobachter kommt in dieser Theorie eine besondere Bedeutung zu. Luhmann grenzt ihn vom Vorgang des Beobach- tens ab: Letzteres sei eine Operation, ersteres ein System autopoie- tischer Beobachtungssequenzen.70 Danach wird einerseits deutlich, dass eine Operation nicht per se sondern durch ihre kontinuierliche Vervielfältigung zum System wird. Ansonsten bleibt sie ein isoliertes Ereignis; um im Bild zu bleiben: Ein Punkt auf der Mattscheibe, der nach kurzzeitigem Aufleuchten wieder erlischt, ohne sich in einen Zusammenhang einzufügen.
Andererseits lässt sich die Position des Beobachters relativ zum beobachteten System bestimmen. Seine Beobachtung ist ein Ereignis, das innerhalb des Systems erfolgt. Denn Beobachtung des Systems ist Beobachtung von dessen Operationen und erfolgt nur dort, wo auch operiert werden kann: Operational geschlossenen Systemen stehen nur eigene Operationen zur Verfügung.
Um ein System beobachten und analysieren zu können, muss also der Beobachter selbst eine Operation dieses Systems sein. Seine eigenen Beobachtungen wiederum, als anschlussfähige Unterscheidungen, konstituieren ihn als System im System, das nur existiert, solange es operiert.
Als Versuch diesen zirkulären Schluss bildhaft im Ansatz zu beschreiben, bietet sich eine entfernte Anleihe bei der Softwaretechnik an: Eine rekursive Funktion ruft sich solange selbst auf, bis eine Abbruchbedingungen erfüllt wird. Sie ist Teil des Programms, innerhalb dessen sie definiert wurde.
Wäre eine solche Funktion vorstellbar, die nicht unmittelbar dem Zweck des Programms dient, etwa der Steuerung von Eingabe- und Ausgabeoperationen in einem Betriebssystem, sondern dessen reibungslosen Ablauf überwacht, so wird es eine Unterscheidung treffen zwischen dem Zustand, in dem das überwachte Programm operieren kann und jenem, in dem das unmöglich wird. Dabei wird sie etwa Fehlermeldungen weitergeben, wenn das Programm nicht mehr wie vorgesehen operiert. Die rekursive Funktion, die zur Überwachung des Laufzustands vom übrigen Programm unabhängige Operationen durchführt, lässt sich als Beobachter beschreiben, der eigenständige Beobachtungen durchführt. Im Verhältnis zu dem Programm, in dem sie definiert wurde, ist sie jedoch wieder eine Struktur. Durch sie wird die Operation gestartet, die das Beobachtungs-Subsystem konstituiert, wenn es benötigt wird.71 72
Die im Vergleich angedeutete, durch die Operation 'Beobachtung' vorgenommene Unterscheidung ist dahingehend zu präzisieren, dass durch sie nur die Seite bezeichnet wird, welche operativ relevant ist; sie ist also nach innen gerichtet.73 Diesen asymmetrischen Vorgang, das Ausblenden der notwendig in der Unterscheidung mitgeführten Umwelt und die Fokussierung der systemimmanenten Operationen, bezeichnet Luhmann in Anlehnung an von Foerster als „>blinden Fleck des [Beobachtens].“74 Um beobachten zu können, muss der BeobachTUNGSgegenstand erkannt werden können, damit schließt man aus, was nicht zu ihm gehört ohne sich dann aber während der Beobachtung noch laufend all dessen zu vergewissern, was nicht ihr Gegenstand ist; der Beobachter als System macht sich selbst demnach gleichsam »unsichtbar«.74 75
Unter der Prämisse, dass der Beobachter durch seine Beobachtungen selbst zum System wird und damit intern operiert, ohne seine eigenen Operationen zu hinterfragen,76 ist die konstatierte Asymmetrie folgerichtig. Zeichnet sich die Beobachtung dadurch aus, den Beobach- tunsgegenstand zu isolieren um ihn zu erkennen, so läuft die dazu notwendige Unterscheidung und ihre kontinuierlich Vervielfältigung ab, wie die autopoietische Operation im beobachteten System. Sie werden erst »sichtbar« durch eine weitere Unterscheidung, die Beobachtung des Beobachters, welche wieder ein neues, für die eigene Unterscheidung blindes System generiert. Dies wird zur Beobachtung auf Ebene zweiter Ordnung.77
f) Kommunikation als Operation sozialer Systeme
So richtet sich die Aufmerksamkeit auf eine weitere Eigenheit der in Bezug genommenen Systemtheorie: die scharfe Trennung zwischen psychischen und sozialen Systemen. Beide seien zur Selbstreflektion fähig. Nach der Terminologie von Foersters sind sie als „nichttriviale Maschinen“ zu bezeichnen, die sich unerwartet verhalten können, eben weil sie ihre Operationen nicht stets blind ablaufen lassen, sondern zwischenzeitlich hinterfragen, sich selbst beobachten können, und gegebenenfalls andere Strukturen erzeugen lassen, als in der Vergangenheit.78 Danach kann auch ein soziales System sein eigener Beobachter sein; der Begriff rekurriert nicht zwangsläufig auf einen Menschen, ein psychi- sches System mit Bewusstsein,79 der von einem externen Standpunkt ein soziales System beobachtet. Ist der Beobachter sein eigenes System, dessen konstituierende autopoietische Operation die Unterscheidung und Bezeichnung des Beobachtungsgegenstandes ist,80 nd findet dieses als Operation des sozialen Systems statt, so beobachtet sich dieses selbst.
Als das soziale System konstituierende Operation benennt Luhmann die Kommunikation, welche wiederum Kommunikation hervorbringt81 und zwischen kommunikationsfähigen Menschen, jeder für sich ein psychisches System, stattfindet. Sie erfasse drei Komponenten: (1) Information, (2) Mitteilung und (3) Verstehen. Sie bestehe also aus einer Neuigkeit, etwas das bisher unbekannt war, dem Akt, diese Neuigkeit einem anderen zur Kenntnis zu bringen sowie dem Akt, die Mitteilung aufnehmen und die Neuigkeit wahrnehmen zu können.82
Fragen Menschen nach einem »Warum?« können sie einen sozialen Vorgang thematisieren und darüber kommunizieren, oder sie stellen diese Frage auf sich selbst bezogen, dann findet die Beobachtung intern in ihrem psychischen System statt. Auch wenn sie in letzterem Fall im sozialen System mit anderen kommunizieren, so geht das doch auf ihre Selbstbeobachtung zurück, die nicht im sozialen System operiert. Die Kommunikationspartner werden vielmehr zur Fremdbeobachtung eingeladen. Hingegen wäre die Reflektion über den Modus, die Art und Weise der gemeinsamen Kommunikation wieder eine Selbstbeobachtung des sozialen Systems. Die Relativität der Sys- ???/UMWELT-Unterscheidung macht die Notwendigkeit deutlich, in der Kommunikation stets die Systemreferenz anzugeben.83
g) Strukturelle Kopplung
Dies führt zur Bestimmung des eingangs erwähnten Begriffs der strukturellen Kopplung. Dieser ebenfalls der Terminologie Maturanas entlehnte Begriff soll die Verbindung eines operational geschlossenen Systems mit seiner Umwelt erfassen.84 Diese erfolgt nicht über dessen Operationen, es kann nicht extern operieren, sondern über seine Strukturen.85 Letztere filtern für das System relevantes, in dessen Umwelt existierendes und koppeln es mit der Autopoieseis, indem nur solches einbezogen wird, was der Erhaltung des Systems, also dem Fortgang der Autopoieseis dienlich ist; was außerhalb dieser selektiven Kopplungen auf das System einwirkt, dessen operative Grenze »gewaltsam« durchbricht, kann nur destruktive Konsequenzen mit sich, die fortwährende Vervielfältigung und damit die Strukturentwicklung zum Stillstand bringen.85 86
Die Komplexität der Umwelt, welche alles beinhaltet, das nicht zum System gehört, wird so auf das Maß reduziert, welches das System verarbeiten kann. Die gekoppelten Einflüsse aus der Umwelt, die von dort gefiltert eindringenden systemfremden Strukturen, irritieren das System. Sie werden durch den jeweiligen Filter in eine Information transformiert, können nur als solche eindringen, denn als Struktur sind sie durch Operationen eines anderen Systems erzeugt worden. Andernfalls würde eine fremde systembildende Operation eindringen, welche die ursprüngliche Unterscheidung aufhebt. Die Grenzen lösen sich auf und das System, das sich nicht mehr abgrenzen, nicht mehr unterscheiden kann, bricht als solches zusammen. Die Autopoiesis kommt zum Stillstand.
Die Information hingegen gibt Aufschluss über mögliche, notwendig destruktive, Grenzverletzungen und induziert eine Anpassung der, notwendig internen, Strukturen zur Abstimmung des Systems auf seine Umwelt, durch Beibehaltung des Unterschieds. Sie ist also ein Ereignis, das als etwas bisher unbekanntes, überraschendes operativ verarbeitet wird. Hingegen ist das Bekannte bereits in die eigene Struktur integriert, ist selbst Struktur und damit keine Information mehr, selbst wenn sie als Phänomen Struktur verschiedener Systeme ist. Allein letzteres wäre das überraschende Ereignis, die Information, sobald sie durch die strukturelle Kopplung dieser Systeme aufgenommen, verarbeitet, als unproblematisch für den jeweiligen Systemerhalt erkannt, dadurch bekannt und so wieder selbst zur Struktur wird.87
Der hier anklingende dramatische Effekt der »Systemvernichtung« durch »Grenzverletzung« verweist auf die scharfe Betonung der operativen Geschlossenheit und ihrer Implikationen in dieser Systemtheorie. Je komplexer aber ein System, um so vielfältiger seine strukturellen Kopplungen, um so weniger ist es zu überraschen. Je einfacher ein System strukturiert ist und je geringer es gekoppelt ist, um so stärker wird die Komplexität seiner Umwelt gefiltert, es also durch die möglichen äußeren Einflüsse nicht überfordert. Durch sie geförderte InformatiONSverarbeitung als STRUKTURanpassung erhöht sukzessive die Vielfalt der Strukturen und als solche auch weitere Kopplungen zu anderen UMWELTsystemen, den InformationsAuss, die fortwährende Reduzierung von Überraschungen und damit die SYSTEMstabilität.
Die Trennschärfe der Systemtheorie erscheint vor diesem Hintergrund gerechtfertigt: Wenn ein Einfluss als Ereignis in das System außerhalb von dessen Kopplungen eindringt, seine Grenzen durchbricht, es also überfordert und dadurch verletzt, so wirkt dieser Einfluss vernichtend, selbst wenn die Autopoiesis nicht unmittelbar, sondern perspektivisch zum Erliegen kommt. Induziert er hingegen selbst dramatische Strukturveränderungen, welche die Komplexität des Systems stark erhöhen, so bleibt die Überforderung dennoch aus, das Ereignis der Verarbeitung zugängliche Information. Vielmehr noch kann die Analyse, die Beobachtung des Systems, die Erkenntnis mit sich bringen, dass es bereits komplexer strukturiert, auch stärker verkoppelt war, als angenommen.
Im Verhältnis zum obigen Fernseherbild steht diese Erläuterung jedoch in einem scheinbaren Widerspruch. Ist die Struktur ein »Punkt auf der Mattscheibe« und nicht das Gesamtbild, das der »Punkt« beim Dahingleiten auf der »Mattscheibe der Zeit« hinterlässt, so ist er stets ein Ereignis in der Gegenwart. Das System, als »abgelenkter Elektronenstrahl«, kann im jeweils gegenwärtigen Zustand nicht überrascht werden, da es »blind« operiert, im nächsten Augenblick also den nächsten »Punkt« setzt, weil es das tun muss, weil die vervielfältigte Operation ihn kopiert. Hält man einen Hufeisenmagneten an die Bildröhre, so wird der Elektronenstrahl abgelenkt. Dem System ist das gleichgültig. Es funktioniert unter den veränderten Systembedingungen weiter. Überrascht ist der externe, der Fremdbeobachter. Ihm fällt auf, dass das Gesamtbild verzogen oder verfärbt ist. Er bemerkt einen kausalen Zusammenhang zwischen dem UMWELTeinfluss und der StrukTURveränderung, da er den Zeitablauf überblickt. Er kann diesen Kausalzusammenhang in seinem System als Information verarbeiten und in der Hoffnung, den alten Zustand wieder herzustellen, den Magneten von der anderen Seite vorsichtig der Bildröhre annähern.
Offensichtlich wurde obige Metapher bereits überstrapaziert und muss nun modifiziert werden, um als Vergleich in diesem anderen Kontext anschlussfähig zu bleiben: Durch den nochmaligen Eingriff kann dieser Beobachter zum Beispiel als Bestandteil, als (typverschiedene) Struktur eines FamilienSYSTEMS identifiziert werden. In diesem mag die Irritation des überraschend verfärbten Fernsehbildes das »Erscheinen« der Struktur einer Sanktion mit sich bringen, die wiederum eine Irritation des SchmerzsinnesSYSTEMS des gegenwärtigen Beobachters zur Konsequenz hat, welches mit dessen BewusstseinsSYSTEM gekoppelt ist und dort gegenwärtig die Struktur ’Angst vor unangenehmen Empfindungen’ »aufleuchten« lässt.
h) Kausalität und Wiedereintritt
Kausalität ist folglich Interpretation eines Beobachters, welcher bedingt durch seine Erwartungen Irritationen als Informationen verarbeitet.88 Verarbeitet das System also selbst Informationen, so als sein eigener Beobachter. Die Bildröhre könnte etwa mit einem KalibrierungsSYSTEM gekoppelt sein, welches gelegentlich durch das BilderzeugungsSYSTEM aktiviert wird, Abweichungen im Kausalverlauf, also Bildfehler feststellt, und eine Nachjustierung des BildSYSTEMS induziert. Die Reduzierung im ersten Fernseherbildnis auf Elektronenstrahl und Mattscheibe ist nun nicht mehr haltbar, da mittlerweile die übrigen Komponenten des BilderzeugungsSYSTEMS darauf drängen, in die systemtheoretische Analyse miteinzufließen. Hier soll jedoch das KalibrierungsSYSTEM als Teil der Bilderzeugung nur Metapher für den Beobachter erster Ordnung sein, der als Operation des sich selbst beobachtenden Systems zum strukturell gekoppelten Subsystem wird und als Operation wieder in dasselbe eintritt. Letzteres wird hier als vom Begriff des Reentry (künftig: Wiedereintritt) erfasst angenommen wird; ebenso tritt der Beobachter wieder ein, wenn er aufhört zu beobachten, ohne Informationen zu verarbeiten.89
i) Medium und Form, Code und Programm
Luhmann betrachtet die Kommunikation als die Grundunterscheidung, die Operation sozialer Systeme und benennt die Sprache als deren wesentliches Medium.90 Er beschreibt Medium unter Rückgriff auf Hei- der als „einen Bereich von losen Kopplungen massenhaft vorkommender Elemente“, wie etwa stehende Luft, die Schallwellen wahrnehmbar macht ohne selbst Geräusche von sich zu geben.90 91 Die Sprache als „Wortschatz und eine Menge von Sätzen“ sei als solche vergleichbar formloses Medium, welches erst durch die sinnvolle Kombination von Wörtern die Form des Satzes annehme.92 Durch die Produktion sinnhafter Formen wird ein gegenseitiges Verstehen wahrscheinlich und damit Kommunikation möglich.93
Ebenfalls als Medium sieht Luhmann binäre Codewerte, welche die Formen kontradiktorischer, also unüberbrückbarer Gegensätze annehmen können94 und als solche den Beobachter im Medium Sprache die systembildende Unterscheidung, die konkrete operationale Schliessung kommunizieren lässt.95 Im Code wirkt insoweit das logische Axiom des Satzes vom ausgeschlossenen Dritten: Es kann weder ambivalente Systemzugehörigkeit (etwa: nicht ganz 'wahr') noch ambivalenten Systemausschluss (nicht ganz 'falsch') geben.96
Der Code enthält diese eindeutige Unterscheidung als Codewerte, leitet somit die blind ablaufenden Operationen. Das Programm des Systems leitet wiederum die Bedingungen der Wertzuschreibung, wie also »dazugehörig« und dessen Negation zutreffend erkannt werden.97 Im sozialen System generiert der Code durch die Tradition das Programm; die Unterscheidung in diese beiden ermöglichen die Autopoiesis also die kontinuierliche Fortsetzung des Codes und damit die Existenz des Systems in der Zeit.
j) Bewertung
Die Systemtheorie Luhmannscher Prägung stellt ein Vokabular zur Verfügung, dessen Komplexität98 der eines Gesellschaftssystems adäquat erscheint. In ihm kommt die Rekursivität der Theorie zum Ausdruck, die sich aus der Berücksichtigung von Raum und Zeit im Augenblick der Gegenwart ergibt und vielversprechende vergangenheitsbezogene Implikationen zulässt, die der Beschreibung entstandener (tradierter) und fortwirkender Strukturen dienen können. Zweifellos erfordert sie ein hohes Maß an Sorgfalt in der Begriffsverwendung und gefährdet die Inbezugnahme der Zeitachse die Orientierung. Das disziplinübergreifende Potential dieses Begriffsmodells, auch zur effektiveren sprachlichen Darstellung logischer Zusammenhänge eines Systems, erscheint jedoch so groß, dass seine Vernachlässigung in rechtswissenschaftlichen Auseinandersetzungen als sträflich, der Versuch seiner Anwendung hingegen, auch mit hohem Risiko des Scheiterns, als ausgesprochen lohnenswert erscheint.
Wird die Autopoiese sozialer Systeme in der Kommunikation gesehen und die Kommunikation über die jeweils systeminterne Kommunikation als Beobachtung, werden die Kommunikationsformen als Strukturen betrachtet, welche jeweils selbstorganisiert erzeugt werden und die gegenseitige Beeinflussung der Systeme als strukturelle Kopplung, die den wechselseitigen Austausch von jeweils selbstbezogen zu verarbeitenden Informationen ermöglichen und lässt sich schließlich dies alles als Konsequenzen der operationalen Schliessung eines Systems anerkennen, welche ihm die Unterscheidung von seiner Umwelt ermöglicht, so lässt sich diese Terminologie auch als Analysewerkzeug in anderen Disziplinen als der Soziologie nutzbar machen, die sich mit Systemen befassen. Denn diese sind Fremdbeobachter ihres Gegenstands und auch Beobachter zweiter Ordnung, indem sie beobachten, wie sich ihr Gegenstand selbst beobachtet, mögen sie in dieser oder ähnlicher Form darüber reflektieren oder nicht. Die Beobachtung derBEOBACHTENDEN Beobachter wäre somit dritter Ordnung, für deren Struktur hier die Terminologie der Systemtheorie erachtet wird, welche durch den Wiedereintritt in das jeweils strukturell gekoppelte BeobachtungsSYSTEM niedrigerer Ordnung als Information ohne Überforderung verarbeitbar erscheint und so auch dort anwendbar wird.
Die Systemtheorie kann dann im Rechtssystem selbst anwendbar werden, wenn in ihr die Entwicklung eines empirischen Rechtsbegriffs möglich ist, der im Bewusstsein seines Codes und des durch ihn erzeugten Programms konstruiert ist und normative Entscheidungen zur Begriffsbestimmung auf eine objektivere Grundlage stellen kann. Im Folgenden soll zunächst die Anwendung auf die bisher mit logischen Begriffen erarbeitete abstrakte Norm versucht werden.
2. Anwendung systemtheoretischer Begriffe
In I 2 b wurde die Normerzeugung im Zusammenhang mit einem Weltenbegriff rekonstruiert, der wiederum als Hilfsbegriff aus Indizien der Verwendung des Wortes 'Welt' im allgemeinen Sprachgebrauch in unterschiedlichen Kontexten konstruiert wurde. Dies schien notwendig, um zum Einen die Anwendung vierwertiger Logik auch außerhalb eines physischen Weltbegriffs zu legitimieren. Zum Anderen sollte die Möglichkeit von Weltüberschneidungen angedeutet und eine bildhafte Abgrenzung von beeinflussbaren und nicht beeinflussbaren Regeln oder besser Regelmäßigkeiten möglich werden.
Im Vergleich zum hier vorgestellten SYSTEMbegriff ist 'Welt' viel zu unscharf, um von einer Identität dieser Begriffe auszugehen. Gleichwohl können die Überlegungen zu ihr als Zwischenschritt zur systemtheoretischen Betrachtung gesehen werden, die sich in letzterer konsequent weiterdenken lassen.
Der Rückzug auf den Satz vom zureichenden Grund aus Sicht der Logik hat oben die alternativen Definitionen nahe gelegt: (1) 'Eine Welt ist eine bestimmte Regel aus der alles weitere folgt' und (2) 'eine Welt ist die Gesamtheit bestimmter, miteinander verknüpfter Regeln'.
Lässt sich Definition (1) auch scheinbar ohne große Schwierigkeiten auf die Operation und damit das System übertragen, so spricht doch bereits der Ausgangspunkt dieser Begriffsbestimmung, die Kausalität, dagegen. In 1 wurde deutlich, dass ein System in der Gegenwart operiert. In der Gleichzeitigkeit kann jedoch keine Ursache einer Wirkung vorausgehen . Dieser Widerspruch lässt sich zumindest auflösen. Die Operation ist Bedingung für die Existenz des Systems im Raum. Die Autopoiesis konstituiert sie in der Zeit.
Insoweit entstammt Definition (1) der Perspektive eines Beobachters den Lauf einer Welt in der Zeit wahrnimmt und von seinen li- nearen Beobachtungen auf ein Ursache-Wirkung-Verhältnis schließt.99 Der Unterschied zwischen ihm und seiner Umwelt, zu der auch der Gegenstand seiner Betrachtung gehört, bleibt ihm jedoch verborgen. Er ist ein Beobachter erster Ordnung, kann über die Grenzen der Welt, in der er sich befindet, nicht hinausgreifen.
Seine Suche nach der weltenkonstituierenden Grundregel bleibt erfolglos. Er kann nur vermuten, dass es eine letztgültige Ursache gibt, diese aber nicht erschließen, da ihm der Blick in die Zeit einen Anfang nahe legt, der außer Sicht ist. Dadurch kann er auch die Trennschärfe der operationalen Schliessung nur erahnen.
Seine Rückschau lässt ihn immerhin eine Systematik erkennen, also die inneren Gesetzmäßigkeiten, welche die betrachtete Welt zusammenzuhalten scheinen. Erkennt er aus dieser Sicht die Definition (1) als metaphysisch, so erscheint ihm Definition (2) als rational. Mit letzterer kann er induktiv versuchen, zu (1) aufzusteigen. Jedoch ist ihm bewusst, dass ihm die letzte und damit erste Wahrheit verborgen bleibt. Er ist gewissermaßen Gefangener der systemischen Selbstreferenz.100
Begreift er jedoch als räumliche Grundbedingung des Gegenstands seiner Betrachtung die Operation, eben die aktive Unterscheidung, die er vorher nur als gegeben anerkennen konnte, so wird ihm der qualitative Unterschied bewusst zwischen den beobachtbaren Gesetzmäßigkeiten und der Regel aus der alles übrige folgt, die ihm Definition (1) nahe legt. Diese Erkenntnis gelingt ihm jedoch nur, wenn er über die Grenze seiner Welt hinaussteigt indem er beobachtet, wie er selbst die Welt beobachtet. Dann wird ihm seine Bindung an die Zeit, seine Unterscheidung in ein Vorher und ein Nachher bewusst. Nun kann er seinen Blick öffnen für die in der Zeit immer gleiche Operation, für die Beobachtung zweiter Ordnung. (Die Zeitbegriffe in diesem Absatz zeigen auf den erneuten »blinden Fleck« dieser Beobachtung hin.)
Von diesem Standpunkt aus lässt sich das, als was er 'Welt' zunächst verstanden wissen wollte, als globaler Begriff erkennen, der verschiedene, in ihr ausdifferenzierte, sich jeweils scharf voneinander unterscheidende Systeme erfasst.101 Wird, wie oben, von einer »Gruppen- weit« gesprochen, die Normen als »Wertungsgemeinschaft« erzeugt, so werden mindestens zwei Systeme benannt: ein NormenSYSTEM und ein WertungsSYSTEM.
Die Existenz des letzteren dürfte zunächst irritieren. So können Werte doch, etwa „Frieden“ oder „Menschenrechte“, als indifferent erscheinen, als ein Medium ohne die Überzeugungskraft anderer Kommunikationsmedien wie »Macht« oder »Geld«.102 Der Vorgang der Wertzuschreibung, welcher in I 2 b bb (2) rekonstruiert wurde, verweist jedoch auf einen Unterscheidungsprozess, die binäre Codierung »gut/schlecht«, und damit grob auf eine Ausdifferenzierung. Diese unterscheidet sich wiederum von der Differenz »Norm/keine Norm«, lässt sich also nicht mit dem NormenSYSTEM unmittelbar in Einklang bringen. Vielmehr lässt sich der in I 2 b bb (3) nachgezeichnete »programmatische Syllogismus«, mit dem zur Normerzeugung ein Wert-Urteil aufgegriffen wird, als strukturelle Kopplung des NormenSYSTEMS zu einem anderen begreifen. »WertungsSYSTEM« ist an dieser Stelle folglich als abstrakte Bezeichnung für jenes zu verstehen, in welchem diese Strukturen originär operational erzeugt werden, bevor sie zur Normerzeugung als normativer Operator103 importiert werden.
Sodann erscheint das eigentliche NormenSYSTEM in der »Gruppenwelt« als eines von mehreren mit eigener Programmierung, dessen Strukturen von denen im »WertungsSYSTEM« wesensverschieden sind. Diese Programmierung, welche letztlich die Codierung und damit die Operationen leitet, die Bedingungen für die SYSTEMbildende Unterscheidung und ihre Vervielfältigung setzt, kann dann als die ursächliche Grundregel für das NormenSYSTEM erkannt werden, welche die Normerzeugung und die strukturellen Kopplungen zu anderen Systemen bestimmt. Dieser iNFORMATiONSaustausch mit dem wesensgleichen Medium 'Sprache' lässt ferner Rückschlüsse auf den Zusammenhalt entsprechend verkoppelter Systeme schließen, in welchen Operationen ebenfalls als Kommunikation ablaufen. So ist der Aufstieg möglich bis hin zur Grundregel, die Definition (1) für die »Gruppenwelt« nahelegt: Alles folgt aus der wesentlichen, immer gleichen Unterscheidung. Ihre Umwelt ist dann alles was nicht auf diese grundlegende Unterscheidung gründet.
Insoweit Menschen Existenzbedingung dieser »Gruppenwelt« sind, die im Folgenden endlich als das soziale System 'Gesellschaft' bezeichnet wird, gehören auch sie deren Umwelt an. Menschen werden offensichtlich nicht durch Kommunikation geboren - zumindest nicht durch zwischenmenschliche, wenn man den Begriff nicht ohnehin von vornherein auf diesen Inhalt beschränken will. Als zunächst biologische Systeme ist für sie die Operation 'Leben' spezifisch. Verfügen Menschen über ein Bewusstsein, dass sich von ihrem biologischen System unterscheidet, so kann die Frage gestellt werden, ob sich dieses Bewusstsein, dieses innermenschliche System, vom zwischenmenschlichen unterscheidet oder in ihm aufgeht.
Es ist wieder eine Frage der Begriffsverengung. Soll Kommunikation allein den zwischenmenschlichen Informationsaustausch bezeichnen, so müssen die inner menschlichen Unterscheidungen, die nicht biologisch sind, anders bezeichnet werden. Unabhängig von der Bezeichnung ist dann jedoch evident, dass sie typverschieden sind. Sind Menschen auch zweifellos unmittelbar an Wertungen und an der Normerzeugung beteiligt, so doch als Kollektiv und nicht als Individuum. Das kommt in dieser scharfen Trennung zwischen typgleichen Sub- und typverschiedenen Systemen im Luhmannschen Begriffsmodell konsequent zum Ausdruck. Das innermenschliche, das psychische System gehört somit auch zur Umwelt des sozialen.
Soweit das Bewusstsein an einen lebenden menschlichen Körper gebunden und dieses Leben wiederum abhängig ist von den physischen Bedingungen, die seinen Fortgang sichern, kommt dadurch auch die Vernetzung typverschiedener Systeme zum Ausdruck. Bezogen auf die Ausführungen zum Weltenbegriff in I 2 b aa lässt sich dieser nun nach systemtheoretischer Betrachtung umformulieren als Sammelbegriff miteinander vernetzter Systeme. Das oben vollzogene Auf- und Abschreiten der Weltebenen drückt sich dann als Auf- und Abschreiten der Vernetzungen aus. 'Welt' kann sowohl auf ein isoliertes psychisches System verweisen, auf ein soziales System mitsamt seinen Subsystemen, auch auf die gekoppelten psychischen und sozialen. Schließlich kann die Gesamtheit dieser Systeme mit den unmittelbar gekoppelten biologischen gemeint sein, bis hinauf zu dem Weltbegriff aufgestiegen wird, der die Gesamtheit aller Systeme, die sich im Kosmos auch als »Partikularien« (Paralleluniversen) ausdifferenziert haben mögen. Ist 'Welt' ein Sammelbegriff verkoppelter Systeme, so begrenzt ihn jeweils dasjenige, was im Fokus der Beobachtung steht. Die oben erörterte »Weltüberschneidung« stellt sich als strukturelle Kopplung heraus.
Das systemtheoretische Denkmodell verhindert nicht die oben angestellten Überlegungen zur Entwicklung modallogischer Argumente. Es stellt vielmehr Begriffe zur Verfügung, die ermöglichen, den »blinden Fleck«, die typverschiedene Unterscheidung, zu benennen, der bisher nur hingenommen werden konnte, und so schlüssiger notwendige und mögliche Wahrheit erkennbar macht.
III. Ergebnis
Wie gesehen zeigt sich die Norm aus logischer Perspektive als mehrdeutiger Ausdruck mit präskriptiver und deskriptiver Komponente, der an sich nicht wahrheitsfähig ist, auf den jedoch logische Operationen anwendbar sind, wodurch das Zusammenspiel von Normen prinzipiell konsistent und widerspruchsfrei gestaltet werden kann. Eine Norm »gilt«, wenn ihrem Normsatz der Wert 'wahr' zugewiesen werden kann. Inkonsistenzen und Widersprüche können sich aus den logisch nicht begründbaren und daher bei der Normerzeugung unreflektiert integrierten Wertungen ergeben, durch welche Normen auf die Handlungen bestimmter Adressatenkreise ausgerichtet werden. Die Wertungen können zwar im Einzelnen nachvollziehbar sein, »in sich« logisch erzeugt. Ihre konkrete Ausgestaltung ist jedoch zweifellos kontingent und daher (aussagen-)logisch nicht überprüfbar. Wird zur Normerzeugung ein breiter und tiefer Komplex von Wertungen in Bezug genommen, liegt folglich die Möglichkeit widersprüchlicher Normen nicht fern. Da Wertungen nicht weiter reflektiert, sondern nur integriert werden, kann der Wertungsvorgang vom Vorgang der Normerzeugung noch unterschieden werden. Trennscharf ist diese Differenz indes nicht. So spricht nichts dagegen, dass das »Subjekt« eine Wertung vornimmt und diese dann als einheitlicher Vorgang mit der Normsetzung für seine »Gruppenwelt« festschreibt.
In der Systemtheorie kann diese Unterscheidung begrifflich differenzierter erfasst werden. Stellt sich eine geltende Norm dort als Struktur eines sozialen Subsystems dar, welches die Wertung als Information aus einem anderen bezieht, so ermöglicht das zum Einen die eindeutige Entscheidung für eine begriffliche Trennung von Wertung und normativer Setzung. Zum Anderen wird so die Beschreibung verschiedener Normen Systeme möglich, wie etwa des RechtsSYSTEMS, was Gegenstand der folgenden Betrachtung sein wird. [...]
Literatur
Aden, Hartmut, Transnationales Recht als Thema fragmentierter Rechtswissenschaften), RW 2010, S. 212-217
Adolphsen, Jens / Schmalenberg, Franziska, Islamisches Recht als materielles Recht in der Schiedsgerichtsbarkeit?, SchiedsVZ 2007, S. 5764
Albert, Mathias, Zur Politik der Weltgesellschaft. Identität und Recht im Kontext internationaler Vergesellschaftung, Weilerswist 2002
Alexy, Robert, Begriff und Geltung des Rechts, 4. Aufl., Freiburg 2005
Aubart, Andrea, Die Behandlung der dépeçage im europäischen Internationalen Privatrecht, Tübingen 2013, zugl.: Diss. jur. Univ. Trier 2013
Baraldi, Claudio, in: GLU. Glossar zu Niklas Luhmanns Theorie sozialer Systeme, Frankfurt a. M. 1997, S., zitiert als: Baraldi, in: GLU
Baraldi, Claudio / Corsi, Giancarlo / Esposito, Elena, GLU. Glossar zu Niklas Luhmanns Theorie sozialer Systeme, Frankfurt a. M. 1997
Baspinar, Deniz, Muslime in Deutschland brauchen die Scharia nicht, ZEIT ONLINE v. 7.2. 2012, abruflar unter : http://www.zeit.de/ gesellschaft/zeitgeschehen/2012-02/scharia-schiedsgerichte/ komplettansicht (abgerufen am 17.06.2014), zitiert als: Baspi- nar, ZEIT ONLINE v. 7. 2. 2012
Baumbach, Adolf / Lauterbach, Wolfgang u. a., Zivilprozessordnung. Kommentar, 72. Aufl., München 2014, zitiert als: Bearbeiter, in: Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann72
Benda, Ernst, Recht und Politik, in: Nohlen, Dieter / Schultze, RainerOlaf (Hrsg.), Lexikon der Politikwissenschaft. Theorien, Methoden, Begriffe, 3. Aufl., München 2005, S. 827-829, zitiert als: Benda, Lexikon der Politikwissenschaft. Theorien, Methoden, Begriffe
Berghahn, Sabine, Der Ritt auf der Schnecke. Rechtliche Gleichstellung in der Bundesrepublik Deutschland (Aktualisierung 2011), gender- politik-online.de Juli 2011, abrufbar unter : http://www.fu-berlin. de / sites / gpo / pol _ sys / gleichstellung / Der _ Ritt _ auf _ der _ Schnecke / Ritt - Schnecke - Vollstaendig . pdf ? 1361541637 (abge rufen am 16.06.2014), zitiert als: Berghahn, gender-politik-online.de 2011
Bock, Wolfgang, Der Islam in der Entscheidungspraxis der Familiengerichte, NJW 2012, S. 122-127
Brettfeld, Katrin / Wetzels, Peter, Muslime in Deutschland - Integration, Integrationsbarrieren, Religion sowie Einstellungen zu Demokratie, Rechtsstaat und politisch-religiös motivierter Gewalt, Hamburg 2007
Al-Buhari, Die Sammlung der Hadithe. Ausgewählt, aus dem Arabischen übersetzt und herausgegeben von Dieter Ferchl, Stuttgart 2013 (1991)
Christensen, Ralph, Sprache und Normativität oder wie man eine Fiktion wirklich macht, in: Krüper, Julian / Merten, Heike / Morlok, Martin (Hrsg.), An den Grenzen der Rechtsdogmatik, Tübingen 2010, S. S. 127-138, zitiert als: Christensen, in: An den Grenzen der Rechtsdogmatik
Corsi, Giancarlo, in: GLU. Glossar zu Niklas Luhmanns Theorie sozialer Systeme, Frankfurt a. M. 1997, S., zitiert als: Corsi, in: GLU
Corsi, Giancarlo / Esposito, Elena, in: GLU. Glossar zu Niklas Luhmanns Theorie sozialer Systeme, Frankfurt a. M. 1997, S., zitiert als: Corsi / Esposito, in: GLU
Degenhart, Christoph, Staatsrecht I. Staatsorganisationsrecht, 25. Aufl., Heidelberg et. al. 2009
Dudenredaktion (Hrsg.), Duden Band 5. Das Fremdwörterbuch, 9. Aufl., Mannheim et. al. 2007
Esposito, Elena, in: GLU. Glossar zu Niklas Luhmanns Theorie sozialer Systeme, Frankfurt a. M. 1997, S., zitiert als: Esposito, in: GLU
Fateh-Moghadam, Bijan, Religiöse Rechtfertigung? Die Beschneidung von Knaben zwischen Strafrecht, Religionsfreiheit und elterlichem Sorgerecht, RW 2010, S. 115-142
Ferchl, Dieter, Einleitung, in: Die Sammlung der Hadithe. Ausgewählt, aus dem Arabischen übersetzt und herausgegeben von Dieter Ferchl, Stuttgart 2013 (1991), S. S. 7-14, zitiert als: Ferchl, in: Die Sammlung der Hadithe
Ferrari, Franco / Kieninger, Eva-Maria u. a., Internationales Vertragsrecht. Rom I-VO, CISG, CMR, FactÜ, 2. Aufl., München 2012, zitiert als: Bearbeiter, in: Ferrari2
Fischer-Lescano, Andreas, Rechtskraft, Berlin 2013
Fischer-Lescano, Andreas / Teubner, Gunther, Regime-Kollisionen. Zur Fragmentierung des globalen Rechts, Frankfurt a. M. 2006
Frankena, William K., Gerechtigkeit als Chancengleichheit, in: Hoers- ter, Norbert (Hrsg.), Recht und Moral. Texte zur Rechtsphilosophie, Stuttgart 2002, S. 154-177, zitiert als: Frankena, Recht und Moral. Texte zur Rechtsphilosophie
Friederici, Peter, Familiensachen: Entscheidungen auch durch Schiedsgerichte? Teil 2, FuR 2006, S. 448-453
Gercke, Björn / Julius, Karl-Peter u.a. (Hrsg.), Strafprozessordnung. Heidelberger Kommentar, 5. Aufl., Heidelberg et. al. 2012, zitiert als: Bearbeiter, in: HK-StPO5
Germelmann, Claas-Hinrich / Künzel, Reinhard u.a. (Hrsg.), Arbeitsgerichtsgesetz. Kommentar, 8. Aufl., Berlin et. al 2013, zitiert als: Bearbeiter, in: Germelmann/Matthes/Prütting8
Groß, Thomas, Postnationale Demokratie - Gibt es ein Menschenrecht auf transnationale Selbstbestimmung?, RW 2011, S. 125-153
Handorn, Boris, Das Sonderkollisionsrecht der deutschen internationalen Schiedsgerichtsbarkeit, Tübingen 2005, zugl.: Diss. jur. Freie Univ. Berlin 2004
Haug, Sonja / Müssig, Stephanie / Stichs, Anja, Muslimisches Leben in Deutschland, Berlin 2012
Haußleiter, Martin (Hrsg.), FamFG. Kommentar, München 2011, zitiert als: Bearbeiter, in: Haußleiter
Hayek, Friedrich A. von, Argumente gegen die Verteilungsgerechtigkeit, in: Hoerster, Norbert (Hrsg.), Recht und Moral. Texte zur Rechtsphilosophie, Stuttgart 2002, S. 177-197, zitiert als: v. Hayek, Recht und Moral. Texte zur Rechtsphilosophie
Heinig, Hans Michael, Religionsfreiheit in Europa, RW 2010, S. 433-439
Heinig, Hans Michael / Morlok, Martin, Von Schafen und Kopftüchern. Das Grundrecht auf Religionsfreiheit in Deutschland vor den Herausfordeungen religiöser Pluralisierung, JZ 2003, S. 777-785
Heschel, Susannah, Der jüdische Jesus und das Christentum. Abraham Geigers Herausforderung an die christliche Theologie, Berlin 2001
Hätte, Franziska, Religiöse Schiedsgerichtsbarkeit. Angloamerikanische Rechtspraxis, Perspektive für Deutschland, Tübingen 2013, zugl.: Diss. jur. Univ. Münster WS 2011/2012
Huber, Thomas, Systemtheorie des Rechts. Die Rechtstheorie Niklas Luh- manns, Stuttgart 2007
Ipsen, Järn, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl., Köln 2009
Jestaedt, Matthias, Hans Kelsens Reine Rechtslehre. Eine Einführung, in: Studienausgabe der 1. Auflage 1934, Tübingen 2008, S. XI-LXVI, zitiert als: Jestaedt, Studienausgabe der 1. Auflage 1934
Kant, Immanuel, Die Metaphysik der Sitten. Werkausgabe VIII (hrsg. v. Wilhelm Weischedel), Frankfurt a. M. 1977, zitiert als: Kant, Werkausgabe Band VIII
Ders., Kritik der praktischen Vernunft. Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Werkausgabe VII (hrsg. v. Wilhelm Weischedel), 20. Aufl., Frankfurt a. M. 2012, zitiert als: Kant, Werkausgabe Band VII
Kaspar, Johannes, Wiedergutmachung und Mediation im Strafrecht, Münster 2004, zugl.: Diss. jur. Univ. München 2004
Keidel, Theodor (Hrsg.), FamFG. Kommentar, 18. Aufl., München 2014, zitiert als: Bearbeiter, in: Keidel18
Kelsen, Hans, Reine Rechtslehre, in: Jestaedt, Matthias (Hrsg.), Studienausgabe der 1. Auflage 1934, Tübingen 2008, S. 1, zitiert als: Kelsen, Studienausgabe der 1. Auflage 1934
Khorchide, Mouhanad, Scharia - der missverstandene Gott. Der Weg zu einer modernen islamischen Ethik, Freiburg 2013
Kloster-Harz, Doris, Das Süddeutsche Familienschiedsgericht, FamRZ 2007, S. 99-100
Kreuzer, Karl, Clash of Civilizations und Internationales Privatrecht, RW 2010, S.143-183
Krüger, Wolfgang / Rauscher, Thomas (Hrsg.), Münchener Kommentar zur Zivilprozessordnung, 4. Aufl., München 2013, zitiert als: Bearbeiter, in: MüKoZPO4
Lohlker, Rüdiger, Islamisches Recht im Wandel. Riba, Zins und Wucher in Vergangenheit und Gegenwart, Münster et. al. 1999, zitiert als: Lohlker, Islamisches Recht im Wandel
Ders., Islamisches Recht. Methoden, Wien 2012, zitiert als: Lohlker, Islamisches Recht. Methoden
Ludwig, Ingo / Herberger, Maximilian u.a. (Hrsg.), juris PraxisKommentar BGB, 6. Aufl., Saarbrücken 2012, zitiert als: Bearbeiter, in: jurisPK-BGB6
Luhmann, Niklas, Das Recht der Gesellschaft, 6 (1), Frankfurt a. M. 2013 (1995), zitiert als: Luhmann, Das Recht der Gesellschaft
Ders., Einführung in die Systemtheorie. Herausgegeben von Dirk Bae- cker, 6. Aufl., Heidelberg 2011, zitiert als: Luhmann, Einführung in die Systemtheorie
Ders., Legitimation durch Verfahren. (seitengleicher Nachdruck der 3. Auflage, Neuwied 1978), Frankfurt a. M. 1983, zitiert als: Luhmann, Legitimation durch Verfahren
Mankowski, Peter, Entwicklungen im Internationalen Privat- und Prozessrecht, RIW 2005, S. 481-499
Manthe, Barbara, Panel VII: „Der Untergang des Abendlandes? Muslime und Islam als Feindbild“, abrufbar unter : http : //www . bpb . de / Veranstaltungen / dokumentation / 181828 / panel - vii - der - Untergang-des-abendlandes-muslime-und- islam-als-feindbild (abgerufen am 29.05. 2014)
Meder, Stephan, Ius non scriptum - Traditionen privater Rechtsetzung, 2. Aufl., Tübingen 2009
Müller-Mall, Sabine, Rechserzeugung als performativer Vorgang in der Sprache, ARSP 135 (2012), S. 117-126
Musielak, Hans-Joachim (Hrsg.), Zivilprozessordnung mit Gerichtsverfassungsgesetz. Kommentar, 11. Aufl., München 2014, zitiert als: Bearbeiter, in: Musielak11
Nagel, Tilmann, Kann es einen säkularisierten Islam geben?, in: MeierWalser, Reinhardt C. / Glagow, Rainer (Hrsg.), aktuelle analysen 26. Die islamische Herausforderung - eine kritische Bestandsaufnahme von Konfliktpotenzialen, München 2001, S. 9, zitiert als: Nagel, aktuelle analysen 26. Die islamische Herausforderung - eine kritische Bestandsaufnahme von Konfliktpotenzialen
One Law for All CLG (Hrsg.), Sharia Law in Britain: A Threat to One Law for All and Equal Rights, London 2010
Osterkamp, Thomas, Juristische Gerechtigkeit. Rechtswissenschaft jenseits von Positivismus und Naturrecht, Tübingen 2004
Palandt, Otto (Hrsg.), Bürgerliches Gesetzbuch, 73. Aufl., München 2014, zitiert als: Bearbeiter, in: Palandt73
Peukert, Helmut, Wissenschaftstheorie-Handlungstheorie
Fundamentale Theologie. Analysen zu Ansatz und Status theologischer Theoriebildung, 3. Aufl., Frankfurt a. M. 2009 (1978)
Pieroth, Bodo / Schlink, Bernhard, Grundrechte. Staatsrecht II, 25. Aufl., Heidelberg 2009
Pieroth, Bodo / Schlink, Bernhard / Kniesel, Michael, Polizei- und Ordnungsrecht mit Versammlungsrecht, 6. Aufl., München 2010
Pratchett, Terry, Schweinsgalopp. Ein Scheibenwelt-Roman, 8. Aufl., München 2003
Preuß, Roland, Wie islamische Schiedsgerichte für mehr Frieden sorgen sollen, sueddeutsche.de v. 2.2. 2012, abrufbar unter : http:// www . sueddeutsche . de / politik / justiz - in - deutschland - wie - islamische - schiedsgerichte - fuer - mehr - frieden - sorgen - sollen-1.1274279 (abgerufen am 14.07.2014), zitiert als: Preuß, su- eddeutsche.de v. 2. 2. 2012
Prümm, Hans Paul, Einführung in die Rechtsphilosophie - Rechtstheorie und Rechtsethik, Norderstedt 2008
Ders., Friedrich II. von Preußen und das Recht. Das Interpretationsverbot im ALR, der Prozess des Müllers Arnold und der Überfall auf Sachsen, ZJS 2012, S. 24-37
Prütting, Hanns / Helms, Tobias (Hrsg.), FamFG. Kommentar mit FamGKG, 3. Aufl., Köln 2014, zitiert als: Bearbeiter, in: Prütting/Helms3
Radbruch, Gustav, Gesetzliches und übergesetzliches Recht (in: SJZ 1946, 105-108), in: Dreier, Ralf / Paulson, Stanley L. (Hrsg.), Studienausgabe, Heidelberg 1999, S. 211, zitiert als: Radbruch, Studienausgabe
Ders., Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht (Auszug), in: Hoerster, Norbert (Hrsg.), Recht und Moral. Texte zur Rechtsphilosophie, Stuttgart 2002, S. 46-50, zitiert als: Radbruch, Recht und Moral. Texte zur Rechtsphilosophie
Ders., Rechtsphilosophie, 3. Auflage, Leipzig 1932, in: Dreier, Ralf / Paulson, Stanley L. (Hrsg.), Studienausgabe, Heidelberg 1999, S. 1, zitiert als: Radbruch, Studienausgabe
Ra,feeq, Mona, Rethinking Islamic Law Arbitration Tribunals: Are they compatibe with traditional American notions of justice?, WILJ 2010, S. 108-139
Rauscher, Thomas, Internationales Privatrecht. Mit internationalem Verfahrensrecht, 4. Aufl., Heidelberg 2012
Rawls, John, Eine Vertragstheorie der Gerechtigkeit, in: Hoerster, Norbert (Hrsg.), Recht und Moral. Texte zur Rechtsphilosophie, Stuttgart 2002, S. 197-213, zitiert als: Rawls, Recht und Moral. Texte zur Rechtsphilosophie
Renner, Moritz, Kontingenz, Redundanz, Transzendenz? Zum Gerechtigkeitsbegriff Niklas Luhmanns, Ancilla Iuris (anci.ch) 2008, S. 6272
Rohe, Mathias, Das islamische Recht. Geschichte und Gegenwart, 3. Aufl., München 2011
Ders., Islamisierung des deutschen Rechts?, JZ 2007, S. 801-806
Röthel, Anne, Lex mercatoria, lex sportiva, lex technica - Private Rechtssetzung jenseits des Nationalstaates, JZ 2007, S. 755-763
Rüthers, Bernd / Fischer, Christian / Birk, Axel, Rechtstheorie mit Juristischer Methodenlehre, 7. Aufl., München 2013
Säcker, Franz Jürgen / Rixecker, Roland / Oetker, Hartmut (Hrsg.), Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 5.-6, München 2006-2013, zitiert als: Bearbeiter, in: MüKoBGB
Schirrmacher, Christine, Friedensrichter, Streitschlichter, Schariagerichtshöfe: Ist die Rolle der Vermittler auf den säkularen Rechtsstaat übertragbar?, Bd. 62 (Rechtspolitisches Forum), Trier 2013
Schneider, Egon / Schnapp, Friedrich E., Logik für Juristen. Die Grundlagen der Denklehre und der Rechtsanwendung, 6. Aufl., München 2006
Scholz, Peter, Islamisches Recht im Wandel am Beispiel des Eherechts islamischer Staaten, abrufbar unter : http://www.jura.fu-berlin. de / fachbereich / einrichtungen / zivilrecht / lehrende / scholzp / dokumente/waneher.pdf?1337600208 (abgerufen am 16.06.2014)
Schönke, Adolf / Schröder, Horst / Eser, Albin, Strafgesetzbuch. Kommentar, 29., München 2014, zitiert als: Bearbeiter, in: Schön- ke/Schröder
Schopenhauer, Arthur, Die Kunst, Recht zu behalten. In achtunddreißig Kunstgriffen dargestellt. Herausgegeben von Franco Volpi, Frankfurt a. M. et. al. 1995
Schroeder, Hans-Patrick, Die Anwendung der Sharia als materielles Recht im kanadischen Schiedsverfahrensrecht, IPRax 2006, S. 77-85
Schumacher, Klaus, Schiedsgerichtsbarkeit und Familienrecht, FamRZ 2004, S.1677-1685
Schütze, Rolf A., Schiedsgericht und Schiedsverfahren, 5. Aufl., München 2012
Seinecke, Ralf, Recht im Rechtspluralismus, ARSP 135 (2012), S. 143158
Somek, Alexander, Rechtliches Wissen, Frankfurt a. M. 2006
Stein, Friedrich / Jonas, Martin (Hrsg.), Kommentar zur Zivilprozessordnung. Band 9, 22. Aufl., Tübingen 2002, zitiert als: Bearbeiter, in: Stein/Jonas22
Stiftung, Bertelsmann (Hrsg.), Religionsmonitor 2013, abrufbar unter : http : / / www . bertelsmann - Stiftung . de / cps / rde / xbcr / SID - BAEC7F5C- 7223950E/bst / RelMoBefundeDeutschlandfinal130428 . pdf (abgerufen am 29.05.2014)
Teubner, Gunther, Recht als autopoietisches System, Frankfurt a. M. 1989
Thomas, Heinz / Putzo, Hans, ZPO. Kommentar, 35. Aufl., München 2014, zitiert als: Bearbeiter, in: Thomas/Putzo35
Trips-Hebert, Roman, „Islamisches Recht“ als Herausforderung deutschen Kollisionsrechts?, RuP 2012, S. 214-219
Wagner, Joachim, Kaffeehausrichter machen es der deutschen Strafjustiz schwer. Was tun mit den islamischen Streitschlichtern?, chrismon v. 2012, Nr. 02, S. 64-66
Wesel, Uwe, Geschichte des Rechts in Europa. Von den Griechen bis zum Vertrag von Lissabon, München 2010
Wessels, Johannes / Beulke, Werner, Strafrecht Allgemeiner Teil. Die Straftat und ihr Aufbau, 39. Aufl., Heidelberg 2009
Wörlen, Rainer, Introduction to Englisch Civil Law for GermanSpeaking Lawyers and Law Students. Vol. 1, 4. Aufl., Münster 2007
Zobel, Petra, Schiedsgerichtsbarkeit und Gemeinschaftsrecht, Tübingen 2005
Zoglauer, Thomas, Einführung in die formale Logik für Philosophen, 4. Aufl., Göttingen 2008
Stichwortverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
[...]
1 Vgl. etwa Manthe; Stiftung, S. 3 f. Schirrmacher, S. 9 f. Trips-Hebert, RuP 2012, 214; Bock, NJW 2012, 122 (127); Heinig, RW 2010, 433 (437); Kreuzer, RW 2010, 143 (182); Fateh-Moghadam, RW 2010, 115 (116) m.w.N. zur rechtswissenschaftlichen Debatte; Rohe, JZ 2007, 801; Heinig/Morlok, JZ 2003, 777.
2 Zu dahingehenden Äußerungen des rheinland-pfälzischen Justizministers Hartloff siehe etwa Preuß, sueddeutsche.de v. 2. 2. 2012.
3 In der Fassung der Bekanntmachung vom 5. 12. 2005 (BGBl. I 3202, ber. 2006, S. 431 und 2007, S. 1781), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. 10. 2013 (BGBl. I S. 3786) m.W.v. 17. 10. 2013 bzw. 01.01. 2014.
4 Fischer-Lescano/ Teubner, S. 41.
5 Zum „Zusammenbruch der klassischen Rechtsnormenhierarchie“ ebd., S. 48.
6 Groß, RW 2011, 125 (127).
7 Ebd., 125 (126).
8 Kreuzer, RW 2010, 143 (181).
9 Aden, RW 2010, 212 (213).
10 Vgl. Groß, RW 2011, 125 ff.
11 Heinig/Morlok, JZ 2003, 777.
12 Rohe, JZ 2007, 801 (806), der sich kritisch zu diesem, wie er es nennt „Alarmis mus“, positioniert.
13 Dazu etwa Alexy, S. 15 ff.
14 Groß, RW 2011, 125 (129).
15 Aus Gründen der Schreibökonomie werden keine sperrigen Mischformen verwendet und kommt auch kein ausgewogenes Mischkonzept männlicher und weiblicher grammatischer Formen zur Anwendung. Geschlecht wird hier allein grammatisch verstanden und den Vorzug erhalten die männlichen Formen allein aufgrund ihrer regelmäßig geringeren Wortlänge.
16 Rohe, JZ 2007, 801; überwiegend identisch mit ders., Islamisches Recht, S. 340.
17 Vgl. dazu Albert, S. 97.
18 Zur Notwendigkeit des Vorbehalts als Ausnahmevorschrift aber siehe wieder Baet- ge, in: jurisPK-BGB6, Art. 6 EGBGB, Rn. 15.
19 Zum Begriff des Kollisionsrechts siehe etwa Rauscher, § 1, Rn. 1; zur Wirkung des Kollisionsrecht siehe einführend u.a. GB, Rn. 1.
20 Zur Grenze des ordre public siehe wieder Rauscher, § 6, Rn. 588 ff., Baetge, in: jurisPK-BGB6, Art. 6 EGBGB, Rn. 15 ff.
21 Vgl. Rauscher, oben Fn. 19.
22 Im Detail nachgezeichnet findet sich die Debatte bei Hötte, S. 134 ff., siehe auch Rohe, S. 321 ff.; als zeitgenössischer Beitrag aus deutscher Perspektive vgl. nur Schroeder, IPRax 2006, 77 ff.
23 Hötte, S. 129.
24 Ebd., S. 134 ff. m.w.N.
25 Ebd., S. 129.
26 Zur Situation in den USA ebd., S. 46 ff.
27 Vgl. ebd., S. 182 ff.
28 dies., S. 165; dazu auch Rafeeq, WILJ 2010, 108 (124) m.w.N.
29 Dazu Hötte, S. 150 ff., 168 f., 185; siehe auch für Deutschland Adolphsen/ Schmalenberg, SchiedsVZ 2007, 57 (59); zur Begriffskonstruktion vgl. nur Seinecke, ARSP 135 (2012), 143-158 (147 ff.).
30 Siehe etwa Hötte, S. 171 ff. insbes. 174 und 191; Rafeeq, WILJ 2010, 108 ff.
31 Vgl. Rohe, S. 385 f.
32 Vgl. Hötte, S. 194 f.; Baspinar, ZEIT ONLINE v. 7. 2. 2012, a.E.
33 Vgl. Schirrmacher, S. 43 ff.; Baspinar, ZEIT ONLINE v. 7. 2. 2012; siehe auch Wagner, chrismon v. 2012, 64 f.
34 Vgl. Hötte, S. 169 m.w.N.
35 Vgl. Rafeeq, WILJ 2010, 108 (112 f.).
36 Vgl. etwa Rohe, S. 340.
37 Haug/Müssig/Stichs, S. 11 ff.; auf diese Studie nimmt auch Rohe Bezug, Rohe, S. 340, dort in Fn. 1.
38 Kritisch Khorchide, S. 24 ff.
39 Vgl. Haug/Müssig/Stichs, S. 147.
40 Näher dazu etwa Rohe, S. 17.
41 Vgl. Haug/Müssig/Stichs, S. 155.
42 Vgl. ebd., S. 154.
43 Vgl. ebd., S. 151.
44 Rohe, S. 385.
45 Ebd., S. 386.
46 Lohlker, Islamisches Recht im Wandel, S. 232, der sie gemeinsam mit ö»IäJ\ (die Haja = Notwendigkeit, „anerkanntes Bedürfnis“) nennt.
47 Rohe, S. 388 f.; zum Prinzip des ?tjjJà^Jt ÿ (ad-darurat tubUh al- mahzurat, sinngemäß: „Not hat kein Gebot“) vgl. ebd., S. 66 f.; zum Notrecht siehe auch Kant, Werkausgabe Band VIII, S. 343.
48 Rohe, S. 389.
49 Ebd., S. 386 ff.
50 Hötte, S. 170 m.w.N. siehe auch Rafeeq, WILJ 2010, 108 (120 f.).
51 Dazu Khorchide, S. 70.
52 Vgl. Brettfeld/Wetzels, S. 118.
53 Zur Arbeitsweise des britischen Muslim Arbitration Tribunal gerade mit dem Augenmerk auf Berücksichtigung dieses Aspekts siehe Rafeeq, WILJ 2010, 108 (124 ff.).
54 Nagel, in: aktuelle analysen 26. Die islamische Herausforderung Bestandsaufnahme von Konfliktpotenzialen, 9 ff.
55 Ebd., 9 (18 f.).
56 Ebd., 9 (14).
57 Ebd., 9 (16).
58 Ebd., 9 (14).
59 Scholz, S. 15.
60 Ebd., S. 15.
61 Ebd., S. 14 f.
62 Vgl. zu den säkular entwickelten Menschenrechten wieder Kreuzer, RW 2010, 143 (181).
63 Zur Geschwindigkeit der bundesrepublikanischen Rechtsentwicklungen vgl. etwa Berghahn, gender-politik-online.de 2011, S. 3 ff.
64 Zu den Reformen für die Geschlechterverhältnisse siehe ebd., S. 13 ff.
65 Rohe, JZ 2007, 801 (806).
66 Bock, NJW 2012, 122 (127).
67 Ebd., 122 (128).
68 Vgl. Trips-Hebert, RuP 2012, 214 (219).
69 Hötte, S. 182 ff.; dazu auch; Rohe, S. 383; siehe zur britischen Debatte ferner One Law for All CLG, S. 9 ff.
70 Hötte, S. 183.
71 Ebd., S. 185.
72 Ebd., S. 186 f. und 189.
73 Dazu auch Schirrmacher, S. 9 und 13 ff. m.w.N.
74 Vgl. etwa Bericht in ebd., S. 43, dortige Fn. 66.
75 Hötte, S. 7.
76 Ebd., S. 249.
77 Vgl. ebd., S. 46 ff.
78 Ebd., S. 73 ff.
79 Zu letzterer siehe ebd., S. 90 ff.
80 Vgl. ebd., S. 81 f.
81 Vgl. ebd., S. 95 ff. und 106.
82 Vgl. ebd., S. 50 m.w.N. in Fn. 34.
83 Vgl. ebd., S. 99.
84 Vgl. ebd., S. 100 und 106.
85 Ebd., S. 116 f. m.w.N.
86 Ebd., S. 119 m.w.N.
87 Ebd., S. 120.
88 Ebd., S. 48.
89 Ebd., S. 129.
90 Ebd., S. 131.
91 Ebd., S. 144 f.
92 Ebd., S. 146 ff.
93 Vgl. Hötte, S. 150 ff.
94 Ebd., S. 153 f.
95 Ebd., S. 156 ff.
96 Ebd., S. 159.
97 Ebd., S. 159 ff.
98 Ebd., S. 162 f.
99 Ebd., S. 165.
100 Vgl. ebd., S. 168 f.
101 Ebd., S. 171 m.w.N.
102 Zur Debatte um den Vorstoß des Erzbischof von Canterbury Rowan Williams siehe ebd., S. 171 ff. insbes. 174.
103 Ebd., S. 176 m.w.N.
104 Ebd., S. 176.
105 Ebd., S. 177.
106 Vgl. ebd., S. 239.
107 Ebd., S. 239.
108 Ebd., S. 240.
109 Hötte, S. 250.
110 Adolphsen/Schmalenberg, SchiedsVZ 2007, 57 (61 f.).
111 Vgl. ebd., 57 (59).
112 Ebd., 57 (63).
113 Ebd., 57 (63 f.).
114 Ebd., 57 (64).
115 Rohe, S. 341.
116 Vgl. ebd., S. 373 und 348.
117 Vgl. ebd., S. 384.
118 Vgl. ebd., S. 385.
119 Hötte, S. 206.
120 Ebd., S. 208.
121 Ebd., S. 203.
122 Ebd., S. 207.
123 Ebd., S. 237.
124 Ebd., S. 239 f.
125 Hier in Fassung der Bekanntmachung vom 21. September 1994 (BGBl. I S. 2494, ber. 1997 I S. 1061), zuletzt geändert durch Artikel Artikel 4 Absatz 4 des Gesetzes vom 1. Oktober 2013 (BGBl. I S. 3719).
126 Hötte, S. 245.
127 Hötte, S. 245 ff.
128 Vgl. oben Fn. 33.
129 In der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Juli 2012 (BGBl. I S. 1478).
130 Hötte, S. 225 ff.
131 In der Fassung des Gesetzes vom 22.12.1997 (BGBl. I S. 3224), nach Aufhebung des Art. 4 § 1 aufgelöst durch Art. 52 des Gesetzes vom 19.4.2006 (BGBl. I S. 866) mit Wirkung vom 25.4.2006.
132 Vgl. BT-Drs. 13/5274, S. 24.
133 Ebd., S. 25.
134 Zum Vereinsgericht siehe etwa OLG Köln, Beschluss vom 16. November 2012, 19 Sch 24/12, Rn. 15 ff. (zit. nach Juris); im Allgemeinen siehe in: Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann72, § 1066, Rn. 2 f.
135 Ebd., Grundz § 1025, Rn. 2.
136 Ebd., Grundz § 1025, Rn. 2.
137 So schon OLG Frankfurt a. M., NJW 1999, 3720.
138 Zu den Inhalten dieser Debatte sei auf die Aufsätze zum Schwerpunktthema „Reli giöse Sonderrechte auf dem Prüfstand“ in: vorgänge. Zeitschrift für Bürgerrechte und Gesellschaftspolitik, 52. Jahrgang, Nummer 203 (Heft 3/2013), Dezember 2013 verwiesen.
139 Dazu in: Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann72, § 1059, Rn. 15 f.
140 Vgl. in: Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann72, § 1029, Rn. 3 und 10; Reichold, in: Thomas/Putzo35, § 1029, Rn. 1; kritisch aber im Ergebnis identisch Münch, in: MüKoBGB, § 1029, Rn. 12.
141 Voit, in: Musielak11, § 1029, Rn. 13.
142 So Münch, in: MüKoBGB, § 1029, Rn. 13 m.W.n.; allgemein zum Prozessvertrag siehe auch in: Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann72, Einl III, Rn. 11; Hin- weis auf a.A. bei Hötte, 196, Fn. 22.
143 Vgl.in: Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann72, § 1029, Rn. 17
144 Für den Ehevertrag a.A. siehe Hötte, S. 209.
145 Dazu Münch, in: MüKoZPO4, § 1066, Rn. 44
146 Dazu in: Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann72, Grundz § 1025, Rn. 4
147 Vgl. Münch, in: MüKoZPO4, § 1029, Rn. 27
148 Münch, ebd., § 1029, Rn. 28.
149 Vgl. in: Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann72, § 1029, Rn. 17; Münch, in: MüKoZPO4, § 1029, Rn. 16 ff.
150 Vgl. in: Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann72, § 1029, Rn. 18; Voit, in: Musielak11, § 1029, Rn. 16.
151 Dazu Reichold, in: Thomas/Putzo35, § 1029, Rn. 4
152 Zu letzterem ausführlich Münch, in: MüKoZPO4, § 1029, Rn. 21 ff. ; ein Über blick über zulässige und unzulässige Details einer Schiedsvereinbarung in in: Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann72, § 1029, Rn. 13 ff.
153 Münch, in: MüKoZPO4, § 1029, Rn. 23 f.
154 Münch, in: MüKoZPO4, § 1029, Rn. 28.
155 Dazu in: Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann72, § 1030, Rn. 4; siehe auch Schütze, Rn. 200 f.
156 In der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Juli 1979 (BGBl. I S. 853, ber. S. 1036), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 10. Oktober 2013 (BGBl. I S. 3786).
157 Näher dazu Germelmann, in: Germelmann/Matthes/Prütting8, § 101, Rn. 33 f.
158 In der Fassung der Bekanntmachung vom 25. August 1969 (BGBl. I S. 1323), zuletzt geändert durch Art. 88 des Gesetzes vom 8. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1864).
159 Siehe Schütze, Rn. 202.
160 in: Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann72, § 1055, Rn. 6; Abramenko, in: Prütting/Helms3, § 36, Rn. 1; a.A. bei Schumacher, FamRZ 2004, 1677 (1679 f.)
161 Vgl. dazu Hötte, S. 194 f.; siehe auch Trips-Hebert, RuP 2012, 214; sehr ausführlich Bock, NJW 2012, 122 ff. m.w.N.
162 In der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Juli 2012 (BGBl. I S. 1577).
163 In der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2586, 2587), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 10. Oktober 2013 (BGBl. I S. 3786).
164 Dazu in: Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann72, Grdz § 128, Rn. 14; ebenso Rauscher, in: MüKoZPO4, Einleitung Rn. 52 ff.
165 Vgl. in: Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann72, § 278, Rn. 6.
166 Dazu etwa Prütting, in: Prütting/Helms3, § 36 a, Rn. 14.
167 Vgl. in: Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann72, § 278, Rn. 2; Prütting, in: Prütting/Helms3, § 36 a, Rn. 8.
168 Vgl. in: Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann72, § 1029, Rn. 20.
169 Ebd., § 1032, Rn. 5.
170 Ebd., § 1032, Rn. 2.
171 Ebd., § 1032, Rn. 7.
172 Ebd., § 1029, Rn. 20.
173 Zur Unzulässigkeit der Überprüfung durch ein staatliches Gericht siehe ebd., § 1029, Rn. 13.
174 Ebd., § 1055, Rn. 2 f.
175 Grüneberg, in: Palandt73, § 399, Rn. 4.
176 Sprau, ebd., § 779, Rn. 6.
177 In: Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann72, § 1055, Rn. 6.
178 Dazu Brudermüller, in: Palandt73, Vorb v § 1310, Rn. 2.
179 Zum Aufenthalt siehe Hau, in: Prütting/Helms3, Vor §§ 98-106, Rn. 21 ff.; zur Diskussion über Reformvorschläge zur Anknüpfung im Kollisionsrecht siehe TripsHebert, RuP 2012, 214 ff.
180 In der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3513).
181 Weber, in: Keidel18, § 111, Rn. 6.
182 Näher dazu Weber, ebd., § 127, Rn. 4 ff.
183 Weber, ebd., § 111, Rn. 6.
184 In: Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann72, Grdz § 128, Rn. 22.
185 Ebd., Grdz § 128, Rn. 23.
186 Weber, in: Keidel18, § 111, Rn. 6.
187 Zur Übersicht über die Wechselwirkung von FamFG und ZPO in Ehe- und Familienstreitsachen siehe Weber, in:
188 Zu ihrem Ausschluss siehe etwa Helms, in: Prütting/Helms3, § 142, Rn. 4.
189 Dazu auch Helms, ebd., § 136, Rn. 1 ; Weber, in: Keidel18, § 1, Rn. 23 f.; seit 2006 im „Süddeutschen Familienschiedsgericht“ über unterhalts- und vermögensrechtliche Streitigkeiten, siehe Kloster—Harz, FamRZ 2007, 99 f.
190 Dazu Helms, in: Prütting/Helms3, § 137, Rn. 58.
191 Hau, ebd., § 98, Rn. 53.
192 Vgl. Hammer, ebd., § 155, Rn. 50.
193 Hammer, ebd., § 155, Rn. 3 und § 156, Rn. 20.
194 So schon vor Einführung des FamFG Friederici, FuR 2006, 448 (450); kategorisch nicht-vermögensrechtliche Streitigkeiten jedoch ausschließend Schumacher, FamRZ 2004, 1677 (1680).
195 Gomille, in: Haußleiter, § 1, Rn. 17.
196 So etwa Gomille, ebd., § 1, Rn. 18.
197 So noch auf die Vorgängervorschrift § 623 ZPO a.F. bezogen Schlosser, in: Stein/Jonas22, § 1030, Rn. 2; weitere Nachweise über diese Auffassung bestätigende Stimmen in der Literatur bei Gomille, in: Haußleiter, § 1, Rn. 18; siehe auch Schumacher, FamRZ 2004, 1677 (1681).
198 In der Fassung der Bekanntmachung vom 21. September 1994 (BGBl. I S. 2494; 1997 I S. 1061), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Juni 2014 (BGBl. I S. 786).
199 Vgl.Brudermüller, in: Palandt73, § 1409, Rn. 1 f.
200 Bezogen auf Kindsunterhaltsansprüche siehe Hätte, S. 200 ff.
201 Nachweise über Gegenstimmen bei Rauscher, in: MüKoZPO4, Einleitung, Rn. 67; siehe insbesondere Hätte, S. 199.
202 Siehe in: Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann72, § 1066, Rn. 2; Weidlich, in: Palandt73, § 1937, Rn. 9.
203 Wieder in: Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann72, § 1066, Rn. 2.
204 Sprau, in: Palandt73, § 779, Rn. 8.
205 Vgl. Sternberg-Lieben/Bosch, in: Schönke/Schröder, § 77, Rn. 10 ff.
206 In der Fassung der Bekanntmachung vom 13. November 1998 (BGBl. I S. 3322), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. April 2014 (BGBl. I S. 410) geändert worden ist.
207 Näher dazu Sternberg-Lieben/Bosch, in: Schönke/Schröder, § 77, Rn. 6 ff.
208 Vgl. Sternberg-Lieben/Bosch, ebd., § 230, Rn. 5.
209 In der Fassung der Bekanntmachung vom 7. April 1987 (BGBl. I S. 1074, 1319), die durch Artikel 3 des Gesetzes vom 23. April 2014 (BGBl. I S. 410) geändert worden ist.
210 Dazu Kurth/Weißer, in: HK-StPO5, § 380, Rn. 1 ff.
211 Für eine Auflistung der Vergleichsbehörden in den verschiedenen Bundesländern siehe dazu Kurth/Weißer, ebd., § 380, Rn. 11 ff.
212 Für die Mediation vgl. Kaspar, S. 145 ff.
213 Vgl. Kurth/Weißer, in: HK-StPO5, § 380, Rn. 5.
214 Vgl. dazu neben den eingangs aufgeführten Referenzen auch als Auszug aktueller Rechtsprechung nur OLG Hamm, FamRZ 2013, 1481 ff.; dass., FamRZ 2011, 1056 f.; OLG Koblenz, NJW 2013, 1377 f.; OLG München, FamRZ 2013, 36 ff.; OLG Celle, IPRspr 2011, Nr 86, 185 ff.; OLG Frankfurt, IPRspr 2010, Nr 8, 20 ff.; OLG Bamberg, IPRspr 2010, Nr. 89, 190 ff.
215 Vgl. etwa in: Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann72, § 1051, Rn. 1 m.w.N.; Münch, in: MüKoZPO4, § 1051, Rn. 1 m.w.N.; Hötte, S. 206 f.
216 ABl. Nr. 177 S. 6, ber. 2009 Nr. L 309 S. 87.
217 Dazu etwa Voit, in: Musielak11, § 1051, Rn. 7 m.w.N.; vgl. auch BT-Drs. 13/5274, S. 52 li. Sp.
218 Vgl. Adolphsen/Schmalenberg, o. Fn. 111.
219 Legitimiert durch Art. 23 Abs. 1 GG, dazu Degenhart, § 3, Rn. 244 f.
220 Vgl. etwa Voit, in: Musielak11, § 1051, Rn. 3 weitere Nachweise bei Münch, in: MüKoZPO4, § 1051, Rn. 9 nd auch Adolphsen/ Schmalenberg, SchiedsVZ 2007, 57 (59) — dieser wieder unter Rückversicherung bei Handorn, S. 75
221 Im Verhältnis zu Dänemark: Art. 1 Abs. 2 lit. d EVÜ.
222 In dieser Weise offenbar den Giuliano/Lagarde-Report zum EVÜ (Official Jour nal of the European Communities No. C 282, 31. 10. 1980 = BT-Drs. 10/503) auslegend: Zobel, S. 62.
223 Münch, in: MüKoZPO4, § 159, Rn. 15.
224 Zu ihren Grenzen vgl. etwa Münch, ebd., § 1059, Rn. 13 ff.
225 Vgl. nur Voit, in: Musielak11, § 1059, Rn. 6 sowie Münch, in: MüKoZPO4, § 1029, Rn. 41 f. und § 1059, Rn. 10 jeweils m.w.N.
226 So auch Münch, ebd., § 1029, Rn. 29 f.
227 Münch, ebd., § 1029, Rn. 29 f.
228 Siehe Zobel, S. 62.
229 So ebd., S. 63; siehe auch Handorn, S. 64 ff. m.w.N. insbes. 67, wonach das Sonderkollisionsrecht des Schiedsverfahrens seine Autonomie aus allgemeinen völkerrechtlichen Rechtsgrundsätzen beziehe.
230 Vgl. Zobel, S. 63 m.w.N.; siehe auch Entwurfsbegründung BT-Drs. 13/5274, S. 52 li. Sp. m.w.N.
231 Aubart, S. 5 m.w.N.; siehe auch Martiny, in: MüKoBGB, Art. 3 Rom I-VO, Rn. 67 zur dépeçage als vertraglicher Teilrechtswahl gem. Art. 3 Abs. 1 S. 3 Rom-I-VO.
232 Zobel, S. 63.
233 So aber ebd., S. 63, wenn auch mit dem Eingeständnis, dass dies schwer zu belegen ist.
234 BT-Drs. 13/5274, S. 52 li. Sp.; der insoweit zurecht bei Handorn kritisierten Begründung entnimmt dieser daher eine Fehleinschätzung des Gesetzgebers und leitet dessen Willen zur Bestätigung des Sonderkollisionsrecht von Völkerrechtsrang ab, Handorn, S. 71 und 74.
235 BT-Drs. 13/5274, S. 52 li. Sp.
236 Ebd., S. 52 re.
237 Vgl. nur Handorn, S. 55 ff.
238 So auch Münch, in: MüKoZPO4, § 1029, Rn. 35.
239 Vgl. zum Begriff Rauscher, § 10, Rn. 1137 m.w.N.
240 So ders., § 10, Rn. 1135; Ferrari, in: Ferrari2, Art. 3 Rom I-VO, Rn. 55; Martiny, in: MüKoBGB, Art. 3 Rom I-VO, Rn. 88; siehe auch Münch, in: MüKoZPO4, § 1051, Rn. 22.
241 Dazu wieder Ferrari, in: Ferrari2, Art. 3 Rom I-VO, Rn. 6 und 49.
242 Vgl. etwa in: Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann72, § 1051, Rn. 2 m.w.N.; Münch, in: MüKoZPO4, § 1051, Rn. 15 m.w.N.
243 Ferrari, in: Ferrari2, Art. 3 Rom I-VO, Rn. 6 f.
244 Ferrari, ebd., Art. 3 Rom I-VO, Rn. 4.
245 Münch, in: MüKoZPO4, § 1051, Rn. 15.
246 So Ferrari, in: Ferrari2, Art. 3 Rom I-VO, Rn. 7 und 42 ff.
247 Siehe oben S. 42
248 Siehe auch Ferrari, in: Ferrari2, Art. 3 Rom I-VO, Rn. 6 m.w.N.
249 Vgl. Ferrari, in: Ferrari2, Art. 3 Rom I-VO, Rn. 8 m.w.N.
250 Ferrari, ebd., Art. 3 Rom I-VO, Rn. 8 m.w.N.
251 Ferrari, ebd., Art. 10, Rn. 4 m.w.N. zur Kritik an der Regelung.
252 Ebd.
253 Ferrari, in: Ferrari2, Art. 10, Rn. 5.
254 Ferrari, ebd., Art. 10, Rn. 5.
255 So aber Voit, in: Musielak11, § 1051, Rn. 3.
256 Ferrari, in: Ferrari2, Art. 3, Rn. 8, zur akzessorischen Anknüpfung des Verweisungsvertrags.
257 ABl. L 199 vom 31.7.2007, S. 40.
258 ABl. L 343 vom 29.12.2010, S. 10.
259 Andere Auffassung freilich Handorn, S. 72.
260 So Münch, in: MüKoZPO4, § 1051, Rn. 13.
261 Münch, ebd., § 1051, Rn. 15.
262 Zur grundsätzlichen Möglichkeit, aber auch ihren offensichtlichen Risiken siehe Ferrari, in: Ferrari2, Art. 3 Rom I-VO, Rn. 36 f. m.w.N.
263 Näher dazu Schulze, ebd., Art. 11 Rom I-VO, Rn. 6.
264 Vgl. Schulze, ebd., Art. 13 Rom I-VO, Rn. 5 f.
265 Die Rechtswahlbefugnis indes kategorisch ausschließend: Münch, in: MüKoZPO4, § 1059, Rn. 14.
266 Zur Rechtsgrundverweisung siehe etwa Rüthers/Fischer/Birk, § 4, Rn. 132.
267 Aus der mangelnden Ausdrücklichkeit leitet Handorn indes gerade die Nichtanwendbarkeit der Rom-I-VO ab, vgl. Handorn, S. 73.
268 Voit, in: Musielak11, § 1051, Rn. 3.
269 Voit, ebd., § 1059, Rn. 29 f.; kritisch: Münch, in: MüKoZPO4, § 1059, Rn. 42.
270 In Voit, in: Musielak11, § 1051, Rn. 2 ff. sind beide Gegenstand des Ordnungspunkts I.
271 Vgl. in: Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann72, § 1051, Rn. 5, so auch Voit, in: Musielak11, § 1051, Rn. 8 je m.w.N.
272 Vgl. Radbruch, in: Studienausgabe, 1 (36).
273 Ebd., 1 (53 ff.).
274 Ebd., 1 (72 f.).
275 Ders., in: Studienausgabe, 211 (216).
276 Voit, in: Musielak11, § 1059, Rn. 29 m.w.N.
277 Ferrari, in: Ferrari2, Art. 3 Rom I-VO, Rn. 14 m.w.N.
278 Martiny, in: MüKoBGB, Art. 3 Rom I-VO, Rn. 23.
279 Vgl. dazu wieder BT-Drs. 13/5274, S. 52 re. Sp.
280 Ferrari, in: Ferrari2, Art. 3 Rom I-O, Rn. 15; auch Martiny, in: MüKoBGB, Art. 3 Rom I-VO, Rn. 28 sowie Sonnenberger, ebd., IPR Einl., Rn. 231.
281 Zum Begriff siehe Martiny, ebd., Art. 3 Rom I-VO, Rn. 14.
282 Ferrari, in: Ferrari2, Art. 3 Rom I-VO, Rn. 18.
283 Ferrari, ebd., Art. 3 Rom I-VO, Rn. 19.
284 Martiny, in: MüKoBGB, Art. 3 Rom I-VO, Rn. 32.
285 Martiny, ebd., Art. 3 Rom I-VO, Rn. 32 f.; siehe auch Sonnenberger, ebd., IPR Einl., Rn. 259, 361; im Detail auch Mankowski, RIW 2005, 481 (491)
286 Vgl. Martiniy, in: MüKoBGB, Art. 3 Rom I-VO, Rn. 33 a.E.
287 Martiny, ebd., Art. 3 Rom I-VO, Rn. 36 m.w.N.
288 Martiny, ebd., Art. 3 Rom I-VO, Rn. 37.
289 Röthel, JZ 2007, 755.
290 Ebd., 755 (761).
291 Martiny, in: MüKoBGB, Art. 3 Rom I-VO, Rn. 28.
292 Vgl. Mankowski, RIW 2005, 481 (491).
293 Ebd., 481 (491).
294 Vgl. Martiny, in: MüKoBGB, Art. 3 Rom I-VO, Rn. 45 f.
295 Martiny, ebd., Art 3 Rom I-VO, Rn. 51 f.
296 Zur teilweisen Rechtswahl siehe Martiny, in: MüKoBGB, Art. 3 Rom I-VO, Rn. 67 ff.
297 Dazu allgemein Rauscher, § 3, Rn. 307 f.
298 Ebd., § 3, Rn. 310.
299 Zur lex mercatoria siehe entsprechend Martiny, in: MüKoBGB, Art. 3 Rom I-VO, Rn. 37.
300 Insoweit identisch vgl. in: Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann72, § 1051, Rn. 5, so auch Voit, in: e m.w.N.
301 BT-Drs. 13/5274, S. 52 li. Sp.
302 Zobel, S. 63.
303 Vgl. in: Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann72, § 1051, Rn. 5 so auch Voit, in: Musielak11, § 1051, Rn. 8 je m.w.N.
304 Vgl. Münch, in: MüKoZPO4, § 1051, Rn. 38 m.w.N.
305 Münch, ebd., § 1051, Rn. 43.
306 Münch, ebd., § 1051, Rn. 39.
307 Münch, ebd., § 1051, Rn. 43.
308 Münch, ebd., § 1051, Rn. 43.
309 Münch, ebd., § 1051, Rn. 59.
310 Vgl. in: Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann72, § 1051, Rn. 5, Voit, in: Musielak11, § 1051, Rn. 8, Münch, in: MüKoZPO4, § 1051, Rn. 38 f. je m.w.N.
311 Münch, ebd., § 1051, Rn. 38.
312 Im Ergebnis identisch bei Münch, ebd., § 1051, Rn. 38, jedoch für die vermeintliche Var. 1 erläutert.
313 Voit, in: Musielak11, § 1051, Rn. 3.
314 Münch, in: MüKoZPO4, § 1051, Rn. 46.
315 Keine rational nachvollziehbare Entscheidungsbegründungen erwarten etwa Voit, in: Musielak11, § 1051, Rn. 3 und Adolphsen/Schmalenberg, SchiedsVZ 2007, 57 (64)
316 Münch, in: MüKoZPO4, § 1051, Rn. 46.
317 Münch, ebd., § 1051, Rn. 52.
318 Münch, ebd., § 1051, Rn. 46.
319 Münch, ebd., § 1051, Rn. 46.
320 Münch, ebd., § 1051, Rn. 46, zum Bezugsrahmen als „Bindung und Begrenzung“ nach § 1051 Abs. 3 Satz 1 siehe ferner Rn. 51.
321 Münch, in: MüKoZPO4, § 1051, Rn. 55; Voit, in: Musielak11, § 1051, Rn. 3.
322 In: Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann72, § 1051, Rn. 4.
323 Münch, in: MüKoZPO4, § 1051, Rn. 57.
324 Besonders deutlich bei Adolphsen/Schmalenberg, SchiedsVZ 2007, 57 (59).
325 Münch, in: MüKoZPO4, § 1059, Rn. 1 f. m.w.N. insbes. in dessen Fn. 5.
326 Im Detail siehe Münch, ebd., § 1059, Rn. 22.
327 Vgl. Münch, ebd., § 1032, Rn. 7 f. und 24.
328 Münch, ebd., § 1032, Rn. 7 f. und 24.
329 So, mit Bedauern, Münch, ebd., § 1059, Rn. 30 f.
330 Wagner, in: MüKoBGB, § 826, Rn. 8.
331 Wagner, ebd., § 826, Rn. 10.
332 Vgl. den weiteren Fortgang der Diskussion Wagner, ebd., § 826, Rn. 11-23.
333 Münch, in: MüKoZPO4, § 1059, Rn. 31.
334 Selbst wenn diese Problematik auch in anderen Fällen relevant werden kann vgl. etwa BGH NJW-RR 2011, 213 (214), Rn. 10 = Beschl. v. 30. September 2010 — III ZB 57/10 (KG).
335 Tiefergehend zum Ausschluss parteiautonom vereinbarter Zusatzgründe und zur über den ordre-public-Vorbehalt hinausgehender staatsgerichtlicher Kontrolle siehe Münch, in: MüKoZPO4, § 1059, Rn. 4 und 7.
336 Münch, ebd., § 1029, Rn. 28 und § 1059, Rn. 13 ff.
337 Münch, ebd., § 1029, Rn. 29.
338 Münch, ebd., § 1029, Rn. 42 und § 1059, Rn. 10, je m.w.N.
339 Münch, ebd., § 1029, Rn. 28.
340 Zu möglichen Hindernissen siehe Münch, ebd., § 1059, Rn. 15.
341 Münch, ebd., § 1059, Rn. 18.
342 Voit, in: Musielak11, § 1059, Rn. 14.
343 Näher Münch, in: MüKoZPO4, § 1059, Rn. 21
344 Münch, ebd., § 1059, Rn. 21.
345 Münch, ebd., § 1059, Rn. 21 m.w.N. anderer Auffassungen.
346 Münch, in: MüKoZPO4, § 1059, Rn. 23 f.
347 Näher Münch, ebd., § 1059, Rn. 25 ff.
348 Münch, ebd., § 1059, Rn. 20.
349 Vgl. Münch, ebd., § 1059, Rn. 21
350 Dazu Münch, ebd., § 1059, Rn. 33 ff.
351 Münch, ebd., § 1059, Rn. 38.
352 Münch, ebd., § 1059, Rn. 44 m.w.N., ähnlich auch Voit, in: Musielak11, § 1059, Rn. 26 ff.; a.A. in: Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann72, § 1059, Rn. 16.
353 Voit, in: Musielak11, § 1059, Rn. 25.
354 Münch, in: MüKoZPO4, § 1051, Rn. 57.
355 Zu beiden Begriffen siehe etwa Schneider/Schnapp, S. 47 und 84.
356 Pieroth/Schlink/Kniesel, S. 114.
357 Vgl. ebd., S. 129.
358 Vgl. Münch, in: MüKoZPO4, § 1059, Rn. 43 m.w.N.; Hötte, 214 m.w.N.
359 in: Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmaann72, § 1059, Rn. 16; Voit, in: Musielak11, § 1059, Rn. 25; letztlich auch die scheinbar vermittelnde Ansicht bei Münch, in: MüKoZPO4, § 1059, Rn. 44; ebenso Baetge, in: jurisPK-BGB6, Art. 6 EGBGB, Rn. 31
360 Nachweis bei Münch, in: MüKoZPO4, § 1059, Rn. 44, dort Fn. 151.
361 Münch, in: MüKoZPO4, § 1059, Rn. 44.
362 Sonnenberger, in: MüKoBGB, Art. 6 EGBGB, Rn. 19.
363 Sonnenberger, ebd., Art. 6 EGBGB, Rn. 3 und 17.
364 Vgl. Rauscher, § 6, Rn. 589 ff.; siehe auch Gottwald, in: MüKoZPO4, § 328, Rn. 117.
365 Sonnenberger, in: MüKoBGB, Art. 6 EGBGB, Rn. 19; Baetge, in: jurisPK- BGB6, Art. 6 EGBGB, Rn. 5.
366 Rauscher, § 6, Rn. 587.
367 Was die „Gleichwertigkeit aller Rechtsordnungen“ letztlich implizieren müsste, dazu Baetge, in: jurisPK-BGB6, Art. 6 EGBGB, Rn. 1.
368 Dazu auch Baetge, ebd., Art. 6 EGBGB, Rn 34.
369 Baetge, ebd., Art. 6 EGBGB, Rn. 34; Gottwald, in: MüKoZPO4, § 328, Rn. 116.
370 In: Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann72, § 1059, Rn. 16; Münch, in: MüKoZPO4, § 1059, Rn. 42; Voit, berger, in: MüKoBGB, Art. 6 EGBGB, Rn. 98.
371 Vgl. Baetge, in: jurisPK-BGB6, Art. 6 EGBGB, Rn. 32
372 Gottwald, in: MüKoZPO4, § 328, Rn. 117.
373 Gottwald, ebd., § 328, Rn. 117.
374 Baetge, in: jurisPK-BGB6, Art. 6 EGBGB, Rn. 32.
375 Gottwald, in: MüKoZPO4, § 328, Rn. 110, 126 ff.
376 Vgl. speziell zum Schiedsverfahrensrecht Münch, ebd., § 1059, Rn. 42; allgemein wieder Baetge, in: jurisPK-BGB6, Art. 6 EGBGB, Rn. 35.
377 BT-Drs. 13/5274, S. 59 re. Sp.
378 In der Fassung des Art. 4 Nr. 11 des Gesetzes vom 25. 7. 1986 (BGBl. I S. 1142) mit Wirkung vom 1. 9. 1986.
379 BT-Drs. 13/5274, S. 59, re. Sp.
380 Vgl. ebd., S. 58 li. Sp. f.
381 Vgl. Sonnenberger, in: MüKoBGB, Art. 6 EGBGB, Rn. 1.
382 Sonnenberger, ebd., Art. 6 EGBGB, Rn. 42.
383 Sonnenberger, ebd., Art. 6 EGBGB, Rn. 4
384 Gottwald, in: MüKoZPO4, § 328, Rn. 119, 121 ff.
385 In: Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann72, § 1059, Rn. 16.
386 Rohe spricht bezogen auf das Strafrecht von „einem weiter verstandenen ordre public“, Rohe, JZ 2007, 801 (802, 805); diese Formulierung erscheint hier aus den genannten Gründen unzweckmäßig.
387 Münch, in: MüKoZPO4, § 1060, Rn. 1.
388 Näher Münch, ebd., § 1059, Rn. 77.
389 Münch, ebd., § 1059, Rn. 77.
390 Vgl. in: Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann72, § 1059, Rn. 1.
391 Ebd., § 1059, Rn. 1 und 18.
392 Siehe auch Voit, in: Musielak11, § 1059, Rn. 35 und § 1060, Rn. 10.
393 Was zumindest ihre pejorativ anmutende Wortwahl, wonach eine auf dieser Grundlage ergangene Entscheidung „geradezu verblüffende Ähnlichkeit mit der Entscheidungsfindung des (¡madí-Richters nach dem fiqh-Recht“ hätte, nahe legt, Adolphsen/Schmalenberg, SchiedsVZ 2007, 57 (64) — wenn sie auch nicht spezifizieren, wie sie sich diese Entscheidungfindung vorstellen.
394 Pratchett, S. 393.
395 Benda, in: Lexikon der Politikwissenschaft. Theorien, Methoden, Begriffe, 827— 829 (828 m.w.N.).
396 Dazu etwa Somek, S. 10.
397 Ebd., 10 f.
398 Insoweit wird also, ausgehend von Luhmann, auch das Ansinnen von Teubner nachvollzogen, vgl. Teubner, S. 7, siehe dort seine Kritik anderer theoretischer Ansichten, ebd., 11 ff. und von ihm aufgeführte Anwendungsbeispiele, ausgehend von einem „intersystemischen Kollisionsrecht“ ab S. 123.
399 Siehe S. 146 ff.
400 Luhmann, Einführung in die Systemtheorie.
401 Vgl. Kelsen, in: Studienausgabe der 1. Auflage 1934, 1 (23).
402 Näher dazu siehe Anhang, Exkurs, S. 160 ff.
403 Siehe ebenda, S. 160.
404 Ebenda, S. 162 ff.
405 Zu Aussagen siehe ebenda, S. 146 ff.
406 Dazu ebenda, S. 149 ff.
407 Näher ebenda.
408 Zur Erläuterung sei daher auf die gesamte Erörterung der Systemtheorie im Anhang ab S. 165 verwiesen.
409 Zur eindeutigen Abgrenzung systemtheoretisch besetzter Begriffe von ihrer Verwendung in anderen Kontexten, werden sie mit Kapitälchen hervorgehoben.
410 Darin geht auch Teubners Ansatz auf, wonach die Autopoiesis als wechselseitig produzierende Verkettung von „Selbstbeobachtung“ und „Selbstkonstitution“ zu betrachten ist, Teubner, S. 44
411 Siehe dazu auch ebd., 23 f.
412 Vgl. auch Teubner, S. 45.
413 Vgl. Kant, Werkausgabe Band VII, S. 11.
414 Vgl. ders., Werkausgabe Band VIII, S. 318.
415 Ders., Werkausgabe Band VII, S. 46.
416 Kant, Werkausgabe Band VII, S. 51.
417 Ebd., S. 21 ff.
418 Ebd., S. 59.
419 Vgl. ebd., S. 70 f.
420 Vgl. ebd., S. 74 ff.
421 Ebd., S. 51.
422 Ebd., S. 39.
423 Ebd., S. 36.
424 Vgl. ebd., S. 38.
425 Zur Wortbedeutung siehe Dudenredaktion, S. 926, li. Sp.
426 Kant, Werkausgabe Band VIII, S. 326 f.
427 Auch für das nachfolgende: Ebd., S. 327 ff.
428 Ebd., S. 330.
429 Kant, Werkausgabe Band VIII, S. 337.
430 Vgl. ebd., S. 338 ff.
431 Ebd., S. 341.
432 Ebd., S. 342.
433 U.a. Prümm, S. 16 m.w.N. auch mit Verweis auf einen der Anwendungsfälle dieses Gedankenexperiments im britischen Verfahren Her Majesty The Queen v. Tom Dudley and Edwin Stephens.
434 Kant, Werkausgabe Band VIII, S. 343.
435 Vgl. Wessels/Beulke, § 10, Rn. 432 ff.
436 Kant, Werkausgabe Band VIII, S. 344.
437 Ebd., S. 343 f.
438 Ebd., S. 345.
439 Siehe dazu auch Alexy, S. 187.
440 Kant, Werkausgabe Band VIII, S. 345.
441 Ebd., S. 324.
442 Zum gesamten Absatz ebd., S. 324.
443 Vgl. etwa zur Menschenwürde, dem „Zweck an sich“ in der, wenn auch unpräzisen „Objektformel“ Pieroth/Schiink, § 7, Rn. 369 und 374 ff. m.w.N.
444 Zum zurechenbaren „Werk“ des Täters vgl. etwa Wessels/Beuike, § 6, Rn. 176 ff.
445 Dazu etwa Alexy, S. 15.
446 Siehe in anderem Zusammenhang zur Gerechtigkeitsproblematik und Inkonsistenzen bei Kant, ebd., S. 191 f.
447 Kant, Werkausgabe Band VIII, S. 341 f.
448 Vgl. ders., Werkausgabe Band VIII, S. 324 f.; siehe auch zu Kants striktem herrschaftsbestätigenden Positivismus Alexy, S. 189 f.
449 Zu unterschiedlichen Gerechtigkeitsbegriffen siehe etwa Frankenia, in: Recht und Moral. Texte zur Rechtsphilosophie, 154—177 (154 ff.); v. Hayek, in: Recht und Moral. Texte zur Rechtsphilosophie, 177—197 (180); Rawls, in: Recht und Moral. Texte zur Rechtsphilosophie, 197—213 (198 ff.).
450 Dazu Alexy, S. 121 f.
451 Radbruch, in: Recht und Moral. Texte zur Rechtsphilosophie, 46—50 (46 f.).
452 Ebd., 46-50 (47).
453 Ebd., 46-50 (49).
454 Radbruch, in: Recht und Moral. Texte zur Rechtsphilosophie, 46—50 (48 f.); dazu auch Alexy, S. 71 ff.
455 In diesem Sinne auch Höffe, zitiert bei ders., S. 58.
456 Ebd., S. 52, siehe auch S. 71 ff. und 106.
457 Ebd., S. 201.
458 Ebd., S. 47.
459 Ebd., S. 56.
460 Ebd., S. 63 f.
461 Kant, Werkausgabe Band VIII, S. 345.
462 Dazu auch Alexy, S. 119 m.w.N.
463 Dazu ebd., S. 57.
464 ebd., S. 73 ff.; siehe zu den Widerspruchsregeln des Normensystems auch oben S. 163 ff.
465 Ebd., S. 64 ff. und 202.
466 Zur logischen Paradoxie siehe etwa Zoglauer, S. 14 ff.
467 Zur retorsio argumenti siehe etwa Schopenhauer, S. 57.
468 Alexy, S. 67.
469 Vgl. Zoglauer, S. 15.
470 Alexy, S. 68.
471 Ebd., S. 202.
472 Alexy, S. 203.
473 Ebd., S. 139 ff. und 144.
474 Kursiv im Original.
475 Alexy, S. 143 und 145.
476 Ebd., S. 175.
477 Ebd., S. 186.
478 Ebd., S. 194.
479 Ebd., S. 189 ff.
480 Ebd., S. 129 ff.
481 Ebd., S. 118.
482 Kursiv im Original.
483 Alexy, S. 120.
484 Wie es auch im Rechtsforbildungsbeschluss zum Ausdruck kommt ebd., S. 119.
485 Ebd., S. 131 ff.
486 Ebd., S. 46 f.
487 Ebd., S. 47 und 205 f.
488 Vgl. Kelsen, in: Studienausgabe der 1. Auflage 1934, 1 (15 f., 23).
489 Kelsen, in: Studienausgabe der 1. Auflage 1934, 1 (18 f.).
490 Ebd., 1 (19).
491 Ebd., 1 (20 ff.).
492 Ebd., 1 (39).
493 Ebd., 1 (25 ff.).
494 Ebd., 1 (33).
495 Ebd., 1 (21).
496 Zum gesamten Absatz ebd., 1 (22 ff.).
497 Ebd., 1 (39).
498 Ebd., 1 (33 f.).
499 Ebd., 1 (37).
500 Vgl. ebd., 1 (39 f.).
501 Aus dieser Perspektive scheint die These einer normativen Kraft des Rechts als „Trieb der Gerechtigkeit“ poetisch, aber unzutreffend, zu dieser siehe Fischer- Lescano, S. 17 f.
502 Kelsen, in: Studienausgabe der 1. Auflage 1934, 1 (54 ff.).
503 Ebd., 1 (73).
504 Ebd., 1 (84. ff.).
505 Ebd., 1 (73).
506 Ebd., 1 (75 ff.).
507 Zur vermeintlichen Inhaltsleere des kategorischen Imperativs siehe ebd., 1 (27).
508 Ders., in: Studienausgabe der 1. Auflage 1934, 1 (79); bei Alexy „im Großen und Ganzen“ in Alexy, S. 144 m.w.N. bei Kelsen.
509 Dies mag dem Ansatz Fischer-Lescanos nahe kommen, die emanzipatorische Kraft des Rechts in der „[normativen] Absicherung der Entfaltung der menschlichen und [. . . ] sozialen Normativkräfte“ zu sehen, wenn Kelsen nicht die morali- sche Gerechtigkeit aus seinem Konzept verbannt hätte, Fischer-Lescano, S. 117 f.
510 Kelsen, in: Studienausgabe der 1. Auflage 1934, 1 (84).
511 Ebd., 1 (84).
512 Vgl. ebd., 1 (25 ff., 46 ff.).
513 Ebd., 1 (83).
514 Dazu wurde im Exkurs der Versuch unternommen, einen »programmatischen Syllogismus« herauszuarbeiten, um die interne Logik der Normerzeugung nachzuzeichnen, siehe Anhang, Exkurs, S. 157 ff.
515 Im Exkurs wurde dies Problematik in einem »Weltenargument« erörtert, S. 149 ff.
516 Kelsen, in: Studienausgabe der 1. Auflage 1934, 1 (72).
517 Vgl. ebd., 1 (94 ff.).
518 Vgl. Kant, Werkausgabe Band VII, S. 66 ff.; der Begriff dürfte wohl in Anlehnung an „Reich Gottes“ eingeführt worden sein, zu diesem siehe etwa Peukert, S. 325 ff.
519 Vertiefend dazu siehe Anhang, Exkurs, S.155 ff.
520 Vgl. Kelsen, in: Studienausgabe der 1. Auflage 1934, 1 (26).
521 Vgl. Kant, Werkausgabe Band VII, S. 25.
522 Jestaedt, in: Studienausgabe der 1. Auflage 1934, XI—LXVI (XXIX).
523 Vgl. Luhmann, Das Recht der Gesellschaft, S. 34 f. und 49.
524 Vgl. ebd., S. 50.
525 Vgl. ders., Das Recht der Gesellschaft, S. 60; siehe auch Huber, S. 90 ff. m.w.N. bei Luhmann.
526 Luhmann, Das Recht der Gesellschaft, S. 70.
527 Vgl. ebd., S. 52 f.; siehe auch Exkurs im Anhang, II 1e, S. 170 ff.
528 Vgl. Alexy, S. 47.
529 Es ist den Gerichten als Beobachtung zweiter Ordnung überlassen, die Erkenntnisse der Wissenschaft in ihrer Rechtserzeugung zu berücksichtigen, vgl. Teub- ner, S. 53; zum Verhältnis von Theorie und Praxis im Recht nach Luhmann siehe auch Huber, S, 132 ff.
530 Abbildung 1 auf S. 78 soll helfen, den Überblick zu erleichtern.
531 Luhmann, Das Recht der Gesellschaft, S. 125 f.
532 Ebd., S. 128.
533 Ebd., S. 130.
534 Ebd., S. 130.
535 Luhmann, Das Recht der Gesellschaft, S. 218, kursiv im Original.
536 Vgl. ebd., S. 219.
537 Vgl. ebd., S. 231.
538 Dazu ebd., S, 118 ff.; dies findet sich auch in einer linguistischliteraturwissenschaftlichen Herangehensweise an die Selbstbeschreibung des Recht wieder, dazu etwa Müller-Mall, ARSP 135 (2012), 117—126 (117 ff.); Christensen, Christensen, Ralph, Sprache und Normativität oder wie man eine Fiktion wirklich macht, hrsg. v. Julian Krüper/Heike Merten/Martin Morlok, Tübingen, 2010, S.127 ff.
539 Das „Zentrum des Rechtssystems“ bei Luhmann, Das Recht der Gesellschaft,
S. 229
540 Vgl. Alexy, S. 46.
541 Dazu Luhmann, Das Recht der Gesellschaft, S. 70 f.
542 ebd., S. 131; zu Funktion und Leistung des Rechts siehe zusammenfassend Huber, S. 98 m.w.N. bei Luhmann
543 Zur Kritik Rottleuthners an dieser Betrachtungsweise siehe Teubner, S. 48 f.
544 Luhmann, Das Recht der Gesellschaft, S. 18.
545 Ebd., S. 129 f., kursiv im Original.
546 Vgl. ebd., S. 129 f., siehe auch S. 118.
547 Ebd., S. 126.
548 Ebd., S. 98.
549 Ebd., S. 130.
550 Ebd., S. 99 ff.
551 Ebd., S. 102.
552 Dazu ebd., S. 106 ff.; zu Konditional- und Zweckprogrammen siehe auch Huber,
S. 94 ff. m.w.N. bei Luhmann.
553 Siehe Luhmann, Das Recht der Gesellschaft, S. 128.
554 Ebd., S. 131.
555 Näher dazu Anhang, Exkurs, S. 173.
556 Luhmann, Das Recht der Gesellschaft, S. 135.
557 Insoweit a.A. ebd., S. 168 ff. einer naturrechtlichen Gerechtigkeitsauffassung S. 219 f.
558 Die Anfrage Rottleuthners nach dem „>Punkt der Entwicklung an dem sich das Rechtssystem zu autpoietischer Geschlossenheit zusammenzieht.<“ beantwortet Teubner mit Rückgriff auf Harts »secondary rule«, wenn Rechtskommunikation über Rechtskommunikation einsetzt, Teubner, S. 49 ff. Das ist identisch mit der Herausbildung dieses Beobachtungssystems.
559 Luhmann, Das Recht der Gesellschaft, S. 215.
560 Vgl. Kelsen, in: Studienausgabe der 1. Auflage 1934, 1 (25 ff.).
561 Vgl. Luhmann, Das Recht der Gesellschaft, S. 215 f., siehe auch zur Ablehnung
562 Luhmann, Das Recht der Gesellschaft, S. 232.
563 Zu den Problemen der Grenzverletzung von SYSTEMEN siehe Anhang, Exkurs, S. 173 ff.
564 Zu diesem und dem vorhergehenden vgl. Luhmann, Das Recht der Gesellschaft, S. 232 ff.; Nachweise zur Kritik an diesem Konzept bei Renner, Ancilla Iuris (anci.ch) 2008, 62 (66 ff.).
565 Luhmann, Das Recht der Gesellschaft, S. 237, zum gesamten Absatz vgl. S. 236 ff.; kritisch dazu Osterkamp, S. 135 ff.
566 Dies zielt auch in die Richtung von Teubners evolutionstheoretischer Vorstellung, vgl. Teubner, S. 73 ff.; zur konfliktbedingten Weiterentwicklung des Rechts siehe Huber, S. 194.
567 Kelsen, in: Studienausgabe der 1. Auflage 1934, 1 (26).
568 Vgl. zur Kritik an Friedrich II. von Preußen Prümm·,, ZJS 2012, 24 (25 ff.).
569 Ebd., 24 (26).
570 In-Kraft-Treten des ALR am 1. 6. 1994, vgl. ebd., 24 (27).
571 Vgl. wieder Alexy, S. 190 f. m.w.N.
572 Somek, S. 15.
573 Ipsen, § 1, Rn. 15 „Handhabbarkeit“ und „Widerspruchsfreiheit“ im Original fett.
574 Die folgenden eigenen Darstellungen zeichnen letztlich auch die Genese der Entwicklung zum autopoietischen Recht nach, wie von Teubner beschrieben, Teub- ner, S. 49 ff. und spiegelt sich auch in der rechtsgeschichtlichen Betrachtung wieder, dazu etwa Wesel, S. 697 ff.
575 Zur Weiterentwicklung des Kollisionsrechts, gleichsam Bezug zur Systemtheorie des Rechts siehe Fischer-Lescano/ Teubner, etwa S. 34 ff., für die internationale Schiedsgerichtsbarkeit relevant insbesondere S. 41 ff.
576 Dazu siehe Luhmann, Das Recht der Gesellschaft, S. 100 f.; zu Problematik und Nutzen des Begriffs siehe etwa Ipsen, § 2, Rn. 84 ff.
577 Soweit das Wort 'Ideologie' nur weltliche Ideenlehren bezeichnen soll, ist diese Unterscheidung notwendig. Soweit die Gott-Idee jedoch als wesensgleich mit den Grundprinzipien anderer Ideenlehren betrachtet wird, etwa der omniprä- sente Klassenkampf, grenzenloses Wachstum, die Überlegenheit der westlichen Demokratie, aber auch der in diesseitiger Vernunft begründete kategorische Imperativ, sind beide Begriffe austauschbar. Letztlich kann das als Grundlage der Säkularisierung betrachtet werden.
578 Dazu Meder, S. 89 ff.
579 Der kategorische Imperativ lässt sich danach eher aus der alttestamentarischen Anweisung zur Nächstenliebe (der im Bund vereinten, vgl. 1. Mose 17, 4) herauslesen (3. Mose 19, 18), als aus ihrer unter Christen häufig irrtümlich originär dem neutestamentarischen Protagonisten Jesus zugeschriebenen Rezeption (Markus 12, 31), in der sie zwar wie bei Kant zur ersten Maxime erhoben wird, jedoch letztlich in einer Ausprägung, welche die Unterordnung der eigenen unter die Bedürfnisse des anderen gebietet (vgl. Matthäus 5, 38 ff.), auch wenn die politische Dimension der Feindesliebe (Matthäus 5, 43 ff.) freilich als originärer Ansatz zur Auflösung der Gruppengrenzen erscheint; siehe aber auch Peukert, S. 343 f. Zur grundlegenden Einordnung Jesu in den gesellschaftlichen Diskurs seiner Zeit siehe etwa Geiger bei Heschel, S. 33 ff., 214 ff., 267 ff.
580 Luhmann, Das Recht der Gesellschaft, S. 228.
581 Zur Einführung sehr eingängig siehe Wörlen, S. 30 ff.
582 Ebd., S. 31.
583 Vgl. Prümm, ZJS 2012, 24 (30 ff.).
584 Vgl. Wörlen, S. 32 ff.
585 Vgl. ebd., S. 36 f.
586 Dudenredaktion, S. 578 re. Sp.
587 Rohe, S. 59.
588 Vgl. Lohlker, Islamisches Recht. Methoden, S. 184 ff. m.w.N.
589 In den zurückliegenden Jahrhunderten konnten also auch Sklaven Juristen sein, vgl. ebd., S. 185 Fn. 6.
590 Vgl. zu diesem und dem nachfolgenden ebd., S. 185.
591 Im 14. Jahrhundert christlicher Zeitrechnung, zitiert wird Taj ad-din as-Subki (gest. 1370).
592 Dazu Lohlker, Islamisches Recht. Methoden, S. 79 ff.; siehe auch Rohe, S. 45 f.
593 Lohlker, Islamisches Recht. Methoden, S. 185.
594 Dazu Rohe, S. 48 ff. und 52 ff.
595 Vgl. Lohlker, Islamisches Recht. Methoden, S. 30 und 37 ff.
596 Vgl. Rohe, S. 62 ff.
597 Vgl. ebenda; dazu auch Lohlker, Islamisches Recht. Methoden, S. 139 ff.
598 Rohe, S. 64.
599 Ebd., S. 66.
600 Auch «ü^dl (almasalih al-mursala), (die Maslaha) = der allgemei ne Nutzen, das öffentliche Interesse, ebd., S. 66.
601 Ebd., S. 71.
602 Ebd., S. 66.
603 Ebd., S. 66.
604 Zu diesen siehe allgemein im Anhang, Exkurs, S. 159 ff. und 163 ff.
605 Dazu siehe auch oben S. 11, die Anwendung nicht-islamischen Rechts von »Traditionalisten« als Darura, woraus nicht zu folgern ist, dass diese Ansicht nicht vertretbar sei, sondern lediglich, dass entsprechende Entscheidungen ein hohes Maß an Begründungsaufwand erfordern, was wiederum gerade dem Ijtihad gerecht wird.
606 Dazu Rohe, S. 71 f.
607 Ebd., S. 72.
608 Ebd., S. 72.
609 Ebd., S. 46.
610 Vgl. Lohlker, Islamisches Recht. Methoden, S. 47 ff., 76 f.
611 Wohl auch y\a- (ja’is), vgl. ebd., S. 105.
612 Wohl auch JhL (batil), vgl. Rohe, S. 10, 104, 580.
613 Vgl. Lohlker, Islamisches Recht. Methoden, S. 102.
614 Zum Diskurs darüber, ob wajib/fard vom Wortsinn des halal erfasst sei oder nicht, siehe ebenda ebd., S. 105 f.
615 Ebd., S. 106.
616 Der Begriff 'Rechtsquelle' wird hier vermieden, da dieser zuvor in I 6 durch den Begriff 'Rechtsgeltung' als PROGRAMMbestandteil und Ausgangspunkt einer jeglichen Rechts-ÜPERATION im aktiven RechtsSYSTEM ausgeschlossen wurde.
617 Vgl. Rohe, S. 72 f. m.w.N.
618 Vgl. ebd., S. 68 f.
619 Vgl. Lohlker, Islamisches Recht. Methoden, S. 103.
620 Vgl. Rohe, S. 59, 67 f.
621 Ebd., S. 58.
622 Sing. ^aUI (der Math'hab)
623 Zu diesen siehe Rohe, S. 28 ff.; Lohlker, Islamisches Recht. Methoden, [S. 70 ff.
624 Dazu Rohe, S. 30 ff.
625 Ebenda, S. 59.
626 Rohe, S. 30 ff.
627 Zu asch-Schafi ‘? hingegen als Erneuerer des Ijtihad siehe Lohlker, Islamisches Recht. Methoden, S. 187
628 Vgl. dazu die süffisante Bemerkung des zitierten hanafitischen Richters al-Bala- sarUnl, Rohe, S. 29
629 Vgl. Lohlker, Islamisches Recht. Methoden, S. 68 ff.; so wird auch erklärbar, dass islamische Staaten sich dennoch eine Verfassung geben, nach der islamisches Recht in der Auslegung einer bestimmten Rechtsschule durch Gesetzeskodifikation inkorporiert wird, wodurch zum einen freilich Herrschaft stabilisiert, aber auch Rechtssicherheit geschaffen wird, vgl. dazu wieder Rohe, S. 182 ff.
630 Ebd., S. 59.
631 Vgl. Lohlker, Islamisches Recht. Methoden, S. 188 m.w.N.
632 Hier wird das grammatische männliche Geschlecht aus dem Arabischen übernom men, auch wenn das Wort im deutschen Sprachraum als Neutrum oder auch Feminium klassifiziert wird.
633 Lohlker, Islamisches Recht. Methoden, S. 188, Hervorhebung durch den Verfasser.
634 Vgl. ders., Islamisches Recht. Methoden, S. 188 ff.; dazu auch für das 20. Jahrhundert Rohe, S. 192 f.
635 Vgl. dazu die zu Wort kommenden Stimmen Lohlker, Islamisches Recht. Methoden, S. 187 ff.; siehe auch Rohe, S. 176 ff. und 189 ff.
636 Vgl. Ferchl, Ferchl, Dieter, Einleitung, Stuttgart, 2013 (1991), S. 11 ff.
637 Zu den Diskussionen über ihre Zulässigkeit als Erkenntnisquelle, gerade im Hinblick auf ihre teils fragliche Authentizität, vgl. Rohe, S. 52 f., Lohlker, Islamisches Recht. Methoden, S. 82 ff.
638 Vgl. Rohe, S. 56.
639 Siehe dazu Al-Buhärä, S. 242-375, 447-462, 447-462, 472-483.
640 Rohe, S. 48. "
641 Zur wohl auf asch-Schafi 'ä zurückgehenden „Lehre von den vier Wurzeln“, Koran, Sunna, Qijäs und Ijma siehe auch Wesel, S. 695 f.
642 Rohe, S. 9.
643 Lohlker, Islamisches Recht. Methoden, S. 101.
644 Vgl. Khorchide, S. 73 ff.
645 Die Fuqaha ‘ sind also die Gelehrten des Fiqh. Dieses Wort kann je nach arabischem Dialekt auch anders vokalisiert sein, hier wird der in nicht-arabischen Werken üblichen Übertragung gefolgt
646 Zu beidem vgl. Lohlker, Islamisches Recht. Methoden, S. 16; siehe auch Rohe, S. 12 m.w.N.
647 Lohlker, Islamisches Recht. Methoden, S. 9, 15 f. und 41 f. m.w.N. Die dort von Deleuze und Guattari übernommene Metapher ist wohl botanisch nicht ganz korrekt. Konkret mag etwa ein gigantisches Ingwer-Rhizom das Bild verdeutlichen.
648 Lohlker, Islamisches Recht. Methoden, S. 15 m.w.M.
649 Ebd., S. 15 f.
650 Arabisch im Singular (hukm), Plural ^IX».| (ahkam).
651 Vgl. Khorchide, S. 79.
652 Siehe dazu auch die Anmerkungen oben in Fn. 518 und 579.
653 Vgl. oben Fn. 393
654 In der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Dezember 2007 (BGBl. I S. 2840), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 1. Oktober 2013 (BGBl. I S. 3714).
1 Dazu Zoglauer, S. 21, 35, 72.
2 Zu den Merkmalen der Aussagen siehe ebd., S. 22.
3 Formal: —(p ? —p), siehe ders., S. 48; eine andere Formulierung, die im Ergebnis dasselbe aussagt wählen etwa Schneider/Schnapp, S. 90: „Zwei einander widersprechende Urteile können nicht beide wahr sein"
4 Formal: p V —p, siehe Zoglauer, S. 48; eine andere Formulierung: „[...] zwei einander widersprechende Urteile [können] nicht beide falsch sein [...]“ bei Schneider /Schnapp, S. 94
5 Vgl. dazu Zoglauer, S. 67 — das hiesige orientiert sich an dem dortigen, klassischen Beispiel, in welchem die Existenz und gleichzeitige Nicht-Existenz Sokrates in die Konsequenz mündet, dass ein Stock in der Ecke steht.
6 Zu dieser Schlussfigur siehe ebd., S. 66.
7 Vgl. ebd., S. 67; dieser ist nicht zu verwechseln mit Modus Ponens oder Modus Tollens, die Gegenstück des jeweils anderen sind, als Schlussfiguren denen eine Implikation zugrunde liegt, zu diesen beiden siehe ebd., X. 60 ff.
8 Vgl. Zoglauer, S. 65.
9 Vgl. ebd., S. 135.
10 Zoglauer, a.a.O., S. 22.
11 Zoglauer, a.a.O., S. 22.
12 Schneider/Schnapp, S. 24.
13 Zur Begriffsbestimmung vgl. Schneider/Schnapp, S. 24 ff.
14 Zoglauer, S. 14.
15 Eine Idee mit langer Tradition, als ein Verweis auf die Debatte siehe ebd., S. 117 m.w.N.
16 Schneider/Schnapp, S. 95.
17 Referenzen zum Satz und zum Weltbegriff.
18 Referenzen zum Individualismus.
19 Referenzen.
20 Referenzen.
21 bei Schopenhauer u.ä.?
22 Quelle.
23 Dazu Zoglauer, S. 72 ff.
24 Ebd., S. 72.
25 Vgl. ebd., S. 87.
26 Ebd., S. 116 ff.
27 Von „'Parallel-Universen'“ zu sprechen ist demnach Unsinn, wenn auch allgemeinverständlich, wie bei Zoglauer, S. 117 m.w.N. Besteht jedoch die Möglichkeit mehrerer paralleler physischer Welten (mindestens einer weiteren, in der unsere existieren kann), ohne selbst einer Existenzbedingung zu unterliegen, oder ist eine Konstellation denkbar, die etwas wie einen »Existenz-Zirkelschluss« aller Welten nahelegt, und soll die Benennung dieser physischen Welten auf Begriffe der Logik rekurrieren, so würde sich besser noch die Bezeichnung 'Partikel' anbieten, oder 'Partikularium'.
28 Referenz.
29 Vgl. Zoglauer, a.a.O., S. 135 f.
30 Dazu und zum nachfolgenden Absatz siehe Zoglauer, S. 135
31 Ebd., S. 135 f.
32 Ähnlich ebd., S. 23.
33 Dazu siehe ebd., S. 79 f.
34 Zur Entscheidbarkeit siehe ebd., S. 109.
35 Dazu und zur folgenden Operatorenumwandlung siehe Zoglauer, S. 136
36 Ebd., S. 136.
37 Für entgegengesetzte Urteile vgl. Schneider/Schnapp, S. 79 ff.
38 Vgl. Zoglauer, S. 136.
39 Siehe ebd., S. 38 ff.
40 Vgl. Zoglauer, S. 137.
41 Dazu ebd., S. 136 f.
42 Vgl. ebd., S. 145 f, 149; als weitere Möglichkeiten stehen freilich, wie an letzter Stelle genannt, die Anerkennung deontischer Widersprüche und die Aufgabe der Normenlogik schlechthin zur Wahl.
43 Vgl. ebd., S. 146 f.
44 Ebd., S. 147.
45 Vgl. ebd., S. 147.
46 Siehe Luhmann, Einführung in die Systemtheorie, S. 40.
47 Einen Überblick über die Grundlage seines Konzeptes bietet Luhmann in Luhmann, Einführung in die Systemtheorie, S. 40-63.
48 Zu Religion siehe etwa ders., Das Recht der Gesellschaft, S. 489, Anm. 105 sowie Corsi, Corsi, Giancarlo, Frankfurt a. M., 1997, S. 156 ff.; zu Moral siehe erneut dies., Corsi, Giancarlo, Frankfurt a. M., 1997, S. 119 ff., zu Politik und Recht siehe Luhmann, Das Recht der Gesellschaft, S. 35, S. 418 ff.; ders., Legitimation durch Verfahren, S. 151, auch Baraldi, Baraldi, Claudio, Frankfurt a. M., 1997, S. 135 ff. sowie Corsi, Corsi, Giancarlo, Frankfurt a. M., 1997, S. 147 ff.
49 Vgl. Luhmann, Einführung in die Systemtheorie, S. 44.
50 Ebd., S. 43.
51 Vgl. ebd., S. 90.
52 Vgl. ebd., S. 115 m.w.N.
53 Vgl. ebd., S. 96, 116 ff.
54 Dazu ders., Einführung in die Systemtheorie, S. 65 und 90 f. siehe auch Esposito, Esposito, Elena, Frankfurt a. M., 1997, S. 195 ff.
55 Luhmann, Einführung in die Systemtheorie, S. 64.
56 Ebd., S. 74.
57 Luhmann, Einführung in die Systemtheorie, S. 73.
58 Ebd., S. 74 ff.
59 Ebd., S. 75.
60 Ebd., S. 75.
61 Ebd., S. 63 und 106 m.w.N.
62 Ebd., S. 107.
63 Ebd., S. 99.
64 Ebd., S. 97.
65 Ebd., S. 98.
66 Ebd., S. 98.
67 Ebd., S. 115.
68 Luhmann, Einführung in die Systemtheorie, S. 98 ff.
69 Zur Identität von Operation und Struktur siehe ders., Das Recht der Gesellschaft, S. 49
70 Ders., Einführung in die Systemtheorie, S. 137.
71 Ebd., S. 137.
72 Luhmann verweist auf Erkenntnisse der Computertechnik seit ihren Ursprüngen in den 1950er Jahren, ebd., S. 137
73 Ebd., S. 139 f.
74 Luhmann, Einführung in die Systemtheorie, S. 140 m.w.N.
75 Ebd., S. 141.
76 Vgl. Esposito, Esposito, Elena, Frankfurt a. M., 1997, S. 123.
77 Vgl. dies., Esposito, Elena, Frankfurt a. M., 1997, S. 150; siehe auch Luhmann, Das Recht der Gesellschaft, S. 16.
78 Zu diesem und dem Folgenden siehe ders., Einführung in die Systemtheorie, S. 94
m.w.N.
79 Ebd., S. 142.
80 u
81 Vgl. Luhmann, Einführung in die Systemtheorie, S. 75 f. und 281.
82 Ebd., S. 250.
83 Dazu ebd., S. 142 f.
84 Vgl. ebd., S. 114 f.
85 Vgl. Luhmann, Einführung in die Systemtheorie, S. 116.
86 Vgl., auch zum folgenden Absatz, ebd., S. 116 f.
87 Zur Bestimmung des Informationsbegriffs siehe ebd., S. 123 f.
88 Vgl. Luhmann, Einführung in die Systemtheorie, S. 90.
89 Als Andeutung zur philosophischen Tragweite des Begriffs des Reentry siehe ebd., S. 161; zu einer allgemeinen Erläuterung siehe Esposito, Esposito, Elena, Frankfurt a. M., 1997, S. 152 ff.
90 Vgl. ebd., S. 180; zur Abgrenzung der Sprache von „System, Operation, Handlung“ siehe Luhmann, Einführung in die Systemtheorie, S. 264 ff.
91 Ders., Einführung in die Systemtheorie, S. 217; siehe auch Corsi/Esposito, Corsi, Giancarlo /Esposito, Elena, Frankfurt a. M., 1997, S. 58 f.
92 Luhmann, Einführung in die Systemtheorie, S. 218.
93 Vgl. Esposito, Esposito, Elena, Frankfurt a. M., 1997, S. 180.
94 Vgl. Luhmann, Einführung in die Systemtheorie, S. 189 und 193; Esposito, Esposito, Elena, Frankfurt a. M., 1997, S. 33 f.
95 Vgl., auch zum Nachfolgenden, dies., Esposito, Elena, Frankfurt a. M., 1997, S. 34.
96 Ebenda.
97 Vgl. Luhmann, Das Recht der Gesellschaft, S. 189 f. Esposito, Esposito, Elena, Frankfurt a. M., 1997, S. 139.
98 Auch von Luhmann häufig selbstkritisch betont, vgl. u.a. Luhmann, Das Recht der Gesellschaft, S. 24
99 Zum Zeitbegriff siehe Luhmann, Einführung in die Systemtheorie, S. 190 ff.
100 Zur Selbstreferenz siehe eingehend bei Corsi, Corsi, Giancarlo, Frankfurt a. M., 1997, S. 163.
101 Zu 'Welt' als „Einheit der Differenz von System und Umwelt“ siehe dies., Corsi, Giancarlo, Frankfurt a. M., 1997, S. 205; zur „Differenzierung“ siehe Baraldi, Baraldi, Claudio, Frankfurt a. M., 1997, S. 26 ff.
102 Corsi, Corsi, Giancarlo, Frankfurt a. M., 1997, S. 208.
103 Siehe oben S. 160.
- Arbeit zitieren
- Jochen Heller (Autor:in), 2014, »Islamisches Recht« im deutschen Schiedsgerichtsverfahren?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/282180
Kostenlos Autor werden


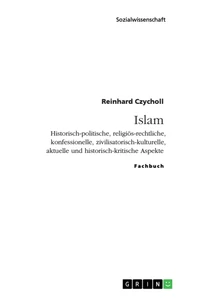















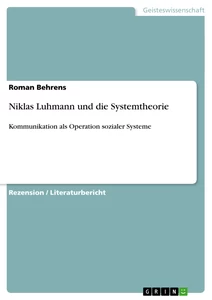
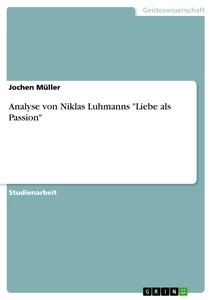
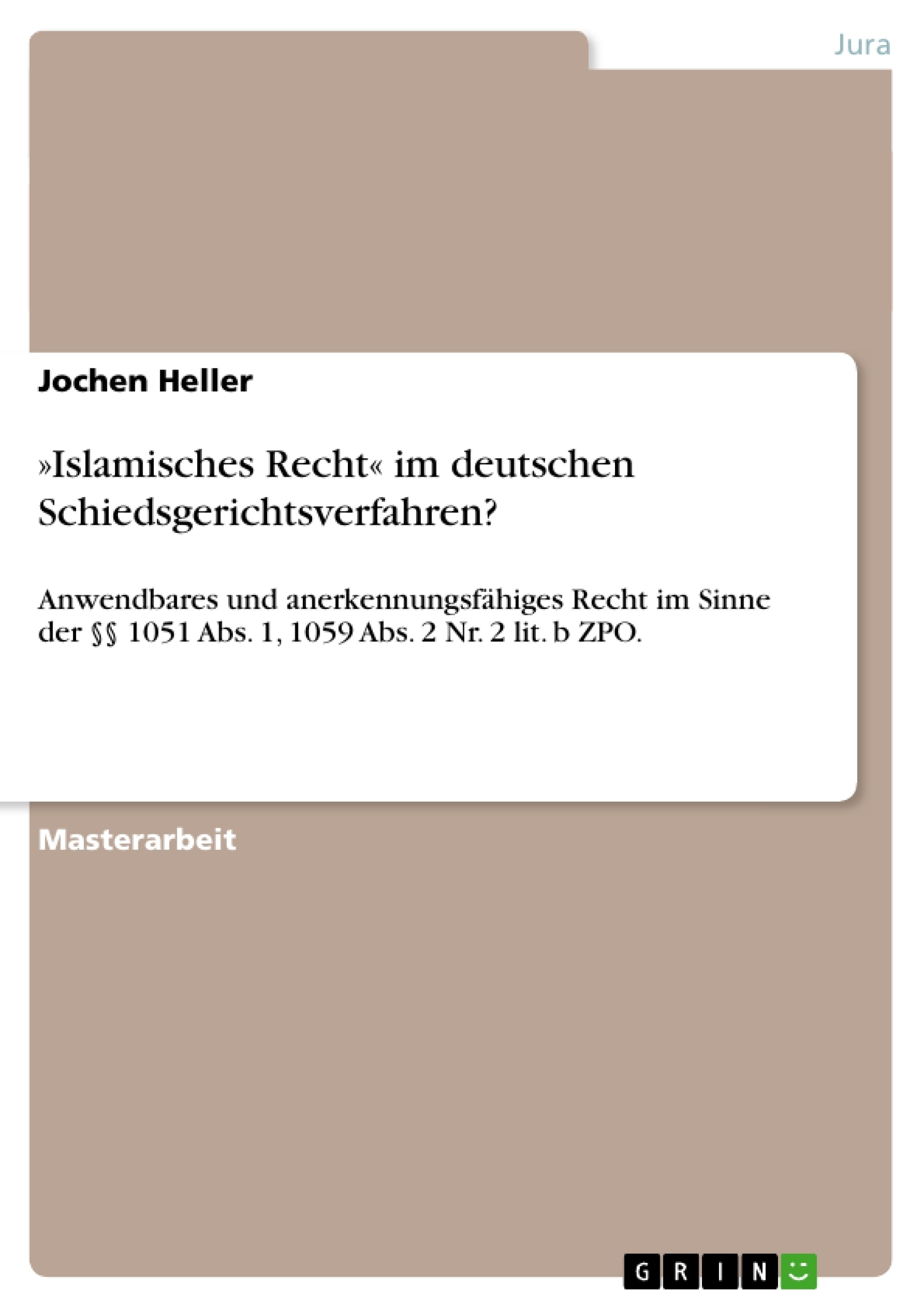

Kommentare