Leseprobe
INHALTSVERZEICHNIS
1. Einleitung
2. Was ist ein Musikvideo? Begriffsbestimmung
3. Die historische Entwicklung der Musikvideos
3.1. Von den historischen Vorläufern bis zur Herausbildung der Musikvideos
3.1.1. Frühe Formen der Verbindung von Ton und Bild und der Diskurs über die Beziehung beider Elemente zueinander
3.1.2. Die visuelle Musik
3.1.3. Einflüsse aus den Bereichen des kommerziellen Kinos und der Musik
3.1.4. Von den ersten Videoclips bis zu MTV
3.2. Die Musikkanalentwicklung
3.2.1. Der Werdegang von MTV
3.2.2. Musikvideos im deutschen Fernsehen
3.2.3. Musikvideos im Jahr 2003
3.2.4. Ausblick
4. Die Analyse der Musikvideos
4.1. Das Klassifizierungsmodell nach Michael Altrogge
4.1.1. Der Musik-Aspekt und die drei Musikstile
4.1.2. Die Darstellungsebenen
4.1.2.1. Die reine Performance
4.1.2.2. Die Konzeptperformance
4.1.2.3. Konzept mit Interpreten
4.1.2.4. Konzept ohne Interpret
4.1.2.5. Die Ausnahmen
4.1.3. Visuelle Binnenstruktur
4.1.4. Rahmenbedeutungen der externen Bilder
4.2. Zur Auswahl und ihrer Begründung
4.3. Die Beschreibung der Musikvideos
4.3.1. Die Videoauswahl 1987
4.3.1.1. Vanessa Paradis - Joe le Taxi
4.3.1.2. Boy George - Everything I Own
4.3.1.3. Black - Wonderful Life
4.3.1.4. George Harrison - I Got My Mind Set on You
4.3.1.5. Samantha Fox - Nothing’ s Gonna Stop Me Now
4.3.1.6. Kim Wilde - You Keep Me Hangin’ on
4.3.1.7. Peter Gabriel - Big Time
4.3.1.8. Hot Chocolate - You Sexy Thing
4.3.1.9. Iggy Pop - Real Wild Child
4.3.2. Die Videoauswahl 2003
4.3.2.1. Oasis - Songbird
4.3.2.2. 50 Cent - In da Club
4.3.2.3. B2K featuring P. Diddy - Bump, Bump, Bump
4.3.2.4. Missy Elliot - Gossip Folks
4.3.2.5. Curse - Hand hoch
4.3.2.6. Moloko - Familiar Feeling
4.3.2.7. Holly Valance - Naughty Girl
4.3.2.8. Placebo - Bitter End
4.3.2.9. Good Charlotte - Lifestyle of the Rich and Famous
4.4. Vergleich der ausgewählten Videos von 1987 und
4.5. Die Überprüfung der Thesen
4.6. Es bleibt alles anders - Die Ergebnisdiskussion
Anhang
Literaturverzeichnis
1. EINLEITUNG
Am Anfang war der Ton. Der macht die Musik und diese die Menschen glücklich - zeitweilig zumindest. Denn nicht in der Musik allein liegt die Begründung für die Faszination, die Musikvideos ausüben. Jeder, der beim Zapping zum ersten Mal über einen Musikvideokanal stolpert, bleibt unwillkürlich hängen. Schnell, bunt und laut kommen die mehrminütigen kleinen Beiträge, die einen Star und seinen Song preisen, daher. Oftmals für das ungeübte Auge kaum zu entschlüsseln. Was ist die Botschaft? Worum geht es? Was will mir der Künstler damit sagen? - „Kaufe meine Platte! Kaufe meine Platte!“ hört man sie zwischen den Bildern flüstern. Für Stars, Sternchen und ihre Macher ist Musik nicht nur Spaß, Erfüllung und Ruhm, sondern vor allem Broterwerb. Musikvideos sind ebenso essentiell wie Konzerttouren und Fernsehshowauftritte. Sie sichern die Verbreitung des Produktes, erhöhen im besten Fall (heavy rotation) die Beliebt- und Bekanntheit des Interpreten und seine Verkaufszahlen.
Jede Liedermacherin mit Gitarre, jede Boy- oder Girlgroup, jeder Gangster-Rapper und jeder Alternative-Rocker braucht heute ein passendes Video, das ihre oder seine Präsenz auf einem Musik- kanal und in den Köpfen der Zielgruppe sichert. Möchte man im Musikbusiness Karriere machen, dann muss man sich an diese einfache Regel halten. Kein Clip, kein Erfolg. Also entstehen Jahr für Jahr tausende Videos für große und kleine Stars. Wen wundert es da, dass Kritiker eine Vereinheitlichung beklagen? Die meisten Musikvideos sind nur für wenige Wochen auf den Bild- schirmen zu sehen, die allerwenigsten schaffen es zum Clipklassiker und werden auch nach Monaten oder Jahren noch ausgestrahlt. Den Beteiligten bleibt, auch in Anbetracht der Tatsache, dass Videos selten länger als vier Minuten dauern, wenig Zeit, das Image einer Musikerin, eines Musikers oder einer Band so zu vermitteln, dass die jungen Zuschauer sich dadurch angesprochen fühlen und bestenfalls einen Kaufwunsch entwickeln. Das schmale Zeitfenster beschränkt Art und Tiefe der Dar- stellung.
Um das Format Musikvideo verstehen zu können, gilt es mehr als nur eine seiner Facetten zu beleuchten. Zwar sind vor allem musikindustrielle Faktoren von Belang, da Musikclips nichts anderes als Werbung für einen Titel und dessen Interpreten darstellen, aber sie sind nicht die einzig bedeutungsvollen Kriterien einer Beurteilung. Für das Erscheinungsbild der Videos sind jugendkulturelle Aspekte genauso ausschlaggebend wie bestimmte Entwicklungen auf dem Gebiet der Medien- und Musikgeschichte. Die viel besprochene Clipästhetik hat sich nicht über Nacht herausgebildet - zum Status Quo haben unterschiedliche Medienformen beigetragen. Und immer wieder kommen ökonomische Überlegungen ins Spiel. So hat beim Entstehen des ersten Musikkanals maßgeblich wirtschaftliches Kalkül seitens der Fernsehkanalbetreiber eine Rolle gespielt.
Natürlich kann die vorliegende Arbeit nicht all diesen Aspekten gleichermaßen gerecht werden, obschon stets versucht wird, auf das komplexe Zusammenspiel der Einflussfaktoren hinzuweisen. Dazu wird zunächst den Ursprüngen der Verbindung von Bild und Musik auf den Grund gegangen und die Entwicklung der Beziehung beider Elemente verfolgt. Einflüsse aus der Filmkunst, aber auch aus dem Bereich des kommerziellen Kinos finden ausführliche Beachtung. Hier reiften die Sujets und Techniken heran, die später Bestandteile der Musikvideos wurden.
Frühe clipähnliche Formen finden sich bereits Ende der 40er Jahre, aber erst die Situation des Musik(show)markts und die Entstehung des Kabel- und Satellitenfernsehens führten schließlich Anfang der 80er Jahre zum Sendestart des ersten Musikkanals. Der Werdegang von MTV wird genauso beleuchtet wie der des deutschsprachigen Pendants. VIVA beliefert Jugendliche hierzulande seit Anfang der 90er Jahre auch mit lang vermissten Videos nationaler Künstler und Künstlerinnen. Gerade in diesen Abschnitten wird deutlich, wie sehr das Auftreten der Sender und die Auswahl der Musikclips durch wirtschaftliche Überlegungen beeinflusst sind.
Dagegen beschäftigt sich der folgende Untersuchungsteil der Arbeit vornehmlich mit dem Erschei- nungsbild der Videos. Es wird versucht zu ergründen, inwieweit sich Musikvideos in den letzten Jahren verändert haben. Schaltet man heute einen Musiksender ein, dann stellt man fest, dass sich hier einiges getan hat. Nicht nur, dass die ursprüngliche Programmeinheit Musikvideo immer öfter zugunsten anderer Inhalte zurücktritt - auch sie selbst hat ein anderes Gesicht bekommen. Die Ermittlung der Modifikationen erweist sich als nicht ganz einfach. Musikvideos haben, genau wie andere Medienformate auch, eine Entwicklung durchlebt, die deutlich geprägt ist von technischen Innovationen, die natürlich einen starken Einfluss auf das Aussehen der Videos hatten. Doch was für clipspezifische Veränderungen gab es, die nicht unbedingt in Zusammenhang damit stehen? Ist die Vermutung begründet, dass, obwohl sich die äußere Hülle offenkundig beträchtlich gewandelt hat, die innere Struktur der Videos dieselbe geblieben ist? Für Werbemaßnahmen, zu denen Musikvideos gehören, besteht eine Notwendigkeit, das Produkt, in dem Falle den Star, auf eine vorteilhafte Art und Weise abzubilden - damals genauso wie heute.
Die Fachliteratur gibt über die Entwicklung der Videoclips nur bedingt Auskunft. Es finden sich zwar viele Videobeschreibungen und -analysen, doch werden meist nur punktuelle Untersuchungen betrieben.1 Vereinzelt tragen Autoren Beobachtungen bezüglich der Veränderungen zusammen, die aber nicht aus wissenschaftlichen Gegenüberstellungen resultieren.2
Um sich über subjektive Eindrücke hinwegzusetzen und eine genaue Musikvideountersuchung durchzuführen, ist ein Analyseinstrument erforderlich, das es erlaubt, die Vielfalt der Clips unter einen Hut zu bringen. Hier bietet das Klassifikationsmodell von Altrogge ein praxiserprobtes Hilfsmittel.3 Mit diesem ist es möglich, die verschiedenen Musikvideoaspekte (das Dargestellte und die Art der Darstellung) vereinheitlicht zu betrachten um so am Ende Aufschluss über den Gestaltwandel der Clips zu erhalten.
2. WAS IST EIN MUSIKVIDEO? BEGRIFFSBESTIMMUNG
Musikvideo bedeutet „ich sehe Musik“4, und zwar nicht nur im wörtlichen, sondern auch im übertragenen Sinn. Auf der einfachsten Ebene steht der Begriff für die Verbindung eines Audio-Parts mit einem visuellen Element, von Tonkunst und bewegten Bildern, wobei der musikalische Teil gekennzeichnet ist durch einen Lied-Charakter. Es handelt sich um eine abgeschlossene musika- lische Einheit, einen Song nach musikindustriellem Verständnis. Hier liegt ein erster Unterschei- dungspunkt zu anderen Videoarbeiten, in denen eine Verbindung von Musik und Bild vollzogen wird, die deswegen aber noch keine Musikvideos sind.5 Der zweite Teil des Wortes legt die Vermu- tung nahe, dass die Produktion und Distribution dieser Medienform mittels analoger Videotechnik vollzogen wird. Dies ist aber nur bedingt der Fall. Burns beschreibt den regulären Ablauf so: „[…] most music videos are shot on film, edited and distributed on videotape, and shown on television.“6 Das bedeutet absurderweise, dass der Rezipient, auf den das Video abzielt, normalerweise nicht mit irgendeiner Art von Bandmaterial in Berührung kommt.
Bezüglich der Entstehungsreihenfolge der beiden Wortkomponenten lässt sich Folgendes festhalten: Die Songkomposition geht der Videoherstellung voraus, die Bilder folgen der Musik. Dies ist ein wei- teres Merkmal, durch das sich Musikvideos von anderen vertonten Videoproduktionen absetzen. Ob- wohl die Bebilderung mit dem Stück nicht zwangsläufig in inhaltlichem Zusammenhang stehen muss, ist das Lied gleichsam ordnungsstiftend für die Visualisierung. Zum einen bieten sein Rhyth- mus, seine Form und sein Sound die Grundordnung für den Aufbau des Videos7, zum anderen geschieht über den Song die Einstufung des Clips in ein bestimmtes Musik-Genre.8
Für die unterschiedlichen Stilrichtungen gibt es mehr oder weniger typische Regelmäßigkeiten ästhetischer und inhaltlicher Natur. Zu letzteren kann man allgemein formulieren, dass Musikvideos ein Schaufenster für die Träume und Alpträume der Jugend sind. Substantiell beziehen sie sich auf „kollektiv (zum Teil auch unbewusst) vorhandene Traumvisionen, Wünsche und mythische Bilder.“9 Dabei werden immer wieder vorgebrachte zentrale Themen der Menschheit wie Liebe und Hass, Gewalt und Tod, Körper und Spaß usw., gepaart mit aktuellen Strömungen und Befindlichkeiten der Pop- und Jugendkultur. Aussagen über das Erscheinungsbild von Musikvideos zu machen, die tatsächlich auf alle Clips oder wenigstens einen großen Teil zutreffen, ist allerdings etwas schwieriger. In einer Besprechung der ästhetischen Eigenheiten der Videoclips von Siebers ist ein Punkt angeführt, der dafür eine Erklärung gibt. Er betrifft die „[…]Benützung sämtlicher nur denkbarer visuellen Stile und Traditionen.“10 In Anbetracht der Tatsache, dass die meisten Publi- kationen sich an dieser Stelle einig sind, und gerade das ja auch einer der Gründe für die Attribu- tierung des Musikvideos als postmoderner Text ist, soll an dieser Stelle nicht versucht werden, mit verwaschenen Formulierungen wie „schnell“, „bunt“, „schrill“, „ausgefallen“ eine allgemeingültige Beschreibung zu finden. Stattdessen sei auf das Kapitel über den historischen Werdegang der Videoclips verwiesen, in dem versucht wird, die verschiedenen Einflüsse auf das Erscheinungsbild darzustellen. Die Ästhetik betreffend sei lediglich bemerkt, dass sich zu der Stilvielfalt oft eine über- durchschnittliche Techniknutzung (z.B. Spezial-Effekte) und eine Vorliebe für exotische, exzentrische Schauplätze und Darsteller gesellen.11 Auch lässt sich eine gewisse Prädominanz der Montage gegenüber den Bildern nicht leugnen, häufig verbunden mit einer verhältnismäßig hohen Schnitt- frequenz.12
Etliche Autoren verweisen bezüglich der Ästhetik von Musikvideos auf eine Orientierung an der Werbung.13 Das kommt nicht von ungefähr. Immerhin ist es oberstes Kommunikationsziel der Video- clips, für den jeweiligen Song und den damit verbundenen Tonträger zu werben. Aber nicht nur dafür macht das Produkt Reklame. Längerfristig ist der Aufbau eines Star-Images von großer Bedeu- tung, weshalb die Vermittlung der (angedachten und aufgebauten) Persönlichkeit des Pop-Sterns ebenfalls ganz oben auf der Liste der wesentlichen Informationsübertragung steht. Die Botschaften, die dafür transportiert werden, fußen zu einem großen Teil im Wertesystem der adoleszenten Lebensart. In diesem Punkt der jugendkulturellen Verwurzelung unterscheiden sich Musikvideos von reiner Produktwerbung.
Die Starinszenierung ist nötig, um über den Song, dem das Musikvideo gilt, hinaus Interesse auch für alle anderen Tonträger, Konzerte und Fanartikel des Musikers, der Musikerin, der Band zu wecken - auch dafür wirbt ein Clip. Nicht zu vergessen gibt es eine Promotionwirkung auf einer tertiären Ebene, die die Musik desselben Genres, das Image und den Lifestyle einer musikalischen Subkultur, inklusive Kleidungsmodalitäten, Szenemagazine, bestimmte Musikfernseh-Sendungen u. Ä. betrifft.14 Der Werbeaspekt des Musikvideos ist demnach von immenser Bedeutung, ist er doch überhaupt der Grund für die Produktion der Clips. In der einschlägigen Literatur findet er aber nicht immer Eingang in die Musikvideo-Definition.15 Bei Quandt findet sich eine Definition, die alle bisher genannten Punkte zusammenfasst und die deshalb die Erläuterungen der Merkmale und Eigenheiten abrunden soll:
„Ein Musikvideo ist eine mit Hilfe technischer bzw. elektronischer Mittel hergestellte vorproduzierte Verbindung von Bildern und Musik, deren musikalische Komponente ein einzelnes Musikstück umfasst und deren Vermittlung und Rezeption über audiovisuelle Medien abläuft.“16 Quandt ergänzt seine vorläufige Definition: „Musikvideos dienen zunächst Werbezwecken, kommunizieren darüber hinaus aber in Bild und Ton enthaltene ‚Botschaften’ (im weitesten Sinne) und vermitteln Informationen, die von jugendkultureller Bedeutung sein können.“17
Seit der Entstehung von Musikvideos, gibt es Versuche, die unterschiedlichen Clips auf irgendeine Weise zu kategorisieren. Die dafür entwickelten Konzepte beschäftigen sich zumeist mit inhaltlichen und/oder musikstilistischen Gesichtspunkten. Infolge des Umstandes, dass musikalische Strömungen oftmals auch durch eine geringe Lebensdauer gekennzeichnet sind, scheint es allerdings sinnvoll, sich bei einer Klassifizierung nicht darauf zu beziehen. Und so haben sich in der Tat Gliederungs- systeme durchgesetzt, die stattdessen Gestaltungskonzepte und Dargestelltes thematisieren.
Üblicherweise kommt es dabei zu einer groben Aufteilung in drei Gruppen.18 Das sind zum einen Performance-Clips, in denen die musikalische Darbietung durch die Interpreten im Vordergrund steht; des Weiteren narrative Musikvideos, die um die Musiker oder Liedtexte eine Geschichte entwickeln, und nicht zuletzt Konzept-Videos, die Bild und Musik auf eine assoziativ-illustrative Weise miteinander verbinden. Diese Formen bestehen sowohl in der hier beschriebenen Reinform als auch in (Ver-)Mischungen. Sehr häufig wird in Musikvideos beispielsweise eine Story erzählt, während zwischen den narrativen Szenen Musiker bei der Ausübung ihres Berufs zu sehen sind.
Im Kapitel 4.1. wird Altrogges Klassifikations-Konzept vorgestellt, das anhand der Analyse der Darstellungsebenen und der visuellen Binnenstruktur eine ausführlichere Einordnung von Musikvideos möglich macht.
Zuletzt bleibt zu erwähnen, dass es neben dem Begriff Musikvideo noch einige andere Bezeich- nungen gibt, die synonym verwendet werden. So benutzt man im Deutschen häufig die Kurzform Video oder aber auch Videoclip bzw. Video-Clip.19 In Nordamerika ist Rock-Video, entstanden in den Anfangsjahren von MTV, ein durchaus noch gängiger Begriff. Lange Zeit beliebt im englisch- sprachigen Raum war die Formulierung Promo (als Abkürzung für Promotional Video). Aber sowohl in den USA als auch in Großbritannien ist heute ebenfalls Music Video der gebräuchlichste Term.
3. DIE HISTORISCHE ENTWICKLUNG DER MUSIKVIDEOS
Musikvideos gibt es in ihrer heutigen Form seit gut 30 Jahren. Zu ihrer Entstehung kam es nicht zufällig: Mehrere miteinander verwobene technische, künstlerische und musikalische Umstände und Geschehnisse haben dazu beigetragen, dass Musikvideos zu einer populären, aber auch umstrittenen Medienform avancierten. Ziel der folgenden Ausführungen ist, die Entwicklungsge- schichte der Musikvideos, mitsamt ihren Wegbereitern und Pionieren, aufzuzeigen, ohne sich mit der einfachen Aufzählung von Fakten zu begnügen; vielmehr sollen die komplexen Zusammenhänge der Entstehungsbedingungen aufgeschlüsselt werden, um so das Phänomen Musikvideo, besonders aber seine ästhetischen und musikwirtschaftlichen Facetten, verstehen zu können.
Bei der Beschäftigung mit der historischen Materie stellt man schnell fest, dass von Anfang an zwei große Unterscheidungen zu treffen sind: Erstens sind Musikvideos und Musiksender klar von einander zu trennen. Dass scheint nur zu logisch, handelt es sich doch bei dem einen um das Produkt und dem anderen um die Plattform, auf dem dieses Produkt angeboten wird. Nimmt man es mit dieser Gegenüberstellung nicht so genau, kann das in der Folge zu Unklarheiten führen. Der Blick auf den Zeitstrahl der geschichtlichen Abläufe offenbart eine zweite große Aufspaltung: In die Perioden vor und nach 1981, dem Geburtsjahr von MTV. Mit dem Sendestart des ersten Musikkanals beginnt eine neue Ära, in der Musikvideos sich zu einer eigenständigen und anerkannten Medienform entwickeln - nicht nur bei den Zuschauern, sondern auch bei Wissenschaftlern, die sich seitdem ernsthaft mit dem Format auseinandersetzen.20
Seit der „Non-stop-Rock-around-the-Clock“-Etablierung von Musikvideos auf den Fernsehschirmen hat sich deren Form und Erscheinung gefestigt; Regelmäßigkeiten stellten sich ein und erlaubten einen griffigeren, leichteren Umgang mit der Materie.
Doch bis dahin war es ein weiter Weg, von dem man heute nicht sagen kann, wo genau er seinen Anfang nahm. Der Zeitstrahl der Musikvideo-Entwicklung hat keinen fest datierten Ursprung. Grund sind die unterschiedlichen Wurzeln, aus denen die Clips rühren: Sprösslinge aus den Bereichen Kunst, Technik und natürlich Musik. Die Einstufung Peter Weibels, der Musikvideos als ein „[…]Hybrid von Avantgarde- und Werbefilm, von Musikfilm und Bühnenbild, von Computergrafik und Lasereffekten, von Film und Video, von High-Technology und Low Performance, von Kunst und Kommerz, von Visual Music und Psychedelia, von Comics, Cartoons und Kinematographie, von Design und Make-up, von Licht, Tanz, Musik, Körper, von Modefotografie, von Broadway-Ballett und digitalen Effekten […]“21 bezeichnete, lässt die zu beleuchtende Mannigfaltigkeit der Einflüsse erahnen.
Dieses Kapitel unterteilt sich - den beiden genannten Splittungen Rechnung tragend - in zwei Abschnitte: Der erste befasst sich mit den historischen Vorläufern der Musikvideos, deren Herausbildung und Entwicklung bis zum Sendestart MTVs, während sich der zweite Teil vor allem den Musikkanalsendern und den Geschehnissen ab 1981 zuwendet.
3.1. Von den historischen Vorläufern bis zur Herausbildung der Musikvideos
3.1.1. Frühe Formen der Verbindung von Ton und Bild und der Diskurs über die Beziehung beider Elemente zueinander
Das Musikvideo ist die heute populäre Form der Verbindung von musikalischem Ton und bewegtem Bild. Es ist nicht der erste Versuch der Menschheit, sich ihren Wunsch nach Visualisierung von Musik zu erfüllen. Vielmehr markiert das Musikvideo den aktuellen Endpunkt dieser Bestrebungen, die schon sehr zeitig begannen.
Überlieferte Schöpfungsmythen verschiedener Kulturen zeigen, dass der Traum vom bebilderten Schall bis in die Frühgeschichte zurückreicht. So glaubten die Ägypter, dass die Welt durch den Lichtschrei einer singenden Sonne erschaffen wurde, die Inder sprachen in ihren brahmanischen Mythen von leuchtenden und klingenden Wesen als ersten Menschen.22 Im alten China wurde man bereits konkreter und fand für die Zusammenführung von Sehen und Hören einen eigenen Begriff: das Ohrenlicht. 23
Das Verbinden von Musik, Gesang und Darstellung - ob am Lagerfeuer nach der Jagd, beim Dorffest oder bei Familientreffen - ist eine alte Tradition. Es führte in unterschiedlichen Zivilisationen zur Herausbildung von spezifischen Volks- und Ritualtänzen. Dieser Umstand deutet darauf hin, dass Musik ursprünglich immer visuell war, „[…] die Gestik der Musikanten, die Bewegungen, der Tanz, all das gehört zum volkstümlichen Musizieren einfach dazu.“24 Der Sinn liegt in der Illustrierung der auditiven Vorführung.
Offenbar geht von optischen und akustischen Ereignissen eine große Faszination aus. Daniels konstatiert: „Das Publikum will vor allem viel Spektakel […]“25. Ein Beleg dafür ist die hohe Pop- ularität von Feuerwerken, Camera Obscura, Laterna Magica, Panorama, Kinetoskop, Mutoskop u. Ä. - notabene Formen der Illusionskunst zu deren Präsentation oftmals auch Musik dargeboten wurde.26 Der Wunsch nach solchen Spektakeln kann gleichsam als Motor für die Entwicklungen auf diesem Gebiet angesehen werden.
Den theoretischen Hintergrund lieferten Überlegungen zu der Beziehung zwischen Farbe und Ton, die sich bis in die griechische Antike zurückverfolgen lassen. Einmal mehr war es Aristoteles (384-322 v.Chr.) der hier Pionierarbeit leistete. Er entwickelte eine siebenteilige Farbfolge, die er analog zur Musiktheorie verstanden haben wollte.27 Das beruhte auf der Beobachtung, „[…] dass Farben - wie Musiknoten - in einer natürlichen Reihenfolge mit harmonischen Intervallen auftreten […]“28. Die Analogie-Entdeckung machte vor ihm bereits Pythagoras (569-475 v.Chr.), der sich allerdings in diesem Zusammenhang vorrangig mit den Zahlenverhältnissen in der Musik beschäftigte und so die Grundlagen der musikalischen Harmonielehre schuf.29 Die Erkenntnis der mathematischen Struktur der Intervalle geht auf ihn zurück. Die Farben- und Harmonielehren von Aristoteles und Pythagoras avancierten zum allgemeinen Bildungsgut und stellen den Ausgangspunkt für weitere Bemühungen in dieser Richtung dar.
Zu Zeiten der Renaissance war es unter anderem Leonardo da Vinci (1452-1519), der sich nicht nur mit der Farbe, sondern gleichfalls mit dem Ton beschäftigte. Er ist vermutlich auch einer der ersten gewesen, der farbiges Licht projizierte.30
Ein Bewunderer da Vincis, Giuseppe Arcimboldo (1527-1593), der sich als Künstler am Prager Hof von Rudolph II. verdingte, setzte seine Denkarbeit zu harmonischen Farbkombinationen in die Tat um und erfand zwei Farbmusik-Instrumente.31 Doch weder für seine perspektivische Laute noch für das grafische Cembalo liegen überlieferte Funktionsweisen vor. Ebenso wenig wie für die audiovisuellen Instrumente, von denen der Jesuiten-Pater Athanasius Kircher (1602-1680) aus geheimen antiken Quellen erfahren haben will.32 Dennoch kommt Kircher eine große Rolle zu, da er die Lichtreflexions- gesetze auf den Schall und die Tonintervalle auf die Farben transferierte.33 Auch er war fest davon überzeugt, dass jedem Tonintervall eine bestimmte Farbe entspräche und entwickelte eine Tabelle mit den jeweiligen Zuordnungen. Diese wiederum diente dem französischen Mathematiker Louis- Bertrand Castel (1688-1757) als theoretischer Ausgangspunkt für das o ptische Cembalo, welches er in einer ersten Fassung 1729 vorstellte.34 Dafür benutzte er ein herkömmliches Cembalo, welches er so umgebaut hatte, dass über ein Hebelsystem einer von 60 kleinen Vorhängen den Blick auf dahinter liegende Farbgläser freigab, sobald man eine Notentaste herunterdrückte. In einer weiter entwickel- ten Form des Clavecin oculaire von 1754 wurden die bunten Gläser von 500 durch Spiegel verstärkte Kerzen durchleuchtet. Castel erlangte mit dieser Attraktion große Anerkennung in seiner Zeit. Er reduzierte die Farbe-Tonintervall- auf die Farbe-Ton-Beziehung und schaffte gleichsam den Transfer auf die Kunst durch die Einführung einer Farbmusik.35
In der Wissenschaft wurde die Diskussion, durch Castel wieder in Schwung gebracht, weitergeführt. Vermehrt gab es auch kritische Stimmen, vor allem aus Deutschland. So verweist etwa der Natur- forscher Georg Wolfgang Krafft (1701-1754) auf die fehlenden Harmonien des optischen Cembalos und besteht auf der Unmöglichkeit der Überführung der musikalischen Intervalle auf die Farben.36 Und auch der Leipziger Philosophie-Professor Karl Heinrich Heydenreich (1764-1801), der sich in deutschen Gefilden am gründlichsten mit Farbe-Ton-Beziehungen auseinandergesetzt hatte, kommt zu diesem Schluss. Da sich die Diskussion inzwischen auf psychologische und physiologische Aspek- te verlagert hatte, ist es nicht verwunderlich, dass Heydenreich das Scheitern der Analogie v.a. mit emotionalen Positionen begründete: Farben würden vergleichsweise wenig Empfindungen hervor- rufen, schon gar keine Wiederempfindungen.37
In der Folgezeit schaffte Goethe (1749-1832) seinen Farbkreis, Philipp Otto Runge die Farbenkugel (1777-1810) und Arthur Schopenhauer (1788-1860) einen quantitativen Farbkreis. Diese Innova- tionen ließen die Diskrepanz in der Struktur von Farb- und Tonsystem noch deutlicher werden. Mit der Entdeckung der spektralen Absorptionslinien durch Joseph Fraunhofer (1787-1827) und den Erkenntnissen, die Hermann von Helmholtz (1821-1894) über die additive und subtraktive Mischung des Lichtes und der Farben erlangte, an die sich die Erklärung anschloss, dass für Farben die absolute Größe ihrer Schwingungsdauer wichtiger sei als das Verhältnis zu anderen Farben, während Töne ihren Charakter erst durch die Beziehung zu anderen Tönen erhalten, musste man sich endgültig eingestehen, dass „ein Vergleich zwischen sehbarem Licht und hörbarem Schall […] nicht mit einer konkreten Farbe-Ton-Beziehung in Einklang zu bringen [ist].“38 Obwohl die physikalischmathematische Analogie nun überholt ist, geht man bis heute von vielschichtigen Wechselwirkungen zwischen Musik und Bild aus. Ein Grund, weshalb die Faszination, die optische Musikinstrumente hervorriefen, weiterhin ungebrochen war.
Castels Clavecin oculaire fand ideenreiche Nachahmer, die seine Attraktion weiterentwickelten. Zwischen 1750 und 1900 entstanden etliche Farbklaviere nach unterschiedlich funktionierenden Prinzipien.
Am 20. März 1915 war in der New Yorker Carnegie Hall die Uraufführung des lang erwarteten „Le Poème du feu >Prométhée<“ zu sehen.39 Dieses Stück des russischen Komponisten Aleksandr Skrjabin (1872-1915), der diese erste Aufführung leider nicht mehr erlebte, wurde bereits in der Zeit von 1908-1910 durch ihn erarbeitet und enthielt nicht nur Partituren für Orchester und Chor, sondern auch für Licht. Skrjabin galt als ein leidenschaftlicher Anhänger der Farbmusik und war wohl einer der ersten, der die Farbe-Ton-Beziehung in seine Kompositionen mit einbezog. Für „Le Poème du feu >Prométhée<“ wurde die Lichtpartitur mittels rotierender Farbprojektionen auf große Stoffe realisiert, die auf der Bühne verteilt hingen. Was das Aufführungs-Instrument angeht, gibt es in der Literatur unterschiedliche Meinungen: bei Jewanski ist zu lesen, dass die Erstdarbietung durch ein Farbklavier von Millar, Little und McKay erfolgte.40 Moritz allerdings behauptet, Alexander Wallace Rimingtons Farborgel sei hier zum Einsatz gekommen.41 Sicher jedoch ist, dass das Stück nicht nur Jubel hervorrief. So bemängelten einige Kritiker eine fehlende Erkennbarkeit des Zusammenhangs von Musik und farbigen Lichtprojektionen oder gar eine Kontraproduktivität beider Elemente.
Ähnlich urteilte man über Alexander Lászlós (1895-1970) Farbenlichtmusik. Auf dem Deutschen Tonkünstlerfestival 1925 in Kiel bot er zum ersten Mal seine „Präludien, Opus 10, für Klavier und Farblicht“ dar.42 Die Aufführungspraxis muss man sich wie folgt vorstellen: „Die Farben werden durch ein von László selbst konstruiertes […] >Farblicht-Klavier<, das aus sieben verschiedenen Projek- tionsapparaten besteht, auf einem Prospekt bei verdunkelter Bühne projiziert; sie werden von einem Spieltisch aus mittels einer Klaviatur ausgelöst.“43 Das Besondere dabei ist, dass von László nicht nur Farben, sondern auch Formen auf die Leinwand gebracht wurden. Auch am Weimarschen Bauhaus stellte die Künstlergruppe um Ludwig Hirschfeld-Mack (1893-1965) Versuche mit Formenproje- ktionen im Rhythmus der Musik an. Die daraus entstandenen „Reflektorischen Farbenlichtspiele“ wurden 1923 durch die Gruppe erstmals vorgeführt, wobei ein konventionelles Klavier die unge- wöhnlichen Lichtabbildungen begeleitete.44 Damit bewegten sich László und die Bauhäusler stark in der Nähe der filmischen Experimente, die zur selben Zeit in Europa vollführt wurden. Doch bevor diese näher betrachtet werden, gilt es noch zwei Meister der Farbmusik-Instrumente zu benennen: Zum einen ist dies die Amerikanerin Mary Hallock Greenewalt (1874-1950), die mit der von ihr ent- wickelten Farborgel namens Sarabet seit 1911 Konzerte gab, bei denen es ihr um die Herausstellung der ästhetischen Verbundenheit von Klängen und Farbenspiel ging.45 Zum anderen der in Dänemark geborene Thomas Wilfred (1889-1968), der sich von der hörbaren Musik abgewandt hatte und während der 20er Jahre mit seinem Farbgerät Clavilux seine ausschließlich lautlosen Lumia - Kompositionen darbot.46 Beide hatten kurzzeitig großen Erfolg mit ihren Arbeiten, doch bald rückten andere Attraktionen in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses und auch der Zweite Weltkrieg ist nicht ganz schuldlos an der verblassenden Beachtung.
Doch warum ist es überhaupt so wichtig für die Erklärung der Musikvideo-Entstehung, die Entwicklungen der Farbe-Ton-Beziehung zu beleuchten? Zunächst einmal handelte es sich um die ersten ernsthaften Auseinandersetzungen mit der Verbindung von Musik und Bild. Diese bringen hier nicht nur einen theoretischen Diskurs hervor, sondern finden auch eine Überführung in die Praxis, in dem Fall in die Kunst. Schon allein diese zwei Punkte machen einen Überblick über die Geschehnisse auf diesem Gebiet erforderlich. Zudem aber unterstreicht die kontinuierliche Ausein- andersetzung mit der Thematik über Jahrhunderte hinweg das Interesse, den Willen und den Wunsch der Menschen nach der Zusammenführung der beiden Elemente. Das zeigt sich nicht nur in dem Engagement der Theoretiker, Wissenschaftler und Künstler. In Anbetracht der Aufsehen er- regenden Ergebnisse, die erzielt, der nicht alltäglichen Spektakel, die geboten wurden, war auch das Publikum sehr angetan. Nachvollziehbar steigert die Visualisierung eines herkömmlichen Musik- stücks, gelungen oder nicht, zumindest den Attraktionswert der Darbietung, da sie über das Ge- wohnte hinausgeht. Hierin liegt ein erster Punkt an den Musikvideos im Grunde direkt anknüpfen. Wichtig ist aber auch, dass der Farbe-Ton-Diskurs den Ausgangspunkt für die visuelle Musik darstellt, die sehr viel mehr mit Musikvideos zu tun hat als ein Farbklavier.
3.1.2. Die visuelle Musik
Hierbei handelt es sich um eine Strömung in der Kunst des experimentellen Films, deren erster zeitlicher Höhepunkt zwischen den beiden Weltkriegen einzuordnen ist. Die damals entstehenden abstrakten grafischen Filme sind zunächst einmal Ausdruck einer Sehnsucht nach Bewegung in der Malerei.47 So sind auch die meisten Künstler, die sich hier engagieren, Maler, die versuchen, Dynamik in ihre Bilder zu bringen. Und obwohl der Film zu dieser Zeit noch nicht als Kunstform anerkannt ist, setzen sie auf die Kinematographie, um die verloren geglaubte soziale Funktion der Kunst wiederherzustellen.48 Sie hatten erkannt, dass auf diesem Weg vermutlich viel mehr Menschen zu erreichen seien als durch die klassische Malerei. Warum aber alle von einer Analogie zwischen Bildender Kunst und Musik ausgingen und den kontinuierlichen Ablauf letzterer ähnlich auf ihre Werke übertrugen - den metrischen Charakter der Kinematographie dabei als Bindeglied nutzend - scheint bis heute rätselhaft.49 Allerdings ist mit Sicherheit davon auszugehen, dass die betreffenden Künstler vertraut waren mit dem Farbe-Ton-Diskurs. Einige hatten sich sogar bereits als Farblicht- musiker einen Namen gemacht, so zum Beispiel die Brüder Bruno Corra (1892-1976) und Arnaldo Ginna (1890-1982), die für die ersten handgemachten, abstrakten Filme, entstanden zwischen 1910 und 1912, verantwortlich sind.50 Sie malten u. a. die chromatische Entwicklung eines Farbakkordes („Accordo di colore“) direkt auf das leere Zelluloid, um so ihre Vorstellungen einer bewegten Malerei und einer Farbmusik zu verwirklichen.
Walther Ruttmann (1887-1941) ging nach einer anderen Technik vor: Er malte seine Formen (Kreise, Dreiecke, Quadrate, Linien) auf Glasplatten, die an einem Tricktisch abfotografiert wurden. Die sich daraus ergebende Filmkopie färbte er anschließend per Hand ein. Auf diese Weise schaffte er „Lichtspiel Opus I“ (1918-19), „Opus II“ (1919), „Opus III“ (1924) und „Opus IV“ (1925). Ihm lag besonders der Rhythmus seiner tausenden von nichtgegenständlichen, akribisch gezeichneten Bilder am Herzen. Um diesen zu unterstützen, beauftragte Ruttmann namhafte Komponisten, für seine Filme eine musikalische Begleitung zu entwickeln, darunter Max Butting und Hanns Eisler. Nicht zu vergessen: In diesen Tagen war das Kino noch stumm.
Von derartigen Untermalungen ist bei den Stücken des Schweden Viking Eggeling (1880-1925) nichts bekannt. Dennoch urteilt Weibel: „Eggelings Film ist vielleicht das zentrale Werk für die Entstehung von visueller Musik und Musikvideos.“51 Eggeling ließ seine meterlangen Rollenbilder mit Zeichnungen von Themen-Variationen (v. a. Kurven, Linien, Harfen, Dreiecke) in den UFA-Studios abfotografieren und gelangte so zu „Horizontal-Vertikal-Orchester“ (Fragment um 1919) und „Diagonal-Symphonie“ (1923-24).52 Um zu einer linearen Dramatik zu kommen, orientierte er sich an musikalischen Formen, wie der der Sonate. „Erstes und zweites Thema, Exposition, Durchführung und Reprise können im filmischen Ablauf klar unterschieden werden“53, bemerkt Selwood zur „Diagonal-Symphonie“.
Oskar Fischinger (1900-1967) sei hier als letzter abstrakter grafischer Filmemacher genannt, wenn- gleich er heute als der bedeutendste gilt. Er lernte sein Handwerk bei Ruttmann, von diesem als Assistenten für seine Opus-Filme eingestellt, und ging 1921 dazu über, eigene Filme zu produ- zieren.54 Aus diesem Jahr stammt seine „Studie 1 - Tanzende Linien“, der erste aus einer Serie von 16 Filmen, die Fischinger ganz schlicht mit Kohle auf weißes Papier zeichnete und sie dann ebenfalls an einem Tricktisch abfotografierte. Anfangs stumm, waren diese zwei- bis vierminütigen Filme, in deren Mittelpunkt abstrakte Formen in Bewegung standen, ab „Studie 6“ (1930) auch vertont. Für Weibel gilt diese Studie auch „als einer der ersten ‚Videoclips’, da der Film eine Reklame für die Schallplatte war, die auf der Tonspur zu hören ist [Musik: Paul Hindemith].“55 Neben seinen Studien produzierte Fischinger noch einige andere Filme, darunter 1933/34 auch zwei Werbespots - „Kreise“, ein Animationsfilm, der für die Tolirag-Reifen-Firma weiterverarbeitet wurde und „Muratti greift ein“, ein nicht nach malerischen, sondern nach szenischen Vorgaben realisierter Trickfilm für die Ziga- rettenindustrie56 - bevor er dem Ruf nach Kalifornien folgte. Da Fischinger mittlerweile als Koryphäe auf dem Gebiet der meisterhaften Verknüpfung von Bewegungsornamenten und Musik galt, zeigte sich auch Disney sehr an ihm interessiert, so leistete Fischinger ab 1936 seinen Teil zum 1940 erstmals vorgeführten „Fantasia“.
Doch sollte das nicht sein einziges Verdienst in den Staaten bleiben. Mit seinem Auftreten dort wurden auch seine visuellen Musikfilme schnell bekannt und beeinflussten die lokalen Künstler derart, dass sich eine so genannte Kalifornische Schule herausbildete. Zu deren Mitgliedern zählt man u. a. James Whitney (1921-1982), bisweilen auch seinen Bruder John (1917-1996, eigentlich eher ein Pionier der Computergrafik), Jordan Belson (geb. 1926), Harry Smith (1923-1991) und auch Charles Dockum (1904-1977). Während sich Whitney, Belson und Smith dem abstrakten Film widmeten, auf Zelluloid malten, aber auch komplizierte Schichtverfahren und andere neue filmhand- werkliche Mittel, wie beispielsweise die Lichtmodulation, entwickelten und dabei ein außergewöhn- liches Gespür für Zeit, Form und dramatische Farbspannung bewiesen, arbeitete Dockum an der Per- fektionierung der Vorführung farbigen Lichts anhand seines Mobil-Color-Projektor.57 Eine Besonderheit beim abstrakten Avantgardefilm der 30er Jahre waren die Experimente mit synthetischem Ton. Vorreiter auch hier: Oskar Fischinger. Er erzeugte Schall, indem er grafische Muster direkt auf die Tonspur des Filmmaterials zeichnete58, wofür auch Len Lye (1901-1980) und Norman McLaren (1914-1987) bekannt wurden. Sie allerdings ritzten bzw. kratzten den Ton lieber auf die Spur und kombinierten die so entstehende Tonkunst synchron mit Real- und Trickbildern. Es wäre unangebracht, an dieser Stelle den Weg des abstrakten Animationsfilms weiterverfolgen zu wollen; hingewiesen sei nur darauf, dass es nach der kurz beschriebenen Hoch-Zeit in den 20er und 30er Jahren immer wieder Künstler gab, die sich an dieser Tradition orientierten und sie weiter- entwickelten, so zum Beispiel Mary Ellen Bute, Hy Hirsh und später Michael Scroggins, Sara Petty, Robert Daroll und John Canemaker.59
In der Avantgarde der 20er Jahre fand sich noch ein weiterer Bereich, der neben dem abstrakten grafischen Werk großen Einfluss auf die Entwicklung der Musikvideos hatte: der dadaistische und surreale Film. Ausgangspunkt war René Clairs Film „Entr´acte“ (1924), der als Zwischenspiel für das dadaistische Ballett „Relâche“ von Francis Picabia entstand.60 Jeder Pariser Avantgarde-Künstler von Rang und Namen wirkte daran mit: Man Ray, Marcel Duchamp, Eric Satie u. a. So entstand ein formal revolutionäres Stück Film: von der Montage über die ungewöhnlichen Kameraperspektiven, vom schnellen Rhythmus bis zu den benutzten surrealen Effekten - alles war ungewöhnlich und so noch nie da gewesen. Bald darauf folgten „Un Chien Andalou“ (1928) und „L´Age d´Or“ (1930) von Luis Buñuel und Salvador Dalí und „Le Sang d´un Poète“ (1930-32) und „Le Belle et la Bête“ (1945) von Jean Cocteau. Weibel resümiert zu den genannten Filmen: „[Es] sind wahrscheinlich die ausgeplün- dertsten Filme der Welt, was insbesondere auch für Musikvideos gilt, die gerne eine surreale Atmosphäre verwenden.“61
Wie auch schon die Macher der gegenstandslosen Filme, sahen sich die Surrealisten veranlasst, allerlei Techniken zu erfinden, zu erproben und weiterzuentwickeln, um ihren Vorstellungen Gesicht und eine ganz bestimmte Ästhetik verleihen zu können. Darüber hinaus galt es auch neue Darstell- ungsweisen zu etablieren. So kreierte Maya Deren mit ihrem Spielfilm „Meshes of the Afternoon“ (1943), in der Tradition von Ray, Buñuel und Cocteau stehend, die Mustervorführung von Liebe und Sexualität für viele heutige Musikclips.62 Oder aber Sara Kathryn Arledge, in deren Film „Intro- spection“ (1943) man Raum-Zeit-Überbrückungen mittels zerrender Spiegelungen und sich wiederholender Körpergesten beobachten kann - wie in zeitgenössischen Musikvideos.63
Der tatsächliche Übergang vom Experimentalfilm zum Musikvideo gelingt später Künstlern wie Bruce Conner, Robert Nelson und Pat O´Neill. Conner erlangte erste Beachtung durch „A Movie“ (1958), der zu einem großen Erfolg des New American Cinema wurde.64 Die Errungenschaft seiner Filme besteht in der Etablierung von Collagen aus Found-Footage, Material, das Conner nicht selbst produzierte, sondern aufspürte, um es neu zu bearbeiten, zu arrangieren im Rhythmus einer bestimmten Musik. In seinem zweiten Film „Cosmic Ray“ (1960) beispielsweise war es Ray Charles´ Song „One More Time“. Die Bilder dazu stammten aus alten Wochenschauen und Fernsehreklamen, waren Zeichentrick-Sequenzen, Aktaufnahmen, aber auch abstrakte Muster. In ihrer Gegenüber- stellung bei extrem schneller Schnittfolge ergaben sich Anspielungen auf Zusammenhänge zwischen Liebe und Krieg, Sex und Gewalt. Die damalige Radikalität der Filme wuchs also nicht nur aus den formalen Innovationen, sondern gleichfalls aus den Inhalten. In „Breakaway“ (1966) und „Mongoloid“ (1977) kommt Conners Verbundenheit mit der Musik noch stärker zum Ausdruck. Ersterer entstand in Zusammenarbeit mit der jungen Sängerin und Tänzerin Antonia Basilotta, die später als Toni Basil Karriere machte und in ihren Musikvideos selbst Regie führte. Gegenstand dieses Films ist eine energiegeladene Tanz- und Gesangsdarbietung in ungewöhnlicher Choreographie und Aufnahme. Mit ca. 5 Minuten hatte der Videofilm auch schon die richtige Länge für einen Musikclip. Ungefähr genauso lang ist die Found-Footage-Collage „Mongoloid“, die für die Gruppe Devo ent- stand und wie „America is Waiting“ (1982, Interpreten: David Byrne und Brian Eno) bereits als tatsächliches Musikvideo gilt.65
Pat O´Neill und Robert Nelson machten sich in ihrer Experimentalfilmer-Karriere vor allem durch ihre Fertigkeiten bei der Entwicklung und Verbesserung technischer Verfahren einen Namen. Beide sind bekannt für den meisterhaften Einsatz des Optischen Kopierens und Chromakeyings. Dabei handelt es sich um die Übereinanderschichtung mehrerer Bilder und das „Ausschneiden“ einzelner Bildteile zur Kombination mit anderem Bildmaterial. So zu sehen in Robert Nelsons siebeneinhalbminütigem Musikfilm „Grateful Death“ (1967) über eine Performance der gleichnamigen Gruppe oder in „Coming down“ (1968) von Pat O´Neill, der als Reklamefilm in einer TV-Musik-Show für die Gruppe United States of America werben sollte.66 Sowohl O´Neill als auch Nelson haben demnach nicht nur unter künstlerischen Aspekten gearbeitet. Die angesprochenen Clips, die heute als frühe Vorläufer der Musikvideos erachtet werden, entstanden durchaus vor kommerziellem Hintergrund.
Die Industrie hatte das Potential der Avantgarde schon frühzeitig entdeckt und für ihre Zwecke eingesetzt. In den Lebensläufen etlicher Filmkünstler - angefangen bei den Pionieren wie Fischinger, Ruttmann und der französischen Experimentalfilmerin Germain Dulac (1882-1942) bis hin zu Videokünstlern unserer Zeit - finden sich Verweise auf mit deren Hilfe entstandene Reklamefilme. Dieser Umstand veranlasst Weibel, selbst nicht nur Theoretiker, sondern auch Künstler, zu folgender Annahme: „Der Avantgardist verkommt historisch zum Special-Effects-Man.“67 Und er konkretisiert auf das hier besprochene Thema: „Die meisten Musikvideos sind keine elektronische Weiterent- wicklung der Film- und Videokunst, sondern eine Kommerzialisierung und Verramschung des Avantgarde- und Animationsfilms, insbesondere des visuellen Musikfilms.“68 Seine Aussagen stellen gleich mehrere Punkte zur Diskussion. Zunächst einmal, ganz nüchtern betrachtet, wird deutlich, dass der Avantgarde ein Verdienst zukommt und zwar das der Entwicklung neuer Techniken, Themen und Stile. Unbestreitbar wurden auf diesem Gebiet etliche technische Methoden herausgearbeitet, Inhalte, Sujets zur Sprache gebracht, die bis dato kaum Gegenstand einer Öffent- lichkeit waren, und das alles gebunden in bestimmte Ästhetiken. Nach der klassischen Periode der handgemachten synthetischen Bilder und Töne (Film) übertrug sich das weiter auf das Zeitalter der elektronischen Synthese (Video). Auch Gehr befindet: „Was als ‚Clipästhetik’, als Neuigkeit und Spezifikum gepriesen oder verdammt wird, ist schließlich nichts anderes als das ganz gewöhnliche Ausbeuten ingeniöser Pionierarbeit durch die Industrie.“69
Mit Sicherheit hat die Industrie versucht ihren Vorteil aus der Avantgarde zu schlagen, aber vermutlich entstand erst durch ihr Interesse, durch den Einsatz der neuen Verfahren in Werbe- und Spielfilmen, auch bei einem größeren Publikum eine Wahrnehmung und ein Bewusstsein dafür, was wiederum förderlich war für Weiterentwicklungen in diesem Bereich.
Festzuhalten ist allerdings auch, dass die Industrie sich nicht nur den Avantgardefilm zu Nutze macht(e). Wo immer neue Techniken entstehen, werden sie auch zu kommerziellen Zwecken ver- wendet.
Weibels Aussagen implizieren des Weiteren, dass Musikvideos die Fortführung der Avantgarde- und Animationsfilme sind, wenngleich er die Ausführung eher kritisch betrachtet. Wie bereits erläutert, hat die Avantgarde in einigen Fragen das Feld für die Musikvideos bereitet, vor allen Dingen bei der Herausbildung des visuellen Vokabulars. Gehr urteilt zu diesem und dem vorangegangenen Punkt: „Formal haben Musikvideos vieles gemeinsam mit den Werken des klassischen Avantgardefilms der zwanziger Jahre, mit den abstrakten Filmen Oskar Fischingers, mit der sich auf Fischinger beru- fenden amerikanischen Westküstenschule der Visuellen Musik, mit Experimentalfilmen der sechziger Jahre. Es gibt jedoch keine entwicklungslogische Linie, die bei den zu Musik synchronisierten Filmen Fischingers beginnt und geradlinig zum Musikvideo führt. Dass Fischingers STUDIE NR. 2 von 1929/30 als Werbefilm für eine Schallplatte fungierte, ist als Analogie sehr hübsch, aber nur von anekdotischem Wert. Eher als eine unmittelbare Entwicklungslinie gibt es eine Stafette von gewissermaßen ästhetischen und technischen Erbinformationen, die vielfach vermittelt und ange- reichert zu einem Repertoire von Mitteln führt, auf die Musikvideo-Regisseure selbstverständlich zurückgreifen.“70 Hierin liegt die eigentliche Bedeutung des Experimentalfilms für das Musikvideo und der Grund für die Beleuchtung der historischen Ereignisse an dieser Stelle.
Daran an schließt sich eine weitere Diskussion, auf die Weibel in seinem Zitat indirekt deutet und die hier nur sehr kurz behandelt werden kann: die Postmoderne-Debatte, die sich auch um Musikvideos dreht, da diese Merkmale aufweisen, die gemeinhin als postmodern gelten.71 So verbinden sich in ihnen die E- und die U-Kultur. Oftmals entsteht der Eindruck einer Ahistorizität, da Stile und Formen scheinbar alle nebeneinander existieren. Durch Verweise auf andere Arbeiten und Einbeziehen dieser in das eigene Werk wird eine Intertextualität konstruiert, wobei die Beziehungsstrukturen oberflächlich bleiben. Das Weiterverwenden, das Kopieren anderer Texte, bei dem es nicht um die Inhalte der ursprünglichen Arbeit, sondern lediglich um den Verweis selbst geht, dürfte das sein, was Weibel mit „Verramschung“ meint.
Es ist also offenbar so, dass der Avantgarde- und Experimentalfilm der Ideen-und-Technik-Pool ist, aus dem für die Musikvideos geschöpft wird. Und ganz augenscheinlich nicht der einzige.
3.1.3. Einflüsse aus den Bereichen des kommerziellen Kinos und der Musik
Themen und Methoden, derer sich die Videoclips bedienen, wurden auch anderweitig entwickelt. So lag der Trick schon von Anfang an in der Wiege der Kinematographie: Georges Méliès war ein früher Wegbereiter der modernen Videotechnik.72 In seinen Filmen finden sich Spezial-Effekte, wie z.B. das Optische Kopieren, in ihrer Urform. Den Zeichentrick-Virtuosen Max und David Fleischer verdanken wir das Rotoscoping-Verfahren, bei dem Frame für Frame die Umrisse eines Objektes erfasst werden, um es in ein anderes Bild zu bringen.73 Auch Cartoons, wie „Betty Boop“ (1931-1939) und „Popeye the Sailor“ (1933) oder „Mickey Mouse“ (ab 1928) haben Einfluss auf das Erscheinungsbild der Musik- videos gehabt.74
Das kommerzielle Kino generell ist ein nicht zu vernachlässigender Faktor. Der erste Tonfilm, der 1927 noch nach dem Nadeltonverfahren aufgeführt wurde, war „The Jazz Singer“ und beinhaltete zu einem großen Teil Musik- und auch Tanzeinlagen, um die Möglichkeiten des neuen Mediums vor- zuführen.75 Seit der Jahrhundertwende hatte sich am Broadway das Musical-Genre entwickelt und etabliert, und mit dem Tonfilm erfolgte alsbald die erfolgreiche Übertragung auf die Leinwand. Die 30er und 40er Jahre waren die Blütezeit der Hollywood-Musicals und ihrer Stars wie Gene Kelly, Ginger Rogers und Fred Astaire.76 Für die Tanz- und Gesangsnummern dieser Streifen, die meist nur wenig in inhaltlichem Zusammenhang mit der Story standen, wurden eigens zusätzliche Regisseure und Choreographen engagiert. Der berühmteste unter ihnen ist wohl Busby Berkeley. Mit „Footlight Parade“ (1933), „42nd Street“ (1933) und „Gold Diggers“ (1933, 1935) setzte er Zeichen hinsichtlich der Visualisierung von Musik. Sein Name steht für immens aufwendige Choreographien etlicher Tänzerinnen in perfekter Synchronisation vor ausladender Kulisse. Um seine Vorstellungen zu realisieren, sah Berkeley sich allzu oft gezwungen, neue Techniken zu entwickeln; beispielsweise komplizierte Vorrichtungen, auf denen man nicht nur die Kameras, sondern auch die Tänzerinnen befestigte, um durch „schwereloses Gleiten“ die vollkommene Illusion zu schaffen.77 Legendär sind auch Berkeleys vielschichtige Bühnendekors, die er für die Revueeinlagen entwarf und die uns heute sehr an Popart erinnern. Der Einfluss, den er und seine Kollegen auf die Musikvideos ausübten, ist aus mehreren Gründen von Bedeutung. Zunächst einmal folgt in diesen Filmen die visuelle Darstellung der Musik. Treffen bewegte Bilder und Musik aufeinander, geschieht dies meist mit der Intention, dass die Musik die Bilder begleite. Ein Merkmal der Musikvideos ist die genau ungekehrte Beziehung. Zuerst gibt es einen Song und dazu entstehen dann die Bilder - wie bei den Musical-Filmen auch.78 Von den Revuefilmen können Musikvideo-Macher sich in punkto Rhythmus, Timing und Synchro- nisation einiges abgucken. Des Weiteren entscheidend ist der Spektakel-Wert der Hollywood- Musicals. Optische Effekte sind essentielle Bestandteile der unabhängig vom Rest des Films existie- renden, manchmal schon abstrakten Tanz- und Gesangseinlagen.79 Musikvideos sind ebenfalls für eine Effekthascherei bekannt. Nicht zuletzt ist der Kult, der um Musical-Stars gemacht wurde, mit dem vergleichar, der um heutige Popgrößen aufgebaut wird.
Vieles von dem eben über Musical-Filme Gesagtem trifft auch auf eine ganze Reihe von Musikfilmen zu, die ab Mitte der 50er entstanden. Titel wie „Rock, Rock, Rock“ (1955), „Rock around the Clock“ (1956) und „Don´t knock the Rock“ (1956) lassen keinen Zweifel, worum es bei diesen Filmen ging: um Rock´n´Roll und seinen Siegeszug in der Jugendkultur. Bill Haley, Chuck Berry, Little Richard, Jerry Lee Lewis und andere Stars stehen im Mittelpunkt von Machwerken, die oft nur eine einzige Aufgabe haben: die Musik der „neuen Helden“ in Szene zu setzen.80 Dabei ist Elvis Presley aufgrund seines Aussehens und des berühmten Hüftschwungs der erfolgreichste unter ihnen. Zwischen seinem ersten Film „Love Me Tender“ (1956) und seinem letzten „Change of Habit“ (1969) entstanden noch weitere 29 Rock´n´Roll-Filme. Hervorzuheben ist „Jailhouse Rock“ (1957), dem durch Shore der ästhetisch größte Einfluss auf Musikvideos zugeschrieben wird.81 Presleys Tanzszene im Gefängnis ist legendär und (manchmal auch ungeahnt) Vorlage für viele ähnliche Szenen in Musikvideos. Rock´n´Roll-Filme erfuhren in den 60ern unter anderem durch die Beatles und den Regisseur Richard Lester eine Weiterentwicklung. „A Hard Day`s Night“ (1964) und „Help“ (1965) setzten durch ihre neuartigen Bild- und Erzählstrukturen Zeichen. Lester brachte dokumentarische Mittel, beispielswei- se mit Handkamera gedrehte Szenen, zum Einsatz. Ungewöhnlich waren auch die Nonsens-Dialoge und die wenig sinnhaften Storys. Diese und die anderen Beatles-Filme „The Magical Mystery Tour“ (1967) und „Yellow Submarine“ (1968) waren nicht nur Ausdruck der Ablehnung des Establishments, sondern vor allem Folie für die Musik von John, Paul, Ringo und George. Da es die Musik war, um die es ging, rückte man Ende der 60er auch ab von dürftigen Storys und konzentrierte sich lieber auf das Wesentliche. Der Konzert- und Studiofilm wird populär. „Woodstock“ (1970, R: Michael Wadleighs) und „Pink Floyd at Pompeii“ (1971, R: Adrain Maben) sind glänzende Beispiele für diese Ära.82 Es ging einmal mehr darum, eine neue Visualisierung für Musik zu finden. Die Musik in aller Ohren war psychedelisch und so sollten auch die Bilder sein. Pink Floyd, Genesis und andere haben ver- sucht, das auf Konzertebene umzusetzen. Psychedelische Happenings mit riesigen Light-Shows, mit aufwendigen Kostümen und eingebundenen Filmen, deren sehr musiksynchrone Bilder surreale, abstrakte und literarische Visualisierungen der Texte lieferten.83
Dass dies nicht ohne Auswirkung für die Herausbildung der Musikvideos bleiben würde, ist zu erahnen. Vor allem wird hier aber deutlich, wie stark die Videoclipentstehung verknüpft ist mit den Entwicklungen innerhalb der Musikbranche. Das betrifft nicht nur den ästhetischen Bereich; musik- technologische und musikindustrielle Einflüsse entfalten ihre Wirkung ebenso. Mit der Erfindung des E-Pianos und des analogen Moog-Synthesizers 1958 begann das Zeitalter der synthetisch generierten Musik.84 Mit Mehrspurtechnik, Sequenzern, Samplern und der beginnenden Elektronisierung änderten sich die Musikaufnahmeprozesse. In den 70ern war diese Entwicklung so- weit fortgeschritten, dass die in Studios eingespielten und bearbeiteten Alben oftmals auf der Bühne gar nicht mehr live reproduzierbar waren. Damit wandelte sich folgerichtig auch der Aufführungs- prozess. Die Position des Interpreten verschob sich vom Musiker zum Performer. Zudem wurde die auditive Qualität der Musik relativiert, während gleichzeitig ihre visuelle Seite aufgewertet wurde.85 Für die Videoclipentwicklung war das ein bedeutender Schritt. Bands sind darauf angewiesen, sich zu präsentieren, und wenn das live nicht möglich ist (aus welchen Gründen auch immer), dann eben mittels eines Videofilms. Die Beatles beispielsweise gaben 1966 ihr letztes Konzert, waren aber unter anderem durch ihre Filme trotzdem weiterhin greifbar für ihre Fans.
Die Pop-Ideologie an sich veränderte sich. Stand lange Zeit Authentizität im Mittelpunkt, waren Playback und andere technische Surrogate nun durchaus legitim.
Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Musikindustrie selbst. In den 50ern kam es mit Elvis Presley und seinen Mitstreitern zur Kommerzialisierung des Rock´n´Rolls. Die Verkaufszahlen explodierten und die Jugend als Verbrauchergruppe etablierte sich. 1964 war das Jahr, in dem die meisten Singles aller Zeiten verkauft wurden und der Jugendmarkt boomte.86 Nach diesem Höhenflug folgte bald die erste Ernüchterung. Sie stellte sich ausgerechnet mit der nun Fuß fassenden Gesellschaftsfähigkeit des Pops ein. Die 70er waren die Zeit der großen Differenzierung. Die Spaltung zwischen Rock und Pop zeichnete sich in ihrer Endgültigkeit ab, und innerhalb beider Hauptstilrichtungen galt es immer mehr Subströmungen zu unterscheiden: Teenypop, Disco, Punk, New Pop usw. Das Zentrum des Geschehens verlagerte sich vom Konzertsaal in den Club. Die Einnahmen der Musikindustrie brachen v. a. Ende der 70er rapide ein.87 Dafür werden heute mehrere Gründe diskutiert. Definitiv mitverant- wortlich waren die konkurrierenden Freizeit- und Medienangebote, wie beispielsweise das Home- Taping mit Kassetten- und Videorekordern. Aber auch sozioökonomische Gründe waren ausschlag- gebend. Es herrschte allgemein Rezession, die Arbeitslosenquote stieg in dieser Zeit und die Zahl der Teenager, der Hauptzielgruppe also, sank.88 Offenbar mangelte es an einem konsumfreudigen Pub- likum. Die Musikbranche musste sich eingestehen, dass ihre bisherigen Formen der Produktwerbung - Konzerttourneen und Radioauftritte - zu kostenaufwendig, umständlich, langsam und unzeitgemäß waren. Effektivere Strategien mit größerer Reichweite mussten her.
Das traf sich sehr gut mit einer anderen Begebenheit dieser Zeit: der Entstehung des Kabel- und Satellitenfernsehens. In den USA schossen Fernsehsender wie Pilze aus dem Boden, v. a. Spartenka- näle, die aufgrund ihrer hohen Zielgruppenspezifität die dringend benötigte Werbekundschaft locken konnten.89 Die zahlreichen Sender mussten sich allerdings den rezessionsbedingt knappen Etat der Reklame-Auftraggeber teilen. Das wiederum brachte aus der einzig möglichen Geldquelle viel weniger Einnahmen für die einzelnen Kanäle. Folglich war der Bedarf an preiswertem Programm sehr groß. Normalerweise behalf man sich bei den Sendern mit wenig aufregendem Programm- Recycling. MTV dagegen beruht auf einer besseren Idee: der Ausstrahlung von Musikvideos. Das Programm kostete den Kanal so gut wie nichts, da der Hauptsendebestandteil von der Musik- industrie geliefert wurde; die aus beschriebenem Grund natürlich ein Interesse daran hatte, eine neue, relativ günstige Plattform für ihre Künstler zu schaffen.90 Für die Clip-Zwischenräume konnte man teure Werbeminuten verkaufen, was durch die Industrie schon nach kurzer Zeit dankbar ange- nommen wurde, konnte die Jugend doch durch kein anderes Instrumentarium so zielgenau ange- sprochen werden. Für MTV bedeutete das kaum Ausgaben bei guten Einnahmen - ein wirtschaft- licher Erfolg.
So weit zu den popkulturellen, musikwirtschaftlichen und medientechnologischen Bedingungen, unter denen MTV entstehen konnte, und fast ist man geneigt zu sagen, entstehen musste. Doch wie kam es konkret zur Herausbildung der Clips und wie zur ersten daraus Kapital schlagenden Sende- station?
3.1.4. Von den ersten Videoclips bis zu MTV
Musik-Clips, ähnlich den heutigen, traten zum ersten Mal in den späten 40er Jahren in Erscheinung. Damals gab es in den USA neben den normalen Jukeboxen auch visuelle Varianten dieses Freizeitvergnügens. Die Panoram -Automaten hatten einen Bildschirm, auf dem zu einem Song der passende Musikfilm, genannt Soundie, zu sehen war.91 Dieser zeigte im Wesentlichen den oder die Interpreten bei der Performance des Stücks. Aber natürlich gab es auch Ausnahmen, bei denen man sich von der üblichen Aufführungssituation trennte und andere Wege ging. Nach einem ähnlichen Prinzip, nur mit modernerer Technik, funktionierten die v. a. in Frankreich Anfang der 60er Jahre populären Scopitone, in denen man auch schon Farbfilme bewundern konnte.92 Für eine kurze Zeit waren derartige Apparate mit ihren kleinen Musikdarbietungen sehr beliebt, und bis heute ist man sich nicht sicher, warum sie sich nicht längerfristig durchsetzen konnten. Ein Grund mag die Unhand- lichkeit der großen und sehr schweren Maschinen gewesen sein; wahrscheinlicher ist, dass der Konkurrent Nummer Eins, das Fernsehen, einfach zu groß und zu mächtig geworden war.93 In dessen Programmen hatten sich Musikdarbietungen schnell einen festen Sendeplatz erobert.
Die ersten regelmäßigen Musik-Shows in den Staaten, beispielsweise Face the Music (1948-1949) und Your Hit Parade (1950-1959), orientierten sich an den 1940 in Amerika eingeführten Pop-Charts und waren eher für ein Familien-, als ein jugendliches Publikum gedacht.94 Die Musik wurde live im Studio gespielt, wenn auch nicht immer von den eigentlichen Stars. Face the Music war eine von mehreren Shows, in der die jeweilige Haus-Combo die aktuellen Hits zum Besten gab. Die eher jugendorien- tierten Sendungen stellten sich erst mit der Rock´n´Roll-Explosion Mitte der 50er ein. The Big Record (1957-1958) war eine der ersten Shows, in denen ausnahmslos Teen-Idole zu Wort bzw. zu Ton kamen. Die adoleszente Variante von Your Hit Parade war American Bandstand (1952-1989), eine sehr erfolgreiche und vermutlich deshalb so langlebige Show, die anfangs werktäglich lief, bis sie ab 1964 nur noch einmal in der Woche zu sehen war. Bestandteil der Sendung waren nicht nur die Stars der Zeit, die im Playback ihre Songs performten, sondern auch viele smarte Teenager, die dazu die ange- sagten Tänze tanzten. Eine imaginäre Konzeptualisierung der Rock- und Popsongs ist hier noch kaum zu erkennen.
Anders in Großbritannien. Seit 1964 ist Top of the Pops der BBC eine der angesagtesten Musik-Shows der Welt. Seit nunmehr fast 40 Jahren präsentieren Moderatoren hochkarätige Acts der aktuellen Charts - im Übrigen in Großbritannien 1952 eingeführt - gipfelnd in dem Auftritt der jeweiligen Nummer Eins.95 Die wöchentlich live ausgestrahlte Veranstaltung findet in einem clubähnlichen Studio statt, die Interpreten geben ihre Playback-Darbietungen meistens von einer Bühne zum Besten, vor ihnen das jubelnde, tanzende Publikum.
Doch schon in der ersten Sendung kam es zu einem typischen Problem: Was tun, wenn die Künstler - in diesem Falle die Beatles - für einen Auftritt nicht zur Verfügung stehen? Statt ihrer zeigte man dann vorab produzierte kurze Filme, so geschehen bei „I Want to Hold Your Hand“, oder aber man präsentierte eine Gruppe Tänzer, die mit einer Show-Einlage die Interpreten vertraten.96 Ein solches, sehr erfolgreiches Ensemble hieß Pan's People und war bei Top of the Pops bis 1976 bühnenaktiv. Die Gruppe beschränkte sich aber mitnichten auf das bloße Tanzen in extra entworfenen Kulissen. Vielmehr erfolgte die Visualisierung der Songs nach oftmals aufwendigen Choreographien und in pompösen Kostümen. Auch bei den regulären Bühnenshows ließ man sich nicht lumpen und arbeitete mit innovativen visuellen Effekten, wie spektakulären Light-Shows und später mit Video- Effekten.
Ähnlich im Ablauf waren auch andere europäische Shows. Top of the Pops größter Konkurrent Ready Steady Go! kam aus dem Heimatland selbst und war von 1963 bis 1966 on air. Der hauptsächliche Unterschied zu Top of the Pops lag in dem Umstand, dass bei Ready Steady Go! normalerweise live performt wurde.97 Die erste deutsche Rockmusikshow Beat Club von und mit Gerhard Augustin und Michael Leckebusch hielt es mit dem Live-Gesang nicht so genau. Dieser war in den Anfangs-(1965- 1967) und Endjahren (1969-1972) der Show gang und gäbe, wurde in der Zwischenzeit aber durch Voll-Playback ersetzt.98 Neben den Songdarbietungen der Interpreten waren im Beat Club filmisch vorproduzierte Star-Auftritte, Go-Go-Tänzerinnen und glamouröse Showeffekte von ebenso großer Bedeutung.
Die kleinen „Star-Ersatz“-Filme spielten aus mehreren Gründen eine Rolle. Bei den wichtigen Shows, wie American Bandstand, Top of the Pops, Ready Steady Go! aber auch bei Shindig und Hullabaloo konnten Musiker sich Abwesenheit nicht leisten, sie hätten mit großen Popularitätseinbußen rechnen müssen. Oftmals jedoch war das persönliche Erscheinen einfach nicht möglich: Die Konzert- tourneen waren lang und führten über mehrere Kontinente, hinzu kamen noch einige andere Verpflichtungen.
Für weniger große Shows, die es in den Staaten, aber auch in Europa zuhauf gab, hatten die SongClips aus einem anderen Grund eine tragende Bedeutung. Obwohl diese Sendungen in Konzept und Aufmachung American Bandstand und Top of the Pops glichen, hatten sie nicht dieselbe Tragweite, ihre Anziehungskraft reichte nicht, um Top-Acts zu locken. So traten die Beatles oder die Rolling Stones nie live im Beat Club auf, sondern waren lediglich als Film- bzw. Videozuspiel zu sehen.99 Ein weiterer Grund war die bereits angesprochene größer werdende Schwierigkeit der musiktechnischen Reproduktion der Songs auf einer Bühne. Als angemessene Lösung galt die Präsentation einer filmischen Umsetzung des Stücks, unterlegt mit den Originalklängen.
Nicht zu vergessen fungierten solche Filmdarbietungen auch als Konzertersatz für Fans, die zu jung oder zu weit weg waren von den großen Städten (insbesondere in den USA ein Thema).100 Nach und nach etablierten sich die Abwesenheits-Clips in den Shows, und aus dem notwendigen Übel wurde für manche Musiker sogar die Herausforderung, besonders ausgefallene „Lückenfüller“ herzustellen.
Im Februar 1967 erschien die Doppel-A-Single der nicht mehr tourenden Beatles „Penny Lane“/ „Strawberry Fields“ zugleich mit zwei Promovideos, die nicht nur für damalige Maßstäbe sehr experimentell waren. Was sich die Beatles in Zusammenarbeit mit dem schwedischen Avantgarde- Filmemacher Peter Goldmann ausdachten, hatte nichts mehr gemein mit der konventionellen Darbietung von Songs. Shore beschreibt es so: „’Penny Lane’ was a more or less literal visualization of the song´s cheerily offhand pop surrealism. But ‘Strawberry Fields’ was something else again: Richard Lester meets Kenneth Anger in the Twilight Zone, with surreal settings (mainly a cobwebbed upright piano in a meadow), chiaroscuro lighting, slow-and-backward motion, multiple overlapped images, and ominously slow dissolves to enigmatic close-ups of the Beatles´ faces.”101 Doch Clips wie diese beiden der Beatles, die von einigen als die ersten echten Musikvideos erachtet werden102, waren noch die Ausnahme und nicht die Regel.
Bands trotz Nichtanwesenheit zu präsentieren, war auch Aufgabe der Anfang der 70er vor allem in den USA entstehenden Demo-Filme. Dabei handelte es sich um 60 bis 90 Minuten lange, von großen Plattenfirmen in Auftrag gegebene Filme mit aneinander gereihtem Bildmaterial von verschiedenen Gruppen. Benötigt wurden diese Filme eigentlich nur für interne Zwe>meetings sollten hauseigene und zukünftige Interpreten präsentiert werden, damit alle betreffenden Mitarbeiter sich über die zu promotenden Songs informieren konnten. Obwohl die Plattenfirmen sich diese Demonstrationsfilme einiges kosten ließen - so lag das Budget der CBS bei 300.000 bis 400.000 US-Dollar - handelte es sich doch um eine Rationalisierungsmaßnahme, denn vergleichswei- se unbezahlbar dagegen war, alle Musiker persönlich erscheinen zu lassen.103 Ken Walz, der späterer Regisseure von Musikvideos wie Cindy Laupers „Girls Just Wanna Have Fun“ (1983), verdiente sich seine Sporen bei dem Musiklabel CBS. Er berichtet, dass er bei der Anfertigung der Filme freie Hand hatte in der Darstellung der Songs.104 Wenn die Bands aus raum-zeitlichen Gründen für die Auf- nahmen nicht zur Verfügung standen, bemühte man eben andere Mittel der Visualisierung. Dann wurde der Songtext zur Vorlage für die Bilder oder man hielt sich gänzlich abstrakt. Auch Anima- tionen und Spezial-Effekte wurden eingesetzt. Kurz und gut: So entstand eine weitere Spielwiese auf der die Musikvideos das Laufen lernten.
Deren hauptsächlicher Dreh- und Angelpunkt war und blieb jedoch das Fernsehen. Die Videotechnik machte große Fortschritte, nicht nur auf der Produktions-, sondern auch auf der Rezeptionsseite. Mitte der 70er Jahre kamen die ersten Heim-Videorekorder auf den Markt. Quandt urteilt: „Das Videoband als Trägermedium ebnete durch geringe Materialkosten und einfach handhabbare Vervielfältigungsmöglichkeiten auf technischer und ökonomischer Ebene den Clips den Weg - auch für einen Einsatz außerhalb des häuslichen Bereichs und des Fernsehens.“105 Quandt spielt hier auf den Einsatz der nun vielfach entstehenden Promo-Clips in Diskotheken, Clubs und anderen Vergnü- gungsorten an. Für die Durchsetzung des neuen Medienformates war das ein Aspekt, der nicht zu vernachlässigen ist.
Ein viel beachteter Meilenstein der Musikvideoentwicklung ist der 1975 für die Gruppe Queen ent- stehende Promo-Film „Bohemian Rhapsody“. Die meisten Autoren sind sich einig, dass es sich hier- bei um ein tatsächliches Musikvideo im heutigen Sinne handelt.106 Der Song war bis zur Veröffent- lichung des Videos schlecht gelaufen, da die Radiostationen ihn aufgrund der doppelten Länge eines konventionellen Stückes kaum spielten. Dann wurde unter der Regie von Bruce Gowers mit einem geringen Budget - $ 7.000 - und innerhalb kürzester Zeit - alles in allem keine 48 Stunden - ein Clip produziert, der die Gruppe Queen eine Woche nach Erstausstrahlung bei Top of the Pops auf Platz Eins der englischen Charts hievte, wo sie sich für die nächsten 9 Wochen hielten.107 „Bohemian Rhap- sody“ war anders als die normalerweise in Musik-Shows gebotenen Promo-Filme, die oftmals nur performende Bands auf Bühnen oder in anderen Locations zeigten, und war doch nicht so revolutio- när (und somit womöglich unverständlich) wie die Clips der Beatles. Er war eine Mischung aus Perfor- mance und Spezial-Effekten (v. a. kaleidoskopartige Vervielfältigungen der Gruppenmitglieder), dessen Erfolg darin bestand, einen massentauglichen Innovationswert an den Tag zu legen. Und weil dies in dem Clip so meisterhaft gelang, strebten alle danach, es ihm gleich zu tun. Plötzlich wurde offenbar, was ein aufregendes Musikvideo für einen Song tun konnte: Ihn an die Spitze der Hitparade katapultieren - schneller und effizienter als Plattencover, Radioauftritte und Konzerttouren. Doch galt dies leider zunächst nur für Europa und Australien. Gerade in dem abgelegenen Kontinent Australien war das Bewusstsein für und der Bedarf an Videoclips groß. Da Bands aus Übersee hier nur selten tourten, war ohne Promo-Filme ein Hiterfolg nur schwer möglich.108 Der amerikanische Fern- sehmarkt war vorerst wenig sensibilisiert für die Rock-Videos aufgrund der fehlenden Zielgruppe: Die Rock-Generation sah in diesen Tagen nicht sehr viel fern. Ihre Eltern hatten die Bestimmungsgewalt über das TV-Gerät im Haus und dementsprechend gestaltete sich auch das Programm. Zudem war der Sound der Fernseher noch sehr blechern, ließ in der Qualität stark zu wünschen übrig, und die Jugend ging Freizeitaktivitäten lieber außer Haus nach, besonders in der Prime Time.109 Das änderte sich Ende der 70er Jahre mit dem Aufkommen von Kabel- und Satellitenfernsehen, Videorekorder und Surround-Sound.
Nachdem „Bohemian Rhapsody“ auch in den Staaten zu sehen war, z. B. in Don Kirshners Midnight Special, der zu jener Zeit wichtigsten Rock-Show des Landes, die eigentlich nur Live-Acts zeigte, bekam Bruce Growers, der Regisseure des Clips, etliche Angebote, ähnliches für US-amerikanische Stars zu gestalten.110 Kurz darauf arbeitete er für und mit Rod Stewart, den Bee Gees und Rush. Die entstandenen Videofilme liefen zwar in den Staaten, waren aber eigentlich vornehmlich für den europäischen Markt gedacht. Zu sehen waren sie dort in Sendungen wie der Kenney Everett Video Show, die 1978 in England startete.111 Den Durchbruch verdankte diese wöchentliche Veranstaltung vor allem Direktor David Mallet, der sich bereits als Leiter von Juke Box Jury und Top of the Pops und Regisseur einiger britischer Werbespots einen Namen gemachte hatte. Everett wird heute als der erste Video-Jockey gehandelt. Seine Ansagen zwischen den Musikclips und den Studio-Perfor- mances waren eloquent, witzig und, dank Mallet, gespickt mit vielfältigen Spezial-Video-Effekten.
Bemerkenswerte Musikvideo-Macher der ersten Stunde waren auch die Mitglieder der Künstler- gruppe Devo. Diese unabhängige Band von der Westküste der USA hatte sich ein allumfassendes Konzept konstruiert, das nicht allein Musik beinhaltete, sondern eine ganze Weltanschauung, die den Rückschritt der Humanität, De-Evolution wie sie es nannten, anprangerte.112 Dabei waren sie in allem sehr innovativ und ihrer Zeit voraus: ihre Musik gilt als eine frühe Version des New-Wave- Elektro-Pops der 80er Jahre, und ihre Marketing-Strategien zielten auf Multimedialität. Devo brach- ten ihre Platten lange Zeit selbst heraus und auch alles andere lag ausschließlich in den Händen der Bandmitglieder: die Kostüme, das Packaging, die Merchandise-Produkte. Musikvideos waren wie selbstverständlich integraler Bestandteil ihrer Arbeit. Bezüglich der Videoaufnahmen ließen sie sich von dem Filmemacher Chuck Statler unterstützen. Die Clips „Jocko Homo“ und „Secret Agent Man“ waren die Stücke, die 1976, sechs Jahre nach Gründung der Band, den Durchbruch bedeuteten. Die beiden Videos zeichneten sich weniger durch große technische Raffinesse aus - das Budget war mehr als knapp, es gab keine Spezial-Effekte, keine ausgefallenen Kamerabewegungen oder auf- fällige Schnitte; vielmehr bestachen sie durch eine extraordinäre Ausdrucksgewalt ihrer Bilder. Maskierte und verkleidete Musiker vollführen absurde Handlungen in grotesken Kulissen. So dachte man, bis die Videos 1977 einen Award bei dem Ann Arbor Film Festival gewannen und so allmählich einem Massenpublikum zugänglich wurden. Die offenbar stark vom Surrealismus beeinflusste Band Devo unterschrieb bald darauf einen Plattenvertrag bei Warner Brothers.
Ähnlich erging es Musikern wie den Residents mit „Land oft the 1.000 Dances“ (1975) oder Mike Nesmith mit „Rio“ (1977). Immer mehr Musikclips entstanden. In den Staaten liefen sie vornehmlich noch in Clubs, in Europa und Australien im Fernsehen. In Großbritannien fertigte der junge Australier Russel Mulcahy einen Promo-Film pro Woche für Virgin Records, u.a. für OMD, XTC, The Members, Human League, The Sex Pistols und Public Image Ltd.113 In den USA gründete Warner Brothers Records 1977 sogar ein eigenes Video-Department. Langsam liefen die Musikclips auch im nord- amerikanischen Fernsehen gut an. In einigen Musik-Shows auf den immer zahlreicheren Kabelka- nälen waren sie immer öfter zu sehen. Nickelodeon von Warner Cabel war einer dieser Sender, gedacht für eine jugendliche Zielgruppe. Anfang 1981 ging dort Popclips auf Sendung: Einmal die Woche gab es eine halbe Stunde lang nur Musikvideos zu sehen, unterbrochen lediglich durch deren Ansage. Diese VJ-Aufgabe kam Howie Mandel zu. Das Sendekonzept stammte von Mike Nesmith - seines Zeichens erfolgreicher Clip-Regisseur - und Bill Dear. Mitte des Jahres traten sie ihre Idee voll- ständig an Warner Cabel ab, die damit Großes vorhatten. In Fusion mit American Express entstand Warner-Amex Satellite Entertainment Corp. (WASEC). Man machte Verträge mit der Musikindustrie, stellte Formate vor, testete sie, suchte und fand die geeigneten VJs, sammelte alle existierenden Musikvideos, unternahm hier und da Feineinstellungen und am 1. August 1981 war es dann soweit: MTV startete seinen Betrieb mit „Video killed the Radio Star“ von den Buggles114 (Regisseur: Russel Mulcahy, der inzwischen mit David Mallet und anderen eine eigene Produktionsfirma gegründet hatte). Die erste visuelle Radiostation sendete ihr Programm an 4 Millionen Haushalte in den USA, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche.
[...]
1 Punktuell meint in diesem Fall, dass entweder einzelne Videos (vgl. Nachtigäller, 1985 zu „Thriller“ mit Michael Jackson) oder aber die Gesamtheit der Musikclips einer Zeit untersucht werden (vgl. Sieber, 1984 - eine der ersten Betrachtungen zu dem damals neuen Format).
2 So beschreibt Rötter - wie er betont subjektiv und rein hypothetisch - Unterschiede in der Videoclip-Ästhetik der 80er und 90er Jahre (vgl. Rötter, 2000, S. 260)
3 vgl. Altrogge, 2001b, S. 18-44
4 lateinisch: video „ich sehe“
5 vgl. Quandt, 1997, S. 14
6 Burns, 1988, S. 45
7 vgl. Neumann-Braun/Schmidt, 1999, S. 20
8 vgl. Neumann-Braun/Schmidt, 1999, S. 20
9 Voulliéme, 1987, S. 168. Tanja Busse unterscheidet in ihrem Buch „Mythos in Musikvideos“ aus dem Jahr 1996 zwischen mehr als einem Dutzend verschiedener Mythen, die in den Clips kommuniziert werden, z.B.: Liebe, Sch ö nheit, Spa ß , Helden, Ü berwindung der Zeit, Life is Dance is Sex is Body, Reich macht gl ü cklich, Weltgemeinschaft der V ö lker, Rebel without a clue u. a.
10 Siebers, 1984, S. 198
11 vgl. Siebers, 1984, S. 198
12 vgl. Siebers, 1984, S. 198
13 z.B. Glogauer, 1986, S. 641. Er benennt an dieser Stelle explizit eine „extreme Schnitthäufigkeit, eine explosive Kamera (viele Schwenks und Zooms), raffinierte Beleuchtungseffekte.“
14 vgl. Quandt, 1997, S. 16
15 vgl. Definition von Neumann-Braun/Schmidt, 1999, S. 10 oder die Definition von Wicke, 1997, S. 346
16 Quandt, 1997, S. 16
17 Quandt, 1997, S. 18
18 z.B.: bei Neumann-Braun/Schmidt, 1999, S. 13 und bei Kurp/Hauschild/Wiese, 2002, S. 50f.
19 vgl. Quandt, 1997, S. 19f. (auch zu den folgenden Begriffs-Angaben)
20 So gibt es die ersten Publikationen zum Thema Musikvideos in den frühen 80ern. Z.B.: Neumann, Hans-Joachim: Stromlinienförmiger Edelkitsch - Auskunft über ein neues Medium: Videoclips, in: medium 7/ 1983
21 Weibel, 1986, S. 38
22 vgl. Jewanski, 1995
23 vgl. Jewanski, 1995, S.345, nach Schneider: Singende Steine, Kassel 1955, S.10
24 Daniels, 1987, S. 175f.
25 Daniels, 1987, S. 167
26 vgl. Kloppenburg, 2000, S. 16
27 vgl. Jewanski, 1995, S. 345
28 Moritz, 1987, S. 19
29 vgl. Moritz, 1987, S. 18
30 vgl. Moritz, 1987, S. 19
31 vgl. Moritz, 1987, S. 20, Jewanski, 1995, S. 345
32 vgl. Moritz, 1987, S. 18
33 vgl. Jewanski, 1995, S. 347
34 vgl. Moritz, 1987, S. 20
35 vgl. Jewanski, 1995, S. 350
36 vgl. Jewanski, 1995, S. 354
37 vgl. Jewanski, 1995, S. 356
38 Jewanski, 1995, S. 358
39 vgl. Moritz, 1987, S. 22, Jewanski, 1995, S. 363
40 vgl. Jewanski, 1995, S. 363
41 vgl. Moritz, 1987, S. 23
42 vgl. Jewanski, 1995, S. 364
43 Maur, 1985, S. 211, nach: László: Einführung in die Farblichtmusik, Leipzig 1926
44 vgl. Maur, 1985, S. 216
45 vgl. Moritz, 1987, S. 28, Jewanski, 1995, S. 365
46 vgl. Moritz, 1987, S. 33, Jewanski, 1995, S. 365
47 vgl. Selwood, 1985, S. 418
48 vgl. Selwood, 1985, S. 417, S. 420
49 vgl. Selwood, 1985, S. 417
50 vgl. Weibel, 1987, S. 73
51 Weibel, 1987, S. 77
52 vgl. Weibel, 1987, S. 76f.
53 Selwood, 1985, S. 419
54 vgl. Weibel, 1987, S. 78f.
55 Weibel, 1987, S. 79
56 vgl. Paech, 1994, S. 60f.
57 vgl. Moritz, 1987, S. 36ff.
58 vgl. Weibel, 1987, S. 84ff.
59 vgl. Moritz, 1987, S. 41ff.
60 vgl. Weibel, 1987, S. 80f.
61 Weibel, 1987, S. 81
62 vgl. Moritz, 1994, S. 33
63 vgl. Moritz, 1987, S. 45
64 vgl. Weibel, 1987, S. 124
65 vgl. Moritz, 1994, S. 33f.
66 vgl. Moritz, 1994, S. 34f.
67 Weibel, 1987, S. 119
68 Weibel, 1987, S. 199
69 Gehr, 1993, S. 16
70 Gehr, 1993, S. 15
71 vgl. Quandt, 1997, S. 62
72 vgl. Quandt, 1997, S. 38
73 vgl. Weibel, 1987, S. 134
74 vgl. Weibel, 1987, S. 135
75 vgl. Shore, 1984, S. 19
76 vgl. Anfang, 1989, S. 78
77 vgl. Weibel, 1987, S. 129ff.
78 vgl. Quandt, 1997, S. 38
79 vgl. Quandt, 1997, S. 38
80 vgl. Anfang, 1998, S. 80
81 vgl. Shore, 1984, S. 43
82 vgl. Anfang, 1998, S. 80
83 vgl. Shore, 1984, S. 37f.
84 vgl. Bartos, 1996, S. 107
85 vgl. Schmidt, 1999, S. 96
86 vgl. Kureishi/ Savage, 1996, S. 81
87 vgl. Schmidt, 1999, S. 98
88 vgl. Quandt, 1997, S. 53
89 vgl. Schmidt, 1999, S. 96f.
90 Eudes, 1996, S. 111
91 vgl. Shore, 1984, S. 21f.
92 vgl. Shore, 1984, S. 27f.
93 vgl. Quandt, 1997, S.42f.
94 vgl. Shore, 1984, S. 23f.
95 vgl. The History of TOTP!, 2003
96 vgl. The History of TOTP!, 2003
97 vgl. Shore, 1984, S. 29
98 vgl. The Beat-Club guide at TV Tome, 2003
99 vgl. Beatclub - TV - Radio Bremen, 2003
100 vgl. Shore, 1984, S. 39
101 Shore, 1984, S. 36
102 vgl. Michel, 1994, S. 77
103 vgl. Shore, 19984, S. 40
104 vgl. Shore, 19984, S. 40
105 vgl. Quandt, 1997, S. 47
106 vgl. Quandt, 1997, S. 47
107 vgl. Shore, 1984, S. 56
108 vgl. Shore, 1984, S. 54
109 vgl. Shore, 1984, S. 55
110 vgl. Shore, 1984, S. 57
111 vgl. Shore, 1984, S. 59f.
112 vgl. Shore, 1984, S. 61ff.
113 vgl. Shore, 1984, S. 69
114 vgl. Shore, 1984, S. 82
- Arbeit zitieren
- Anne Wäschle (Autor:in), 2003, New Pictures, Old Ideas - Die Entwicklungsgeschichte der Musikvideos und ihre Veränderung in Struktur, Inhalt und Bedeutung zwischen 1987 und 2003, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/28199
Kostenlos Autor werden

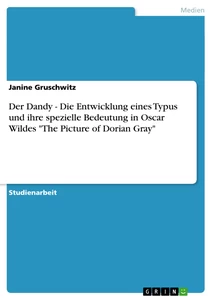







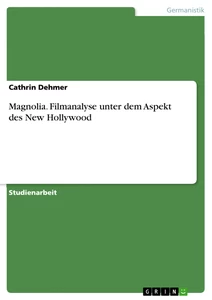
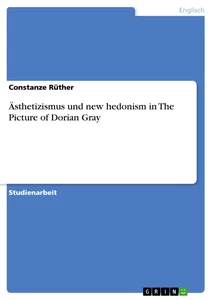

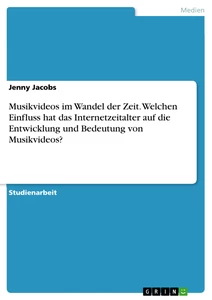







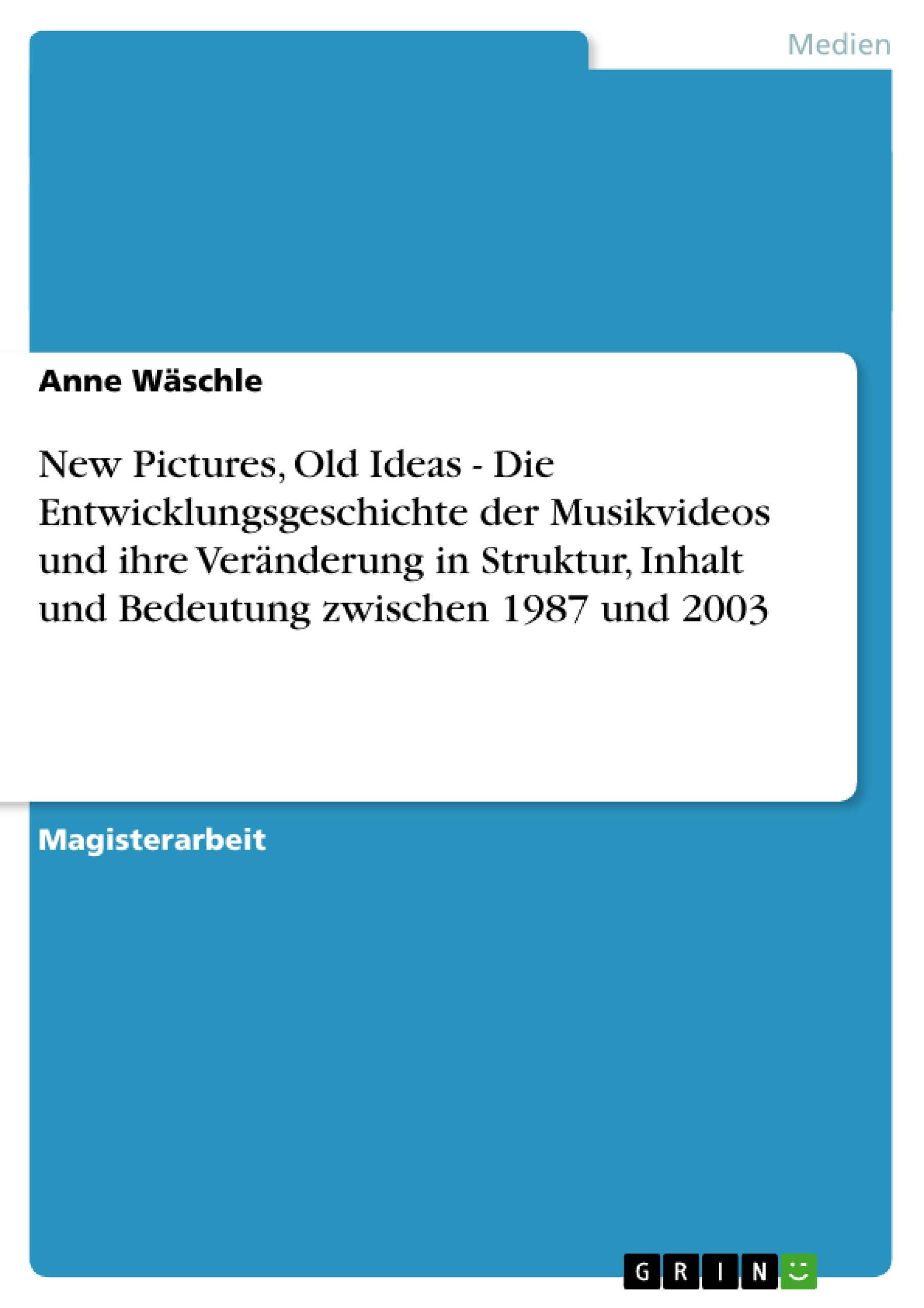

Kommentare