Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
2 Zur Entstehung der Männlichkeitsforschung
3 Die Verhandlung von Männlichkeit in der Theorie
3.1 Männlichkeit - ein Definitionsversuch
3.2 Männlichkeit als soziale Konstruktion
3.3 Zentrale Ansätze zur Erklärung des Geschlechterverhältnisses
3.3.1 Raewyn Connell und das Konzept der hegemonialen Männlichkeit
3.3.2 Pierre Bourdieu und das Konzept der männlichen Herrschaft
3.4 Kritik
3.5 Verwendung im Rahmen des eigenen Forschungsvorhabens
4 Männlichkeit als Gegenstand der empirischen Sozialforschung
4.1 Stand der Forschung
4.2 Der Nutzen qualitativer Methoden bei der Untersuchung von Männlichkeit
4.3 Der Nutzen quantitativer Methoden bei der Untersuchung von Männlichkeit
5 Männlichkeit und Fußball
5.1 Die Entwicklung des Fußballs zu einer Domäne des männlichen Gestaltungswillens
5.2 Fußball als Gegenstand der Männlichkeitsforschung
6 Forschungsdesign: Die Konstruktion von Männlichkeit(en) im Fußball
6.1 Qualitative Datenerhebung
6.1.1 Interviews
6.1.2 Teilnehmende Beobachtung
6.1.3 Auswertung
6.2 Quantitative Datenerhebung
6.2.1 Hypothesen
6.2.2 Operationalisierung
6.2.3 Aufbau und Inhalt des Fragebogens
6.2.4 Anwendungsbeispiele
7 Diskussion
8 Fazit
Literaturverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Anhangsverzeichnis
Anhang
Eigenständigkeitserklärung
Abstract
In der vorliegenden Masterarbeit befasse ich mich mit der Frage, inwiefern sich Raewyn Connells theoretisches Konzept der hegemonialen Männlichkeit auf das empirische Feld des Fußballs übertragen lässt. Auf Basis einer qualitativen Analyse des Mannschaftslebens von bayerischen Amateurfußballteams untersuche ich, welche verschiedenen Formen von Männlichkeit in der Praxis beobachtet werden können, und wie diese durch die aktive Herstellung von Geschlecht konstruiert, (re)produziert und dargestellt werden. Den theoretischen Rahmen meiner Arbeit bilden dabei West/Zimmermans Ansatz des ‚doing gender‘, Connells Konzept der hegemonialen Männlichkeit sowie Bourdieus Theorie der männlichen Herrschaft. Im Anschluss an meine qualitative Feldforschung entwickle ich ein quantitatives Forschungsdesign, welches es ermöglicht, Männlichkeit im Fußball auf statistischem Wege zu untersuchen. Die empirischen Ergebnisse meiner Arbeit zeigen, dass sich im fußballerischen Rahmen verschiedene Männlichkeitsformen herausbilden, welche durchaus der von Connell formulierten Typologie zugeordnet werden können. Nach einer Diskussion der Ergebnisse sowie der kritischen Reflexion meines Forschungsdesigns sollen am Ende noch etwaige Limitationen der eigenen Arbeit und Ideen für weiterführende Fragestellungen besprochen werden.
1 Einleitung
„Ich äußere mich zu meiner Homosexualität, weil ich die Diskussion über Homosexualität unter Profisportlern voranbringen möchte“ (Lehmann 2014). Mit diesen Worten bekannte sich Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger im Januar dieses Jahres als erster deutscher Fußballprofi ganz offen zu seiner Homosexualität. Das mediale Echo war dementsprechend groß - nicht zuletzt deshalb, weil schwule Fußballer bei Vereinen, Verbänden und Fans nach wie vor ein absolutes Tabuthema darstellen. Für viele Beteiligte scheint es ein enormes Problem zu sein, den harten, disziplinierten Lebensstil eines Profifußballers mit den klischeehaften Vorstellungen eines sensiblen, homosexuellen Mannes in Einklang zu bringen. Die effektive Verkörperung von Kampfgeist, Siegeswille und Leidenschaft wird daher ausschließlich heterosexuellen Spielern zugetraut. Homosexuelle hingegen würden nicht entschlossen genug in Zweikämpfe gehen, könnten sich in Laufduellen nicht durchsetzen oder hätten gar Angst davor, sich in die Schusslinie des Balles zu werfen. Kurz: Schwulen Fußballern könne es unter keinen Umständen gelingen, den Männlichkeitsanforderungen des Profifußballs auch nur annähernd gerecht zu werden. Doch wie sehen diese Männlichkeitsanforderungen konkret aus? Und was ist Männlichkeit überhaupt? Was macht Männlichkeit aus? Plakativ gefragt: Können schwule Fußballer nicht männlich sein? Und sind im Umkehrschluss alle heterosexuellen Fußballer ‚automatisch‘ männlich?
Betrachtet man die optische Selbstinszenierung einiger weltbekannter Fußballstars, so bietet sich einem ein kontroverses Bild. Während Profis wie David Beckham oder Cristiano Ronaldo aufgrund ihres gepflegten, oftmals feminin anmutenden Äußeren häufig in die Nähe von Weiblichkeit rücken, scheinen Spieler wie Wayne Rooney oder der von Kopf bis Fuß tätowierte, portugiesische Nationalspieler Raúl Meireles den Inbegriff der Männlichkeit darzustellen. Fußballer wie Lionel Messi oder Philipp Lahm hingegen wirken aufgrund ihrer zierlichen Statur und ihres harmlosen Erscheinungsbildes eher knabenhaft und burschikos. So unterschiedlich sie auch aussehen mögen, eines haben all diese Spieler gemein: Sie schaffen es, aufgrund ihrer Leistungen auf dem Platz als Idealform ihrer Spezies anerkannt zu werden. Dass diese Idealform heteronormativ ausgerichtet ist, spielt dabei eine immanent wichtige Rolle in der öffentlichen Wahrnehmung - schließlich sind es männlich konnotierte Eigenschaften wie Aggressivität, Brutalität und Furchtlosigkeit, welche ein erfolgreicher Fußballer in sich vereinen muss, um an die Weltspitze zu gelangen. Und in jenes Kollektiv aus ‚typisch männlichen’ Attributen reiht sich eben auch die körperliche Zuneigung zum anderen Geschlecht als eine Art ‚Pflichtsexualität‘ ein. Männlichkeit scheint somit primär keine Frage von Auftreten und Optik zu sein, sondern das Produkt von Leistung, Können und Erfolg.
Was jedoch, wenn der Erfolg ausbleibt? Wenn Zweikämpfe verloren gehen, Sprints misslingen, und das eigene Spiel eine Vielzahl von Mängeln aufweist? Dann werden Fehlpässe auch mal als „schwule Pässe“ (Emcke/Müller-Wirth 2014) bezeichnet. Es scheint, als würde die sexuelle Orientierung eines Spielers unweigerlich mit seiner spielerischen Qualität zusammenhängen. Die Verwendung des Adjektivs ‚schwul’ stellt dabei eine Art Kompromiss dar: Zwar entspricht die hervorgebrachte Leistung nicht dem männlichen Ideal, dennoch ist sie aufgrund des biologischen Geschlechts des Spielers klar von der Weiblichkeit abzugrenzen. Schließlich könnte man, ausgehend von einem semiotischen Verständnis des Begriffs, Nicht-Männlichkeit auch als Weiblichkeit auslegen. Dass dies in der Praxis jedoch nicht der Fall ist, kann als wichtiger Anhaltspunkt für die Pluralität von Männlichkeit gedeutet werden.
Bis zu diesem Zeitpunkt lassen sich also mindestens zwei verschiedene Formen von Männlichkeit identifizieren: Eine ‚ideale Männlichkeit’, welche die normativen Anforderungen der Gesellschaft in vollem Ausmaß erfüllen kann, sowie eine ‚schwule Männlichkeit’, welcher es scheinbar nicht gelingt, den sozial konstruierten Standards jener ‚idealen Männlichkeit’ gerecht zu werden. Dass die beiden Männlichkeitsausprägungen zwar nebeneinander, nicht jedoch auf derselben Hierarchieebene existieren, wird auch im Kontext des Vereinsfußballs deutlich: Man erzählt sich Schwulenwitze, verwendet ‚schwul’ als Synonym für Adjektive wie ‚schlecht’, ‚schwach’ oder ‚unfähig’ und obendrein wird auch noch eine Art ‚Hexenjagd’ betrieben, indem untereinander Gerüchte darüber verbreitet werden, welche Spieler aus den gegnerischen Mannschaften angeblich homosexuell sind (vgl. ebd.). Verschiedene Männlichkeiten stehen somit in einem über- bzw. untergeordneten Machtverhältnis zueinander, welches im eben genannten Beispiel durch verbale Äußerungen und Diffamierungsakte ihren Ausdruck findet. Doch sind jene Maßnahmen, welche dazu dienen, andere Individuen zu Gunsten der eigenen Vormachtstellung zu unterdrücken, lediglich verbaler Natur? Oder spielt vielmehr auch Körperlichkeit eine entscheidende Rolle bei der Konstruktion von Männlichkeit?
In der vorliegenden Masterarbeit befasse ich mich mit der Frage, wie es im fußballerischen Rahmen zur Entstehung von verschiedenen Männlichkeitsformen kommt, und wie diese konkret aussehen. Dieser Ausgangsfrage geht einerseits die Annahme voraus, dass Männlichkeit nicht auf ‚natürlichen’ Tatsachen basiert, sondern stets durch eine Vielzahl von Interaktionen hergestellt, (re)produziert und verfestigt werden muss, und andererseits, dass es nicht eine, sondern viele verschiedene Arten von Männlichkeit zu beobachten gibt. Um also erklären zu können, welche verschiedenen Ausprägungen von Männlichkeit existieren, muss zunächst geklärt werden, wie Männlichkeit in der Praxis hergestellt wird. Auch dies soll im Zuge meiner Arbeit ausführlich erläutert und analysiert werden.
Ich bin davon überzeugt, dass neben der Sport- und Geschlechtersoziologie vor allem der Jugendfußball von den Ergebnissen meiner Forschung profitieren könnte. Die Adoleszenz gilt als wichtige Phase für die Entwicklung der männlichen Geschlechtsidentität (vgl. Meuser 2001: 17). Dementsprechend wäre es für Vereine und Verbände sicher von großem Interesse, ihre Teambildungsmaßnahmen auf die geschlechtsspezifische Sozialisation von Jungs, und damit einhergehend auch auf die stellenweise oppressiv ausgerichteten Praktiken des männlichen Mannschaftssports abzustimmen. Ich erachte es als wünschenswert, interne Rivalitäten durch gezielte Trainingseinheiten, Gesprächsrunden und Mannschaftsbesprechungen auf ein Minimum zu reduzieren, um somit den inneren Zusammenhalt der Mannschaft zu stärken. Im besten Falle würde dies in einem offeneren Umgang mit dem Thema Sexualität resultieren, was wiederum die langwierige Debatte um das Tabu des ‚schwulen Fußballers’ positiv vorantreiben könnte.
Zum Aufbau meiner Arbeit: In einem ersten Schritt soll die Entstehung der Männlichkeitsforschung chronologisch nachgezeichnet werden (Kap. 2). Dies ist nötig, um ein elementares Verständnis für die theoretischen Ausgangs- und Anknüpfungspunkte des heutigen Forschungsstandes zu entwickeln. Die Geschichte der Männlichkeitsforschung wird dabei insbesondere im Hinblick auf die feministische Patriarchatskritik sowie die sozialpsychologische Geschlechtsrollentheorie rekonstruiert.
Im Anschluss daran soll die theoretisch-analytische Rahmung meiner Arbeit erläutert werden. Dabei gilt es zunächst, sich dem Männlichkeitsbegriff aus verschiedenen Forschungsperspektiven definitorisch anzunähern (Kap. 3.1). Zu diesem Zweck werden sowohl normative, als auch essentialistische, positivistische und semiotische Sichtweisen auf das Verständnis von Männlichkeit besprochen. Dieser Schritt dient als unverzichtbare Basis für weitere theoretische Überlegungen, da er die Komplexität und den Facettenreichtum von Männlichkeit aus einer Vielzahl von unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet.
Das darauffolgende Unterkapitel beschäftigt sich mit der Frage, wie Männlichkeit in der Praxis hergestellt wird (Kap. 3.2). Anhand des ‚doing gender‘-Ansatzes von West/Zimmerman (1987) soll gezeigt werden, dass Geschlecht nichts ‚Natürliches’ ist, was man ‚einfach so‘ hat, sondern dass es durch alltägliche Interaktionen und Praktiken kontinuierlich hergestellt und verfestigt werden muss.
Als Nächstes kommt es zu einer ausführlichen Darstellung der für meine Arbeit zentralen Theorieansätze (Kap.3.3.1 bis Kap. 3.3.2). Dabei erläutere ich sowohl Raewyn Connells[1] Konzept der hegemonialen Männlichkeit (1987, 2000), als auch Pierre Bourdieus Theorie der männlichen Herrschaft (1997a, 2005). Beide Ansätze beschäftigen sich mit dem binnengeschlechtlichen Verhältnis von Männern und sind deshalb bestens für mein Vorhaben geeignet.
Da sich meine empirische Forschung primär an den von Connell formulierten Männlichkeitsformen orientiert, kommt es danach zu einer kritischen Auseinandersetzung mit den von ihr entwickelten Männlichkeitsformen (Kap. 3.4). Dies ist für meine Arbeit von enormer Bedeutung, da ich Connells Konzept auf Basis jener Kritik für meine eigene Forschung modifizieren werde.
Das finale Unterkapitel des Theorieblocks erfüllt schließlich den Zweck, den Bezug zwischen der theoretischen Rahmung und meiner eigenen empirischen Arbeit herzustellen (Kap. 3.5). Entlang von Michael Meusers (2003, 2008a) Auffassung des Wettbewerbs als ein „zentrales Mittel männlicher Sozialisation“ (Meuser 2008a: 34) sollen wichtige Anhaltspunkte für die Entwicklung und Anwendung meines Forschungsdesigns gesammelt werden.
Der nächste Schritt besteht in der Betrachtung von Männlichkeit als Gegenstand der empirischen Sozialforschung. Hierbei kommt es zunächst zu einer thematisch gegliederten Darstellung des aktuellen Forschungsstandes (Kap. 4.1). Anschließend soll der Nutzen von qualitativen und quantitativen Methoden bei der Untersuchung von Männlichkeit aufgezeigt werden. Dabei werden die verschiedenen Methoden sowohl vorgestellt, als auch hinsichtlich ihrer Eignung im Zuge meines eigenen Forschungsvorhabens diskutiert (Kap. 4.2 bis 4.3).
Das darauffolgende Kapitel befasst sich mit dem Thema ‚Männlichkeit und Fußball‘. Hier werde ich zunächst die Geschichte des modernen Fußballs in Bezug auf sein heutiges Image als ‚Männersport’ rekonstruieren (Kap. 5.1). Dabei soll insbesondere erklärt werden, weshalb Fußball heutzutage in unserer Gesellschaft als Domäne des männlichen Gestaltungswillens gilt, und wie es im Laufe des letzten Jahrhunderts zur systematischen Exklusion von Frauen aus dem aktiven Fußballgeschehen kam. Um den Anschluss an thematisch ähnliche Arbeiten gewährleisten zu können, wird außerdem noch ein Blick auf den aktuellen Stand der Männlichkeitsforschung zum Thema ‚Fußball‘ geworfen (Kap. 5.2).
Als Nächstes erfolgt schließlich die Entwicklung eines eigenen Forschungsdesigns, mit welchem sich Männlichkeit im Feld des Fußballs untersuchen lässt (Kap. 6). Ich greife dabei sowohl auf qualitative, als auch auf quantitative Methoden der empirischen Sozialforschung zurück. Während der qualitative Teil meines Designs im Zuge dieser Arbeit sowohl angewendet als auch ausgewertet wird, soll der quantitative Teil lediglich für zukünftige Forschungsvorhaben formuliert werden.
In einem weiteren Schritt kommt es zur ausführlichen Diskussion meiner empirischen Ergebnisse (Kap. 7). Dabei werden auch die Stärken und Schwächen meines qualitativen und quantitativen Forschungsdesigns sowie etwaige Limitationen der eigenen Arbeit nochmals ausgiebig reflektiert.
Abschließend werde ich in einem kurzen Fazit auf die Erkenntnisse meiner Forschung eingehen (Kap. 8). Dabei sollen sowohl der Nutzen der eigenen Forschung sowie Ideen für weiterführende Fragestellungen besprochen werden.
2 Zur Entstehung der Männlichkeitsforschung
Die Erforschung von Männern und Männlichkeit ist seit etlichen Jahrzehnten[2] ein zentraler Bestandteil der interdisziplinären Geschlechterforschung. Den initialen Anstoß zur Debatte um die vorherrschenden Geschlechterverhältnisse, und die damit unweigerlich verbundene Frage nach der gesellschaftlichen Stellung von Männern, bildete damals die zweite Welle des Feminismus, welche bereits Mitte der 1960er Jahren in den USA begann und sich im Laufe der kommenden Jahrzehnte über weite Teile der westlichen Welt ausbreitete (vgl. Gamble 2001: 25ff). Während sich die erste Welle des Feminismus noch primär auf die juristische und demokratische Gleichstellung von Frauen konzentrierte[3], wurde während der zweiten Welle eine Vielzahl von weiteren Themen in den Fokus gerückt. Insbesondere die Bereiche Sexualität, Familie und Arbeit, aber auch andere gesetzlich verankerte Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen sollten dabei öffentlich verhandelt und diskutiert werden (vgl. Lorber 2010: 3).
Die zweite Welle des Feminismus hatte jedoch auch zur Folge, dass es in den 1990er Jahren zu einem breiten Spektrum an Reaktionen von Seiten der westlichen Männer kam. So ließ sich zum einen eine antifeministische Backlash-Bewegung beobachten, welche darauf abzielte, den sich ausbreitenden Feminismus dauerhaft und effizient zu unterbinden (vgl. Faludi 1991: 18). Dies geschah unter anderem dadurch, dass dem Feminismus im öffentlichen Diskurs diverse soziale Probleme und Mythen angelastet wurden, welche die Emanzipation der Frauen in ein schlechtes Licht rücken sollten (vgl. Boyd et. al 2007: 99). Auch die erziehungspolitische Diskussion um eine geschlechterbedingte Benachteiligung von Jungen im vorherrschenden Bildungssystem (vgl. Cox 1995; Yates 1997; Martino/Meyenn 2001) lässt sich in diesem Zusammenhang durchaus als antifeministisch motivierte Debatte betrachten (vgl. Wedgwood/Connell 2010: 116). Auf der anderen Seite formierte sich eine profeministische Männerbewegung, welche sich gegen Sexismus und geschlechtsbedingte Diskriminierung stark machte und die Gleichstellungsziele des Feminismus tatkräftig unterstützte (vgl. Wood 2008: 83ff). Zwischen diesen beiden Extrempositionen agierte schließlich noch die esoterisch verwurzelte mythopoetische Männerbewegung, deren Ziel es war, die männliche Selbstwahrnehmung durch die Aufrechterhaltung des psychischen und emotionalen Wohlbefindens zu fördern. Genderpolitischen Themen wurde dabei stets mit einer gewissen Neutralität und Gleichgültigkeit begegnet, was der mythopoetischen Männerbewegung viel Kritik von Seiten der Feminist_innen[4] einbrachte (vgl. Messner 2000: 21ff).
Obwohl die Auswirkungen der zweiten Welle des Feminismus ein breites Spektrum an Diversität aufwiesen, so hatten sie doch eins gemein: Es kam unweigerlich zu einer Problematisierung von Männern und Männlichkeit. Durch die vielfältigen Reaktionen aus weiten Teilen der westlichen Welt wurde Mitte der 1970er Jahre im Rahmen der feministischen Geschlechterforschung erstmals auch die Rolle von Männern in den Sozialwissenschaften verstärkt hinterfragt (vgl. Wedgwood/Connell 2010: 116). Das Ziel der sich daraus entwickelnden Männlichkeitsforschung war es schließlich, „Männlichkeit in einer relationalen Perspektive als Dimension der Kategorie Geschlecht zu betrachten und zu analysieren“ (Bereswill et al. 2011: 8). Eben jene Zielsetzung hat auch der Soziologe Harry Brod Ende der 1980er Jahre in einem der ersten veröffentlichten Reader zum Thema Männlichkeit artikuliert:
„The most general definition of men’s studies is that it is the study of masculinities and male experiences as specific and varying social-historical-cultural formations. Such studies situate masculinities as objects of study on a par with femininities, instead of elevating them to universal norms” (Brod 1987: 40).
Grob betrachtet lässt sich die Geschichte der Männlichkeitsforschung anhand zwei verschiedener Entstehungskontexte nachzeichnen. So gründet sie zum einen auf der sozialpsychologischen Geschlechtsrollentheorie, welche sich seit Mitte der 1970er Jahre mit wandelnden Geschlechterverhältnissen und den damit einhergehenden Auswirkungen für Männer beschäftigt. Der Fokus wurde dabei vor allem auf die negativen Aspekte des Mannseins gelegt. Unter Schlagwörtern wie ‚Rollenstress’ oder ‚Rollenkonflikt’ sollte darauf aufmerksam gemacht werden, dass Männer tagtäglich mit diversen Unsicherheiten zu kämpfen haben und sich kontinuierlich den stets wechselnden, oft gegensätzlichen Anforderungen an ihre Rolle anpassen müssen. All das resultierte in einem generellen Abwehrverhalten, da viele Aspekte des traditionell männlichen Auftretens von den Feminist_innen als sexistisch oder unterdrückend wahrgenommen wurden (vgl. O’Neil 1982: 6). Besonders drastisch ist dieser Umstand vor allem in Verbindung mit Studien, welche zeigen, dass Männer im Vergleich zu Frauen deutlich seltener psychologische Hilfe aufsuchen, wenn sie unter mentalen Problemen leiden (vgl. Kessler et al. 1981; Tudiver/Talbot 1999).
Des Weiteren resultiert die Männlichkeitsforschung aus der feministischen Patriarchatskritik, in deren Kontext vor allem die Arbeiten aus den späten 1980er Jahren auch heute noch als bedeutende Referenzwerke im Feld der Männlichkeitsforschung gelten (vgl. Bereswill et al. 2011: 8). Im Vergleich zum Geschlechtsrollenkonzept, welches im Laufe der letzten Jahre hauptsächlich in Form von Ratgebern und sonstigen trivialliterarischen Kontexten aufgegriffen wurde[5], kann die feministische Patriarchatskritik als Auslöser für eine stärkere Fokussierung auf Männlichkeit in einer herrschaftstheoretischen und gesellschaftskritischen Perspektive betrachtet werden (vgl. Bereswill et al. 2011: 9). Zu den wichtigsten Werken, welche in diesem Kontext zu den Anfängen der ‚kritischen Männlichkeitsforschung’ entstanden sind, zählen Jeff Hearns „The Gender of Oppression“ (1987) sowie Raewyn Connells „Gender and Power“ (1987).
In Deutschland stellt die Männlichkeitsforschung ein noch wenig institutionalisiertes Forschungsfeld dar. Dennoch werden seit den späten 1980er Jahren auch im deutschsprachigen Raum viele Arbeiten zum Thema ‚Männlichkeit‘ auf dem Gebiet der Geschlechterforschung veröffentlicht. Einen nennenswerten Beitrag stellt dabei das in der Publikationsreihe der Sektion Frauenforschung der Deutschen Gesellschaft für Soziologie erschienene Werk „FrauenMännerBilder“ (Hagemann-White/Rerrich 1988) dar. Es dokumentiert die Debatte über die Fragen, ob Männer und Männlichkeit auch Gegenstand der feministischen Forschung sein sollten, und falls ja, wie eine solche feministische Erforschung von Männlichkeit aussehen könnte. Auslöser für jene Diskussion war ein Vortrag von Elke Gravenhorst auf dem Soziologentag 1984 in Dortmund, in welchem sie forderte, dass sich die Frauenforschung ihrer „impliziten Bilder über Männer und Männlichkeit bewusst werden müsse“ (Bereswill et al. 2011: 7; vgl. Gravenhorst 1988).
In den letzten Jahren konnte ein enormer Zuwachs an empirischen Studien zum Thema Männer und Männlichkeit beobachtet werden[6]. Dies lässt meiner Ansicht nach darauf schließen, dass das Feld der Männlichkeitsforschung auch in Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen wird.
3 Die Verhandlung von Männlichkeit in der Theorie
In diesem Kapitel soll der theoretisch-analytische Rahmen meiner Arbeit genauer erläutert werden. Der erste Schritt besteht deshalb darin, sich dem Männlichkeitsbegriff aus verschiedenen Forschungsperspektiven definitorisch anzunähern. Zu diesem Zweck werden sowohl normative, als auch essentialistische, positivistische und semiotische Sichtweisen auf das Verständnis von Männlichkeit beschrieben und gegenübergestellt. Um verstehen zu können, wie Männlichkeit in alltäglichen Interaktionen hergestellt wird, erläutere ich daraufhin den von West/Zimmerman (1987) entwickelten Ansatz des ‚doing gender‘. Dieser ist von enormer Bedeutung für mein weiteres Forschungsvorhaben, da verschiedene Männlichkeitsformen sich nur dann herausbilden können, wenn Männlichkeit nicht als ‚natürlich gegeben‘ aufgefasst wird, sondern durch bestimmte Praktiken aktiv hergestellt werden muss. Im Anschluss kommt es zu einer ausführlichen Darstellung der für meine Arbeit zentralen Theorien. Es handelt sich dabei zum einen um Raewyn Connells Konzept der hegemonialen Männlichkeit und zum anderen um Pierre Bourdieus Theorie der männlichen Herrschaft. Nach der Vorstellung beider Konzepte kommt es zur kritischen Auseinandersetzung mit einzelnen Theorieaspekten. Abschließend stelle ich den Bezug zwischen der theoretischen Rahmung und meiner eigenen empirischen Arbeit her, indem ich im Anschluss an Michael Meusers Auffassung des Wettbewerbs als ein „zentrales Mittel männlicher Sozialisation“ (Meuser 2008a: 34) wichtige Anhaltspunkte für die eigene Feldforschung zusammentrage.
3.1 Männlichkeit - ein Definitionsversuch
„Wann ist ein Mann ein Mann?“ - mit dieser prägnanten Zeile aus seinem Song ‚Männer‘ gelang es Herbert Grönemeyer vor knapp 30 Jahren, die Frage nach der Rolle und Positionierung von Männern in der Gesellschaft in einem popkulturellen Kontext medienwirksam zu thematisieren. Und dennoch: Bis heute gibt es keine universell gültige Antwort auf die Frage, wie sich Männlichkeit genau definieren lässt. Dies liegt primär daran, dass sich Männlichkeit stets an kulturellen Normen und Idealen orientiert, welche sowohl zeitlich als auch örtlich stark variieren und somit eine einheitliche Definition des Begriffs unmöglich machen. Dennoch soll im Folgenden versucht werden, sich dem Kern von Männlichkeit zu nähern.
Das moderne Verständnis von Männlichkeit beruht auf der Vorstellung, dass individuelle Unterschiede und die persönliche Handlungsfähigkeit dafür verantwortlich sind, welcher Typ Mensch man ist. Diese Annahme basiert auf dem Konzept der Individualität, welches im Zuge der zunehmenden Kolonialisierung und kapitalistischen Wirtschaftsbeziehungen im Europa der frühen Moderne entstanden ist (vgl. Connell 2000: 87f). Unmännliche Menschen verhalten sich demnach eher untypisch für das derzeit vorherrschende westliche Verständnis von Männlichkeit: Sie sind devot statt dominant, physisch schwach statt stark, oder tragen lange statt kurze Haare - und rücken damit unweigerlich in die Nähe von Weiblichkeit. Männlichkeit könnte ohne Weiblichkeit jedoch gar nicht existieren, da sich die beiden Begriffe durch ihre innere Relationalität gegenseitig bedingen. Somit kann eine Gesellschaft nur dann ein Konzept von Männlichkeit entwickeln, wenn Männer und Frauen diskursiv mit polarisierten Charaktereigenschaften ausgestattet werden. Die Geschichtsforschung geht davon aus, dass dies in Europa vor Beginn des 18. Jahrhunderts nicht der Fall war: Zwar wurden Männer und Frauen stets als unterschiedlich wahrgenommen, jedoch in dem Sinne, dass Frauen als unvollkommene und mangelhafte Wesen desselben Charakters galten (vgl. ebd.: 88). Die Idee, dass Männer und Frauen unterschiedliche Charaktere besitzen, entwickelte sich erst im Laufe des 19. Jahrhunderts, als die bourgeoise Ideologie der ‚getrennten Sphären‘[7] zur gesellschaftlichen Norm wurde (vgl. Becker 2000: 244). Männlichkeit ist demnach ein Produkt der kulturellen Herstellung von Geschlecht und muss stets auch als solches verstanden werden.
Wenn man sich nun die verschiedenen Männlichkeitsdefinitionen ansieht, so setzen die meisten von ihnen den kulturellen Standpunkt unserer Gesellschaft einfach voraus, ohne ihn jedoch in irgendeiner Form zu hinterfragen. Dennoch verfolgen sie verschiedene Strategien bei der Charakterisierung einer männlichen Person. Hinsichtlich ihrer Logik lassen sich demnach vier verschiedenen Strategien unterscheiden:
Essentialistische Definitionen
Die essentialistischen Definitionen von Männlichkeit zeichnen sich zumeist dadurch aus, dass sie sich einem bestimmten Aspekt widmen, welcher das Schlüsselelement von Männlichkeit erfassen soll. Auf Basis dieses Aspekts wird schließlich das gesamte Leben der Männer erklärt. Sigmund Freud setzte beispielsweise Männlichkeit mit Aktivität gleich, während er Frauen Passivität zuschrieb[8] (vgl. Freud 1948: 454). Im weiteren Verlauf sollten schließlich Begriffe wie Risikofreudigkeit und Aggression oder gegensätzliche Attribute, wie Verantwortlichkeit und Unverantwortlichkeit, den Kern von Männlichkeit darstellen.
Die Schwäche des Ansatzes liegt in der Willkür der Begriffswahl begründet. Es findet keinerlei Einigung auf die Essenz von Männlichkeit statt. Dies liegt unter anderem daran, dass es von Seiten des Essentialismus keinerlei Bestreben danach gibt (vgl. Connell 2000: 88f).
Positivistische Definitionen
Die positivistische Sozialwissenschaft versucht ihr Verständnis von Männlichkeit so einfach wie möglich zu formulieren: „männlich ist, wie Männer wirklich sind“ (ebd.: 89). Um dieser Wirklichkeit näher zu kommen, wird unter anderem auf (M/F)-Skalen[9] zurückgegriffen. Diese erheben aufgrund ihres statistischen Ursprungs den Anspruch, valide zwischen Männern und Frauen trennen zu können. Dementsprechend sei es auch möglich, männliche und weibliche Eigenschaften und Charakterzüge klar voneinander zu unterscheiden. Dass die Verwendung solcher Skalen nicht zwangsläufig zu reliablen Ergebnissen führt, wurde jedoch bereits des Öfteren kritisiert (vgl. Constantinople 1973; Archer 1989; McHugh/Frieze 1997).
Die Schwachpunkte dieser Definition sind vielzählig: So kann man dem hohen Anspruch einer neutralen und wertfreien Beschreibung der einzelnen Items nie gerecht werden, da sämtliche Komponenten einer (M/F)-Skala auf bereits getroffene Vorannahmen über das soziale Geschlecht zurückgreifen. Auch die Tatsache, dass bei den Untersuchungen in den Kategorien ‚Männer’ und ‚Frauen’ gedacht wird, stellt sich als äußerst problematisch heraus. Schließlich gründet die positivistische Herangehensweise genau auf jener Typisierung, welche es eigentlich zu erforschen gilt. Auch ist es laut dieser Definition nicht möglich, eine Frau als ‚männlich’ oder einen Mann als ‚weiblich’ zu beschreiben. Im Gegenteil: Wenn Männer und Frauen absolut homogene Gruppen wären, könnte man vollständig auf die Verwendung von Adjektiven wie ‚männlich’ oder ‚weiblich’ verzichten, da man mit ‚Männer’ und ‚Frauen’ bereits jene Charakterisierung vorgenommen hat (vgl. Connell 2000: 89).
Normative Definitionen
Die normativen Auslegungen von Männlichkeit berücksichtigen den letztgenannten Kritikpunkt und relativieren somit das positivistische Verständnis einer Männlichkeit, welche ausschließlich von Männern verkörpert werden kann. Dementsprechend lautet der normative Standard: „Männlichkeit ist, wie Männer sein sollten“ (ebd.: 90). Somit ist Männlichkeit nicht mehr zwangsläufig an das biologische Geschlecht des Mannes gebunden, sondern wird in Bezug zum sozialen Geschlecht gesetzt. Die normativen Wertvorstellungen basieren dabei auf Musterbeispielen aus Bereichen wie Film, Fernsehen, Literatur oder Sport. Die strikte Geschlechtsrollentheorie betrachtet Männlichkeit somit als eine Norm, deren Erfüllung das Ziel aller Männer sein sollte (vgl. ebd.).
Das Problem an der normativen Vorstellung einer Männlichkeit ist, dass das Streben nach ihr nur in eingeschränktem Maße erfolgen kann: Kaum ein Mann schafft es, sämtliche Facetten einer normativ vorgegebenen Männlichkeit zu erfüllen. Von daher stellt sich die Frage, wie etwas als Norm gelten kann, was nur von den wenigsten Männern auch tatsächlich realisiert wird (vgl. ebd.).
Semiotische Definitionen
Bei der semiotischen Perspektive wird Männlichkeit durch ein System von symbolischen Differenzen definiert. Dies geschieht, indem männliche und weibliche Standpunkte miteinander konfrontiert werden. Männlichkeit wird demnach als Nicht-Weiblichkeit ausgelegt. Den theoretischen Ausgangspunkt dieses Ansatzes bildet die strukturelle Linguistik, bei welcher Sprechelemente aufgrund ihrer Unterschiede zueinander definiert werden[10]. Im Gegensatz zu essentialistischen, positivistischen und normativen Definitionen schaffen es semiotische Ansätze, eine willkürliche und oftmals widersprüchliche Wahl von elementaren Kernaspekten zur Beschreibung von Männlichkeit zu vermeiden (vgl. ebd.: 90f).
Der Schwachpunkt von semiotischen Definitionen besteht darin, dass sie nur dann uneingeschränkt gelten können, wenn man davon ausgeht, dass in der sozialen Analyse ausschließlich Diskurse betrachten werden können (vgl. ebd.: 91). Um das gesamte Spektrum an Themen im Umkreis von Männlichkeit zu berücksichtigen, muss auch über Beziehungen anderer Art gesprochen werden. Dabei kann es sich beispielsweise um die „geschlechtsspezifische Positionierung in Produktion und Konsumption, in Institutionen und in der natürlichen Umgebung, in sozialen und militärischen Auseinandersetzungen“ (ebd.) handeln.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Männlichkeit in ihrer symbolhaften Form nur dann existieren und verstanden werden kann, wenn sie in einem System von zusammenhängenden Symbolen eingebettet ist. Ohne die systematische Konstruktion von Geschlechterbeziehungen ist es nicht möglich, ein Konzept von Männlichkeit zu entwickeln. Auch sollte Männlichkeit nicht als statisches Objekt verstanden werden, sondern vielmehr als flexibles Resultat von Interaktionsprozessen, welche dafür verantwortlich sind, dass Männer und Frauen ein vergeschlechtlichtes Leben führen. Männlichkeit ist somit „eine Position im Geschlechterverhältnis; die Praktiken, durch die Männer und Frauen diese Position einnehmen, und die Auswirkungen dieser Praktiken auf die körperliche Erfahrung, auf Persönlichkeit und Kultur“ (ebd.).
3.2 Männlichkeit als soziale Konstruktion
Männlichkeit ist keine ‚natürliche’ Tatsache, sondern vielmehr das Produkt einer kontinuierlichen Konstruktionsleistung. Ganz im Sinne von Simone de Beauvoirs berühmten Zitat „man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es“ (Beauvoir 2000: 334) müssen auch Männer tagtäglich Geschlecht in Interaktionsprozessen (re)produzieren und darstellen.
Ein Ansatz, welcher jenen permanent ablaufenden Prozess der Geschlechtsherstellung zu erklären versucht, ist das von Candace West und Don H. Zimmerman (1987) entwickelte Konzept des ‚doing gender’. Es handelt sich dabei um einen aktionsorientierten Analyseansatz, welcher Geschlecht als das Produkt von performativen Tätigkeiten begreift. West/Zimmerman nehmen an, dass man im Alltag permanent das sozial erlernte und erwartete Geschlecht herstellt, was letztendlich in einer Stabilisierung der bestehenden Geschlechterverhältnisse resultiert. Somit ist Geschlecht nicht als feste Eigenschaft zu verstehen, sondern vielmehr als das Ergebnis von sozialen Prozessen, in denen Geschlecht als folgenreiche Unterscheidung hergestellt und verfestigt wird (vgl. Gildemeister 2004: 137).
Einen zentralen Baustein des ‚doing gender‘-Ansatzes bildet die dreistufige Neufassung der ‚sex-gender’ Differenzierung: West/Zimmerman unterscheiden bei ihrem Konzept zwischen den Begriffen ‚sex’, ‚sex-category’ und ‚gender’. Während ‚sex’ die Geburtsklassifikation des Geschlechts auf der Grundlage von gesellschaftlich vereinbarten biologischen Kriterien bezeichnet, beschreibt ‚sex-category’ die Zuordnung zu einem Geschlecht auf Basis der gesellschaftlich erwartbaren Darstellung einer identifizierbaren Zugehörigkeit. Erwähnenswerterweise muss diese Zuordnung jedoch nicht zwangsläufig mit der Geburtsklassifikation identisch sein. Mit dem Begriff ‚gender‘ beschreiben West/Zimmerman schließlich die intersubjektive Validierung von Geschlecht. Dazu müssen sich bestimmte Handlungen und Verhaltensweisen an normativen Vorgaben orientieren, um in Interaktionsprozessen angemessen interpretiert zu werden (vgl. Gildemeister 2004: 138).
Um zu erläutern, wie der Vorgang des ‚doing gender‘ in der Praxis abläuft, teilt Paula-Irene Villa (2006) den Prozess in verschiedene Kategorien auf. Im Anschluss an Hirschauer (1989) beschreibt sie die Geschlechtskonstruktion als ein Zusammenspiel von Geschlechtsdarstellung und -attribution.
Unter Geschlechtsdarstellung versteht man, dass jedes Individuum dafür sorgen muss, dass es als Mann oder Frau erkannt wird. Dies geschieht, indem man sich hinsichtlich bestimmter Eigenschaften, wie Kleidung, Stimme, Gestik, Mimik sowie einem ‚angemessenen‘ Verhalten gegenüber dem anderen Geschlecht an normativen Vorgaben orientiert.
Die Geschlechtsattribution beschreibt bestimmte Eigenschaften und Wertungen, welche einem Geschlecht zugeschrieben werden. Erst durch die Geschlechtsattribution kommt es in der sozialen Interaktion dazu, dass man von anderen Individuen als Mann oder Frau betrachtet wird. Anhand des Zusammenspiels von Geschlechtsdarstellung und Geschlechtsattribution lässt sich schließlich die Geschlechtszugehörigkeit zweifelsfrei festlegen (vgl. Villa 2006: 91f). Die alltägliche Herstellung von Geschlecht erfolgt somit durch die kontinuierliche (Re)produktion von geschlechtlich konnotierten Praktiken, da es durch die permanente Ausübung von bestimmten Handlungen, Sprechweisen oder auch der Kleidungswahl zur unmittelbaren Einverleibung der sozial konstruierten Geschlechtsnormen kommt. ‚Doing gender‘ ist demnach sowohl „das Ergebnis, wie auch die Rechtfertigung verschiedener sozialer Arrangements, sowie ein Mittel, eine der grundlegenden Trennungen der Gesellschaft zu legitimieren“ (Gildemeister 2004: 132). Dies bedeutet, dass es erst durch die alltägliche (Re)Produktion der binären Geschlechterteilung dazu kommt, dass die Differenz jener Geschlechter als ‚natürlich‘ und ‚angeboren‘ erscheint.
Eine zentrale Rolle bei der (Re)Produktion der binären Geschlechtereinteilung spielen Diskurse. Villa versteht darunter „Systeme des Denkens und Sprechens, die das, was wir von der Welt wahrnehmen, konstituieren, in dem sie die Art und Weise der Wahrnehmung prägen“ (Villa 2012: 20). Demnach wird ein Individuum erst dann zum Mann oder zur Frau, wenn es im Diskurs dazu gemacht wird. Im Anschluss an die Sprechakttheorie von John L. Austin (1972) identifiziert Villa performative Sprechakte als elementaren Bestandteil der sozialen Praxis. Für sie sind performative Äußerungen somit „Formen der Rede, die das, was sie besagen, dadurch, dass etwas gesagt wird, produzieren“ (Villa 2012: 26). Dies bedeutet, dass performative Äußerungen das ausführen, was gesagt wird, indem es gesagt wird. Es muss jedoch an dieser Stelle erwähnt werden, dass performative Äußerungen stets von der sozialen Position des Sprechers abhängig sind. Schließlich steht nicht jedem Individuum dasselbe Maß an Macht und Autorität zu[11].
Michael Meuser schließt nun an West/Zimmermans Konzept des ‚doing gender‘ an, indem er mit dem Begriff des ‚doing masculinity‘ all jene Praktiken umschreibt, die für die Konstruktion und Darstellung von Männlichkeit verantwortlich sind. Eine elementare Form der Männlichkeitskonstruktion erfolgt dabei durch die bewusste Abgrenzung zur Weiblichkeit. Den Bezugspunkt für das ‚doing masculinity‘ sieht Meuser in homosozialen Cliquen verankert. Hier sind es insbesondere körperliche Auseinandersetzungen, Mutproben, Wortgefechte oder sonstige Duellsituationen, in denen sich Männer untereinander beweisen müssen. Meuser beschreibt den Nutzen und die Auswirkungen von derartigen Praktiken wie folgt:
"Die jungen Männer sind einerseits ständig gefordert, ihre Männlichkeit unter Beweis zu stellen - insofern ist ihre Männlichkeit fragil -, sie wissen aber andererseits und werden darin durch die Gruppe bestärkt, was sie tun müssen, um sich als Mann zu beweisen - insofern gibt es eine habituelle Sicherheit. Es sind die ernsten Spiele des Wettbewerbs, in denen Männlichkeit sich formt, und die homosoziale Gemeinschaft sorgt dafür, dass die Spielregeln in das inkorporierte Geschlechtswissen der männlichen Akteure eingehen" (Meuser 2008a: 38).
Die Adoleszenz betrachtet Meuser somit als essentiell wichtige Phase für die Stabilisierung und Inkorporierung von ‚männlichen‘ Wert- und Normvorstellungen. Neben dem Wettbewerb zeigt sich der Prozess des ‚doing masculinity‘ häufig auch in Form von Gewaltakten, dem fahrlässigen Umgang mit der eigenen Gesundheit oder einer generellen Abneigung gegenüber Gefühlen und Emotionen. All jene Praktiken sind es, die im Zusammenspiel dafür sorgen, dass ein Mann als ‚männlich‘ wahrgenommen wird.
3.3 Zentrale Ansätze zur Erklärung des Geschlechterverhältnisses
Dieses Unterkapitel setzt sich zunächst mit Connells Theorie der hegemonialen Männlichkeit auseinander. Dabei soll der Fokus vor allem auf die Typisierung der unterschiedlichen Männlichkeitsformen gelegt werden. Dies ist von Nöten, um einen soliden Anknüpfungspunkt für die modifizierte Einteilung von verschiedenen Männlichkeitsausprägungen im Rahmen meiner eigenen Forschung gewährleisten zu können. Im Anschluss daran kommt es zu einer Darstellung von Bourdieus Konzept der männlichen Herrschaft, auf welchem Michael Meusers These des Wettbewerbs als ein „zentrales Mittel männlicher Sozialisation“ (Meuser 2008a: 34) aufbaut. Sowohl Connell, als auch Bourdieu und Meuser beschäftigen sich in ihren Arbeiten intensiv mit dem binnengeschlechtlichen Verhältnis von Männern, weshalb sich deren Ansätze hervorragend als theoretische Basis für meine weiterführenden Überlegungen eignen.
3.3.1 Raewyn Connell und das Konzept der hegemonialen Männlichkeit
Das Konzept der hegemonialen Männlichkeit beschreibt eine gesellschaftliche Praxis, welche die soziale Dominanz von Männern gegenüber Frauen, aber auch gegen alternative, nebeneinander existierende Formen von Männlichkeit dauerhaft absichern und erhalten soll. Es wurde erstmals in der Forschungsarbeit „Ockers & Disco-maniacs“ (Kessler et al. 1982) thematisiert. Die darin beschriebene Feldstudie beschäftigte sich mit sozialer Ungleichheit an australischen High-Schools. Sie lieferte Hinweise darauf, dass es sowohl in Bezug auf Geschlecht, als auch auf die Klassenzugehörigkeit zu verschiedenen Hierarchieformen kommt, welche unmittelbar mit der aktiven Konstruktion und Darstellung von Geschlecht zusammenhängen (vgl. Connell et al. 1982). Eine systematisierte Abhandlung von Connells Beobachtungen wurde schließlich in Form des Aufsatzes „Towards a New Sociology of Masculinity“ (Carrigan et al. 1985) veröffentlicht. Die Autoren kritisierten darin insbesondere das weitverbreitete Verständnis einer singulären männlichen Geschlechterrolle und schlugen im Gegenzug ein alternatives Modell vor, welches multiple Formen von Männlichkeiten berücksichtigt. Auch die Beziehung zwischen Geschlecht und Macht sollte dabei ausreichend thematisiert werden. Große Bekanntheit erlangte das Konzept schließlich im Zuge der Veröffentlichung von „Gender and Power“ (Connell 1987), welches auch heute noch als Referenzwerk im Feld der Männlichkeitsforschung gilt. Connell erklärt dabei zunächst die Grundzüge ihres Konzepts:
„’Hegemonic masculinity’ is always constructed in relation to various subordinated masculinities as well as in relation to women. The interplay between different forms of masculinity is an important part of how a patriarchal social order works“ (Connell 1987: 183).
In Anlehnung an Gramsci (1971) beschreibt Connell den Begriff der Hegemonie als soziale Vorherrschaft, welche durch ein Zusammenspiel von gesellschaftlichen Wertvorstellungen gewährleistet wird. Connell identifiziert demnach nicht die Androhung von körperlicher Gewalt oder juristischen Sanktionen als essentiellen Bestandteil einer Hegemonie. Vielmehr sind es gewisse Normen und Strukturen, basierend auf kulturellen Vorstellungen und gesellschaftlichen Idealen, welche über soziale Praktiken strukturierend auf die Gesellschaft einwirken. Connell macht diese Überlegung unter Einbezug von empirischen Beispielen deutlich:
„Ascendancy of one group of men over another achieved at the point of a gun, or by the threat of unemployment, is not hegemony. Ascendancy which is embedded in religious doctrine and practice, mass media content, wage structures, the design of housing, welfare/taxation policies and so forth, is“ (ebd.: 184).
An dieser Stelle muss jedoch betont werden, dass juristische Sanktionen und körperliche Gewalt durchaus mit der sozialen Vormachtstellung im Sinne einer Hegemonie einhergehen können[12]. Gewalt und Hegemonie schließen sich demnach nicht aus, sondern stehen in einem engen wechselseitigen Verhältnis zueinander (vgl. ebd.).
Connell hält fest, dass Hegemonie nicht als zeitlich unabhängige Form von Dominanz verstanden werden darf. Im Gegenteil: Es existieren zu jedem Zeitpunkt auch alternative Formen bestimmter Machtkonfigurationen. Diese sind zwar temporär untergeordnet, können jedoch durch gewisse kulturelle Entwicklungen und Normverschiebungen jederzeit selbst zu einem hegemonialen Muster werden. Dies erklärt auch, warum es in der Vergangenheit zu einem permanenten Wandel der hegemonialen Männlichkeit kam: Hegemonie ist zeitlich flexibel und bleibt somit stets adaptionsfähig (vgl. ebd: 184f). Dies steht im direkten Widerspruch zu starren Geschlechterrollenkonzepten, wie sie häufig auf Basis von empirischen Untersuchungen angefertigt wurden (z.B. Adorno et al. 1950). Und dennoch sieht Connell eine Verknüpfung zwischen spezifischen Männlichkeitstypen und dem Konzept der hegemonialen Männlichkeit. So sind es sowohl reale als auch fiktive Personen, welche als Produkt und Ausdrucksform von hegemonialer Männlichkeit betrachtet werden können[13]. Zwar gelingt es nur wenigen Männern, das Ideal dieser Charaktere auch tatsächlich zu verkörpern, viele von ihnen tragen jedoch aktiv dazu bei, dass das visuelle Abbild einer hegemonialen Männlichkeit durch die konsensuelle Hochstilisierung derartiger ‚Vorzeigepersönlichkeiten’ stets erhalten bleibt (vgl. Connell 1987: 185). Der Symbolcharakter besagter Vorbilder dient demnach der Sicherung der Hegemonie:
„The public face of hegemonic masculinity is not necessarily what powerful men are, but what sustains their power and what large numbers of men are motivated to support“ (ebd.).
Die komplizenhafte Unterstützung einer hegemonialen Männlichkeit kann dabei verschiedene Gründe haben. Neben der Erfüllung von gewissen Fantasien (wie das Hineinversetzen in bestimmte Rollen und Charaktere) oder dem Aus- bzw. Erleben von unterdrückten Aggressionen (wie es die Identifikation mit männlichen Protagonisten in Actionfilmen ermöglicht), zielt sie vor allem darauf ab, Profit aus der sozialen Unterordnung von Frauen zu schlagen. Dies heißt jedoch nicht, dass ausschließlich Vertreter einer hegemonialen Männlichkeit für die gesellschaftliche Unterdrückung von Frauen verantwortlich gemacht werden können[14]. Vielmehr kommt es auch von Seiten der Frauen zu einer Art ‚Akzeptanz’ dieser Unterwerfung, welche Connell als „emphasized femininity“[15] (ebd.: 183) bezeichnet.
Das Konzept der ‚emphasized femininity‘, welches komplementär zum Entwurf der hegemonialen Männlichkeit entwickelt wurde, beschreibt das „Einverständnis [der Frauen] mit der eigenen Unterordnung und die Orientierung an Interessen und Wünschen des Mannes“ (Meuser 2010: 101, nach Connell 1987: 183). Um dieses ‚Einverständnis’ auf Dauer gewährleisten zu können, muss sich die hegemoniale Männlichkeit einer Vielzahl von zeitgleich verlaufenden Strategien bedienen. Demnach findet eine kontinuierliche Verhandlung von geschlechterspezifischen Themen statt, welche sich maßgeblich im vorherrschenden Abbild einer hegemonialen Männlichkeit widerspiegeln. Jenes permanente, diskursive Verhandeln ist es, welches für die Dynamik einer sich stets wandelnden Geschlechterordnung verantwortlich gemacht werden kann (vgl. Connell 1987: 183f).
In ihrem Werk „Der gemachte Mann“[16] (Connell 2000) erweitert Connell das Konzept der hegemonialen Männlichkeit schließlich um zwei Ebenen: Zunächst wird in Form eines dreistufigen Modells die Struktur des sozialen Geschlechts dargestellt. Dies soll als Ansatz zur Erklärung der ungleichen Geschlechterordnung innerhalb der Gesellschaft dienen. Connell definiert den Begriff des sozialen Geschlechts dabei wie folgt:
„Das soziale Geschlecht ist eine Art und Weise, in der soziale Praxis geordnet ist. In Geschlechterprozessen wird der alltägliche Lebensvollzug organisiert in Relation zu einem Reproduktionsbereich[17] (...), der durch körperliche Strukturen und menschliche Reproduktionsprozesse definiert ist. Dieser Bereich beinhaltet sowohl sexuelle Erregung und Geschlechtsverkehr, als auch das Gebären und Aufziehen von Kindern, die körperlichen Geschlechtsunterschiede und -gemeinsamkeiten“ (ebd.: 92).
Im Anschluss an Mitchell (1981) und Rubin (1975) hält Connell fest, dass das soziale Geschlecht eine vielschichtige innere Struktur besitzt, in welcher verschiedene Logiken übereinander gelagert sind. Sie betrachtet diesen Umstand für die Analyse von Männlichkeiten als höchst bedeutsam, da jegliche Form von Männlichkeit gleichzeitig in einer Vielzahl von Beziehungsstrukturen verortet ist, welche unterschiedlichen historischen Entwicklungen entstammen können (vgl. Connell 2000: 94).
Um die Struktur des sozialen Geschlechts darzustellen, unterscheidet Connell zwischen drei Stufen: Macht, Produktion und emotionaler Bindungsstruktur (Kathexis[18] ).
Macht
Als wichtigste Achse der Macht betrachtet Connell die „allgegenwärtige Unterordnung von Frauen und die Dominanz von Männern“ (ebd.). Diese Feststellung sei zwar nicht ausnahmslos zutreffend, dennoch besitzt jene Struktur laut Connell in der heutigen westlichen Geschlechterordnung eine prinzipielle Allgemeingültigkeit. Auch vielfacher Widerstand, wie er von Seiten des Feminismus über Jahrzehnte hinweg auftrat, konnte diese Struktur nicht durchbrechen. Dennoch resultiert die Existenz von sozial überlegenen Frauen sowie das kontinuierliche Aufbegehren von Feminist_innen zwangsläufig in permanenten Schwierigkeiten hinsichtlich der Aufrechterhaltung der männlichen Vormachtstellung. Im Zuge dieses Widerstands kommt es schließlich zu der Frage nach der Legitimität der männlichen Dominanz, was laut Connell für die Männlichkeitspolitik von hoher Bedeutung ist (vgl. ebd.).
Produktion
Für Connell ist es kein statistischer Zufall, dass nicht Frauen, sondern Männer die großen Firmen des westlich-kapitalistischen Wirtschaftssystems leiten. Sie sieht diesen Umstand in der sozialen Konstruktion von Männlichkeit begründet, da das „Verständnis von Männlichkeit in Gefahr gerate, wenn es für den Mann unmöglich wird, seine Familie zu ernähren“ (ebd.: 112). Connell fordert deshalb, bei der Strukturanalyse des sozialen Geschlechts auch auf die wirtschaftlichen Folgen der geschlechtlichen Arbeitsteilung zu achten, da die ungleiche Beteiligung von Männern und Frauen an der Wirtschaft zwangsläufig einen „geschlechtsbezogenen Akkumulationsprozeß“ (ebd.: 95) von Macht und privatem Vermögen nach sich zieht. Dies bedeutet, dass es nicht nur zu einer ungleichen Verteilung von Löhnen, sondern auch von Kapital und Einfluss kommt. Für Connell steht die Akkumulation von Reichtum somit in einem direkten Zusammenhang mit dem über das gesellschaftliche Geschlechterverhältnis vermittelten Reproduktionsbereich (vgl. ebd.).
Emotionale Bindungsstruktur (Kathexis)
Als dritte Stufe ihres Modells betrachtet Connell die emotionale Bindungsstruktur. Dabei geht sie explizit auf das sexuelle Begehren ein. In Anlehnung an Freud definiert Connell das Begehren als „emotionale Energie, die an ein Objekt geheftet wird“ (ebd.). Somit sind diejenigen Praktiken, die für die Formierung und Realisierung des menschlichen Begehrens verantwortlich gemacht werden können, ebenfalls ein wichtiger Aspekt der Geschlechterordnung. Es gilt daher, auch die sozialen Umstände zu untersuchen, in denen das Begehren entsteht und ausgelebt wird. Insbesondere das Verhältnis zwischen Freiwilligkeit und Zwang spielt dabei eine große Rolle. Auch die Frage, ob sexuelle Befriedigung von einseitigem oder gegenseitigem Genuss geprägt ist, und ob dieser Genuss aktiver oder passiver Natur ist, nimmt bei der Analyse des Geschlechterverhältnisses eine hohe Bedeutung ein[19] (vgl. ebd.).
Connell hält fest, dass die gesamte soziale Praxis durch das soziale Geschlecht strukturiert wird. Aus diesem Grund ist es zwangsläufig auch mit weiteren sozialen Strukturen, wie beispielsweise Klasse oder Rasse, verknüpft (vgl. ebd.: 95f). Da dem Wechselspiel zwischen sozialem Geschlecht, Klasse und Rasse immer größere Aufmerksamkeit geschenkt wurde, rückte auch die Unterscheidung von verschiedenen Männlichkeitsformen immer mehr in den Fokus der Forschung[20]. Die Erkenntnis, dass es unterschiedliche Arten von Männlichkeit gibt, sei jedoch nur der erste Schritt in die richtige Richtung. Connell fordert deshalb:
„Wir müssen auch die Beziehungen zwischen den verschiedenen Formen untersuchen. Außerdem sollte man die Milieus von Klasse und Rasse auseinandernehmen und den Einfluß des sozialen Geschlechts innerhalb dieser Milieus berücksichtigen. Es gibt schließlich auch schwarze Schwule und effiminierte Fabrikarbeiter, Vergewaltiger aus der Mittelschicht und bürgerliche Transvestiten“ (ebd.: 97).
Das Geschlechterverhältnis unter Männern muss laut Connell deshalb beachtet werden, um eine starre Typologie zu verhindern, und um die nötige Flexibilität zu gewährleisten, Männlichkeit auch unabhängig von Zeit und Raum analysieren zu können (vgl. ebd.). Aus diesem Grund entwickelt sie vier verschiedene Ausprägungen von Männlichkeit, welche sie als „Hauptformen von Männlichkeit in der derzeitigen westlichen Geschlechterordnung“ (ebd.) bezeichnet.
Hegemoniale Männlichkeit
Der Begriff der hegemonialen Männlichkeit umschreibt die derzeit ‚durchsetzungsfähigste’ Form von Männlichkeit. In Anlehnung an Gramsci umschreibt Connell mit diesem Terminus die „gesellschaftliche Dynamik, mit welcher eine Gruppe eine Führungsposition im gesellschaftlichen Leben einnimmt und aufrechterhält“ (ebd.: 98). Sie definiert hegemoniale Männlichkeit dementsprechend als
„jene Konfiguration geschlechtsbezogener Praxis (...), welche die momentan akzeptierte Antwort auf das Legitimitätsproblem des Patriarchats verkörpert und die Dominanz der Männer sowie die Unterordnung der Frauen gewährleistet (oder gewährleisten soll)“ (ebd.).
Hegemoniale Männlichkeit ist demnach sowohl zeitlich als auch kulturell flexibel und kann somit jederzeit von Frauen und anderen Männlichkeitsentwürfen infrage gestellt werden. Des Weiteren muss klargestellt werden, dass die offensichtlichsten Vertreter der hegemonialen Männlichkeit nicht zwangsläufig auch die mächtigsten Positionen in der Gesellschaft einnehmen. Im Gegenteil: Sie dienen eher als bewusst konstruierte Vorbilder, welche zwar die Ideale und Vorstellungen einer hegemonialen Männlichkeit in sich vereinen, jedoch außerhalb ihres Milieus kaum Einfluss oder Macht genießen (vgl. ebd.). Beispielsweise verkörpern zwar Stars wie Brad Pitt, Johnny Depp oder Leonardo DiCaprio hegemoniale Männlichkeit in ihren Filmrollen, abseits der Industrie ist ihre gesellschaftliche Wirkmächtigkeit jedoch meist stark begrenzt. Bei sozial einflussreichen Männern, wie Bill Gates, Wladimir Putin oder dem Papst ist es hingegen so, dass ihr optisches Auftreten sowie der individuelle Lebensstil stark vom Ideal einer hegemonialen Männlichkeit abweichen. Nichtsdestotrotz genießen sie vielerorts Ansehen und nehmen großen Einfluss auf das Weltgeschehen.
Für Connell ist es wichtig, zu begreifen, dass hegemoniale Männlichkeit nur dann entstehen kann, „wenn es zwischen dem kulturellen Ideal und der institutionellen Macht eine Entsprechung gibt“ (ebd.). Diese kann sowohl kollektiver als auch individueller Natur sein. Laut Connell stellen die Führungsebenen von Politik, Wirtschaft und Militär eine „überzeugende, korporative Inszenierung von Männlichkeit zur Schau, die von feministischen Angriffen und sich verweigernden Männer immer noch ziemlich unberührt scheint“ (ebd.). Dies soll jedoch nicht heißen, dass hegemoniale Männlichkeit zwangsläufig durch körperliche Gewalt gesichert werden muss. Zwar kann Gewalt dazu führen, dass erwünschte soziale Muster gefördert und aufrechterhalten werden, nichtsdestotrotz zeichnet sich hegemoniale Männlichkeit in erster Linie durch eine mehr oder weniger fraglos hingenommene Autorität aus (vgl. ebd.).
Komplizenhafte Männlichkeit
Nur wenige Männer schaffen es, sämtliche normativ vorgegebenen Facetten einer hegemonialen Männlichkeit erfolgreich in sich zu vereinen. Dennoch profitieren die Komplizen von der Vorherrschaft der Hegemonie, da sie an der „patriarchalen Dividende[21] “ (ebd.: 100) teilhaben. Im Gegensatz zu den Vertretern der hegemonialen Männlichkeit setzen sich die Komplizen jedoch nicht den „Spannungen und Risiken an der vordersten Frontlinie des Patriarchats“ (ebd.) aus. Vielmehr sind sie aufgrund ihrer Rolle als Ehemänner, Väter und Beziehungspartner darauf angewiesen, tagtäglich Kompromisse mit Frauen einzugehen. Die Dominanz und unbestreitbare Autorität, welche der hegemonialen Männlichkeit zugeschrieben wird, kann in einem derartigen Rahmen nicht vollständig und widerstandslos ausgelebt werden (vgl. ebd.: 100f).
Der Entwurf einer komplizenhaften Männlichkeit ist für Connell deshalb so wichtig, weil er von der breiten Masse der Männer verkörpert wird. Zwar beruft sich Connell in ihrer Darstellung von Männlichkeit kaum auf Zahlen und Statistiken, nichtsdestotrotz hält sie fest, dass Geschlechterpolitik auch Massenpolitik ist, weshalb die Strategien einer hegemonialen Männlichkeit auch von der zahlenmäßig dominierenden komplizenhaften Männlichkeit befürwortet werden müssen (vgl. ebd.: 100).
Untergeordnete Männlichkeit
Nicht nur das Verhältnis zwischen Männern und Frauen zeichnet sich durch Dominanz und Unterwerfung aus. Auch die binnengeschlechtliche Beziehung verschiedener Männlichkeitsformen zueinander ist maßgeblich davon geprägt. Aus diesem Grund entwirft Connell die untergeordnete Männlichkeit als direktes Gegenstück zur hegemonialen Männlichkeit. Während Heterosexualität die wichtigste Eigenschaft der temporär vorherrschenden hegemonialen Männlichkeit darstellt[22], wird Homosexualität als elementares Merkmal einer untergeordneten Männlichkeit betrachtet. Connell bezieht sich dabei nicht nur auf die kulturelle Stigmatisierung von homosexuellen Männern, sondern auch auf eine Reihe von Praktiken, welche deren Unterordnung erzwingen soll. Diese umfassen „politischen und kulturellen Ausschluß, kulturellen Mißbrauch (...), staatliche Gewalt (...), Gewalt auf den Straßen (...), wirtschaftliche Diskriminierung und Boykottierung als Person“ (vgl. ebd.: 99). Connell sieht das oppressive Verhalten gegenüber homosexuellen Männern unter anderem in dem diskursiv erzeugten Image von AIDS als ‚Schwulenseuche‘[23] begründet. Demnach nahm die Sympathie für schwule Männer in den 1980er Jahren rapide ab, da sie als gesundheitliche Bedrohung für die Allgemeinbevölkerung wahrgenommen wurden (vgl. Connell 1987: 186).
Die systematische Unterdrückung von homosexueller Männlichkeit sorgt dafür, dass schwule Männer unweigerlich auf der untersten Ebene der männlichen Geschlechterhierarchie stehen. Sämtliche persönlichen Merkmale und Vorlieben, die der Ideologie einer hegemonialen Männlichkeit widersprechen, werden laut Connell sofort als ‚schwul’ interpretiert. Connell betont jedoch, dass prinzipiell auch heterosexuelle Männer die untergeordnete Männlichkeit verkörpern können, wenn sie die heteronormativen Strukturen der Gesellschaft missachten (vgl. Connell 2000: 99).
Marginalisierte Männlichkeit
Während die Entwürfe einer hegemonialen, komplizenhaften oder untergeordneten Männlichkeit als „interne Relationen der Geschlechterordnung“ (ebd.: 101) konzipiert sind, sorgt die Verknüpfung des sozialen Geschlechts mit weiteren Strukturen (wie Klasse oder Rasse) für die Entstehung von weiteren Männlichkeitsformen. Anhand des Begriffs der marginalisierten Männlichkeit beschreibt Connell nun die „Beziehungen zwischen Männlichkeiten dominanter und untergeordneter Klassen oder ethnischer Gruppen“ (ebd.: 102). Marginalisierung erfolgt dabei stets „relativ zur Ermächtigung hegemonialer Männlichkeit der dominanten Gruppe“ (ebd.). Neben der Betrachtung von Arbeiterklasse und Mittelschicht legt Connell den Fokus ihrer Ausführungen vor allem auf die schwarze Bevölkerung. Im Kontext einer weiß dominierten Gesellschaft schreibt sie der schwarzen Männlichkeit eine „symbolische Bedeutung für die Konstruktion des sozialen Geschlechts von Weißen“ (ebd.: 101) zu. Connell spielt damit auf die oftmals gegensätzliche Instrumentalisierung von schwarzen Männern in der Öffentlichkeit an: Während viele schwarze Sportler zu Paradebeispielen für männliche Härte ernannt werden, kommt es gleichzeitig auch zu einer Stigmatisierung von männlichen Schwarzen als Vergewaltiger und Kriminelle. Vertreter der hegemonialen Männlichkeit machen sich demnach die verschiedenen Vorstellungen von schwarzer Männlichkeit zunutze, und verwenden sie je nach Bedarf für ihre eigenen Zwecke[24]. Connell sieht deshalb in der physischen und institutionellen Unterdrückung von schwarzen Männern einen wichtigen Einflussfaktor für die Konstruktion von schwarzer Männlichkeit (vgl. ebd.).
Zusammengefasst lässt sich sagen, dass es nicht eine, sondern viele verschiedene Formen von Männlichkeit gibt, welche allesamt in einem hierarchisch gegliederten Verhältnis zueinander stehen. Bei jenen Formen handelt es sich um zeitlich flexible Interpretationen von unterschiedlichen Männlichkeitsentwürfen, deren Herrschaftsanspruch stets zeitlich begrenzt ist. Zwar befinden sich die verschiedenen Ausprägungen von Männlichkeit in einer unter- bzw. übergeordneten Beziehung zueinander, dennoch haben sie gemein, dass sie in ihrer Gesamtheit über Frauen herrschen. Dabei ist es vor allem die hegemoniale Männlichkeit als ‚durchsetzungsfähigste‘ Form von Männlichkeit, welche die Dominanz von Männern sowie die Unterordnung von Frauen dauerhaft gewährleisten soll.
3.3.2 Pierre Bourdieu und das Konzept der männlichen Herrschaft
Bourdieu beschreibt in seinen Arbeiten zur männlichen Herrschaft (1997a, 2005) die gesellschaftlichen Machtbeziehungen zwischen Männern und Frauen, indem er das ursprünglich zur Analyse von Klassenverhältnissen entworfene Habituskonzept auf die Untersuchung der Geschlechterverhältnisse anwendet. Den Ausgangspunkt von Bourdieus Überlegungen bildet dabei die Frage, wie sich „die bestehende Ordnung mit ihren Herrschaftsverhältnissen, ihren Rechten und Bevorzugungen, ihren Privilegien und Ungerechtigkeiten (...) mit solcher Mühelosigkeit erhält“[25] (Bourdieu 2005: 7). Als ausschlaggebend für die scheinbar fraglos hingenommene Unterwerfung betrachtet Bourdieu ein Phänomen, welches er als „symbolische Gewalt“[26] bezeichnet. Mit diesem Begriff umschreibt Bourdieu die „sanfte, für ihre Opfer unmerkliche, unsichtbare Gewalt, die im Wesentlichen über die rein symbolischen Wege der Kommunikation und des Erkennens, oder genauer des Verkennens, des Anerkennens oder, äußerstenfalls, des Gefühls ausgeübt wird“ (ebd.: 8).
Herrschaft wird demnach mit Hilfe eines symbolischen Prinzips ausgeübt, welches sowohl der Herrschende, als auch der Beherrschte (an)erkennen. Dabei kann es sich um eine Sprache oder einen gewissen Lebensstil, aber auch um bestimmte Denk- und Handlungsweisen handeln (vgl. ebd.). Obwohl es der Ausdruck vermuten lässt, ist symbolische Gewalt jedoch nicht zwangsläufig frei von physischer Gewalt. Zwar kommt sie prinzipiell ohne den Einsatz von körperlicher Gewalt aus, nichtsdestotrotz kann auch physische Gewalt als Bestandteil der symbolischen Gewalt durchaus ein Mittel zur Durchsetzung von Machtansprüchen darstellen (vgl. ebd.: 64).
Um nun das „Verhältnis trügerischer Vertrautheit“ (ebd.: 11) zu umgehen, erläutert Bourdieu die symbolische Dimension der männlichen Herrschaft nicht im Kontext unserer westlich-zivilisierten Welt, sondern anhand der androzentrisch organisierten Gesellschaft der Kabylei[27], wo das gesamte soziale Leben nach dem Gegensatz von ‚männlich’ und ‚weiblich’ ausgerichtet ist. Er wählt diesen Umweg, um die notwendige Objektivität für seine Analysen gewährleisten zu können (vgl. ebd.: 10). Durch die Übertragung seiner Erkenntnisse auf die heutige westliche Gesellschaft beweist Bourdieu schließlich, dass männliche Herrschaft kein zeitloses und unveränderliches Konstrukt darstellt, sondern vielmehr das Ergebnis einer unablässigen Reproduktionsarbeit ist, an welcher sowohl einzelne Akteure, als auch Institutionen, Familien, Kirche, Schule und Staat beteiligt sind[28] (vgl. ebd.: 65).
Laut Bourdieu manifestiert sich der legitimierte Vorrang von Männern innerhalb der Gesellschaft zum einen in der „Objektivität der sozialen Strukturen und der produktiven und reproduktiven Tätigkeiten, die auf einer geschlechtlichen Arbeitsteilung der biologischen und sozialen Produktion gründen“ (ebd.: 63), und zum anderen in den „allen Habitus immanenten Schemata“ (ebd.), welche als „Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsmatrizen“ (ebd.) für die objektive Abstimmung aller Mitglieder der Gesellschaft sorgen. Dass Frauen sich dem Machtanspruch der Männer nicht widersetzen, erklärt Bourdieu dadurch, dass sie in Hinblick auf bestimmte Sachverhalte ausschließlich Denkschemata anwenden, welche selbst ein „Produkt der Inkorporierung“ (ebd.) eben jener Machtverhältnisse darstellen. Auf diese Weise werden Herrschaftsverhältnisse als fraglos gegeben wahrgenommen und akzeptiert.
Um das Prinzip der symbolischen Herrschaft vollständig begreifen zu können, ist es jedoch notwendig, die Vorstellung einer „reinen Logik des erkennenden Bewußtseins“ (ebd.: 70) zu überwinden. Dies gelingt laut Bourdieu durch den Einbezug des Habitus-Konzepts:
„Ihre Wirkung entfaltet die symbolische Herrschaft (...) durch die Wahrnehmungs-, Bewertungs- und Handlungsschemata, die für die Habitus konstitutiv sind und die diesseits von Willenskontrolle und bewußter Entscheidung eine sich selbst zutiefst dunkle Erkenntnisbeziehung begründen“ (ebd.).
Symbolische Herrschaft kann demnach nur funktionieren, wenn es zu einer unbewussten habituellen Verankerung der Herrschaftsbeziehungen kommt. Jene Verankerung ist sowohl der Selbstreflektion als auch der Willenskontrolle größtenteils entzogen und findet ihren Ausdruck in den Dispositionen der einzelnen Akteure. Durch die Somatisierung von Normen und Wertvorstellungen wird der Körper somit zu einer Art ‚Gedächtnisstütze’ für die soziale Welt. Die paradoxe Logik von männlicher Herrschaft und weiblicher Unterwerfung lässt sich demnach nur verstehen, wenn man von den nachhaltigen Auswirkungen der sozialen Ordnung auf Frauen und Männer sowie den an diese Ordnung angepassten Dispositionen Kenntnis nimmt (vgl. ebd.: 70f). Bourdieu bezeichnet diese Form von Macht als symbolische Kraft, welche „jenseits allen physischen Zwangs unmittelbar (...) auf die Körper ausgeübt wird“ (ebd.). Das Fortbestehen eines Herrschaftsverhältnisses, welches sich zwangsläufig auf Dispositionen stützt, hängt demnach primär vom Fortbestehen derjenigen Strukturen ab, deren Produkt jene Dispositionen sind (vgl. ebd.: 78).
[...]
[1] Ehemals Robert W. Connell oder auch Bob Connell.
[2] Jeff Hearn kommentiert, dass die wissenschaftliche Erforschung von Männern eine weitaus längere Tradition hat: „Men have been studying men for a long time, and calling it ‚History’, ‚Sociology’, or whatever“ (Hearn 2004: 49).
[3] Es wurde insbesondere dafür gekämpft, dass Frauen sowohl beim Wahlrecht als auch beim Eigentumsrecht juristisch mit Männern gleichgestellt werden (vgl. Lorber 2010: 1).
[4] Im Zuge dieser Arbeit soll auf die von Steffen Kitty Herrmann entworfene ‚Gender Gap‘ zurückgegriffen werden, welche es ermöglicht, auch Subjekte jenseits der binären Geschlechterkategorien gendersensibel zu adressieren (vgl. Herrmann 2003: 22).
[5] Eine erwähnenswerte Ausnahme stellt hingegen die Berücksichtigung der Geschlechtsrollentheorie im Kontext der Männergesundheitsforschung dar, welche die Häufigkeit der Ausprägung von bestimmten Krankheitsbildern unter anderem auch in der männlichen Geschlechtsrolle begründet sieht (vgl. Jacobi 2002: 16f).
[6] Einen facettenreichen Überblick über die empirische Erforschung von Männlichkeit bieten Bereswill et al. (2011) sowie Baur/Luedtke (2008).
[7] Der Begriff umschreibt die Vorstellung, dass sich die Geschlechterrollen innerhalb einer Gesellschaft durch ‚naturgegebene‘ Merkmale begründen lassen. Der Entwurf eines biologistischen Erklärungsmodells steht demnach im absoluten Kontrast zur Perspektive des Sozialkonstruktivismus.
[8] Freud kam später selbst zu der Erkenntnis, dass jene Gleichsetzung den Sachverhalt zu sehr vereinfachen würde (vgl. Connell 2000: 88).
[9] Die (M/F)-Skala stammt aus der Psychologie und soll Interessen und Verhaltensweisen mit Hilfe von männlichen und weiblichen Stereotypen messen. Die Items der Skala sind dabei geschlechtsneutral formuliert, so dass die Antworten nicht durch eine genderspezifische Adressierung beeinflusst werden.
[10] Der Ansatz wurde sowohl in den feministischen und poststrukturalistischen Kulturanalysen, als auch in der Lacan’schen Psychoanalyse sowie in Studien über Symbolismus häufig angewendet (vgl. ebd.: 91).
[11] Beispielsweise können Richter über die Schuld oder Nichtschuld eines Angeklagten entscheiden, indem sie ihr Urteil vor Gericht verbal verkünden. Eine Person, die nicht das Richteramt bekleidet, verfügen hingegen nicht über die Macht, ein derartiges Urteil wirksam werden zu lassen.
[12] Als aktuelles Beispiel sei hier auf Russland verwiesen, wo körperliche Gewalt gegen Homosexuelle als Stärkung der staatlich angestrebten Unterbindung von Homosexualität im öffentlichen Diskurs betrachtet werden kann.
[13] Als empirische Beispiele nennt Connell hier sowohl Filmstars wie Humphrey Bogart, John Wayne und Sylvester Stallone, als auch Sportler wie Ron Barassi und Muhammed Ali (vgl. Connell 1987: 184f).
[14] Laut Connell verhalten sich auch alternative, nicht-hegemoniale Formen von Männlichkeit oppressiv gegenüber Frauen (vgl. ebd.).
[15] Zu Deutsch: ‚betonte Weiblichkeit‘.
[16] Im Original: „Masculinities“.
[17] Connell bedient sich hier des Wortes ‚Reproduktionsbereich‘, um zu betonen, dass es sich dabei nicht um ein „starres Gefüge biologischer Determinaten“ handelt, sondern um einen „historischen, den Körper einbeziehenden Prozess“ (Connell 2000: 92).
[18] Der Begriff ‚Kathexis’ stammt aus der Psychologie und umschreibt die Energie, welche in Handlungen, Objekte oder Menschen investiert wird (vgl. Connell 2000: 94).
[19] Besagte Kriterien spielen vor allem bei der feministischen Analyse von Sexualität eine zentrale Rolle, wenn es um den Zusammenhang zwischen Heterosexualität und der sozialen Dominanz von Männern geht (vgl. ebd.).
[20] Connell kritisiert in diesem Zusammenhang die anfangs noch stark vereinfachten Unterscheidungen, etwa zwischen Schwarzen und Weißen, oder die Einteilung in Arbeiterklasse, Mittel- und Oberschicht (vgl. ebd.: 97).
[21] Connell bezeichnet mit diesem Begriff den „allgemeinen Vorteil, der den Männern aus der Unterdrückung der Frauen erwächst” (ebd.: 100).
[22] Connell wörtlich: „The most important feature of contemporary hegemonic masculinity is that it is heterosexual“ (Connell 1987: 186).
[23] Im Original: „gay plague“ (Connell 1987: 186).
[24] Insbesondere in den USA bedienen sich rechte Parteien und Organisationen häufig an Zahlen und Statistiken, um das kriminelle Potential von ethnischen Minderheiten öffentlich zu proklamieren.
[25] Er spricht in diesem Zusammenhang auch vom „Paradox der doxa“ (ebd.: 7), also dem Umstand, dass die gesamte Weltordnung mit all ihren Verpflichtungen und Sanktionen im Allgemeinen respektiert wird, und dass die Unterworfenen ihre Untergebenheit sowohl anerkennen, als auch aktiv mitkonstruieren.
[26] In diesem Punkt zeigen sich starke Parallelen zu Connells Verständnis einer hegemonialen Männlichkeit, bei welcher körperliche Gewalt ebenfalls als potentielles, jedoch nicht elementares Mittel zur Durchsetzung von Herrschaftsansprüchen beschrieben wird (vgl. Connell 1987: 184). Auch ähnelt Bourdieus Auffassung einer symbolischen Gewalt stark der kulturtheoretischer Perspektive in Connells Arbeiten.
[27] Bourdieu hat dort von 1958 bis 1960 Feldforschung zur Kultur der Berber durchgeführt.
[28] Jene Zeitlosigkeit wird vor allem dadurch sichtbar, dass die männliche Dominanz der heutigen Gesellschaft nicht mehr als fraglos gegeben gilt, sondern von vielen Seiten angegriffen und kritisiert wird. Auch hier ähnelt das Verständnis einer historisch verwurzelten „männlichen Herrschaft“ dem Connell‘schen Entwurf einer sich stets wandelnden „hegemonialen Männlichkeit“ (vgl. Connell 2000: 98). Während Connell jedoch nur von einem binnengeschlechtlichen Angriff auf die „hegemoniale Männlichkeit“ spricht, hält Bourdieu gar einen Wechsel des Herrschaftsverhältnisses zwischen den Geschlechtern in der Theorie für denkbar. Dies kann jedoch nur geschehen, wenn es zu einer „Revolution der symbolischen Ordnung“ (Bourdieu 1997b: 227) kommt, welche sich in den Dispositionen niederschlägt und eine neue Sicht auf die Welt bewirkt (vgl. ebd.).
- Arbeit zitieren
- Sebastian Hauser (Autor:in), 2014, Das Konzept der hegemonialen Männlichkeit und sein Verhältnis zur Empirie, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/281823
Kostenlos Autor werden




















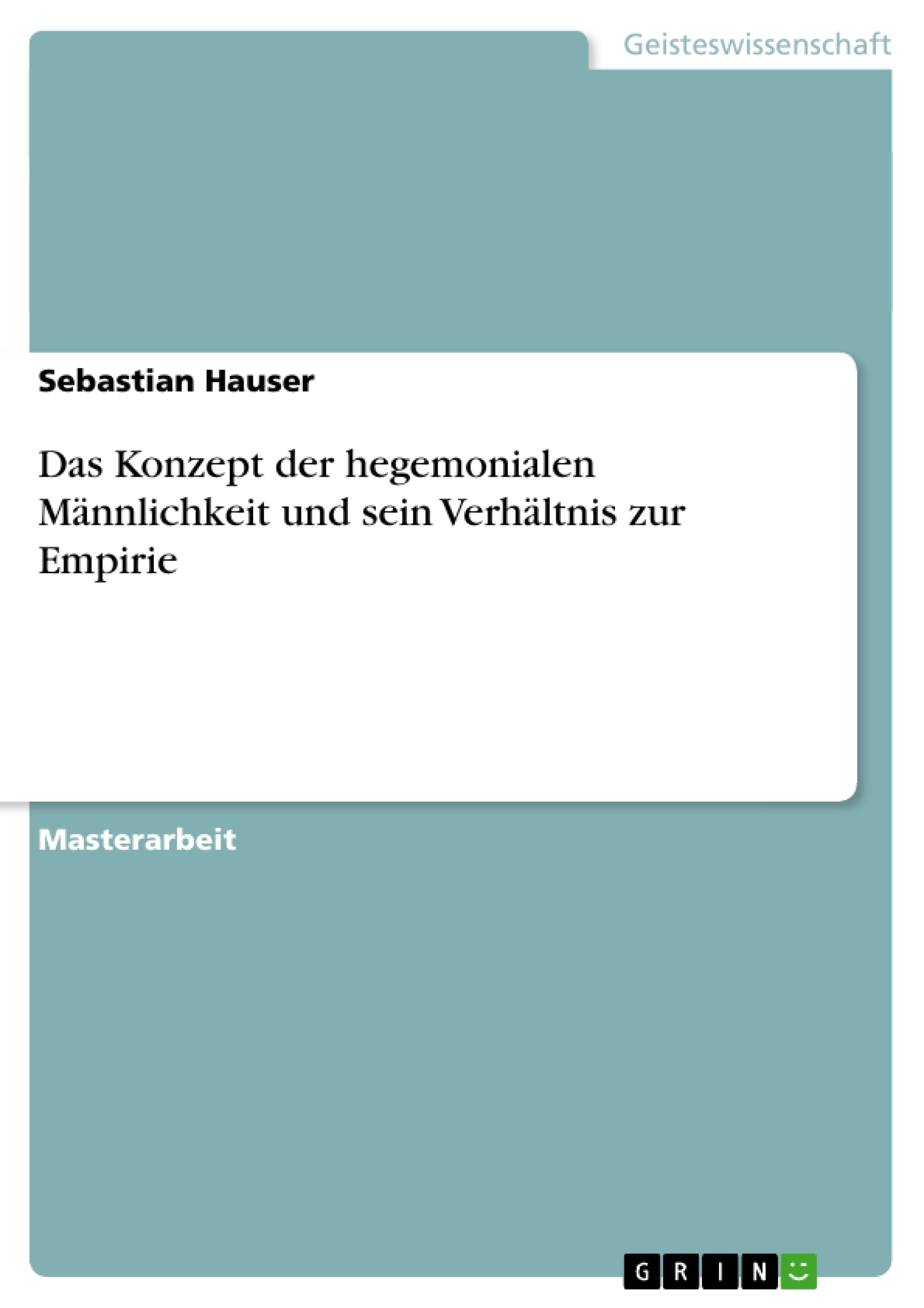

Kommentare