Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Tabellenverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Problemstellung und Ziel der Arbeit
1.2 Gang der Untersuchung
2 Grundlagen des Wissensmanagements
2.1 Begriff und Ziele des Wissensmanagements
2.2 Elemente des Wissensmanagements
2.2.1 Wissensarten
2.2.2 Wissensträger
2.2.3 Wissensinhalte
2.3 Prozess des Wissensmanagements
2.3.1 Wissensmanagement nach Nonaka und Takeuchi
2.3.2 Bausteinmodell nach Probst, Raub und Romhardt
2.4 Kriterien zur Beurteilung eines erfolgreichen Wissensmanagements
2.4.1 Balanced Scorecard
2.4.2 Wissensmanagement mit Balanced Scorecard
2.5 Wissensmanagement in der Praxis
2.5.1 Die Entwicklung zur Wissensgesellschaft
2.5.2 Empirische Studie „Wettbewerbsfaktor Wissensmanagement“
3 Intergenerationaler Wissenstransfer als Herausforderung für das Wissensmanagement
3.1 Begrifflichkeiten und Zieldefinition des Intergenerationalen Wissenstransfers
3.2 Generationen im Unternehmen und Demographischer Wandel
3.2.1 Einführung
3.2.2 Babyboomer
3.2.3 Generation X
3.2.4 Generation Y
3.2.5 Fazit
3.3 Methoden des Intergenerationalen Wissenstransfers
3.3.1 People-to-data
3.3.2 People-to-people
3.4 Umsetzung des Intergenerationalen Wissenstransfers
3.4.1 Einführung
3.4.2 Altersstrukturanalyse
3.4.3 Ausführung
3.5 Wissenskultur im Unternehmen
3.5.1 Unternehmenskultur
3.5.2 Wissenskultur
3.6 Anreizsysteme zur Wissensübergabe
3.6.1 Einführung
3.6.2 Anforderungen an Anreizsysteme
3.6.3 Extrinsische Anreizsysteme
3.6.4 Intrinsische Anreizsysteme
3.7 Bewertung des Intergenerationalen Wissenstransfers
4 Fallstudien zum Intergenerationalen Wissenstransfer
4.1 Fraport AG
4.2 Deutsche Bank AG
4.3 AOK Hessen
4.4 Vergleichende Analyse und Handlungsempfehlungen
5 Schlussbetrachtung
Anhang
Literaturverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Konzept der Wissenstreppe nach North
Abbildung 2: Materielle Wissensträger
Abbildung 3: Die Wissensspirale nach Nonaka und Takeuchi
Abbildung 4: Bausteinmodell des Wissensmanagements nach Probst et al
Abbildung 5: Balanced Scorecard im Wissensmanagement
Abbildung 6: Beispiel einer Wissensquellenkarte (knowledge source map)
Abbildung 7: Beispiel einer Wissensanlagekarte (knowledge asset map)
Abbildung 8: Altersstrukturanalyse
Abbildung 9: Ergebnis einer Altersstrukturanalyse
Abbildung 10: Das 3-Ebenen-Modell der Unternehmenskultur nach Schein
Abbildung 11: Altersstruktur Fraport AG
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Strategische Ziele und deren Messgrößen im Wissensmanagement
Tabelle 2: Messgrößen des Intergenerationalen Wissenstransfers
1 Einleitung
1.1 Problemstellung und Ziel der Arbeit
„Den Wert eines Unternehmens machen nicht die Gebäude, nicht die Maschinen und auch nicht seine Bankkonten aus. Wertvoll an einem Unternehmen sind die Menschen, die dafür arbeiten und der Geist, in dem sie es tun.“ (Heinrich Nordhoff, 1899 - 1968)
Was der damalige Vorstandsvorsitzende der Volkswagenwerk AG im Jahre 1966 zum Ausdruck brachte, ist heute mehr denn je von Relevanz. Geprägt von gesellschaftlichen und volkswirtschaftlichen Entwicklungen, beziehen Unternehmen den Faktor Wissen immer mehr in ihre strategische Ausrichtung mit ein. Die Entwicklung fort von einer „Market-based View“ über die „Resource-based View“ hin zu einer „Knowledge-based View“ ist deutlich erkennbar (vgl. Trojan 2005, S. 288).1
Verstärkt wird dies durch die demographische Entwicklung. Das Durchschnittsalter der Deutschen steigt zunehmend an, was sich auch in den Altersstrukturen der Unterneh- men widerspiegelt. Die Generation der „Babyboomer“, die in Betrieben derzeit die höchste Anzahl der Arbeitsplätze einnimmt, wird in den nächsten Jahren die Pension antreten. Damit ihre gesammelten Erfahrungen und Fähigkeiten dennoch im Unterneh- men erhalten bleiben, gilt es diese auf die jüngeren Kollegen zu übertragen. Diesen Pro- zess nennt man Intergenerationalen Wissenstransfer (vgl. Deller et al. 2008, S. 60).
Ziel der Thesis ist es dem Leser zu verdeutlichen, welch einen hohen Wert und Nutzen der Faktor Wissen in der heutigen Wirtschaft hat. Es soll hervorgehen, dass die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens maßgeblich von dessen personellen Ressourcen abhängig ist. Eine wissensorientierte Unternehmensführung und der Einsatz gezielter Personalentwicklungsinstrumente sind von strategischer Relevanz. Die Thesis soll Antwort auf die Fragen geben, wie Wissen vor dem Hintergrund des Demographischen Wandels definiert, erkannt, verteilt und bewahrt werden kann.
Nicht Bestandteil der Ausarbeitung ist die informationstechnische Entwicklung und Umsetzung von Wissensmanagement-Systemen. Diese werden lediglich hinsichtlich ihres Nutzens für die Organisation vorgestellt.
1.2 Gang der Untersuchung
Vorliegende Thesis ist in weitere vier Kapitel gegliedert. Beginnend mit den „Grundla- gen des Wissensmanagements“, werden für das Verständnis des Themas fundamentale Begriffe und Zusammenhänge erläutert. Auch in der Literatur weit verbreitete Wis- sensmodelle, wie das Bausteinmodell nach Probst, Raub und Romhardt oder die Wis- sensspirale nach Nonaka und Takeuchi, werden in Kapitel 2 vorgestellt. Im darauffolgenden Teil, „Intergenerationaler Wissenstransfer als Herausforderung für das Wissensmanagement“, geht es speziell um den Austausch von Wissen innerhalb verschiedenener Altersgruppen. Im Hinblick auf den Demographischen Wandel kommt es hier vor allem auf die Weitergabe von Erfahrungswissen an, welches die älteren Ar- beitnehmer in sich tragen.
Um einen Einblick zu erhalten, welche Generationen derzeit in deutschen Unternehmen beschäftigt sind und welche spezifischen Charaktereigenschaften diese ausmachen, werden zunächst die „Babyboomer“, „Generation X“ und „Generation Y“ vorgestellt. Konkrete Ansätze zu den Gestaltungsmöglichkeiten des Wissenstransfers und wie das Unternehmen seine Mitarbeiter dazu motivieren kann persönliches Wissen weiterzugeben, wird im Verlauf des dritten Kapitels erläutert.
Es folgt eine Fallstudie mit Praxisbezug zu den Unternehmen der Deutschen Bank AG, der Fraport AG und der AOK Hessen. Es wird erläutert, wie sich die genannten Unter- nehmen auf die Folgen des Demographischen Wandels vorbereiten und welche perso- nalpolitischen Methoden sie nutzen um einen rechtzeitigen Transfer des Erfahrungswis- sens zu gewährleisten.
Die Thesis endet mit einer Zusammenfassung der gewonnenen Resultate und einem Ausblick auf die Bedeutung von Wissenstransfer in der Zukunft.
2 Grundlagen des Wissensmanagements
2.1 Begriff und Ziele des Wissensmanagements
Um Wissensmanagement korrekt definieren zu können, hilft es zunächst die darin enthaltenen Begriffe „Wissen“ und „Management“ zu erläutern.
Management, abgeleitet aus dem lateinischen „manage“, was soviel heißt wie „an der Hand führen“, steht im Rahmen der Betriebswirtschaftslehre für eine mit Führungskompetenz ausgestattete, leitende Unternehmensfunktion. Wissen, so Probst, bezeichnet die an Personen gebundene Fähigkeit, bestimmte Informationen in der Form zu verarbeiten, dass diese zur Lösung bestehender Probleme herangezogen werden können (vgl. Staehle et al. 1999, S. 71; Probst et al. 2012, S. 23).
Wie Wissen entsteht und welchen Nutzen es den Unternehmen durch korrekte Anwendung verschaffen kann, veranschaulicht folgendes Modell der „Wissenstreppe“.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abbildung 1: Konzept der Wissenstreppe nach North
Quelle: Entnommen aus: North 2011, S. 36
Es ist erkennbar, dass Wissen alleinstehend noch keinen Einfluss auf den unternehmersichen Erfolg hat. Es sind eine Anzahl vor- und nachgelagerter Stufen notwendig, um relevante Fähigkeiten zu entwickeln und diese erfolgsorientiert im Unternehmen einzubringen (vgl. Oelsnitz/Hahmann 2003, S. 43 f.).
Die erste Stufe der Wissenstreppe besteht aus Zeichen. Einzelne Buchstaben und Ziffern liegen hier in einer unsortierten Form vor. Wenn diese Zeichen sortiert werden und eine Struktur erhalten, werden sie zu Daten. Daten können beispielsweise aus Messungen oder Beobachtungen gewonnen werden. Wird diesen Daten eine Bedeutung zugeschrieben, so entstehen Informationen (vgl. North 2011, S. 36 f.).
Als Information kann man „(…) die Teilmenge von Wissen, die von einer bestimmten Person oder Gruppe in einer konkreten Situation benötigt wird und häufig nicht explizit vorhanden ist.“ verstehen (Universität des Saarlandes, Fachrichtung 5.6 Informations- wissenschaft). Im betriebswirtschaftlichen Sinne sind Informationen das Fundament zur Entscheidungsfindung und -durchführung (vgl. North 2011, S. 37). Wissen entsteht durch eine handlungsorientierte Kombination unterschiedlicher Infor- mationen. Es wird zwischen Ursachenwissen, Erklärungswissen und Handlungswissen unterschieden. Letzteres ist notwendig, damit aus Wissen eine Kompetenz entsteht. Je bedeutsamer und einzigartiger diese Kompetenz ist, desto besser lässt sich das Unter- nehmensziel, die Wettbewerbsfähigkeit, erreichen (vgl. Biethahn/Muksch/Ruf 2011, S. 37; North 2011, S. 38).
Übergeordnetes Ziel eines Wissensmanagements ist somit die Wettbewerbsfähigkeit. Betrachtet man die Wissenstreppe von oben herab, so soll herausgefunden werden, wel- che Kompetenzen zum Erreichen des Unternehmensziels notwendig sind und aufgebaut werden müssen. Man fasst diesen Vorgang unter dem Begriff „Strategisches Wissens- management“ zusammen.
Wird die Wissenstreppe hingegen von unten herauf gelesen, spricht man von „Operati- ven Wissensmanagement“. Hier geht es darum, Informationen zu erhalten und daraus Wissen zu entwickeln um letztendlich eine starke Wettbewerbsposition zu erreichen. Innerhalb dieses Prozesses ist es besonders wichtig, individuelles Wissen unternehmensweit zugänglich zu machen, beziehungsweise bereits bekanntes Wissen auf einzelne Personen zu übertragen (vgl. North 2011, S. 39).
2.2 Elemente des Wissensmanagements
2.2.1 Wissensarten
Zahlreiche, in der Literatur vorgenommene, Unterscheidungen verdeutlichen, dass es sich bei Wissen um keinen eigenständigen Begriff handelt, sondern dieser auf unterschiedliche Art und Weise interpretiert werden kann.
Eine mögliche Differenzierung von Wissensarten kann durch die Gegensatzpaare „Wissen“ und „Können“ dargestellt werden. Lehner unterscheidet diesbezüglich wie folgt (vgl. Lehner 2012, S. 57):
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Wie bereits im Konzept der Wissenstreppe erläutert, unterscheiden sich die Stufen Wissen und Können durch den Anwendungsbezug. In dieser Weise setzen sich auch die obenstehenden drei Wissenspaare zusammen.
Planungswissen, objektives Wissen und explizites Wissen werden dem Baustein Wissen zugeordnet und bestehen demnach ausschließlich aus gewonnenen Informationen. Erfahrungswissen, subjektives Wissen und implizites Wissen enstehen hingegen erst durch entsprechende Handlungen (ebd.).
Die für das Wissensmanagement bedeutendste Unterscheidung ist jene zwischen expli- zitem und implizitem Wissen. Unter explizitem Wissen versteht man ein solches Wis- sen, das durch Artikulation und Dokumentation gespeichert werden kann. Es ist dem- nach öffentlich zugänglich und nicht an einzelne Personen gebunden. Implizites Wissen hingegen ist nicht objektiv erkennbar, sondern hat sich durch die Erfahrungen einzelner Individuen entwickelt. Da es sich dabei um personengebundenes Wissen handelt, ist es im Gegensatz zum expliziten Wissen schwer zugänglich und nicht dokumentierbar (vgl. Geiger 2004, S. 85; Prange 2002, S. 27).
Eine genauere Betrachtung von explizitem und implizitem Wissen folgt in Kapitel
2.3.1, dem Wissensmodell nach Nonaka und Takeuchi.
2.2.2 Wissensträger
Vorab ist zu erwähnen, dass der übergeordnete Wissensträger immer das Unternehmen selbst ist. Innerhalb dessen gibt es unterschiedliche Möglichkeiten Wissensträger zu kategorisieren (vgl. Pautzke 1989, S. 63).
Eine wichtige Kategorie ist die Speicherbarkeit des Wissens. Demnach unterscheiden sich materielle von personellen Wissensträgern. Materielle Wissensträger werden auch als „Wissensspeicher“ angesehen. Dokumentiert auf verschiedene Art und Weise wer- den Informationen gesammelt und langfristig im Unternehmen aufbewahrt. Materielle Wissensträger können unterschieden werden in rechnerbasierte, druckbasierte, maschi- nenbasierte und audiovisuelle Wissensträger (vgl. Amelingmeyer 2000, S. 52).
Abbildung 2: Materielle Wissensträger
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Amelingmeyer 2000, S. 52
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Alle genannten Varianten dienen einer langfristigen Dokumentation unternehmerischen Wissens. Diese Dokumentation kann zahlreiche Hintergründe haben wie zum Beispiel die Erfüllung rechtlicher Vorgaben, die Unterstützung der Mitarbeiter durch Handbü- cher und Lehrmaterial oder das Festhalten von Prozessdaten für eine vereinfachte Erfül- lung von Folgeprozessen. Da materielle Wissensträger nicht in der Lage sind Wissen zu erweitern, ist die Herkunft des Wissen für die Qualität ausschlaggebend (ebd.).
Bei personellen Wissensträgern hingegen handelt es sich um Personen, die implizites Wissen verkörpern. Dieses Wissen ist demnach nicht zur Dokumentation und Verviel- fältigung aufbereitet, sondern zunächst nur in den Köpfen der Wissensträger vorhanden. Im Gegensatz zu materiellen Wissensträgern, handelt es sich bei personellen Wissens- trägern um Menschen, die in der Organisation tätig sind. Durch ihre kognitiven Fähig- keiten2 sind sie in der Lage Informationen in Wissen zu verarbeiten und können somit auch neues Wissen erzeugen und weitergeben. Sie gelten demnach als Wissensgenerato- ren, -träger und -verteiler (vgl. Hasler Roumois 2010, S. 105; Porschen 2008, S. 37).
2.2.3 Wissensinhalte
Das Identifizieren relevanter Wissensinhalte im Unternehmen zeugt in der aktuellen Wettbewerbssituation von strategischer Relevanz. Nur wenn das Unternehmen weiß, welches Wissen am Markt gefragt ist und ob die eigene Organisation dieses Wissen abdeckt, kann es wettbewerbsorientiert handeln (vgl. North 2011, S. 9). Mit der Frage, wie sich Wissen inhaltlich differenzieren lässt, hat sich Prof. Dr. Michael H. Zack, Universität Boston, auseinandergesetzt. Er schlägt vor, den Aspekt der Wettbewerbsfähigkeit des Wissens und somit die Abgrenzung des Unternehmens zu seiner Konkurrenz, als Klassifizierungsgrundlage heranzuziehen (vgl. Zack 1999, S. 125 ff.). Laut Zack werden drei Arten von Wissensinhalten unterschieden:
Kernwissen („core knowledge“)
Das Verfügen über Kernwissen ist die Grundlage um am Marktgeschehen teilhaben zu können. Jedes Unternehmen einer gemeinsamen Branche verfügt über dieses Wissen. Es findet somit keine Abgrenzung untereinander statt, was bedeutet, dass kein Unterneh- men einen Wettbewerbsvorteil gegenüber den anderen Unternehmen der Branche hat (ebd.).
Fortgeschrittenes Wissen („advanced knowledge“)
Erste Wettbewerbsvorteile ermöglichen sich durch Fortgeschrittenes Wissen. Verfügt eine Organisation über mehr Informationen als ihre Konkurrenz oder wendet Wissen in einer abgewandelten Art und Weise an, kann sie sich am Markt positiv hervorheben (ebd.).
North nennt in diesem Zusammenhang die Begriffe „umweltbezogener Ansatz“ und „ressourcenbezogener Ansatz“. Laut dem umweltbezogenen Ansatz ergeben sich aus der ungleichmäßigen Verteilung von Informationen Wettbewerbsvorteile. Unternehmen, die schneller über mehr relevante Ereignisse informiert sind, können effizienter handeln und sich dadurch besser positionieren als ihre Konkurrenten. Der ressourcenbezogene Ansatz besagt darüber hinaus, dass ein langfristiger Wettbewerbsvorteil durch solches Wissen entsteht, das von der Konkurrenz nur schwer zu erkennen und dadurch nicht einfach zu imitieren ist (vgl. North 2011 S. 61 f.).
Innovatives Wissen („innovative knowledge“)
Verfügt ein Unternehmen über Innovatives Wissen, so kann es sich stark von der Konkurrenz hervorheben und somit sogar eine Marktführerschaft3 erlangen. Stetige Entwicklungs- und Innovationsprozesse sind somit ausschlaggebend für eine starke Wettbewerbsposition. Zu beachten ist jedoch, dass je nach Wettbewerbsumfeld, Innovatives Wissen schnell an Wert verlieren kann und zu Kernwissen zurückgebildet wird. Dies ist zum Beispiel der Fall in einem dynamischen Wettbewerbsumfeld, bei dem ständig neue Entwicklungen ins Leben gerufen werden (vgl. Lehner 2012, S. 45).
2.3 Prozess des Wissensmanagements
In der Literatur existieren zahlreiche Methoden, die den Prozess des Wissensmanagements im Unternehmen darstellen (siehe Anhang 1).
Im Folgenden werden zwei der bekanntesten Modelle des Wissensmanagements vorgestellt: Die Wissensspirale nach Nonaka und Takeuchi sowie das Bausteinmodell nach Probst, Raub und Romhardt.
2.3.1 Wissensmanagement nach Nonaka und Takeuchi
Laut den Japanern Ikujiro Nonaka und Hirotaka Takeuchi wird der unternehmerische Erfolg stark von der Art der Wissensschaffung im Unternehmen beeinflusst. Japanische Firmen, so Nonaka und Takeuchi, profitieren durch ihr systematisches Wissensma- nagement. Das Unternehmen wird dabei nicht als Organisation verstanden, in der Wis- sen verarbeitet wird, sondern als ein lebender Organismus, bestimmt von unterschiedlichen Individuen (vgl. Nonaka/Takeuchi 1997, S. 71).
Wie bereits in Kapitel 2.2.1 erläutert, unterscheidet man zwischen explizitem und impli- zitem Wissen. Nach Nonaka und Takeuchi ist Wissen erst dann für ein Unternehmen von Nutzen, wenn es in expliziter, also dokumentierter Form, darliegt. Die zentrale Aufgabe des Wissensmanagements liegt somit in der Umwandlung von implizitem zu explizitem Wissen (ebd.).
Dass dies nicht in einem einzelnen Schritt erfolgen kann, sondern ein fortlaufender, sich ständig wiederholender Prozess ist, zeigt das in Abbildung 3 dargestellte Modell der Wissensspirale.
Abbildung 3: Die Wissensspirale nach Nonaka und Takeuchi
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Nonaka/Takeuchi 1997, S. 85
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Innerhalb der Wissensumwandlung werden vier Bereiche unterschieden. Beginnend mit der Sozialisation setzt sich der Kreislauf mit der Externalisierung, der Kombination und der Internalisierung fort. In jedem Quartal werden Wissensinhalte erzeugt, auf die im darauf folgenden Quartal aufgebaut wird (vgl. Lehner 2012, S. 73).
Sozialisation (von implizit zu implizit)
Man spricht von Sozialisation, wenn zwei oder mehr Personen ihr Erfahrungswissen austauschen. Implizites Wissen wird demnach nicht externalisiert, sondern lediglich auf weitere Personen übertragen.
Möglichkeiten der Sozialisation sind unter anderem persönliche Gespräche oder Dis- kussionsrunden. Auch die Einarbeitung neuer Mitarbeiter kann in Form einer Sozialisa- tion erfolgen. Dabei wird diese nicht mit Hilfe von Handbüchern oder Lernsoftware gestaltet, sondern dem neuen Mitarbeiter wird ein erfahrener Kollege zur Seite gestellt. Durch die Betrachtung der Arbeitsweise des Wissensträgers können bestimmte Handlungsabläufe und Verhaltensmuster erkannt werden. Wendet der neue Mitarbeiter diese in seiner eigenen Arbeitsweise an, so hat sich das Erfahrungswissen übertragen und eine Sozialisation erfolgreich stattgefunden (vgl. Lehner 2012, S. 73).
Externalisierung (von implizit zu explizit)
Im Unterschied zur Sozialisation steht bei der Externalisierung die Dokumentation des personengebundenen Wissens im Mittelpunkt. Ziel ist es, eine für alle Mitarbeiter zugängliche Wissensbasis zu schaffen (vgl. North 2011, S. 49).
Hauptsächlich findet die Externalisierung durch das Niederschreiben von Erfahrungs- wissen statt. Dies kann anhand von Protokollen, Handbüchern oder Prozessabläufen erfolgen. In größeren und internationalen Unternehmen hilft hier zudem die Einführung informationstechnischer Systeme, durch die Wissen über alle räumlichen und zeitlichen Distanzen dokumentiert und abgerufen werden kann (vgl. Schmidt 2011, S. 37).
Kombination (von explizit zu explizit)
Im Schritt der Kombination wird das in der Organisation bekannte Wissen neu geordnet und klassifiziert. Der Gesamtbestand an Wissen verändert sich dadurch nicht (vgl. North 2011, S. 49).
Die Wissensinhalte, die durch Sozialisation und Externalisierung bekannt wurden, werden mit dem bereits vorhandenen Wissen kombiniert. Dadurch entstehende Zusatzinformationen sollen eine verbesserte Wissensbasis für die gesamte Organisation bezwecken (vgl. Nonaka/Takeuchi 1997, S. 81).
Im Idealfall ergeben sich Synergieeffekte, durch die Prozesse effizienter gestaltet werden können. Eine erfolgreiche Kombination ist zum Beispiel die Anwendung bewährter Prozessabläufe in neuen Aufgabengebieten (vgl. Schmidt 2011, S. 37).
Internalisierung (von explizit zu implizit)
Im Prozess der Internalisierung geht es darum, explizites Wissen zu verinnerlichen. Umschrieben mit dem Begriff „Learning by doing“ sollen die Mitarbeiter durch tägliche Anwendung eine Routine in ihren Handlungsabläufen entwickeln, sodass in ihren Köpfen neues individuelles Wissen aufgebaut wird (vgl. Porschen 2008, S. 63).
Das nun entstandene implizite Wissen bildet wiederrum die Ausgangslage zum erneuten Durchlaufen der Wissensspirale (vgl. Noriko/Richta 2011, S. 81).
2.3.2 Bausteinmodell nach Probst, Raub und Romhardt
Das Bausteinmodell nach Probst et al. fällt in die Kategorie der praxisorientierten Ansätze des Wissensmanagements. Ziel ist es, Unternehmen den Umgang mit der Ressource Wissen näher zu bringen und sie bei der Einführung eines Wissensmanagements zu unterstützen (vgl. Probst et al. 2012, S. 29 f.).
Das Modell orientiert sich stark am traditionellen Managementprozess, der sich aus den Bereichen Zielsetzung, Umsetzung und Bewertung zusammensetzt (ebd.).
Abbildung 4: Bausteinmodell des Wissensmanagements nach Probst et al. Quelle: Entnommen aus: Probst et al. 2012, S. 34
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Wie in Abbildung 4 erkennbar, besteht das Modell aus acht Bausteinen. Die sechs Bausteine im unteren Quadrat stellen die Kernprozesse dar, welche im unternehmerischen Wissensmanagement von Nöten sind. Die Verknüpfung der einzelnen Bausteine zeigt auf, dass diese nicht unabhängig voneinander ablaufen, sondern in einer gegenseitigen Beeinflussung stehen (ebd. S. 30).
Separat der sechs Kernkompetenzen befinden sich die als „pragmatische Bausteine“ definierten Prozesse „Wissensziele“ und „Wissensbewertung“ (ebd. S. 32 f.).
Wissensziele lassen sich auf drei Ebenen unterteilen. Übergreifende Rahmenbedingun- gen, die ein betriebliches Wissensmanagement überhaupt erst ermöglichen, finden sich in den „normativen Zielen“ wieder. Darin enthalten ist beispielsweise die Sensibilisie- rung der Unternehmensführung für das Thema Wissensmanagement. Die Entwicklung einer wissensfördernden Unternehmenskultur ist Fundament aller weiteren Aktivitäten. Dem untergeordnet sind die „strategischen Ziele“. Um diese genau festlegen zu können, muss das Unternehmen zunächst einen Abgleich zwischen bereits vorhandenen und zukünftig benötigten Kompetenzen durchführen. Dazu eignen sich betriebswirtschaftli- che Methoden wie die Szenario- und die Portfolioanalyse.4 (vgl. Klabunde 2003, S. 98).
Strategische Ziele werden nun in kleinere, operative Ziele zerlegt. Laut Roehl und Romhardt sind dies „(…) konkret formulierte und organisationsweit mit aller Konsequenz verfolgte, richtungsweisende Zielgrößen.“ (Roehl/Romhardt 1997, S. 43). Sie sollen somit sicherstellen, dass Wissensmanagement im Unternehmen Anwendung findet und einzelne Personen, Gruppen und Abteilungen mit ihren Aufgaben vertraut sind und diese korrekt ausführen (ebd.).
Um die Ziele hinsichtlich ihres Erfolges messen zu können, führen Probst et al. den Baustein der Wissensbewertung an. Sind stärkere Abweichungen zu den gesetzten Un- ternehmenszielen erkennbar, so sollte das Unternehmen seine Prozesse analysieren und intervenieren um stärkere Fehlschritte zu vermeiden (vgl. Probst et al. 2012, S. 33).
Grundlage für die Ausgestaltung der Aktivitäten im Wissensmanagement ist die Kennt- niss über welches Wissen das Unternehmen derzeit überhaupt verfügt. Der Prozess Wissensidentifikation soll vorhandenes Wissen innerhalb und außerhalb der Organisa- tion sichtbar machen und bildet somit das Fundament weiterer Handlungen (vgl. Lehner 2012, S. 79).
Im nächsten Schritt, dem Wissenserwerb, wird sich der Frage angenommen, welche Informationen außerhalb des Unternehmens bezogen werden können. Diese Informationen können von Kunden, Lieferanten, sonstigen Kooperationspartnern oder auch von der Konkurrenz stammen (ebd. S. 80).
Die Wissensentwicklung hingegen gibt das Ziel vor, Wissenslücken intern zu schlie- ßen. Beginnend mit einer Analyse derzeitiger Prozesse sollen neue Ideen und Fähigkei- ten entwickelt werden, die der Leistungsfähigkeit des Unternehmens zu Gute kommen. Besonders die internen Bereiche Forschung und Entwicklung sowie Marketingaktivitä- ten sind dabei stark angesprochen. Die Motivation der Mitarbeiter, einhergehend mit einer hohen Leistungsbereitschaft, unterstützt zudem den Prozess der Ideenfindung (vgl. Probst et al. 2012, S. 31).
Ist Wissen im Unternehmen vorhanden, so sollte dies auch genutzt werden. Im Prozess der Wissens(ver)teilung ist die zentrale Frage „Wer sollte was in welchem Umfang wissen oder können?“ (ebd. S. 32). Informationen werden somit nicht mit der gesamten Organisation geteilt, sondern spezielle Personenkreise sollen innerhalb ihrer Verantwor- tungsbereiche über das notwendige Wissen verfügen. Hier ist der Zusammenhang zum Ökonomischen Prinzip erkennbar, in dem Arbeitsteilung als ein notwendiges Instrument der Spezialisierung und Produktivität angesehen wird (vgl. Albers/Reihlen 2009, S. 14 f.).
Da die Bereitstellung von Wissen aber noch keine Garantie für dessen Anwendung ist, führen Probst et al. den Begriff der Wissensnutzung an. Hier geht es darum, Hindernisse, die der korrekten Anwendung von Wissen im Wege stehen, zu erkennen und zu beseitigen (vgl. Probst et al. 2012, S. 32).
Die letzte Kernkompetenz ist die Wissensbewahrung. Ist eine fundierte Wissensbasis im Unternehmen existent, so muss diese geschützt werden. Verschiedene Speichermög- lichkeiten sowie eine stetige Überprüfung des Wissens auf Aktualität ist die Grundlage für das zukünftige Bestehen eines effektiven Wissensmanagementsystems (ebd).
Das Modell nach Probst et al. ist heute weit verbreitet und wird von vielen Unternehmen zur Durchführung von Projekten herangezogen. Durch die praxisnahe Aufbereitung und flexible Handhabung wird es als geeignetes Instrument zum Aufbau eines Wissensmanagementsystems angesehen. Je nach Ausgangssituation des Unternehmens können die einzelnen Bausteine in unterschiedlicher Reihenfolge und Intensität bearbeitet werden (vgl. Lehner 2012, S. 78).
2.4 Kriterien zur Beurteilung eines erfolgreichen Wissensmanagements
2.4.1 Balanced Scorecard
Das Konzept der Balanced Scorecard (BSC) geht zurück auf die Entwicklung eines neuen, strategischen Managementsystems durch die amerikanischen Professoren Robert S. Kaplan und David P. Norton zu Beginn der 90er Jahre. Ziel war es, ein Kennzahlensystem zu kreieren, das neben den vergangenheitsorientierten Werten auch zukünftige Entwicklungen berücksichtigt und sich somit mit der unternehmerischen Zielsetzung identifiziert (vgl. Kaplan/Norton 1997, S. 7 f.).
Gegliedert in vier Perspektiven, abgeleitet aus der Unternehmensvision, soll der Erfolg einer Organisation anhand entsprechender Kennzahlen ermittelt werden. Im Unterschied zu zuvor bestehenden Kennzahlensystemen sind in der BSC nicht nur monetäre Größen vorhanden, sondern sie macht zudem Gebrauch von Kennzahlen außerhalb des finanziellen Sektors (vgl. ebd. S.24 ff.).
Im Folgenden werden die vier Perspektiven kurz erläutert:
Finanzwirtschaftliche Perspektive
Die finanzwirtschaftliche Perspektive soll aufzeigen, ob die Implementierung einer Strategie das Unternehmensergebnis verbessert oder verschlechtert. Bedeutende Kennzahlen sind unter anderem der Return on Investment (ROI), Economic Value Added (EVA) und der Verschuldungsgrad (VG) (vgl. Weber/Schäffer 2000, S. 9).
In der Kundenperspektive geht es primär um die Zufriedenheit und Loyalität bestehender Kunden und um die Akquise neuer Kunden. Besteht eine hohe Kudenrentabilität5, so fließen dem Unternehmen weiterhin geldwerte Mittel zu um sich zu finanzieren (vgl. Kaplan/Norton 1997, S. 66).
Interne Prozessperspektive
Im Bereich der internen Prozessperspektive werden innerbetriebliche Prozesse gefiltert, die relevant sind um Kundenbedürfnisse zu befriedigen und finanzielle Ziele zu errei- chen. Innovationsprozess, Betriebsprozess und Kundendienstprozess spielen hierbei eine besondere Rolle (vgl. Weber/Schäffer 2000, S. 8).
Lern- und Entwicklungsperspektive
Die Lern- und Entwicklungsperspektive ist besonders zukunftsorientiert und steht unter der Fragestellung was im Unternehmen verbessert werden kann um effizienter zu arbeiten. Der Mitarbeiterführung und Organisationsentwicklung gilt hierbei hohe Aufmerksamkeit zu widmen (vgl. Kaplan/Norton 1997, S. 122 ff.).
Ziel ist es, gegenseitige Abhängigkeiten und mögliche Konflikte innerhalb der vier Perspektiven transparent zu machen. Dies ist eine weitere Unterscheidung der BSC zu den üblichen Kennzahlensystemen, in denen keine Beziehungen zu anderen Bereichen hergestellt werden, sondern eine separate Betrachtung der einzelnen Größen erfolgt. Ursachen-Wirkungs-Beziehungen, so Horvath, sind jedoch Grundlage für das Gesamtverständnis einer Organisation und der Kommunikation einer Strategie im Unternehmen (vgl. Horvath & Partner 2000, S. 39).
2.4.2 Wissensmanagement mit Balanced Scorecard
„Um den Erfolg des Wissensmanagements messbar zu machen, ist dabei das scheinbar Unmögliche nötig: Die kontextgebundene Ressource Wissen soll objektivierbar gemessen werden können.“ (Probst et al. 2012, S. 225).
Zwar ist in der Ausgestaltung der BSC laut North „ (…) keine konrekte Operationalisierung der Wissensperspektive (…)“ (North 2011, S. 240) vorhanden, doch lässt sich das von Kaplan und Norton konzipierte Modell in einigen Punkten auf die Systematik des Wissensmanagements übertragen.
Die vier genannten Perspektiven der BSC sind nicht fest vorgeschrieben und dienen lediglich der Orientierung. So ist jedem Unternehmen die Möglichkeit gegeben, eigene Perspektiven, abgestimmt auf individuelle Strategien, zu entwickeln (vgl. Kaplan/Norton 1997, S. 33).
Mit Bezug auf das Wissensmanagement bietet es sich hier an, dass Bausteinmodell nach Probst et al. heranzuziehen. Wird die „Einführung eines Wissensmanagementsystems“ als Zielgröße (Soll) definiert, so lässt sich der Erfolg dessen anhand der verbleibenden operativen Bausteine messen. Eine mögliche BSC des Wissensmanagements kann somit wie folgt aussehen.
Abbildung 5: Balanced Scorecard im Wissensmanagement
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Nohr 2001, Steuerung und Erfolgsmessung im Wissensmanagement mit Balanced Scorecard, erschienen in: wissensmanagement online
Im zentralen Bereich der Abbildung steht das übergeordnete strategische Unternehmensziel. Um dies zu erreichen, wird es auf einzelne operative Aktivitäten heruntergebrochen, für die wiederrum eigene Ziele, Maßnahmen und Kennzahlen zur Erfolgsmessung entwickelt werden (vgl. Steuerung und Erfolgsmessung im Wissensmanagement mit Balanced Scorecard, wissensmanagement online).
Da es sich bei Wissensmanagement um einen betriebswirtschaftlichen Prozess handelt der sich letztendlich im Unternehmenserfolg niederschlägt, darf eine finanzielle Be- trachtung nicht außer Acht gelassen werden. Diese leitet sich aus der ursprünglichen BSC ab und zeigt auf, wie hoch der finanzielle Aufwand hinter den Aktivitäten ist. Durch einen Abgleich mit den Ergebnissen der übrigen Perspektiven lässt sich beurtei- len, ob die Investition gerechtfertigt war oder ob finanzielle Verluste eingegangen wur- den (ebd.).
Welche strategischen Ziele aus den einzelnen Perspektiven abgeleitet werden können und anhand welcher Größen diese messbar sind, zeigt folgende Tabelle auf.
Einzelne, darin enthaltende Begrifflichkeiten, wie zum Beispiel Wissenslandkarten und das Intranet, werden im Verlauf der Thesis näher erläutert.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Tabelle 1: Strategische Ziele und deren Messgrößen im Wissensmanagement
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Nohr 2001, Steuerung und Erfolgsmessung im Wissensmanagement mit Balanced Scorecard, erschienen in: wissensmanagement online
2.5 Wissensmanagement in der Praxis
2.5.1 Die Entwicklung zur Wissensgesellschaft
Die volkswirtschaftliche Entwicklung, fort von der Industrie- und hin zu einer Wissens- gesellschaft, spiegelt sich gegenwärtig auch in vielen deutschen Unternehmen wider. Begriffe rund um das „Organisationale Lernen“ und eine auf die Ressource Wissen aus- gerichtete Unternehmensführung sind heute keine Seltenheit mehr. Während in der Vergangenheit die klassischen Produktionsfakoren Boden, Arbeit und Kapital zur Wertschöpfung des Unternehmens führten, ist es gegenwärtig der immateri- elle Produktionsfaktor „Wissen“, der Unternehmen zum Erfolg führt (vgl. Stampfel 2011, S. 15).
[...]
1 Die Market-based View richtet betriebliches Handeln (u.a. Preisgestaltung, Marketingaktivitäten) nach der gegenwärtigen Marktsituation aus. Die Resource-based View hingegen richtet sich nach internen Ressourcen und Kapazitäten, aus denen ein Wettbewerbsvorteil gezogen werden soll. Eine Weiterentwicklung der Resource-based View ist die Knowledge-based View. Diese bezeichnet den Faktor Wissen als erfolgsbestimmenden Produktionsfaktor (vgl. Jenner 1999, S. 241; Grant 2002, S. 8).
2 Kognitive Fähigkeiten ermöglichen Menschen sich in ihrem Umfeld zu orientieren. Darunter fallen alle Prozesse, die der Wahrnehmung einer Situation dienen, z.B. das Erkennen, Verstehen und Bewerten eines Sachverhaltes (vgl. Bertelsmann Lexikon der Psychologie 1995, S. 225).
3 Marktführer ist das Unternehmen, welches den höchsten Marktanteil besitzt (vgl. Kotler et al. 2011, S. 547).
4 Szenarioanalysen dienen einer vorzeitigen Information über zukünftige Entwicklungsverläufe einer Situation. Dabei werden sogenannte „worst-case“ und „best-case“ Fälle beschrieben (vgl. Szenario- Analyse, in: Controlling-Portal). Portfolioanalysen setzen sich aus einer Unternehmens- und einer Um- feldanalyse zusammen. Zukünftige Chancen und Risiken sowie eigene Stärken und Schwächen im Hin- blick auf einzelne Geschäftseinheiten sollen aufgezeigt werden (vgl. Portfolio-Analyse, in: Controlling- Portal).
5 Kundenrentabilität legt offen, ob Kunden rentabel oder nicht rentabel sind. Der Aufwand, der durch Akquise oder Kundenzufriedenheitsmaßnahmen entsteht sollte durch die Umsatzerlöse gedeckt sein (vgl. Kaplan/Norton 1997, S. 44).
- Arbeit zitieren
- Manuela Ferdinand (Autor:in), 2014, Wissenstransfer im Generationenwechsel, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/280652
Kostenlos Autor werden











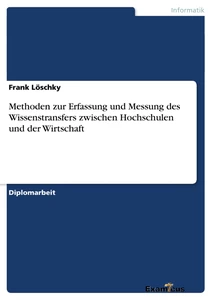








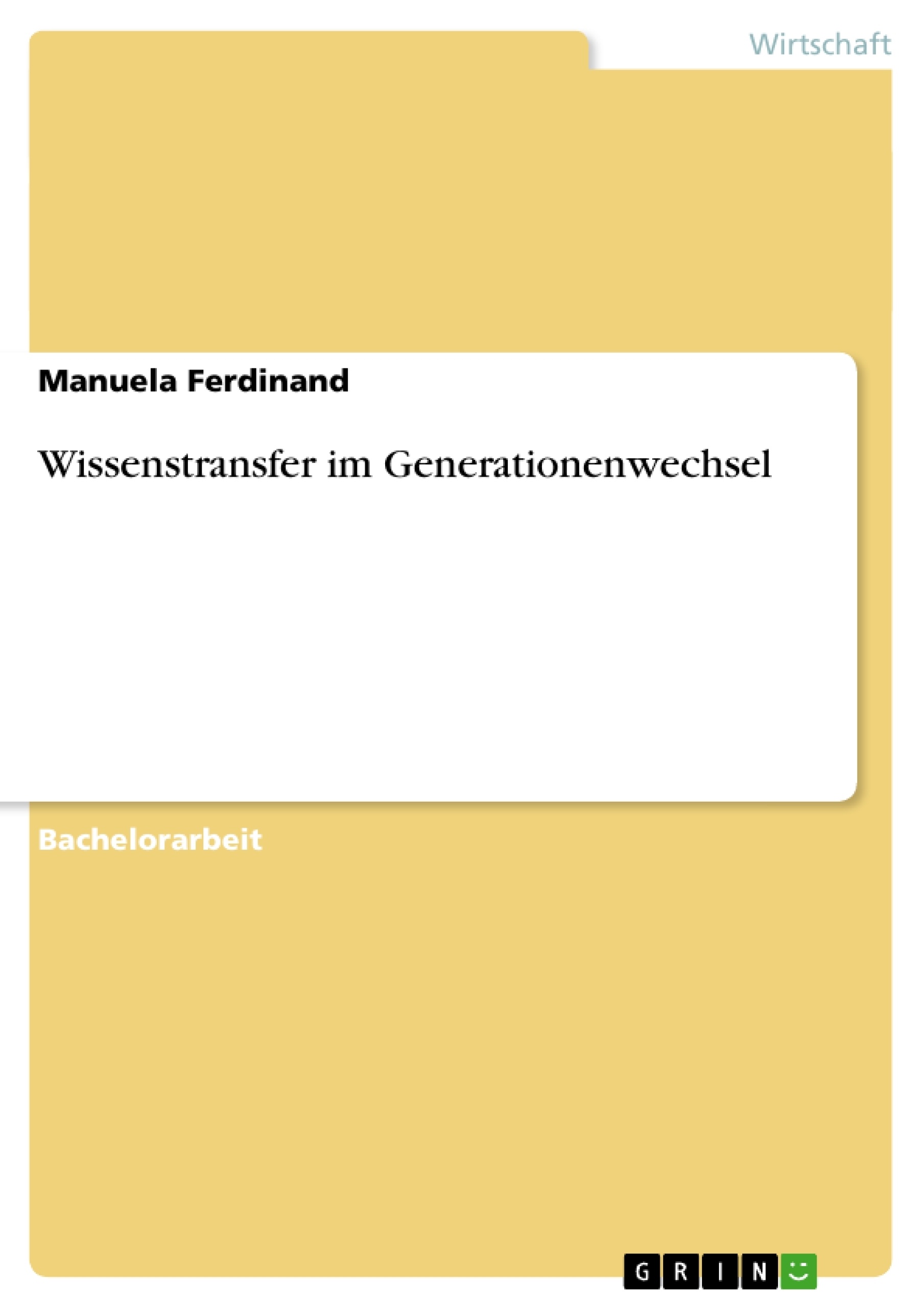

Kommentare