Leseprobe
Inhaltsverzeichnis
I Einleitung
II Theoretischer Teil
1 Einführung
2 Belastung und Beanspruchung
2.1 Allgemeines
2.2 Stress
2.3 Stresstheorien
2.3.1 Cannons Stresstheorie
2.3.2 Die Theorie von Hans Selye
2.3.3 Das Transaktionale Stressmodell von Lazarus
2.4 Stressfaktoren
2.4.1 Daily Hassles
2.4.2 Kritische Lebensereignisse
2.4.3 Traumatische Ereignisse
2.5 Stressbewältigung
2.6 Soziale Schutzfaktoren
2.6.1 Salutogenese nach Antonovsky
2.6.2 Soziale Unterstützung
3 Rettungsdienst
3.1 Geschichtliche Entwicklung
3.2 Das Rettungswesen
3.3 Das Bayerische Rote Kreuz
3.4 Leistungen des BRK
3.5 Notarztsystem
3.6 Berufe im Rettungsdienst
3.6.1 Rettungsassistent
3.6.2 Rettungssanitäter
3.6.3 Rettungshelfer
4 Belastende Ereignisse im Rettungsdienst
4.1 Definition
4.2 Arten von belastenden Ereignissen
4.3 Einsatznachsorge
III Empirischer Teil
5 Ziel der Arbeit
6 Hypothesen
7 Methode
7.1 Vorbereitung der Stichprobe
7.2 Pre-Test
7.3 Stichprobenumfang
7.4 Gütekriterien
7.5. Operationalisierung
7.5.1 Subskala 1 und Subskala 2 - Belastende Ereignisse und allgemeine Belastungen
7.5.1.1 Subskala 1 - Häufigkeit und Stärke von belastenden Ereignissen
7.5.1.2 Subskala 2 - Allgemeine Belastungen
7.5.2 Subskala 3 - Fragen zur sozialen Unterstützung
7.5.3 Subskala 4 - Verarbeitung von belastenden Situationen
7.5.4 Subskala 5 - Fragen zur Beanspruchung
7.5.5 Subskala 6 - Soziodemographische Daten
7.6 Untersuchungsdurchführung
7.6.1 Kurzvorstellung der Dienststellen
7.6.2 Durchführung der Befragung
7.6.3 Beteiligung
8 Ergebnisse
8.1 Stichprobenbeschreibung
8.2 Scorebildung
8.2.1 Verteilungscharakteristiken der Subskalen
8.2.2 Trennschärfe der Items
8.3 Deskriptive Statistik
8.3.1 Belastende Ereignisse
8.3.2 Allgemeine Belastungen
8.3.3 Soziale Unterstützung
8.3.4 Verarbeitung belastender Ereignisse
8.3.5 Fragen zur Beanspruchung
9 Faktorenanalyse
10 Korrelationen
10.1 Berechnung der Korrelationen
10.2 Interpretation der Ergebnisse
10.2.1 Subskala Belastende Ereignisse - BELE
10.2.2 Allgemeine Belastungen - ABEL
11 Diskussion der Ergebnisse
11.1 Überprüfung der Hypothesen
11.1.1 Hypothese H1
11.1.2 Hypothese H2
11.1.3 Hypothese H3
11.1.4 Hypothese H4
11.2 Zusammenfassung
IV Schluss
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: Einsatzaufkommen im öffentlichen Rettungsdienst Seite
Abb. 2: Veranschaulichung der Aussagen des Belastungs-Beanspruchungs- Seite Konzepts zu Auswirkungen von Arbeitstätigkeiten
Abb. 3: Was ist Stress? Seite
Abb. 4: Das Stress-Modell von Lazarus Seite
Abb. 5: Die Struktur des Bayerischen Roten Kreuzes Seite
Abb. 6: Rettungsdiensteinsätze des BRK im Jahr 2012 Seite
Tabellenverzeichnis
Tab. 1: Teilnehmende Dienststellen Seite
Tab. 2: Soziodemographische Daten Seite
Tab. 3: Verteilungscharakteristika der Subskalen Seite
Tab. 4: Trennschärfenberechnung für Subskala 1 Seite
Tab. 5: Trennschärfenberechnung für Subskala 2 Seite
Tab. 6: Trennschärfenberechnung für Subskala 3 Seite
Tab. 7: Trennschärfenberechnung für Subskala 4 Seite
Tab. 8: Trennschärfenberechnung für Subskala 5 Seite
Tab. 9: Rangsortierte Subskala belastender Ereignisse Seite
Tab. 10: Rangsortierte Subskala der Stressoren Seite
Tab. 11: Barlett-Test auf Sphärität und KMO-Maß Seite
Tab. 12: Geschätzte Verteilungsparameter des Q-Q-Plots Seite
Tab. 13: Kolmogorov-Smirnov-Test bei einer Stichprobe Seite
Tab. 14: Rangsortierte Berechnung des Produkt-Moment-Korrelations- Seite
Tab. 15: Produkt-Moment-Korrelations-Koeffizienten im Vergleich Seite
I. Einleitung
„Krankenstand erneut gestiegen - Psychische Erkrankungen verursachen die längsten Ausfallzeiten.“
So titelt das Wissenschaftliche Institut der AOK in seiner Pressemitteilung zum Fehlzeitenreport 2009 (S. 1). Im weiteren Verlauf dieser Mitteilung heißt es, dass die Fehlzeiten in den letzten Jahren deutlich zugenommen haben. Helmut Schröder (Mitherausgeber des Fehlzeitenreportes 2009): „So stieg die Zahl der von psychischen Erkrankungen verursachten Arbeitsunfähigkeitsfälle seit 1995 um 80%.“
Im Vorwort zum BARMER-Gesundheitsreport 2009 äußert sich Birgit Fischer, stellvertretende Vorstandsvorsitzende: „In den letzten fünf Jahren hat sich der Krankenstand in der Diagnosegruppe ‚Psychische und Verhaltensstörungen‘ mehr als verdoppelt und nimmt somit - nach den Muskel-Skeletterkrankungen - Platz 2 der Rangliste der wichtigsten Krankheiten ein.
Diese Ergebnisse und Feststellungen wurden von der Politik bisher jedoch nicht entsprechend berücksichtigt. So ist auf der Internetseite des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) zu lesen:
Nach wie vor ist die Zahl der Menschen, die an Volkskrankheiten wie Krebs, Herz-Kreislauf-, Stoffwechsel-, Infektions-, Lungen- und neuro- degenerativen Erkrankungen leiden beziehungsweise neu erkranken, besorgniserregend. Optimale Forschungsbedingungen zu schaffen, um Volkskrankheiten zu bekämpfen, ist ein zentrales Anliegen der neu ge- gründeten Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung (DGZ).
Zu diesem Zweck stellt das BMBF in den nächsten Jahren rund 700 Millionen Euro den DGZ zur Verfügung.
„Betrachtet man die Aufzählung der sechs Themengebiete, so werden psychi- sche Erkrankungen nicht einmal im weitesten Sinne erfasst.“ (Christmann, 2012, S. 20). Im weiteren kommt er zu dem Ergebnis: „Umso mehr wird klar, wie dringend Forschungen genau zu diesem Thema betrieben werden müssen […].“ (ebd., S. 21) und widmet seine Dissertation eben diesem Thema im Be- reich des Rettungsdienstes.
Mit dieser Magister-Arbeit soll die Frage beantwortet werden, welche belas- tenden Ereignisse im Rettungsdienst vorhanden sind und wie sie unter Berück- sichtigung von Bewältigungsstrategien mit psychischen Beanspruchungen zu- sammenhängen.
Im ersten Teil dieser Arbeit werden die theoretischen Grundlagen erörtert, im zweiten, dem empirischen Teil, werden die Ergebnisse der Befragung, die zu dem Themengebiet bei Teilen des Rettungsdienstes des BRK durchgeführt wurde, dargestellt und diskutiert.
II. Theoretischer Teil
1. Einführung
Nach der Gesundheitsberichterstattung des Bundes wurden in den Jahren 2008/2009 von den öffentlichen Rettungsdiensten ca. 14,17 Millionen Einsätze durchgeführt. Bricht man diese Zahl herunter, werden täglich ca. 39.000 Hilfe- ersuchen an die Rettungsstellen gerichtet, wobei dies einer Einsatzzahl von 27 pro Minute entspricht.
Dabei zeigt sich in den vergangenen Jahren folgendes Bild:
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 1: Einsatzfahrtaufkommen im öffentlichen Rettungsdienst (Quelle: Gesundheitsberichterstattung des Bundes - Graphik: eigene)
Auch der ADAC, neben der Deutschen Rettungsflugwacht (DRF) größter Be- treiber der Luftrettung berichtet in der „ADAC-Motorwelt“ im Dezember 2013 (Heft 12, S. 66) von einer Zunahme der Rettungseinsätze seit dem Jahr 2000 um fast das Doppelte, nämlich rund 49.000 Einsätze 2012.
Die Gründe für diesen Fortgang sieht Winkelsträter (2011) zum einen in der demographischen Entwicklung, zum anderen durch verheerende Unwetter.
Trotz dieser kontinuierlichen Steigerung hat die Qualität der Notfallversorgung (trotz eines erheblichen Leistungsdruckes) nicht abgenommen. Im Gegenteil: durch technischen Fortschritt und zunehmende Technisierung in der präklinischen Akutversorgung von Notfallpatienten durch nichtärztliches Rettungsfachpersonal (Rettungssanitäter, Rettungsassistenten, Rettungshelfer1 ) sind heute mehr Möglichkeiten gegeben als noch Jahre zuvor.
Nach Koch (1996, S. 22) führt dies u.a. zu einer Änderung im Tätigkeitsprofil. Der Wandel im Tätigkeitsprofil lässt sich dadurch erkennen, dass in der „Klas- sifizierung der Berufe“ von 1988 der Beruf des Sanitäters (Berufsgruppe 8542) der Untergruppe 854 „Helfer in der Krankenpflege“ zugeordnet war (vgl. Bun- desanstalt für Arbeit, 1988). Die Fassung von 2010 beinhaltet nunmehr die „Berufe im Rettungsdienst“ (Berufsgruppe 8134) mit den Tätigkeiten des Ret- tungsdiensthelfers und Rettungshelfers (81341) und die Rettungsassistenten und Rettungssanitäter (81342 - vgl. Bundesagentur für Arbeit, 2011a und 2001b).
2014 wird das Notfallsanitätergesetz („Gesetz über den Beruf der Notfallsanitäterin und des Notfallsanitäters“) in Kraft treten.
Damit wird aus dem Rettungsassistenten der Notfallsanitäter. „Die Ausbildung soll reformiert werden, um den Anforderungen an einen modernen Rettungsdienst gerecht zu werden.“ (Gerst, 2013).
Es sollen aber auch Kompetenzerweiterungen stattfinden, die den Notfallsani- täter befähigt, nach Delegation durch den ärztlichen Leiter Rettungsdienst „ei- genständiges Durchführen von heilkundlichen Maßnahmen“ (vgl. § 4 Not- SanG).
Dr. med. Mathias Wesser (Präsident der Landesärztekamme Thüringen und Vorsitzendes des Ausschusses Notfall-/Katastrophenmedizin und Sanitätswe- sen der Bundesärztekammer) befürchtet, dass die bestehende Handlungskom- petenz des Rettungsassistenten in der präklinischen Notfallversorgung „zu weit
Es wird im Folgenden auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachform verzichtet. Die männliche bezieht die weibliche Form mit ein, dient der besseren Lesbarkeit und stellt keinen Akt der Diskriminierung dar.
in den ärztlichen Bereich hineinverschoben“ wird (Deutsches Ärzteblatt, Heft 4 vom 25. Januar 2013, S. A123).
Inwieweit sich diese Befürchtungen bewahrheiten, muss die Praxis zeigen, wenn erste Erfahrungen mit der neuen Ausbildung vorliegen.
2. Belastung und Beanspruchung
2.1 Allgemeines
„Das Belastungs-Beanspruchungskonzept wurde ursprünglich für Belastungen mit physiologischen Beanspruchungen entwickelt. Infolge seiner Erweiterun- gen für sozialwissenschaftliche Fragestellungen beansprucht es Gültigkeit auch für Belastungen mit psychischen Beanspruchungen.“(Oesterreich, 2001, S. 162).
„Die folgenden Weiterentwicklungen des Konzepts betreffen im Wesentlichen eine Erweiterung der naturwissenschaftlichen, physiologische Sichtweise um Erkenntnisse aus den Sozialwissenschaften.“ (Fenzl, 2008, S. 21).
Die Begriffe „Belastung“ und „Beanspruchung“ entstammen ursprünglich der Materiallehre. Sie wurden in der technischen Mechanik in Form einer UrsacheWirkungsbeziehung konzipiert und entsprechen damit den Begriffen „Stimulus“ und „Response“ (vgl. Sonntag et al., 2012, S. 262). In der englischsprachigen Literatur finden sich hierfür die Ausdrücke „Stress“ und „Strain“, welche im deutschsprachigen Schrifttum synonym verwendet werden.
Dieses Ursache-Wirkungs-Modell wurde mehrfach erweitert und in die ar- beitspsychologische Forschung einbezogen. Rohmert (1984) bezieht jedoch nicht nur körperliche, sondern auch psychosoziale Aspekte mit ein (S. 194).
Rohmert & Rutenfranz (1975) nehmen eine definitorische Trennung der beiden Begriffe vor, die sich letztendlich in der DIN EN ISO 10075-1 niederschlägt. Diese Norm definiert:
„Psychische Belastung ist die Gesamtheit aller erfassbaren Einflüsse, die von außen auf den Menschen zukommen und psychisch auf ihn einwirken“.
„Psychische Beanspruchung ist die unmittelbare (nicht die langfristige) Auswirkung der psychischen Belastung im Individuum in Abhängigkeit von seinem jeweiligen überdauernden und augenblicklichen Voraussetzungen einschließlich der individuellen Bewältigungsstrategien.“
Oesterreich (2001, S. 163) sagt hierzu:
Der Begriff „Belastung“ hat im engeren wie im erweiterten Belastungs- Beanspruchungskonzept eine zunächst neutrale Bedeutung; erst wenn die Belastung zu hoch oder zu niedrig wird, hat sie negativ zu wertende Beanspruchungsfolgen. Zu gering Belastung kann als „Unterforderung“ zu ‚Fehlbeanspruchung‘ und zu hohe Belastung als „Überforderung“ ebenfalls zu „Fehlbeanspruchung“ führen; der mittlere Bereich einer quasi „optimalen“ Belastung führt nicht zu Fehlbeanspruchung.“
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 2: Veranschaulichung der Aussagen des Belastungs-Beanspruchungskonzepts zu Auswirkungen von Arbeitstätigkeiten (Oesterreich, 2001, S. 163)
Für das Auftreten psychischer Belastung und Beanspruchung werden in der Literatur verschiedene Ursachen genannt. So unterteilt Hettinger (1989) den Ursprung in die berufliche und die private Sphäre (S. 174). Schönpflug (1987, S. 144 ff. zitiert nach Ulich, 1998, S. 413) unterscheidet sechs Dimensionen der Belastungen: „(1) nach ihrer Herkunft, (2) nach ihrer Qualität, (3) nach den Möglichkeiten, sie zu beeinflussen, (4) nach der Möglichkeit, ihr Auftreten vorherzusehen, (5) nach ihrer zeitlichen Struktur und (6) nach der Art der Auswirkung auf den Betroffenen“.
Stadler (2006) differenziert die Einflussfaktoren in vier Kategorien: (a) der Arbeitsaufgabe, (b) den Umgebungsbedingungen (c) der betrieblichen Organisation und (d) den sozialen Verhältnissen (S. 2).
Bei den Untersuchungen zum Thema Stress, die im Stressreport Deutschland 2012 (Lohmann-Haislah, 2012, S. 34) veröffentlich sind, wurde die psychische Belastung in drei Anforderungsbereiche eingeteilt: (1) Anforderungen aus dem Arbeitsinhalt und -organisation, (2) Anforderungen aus der Arbeitszeitorganisation und (3) Anforderungen aus der Beschäftigungssitaution.
2.2 Stress
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 3: Was ist Stress? (Stadler, 2009, S. 2)
In der arbeitspsychologischen Wissenschaft haben sich verschiedene Modelle der Ursachenforschung herausgebildet, wobei einerseits das Belastungs- Beanspruchungskonzept, andererseits den Begriff „Stress“ zum Inhalt haben.
Insbesondere der Begriff „Stress“ wird heutzutage nicht nur in der Umgangs- sprache, sondern auch in der wissenschaftlichen Forschung verwendet. Zim- bardo & Gerrig (2004, S. 562) definieren Stress als „Das Muster spezifischer und nichtspezifischer Reaktionen eines Organismus auf die Ereignisse, die sein Gleichgewicht stören und seine Fähigkeit, diese zu bewältigen, stark beans- prucht oder übersteigt.“
„Arbeitsbedingter Streß läßt sich definieren als Gesamtheit emotionaler, kognitiver, verhaltensmäßiger und physiologischer Reaktionen auf widrige und schädliche Aspekte des Arbeitsinhalts, der Arbeitsorganisation und der Arbeitsumgebung.“ (Europäische Kommission, 1999, S. 9).
Lasogga & Gasch (2011) geben jedoch zu bedenken: „Die Bedeutung des Be- griffs »Stress« hängt letztendlich von der zugrunde liegenden Stresstheorie ab […]. (S. 129).
2.3 Stresstheorien
2.3.1 Cannons Stresstheorie
Das älteste Stress-Modell stammt von Cannon2 „Fight-or-flight“: durch neuro- biologische Abläufe bei Bedrohung werden im Körper Kraftreserven bereitges- tellt, die eine angemessene Reaktion in Stress-Situationen auslöst, nämlich Kampf oder Flucht.
2.3.2 Die Theorie von Hans Selye
Ein weiteres Modell, das „Allgemeine Anpassungssyndrom“, entwickelte Se- lye3. Synonym wird hierzu auch der Begriff „Generalisiertes Anpassungssyn- drom“ verwendet. Dabei handelt es sich um das ursprüngliche Stresskonzept. Zimbardo & Gerrig (2004, S. 565) beschreiben dieses Syndrom als „Muster nichtspezifischer adaptiver physiologischer Mechanismen, welches als Reakti- on auf die andauernde Bedrohung durch fast jeden starken Stressor auftritt.“
Die Reaktionen auf Stress gliedern sich beim Allgemeinen Anpassungssyndrom in drei Phasen:
a) Alarmreaktion (alarm reaction)
Auf dieser Stufe findet der von Cannon beschriebene Mechanismus fight-or- flight statt, der Körper konzentriert alle Kraftreserven auf höchstem Niveau, um angemessen reagieren zu können. Im Menschen finden Überlegungen statt, wie dem Stressor begegnet werden kann.
b) Widerstandsphase (stage of resisdence)
Hält die belastende Situation an, erfolgt ein Anpassungsversuch des Körpers mit entsprechender Hormonausschüttung, um die Reaktionsmöglichkeit, für sich das Individuum entschieden hat, auszuführen.
c) Erschöpfungsphase (stage of exhaustion)
Besteht die körperliche Anspannung fort, es gelingt dem Betreffenden also nicht, die Widerstandsphase aufrecht zu erhalten und die belastenden Ereignis- se zu verarbeiten, sind die Energiereserven aufgebraucht, der Mensch ist er- schöpft und gibt auf.
„Nach Selye gibt es zwei Möglichkeiten der Entstehung von Krankheiten im Zusammenhang mit dem generalisierten Anpassungssyndrom:
- Schädigung durch mangelnde Adaption (Stressulcus)
- Schädigung durch überschießende Adaptionsreaktionen (Hypertonie).“
(Stangl, 2013, S. 4).
Aber nicht jede Art von Stress ist schädlich. Dies hat Selye erkannt und in sei- nem Modell zwei Arten unterschieden: positivem (Eu-Stress) und negativem (Dis-Stress). Während Dis-Stress, wenn er längere Zeit auf den Körper ein- wirkt, zu Schäden (bis hin zum Tod) führt, ist Eu-Stress für den Betroffenen von positiver Bedeutung. Er erhöht die Aufmerksamkeit und steigert die Leis- tungsfähigkeit und bewirkt im Menschen, dass Fähigkeiten und Fertigkeiten weiterentwickelt werden.
Von den meisten Autoren wird diese Unterscheidung nicht gemacht - die Ver- wendung des Begriffs „Stress“ wird nur in seiner negativen Form verwendet.4
2.3.3 Das Transaktionale Stressmodell von Lazarus
„ ‚Transaktionale‘ Konzepte versuchen, auslösende Bedingungen und die Auseinandersetzung mit diesen Bedingungen in einem Modell zu- sammen zu betrachten. Das (gestörte) Verhältnis beider: ein Ungleich- gewicht zwischen den Anforderungen der Umwelt und den Möglichkei- ten des Individuums, si zu bewältigen, steht somit im Vordergrund sol- cher Modelle, als deren ‚Erfinder‘ R.S. Lazarus […] gelten kann. Wenn das Individuum ein solches Ungleichgewicht befürchtet […] liegt nach Lazarus Streß vor.“ (Frese & Semmer, 1987, S. 342).
Das Modell von Lazarus ist das wohl bekannteste Stressmodell. „Im Gegensatz zu früheren Stresstheorien ging Lazarus davon aus, dass nicht die (objektive) Beschaffenheit der Reize oder Situationen für die Stressreaktion von Bedeu- tung sind, sondern deren (subjektive) Bewertung durch den Betroffenen.“ (Rusch, 2012, S. 170)
In diesem Modell finden vorausgehend drei Bewertungen des aktuellen Geschehens, welches zu Stress führt, statt:
a) die Primäre Bewertung (Primary Appraisal) - in dieser Phase werden Situationen als positiv, irrelevant oder stressend bewertet.
b) Sekundäre Bewertung (Secondary Appraisal) - hier wird geprüft, ob die Situation mit zur Verfügung stehenden Mitteln bewältigt werden kann; sind die Mittel nicht ausreichend vorhanden, wird eine Stressreaktion ausgelöst und eine Bewältigungsstrategie entworfen.
c) Neubewertung (Reappraisal) - jetzt erfolgt eine Bewertung der Bewälti- gungsstrategie. War diese erfolgreich, entsteht für die Person beim Erleben ähnlicher Situationen kein Stress, sondern gegebenenfalls nur noch eine He- rausforderung dar. War die Strategie erfolglos, wird eine Neubewertung durch- geführt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 4: Das Stress-Modell von Lazarzus (Quelle: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/thumb/1/13/Stressmodell_von_Richard_Lazarus.png /380px-Stressmodell_von_Richard_Lazarus.png)
2.4 Stressfaktoren
„One of the most striking features of modern stress research is its preoccupa- tion with dramatic events and severely taxing situations.“ (Kanner et al., 1981, S. 2)
„Es existieren eine Reihe unterschiedlicher Stressfaktoren, die sich hinsichtlich der Dimensionen ‚Intensität‘ (negative Valenz) des Ereignisses und ‚erforderli- che Readaptationszeit‘ meist den drei Kategorien ‚Daily Hassles‘, ‚Kritische Lebensereignisse‘ und ‚Traumatische Ereignisse‘ zuordnen lassen.“ (Klemisch, 2006, S. 5).
2.4.1 Daily Hassles
Kanner et al. (1981, S. 24) definieren Hassles: „Hassles are irritations that can range from minor annoyances to fairly major pressures, problems or difficulties. They can occur few or many times.” (Kanner et al., 1981, S. 24).
“Die Hassles Scale von Kanner et al. umfaßt 117 Items (siehe Anhang F-1) und enthält potentiell unangenehme Alltagsereignisse (Bsp.: einen Gegenstand ver- lieren); in der Originalform werden die Items auf einer dreistufigen Skala beur- teilt, wie sehr sie das Leben im Laufe des letzten Monats gestört haben.“ (Per- rez et al., 1998, S. 297).
„Hassles are irritating, frustrating demands that occur during everyday transactions with the environment.“ (Holm & Holroyd, 1992, S. 465). In der „Daily Hassles Scale” führen sie eine Reihe von täglichen Stresssituationen aus den Bereichen psychische Angelegenheiten, finanzielle Angelegenheiten, Zeitdruck, Arbeitsstress, Umweltprobleme, Familienangelegenheiten und Gesundheitsfragen. (S. 472 - 473 / siehe Anhang F-2).
Es handelt sich also hierbei um auftretende Belastungen des Alltags und stehen in der Reihenfolge der Stressfaktoren an unterster Stelle. „Sie beinhalten je- doch aufgrund der Frequenz ihres Auftretens ein hohes Chronifizierungsrisiko und dem enstsprechend auch ein beträchtliches Risiko für die Entwicklung physischer und psychischer Störungen.“ (Klemisch, 2006, S. 5). Darüber hinaus können sie sich direkt auf das Befinden auswirken aber auch die Effekte anderer Belastungen verstärken. (Perrez et al., 1998, S. 285).
2.4.2 Kritische Lebensereignisse
Das erste normierte Verfahren entwickelten Holmes & Rahe (1967) - es um- fasst 43 Lebensereignisse, deren Wiederanpassungswerte nach einer Studie festgelegt wurden - die sog. Social Readjustment Rating Scale (SRRS - siehe Anhang F-3). Mit diesem Instrument wurden von ihnen Belastungswerte von lebensverändernden Ereignissen festgelegt, um die entsprechende Intensität einschätzen zu können.
Basis für die SRRS war die von ihnen in den 50-er Jahren ausgearbeitete Liste von lebensverändernden Ereignissen (Schedule of Recent Experience).
„Es konnte ein zeitlicher Zusammenhang zwischen dem Erleben eines Ereignisses […] und dem Auftreten von Krankheiten nachgewiesen werden.“(Klemisch, 2006, S. 6).
2.4.3 Traumatische Ereignisse
Ein traumatisches Ereignis ist ein „Ereignis hoher Intensität mit gleichzeitig fehlender adäquater Bewältigungsmöglichkeit und einer Überlastung der An- passungskapazität des Individuums mit Anpassungs- und Belastungsstörun- gen.“ (Freedy & Hobfoll, 1995, zitiert nach Perrez et al., 1998, S. 283).
Die American Psychatric Association legt in ihren Regelungen des DSM-IV- TR, Appendix E, Pkt. A, Absatz 1 (sh. Anhang F-4), fest, wann ein traumati- sches Ereignis vorliegt: die Person erlebt ein Ereignis, wenn es mit dem Tod, der Androhung des Todes, einer schweren Verletzung oder einer anderen Be- drohung der körperlichen Unversehrtheit selbst oder bei anderen konfrontiert wird. Die Reaktion der Person besteht aus intensiver Angst, Hilflosigkeit oder Entsetzen. (Absatz 2).
Das medizinische Klassifikationssystem ICD-10 der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die zugehörigen diagnostischen Anleitungen beschreiben das Traumakriterium als: „[…] ein belastendes Ereignis oder eine Situation kürzerer oder längerer Dauer, mit außergewöhnlicher Bedrohung oder katastrophenartigem Ausmaß, die bei fast jedem eine tiefe Verzweiflung hervorrufen würde (ICD-10, 2006, F43.1- sh. Anhang F-5).“
„Das Individuum ist nicht mehr in der Lage, sich an die Anforderungen anzupassen und es resultieren Belastungsstörungen.“ (Freedy & Hobfoll, 1995, zitiert nach Klemisch, 2006, S. 6).
Zusammengefasst kann man sagen, dass traumatische Ereignisse ein besonderes Format der kritischen Lebensereignisse darstellt, die zum größten Teil die Bewältigungsmöglichkeiten des Betroffenen überbeanspruchen.
2.5 Stressbewältigung
Bewältigung (Coping) wird dabei von Lazarus und Folkman (1984, S. 141) definiert als „sich ständig verändernde kognitive und verhaltensmäßige Bemü- hungen bzw. Anstrengungen mit spezifischen externen und/oder internen An- forderungen, die die Ressourcen einer Person beanspruchen oder übersteigen, fertig zu werden.“
Häcker & Stapf definieren Coping al eine „Vielzahl von Strategien und Verhaltensweisen der Auseinandersetzung mit Stressoren und bealstenden Situationen.“ (1998, S. 159)
Carver et al. beschreiben den Prozess der aktiven Bewältigung: „Active coping is the process of taking active steps to try to remove or circumvent the stressor or to ameliorate its effects.” Diese beinhaltet die Eröffnung aktiver Schritte, die Verstärkung der eigenen Bemühungen und den Versuch, Bewältigungsanstrengungen schrittweise auszuführen. (1989, S. 268)
In seinem transaktionalen Stressmodell unterscheidet Lazarus drei Arten der Stressbewältigung:
a) Problemorientiertes Coping
Hierunter ist zu verstehen, dass die Person durch Informationssuche, direktem Handeln oder Unterlassen von Handlungen versucht, Stresssituationen zu überwinden oder sich den Tatsachen anzupassen. Diese Art des Coping findet auf der Ebene der Situation bzw. des Reizes statt.
b) Emotionsorientiertes Coping
Bei dieser Bewältigungsstrategie (sog. intrapsychisches Coping) prüft das In- dividuum, die durch den Stress entstandene emotionale Erregung abzubauen.
c) Bewertungsorientiertes Coping
Mit dem in seinem Transaktionalen Stressmodell verwendete Ausdruck „Reappraisal“ meint Lazarus zum einen den Bewertungsprozess neu zu beginnen. Andererseits ist diese Neubewertung aber auch als Coping-Strategie zu verstehen: „I also used the term cognitive coping to express this idea that coping can influence stress and emotion merely be a reappraisal of personenvironment relationsship.” (Lazarus, 1991, S. 77).
Unter unzähligen Möglichkeiten, Stress zu bewältigen oder zu umgehen, haben sich vier grundlegende Strategien bewährt (Mitchell & Everly, 1998, S. 41):
1. Vermeidung von Stressverursachern
2. kognitive Neubewertung
3. Erregung verringern
4. Stressreaktion bearbeiten und verbalisieren.
„Seit über 30 Jahren werden Programme und Trainings zur Streßbewältigung entwickelt und in speziellen Einsatzbereichen erprobt. Diese Techniken […] sind erlern- und vermittelbar. Die meisten Ansätze sind basieren auf der Streßimpfung von Meichenbaum.“ (Bengel, 1997, S. 232).
Bei dem Stressimpfungs-Training werden Verfahren zur Stressbewältigung vermittelt. Dabei vollzieht sich der Prozess der Vermittlung solcher Strategien präventiv, das heißt, vor Entstehung der Stresssituation werden diese Hilfsmittel dem Probanden beigebracht. Es handelt sich hierbei um ein kognitivverhaltenstherapeutisches Verfahren.
Darüber hinaus haben die Kardiologen Friedmann & Rosemann im Rahmen ihrer Untersuchung festgestellt, dass es einen Zusammenhang zwischen Lebensstilen und deren Empfänglichkeit für bestimmte Erkrankungen gibt. Sie unterscheiden die Persönlichkeits-Typen A, B und C.
„Besonders Stress-gefährdet ist der Typ A, dessen Verhalten durch ein starkes Leistungs- und Erfolgsstreben, den Hang zum Perfektionismus, verstärktes Konkurrenzdenken sowie durch das Verfolgen von parallelen Aufgaben und Verpflichtungen gekennzeichnet ist.“ (Hartig, 2007, S. 18).
2.6 Soziale Schutzfaktoren
Art und Intensität eines belastenden Ereignisses wird von Betroffenen unterschiedlich bewertet. Nach Gasch (2000, S. 61) besteht in der Forschung Einigkeit darüber, dass es gewisse Schutzmechanismen geben muss, die manche Personen robuster und andere vulnerabler machen.
2.6.1 Salutogenese nach Antonovsky
„Das Konzept der Salutogenese von Antonovsky (1979, 1993) hat einen spe- ziellen Zugang zur Streßbewältigung eröffnet, indem danach gefragt wird, wel- che Faktoren manche Menschen ‚widerstandsfähiger‘ gegenüber Belastungs- faktoren bzw. Stress machen als andere […] In diesem Zusammenhang wird häufig von Ressourcen (oder auch Schutzfaktoren) gesprochen.“ (Vogel et al., 2000, S. 423).
Nach dem Salutogenese-Modell ist Gesundheit nicht als Zustand, sondern als Prozess zu verstehen. Dabei wird davon ausgegangen, dass Gesundheit nicht grundsätzlich besteht, sondern erst durch bestimmte Schutzfaktoren hergestellt wird.
„Antonovsky hat einen Paradigmenwechsel beschworen: neu salutogen zu denken statt in den alt hergebrachten Bahnen der pathogenen Analyse zu bleiben.“ (Reinshagen, 2008, S. 144).
Nach der Auffassung von Antonovsky ist das Kohärenzgefühl der Kernpunkt in der Fragestellung nach der Entstehung von Gesundheit.
Das Kohärenzgefühl (>sense of coherence<) ist eine globale Orientie- rung, die ausdrückt, in welchem Ausmaß man ein durchdringendes, an- dauernd und dennoch dynamisches Gefühl des Vertrauens hat, dass (1) die Stimuli, die sich im Verlauf des Lebens aus der inneren und äußeren Umgebung ergeben, strukturiert, vorhersehbar und erklärbar sind; (2) einem die Ressourcen zur Verfügung stehen, um die Anforderungen, die diese Stimuli stellen, zu begegnen; (3) diese Anforderungen Heraus- forderungen sind, die Anstrengung und Engagement lohnen. (Anto- novsky, 1997, S. 36).
Die Grenzen seines Konzeptes sieht Antonovsky darin, dass die Weltsicht, die sich die Menschen über Jahrzehnte durch institutionelle, soziale und kulturelle Vorgaben angeeignet haben, durch „Begegnungen zwischen Klient und Klini- ker“ (ebd., S. 36) nicht signifikant verändern lassen. „Zugleich ist es aber An- tonovsky selbst, der die Diskussion über die Wirkensweise von Stressoren (Stressfaktoren) erweiterte, weil er bedauerte, dass sie ausschließlich von ihrer krankmachenden, pathogenen Seite her interpretiert werden.“ (Gleide, 2004, S. 8).
2.6.2 Soziale Unterstützung
Freese & Semmer, 1991 sind der Auffassung, dass sich in wissenschaftlichen Untersuchungen als wichtige externe Schutzfaktoren Kontrolle und soziale Unterstützung erwiesen haben.
Schwarzer (2004, S. 177) definiert: „Soziale Unterstützung ist die Interaktion zwischen zwei oder mehr Menschen, bei der es darum geht, einen Problemzustand, der bei einem Betroffenen Leid erzeugt, zu verändern oder zumindest das Ertragen dieses Zustandes zu erleichtern.“
Cobb (1976, S. 312) erklärt, dass sich soziale Unterstützung verschiedentlich als effektiver Moderator für Stresseffekte erwiesen hat. Somit leiden Personen mit höherer Unterstützung weniger unter Krankheiten, auch wenn sie gleichho- hem Stress ausgesetzt sind. „Insbesondere Karasek und Theorell (1990) stellten auch bei hohen Arbeitsanforderungen keine negativen Beanspruchungsfolgen fest, wenn die soziale Unterstützung aus dem Kollegenkreis hoch war.“ (Ben- zin, 2007, S. 34).
Cohen & Wills (1985) führen an, das zahlreiche Studien gezeigt haben, dass soziale Unterstützung mit der psychischen und physischen Gesundheitslage verknüpft sind. Desweiteren merken sie an, dass in diesen Studien festgestellt wurde, dass bei allen Ursachen von Sterblichkeit die Rate bei Personen mit relativ geringer Unterstützung größer war. Ebenso haben prospektive Studien, die den geistigen Gesundheitszustand zum Gegenstand hatten, ergeben, dass ein positiver Zusammenhang zwischen sozialer Unterstützung und geistiger Gesundheit besteht. (S. 311).
Das Robert-Koch-Institut unterteilt soziale Unterstützung in vier, sich überlagernden Dimensionen: (1) Emotionale Unterstützung, (2) Instrumentelle Unterstützung, (3) Unterstützung bei der Bewertung und Einschätzung und (4) Informationelle Unterstützung. (2011, S. 115).
Es ist jedoch zu beachten, dass es sich bei der sozialen Unterstützung um ein dyadisches System handelt. Es setzt sich zusammen aus dem Hilfeempfänger und dem Unterstützungsgeber. Antoniw et al. zeigen jedoch auf, dass Studien, die sich mit den unterstützungsbedingten Faktoren eines Unterstützungsgebers beschäftigen, vergleichsweise unterrepräsentiert sind. (2007, S. 158).
Laireiter & Lettner haben sechs Kategorien negativer Effekte der sozialen Unterstützung beim Unterstützungsempfänger herausgearbeitet:
a) belastende Effekte normaler Unterstützung (Gefahr der Selbstwertbedro- hung)
b) inadäquate Unterstützung (Überforderung des Hilfegebers)
c) enttäuschte Unterstützungserwartungen (Unterlassung der Hilfeleistung)
d) exzessive Hilfe (übertriebenes emotionales Engagement)
e) problematische Beziehungen zwischen Unterstützer und Unterstützen
f) belastungsbedingte Ineffektivität (Überforderung des Hilfegebers aufgrund länger anhaltender Unterstützung). (1993, S. 108 - 111).
Im Vordergrund sozialer Unterstützung sollte jedoch auf jeden Fall der positive Effekt stehen. „Die Ergebnisse der GEDA-Studie 2009 zeigen, dass ein Großteil der Bevölkerung Deutschlands in ausreichendem Maß sozial unterstützt wird.“ (Robert-Koch-Institut, 2011, S. 115).
3. Der Rettungsdienst
3.1 Geschichtliche Entwicklung
Die mangelnde Rekrutierung von Soldaten machte es notwendig, den Verwundeten auf den Schlachtfeldern im 18. und 19. Jahrhundert eine Erste Hilfe zu Teil werden zu lassen. Insbesondere die umgehende Behandlung von blutenden Wunden und Knochenbrüchen machte es möglich, die Einsatzfähigkeit der betroffenen Soldaten wieder zu herzustellen. Auch konnten sofort durchgeführte Operationen die Sterblichkeitsrate zu senken.
D.J. Larrey5 (der später Chefchirurg in der großen Armee Napoleons wurde) erkannte 1792 „die Mängel des damaligen Verwundeten-Transportsystems und die Leiden der Betroffenen“ (Gorgaß & Ahnefeld, 1989, S. 11). Aus diesen Erkenntnissen heraus gründete er ein militärisches Notfallsystem, in dem er sogenannte „Fliegende Lazarette“ einrichtete. Diese waren weniger als eine Meile hinter der Frontlinie stationiert und die dort tätigen Ärzte nutzten die durch die Schockwirkung reduzierte Schmerzempfindung zur Durchfüh- rung notwendiger Operationen.
„Die frühzeitige Wundversorgung verringerte deutlich Wundinfektionen sowie damit zusammenhängende Erkrankungen, zum Beispiel Gasbrand oder Tetanus.“ (Gorgaß et al., 2007, zitiert nach Pietzek, 2007, S. 5).
Die fortschreitende Industrialisierung und eine wachsenden Bevölkerung im 19. und 20. Jahrhundert brachte nicht nur eine Zunahme von Unfällen, sondern auch eine steigende Zahl von Herz-Kreislauferkrankungen mit sich. Hieraus ergab sich die Notwendigkeit, auch im zivilen Bereich entsprechende Hilfeleistungen zur Verfügung zu stellen.
Nach dem zweiten Weltkrieg wurde das bis dahin praktizierte medizinische Laiensystem professionalisiert - die Notfallrettung entwickelte sich zu einem modernen System der zivilen präklinischen Notfallversorgung mit den Aufga- ben der Landrettung. 1970 startete der erste Rettungshubschrauber in München. Bis zu diesem Zeitpunkt wurde die Luftrettung durch die SAR6 - Hubschrauber der Bundeswehr durchgeführt. Seit 1982 werden die Aufgaben der Seenotrettung durch die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) wahrgenommen. Vor diesem Zeitpunkt wurde dieses Aufgabenfeld durch die Küstenwache und die Bundesmarine abdeckt.
3.2 Das Rettungswesen
Das Rettungswesen, als Teil des Gesundheitswesens, ist in der Bundesrepublik Deutschland durch das in Art. 30 Grundgesetz (GG)7 festgelegten Föderalis- musprinzips, Sache der Bundesländer. Hierdurch existieren in Deutschland 16 Rettungsdienstgesetze, jedoch sind die Zugangsqualifikationen für die einge- setzten Berufsgruppen im Rettungsdienst bundeseinheitlich festgelegt [sh. Ret- tungsassistentengesetz vom 10. Juli 1989 (BGBl. I S. 1384), das zuletzt durch Artikel 19 des Gesetzes vom 2. Dezember 2007 (BGBl. I S. 2686) geändert worden ist]:
„Der Rettungsdienst ist eine öffentliche Aufgabe der Gefahrenabwehr und der Gesundheitsvorsorge. Er hat die bedarfsgerechte, wirtschaftliche und dem ak- tuellen Stand der Medizin und Technik entsprechende Versorgung der Bevöl- kerung mit Leistungen der Notfallversorgung und des Krankentransportes si- cherzustellen.“ (vgl § 1 Hessisches Rettungsdienstgesetz vom 16.12.2010). Hieraus ergibt sich die elementare Aufgabenuntergliederung: Notfallversor- gung und Krankentransport.
Kochen (2012, S. 39) definiert: „Als Notfall wird eine medizinische Situation bezeichnet, in der eine potenziell lebensbedrohliche oder existenzielle Gefährdung der Gesundheit gegeben ist.“
Das Internet-Lexikon WIKIPEDIA beschreibt:
Als Notfall werden im Rettungswesen Fälle benannt, bei denen es zu einer lebensbedrohlichen Störung der Vitalparameter Bewusstsein, At- mung und Kreislauf oder der Funktionskreisläufe Wasser-Elektrolyt- Haushalt, Säure-Basen- Haushalt, Temperaturhaushalt und Stoffwech- sel kommt. Ohne sofortige Hilfeleistung sind erhebliche gesundheitli- che Schäden oder der Tod des Patienten zu befürchten. In einem weite- ren Sinn fasst man auch psychische Notsituationen wie beispielsweise Selbsttötungsabsichten oder Psychosen sowie Gewalt unter den Notfall- Begriff.“8
Der zweite Aufgabenkomplex ist der Krankentransport. DIN 13050:2009-02 erklärt diesen Begriff wie folgt: „Transport, der die Beförderung von Erkrankten, Verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Personen, die keine Notfallpatienten sind, und die fachgerechte Betreuung in einem Krankenkraftwagen durch dafür qualifiziertes Personal umfasst.“ (Nr. 3-21). Daher wird in der Literatur bisweilen der Begriff „qualifizierter Krankentransport“ verwendet (vgl. Heringshausen, 2011, S. 11; Mühlen et al., 2005, S. 165).
Hiervon abzugrenzen ist die Krankenfahrt. DIN 13050 (Nr. 3-19) führt hierzu aus: „Beförderung von Personen, die keiner medizinisch fachlichen Hilfe oder Betreuung bedürfen.“ Diese fallen somit nicht in den Aufgabenbereich des Rettungsdienstes.
3.3 Das Bayerische Rote Kreuz
Für die durchgeführte Untersuchung wurden Rettungskräfte des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) ausgewählt. Es soll daher ein kurzer Überblick über Aufbau und Struktur dieser Einrichtung gegeben werden.
Das BRK ist im Gegensatz zum Deutschen Roten Kreuz (DRK - eingetragener Verein) eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Rechtsaufsichtsbehörde ist daher das Bayerische Staatsministerium des Inneren und ist organisatorisch einer von 19 Landesverbänden des DRK.
Es betreibt nach eigenen Angaben den größten Rettungsdienst in Deutschland und auf dem westeuropäischen Kontinent.
(Quelle: http://www.rettungsdienst.brk.de/wir-ueber-uns/leistungsdaten).
Wie auch das DRK ist das BRK hierarchisch gegliedert. Es unterteilt sich in die Landesgeschäftsstelle (die operative Leitung und Steuerung des Verbandes erfolgt unter der Leitung des Landesgeschäftsführers) und fünf Bezirksverbänden (Oberbayern, Niederbayern / Oberpfalz, Schwaben, Oberfranken / Mittelfranken und Unterfranken).
Darunter befinden sich 73 Kreisverbände, die wiederum in Ortsgruppen einge- teilt sind.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 5: Die Struktur des Bayerischen Roten Kreuzes (Quelle: Christmann, 2012, S. 57, Graphik: eigene)
Der Rettungsdienst des BRK untergliedert sich in 26 Bereiche.Das Personal setzt sich aus haupt- und ehrenamtlichen Kräften zusammen, wobei die im Ret- tungsdienst eingesetzten Mitarbeiter überwiegend hauptamtlich tätig sind. Das BRK verfügt derzeit über ca. 16.000 hauptamtliches und ca. 130.000 ehrenamtliches Personal.
Die ehrenamtlichen Mitglieder leisten Dienst in den Bereichen: Bereitschaften, Wasserwacht, Jugendrotkreuz, Wohlfahrt- und Sozialarbeit sowie Bergwacht. Die wahrzunehmenden Aufgaben sind standortabhängig , so hat zum Beispiel die Wasserwacht ihr Tätigkeitsfeld in und auf den Seen und Flüssen des Freis- taates.
3.4 Leistungen des BRK
Der BRK-Rettungsdienst erledigte im Jahr 2012 ca. 1,6 Millionen Einsätze. Dies entspricht einer Einsatzzahl von drei Einsätzen pro Minute. Dabei wurden über 45 Millionen Kilometer zurückgelegt.
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Abb. 6: Rettungsdiensteinsätze des BRK im Jahr 2012 (Graphik: eigene).
3.5 Notarztsystem
Für die Notarztversorgung haben sich bundesweit zwei Organisations- formen entwickelt. Beim Stationssytem rückt der NAW (Notarztwa- gen), der in der Regel an einem Krankenhaus stationiert ist, mit dem Notarzt zum Notfallort auf. Im Rendezvous-System fährt der Notarzt von seinem Tätigkeitsort - Krankenhaus, Praxis - mit dem Notarztein- satzfahrzeug (einem PKW mit Zusatzausstattung zum Einsatzort. Gleichzeitig startet der RTW (Rettungswagen) von der nächsten Ret- tungswache mit dem Rettungsteam zum Einsatzort. (Joó, 2000, S. A3061).
„Das Rendezvous-System hat sich mit einem Anteil von 99,1% gegenüber dem Stationssystem bundesweit durchgesetzt.“ (Bundesanstalt für Straßenwesen, 2011, S. 3).
Hierdurch konnten auch die entsprechenden Eintreffzeiten und Hilfsfristen verkürzt werden. „Die Eintreffzeit wird definiert als die Zeitspanne, die zwi- schen Eingang der Notfallmeldung in der Rettungsleitstelle bis zum Eintreffen des Rettungsmittels am Notfallort an der Straße vergeht. Hilfsfrist bedeutet das Eintreffen des ersten geeigneten Hilfsmittels am Einsatzort.“ (Joó, 2000, S. A3061).
In § 2 der Verordnung zur Ausführung des Bayerischen Rettungsdienstgesetzes vom 30.11.2010 ist festgelegt, „Standort, Anzahl und Ausstattung der Ret- tungswachen […] sind so zu bemessen, dass Notfälle im Versorgungsbereich einer Rettungswache in der Regel spätestens 12 Minuten nach Ausrücken […] erreicht werden können.“
Die Bundesanstalt für Straßenwesen ermittelte eine mittlere Hilfsfrist von 8,7 Minuten im Berichtszeitraum 2008/2009. Hierbei handelte es sich um Fahrten mit Sonderrechten, d.h. mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn. Für Joó ist die Hilfsfrist ein wichtiges Kriterium für die Qualität eines Rettungsdienstes (2000, S. A3061).
Diese Hilfsfrist kann man in drei wesentliche Zeitblöcke zerlegen: die Gesprächs- und Dispositionszeit in der Rettungsleitstelle, die Ausrückzeit der Einsatzkräfte und die Anfahrtszeit bis Einsatzort.
3.6 Berufe im Rettungsdienst
Im Rettungsdienst finden sich drei Tätigkeitsfelder:
3.6.1 Rettungsassistent
Diese Berufssparte verfügt über die höchste, nichtärztliche Qualifikation im Rettungswesen. Nach dem Rettungsassistentengesetz darf diese Berufsbezeichnung nur von Personen geführt werden, die eine entsprechende Ausbildung absolviert haben. Diese Ausbildung ist bundeseinheitlich geregelt und die einzig anerkannte im Rettungsdienst.
Die Ausbildung wird von staatlich anerkannten Schulen für Rettungsas- sistenten angeboten, erstreckt sich über zwei Jahre und besteht aus ei- nem theoretischen und einem praktischen Teil. Während der prakti- schen Tätigkeit kann der Azubi unter Umständen Geld verdienen, die theoretische Ausbildung muss er aus eigener Tasche bezahlen. Die nö- tigen Lehrgänge kosten zwischen 630 und 5500 Euro. (Süddeutsche Zeitung vom 17.05.2010).
3.6.2 Rettungssanitäter
Die Ausbildung zum Rettungssanitäter ist kein anerkannter Ausbildungsberuf und umfasst eine Ausbildungszeit von 520 Stunden. Im Notfalleinsatz fungiert er als Fahrer und Teampartner des Rettungsassistenten. Kosten hierfür sind vom angehenden Rettungsassistenten selbst zu tragen und belaufen sich auf ca.
1.200 Euro.
3.6.3 Rettungshelfer
Diese Personengruppe wird fast ausschließlich als Fahrer im Bereich des qualifizierten Krankentransportes eingesetzt. Die Ausbildung hierfür umfasst 160 Stunden und ist, wie auch die des Rettungssanitäters nicht einheitlich geregelt, und somit Sache der einzelnen Bundesländer.
4. Belastende Ereignisse im Rettungsdienst
„Mitarbeiter von Rettungsdiensten […] werden bei Großschadensereignissen und Naturkatastrophen innerhalb kürzester Zeiträume hochgradigen Belastungen ausgesetzt.“ (Appel-Schumacher, 1997, S. 256).
Lange Zeit wurde es als selbstverständlich betrachtet, dass Einsatzkräfte die grausamen Erfahrungen, welche sie im Umgang mit ihrer helfenden Tätigkeit erleben, ohne seelische Beeinträchtigungen verarbeiten würden. (Teegen, 2003, S. 9).
Bereits 1994 haben Hermanutz & Buchmann festgestellt: „Diejenigen Perso- nen, die bei solchen Einsätzen mit den schlimmsten Situationen als Rettungs- personal konfrontiert werden, wurden bisher kaum untersucht.“ (S. 295).
Daher haben z.B. die Flugzeugkatastrophe in Ramstein oder das ICE-Unglück in Eschede die Arbeit des Rettungsdienstes in den Fokus der Betrachtungen von Wissenschaft und Forschung gerückt.
Hierbei lag das Interesse vor allem auf Ereignissen, die bei dem Rettungsfachpersonal eine längerfristige Wirkung, insbesondere eine Posttraumatische Belastungsstörung nach sich zogen.
„Zur Bedeutung alltäglicher ‚Banalbelastungen‘ und ungünstigen Arbeitsbedingungen liegen kaum Daten vor.“ (Hering & Beerlage, 2004, S. 415).
Hinzu kommt, dass Rettungskräfte einen zweigeteilten Beruf nachkommen: einerseits steht die interne Beschäftigung (Erfassung und Abrechnung des letzten Einsatzes, Überprüfung der Notfallausrüstung, Wartezeit) - andererseits die externe Arbeitszeit, also die Einsatzfahrten.
Christmann (2012, S. 64) hat ermittelt, dass bei der Dienstzeit eines Rettungs- dienstmitarbeiters 57,5% auf den Einsatz und 42,5% auf die Zeit auf der Ret- tungswache entfallen. „Aus der zeitlichen Verteilung kann man schließen, dass der ‚durchschnittliche‘ Rettungsdienstmitarbeiter also nicht nur unter den ex- ternen Stressoren […] leidet, sondern auch die internen Faktoren keineswegs zu vernachlässigen sind.“
In der nachfolgenden Betrachtung sollen daher auch beide Ereignisquellen einbezogen werden.
4.1 Definition
Mitchell & Everly (1998, S. 97) definieren ein belastendes Ereignis wie folgt: „Jedes Ereignis, das gewaltig genug ist, um - unmittelbar oder zeitlich verzö- gert - deutliche emotionale Reaktionen bei Menschen hervorzurufen. Es han- delt sich dabei um ein Ereignis, das außerhalb der üblichen menschlichen Er- fahrung liegt.“
4.2 Arten von belastenden Ereignissen
In der Literatur findet sich eine Reihe von belastenden Ereignissen, die in wissenschaftlichen Studien und Befragungen ermittelt wurden.
Dabei ist nach Bengel (1997, S. 61) die individuelle Bewertung (Wahrnehmung und Verarbeitung) der Traumata von entscheidender Bedeutung. Hierbei spielen aber auch die Veranlagung, die „Tagesform“ und die Art der Beteiligung eine nicht unerhebliche Rolle.
Aufgrund dieser individuellen Unterschiede lässt sich auch keine sog. „Hitliste“ der belastenden Ereignisse erstellen. Fasst man jedoch die Ergebnisse der wissenschaftlichen Forschungs- und Befragungsergebnisse [z.B. Hermanutz & Fiedler (1997), Mitchell & Everly (1998), Lenzenhuber (2000), Teegen und Yasui (2000), Gebhardt et al. (2006)] zusammen, lassen sich die folgenden (am häufigsten genannten) einsatzbedingte Ereignisse herausarbeiten. Dabei ist die Reihenfolge willkürlich gewählt und stellt keine Wertung dar:
Tod oder schwere Verletzung von Kollegen, Gewalt gegen die Einsatzkräfte
Suizid eines Kollegen
langandauernde, schwierige und unübersichtliche Einsätze persönliche Bekanntschaft zu dem/den Geschädigten
massive Bedrängung von Medienvertretern pädiatrische Notfälle
fehlgeschlagene Versuche der Lebensrettung Infektionsgefahr
eigene Verletzungs- oder Todesgefahr
Großeinsätze mit vielen Toten und Verletzten (insbesondere Amputationsverletzungen)
psychiatrische Patienten und Suizidenten
Green (1990, S. 1636 - 1638) hat diese Situationen nach acht verschiedenen Gesichtspunkten unterteilt:
(1) Bedrohung von Leib und Leben,
(2) schwere körperliche Verletzung
(3) vorsätzliche Schädigung oder Verletzung
(4) gewaltsamer, plötzlicher Verlust nahestehender Menschen,
(5) Zeuge von Gewalt gegenüber nahestehenden Menschen,
(6) Konfrontation mit dramatischen Situationen,
(7) Konfrontation mit giftigen und/oder ansteckenden Stoffen,
(8) Verursachung von Tod oder schwerer Verletzung anderer.
Ungünstige Arbeits- und Umgebungsbedingungen können die durch die Ereignisse entstandenen Belastungen verstärken, wie z.B. Lärm, Schlafmangel, private Probleme, Führungsstil des Vorgesetzten, fehlende Anerkennung durch die Gesellschaft (Krankenträger-Image), Schichtdienst, Zeitdruck.
„Erschwerend für Rettungskräfte ist, dass im Einsatz ein kontinuierlicher Entscheidungsdruck existiert. In solchen Fällen potenzieren sich die Beanspruchungen und Belastungen.“ (Reinhard & Maercker, 2004, S 30).
4.3 Einsatznachsorge
Nach der Flugzeugkatastrophe in Ramstein im Jahr 1988 wurde die Notwen- digkeit der Einsatznachsorge nach Großschadensereignissen erkannt. Aus die- ser Erkenntnis heraus wurden entsprechende Ausbildungs- und Trainingsprogramme entwickelt.
Beispielhaft seien hier das Stressimpfungstraining nach D. Meichenbaum (1991) und das Critical Incident Stress Management (CISM) nach J. Mitchell (1980) genannt.
Das CISM wurde an deutsche Verhältnisse angepasst und unter Einbeziehung europäischer Modifikationen im deutschsprachigen Raum als SbE (Stressbear- beitung nach belastenden Ereignissen) zum Standard entwickelt. 1996 schlos- sen sich Einsatzorganisationen zur SbE-Bundesvereinigung zusammen. Kris- tallisationspunkt war der Flughafenbrand in Düsseldorf im Jahr 1996. Erstmals kam das SbE-Programm nach dem ICE-Unglück von Eschede in großem Um- fang zum Einsatz.
Es wendet sich vor allem an Einsatzkräfte exponierter Berufsgruppen, um belastungsbedingtem Stress vorzubeugen bzw. erlebte Extrembelastungen zu verarbeiten. Es soll dadurch verhindert werden, dass dieses Personal zu sog. Sekundäropfern wird und langfristige psychische Störungen entwickeln. Unter Sekundäropfern verstehen Mitchell & Everly (1998, S. 16) „Menschen, die unmittelbar mit den psychischen Traumatisierungen der Primäropfer [= direkte Opfer eines Traumas, Anm. des Verf.] konfrontiert sind.“
Das SbE arbeite in Teams mit psychologischen Fachkräften und Peers. Peers sind geschulte Einsatzkräfte die als kollegiale Ansprechpartner gelten und die entsprechenden Interventionen tragen, da sie über genaue Kenntnisse der Ar- beit des Rettungsdienstes verfügen und darüber hinaus auch den gleichen „Sprachcode“ wie die Betroffenen verwenden. Somit wird eine adäquate Ver- trauensbasis geschaffen.
Die psychologischen Fachkräfte sind für die Qualität der Arbeit verantwortlich, leiten Gesprächsgruppen und sind zuständig für die Vernetzung der SbE- Teams.
Die Methode zielt zum einen auf präventive Maßnahmen, zum anderen auf die ereignisbezogene Nachsorge sowie Nachfolgemaßnahmen.
Die SbE hat damit für die Einsatzkräfte dieselbe Bedeutung, wie die Krisenintervention für die Angehörigen von Notfallopfern. Es muss aber betont werden, dass es sich hierbei nicht um Therapiemaßnahmen handelt.
III. Empirischer Teil
5 Ziel der Arbeit
Hauptziel dieser Untersuchung ist es, die belastenden Ereignisse Im Rettungsdienst herauszuarbeiten. Im Weiteren sollen die Zusammenhänge zu psychischer Beanspruchung hergestellt und die Bewältigungsstrategien berücksichtigt werden. Hieraus ergeben sich folgende Fragen:
(a) Welche Ereignisse werden von Mitarbeitern des Rettungsdienstes als be- sonders belastend bzw. als am wenigsten belastend eingestuft?
(b) Mit welcher Häufigkeit und Stärke treten diese Ereignisse auf?
(c) Welche Strategien der Stressbewältigung (Coping) wendet das Rettungs- fachpersonal an?
(d) Besteht ein Zusammenhang zwischen der Belastungsstärke und der ange- wandten Coping-Strategie?
(e) Welche Auswirkungen haben die Belastungen auf die emotionale sowie kognitive Beanspruchung?
6 Hypothesen
Aus der Fragestellung werden die entsprechenden Hypothesen formuliert:
H-1: Die Stärke der Belastung ist unabhängig von der Häufigkeit des Erle- bens belastender Ereignisse.
H-2: Soziale Unterstützung moderiert den Zusammenhang zwischen Belas- tung und Beanspruchung.
H-3: Die Coping-Strategie ist abhängig von der wahrgenommenen Belas- tungsstärke.
[...]
1 Es wird im Folgenden auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachform verzichtet. Die männliche bezieht die weibliche Form mit ein, dient der besseren Lesbarkeit und stellt keinen Akt der Diskriminierung dar.
2 Cannon, Walter (*19.10.1871 + 01.10.1945), amerikanischer Physiologe
3 Selye, Hans (*26.01.1907 + 16.10.1982), österreichisch-kanadischer Mediziner
4 Lazarus, Richard (*03.03.1922 +24.11.2002), amerikanischer Psychologe
5 Larrey, Dominique Jean (* 08.07.1766 + 25.07.1842) französischer Militärarzt und Chirurg
6 SAR = Search and Rescue
7 Art. 30 GG lautet: Die Ausübung der staatlichen Befugnisse und die Erfüllung der staatlichen Aufgaben ist die Sache der Länder, soweit dieses Grundgesetz keine anderen Regelungen trifft oder zuläßt.
8 Diese Definition aus WIKIPEDIA ist wissenschaftlich zwar nicht fundiert, wurde aber in einer anderen wissenschaftliche Arbeit akzeptiert (vgl. Ruppert, 2010, S. 12)
- Arbeit zitieren
- M.A. Helmut Dudla (Autor:in), 2014, Belastende Ereignisse im Rettungsdienst, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/280416
Kostenlos Autor werden





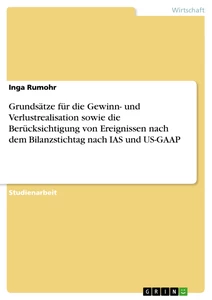
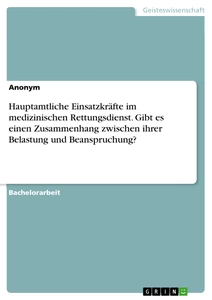









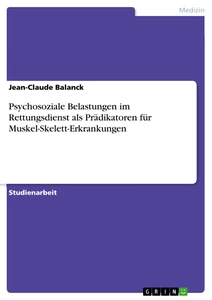


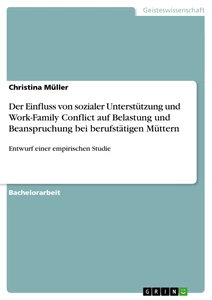


Kommentare