Leseprobe
Inhalt
1. Vorwort: Kants Grundlegung der Moralität
2. Einleitung: Autonomie des Willens und freie Willkür
2.1. Der Begriff der Person: das moralische Subjekt
2.2. Die freie Willkür
2.3. Warum soll ich sollen?
3. Das einzelne Subjekt und der objektive Geist
3.1. Die Menschheit als Gattung
3.2. Die Menschheit als moralisch-sittliche Gemeinschaft
3.3. Die ontologische Einsamkeit des Einzelnen
4. Das Sollen und das Böse
4.1. Das Böse als Kritik der Moralität
4.2. Phänomenologie des Bösen
4.3. Das Böse als Spitze der Moralität
5. Objektiver Idealismus und subjektiver Realismus
5.1. Weltimmanente Moralität
5.2. Eudämonismus und Sterblichkeit
5.3. Kritik der Unsterblichkeit
6. Was darf ich hoffen?
6.1. Die Hoffnung und das Sollen
6.2. Der Sinn des Lebens
6.3. Transzendentale Weltimmanenz
7. Schlusswort: Was soll ich tun?
1. Vorwort: Kants Grundlegung der Moralität
Wozu brauchen wir einen moralischen Imperativ? Was erhoffen wir uns davon? Kant sagt, alles Hoffen gehe auf Glückseligkeit1. Warum aber dürfen wir überhaupt etwas hoffen, und wie hängt Hoffnung mit der Moral zusammen? "Die Philosophie aber muß sich hüten, erbaulich sein zu wollen"2, weiß Hegel. In diesem Spannungsverhältnis steht die praktische Vernunft: einerseits muss sie den Menschen einen Hoffnungshorizont bieten, der das Leben sinnvoll, oder zumindest lebenswert macht, andererseits darf sie, der Wahrheit verpflichtet, keine Luftschlösser bauen. Ist ein moralischer Imperativ durch die Beschaffenheit der Vernunft selbst notwendig, und drängt er sich uns als Vernunftwesen unleugbar auf, so müssen wir, ohne Rücksicht darauf, ob wir uns von der Moral Glückseligkeit erhoffen können, um unserer Würde willen in einem heroischen Nihilismus moralische Wesen sein. Das Ziel dieser Arbeit ist, den Sinn der Frage "Was soll ich tun?" in ihrem notwendigen Hoffnungszusammenhang begreiflich zu machen. Ist diese Frage überhaupt sinnvoll, und welche Bedingungen müssen in theoretischer und praktischer Hinsicht erfüllt werden, damit diese Frage sinnvoll ist? Die Fragestellung "Was soll ich tun?" impliziert, dass ich erstens meine Handlungen an einem moralischen Imperativ ausrichten muss, und zweitens, dass ich mit der Möglichkeit, das Gesollte wie nicht das Gesollte tun zu können, auch die Willensfreiheit dazu habe. Impliziert diese Frage aber noch mehr - dass es in der Welt als Ganzes vernünftig zugehen muss? "Moral also führt unumgänglich zur Religion, wodurch sie sich zur Idee eines machthabenden moralischen Gesetzgebers außer dem Menschen erweitert, in dessen Willen dasjenige Endzweck (der Weltschöpfung) ist, was zugleich der Endzweck des Menschen sein kann und soll"3, schließt Kant aus der auch in moralischen Fragen notwendigen Zweckgebundenheit des menschlichen Willens. Nach Kant kann es keinen theoretischen Beweis geben, dass die Welt als Ganzes vernünftig ist, doch die praktische Vernunft liefert durch die Evidenz ihrer moralischen Schlüsse einen indirekten Beweis der höchsten Vernunft. Jedoch darf die Frage, was ich tun soll, für Kant nicht vom Glauben an die Glückseligkeit als eine notwendige Folge des moralisch guten Handelns abhängen, denn damit wäre die Willensfreiheit aufgegeben, die - wie in der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten ausgeführt - sich in der Autonomie des Willens, der Möglichkeit, ohne Rücksicht auf innere Neigungen und äußeren Zwang, aus reiner Pflicht zu handeln, äußert. Ich muss also standhaft aus reiner Pflicht handeln, darf aber mir, wenn ich so handle, Glückseligkeit erhoffen. Wird hierdurch der von Kant verworfene Eudämonismus nicht bloß auf höherer - der höchstmöglichen - Stufe wiederhergestellt? Der Alltagsverstand kennt keine Trennung zwischen den Fragen "Was soll ich tun?" und "Was darf ich hoffen?" - er tut etwas, weil er sich davon etwas erhofft. Kant trennt diese Fragen in der menschlichen Vernunft, um sie in der höchsten Vernunft, in Gott, wieder zu vereinen. Somit macht Kant, der den vernunftlosen religiösen Glauben für einen Afterdienst Gottes hält, den Vernunftglauben an Gott zu einer moralischen Notwendigkeit. Ohne diesen Vernunftglauben bleibt dem Menschen nur die unzumutbare Alternative des heroischen Nihilismus - unzumutbar, weil sein Vollzug von der bloßen Willkür abhängt.
Indem Kant im kategorischen Imperativ das moralisch gute Handeln als einen Selbstzweck etabliert4, begründet er die erste philosophisch qualifizierte Ethik als eine Lehre, die, vom freien Willen ausgehend, das Gebotene zu ihrem Gegenstand hat. Was vor Kant Ethik genannt wurde, fällt nach Kant in die Sphäre der bloßen Legalität, die das durchaus Erlaubte, aber nicht das unbedingt Gebotene umfasst. In die Sphäre der Legalität (das Recht) fallen alle der Ethik nicht widerstrebenden hypothetischen Imperative, die heteronomen, auf einen äußeren Zweck gerichteten Handlungsanweisungen. In die Sphäre der Moralität (die Ethik) fällt nun das vom moralischen Gesetz, d. i. vom kategorischen Imperativ, unbedingt Gebotene: "Also wird in der Ethik der Pflichtbegriff auf Zwecke leiten und die Maximen in Ansehung der Zwecke, die wir uns setzen sollen, nach moralischen Grundsätzen begründen müssen"5. Nur ein Zweck, der zugleich Pflicht sei, könne eine Tugendpflicht genannt werden6. Der gute Wille ist ein praktischer Entschluss (kein bloßer Wunsch, d. h. ihm müssen nach Kräften Taten folgen), der Tugendpflicht gemäß zu handeln. Er fällt in den geistigen Innenraum einer Person, und ist von Außen nicht zu sehen. Die Einsamkeit des Tugendhaften in einer schlechten Gesellschaft kann durch keine weltimanntenten Folgen, die sein guter Wille mit Notwendigkeit herbeiführte, aufgelöst werden, denn sobald der Wille den Innenraum der Person verlässt, begibt er sich in das Reich der Naturkausalität. Wieder einmal - um den heroischen Nihilismus zu vermeiden - muss von einer höchsten Vernunft ausgegangen werden, die den wahren Willen einer Person sehen kann. Kants Ethik setzt Transzendenz voraus, ohne dass seine Erkenntnistheorie einen Weg bereitete, die höchste Vernunft auf theoretischem Wege erkennen zu können. Da das Verhältnis von Moralität und Glückseligkeit weltimmanent nicht zufriedenstellend ist, postuliert Kant eine überweltliche Instanz, in welcher Moralität und Glückseligkeit als Grund und Folge zusammenfallen. Dass Kant nicht gänzlich davon absieht, auf die Pflichterfüllung Glückseligkeit folgen zu lassen (wenn nicht in dieser, dann in einer anderen Welt), könnte ihm als Eudämonismus ausgelegt werden, oder aber als ehrliche Einsicht, dass der Mensch als Sinnenwesen immer auf Glückseligkeit7 aus ist, und der Eudämonismus nur in bestimmte Schranken gesetzt, aber nicht gänzlich eliminiert werden darf, weil dies den Menschen in seiner Natur negieren würde. Der Mensch will als Sinnenwesen glücklich werden, und als Vernunftwesen das moralisch Gebotene tun; während das erste unbedingt einleuchtet, bedarf das zweite einer längeren Ausführung, die einleitend in die Problematik dieser Arbeit folgen wird.
7 Zum Begriff der Glückseligkeit Kant, Immanuel: Kritik der reinen Vernunft. B 834: "Glückseligkeit ist die Befriedigung aller unserer Neigungen, (so wohl extensive, der Mannigfaltigkeit derselben, als intensive, dem Grade, und auch protensive, der Dauer nach). Das praktische Gesetz aus dem Bewegungsgrunde der Glückseligkeit nenne ich pragmatisch (Klugheitsregel); dasjenige aber, wofern ein solches ist, das zum Bewegungsgrunde nichts anderes hat, als die Würdigkeit, glücklich zu sein, moralisch (Sittengesetz). Das erstere rät, was zu tun sei, wenn wir der Glückseligkeit wollen teilhaftig, das zweite gebietet, wie wir uns verhalten sollen, um nur der Glückseligkeit würdig zu werden. Das erstere gründet sich auf empirische Prinzipien; denn anders, als vermittelst der Erfahrung, kann ich weder wissen, welche Neigungen dasind, die befriedigt werden wollen, noch welches die Naturursachen sind, die ihre Befriedigung bewirken können. Das zweite abstrahiert von Neigungen, und Naturmitteln sie zu befriedigen, und betrachtet nur die Freiheit eines vernünftigen Wesens überhaupt, und die notwendigen Bedingungen, unter denen sie allein mit der Austeilung der Glückseligkeit nach Prinzipien zusammenstimmt, und kann also wenigstens auf bloßen Ideen der reinen Vernunft beruhen und a priori erkannt werden".
2. Einleitung: Autonomie des Willens und freie Willkür
"Die Moral, sofern sie auf dem Begriffe des Menschen, als eines freien, eben darum aber auch sich selbst durch seine Vernunft an unbedingte Gesetze bindenden Wesens, gegründet ist, bedarf weder der Idee eines andern Wesensüber ihm, um seine Pflicht zu erkennen, noch einer andern Triebfeder als des Gesetzes selbst, um sie zu beobachten. Wenigstens ist es seine eigene Schuld, wenn sich ein solches Bedürfnis an ihm vorfindet, dem aber alsdann auch durch nichts anderes abgeholfen werden kann; weil, was nicht aus ihm selbst und seiner Freiheit entspringt, keinen Ersatz für den Mangel seiner Moralität abgibt" 8, fasst Kant die Ergebnisse seiner Moralphilosophie am Anfang seiner Religionsschrift zusammen. Das Bedürfnis nach einem materiellen Bestimmungsgrund des Willens ist nach Kant keine anthropologische Notwendigkeit, sondern ein schuldhaftes Versagen. Wenn die Freiheit des Menschen, wie aus der Grundlegung der Metaphysik der Sitten folgt, in der Autonomie seines Willens besteht, sind nur Bestimmungsgründe für den Willen zulässig, die aus der reinen Vernunft selbst herrühren, denn jeder dem Willen äußerliche Grund würde diesem seine Freiheit nehmen. Es kann also nur einen formalen Bestimmungsgrund des Willens geben. Dieser erfordert ein Subjekt, das sich nicht nur auf äußere Objekte (oder auf sich selbst als ein Äußeres) bezieht, sondern von allem, was ihm äußerlich ist, abstrahieren kann, und sich somit vom bloßen Naturwesen transzendiert. Ein solches, ein menschliches Subjekt, kann nicht mehr nur Gegenstand der rein theoretischen Betrachtung sein, denn der Mensch ist nicht bloß auf eine bestimmte Art beschaffen, sondern macht sich selbst willentlich zu dem, was er ist. Als bloßes Naturwesen strebt der Mensch nach Glück, das zunächst darin besteht, Lust zu gewinnen, und Schmerz zu vermeiden9, - als Vernunftwesen strebt der Mensch danach, das Richtige, das Sinnvolle zu tun, denn die durch ihre Zufälligkeit der Vernunft unangemessenen materiellen Bestimmungsgründe des Willens beleidigen seine Intelligenz wie den Stolz seiner Autonomie. Deshalb ist Kant nicht faul, jemanden, der für die Erfüllung seiner moralischen Pflicht eine äußere Belohnung braucht, einen "Nichtswürdigen" zu nennen10.
2.1. Der Begriff der Person: das moralische Subjekt
Kants kategorischer Imperativ: "Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, daß sie ein allgemeines Gesetz werde"11 ist ein moralischer Satz mit unbedingtem Anspruch auf Allgemeinheit: um hierin zuzustimmen, braucht man nur eine Person zu sein, und nicht einer bestimmten Glaubensgemeinschaft angezuhören oder der Meinung zu sein, der kategorische Imperativ sei das optimale moralische Prinzip. Mit dem kategorischen Imperativ zeigt Kant, dass ein moralischer Imperativ zwingend gelten muss, also ein kategorischer sein muss, und kein bloß hypothetischer. Ein hypothetischer Imperativ kennt keine Pflicht, sondern nur konkrete äußere Zwecke; wer keine anderen Imperative kennt, als die hypothetischen, ist ein Opportunist12. Ein hypothetischer Imperativ ist situationsabhängig, und wird jedesmal widerlegt, wenn sich die Spielregeln im laufenden Spiel ändern. Ein kategorischer Imperativ ist rein formal, und kann nur widerlegt werden, wenn er nicht verallgemeinerungsfähig formuliert wird. Dadurch aber kommt es darauf hinaus, dass es nur einen einzigen kategorischen Imperativ geben kann, welcher jedoch unterschiedliche Formulierungen erfahren kann, so auch diese: "Handle so, daß du die Menschheit sowohl in deiner Person, als in der Person eines jeden andern jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchest"13. Moralität gehört zwar der inneren Dimension der Person an, doch sie erschöpft sich nicht in der Innerlichkeit, sondern stellt den Ausgangspunkt für das praktische intersubjektive Verhältnis von Personen untereinander dar. Darum formuliert Kant den kategorischen Imperativ in Hinsicht auf Intersubjektivität als Selbszweckformel, die jedes vernünftige Wesen als einen Zweck an sich zu behandeln fordert. Eine Person, die eine Person als bloßes Mittel behandelt, behandelt sie wie eine Sache, und verletzt damit ihre Würde. Eine Person als Person anzuerkennen bedeutet, sie fortwährend als einen Selbstzweck zu denken.
Der kategorische Imperativ fordert, dass Menschen einander als Personen anerkennen. Er setzt aber bereits voraus, dass Menschen Personen sind, sprich die Fähigkeit haben, den kategorischen Imperativ intellektuell einzusehen, und die Willensfreiheit, ihre hieraus erfolgende Pflicht tun zu können. Der kategorische Imperativ ist historisch und politisch indifferent, mit dem Primat des guten Willens ist Kants Moralität rigoros subjektiv. Die rechtliche Anerkennung eines jeden Menschen als Person ist jedoch historisch vor der bürgerlichen Gesellschaft der Neuzeit nicht anzutreffen. Da Kant nun zu einer Zeit lebt, in der eine bürgerliche Gesellschaft bereits existiert, hat die rechtliche Maxime, dass die Freiheit eines jeden zugleich mit der Freiheit aller anderen bestehen können muss, die in der Rechtslehre der Metaphysik der Sitten auftaucht, einen konkreten historischen Bezug. Ließe sich eine rechtliche Maxime, die dem kategorischen Imperativ nicht widerspräche, und in eine andere Gesellschaftsform passte, auch denken, indem man die persönlichen Freiheiten der Menschen hierarchischen Abstufungen unterstellen würde? Diese Maxime würde zum Beispiel besagen: der König darf alles, der Adel darf alles, was der König erlaubt, und was andere Adlige in ihrer Freiheit nicht beeinträchtigt, und das Volk darf schließlich alles, was der König und der Adel erlauben, und was mit der restlichen Freiheit der anderen nicht kollidiert, - dies wäre eine denkbare rechtliche Maxime der Standesgesellschaft. Eine solche Maxime widerspräche dem kategorischen Imperativ, sobald Ranghöhere die Rangniederen nicht als Personen, sondern als Sachen behandelten. Ein König aber, der darauf achten muss, dass er seine Untertanen niemals bloß als Mittel, sondern immer zugleich als Selbstzwecke behandelt, ist ein konstitutioneller Monarch, und gehört somit der bürgerlichen Gesellschaft an. Es ist also denkbar, dass der Begriff des moralischen Subjekts, der Person, ein historisch neuzeitlicher Begriff ist, und der kategorische Imperativ ohne die vorausgesetzte gegenseitige Anerkennung der Menschen als Personen gegenstandslos. Eine logisch-historische Entwicklung des Begriffs der Person leistet Hegel im Selbstbewusstseinskapitel seiner Phänomenologie des Geistes14. Der Barbarei (Kampf auf Leben und Tod) folgt die unfreie Gesellschaft (der Mensch ist entweder Herr oder Knecht), und aus deren Widersprüchen erwächst die gegenseitige rechtliche Anerkennung der Menschen als Personen. Kants Geschichtsphilosophie kann, selbst wo sie Aussagen über die historische Entwicklung der (besser: zur) bürgerlichen Gesellschaft trifft, hier nicht zum Vergleich herangezogen werden, weil die Geschichtlichkeit für Kants Moralität irrelevant ist. Die Tatsache des freien Willens, die Kant in praktischer Hinsicht damit beweist, dass der Mensch "nicht anders als unter der Idee der Freiheit handeln kann"15, kann jedoch auch in einer historischen Betrachtung nicht unberücksichtigt bleiben. Den freien Willen gibt es, seit es das menschliche Subjekt gibt, das Wesen, welches den Begriff des Menschen erfüllt. Dass in der antiken Welt, in der der kategorische Imperativ, der die moralische Gleichheit aller Menschen impliziert, und die rechtliche Gleichheit fordert, nicht möglich war, kann nicht bedeuten, dass es damals noch keine Menschen gab. Wenn es aber Menschen historisch vor der bürgerlichen Gesellschaft gab, kann sich die Willensfreiheit nicht in der moralisch tätigen Vernunft erschöpfen, sondern muss als freie Willkür auch unvernünftig bestehen können.
2.2. Die freie Willkür
Die Freiheit des Willens ist die Voraussetzung für die Autonomie des Willens, die sich in der Möglichkeit moralischer Maximen aus reiner Vernunft äußert. Die Willensfreiheit selbst setzt aber die innere Selbstbestimmung nicht voraus. Es reicht zum praktischen Erkennen des Faktums der Willensfreiheit bereits aus, dass der Mensch, sobald er einen Willen hat, nicht anders handeln kann, als unter der Vorstellung, sein Wille sei frei: "Ein jedes Wesen, das nicht anders als unter der Idee der Freiheit handeln kann, ist eben darum in praktischer Rücksicht wirklich frei, d.i. es gelten für dasselbe alle Gesetze, die mit der Freiheit unzertrennlich verbunden sind, ebenso als ob sein Wille auch an sich selbst und in der theoretischen Philosophie gültig für frei erklärt wurde" 16. Kant macht sich nicht einmal die Mühe, einen theoretischen Beweis für die Willensfreiheit zu suchen, weil diese praktisch unwiderlegbar ist; selbst wenn der freie Wille nicht theoretisch bewiesen werden kann, ist er eine praktische Tatsache. Noch eleganter sieht aber die Erklärung Hegels aus, weshalb der Wille frei ist: "Wille ohne Freiheit ist ein leeres Wort, so wie die Freiheit nur als Wille, als Subjekt wirklich ist"17. Dass der Wille frei sei, ist für Hegel ein analytischer Satz, und wird nicht erst dadurch einsichtig, dass der Mensch nicht anders handeln kann, als unter der Idee der Freiheit. In der Konsequenz ist der Wille auch dort frei, wo der Mensch nicht unter der Idee der Freiheit handelt: "Der nur an sich freie Wille ist der unmittelbare oder natürliche Wille"18. Der nur an sich - noch nicht für sich - freie Wille findet seinen Inhalt unmittelbar vor: "Triebe, Begierden, Neigungen"19. Doch keineswegs ist der an sich freie Wille mit dem Trieb identisch: er kann sie nämlich willkürlich verwerfen, und muss ihnen nicht, wie das Tier, blind gehorchen20. Ein entscheidender Moment des Willens ist es, Willkür zu sein. Die Willkür ist im Unterschied zur konkreten Selbstbestimmung, die die Form des Vernunftgesetzes notwendig annehmen muss, eine bloß abstrakte Wahlfreiheit zwischen Gegebenem, jedoch keine Unfreiheit, wie der tierische Trieb. Ein aus bloßer Willkür bestehender freier Wille ist stets heteronom, da er seinen konkreten Inhalt immer nur von Außen nehmen kann. Da ihm sein Inhalt äußerlich ist, ist er noch nicht für sich, und widerspricht seinem eigenen Begriff, der Freiheit, weil er keine höhere vernünftige Wirklichkeit hat, als ein empirischer Entschluss zu sein21.
2.3. Warum soll ich sollen?
Der freien Willkür stellt sich, sobald sie sich mit Sollensforderungen konfrontiert sieht, die Frage, warum man überhaupt etwas soll. Dass man etwas soll, scheint quer durch die Jahrtausende ein moralphilosophischer Konsens zu sein, denn keine Ethik begnügt sich damit, bloß theoretisch auszumachen, was für ein besseres, sinnvolleres oder glücklicheres Leben zu tun erforderlich wäre, um die Entscheidung dann dem Einzelnen selbst zu überlassen, ob er das als gut und richtig Erkannte befolgt. Dass die Einsicht automatisch zum richtigen Handeln führt, ist ein Fehlschluss aus der Antike, die den Begriff des Subjekts noch nicht hatte. Zwischen dem richtigen oder vermeintlichen Wissen, was man tun sollte, um z. B. glücklich zu werden, und dem tätigen Befolgen der entsprechenden Gebote liegt stets eine willentliche Entschlusshandlung. Auf diese Handlung des freien Willens beziehen sich alle Sollensforderungen, denn es soll nicht bloß der Forderung zugestimmt werden, sondern das Geforderte soll getan werden. Hypothetische Imperative können jedoch niemals über den Status unverbindlicher Empfehlungen hinausgehen, und fremdbestimmte Sollensforderungen funktionieren nur unter äußerem Zwang. Nur durch einen kategorischen Imperativ 21 Eine Theorie der Willensfreiheit, die den freien Willen nichts weiter als die bloße Willkür sein lässt, ist genötigt, sich mit empirischen Widerlegungen der Willensfreiheit, wie etwa dem Libet-Experiment, auseinanderzusetzen. Dieses Experiment zeigt, dass die Materie, repräsentiert durch ein elektrisch messbares Bereitschaftspotential im Nervensystem, schneller bei einem konkreten Entschluss ist, als der Geist, der in Person eines menschlichen Probanden diesen Entschluss fasst. Wenn nicht das physiologisch bedingte Bereitschaftspotential die Ursache des Entschlusses sein soll, muss die Willensfreiheit so abstrakt gefasst werden, dass sie nichts weiter besagt, als dass der Mensch letztlich eine Wahlfreiheit hat, da ein bestimmter Entschluss, selbst wenn es das Drücken eines Knopfes ist, zustande kommt. Damit ist die Freiheit aber immer noch nicht bewiesen, denn auch ein Würfel fällt auf eine bestimmte Seite, und hat dennoch keine Entscheidungsfreiheit. Für den äußeren Schein kann also die bloße Willkür nicht vom Zufall unterschieden werden, und eine auf der bloßen Willkür basierende Theorie der Willensfreiheit, die das Fürsichsein des Willens nicht aufzeigt, und somit auf das Empirische beschränkt ist, ist nicht haltbar.
verinnerlicht der Mensch das Sollen, und wird zu einem autonomen moralischen Subjekt. Das Erkennen eines kategorischen Imperativs ist keine Erkenntnis eines dem Subjekt Äußerlichen, sondern eine Selbsterkenntnis des Subjekts. Ein Subjekt, das sich selbst als frei erkennt, will seine Freiheit, und sein Wille ist, in Hegels Worten, nicht bloß an sich, sondern für sich frei. Der freie Wille, der den freien Willen will, ist der abstrakte Begriff des fürsichseienden Willens, oder, näher an Kant formuliert, der Autonomie des Willens22. Das verwirklichte Dasein des freien Willens nennt Hegel das Recht23. Das Recht ist nach Hegel somit einerseits das, was der freie Wille als logisch Erstes will (er will den freien Willen), und andererseits das, was der freie Wille eigentümlich ist (er ist der freie Wille). Damit hat der Wille Rechtscharakter, und das Recht Willenscharakter, weshalb das Recht als Recht dem Willen nicht äußerlich sein kann24.
Der skizzierte Weg von der freien Willkür zur Autonomie des fürsichseienden Willens hat das Sollen des Sollens zum Ausgangspunkt: dass etwas gesollt werden soll, ist eine unhintergehbare Prämisse aller Ethik. Die Ethik als philosophische Disziplin führt zur Einsicht dessen, was man soll, schweigt aber darüber, weshalb man überhaupt etwas soll. Man kann jemandem, der diese Frage stellt, vorwerfen, auf dem Standpunkt der Willkür zu stehen, und den fürsichseienden Willen, für den sich die Sollensfrage von selbst versteht, nicht begrifflich erfasst zu haben. Doch gerade nachdem man die Autonomie des Willens begrifflich erfasst hat, stellt sich die Frage, warum man überhaupt etwas soll, auf einer höheren Ebene wieder, denn der Wille des Subjekts ist immer über das theoretisch Erkannte hinaus: das Erkannte schließt als Objekt des Erkennens das Subjekt als Erkennendes von sich aus. Wenn es sich um Selbsterkenntnis handelt, Subjekt und Objekt somit identisch sind, unterscheidet sich das tätige Subjekt von seinem Sosein, und kann es wollen oder nicht wollen. Wenn ich mich entschließe, moralisch zu handeln, dann komme ich unvermeidlich auf den kategorischen Imperativ, und erkenne mir daraus entstehende Pflichten. Doch bevor ich mich entschließe, moralisch zu handeln, stellt sich mir die Frage nach einem absoluten, nicht relativierbaren Sinnzusammenhang, den ich nicht nur im Theoretischen als logisch wahr erkennen kann, sondern der mich auch praktisch einschließt, so dass ich nicht nur weiß, was ich (wollen) soll, sondern auch will, was ich soll.
3. Das einzelne Subjekt und der objektive Geist
Das einzelne, endliche Subjekt will einerseits sich selbst, aber andererseits über sich selbst hinaus. Die drei Fragen, die für Kant alles Interesse der Vernunft vereinigen25, stellen bei Kant zwar keine logische Entwicklung des Subjekts dar, sind aber in der richtigen Reihenfolge hierfür gestellt: 1) das Subjekt an sich ist ein Bewusstsein von allem außer seiner Selbst, ein passives, vom Objekt bestimmtes, erkennendes Subjekt, und sein Interesse, das theoretischer Art ist, lässt sich in der Frage "Was kann ich wissen?" zusammenfassen; 2) das Subjekt für sich ist Selbstbewusstsein, und dadurch Wille, - es wird tätig, und fragt sich: "Was soll ich tun?" - sein Interesse ist praktisch; 3) das Subjekt an und für sich will den Subjekt- Objekt-Gegensatz in sich selbst überwinden, denn theoretisches und praktisches Interesse stehen nicht nur in besonderen Fällen26 im Widerspruch zueinander: sie können in einem und demselben Willen nicht gleichwertig nebeneinander existieren. Das Primat der praktischen Vernunft, das für Kant im Zweifelsfall gilt, ist nur eine Verlegenheitslösung, die zu zwei Welten - der empirischen und der moralischen - führt. Weil das erkennende Subjekt der theoretischen Vernunft die äußere Mannigfaltigkeit nicht selbst produziert, sondern nur in ihren zufälligen Erscheinungsformen vorfindet, sind dem theoretischen Erkennen Grenzen gesetzt: prinzipiell kann man nicht alles wissen. Die praktische Vernunft hat es aber nicht mit äußeren Dingen zu tun, sondern allein mit sich selbst, und kann daher die Frage, was man tun soll, erschöpfend beantworten. Während es im Praktischen also sicheres Wissen über die Sache selbst geben kann, kann im Theoretischen nur die Methode a priori erkannt werden, nicht aber der Gegenstand selbst. Somit ist das Primat der praktischen Vernunft sinnvoll, aber nur die zweitbeste Lösung im Vergleich zu einer Vereinigung des Theoretischen und Praktischen in einem größeren Ganzen. Denkbar, dass dieses größere Ganze sein Ansichsein in der Kultur hat, sein Fürsichsein im Recht, und sein Anundfürsichsein in der Religion; die ansichseiende Selbsttranszendenz wäre somit die bloße Gemeinschaft mit anderen Menschen, die fürsichseiende Selbsttranszendenz wäre das sittliche Gemeinwesen, und die anundfürsichseiende Selbsttranszendenz das höchste Gut27. Selbsttranszendenz gelingt, wenn das zu transzendierende Subjekt, ohne vernichtet zu werden, im größeren Ganzen restlos aufgeht (ein solches Ganzes muss mehr als die Summe seiner Teile sein, denn eine bloße Vielheit ist noch keine höhere Qualität, und somit keine Transzendenz, - und eine unterschiedslose Einheit ist keine Transformation, sondern eine Vernichtung der einzelnen Elemente). Sie misslingt, wenn das Subjekt nicht oder nur teilweise transformiert wird, im Wesentlichen aber auf seine Einzelheit zurückgeworfen wird. Ob das einzelne menschliche Subjekt im objektiven Geist der Menschheit restlos aufgeht (ob es im Hegelschen Sinne aufgehoben - überwunden und auf einer höheren Ebene bewahrt - , und nicht auf seine Einzelheit zurückgeworfen wird), gilt es zu untersuchen, bevor zur Frage nach dem Sinn des Sollens überhaupt zurückgekehrt werden kann.
3.1. Die Menschheit als Gattung
Es lässt sich freilich eine noch materialistischere Weltanschauung denken, als jene, die die Religion für das Opium des Volkes hält: die gesamte menschliche Kultur kann als ein Epiphänomen der menschlichen Natur angesehen werden, und der Mensch kann gänzlich auf seine Tierheit reduziert werden. Das wäre ein Extremfall der äußerlichen Betrachtung, in dem der Mensch vollständig seinen Subjektcharakter verlöre. Ein Anthropologe, für den der Mensch ein bloßes Objekt ist, kann selbst nicht menschlich sein, denn als Mensch weiß man um die Nichtreduzierbarkeit des Ich auf das Es. Doch auch das andere Extrem ist nicht weniger falsch: die animistische Vorstellung, die Materie selbst sei bereits Subjekt, und die Evolution eine, wenn man so will, chthonische Gottheit. Wenngleich bereits das unbewusste Sein eine Subjektstruktur aufweist28, kann das menschliche Subjekt nicht durch ein diffuses Natursubjekt ersetzt werden, das durch die Natur auch im Menschen wirkt. Der absolute Materialismus (totale Leugnung der geistigen Realität der Ichheit) und der absolute Animismus (die Vorstellung, alles sei Ich) kommen auf dasselbe hinaus: die Entmündigung des menschlichen Subjekts.
Moralität, Recht und Sittlichkeit sind nur möglich, wenn dem menschlichen Subjekt eine geistige Realität zuerkannt wird; als ein Nicht-Subjekt kann sich der Mensch nicht auf eine bestimmte Art richtig oder falsch zu sich selbst, zu seiner Gattung und zur Natur verhalten.
Als Subjekt ist der Mensch nicht durch ein biologisches oder psychologisches Naturgesetz vollständig beschreibbar, sondern autonom und frei, und erst dadurch ensteht ihm seine Verantwortung in der Welt. Als Angelpunkt der Verantwortlichkeit wurde von Kant in der Grundlegung der Metaphysik der Sitten das moralische Gesetz selbst ausgemacht: der kategorische Imperativ ist nichts als die allgemeine Form aller als moralisch qualifizierten Maximen. Der Mensch ist vor seiner Vernunft, die er nicht leugnen kann, verantwortlich, - und nicht vor einem äußeren Gesetzgeber. Die Moralität ist eine innere Dimension des Menschen, kann aber genausowenig seine ganze Welt ausmachen, wie die äußere Mannigfaltigkeit. Das Gesetz, nach dem der Mensch in der Außenwelt handeln soll, ist ein apriorisches und innerliches, - sind Außen und Innen, Determinismus und Freiheit, auf wundersame Weise so beschaffen, dass sie zueinander passen, oder muss eine äußere Anwendung des moralischen Gesetzes an der Inkommensurabilität beider Sphären scheitern? Kant gibt ein Beispiel: “Einer, der durch eine Reihe vonübeln, die bis zur Hoffnungslosigkeit angewachsen ist, einenüberdruss am Leben empfindet, ist noch so weit im Besitze seiner Vernunft, dass er sich selbst fragen kann, ob es auch nicht etwa der Pflicht gegen sich selbst zuwider sei, sich das Leben zu nehmen”29. Kann die Maxime, sich umzubringen, wenn das Leben unerträglich geworden ist, zum allgemeinen Gesetz werden? Kant verneint dies: “Da sieht man aber bald, dass eine Natur, deren Gesetz es wäre, durch dieselbe Empfindung, deren Bestimmung es ist, zur Beförderung des Lebens anzutreiben, das Leben selbst zu zerstören, ihr selbst widersprechen und also nicht als Natur bestehen würde, mithin jene Maxime unmöglich als allgemeines Naturgesetz stattfinden könne und folglich dem obersten Prinzip aller Pflicht gänzlich widerstreite”30. Kant bringt mit Bedacht die Natur ins Spiel, denn er entwickelt den kategorischen Imperativ, mit Newton als Vorbild, als ein Gesetz, das mit der logischen Notwendigkeit eines Naturgesetztes gelten soll: "Weil die Allgemeinheit des Gesetzes, wonach Wirkungen geschehen, dasjenige ausmacht, was eigentlich Natur im allgemeinsten Verstande (der Form nach), d. i. das Dasein der Dinge, heißt, sofern es nach allgemeinen Gesetzen bestimmt ist, so könnte der allgemeine Imperativ der Pflicht auch so lauten: handle so, als ob die Maxime deiner Handlung durch deinen Willen zum ALLGEMEINEN NATURGESETZE werden sollte" 31 . Natürlich könnte eine Natur nicht bestehen, wenn sie die Selbstvernichtung als eine Form der Problemlösung zu ihrem Gesetz hätte. Doch hier denkt Kant nicht weit genug: der Tod des Individuums ist nicht der Tod der Gattung, und für die Natur kommt der Mensch nur als Gattungswesen in Betracht, weil der einzelne Mensch sterblich ist. Eine Natur, die es erlaubt, dass sich Unglückliche und Verzweifelte selbst umbringen, kann durchaus als Natur bestehen, - sie könnte dies jedoch nicht, wenn sie gleichzeitig jeden Einzelnen, und somit die ganze Menschheit zum Selbstmord treiben würde. Doch selbst das lässt sich nur mit der Voraussetzung behaupten, dass das Dasein einer Menschheit, einer Gattung von Vernunftwesen, für die Natur unabdingbar ist. Es ist eine paläontologische Tatsache, dass eine überwältigende Mehrheit aller Tierarten, die in der Erdgeschliche existiert haben, ausgestorben sind. 32 Wenn das Aussterben der menschlichen Gattung die Natur als solche in Frage stellen würde, dann muss die Menschheit eine ganz besondere Tierart sein. Kant zeigt, dass die Natur selbst keine Endzwecke hat, und deshalb eine Gattung vernünftiger Wesen als ihren Endzweck braucht: "Zur objektiven theoretischen Realität also des Begriffs von dem Endzwecke vernünftiger Weltwesen wird erfordert, daßnicht allein wir einen uns a priori vorgesetzten Endzweck haben, sondern daßauch die Schöpfung, d.i. die Welt selbst, ihrer Existenz nach einen Endzweck habe: welches, wenn es a priori bewiesen werden könnte, zur subjektiven Realität des Endzwecks die objektive hinzutun würde. Denn, hat die Schöpfungüberall einen Endzweck, so können wir ihn nicht anders denken, als so, daßer mit dem moralischen (der allein den Begriff von einem Zwecke möglich macht)übereinstimmen müsse. Nun finden wir aber in der Welt zwar Zwemargin-top:0in;margin-right:0in;margin-bottom:0in;margin-left:1.0pt;margin-bottom:.0001pt;line-height:11.5pt;text-autospace:none;"> einen Satz der teleologischen Urteilskraft, und nicht um ein a priori gültiges Urteil der theoretischen oder praktischen Vernunft. Der Endzweckbegriff verweist zudem auf etwas Höheres, als die menschliche Gattung, denn es liegt nicht in der Macht des Menschen, eine moralische Welt33 hervorzubringen.
3.2. Die Menschheit als moralisch-sittliche Gemeinschaft
Die Menschheit hat eine besondere Stellung in der Natur, aber nicht als eine biologische Gattung. Der Mensch ist das einzige Wesen in der Natur, das sich einen Endzweck setzen kann, jedoch handelt es sich bei der Menschheit nicht um eine Gattung, die von der Natur befähigt wurde, einen Endzweck zu setzen, - vielmehr transzendiert der Mensch, wenn er einen Endzweck setzt, Natur und Gattung. Wenn sich die Menschheit einen Endzweck setzt, dann geschieht dies immer im Bewusstsein einzelner Menschen, die die Begriffe der Moralität durch ihre Vernunft erfassen, und jeweils individuell ihren Willen nach der moralischen Pflicht orientieren. Im Tierreich handelt jedes Individuum nach seinem Instinkt, und die unsichtbare Hand der Gattung sorgt für das Gelingen im Ganzen. Die Menschheit ist mehr als eine bloße Gattung in der Natur, denn für das Gelingen der Menschheit braucht es nicht nur die kreatürliche Zugehörigkeit zum Menschengeschlecht, sondern auch die Intelligenz und den Willen der einzelnen Menschen. Eine Formulierung des kategorischen Imperativs, die wie folgt lautet: "Handle so, daßdu die Menschheit sowohl in deiner Person, als auch in der Person eines jeden andern jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloßals Mittel brauchest" 34, nennt Kant den praktischen Imperativ. Keine andere Willensmaxime wäre als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung unter Personen, moralischen Selbstzwecken, angemessen. "Handle so, dass deine Art erhalten wird", wäre als Maxime für Menschen nicht mehr angemessen, wenn auch die Erhaltung der Art auch für Menschen eine notwendige Bedingung für das Gelingen der Gattung ist: eine Menschheit, die nicht existiert, kann auch keinen Endzweck setzen. Doch während es beim Tier genau dem Zweck seiner Existenz entspricht, für den Fortbestand seiner Art zu sorgen, ist es moralisch verwerflich, einen Menschen in die Welt zu setzen, damit die Gattung weiter existiert: ein Mensch, der geboren wird, damit die Menschheit nicht ausstirbt, wird schon vor seiner Geburt als bloßes Mittel zum Zweck behandelt. So kann auch nicht mit Recht behauptet werden, es sei dem Menschen geboten, sich fortzupflanzen, - es ist jedoch eine moralische Pflicht, für den Fortbestand der Menschheit zu sorgen. Diese Menschheit, die sein soll, ist, wie hier nochmals klar wird, nicht die bloße Gattung, sondern etwas darüber hinaus. Kant spricht im praktischen Imperativ nicht die Menschheit als Gattung an, sondern als Menschheit in der Person eines jeden Menschen. Ein einzelner, von Geburt an außerhalb der menschlichen Gemeinschaft aufgewachsener Mensch kann keine Menschheit in seiner Person haben, und ist nicht einmal eine Person. Die Menschheit ist ein Allgemeines, das allein in Person von Einzelnen existieren kann, aber nur wenn diese Einzelnen in Gemeinschaft mit anderen Menschen leben.
Es gibt keine Menschheit ohne Persönlichkeit: eine Menschheit ist nur da, wenn es Menschen gibt, die die Menschheit in ihrer eigenen Person (sowie gegenseitig) erkennen, anerkennen und achten können. Die Persönlichkeit ist nichts anderes als Freiheit und Autonomie des Willens35. Die Freiheit des Willens ist nicht nur negativ bestimmt - als Freiheit von der Naturkausalität - , sondern auch positiv - als Freiheit zum Gebrauch der Vernunft. Die Vernunft führt notwendig zum Begriff der Pflicht, nach dem moralischen Gesetz (welches ein kategorischer Imperativ, ein unbedingtes Gebot ist) zu handeln. "Das moralische Gesetz ist heilig (unverletzlich)"36, konstatiert Kant. Er bemerkt: "Der Mensch ist zwar unheilig genug, aber die Menschheit in seiner Person muß ihm heilig sein"37. In aller Deutlichkeit wird hier die Menschheit als Gattung (der Mensch) von der Idee der Menschheit (Menschheit in der Person eines Menschen) unterschieden. Nun bedarf es keiner anderen Motivation, als der Pflicht selbst, um das moralische Gesetz zu erfüllen38, denn dies macht die moralische Selbstbestimmung des Menschen aus. Wäre die Menschheit eine geistige Gattung, nach dem Vorbild einer natürlichen, so müsste den Menschen die Erfüllung der moralischen Pflicht genauso glücklich machen, wie das Tier die Befriedigung seiner Triebe, doch das tut es mitnichten: "Dieser Trost ist nicht Glückseligkeit, auch nicht der mindeste Teil derselben"39. Das Bewusstsein, die Würde der Menschheit in der eigenen Person nicht verletzt zu haben, kann für den einzenen Menschen nichts weiter sein, als ein Trost. Der Mensch ist weder ein natürliches noch ein geistiges Tier, wenn mit dem Tier ein Wesen gemeint sein soll, das dadurch glücklich wird, dass es seine allgemeine Bestimmung erfüllt.
[...]
1 Vgl. Kant, Immanuel: Kritik der reinen Vernunft. B 833.
2 Vgl. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Phänomenologie des Geistes. Hamburg, 2006. S 9.
3 Kant, Immanuel: Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft. AA 6.
4 Vgl. die Herleitung des kategorischen Imperativs in der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten.
5 Kant, Immanuel: Die Metaphysik der Sitten. AA 382.
6 Vgl. a. a. O., AA 383.
8 Kant, Immanuel: Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft. AA 3.
9 Dieser epikureische Gedanke schließt kein menschliches Wesen aus: selbst der Mensch in seinem tierischsten Zustand wird noch damit erfasst. Kaum ist die Ethik über den Menschen als bloßes Naturwesen hinaus, beginnt sie, immer mehr Menschen vom Status des moralischen Subjekts auszuschließen, wenngleich sie allen Menschen den Status eines moralischen Objekts (eines Selbstzwecks) zuerkennen kann.
10 Vgl. a. a. O., AA 4.
11 Kant, Immanuel: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. AA 421.
12 Eine Ethik nach ausschließlich hypothetischen Imperativen gehörte nicht der praktischen, sondern der theoretischen Philosophie an, denn ihre Imperative hätten keinen Gebotscharakter, sondern den Charakter eines naturwissenschaftlichen Experiments: tu A, wenn du willst, dass B passiert.
13 A. a. O., AA 429.
14 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Phänomenologie des Geistes. Hamburg, 2006. S 120ff.
15 Kant, Immanuel: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. AA 448.
16 Kant, Immanuel: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. AA 448.
17 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Grundlinien der Philosophie des Rechts. In: Werke in 20 Bänden. Band 7. Frankfurt a. M., 1970. S. 46.
18 A. a. O., S. 62.
19 A. a. O., S. 62.
20 Vgl. a. a. O., S. 63.
21 Eine Theorie der Willensfreiheit, die den freien Willen nichts weiter als die bloße Willkür sein lässt, ist genötigt, sich mit empirischen Widerlegungen der Willensfreiheit, wie etwa dem Libet-Experiment, auseinanderzusetzen. Dieses Experiment zeigt, dass die Materie, repräsentiert durch ein elektrisch messbares Bereitschaftspotential im Nervensystem, schneller bei einem konkreten Entschluss ist, als der Geist, der in Person eines menschlichen Probanden diesen Entschluss fasst. Wenn nicht das physiologisch bedingte Bereitschaftspotential die Ursache des Entschlusses sein soll, muss die Willensfreiheit so abstrakt gefasst werden, dass sie nichts weiter besagt, als dass der Mensch letztlich eine Wahlfreiheit hat, da ein bestimmter Entschluss, selbst wenn es das Drücken eines Knopfes ist, zustande kommt. Damit ist die Freiheit aber immer noch nicht bewiesen, denn auch ein Würfel fällt auf eine bestimmte Seite, und hat dennoch keine Entscheidungsfreiheit. Für den äußeren Schein kann also die bloße Willkür nicht vom Zufall unterschieden werden, und eine auf der bloßen Willkür basierende Theorie der Willensfreiheit, die das Fürsichsein des Willens nicht aufzeigt, und somit auf das Empirische beschränkt ist, ist nicht haltbar.
22 Vgl. a. a. O., S. 79.
23 Vgl. a. a. O., S. 80.
24 Einzelne Bestimmungen des positiven Rechts können dem freien Willen widersprechen, aber nicht das Recht als solches, weshalb Anomie ein dem freien Willen unangemessener, amoralischer Zustand ist.
25 Vgl. Kant, Immanuel: Kritik der reinen Vernunft. B 833.
26 In der Wissenschaft - damit befasst sich die Wissenschaftsethik - geht es darum, dem Erkenntnisdrang moralische Grenzen zu setzen, sofern die Erkenntnismethoden mit der Moral in einen Konflikt geraten; in der Ethik besteht das Problem, dass wissenschaftliche Erkenntnisse die Moral untergraben können.
27 "Ich nenne die Idee einer solchen Intelligenz, in welcher der moralisch vollkommenste Wille, mit der höchsten Seligkeit verbunden, die Ursache aller Glückseligkeit in der Welt ist, so fern sie mit der Sittlichkeit (als der Würdigkeit glücklich zu sein) in genauem Verhältnisse steht, das Ideal des höchsten Guts" (a. a. O., B 838).
28 Ein prominentes jüngeres Beispiel einer lebenswissenschaftlichen Theorie der Subjektivität (Erstveröffentlichung 1973 unter dem Titel "Organismus und Freiheit"): Jonas, Hans: Das Prinzip Leben. Frankfurt am Main, 1994/2011.
29 Kant, Immanuel: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. AA 421.
30 A. a. O., AA 421f.
31 A. a. O., AA 421.
32 Kant, Immanuel: Kritik der Urteilskraft. AA 453f.
33 Kant, Immanuel: Kritik der reinen Vernunft. B 836: "Ich nenne die Welt, so fern sie allen Gesetzen gemäß wäre, (wie sie es denn, nach der Freiheit der vernünftigen Wesen, sein kann, und, nach den notwendigen Gesetzen der Sittlichkeit, sein soll,) eine moralische Welt".
34 Kant, Immanuel: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. AA 429.
35 Vgl. Kant, Immanuel: Kritik der praktischen Vernunft. AA 87.
36 A. a. O., AA 87.
37 A. a. O., AA 87.
38 Vgl. A. a. O., AA 88.
39 A. a. O., AA 88.
- Arbeit zitieren
- B. A. Konstantin Karatajew (Autor:in), 2013, Bedingungen der Möglichkeit eines moralischen Imperativs, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/278500
Kostenlos Autor werden




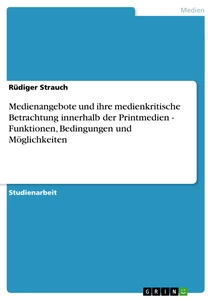

















Kommentare